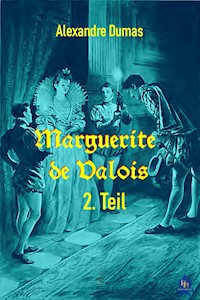
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BROKATBOOK
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
König Karl bewahrt Henry vor der Verhaftung, indem er mit ihm den Louvre verlässt und sie übernachten bei seiner Geliebten Marie und seinen Kind. De Mouy, der sich in Henrys Zimmer aufhält, tötet die Wachen und verletzt Catherines gedungenen Mörder schwer. Der junge Orthon wird von Catharine ermordet, um in den Besitz der Nachricht des von De Mouy an König Henry zukommen. Catharine plant mit einem vergifteten Buch einen weiteren Mordanschlag auf Henry von Navara, aber an seiner Stelle stirbt Karl X. am 30. Mai 1574. Graf Annibal de Coconnas und Hyacinthe La Mole wurden durch eine Intrige der Königinmutter zum Tode verurteilt und durch Caboche, den Henker von Paris, geköpft. Zwei Jahre später gelang Heinrich von Navarra die Flucht aus den Appartements des Louvre, worauf er den katholischen Glauben wieder ablegte. 1578 sahen sich Heinrich und Margarete nach 32 Monaten Trennung in der Guyenne wieder, wo Heinrich seit 1576 Gouverneur war. Sie kam auf Wunsch ihrer Mutter dorthin, in der Hoffnung, Heinrich zurück an den Pariser Hof zu holen. Nach einem Aufenthalt von fast vier Jahren kehrte Margarete 1582 zurück in den Louvre. Im Dezember 1599 wurde die Ehe mit Margarete durch Papst Clemens VIII. (sie blieb allerdings Königin) annulliert. Grund für diese Trennung war, dass die Ehe keine Kinder hervorbrachte und beide, sowohl Heinrich als auch Margarete, sich Mätressen bzw. Liebhaber hielten. Nach langwierigen Kämpfen mit den französischen Katholiken und den habsburgischen Spaniern konvertierte Heinrich von Navarra am 25. Juli 1593 erneut zum Katholizismus, indem er in der Basilika Saint-Denis die Kommunion empfing. ("Paris ist eine Messe wert") 1594 wurde er als Heinrich IV. König von Frankreich und am 14. Mai 1610 in Paris ermordet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Alexandre Dumas
Marguerite de Valois
Impressum
Texte: © Copyright by Alexandre Dumas
Umschlag: © Copyright by Gunter Pirntke
Übersetzung: © Copyright by Walter Brendel
Verlag:
Das historische Buch, Dresden / Brokatbookverlag
Gunter Pirntke
Mühlsdorfer Weg 25
01257 Dresden
Inhalt
KAPITEL XXXV. EINE NACHT DER KÖNIGE.
KAPITEL XL. DIE ATRIDEN.
KAPITEL XLIV. ORESTES UND PYLADES.
KAPITEL XLV. ORTHON.
KAPITEL L. HAWKING.
KAPITEL LIV. DER WALD VON VINCENNES.
KAPITEL LV. DIE ABBILDUNG AUS WACHS.
KAPITEL LX. DER ORT SAINT JEAN EN GRÈVE.
KAPITEL LXV. DER KÖNIG IST TOT! LANG LEBE DER KÖNIG!
KAPITEL LXVI. EPILOG.
KAPITEL XXXII. BRÜDERLICHKEIT.
Indem er das Leben von Charles rettete, hatte Henry mehr getan, als nur das Leben eines Mannes zu retten – er hatte drei Königreiche daran gehindert, die Herrscher zu wechseln.
Wenn Karl IX. getötet worden wäre, wäre der Duc d'Anjou König von Frankreich geworden, und der Duc d'Alençon wäre aller Wahrscheinlichkeit nach König von Polen geworden. Was Navarra betrifft, da Monsieur le Duc d'Anjou der Liebhaber von Madame de Condé war, hätte seine Krone dem Ehemann wahrscheinlich die Selbstgefälligkeit seiner Frau bezahlt. Nun wäre Henry bei all dem nichts Gutes ergangen. Er hätte den Meister gewechselt, das wäre alles gewesen. Statt Karl IX. Wer ihn geduldet hätte, der hätte den Duc d'Anjou auf dem Thron Frankreichs gesehen, und da er mit seiner Mutter Katharina eins war, hatte diese ihm geschworen, zu sterben, und er hätte seinen Eid nicht versäumt . All diese Gedanken kamen ihm in den Sinn, als das Wildschwein auf Karl IX. zukam.
Karl IX. war durch einen Akt der Hingabe gerettet worden, dessen Motiv der König nicht ergründen konnte. Aber Marguerite hatte verstanden, und sie hatte diesen seltsamen Mut von Henry bewundert, der wie Blitze nur im Sturm leuchtete.
Leider war es nicht alles, dem Königreich des Duc d'Anjou entkommen zu sein. Henry musste sich selbst zum König machen. Er musste Navarra mit dem Duc d'Alençon und mit dem Prinzen von Condé bestreiten; vor allem musste er den Hof verlassen, wo man nur zwischen zwei Abgründen wandelte, und von einem Sohn Frankreichs beschützt fortgehen.
Als er von Bondy zurückkehrte, dachte Henry tief über die Situation nach. Als er im Louvre ankam, stand sein Plan fest. Ohne seine Reitstiefel auszuziehen, begab er sich, so wie er war, mit Staub und Blut bedeckt, in die Gemächer des Herzogs von Alençon, den er in großer Aufregung auf und ab schreiten sah.
Als der Prinz ihn bemerkte, fuhr er überrascht zusammen.
"Ja," sagte Henry, ihn durch beide Hände nehmend; „Ja, ich verstehe, mein guter Bruder, du bist wütend, weil ich als erster den König darauf aufmerksam gemacht habe, dass deine Kugel das Bein seines Pferdes getroffen hat und nicht den Eber, wie du es beabsichtigt hast. Aber was kannst duerwarten? Ich konnte einen Aufschrei der Überraschung nicht verhindern. Außerdem hätte es der König bemerkt, nicht wahr?“
"Kein Zweifel, kein Zweifel", murmelte D'Alençon. „Und doch kann ich es nur als eine böse Absicht Ihrerseits betrachten, mich so zu denunzieren, wie Sie es getan haben, und die, wie Sie selbst gesehen haben, zu keinem Ergebnis geführt hat, außer dass mein Bruder Charles mich verdächtigt und zwischen uns harte Gefühle verursacht hat."
„Wir werden in wenigen Augenblicken darauf zurückkommen. Was meine guten oder bösen Absichten in Bezug auf Sie betrifft, bin ich absichtlich zu Ihnen gekommen, damit Sie sie beurteilen können.“
"Sehr gut!" sagte D'Alençon mit seiner üblichen Zurückhaltung. "Sprich, Henry, ich höre zu."
„Wenn ich gesprochen habe, François, werden Sie sofort sehen, was ich vorhabe, denn das Vertrauen, das ich in Sie setzen werde, hebt alle Zurückhaltung und Klugheit auf. Und wenn ich es Ihnen gesagt habe, können Sie mich ruinieren ein einziges Wort!"
"Was ist es?" sagte François, beginnend besorgt zu sein.
„Und doch,“ fuhr Henry fort, „habe ich lange gezögert, mit Ihnen über das zu sprechen, was mich hierher führt, besonders nach der Art und Weise, wie Sie sich heute taub gestellt haben.“
"Wirklich", sagte François und wurde blass, "ich weiß nicht, was du meinst, Henry."
"Bruder, deine Interessen liegen mir zu am Herzen, um dir nicht zu sagen, dass die Hugenotten mir Avancen gemacht haben."
"Interessen!" sagte D’Alençon. "Welche Interessen?"
„Einer von ihnen, Monsieur de Mouy von Saint Phal, der Sohn des tapferen De Mouy, wurde von Maurevel ermordet, wissen Sie“
"Ja."
"Nun, er kam unter Einsatz seines Lebens, um mir zu zeigen, dass ich in Gefangenschaft war."
"Ah! in der Tat! Und was hast du zu ihm gesagt?"
„Bruder, du weißt, dass ich Charles sehr liebe. Er hat mein Leben gerettet und die Königinmutter war wie eine richtige Mutter für mich. Also habe ich alle Angebote abgelehnt, die er mir gemacht hat.“
"Was waren das für Angebote?"
"Die Hugenotten wollen den Thron von Navarra rekonstruieren, und da dieser Thron in Wirklichkeit mir durch Erbschaft gehört, haben sie ihn mir angeboten."
"Ja; und Monsieur de Mouy hat statt der Zustimmung, um die er zu bitten erwartete, Ihren Verzicht erhalten?"
"Mein formeller Verzicht - sogar schriftlich. Aber seitdem", fuhr Henry fort.
"Du hast Buße getan, Bruder?" unterbrach D'Alençon.
"Nein, ich dachte nur, ich hätte bemerkt, dass Monsieur de Mouy unzufrieden mit mir geworden war und woanders seine Besuche abstattete."
"Wo?" fragte François schnell.
"Ich weiß es nicht. Vielleicht beim Prinzen von Condé."
„Ja, das könnte sein“, sagte der Herzog.
"Außerdem", fuhr Henry fort, "habe ich positives Wissen betreffs des Anführers, den er gewählt hat."
François wurde blass.
„Aber“, fuhr Henry fort, „die Hugenotten sind untereinander gespalten, und de Mouy, so mutig und treu er auch ist, stellt nur die eine Hälfte der Partei dar. Nun, diese andere Hälfte, die nicht zu verachten ist, hat nicht nachgegeben die Hoffnung wecken, Heinrich von Navarra auf dem Thron zu haben, der nach anfänglichem Zögern vielleicht nachgedacht hat."
"Du denkst das?"
„Oh, jeden Tag erhalte ich Beweise davon. Die Truppen, die sich uns bei der Jagd angeschlossen haben, ist Ihnen aufgefallen, aus welchen Männern sie bestand?“
"Ja, von bekehrten Herren."
"Hast du den Anführer der Truppe erkannt?"
"Ja, es war der Vicomte de Turenne."
"Wusstest Du, was sie von mir wollten?"
"Ja, sie haben dir vorgeschlagen zu fliehen."
"Dann", sagte Henry zu François, der unruhig wurde, "gibt es offensichtlich eine zweite Partei, die etwas anderes will als das, was Monsieur de Mouy will."
"Eine zweite Partei?"
„Ja, und ein sehr mächtiges, sage ich Ihnen, so dass es, um erfolgreich zu sein, notwendig ist, die beiden zu vereinen – Turenne und De Mouy. Die Verschwörung schreitet voran, die Truppen sind bereit, es wird nur auf das Signal gewartet. Jetzt rein dieser erhabenen Situation, die meinerseits eine schnelle Lösung verlangt, bin ich zu zwei Entscheidungen gekommen, zwischen denen ich schwanke. Ich bin gekommen, um diese Entscheidungen Dir wie einem Freund vorzulegen.“
"Sag eher wie zu einem Bruder."
"Ja, betreffs eines Bruders," fuhr Henry fort.
"Sprich dann, ich höre zu."
„Zunächst sollte ich Ihnen meinen Geisteszustand erklären, mein lieber François. Keine Lust, kein Ehrgeiz, keine Fähigkeit. Ich bin ein ehrlicher Landherr, arm, sinnlich und schüchtern. Die Karriere eines Verschwörers bietet sich mir an Demütigungen, die selbst durch die sichere Aussicht auf eine Krone kaum kompensiert werden."
„Ah, Bruder,“ sagte François, „du hast Unrecht. Traurig ist in der Tat die Stellung eines Prinzen, dessen Vermögen durch die Grenze des väterlichen Besitzes oder durch einen Mann in einer Ehrenkarriere begrenzt ist! Ich glaube daher nicht, in dem, was du mir sagst."
„Und doch ist das, was ich dir sage, so wahr, Bruder, dass ich, wenn ich glaubte, einen wahren Freund zu haben, zu seinen Gunsten auf die Macht verzichten würde, die diese Partei mir geben will; aber“, fügte er seufzend hinzu, „ich habe keine."
„Vielleicht hast du. Wahrscheinlich irrst du dich.“
"Nein, ventre saint gris !" sagte Henry, „außer dir, Bruder, sehe ich niemanden, der mit mir verbunden ist; so dass ich, anstatt einen Versuch scheitern zu lassen, der einen unwürdigen Mann ans Licht bringen könnte, lieber meinen Bruder, den König, über das, was vor sich geht, informieren möchte . Ich werde keine Namen nennen, ich werde weder Land noch Datum nennen, aber ich werde die Katastrophe vorhersagen.“
"Großer Gott!" rief D'Alençon unfähig, seinen Schrecken zu unterdrücken, "was meinst du damit? Was! Du, die einzige Hoffnung der Partei seit dem Tod des Admirals; du, ein bekehrter Hugenotte, ein armer Bekehrter, oder zumindest so einer." dachte man, du würdest das Messer gegen deine Brüder erheben! Henry, Henry, weißt du, wenn du das tust, dass du alle Calvinisten im Königreich einem zweiten Heiligen Bartholomäus ausliefern würdest? Weißt du, dass Katharina wartet nur eine solche Chance, alle zu vernichten, die überlebt haben?"
Und der Herzog zitterte, sein Gesicht war mit roten und weißen Flecken übersät, und drückte Henrys Hand, um ihn zu bitten, diesen Gedanken aufzugeben, der ihn ruinieren würde.
"Was!" sagte Henry mit einem Ausdruck perfekter guter Laune, "glaubst du, es würde so viel Ärger geben, François? Mit dem Wort des Königs scheint es mir jedoch, dass ich es vermeiden sollte."
„Das Wort von König Karl IX., Heinrich! Hatte es nicht auch der Admiral? Hatte es nicht Téligny? Hattest du es nicht selbst? Oh, Heinrich, ich sage dir, wenn du das tust, wirst du uns alle ruinieren. Nicht nur sie, sondern alle, die direkte oder indirekte Beziehungen zu ihnen hatten."
Henry schien einen Augenblick nachzudenken.
„Wenn ich ein bedeutender Hoffürst wäre“, sagte er, „würde ich anders handeln. An deiner Stelle zum Beispiel, an deiner Stelle François, ein Sohn Frankreichs und wahrscheinlicher Thronfolger“
François schüttelte ironisch den Kopf.
"An meiner Stelle", sagte er, "was würdest du tun?"
„An deiner Stelle, Bruder,“ erwiderte Henry, „sollte ich mich an die Spitze der Bewegung stellen und sie leiten. Mein Name und meine Ehre sollten meinem Gewissen für das Leben der Rebellen genügen, und ich sollte zuerst etwas davon haben für mich, dann vielleicht für den König von einem Unternehmen, das sonst Frankreich den größten Schaden zufügen könnte.
D'Alençon lauschte diesen Worten mit einer Freude, die jeden Muskel seines Gesichts dehnen ließ.
"Glaubst Du", sagte er, "dass diese Methode praktikabel ist und uns alle Katastrophen ersparen würde, die Sie voraussehen?"
"Ich denke schon", sagte Henry. „Die Hugenotten lieben dich. Deine Haltung ist bescheiden, deine Stellung hoch und interessant, und die Freundlichkeit, die du den Gläubigen gegenüber immer gezeigt hast, wird sie dazu bringen, dir zu dienen.“
"Aber", sagte D'Alençon, "es gibt eine Spaltung in der Partei. Werden diejenigen, die Dich wollen, auch mich wollen?"
"Ich werde mich verpflichten, sie auf zwei Wegen zusammenzubringen."
"Was bedeutet?"
"Erstens durch das Vertrauen, das die Führer in mich haben; dann durch die Angst, dass Ihre Hoheit, die ihre Namen kennt"
"Aber wer wird mir diese Namen sagen?"
"Ich, ventre saint gris!"
"Wirst du das tun?"
"Höre, François; wie ich Ihnen sagte, Du bist der Einzige, den ich am Hofe liebe," sagte Henry. "Das liegt zweifellos daran, dass Du wie ich verfolgt werde; und außerdem liebt Dich auch meine Frau mit einer Zuneigung, die ihresgleichen sucht"
François errötete vor Vergnügen.
"Glaube mir, Bruder," setzte Henry fort; "nimm dieses Ding in die Hand, regiere in Navarra; und vorausgesetzt, du hältst mir einen Platz an deinem Tisch und einen schönen Wald zum Jagen frei, dann werde ich mich glücklich schätzen."
"Herrscher in Navarra!" sagte der Herzog; "doch wenn…"
"Wenn der Duc d'Anjou zum König von Polen gewählt wird, ist es das? Ich werde Deinen Gedanken für Dich beenden."
François sah Henry mit etwas wie Entsetzen an.
„Nun, hör zu, François,“ fuhr Henry fort, „da dir nichts entgeht. Ich argumentiere folgendermaßen: Wenn der Duc d’Anjou zum König von Polen gewählt wird und unser Bruder Karl, Gott beschütze ihn, zufällig sterben sollte Von Pau bis Paris sind es nur zweihundert Meilen, von Paris bis Cracovie hingegen vierhundert Meilen. Sie würden also hier sein, um das Erbe zu empfangen, bis der König von Polen erfährt, dass es frei ist. Dann, wenn Sie mit mir zufrieden sind, du könntest mir das Königreich Navarra geben, das fortan nur noch einer deiner Kronjuwelen wäre, so würde ich es annehmen, das Schlimmste, was dir passieren könnte, wäre, dass du dort König bleibst und ein Geschlecht erziehst der Könige, indem du bei mir und meiner Familie lebst, während du hier bist, ein armer verfolgter Prinz, ein armer dritter Sohn eines Königs, der Sklave zweier älterer Brüder,und einer, den eine Laune in die Bastille schicken kann.
"Ja, ja", sagte François; „Das weiß ich sehr gut, so gut, dass ich nicht verstehe, warum du diesen Plan, den du mir vorschlägst, aufgeben solltest.
Und der Duc d'Alençon legte seine Hand auf das Herz seines Bruders.
"Es gibt", sagte Henry lächelnd, "Lasten, die für einige Hände zu schwer sind; deshalb werde ich nicht versuchen, diese zu heben; die Angst vor Ermüdung ist größer als der Wunsch nach Besitz."
"Also, Henry, verzichtest du wirklich darauf?"
"Das habe ich De Mouy gesagt und ich wiederhole es Dir."
"Aber in solchen Fällen, mein lieber Bruder", sagte D'Alençon, "sagt man nicht, man beweist."
Henry atmete wie ein Faustkämpfer, der spürt, wie sich der Rücken seines Gegners krümmt.
"Ich werde es heute Abend beweisen," sagte er. „Um neun Uhr werden wir die Namen der Führer und den Plan des Unternehmens haben. Ich habe De Mouy bereits meine Verzichtserklärung übermittelt.“
François nahm Henrys Hand und drückte sie überschwänglich zwischen seine.
In diesem Augenblick betrat Catharine unangekündigt die Gemächer des Duc d'Alençon, wie es ihre Gewohnheit war.
"Zusammen!" sagte sie lächelnd; "zwei gute Brüder, wirklich!"
"Ich vertraue darauf, Madame," sagte Henry mit großer Kühle, während der Duc d'Alençon vor Kummer weiß wurde.
Henry trat zurück, um Catharine Zeit zu lassen, mit ihrem Sohn zu sprechen.
Die Königinmutter zog ein prächtiges Juwel aus ihrer Tasche.
„Dieser Verschluss kommt aus Florenz,“ sagte sie. "Ich werde es dir für den Gürtel deines Schwertes geben."
Dann leise:
"Wenn Sie heute Nacht Geräusche im Zimmer Ihres guten Bruders Henry hören, rühren Sie sich nicht."
François drückte die Hand seiner Mutter und sagte:
"Erlauben Sie mir, Henry das schöne Geschenk zu zeigen, das Sie mir gerade gegeben haben?"
"Du kannst mehr tun. Gib es ihm in deinem Namen und in meinem, denn ich habe ein zweites genauso bestellt."
"Höre, Henry", sagte François, "meine gute Mutter bringt mir dieses Juwel und verdoppelt seinen Wert, indem sie mir erlaubt, es Ihnen zu geben."
Henry geriet in Ekstase über die Schönheit des Verschlusses und war begeistert von seinem Dank. Als sein Entzücken ruhiger geworden war hörte er:
„Mein Sohn,“ sagte Catharine, „ich fühle mich etwas unwohl und gehe zu Bett; dein Bruder Charles ist sehr müde von seinem Sturz und wird das Gleiche tun. Also werden wir heute Abend nicht zusammen zu Abend essen, aber jeder wird es tun in seinem eigenen Zimmer serviert werden. Oh, Henry, ich habe vergessen, dir zu deiner Tapferkeit und Schnelligkeit zu gratulieren. Du hast deinen König und deinen Bruder gerettet, und du sollst dafür belohnt werden.“
"Ich bin bereits belohnt, Madame," antwortete Henry, sich verbeugend.
"Durch das Gefühl, dass Sie Ihre Pflicht getan haben?" erwiderte Katharina. "Das ist nicht genug, und Charles und ich werden etwas tun, um die Schulden zu bezahlen, die wir dir schulden."
"Alles, was von Ihnen und meinem guten Bruder zu mir kommt, ist willkommen, Madam."
Dann verneigte er sich und zog sich zurück.
"Ah! Bruder François!" dachte Henry, als er ging, „ich bin sicher, dass ich nicht allein gehen werde, und die Verschwörung, die einen Körper hatte, hat einen Kopf und ein Herz gefunden. Lasst uns nur auf uns selbst aufpassen. Catharine gibt mir ein Geschenk, Catharine verspricht mir eine Belohnung. Dahinter steckt ein wenig Teufelei. Ich muss mich heute Abend mit Marguerite beraten.“
KAPITEL XXXIII. DIE DANKBARKEIT VON KÖNIG KARL IX.
Maurevel hatte einen Teil des Tages in der Waffenkammer des Königs verbracht; aber als es für die Jäger an der Zeit war, von der Jagd zurückzukehren, schickte Catharine ihn mit den Wachen, die sich ihm angeschlossen hatten, in ihr Oratorium.
Karl IX., der bei seiner Ankunft von seiner Amme darüber informiert wurde, dass ein Mann einen Teil des Tages in seinem Zimmer verbracht habe, war zunächst sehr verärgert darüber, dass ein Fremder in seine Gemächer eingelassen worden war. Aber seine Amme beschrieb den Mann und sagte, er sei derselbe, den man ihr eines Abends befohlen hatte, aufzunehmen, und der König erkannte, dass es Maurevel war. Als er sich an den Befehl erinnerte, den seine Mutter ihm an diesem Morgen abgerungen hatte, verstand er alles.
"Oh ho!" murmelte Charles, "derselbe Tag, an dem er mir das Leben gerettet hat. Die Zeit ist schlecht gewählt."
Er wollte zu seiner Mutter gehen, aber ein Gedanke hielt ihn davon ab.
„Beim Himmel! Wenn ich ihr das erzähle, wird das zu einer endlosen Diskussion führen. Besser für uns, selbst zu handeln.
„Schwester“, sagte er, „schließt alle Türen ab und sagt zu Königin Elizabeth1 dass ich etwas unter dem Sturz leide, den ich hatte, und dass ich heute Nacht allein schlafen werde.
Die Amme gehorchte, und da es noch nicht an der Zeit war, seinen Plan auszuführen, setzte sich Charles hin, um Gedichte zu verfassen. Diese Beschäftigung ließ die Zeit für den König am schnellsten vergehen. Es schlug neun Uhr, bevor er dachte, dass es über sieben war. Er zählte die Schläge der Uhr einen nach dem anderen und stand schließlich auf.
"Der Teufel!" sagte er, "es ist gerade Zeit." Er nahm Hut und Umhang und verließ sein Zimmer durch eine Geheimtür, die er in die Wand hatte einbauen lassen, von deren Existenz selbst Catharine nichts wusste.
Charles ging direkt zu Henrys Wohnungen. Beim Verlassen des Duc d'Alençon war dieser in sein Zimmer gegangen, um sich umzuziehen, und war sofort wieder gegangen.
"Wahrscheinlich hat er beschlossen, mit Margot zu Abend zu essen", sagte der König. "Er war heute sehr angenehm mit ihr, zumindest schien es mir so."
Er ging zu den Gemächern der Königin. Marguerite hatte die Duchesse de Nevers, Coconnas und La Mole mitgebracht und aß mit ihnen Eingemachtes und Gebäck zu Abend.
Charles klopfte an die Flurtür, die von Gilonne geöffnet wurde. Aber beim Anblick des Königs war sie so erschrocken, dass sie kaum genug Geistesgegenwart hatte, um höflich zu sein, und anstatt zu laufen, um ihrer Herrin den erhabenen Besuch mitzuteilen, der ihr bevorstand, ließ sie Charles ohne andere Warnung als den Schrei, der gekommen war, eintreten entkam ihr. Der König durchquerte das Vorzimmer und ging, von schallendem Gelächter geleitet, auf das Speisezimmer zu.
"Armer Henriot!" sagte er, "er vergnügt sich ohne einen Gedanken an Böses."
„Ich bin es“, sagte er, hob die Portière und zeigte ein lächelndes Gesicht.
Marguerite stieß einen schrecklichen Schrei aus. So lächelnd er auch war, erschien ihr sein Gesicht wie das Gesicht der Medusa. Als sie der Tür gegenüber saß, hatte sie ihn sofort erkannt. Die beiden Männer wandten dem König den Rücken zu.
"Eure Majestät!" rief die Königin und erhob sich erschrocken.
Die drei anderen Gäste spürten, wie ihre Köpfe zu schwimmen begannen; Coconnas allein behielt seine Selbstbeherrschung. Er erhob sich auch, aber mit so taktvoller Ungeschicklichkeit, dass er dabei den Tisch und damit das Glas, den Teller und die Kerzen umwarf. Sofort herrschte völlige Dunkelheit und die Stille des Todes.
"Lauf", sagte Coconnas zu La Mole; "schnell schnell!"
La Mole ließ sich das nicht zweimal sagen. Er sprang an die Seite der Wand und fing an, mit den Händen nach dem Schlafzimmer zu tasten, um sich in dem Schrank zu verstecken, der sich daraus öffnete und den er so gut kannte. Aber als er über die Schwelle trat, stieß er mit einem Mann zusammen, der gerade durch den Geheimkorridor eingetreten war.
"Was hat das alles zu bedeuten?" fragte Charles in der Dunkelheit in einem Ton, der anfing, einen furchtbaren Akzent der Ungeduld zu verraten. „Bin ich so eine Freude, dass mein Anblick all diese Verwirrung verursacht? Komm, Henriot! Henriot! Wo bist du? Antworte mir.“
"Wir sind gerettet!" murmelte Marguerite und ergriff eine Hand, die sie für die von La Mole hielt. "Der König denkt, mein Mann ist einer unserer Gäste."
„Und ich werde ihn so denken lassen, Madame, Sie können sicher sein,“ sagte Henry und antwortete der Königin im selben Ton.
"Großer Gott!" rief Margarete und ließ hastig die Hand los, die sie hielt, die die des Königs von Navarra war.
"Schweig!" sagte Heinrich.
"Im Namen von tausend Teufeln! Warum flüsterst du so?" rief Karl. "Henry, antworte mir; wo bist du?"
"Hier, Herr", sagte der König von Navarra.
"Der Teufel!" sagte Coconnas, der die Duchesse de Nevers in einer Ecke hielt, "die Handlung verdichtet sich."
"In diesem Fall sind wir doppelt verloren", sagte Henriette.
Coconnas, mutig bis zur Unbesonnenheit, hatte überlegt, dass die Kerzen früher oder später angezündet werden müssten, und dachte, je früher, desto besser, ließ er die Hand von Madame de Nevers los und hob eine Kerze aus der Mitte des Schutts auf, und als er zu einem Kohlenbecken ging, blies er ein Stück Kohle an, mit der er sofort ein Feuer machte. Die Kammer wurde wieder beleuchtet. Karl IX. sah sich fragend um.
Henry war an der Seite seiner Frau, die Duchesse de Nevers war allein in einer Ecke, während Coconnas mit einem Kerzenhalter in der Hand in der Mitte des Raumes stand und die ganze Szene erhellte.
"Entschuldigen Sie, Bruder", sagte Marguerite, "wir haben Sie nicht erwartet."
"Also, wie Sie vielleicht bemerkt haben, erfüllte uns Ihre Majestät mit seltsamem Schrecken", sagte Henriette.
"Ich für meinen Teil", sagte Henry, der alles vermutet hatte, "ich glaube, die Angst war so real, dass ich beim Aufstehen den Tisch umwarf."
Coconnas warf dem König von Navarra einen Blick zu, um zu sagen:
"Gut! Hier ist ein Mann, der sofort versteht."
"Was für ein schrecklicher Tumult!" wiederholte Karl IX. "Dein Abendessen ist ruiniert, Henriot; komm mit mir und du sollst es woanders zu Ende bringen; ich werde dich heute Abend entführen."
"Was, Herr!" sagte Henry, "Eure Majestät wird mir die Ehre erweisen?"
„Ja, seine Majestät wird Dir die Ehre erweisen, Dich aus dem Louvre fortzuführen. Leihen ihn mir, Margot, ich bringe ihn Ihnen morgen früh zurück.“
"Ah, Bruder", sagte Marguerite, "dafür brauchst du meine Erlaubnis nicht; du bist Herr."
"Sire", sagte Henry, "ich werde einen anderen Umhang aus meinem Zimmer holen und sofort zurückkehren."
"Du brauchst ihn nicht, Henriot; der Umhang, den du hast, ist in Ordnung."
„Aber Sire“, begann der Béarnais.
„Im Namen von tausend Teufeln sage ich dir, dass du nicht in deine Zimmer gehen sollst! Hörst du nicht, was ich sage?
"Ja, ja, geh!" sagte Marguerite und drückte plötzlich den Arm ihres Mannes; denn ein einzigartiger Blick von Charles hatte sie davon überzeugt, dass etwas Ungewöhnliches vor sich ging.
"Hier bin ich, Sire," sagte Henry.
Charles sah Coconnas an, der immer noch sein Amt als Fackelträger ausübte, indem er die anderen Kerzen anzündete.
"Wer ist dieser Herr?" fragte der König von Heinrich und musterte die Piemontesen von Kopf bis Fuß. "Ist er Monsieur de la Mole?"
"Wer hat ihm von La Mole erzählt?" fragte Marguerite leise.
„Nein, Sire,“ erwiderte Henry, „Monsieur de la Mole ist leider nicht hier. Sonst hätte ich die Ehre, ihn Eurer Majestät gleichzeitig mit Monsieur de Coconnas, seinem Freund, vorzustellen. Sie sind vollkommen unzertrennlich, und beide sind in der Suite von Monsieur d'Alençon."
"Ah! Unser berühmter Schütze!" sagte Karl. "Gut!" Dann Stirnrunzeln:
"Ist dieser Monsieur de la Mole nicht ein Hugenotte?" er hat gefragt.
"Er ist bekehrt, Herr, und ich werde für ihn wie für mich selbst antworten."
„Wenn Du für irgendjemanden einstehen, Henriot, habe ich nach dem, was Du heute getan haben, kein Recht mehr, an ihm zu zweifeln. Aber diesen Monsieur de la Mole hätte ich gern gesehen.
Charles sah sich noch einmal im Zimmer um, umarmte Margarete, ergriff den Arm des Königs von Navarra und führte ihn fort.
Am Tor des Louvre wollte Henry mit jemandem sprechen.
„Komm, komm! Werde schnell ohnmächtig, Henriot“, sagte Charles. "Wenn ich dir sage, dass dir die Luft im Louvre heute Abend nicht gut tut, Teufel! Du musst mir glauben!"
„Ventre saint gris! “ murmelte Henry; „Und was wird De Mouy ganz allein in meinem Zimmer tun?
"Ah!" rief der König aus, als Henry und er die Zugbrücke überschritten hatten, "passt es Ihnen, Henry, dass die Herren von Monsieur d'Alençon Ihre Frau umwerben?"
"Wieso, Herr?"
"Wahrlich, macht dieser Monsieur de Coconnas nicht Augen auf Margot?"
"Wer hat dir das gesagt?"
"Nun", sagte der König, "ich habe es gehört."
"Ein bloßer Scherz, Sire; Monsieur de Coconnas macht zwar jemandem schöne Augen, aber das ist bei Madame de Nevers."
"Ah, bah."
"Ich kann Ihrer Majestät für das antworten, was ich Ihnen sage."
Charles brach in Gelächter aus.
„Nun,“ sagte er, „lass den Herzog von Guise wieder mit seinem Klatsch zu mir kommen, und ich werde ihm sanft den Schnurrbart ziehen, indem ich ihm von den Heldentaten seiner Schwägerin erzähle. Aber immerhin,“ sagte der König , überlegte es sich anders: "Ich weiß nicht, ob es Monsieur de Coconnas oder Monsieur de la Mole war, auf den er sich bezog."
"Keiner mehr als der andere, Sire, und ich kann Ihnen für die Gefühle meiner Frau antworten."
"Gut, Henriot, gut!" sagte der König. „Ich mag dich jetzt mehr als früher. Bei meiner Ehre, du bist ein so guter Kerl, dass ich am Ende nicht mehr ohne dich auskommen werde.“
Während er sprach, stieß der König einen eigentümlichen Pfiff aus, worauf sich vier Herren, die am Ende der Rue de Beauvais auf ihn warteten, zu ihm gesellten. Die ganze Gesellschaft machte sich auf den Weg in die Mitte der Stadt.
Es schlug zehn Uhr.
"Teufel!" sagte Margarete, nachdem der König und Heinrich gegangen waren, "sollen wir wieder zu Tisch gehen?"
"Gnade, nein!" rief die Herzogin, „ich habe mich zu sehr erschrocken. Es lebe das kleine Haus in der Rue Cloche Percée! Niemand kann das betreten, ohne es regelmäßig zu belagern, und unsere guten Männer haben das Recht, dort ihre Schwerter zu führen. Aber was bist du? Suchen Sie unter den Möbeln und in den Schränken, Monsieur de Coconnas?
"Ich versuche, meinen Freund La Mole zu finden", sagte der Piemonteser.
"Schauen Sie in mein Zimmer, Monsieur", sagte Marguerite, "da ist ein gewisser Schrank"
"Sehr gut", sagte Coconnas, "ich werde dorthin gehen."
Er betrat den Raum.
"Teufel!" sagte eine Stimme aus der Dunkelheit; "Wo sind wir?"
"Oh! beim Himmel! Wir haben das Dessert erreicht."
"Und der König von Navarra?"
„Er hat nichts gesehen. Er ist ein perfekter Ehemann, und ich wünschte, meine Frau hätte einen wie ihn. Aber ich fürchte, sie wird es nie tun, selbst wenn sie noch einmal heiratet.“
"Und König Charles?"
"Ah! der König. Das ist eine andere Sache. Er hat den Ehemann mitgenommen."
"Wirklich?"
„Es ist, wie ich es dir sage. Außerdem hat er mich geehrt, indem er mich schief angesehen hat, als er entdeckte, dass ich Monsieur d'Alençon gehöre, und verärgert, als er herausfand, dass ich dein Freund war.“
"Du denkst also, dass er von mir gesprochen hat?"
„Ich fürchte, er hat nichts sehr Gutes von Ihnen gehört. Aber darum geht es nicht. Ich glaube, diese Damen müssen zur Rue de Roi de Sicile pilgern, und wir sollen sie dorthin bringen.“
"Na, das ist unmöglich! Das weißt du sehr gut."
"Wie unmöglich?"
"Wir haben Dienst bei Seiner Königlichen Hoheit."
„Beim Himmel, das ist so; ich vergesse immer, dass wir rangiert sind und dass wir von den Herren, die wir einst waren, die Ehre hatten, zu Dienern überzugehen.“
Daraufhin gingen die beiden Freunde und erklärten der Königin und der Herzogin die Notwendigkeit, zumindest bei der Abreise von Monsieur le Duc anwesend zu sein.
"Nun gut", sagte Madame de Nevers, "wir gehen alleine."
"Dürfen wir wissen, wohin Sie gehen?" fragte Coconnas.
"Oh! Sie sind zu neugierig!" sagte die Herzogin. " Quære et invenies. "
Die jungen Männer verneigten sich und gingen sofort zu Monsieur d'Alençon.
Der Herzog schien sie in seinem Kabinett zu erwarten.
"Ah!" sagte er, "Sie kommen sehr spät, meine Herren."
"Es ist kaum zehn Uhr, Monseigneur", sagte Coconnas.
Der Herzog zog seine Uhr.
"Das ist wahr," sagte er. "Und doch sind alle im Louvre schlafen gegangen."
"Ja, Monsieur, aber wir sind auf Ihren Befehl hier. Müssen wir die Herren, die beim König sind, bis er sich zurückzieht, in das Zimmer Ihrer Hoheit lassen?"
"Im Gegenteil, gehen Sie in das kleine Empfangszimmer und entlassen Sie alle."
Die jungen Männer gehorchten, führten den Befehl aus, der wegen des bekannten Charakters des Herzogs niemanden überraschte, und kehrten zu ihm zurück.
"Monseigneur", sagte Coconnas, "Ihre Hoheit wird wahrscheinlich entweder zu Bett gehen oder arbeiten, nicht wahr?"
"Nein, meine Herren, Sie können bis morgen Urlaub haben."
„Nun gut“, flüsterte Coconnas La Mole ins Ohr, „das Gericht wird anscheinend die ganze Nacht wach bleiben. Es wird teuflisch angenehm sein. Lassen Sie uns unseren Anteil daran haben.“
Und beide jungen Männer stiegen vier Stufen auf einmal die Treppe hinunter, nahmen ihre Umhänge und ihre Nachtschwerter und verließen hastig den Louvre hinter den beiden Damen, die sie an der Ecke der Rue du Coq Saint Honoré einholten.
Unterdessen schloss sich der Duc d'Alençon mit offenen Augen und Ohren in seinem Zimmer ein, um die unerwarteten Ereignisse abzuwarten, die ihm versprochen worden waren.
KAPITEL XXXIV. DER MENSCH SCHLÄGT VOR, ABER GOTT VERFÜGT.
Wie der Herzog den jungen Männern gesagt hatte, herrschte tiefstes Schweigen im Louvre.
Marguerite und Madame de Nevers waren in die Rue Tizon aufgebrochen. Coconnas und La Mole waren ihnen gefolgt. Der König und Heinrich klopften in der Stadt herum. Der Duc d'Alençon war in seinem Zimmer und wartete vage und ängstlich auf die Ereignisse, die die Königinmutter vorhergesagt hatte. Catharine war zu Bett gegangen, und Madame de Sauve, die neben ihr saß, las einige italienische Geschichten vor, die die gute Königin sehr amüsierten. Catharine war schon lange nicht mehr so gut gelaunt. Nachdem sie eine Abstimmung mit ihren Hofdamen vorgenommen, ihren Arzt konsultiert und die täglichen Konten ihres Haushalts geordnet hatte, hatte sie Gebete für den Erfolg eines bestimmten Unternehmens angeordnet, von dem sie sagte, dass es für das Glück ihrer Kinder von großer Bedeutung sei . Unter gewissen Umständen war es Catharines Angewohnheit – übrigens eine Angewohnheit,
Schließlich hatte sie Réné gesehen und einige Neuheiten aus ihrer reichen Sammlung parfümierter Taschen ausgewählt.
„Lassen Sie mich wissen,“ sagte Catharine, „wenn meine Tochter, die Königin von Navarra, in ihren Gemächern ist, und wenn sie dort ist, bitten Sie sie, zu mir zu kommen.“
Der Page, dem dieser Befehl gegeben wurde, zog sich zurück, und einen Augenblick später kehrte er in Begleitung von Gilonne zurück.
"Was soll das!" sagte die Königinmutter, "ich habe nach der Herrin gefragt, nicht nach der Dienerin."
„Madame“, sagte Gillonne, „ich dachte, ich sollte selbst kommen und Eurer Majestät mitteilen, dass die Königin von Navarra mit ihrer Freundin, der Herzogin von Nevers, ausgegangen ist“
"Zu dieser Stunde ausgegangen!" rief Catharine stirnrunzelnd aus; "wo kann sie hingegangen sein?"
"Auf eine Vorlesung über Chemie", erwiderte Gillonne, "die im Hôtel de Guise gehalten werden soll, in dem von Madame de Nevers besetzten Pavillon."
"Wann kommt sie zurück?" fragte die Königinmutter.
„Der Vortrag wird bis spät in die Nacht dauern,“ erwiderte Gillonne, „so dass Ihre Majestät wahrscheinlich bis morgen früh bei ihrer Freundin bleiben wird.“
"Die Königin von Navarra ist glücklich", murmelte Catharine; "Sie hat Freunde und sie ist Königin; sie trägt eine Krone, wird Eure Majestät genannt, hat aber keine Untertanen. Sie ist wirklich glücklich."
Nach dieser Bemerkung, die ihre Zuhörer innerlich schmunzeln ließ:
„Nun,“ murmelte Catharine, „seit sie ausgegangen ist – denn sie ist ausgegangen, sagst du?“
"Vor einer halben Stunde, Madame."
"Alles ist zum Besten; du darfst gehen."
Gilonne verneigte sich und ging.
„Lesen Sie weiter, Charlotte,“ sagte die Königin.
Madame de Sauve fuhr fort. Nach zehn Minuten unterbrach Catharine die Geschichte.
"Ach übrigens", sagte sie, "lasst die Wachen aus dem Korridor entlassen."
Das war das Signal, auf das Maurevel wartete. Der Befehl der Königinmutter wurde ausgeführt, und Madame de Sauve erzählte weiter. Sie hatte ungefähr eine Viertelstunde ohne Unterbrechung gelesen, als ein langanhaltender und schrecklicher Schrei die Königskammer erreichte und den Anwesenden die Haare zu Berge stellte.
Dem Schrei folgte das Geräusch eines Pistolenschusses.
"Was ist es?" sagte Katharina; "Warum hörst du auf zu lesen, Carlotta?"
"Madame", sagte die junge Frau und erbleichte, "haben Sie nicht gehört?"
"Was?" fragte Katharina.
"Dieser Schrei."
"Und dieser Pistolenschuss?" fügte der Hauptmann der Wachen hinzu.
"Ein Schrei, ein Pistolenschuss?" fragte Katharina; „Ich habe nichts gehört. Außerdem, ist ein Schrei oder ein Pistolenschuss so etwas sehr Ungewöhnliches im Louvre? Lies, lies, Carlotta.“
"Aber hören Sie, Madame", sagte dieser, während Monsieur de Nancey aufstand, die Hand auf dem Schwert, aber ohne Erlaubnis der Königin nicht wegzugehen wagte, "hören Sie, ich höre Schritte, Flüche."
"Soll ich gehen und es herausfinden, Madame?" sagte DeNancey.
„Keineswegs, Monsieur, bleiben Sie, wo Sie sind“, sagte Catharine und erhob sich mit einer Hand, um ihrem Befehl Nachdruck zu verleihen. "Wer würde mich dann im Alarmfall beschützen? Es kämpfen nur betrunkene Schweizer."
Die Ruhe der Königin, im Gegensatz zu dem Schrecken auf den Gesichtern aller Anwesenden, war so bemerkenswert, dass Madame de Sauve, schüchtern wie sie war, einen fragenden Blick auf die Königin warf.
"Warum, Madame, ich sollte denken, dass sie jemanden töteten."
"Wen glaubst du, töten sie?"
"Der König von Navarra, Madame; der Lärm kommt aus der Richtung seiner Gemächer."
"Der Dummkopf!" murmelte die Königin, deren Lippen sich trotz ihrer Selbstbeherrschung seltsam zu bewegen begannen, denn sie murmelte ein Gebet; "der Narr sieht ihren König von Navarra überall."
"Mein Gott! Mein Gott!" rief Madame de Sauve und fiel in ihren Stuhl zurück.
"Es ist vorbei, es ist vorbei", sagte Catharine. „Captain“, fuhr sie fort und wandte sich an Monsieur de Nancey, „ich hoffe, wenn es im Palast zu einem Skandal kommt, werden die Schuldigen morgen hart bestraft. Fahren Sie mit Ihrer Lektüre fort, Carlotta.“ Und Catharine sank mit einer Ruhe, die stark an Schwäche erinnerte, auf ihr Kissen zurück, denn die Anwesenden bemerkten, wie ihr große Schweißtropfen über das Gesicht liefen.
Madame de Sauve gehorchte diesem förmlichen Befehl, aber ihre Augen und ihre Stimme waren bloße Maschinen. Ihre Gedanken wanderten zu anderen Dingen, die eine schreckliche Gefahr darstellten, die über einem geliebten Haupt schwebte. Schließlich, nachdem sie mehrere Minuten weitergekämpft hatte, wurde sie zwischen ihren Gefühlen und ihrer Etikette so bedrückt, dass ihre Worte unverständlich wurden, das Buch aus ihren Händen fiel und sie ohnmächtig wurde.
Plötzlich war ein lauteres Geräusch zu hören; ein schneller, schwerer Schritt fiel auf den Korridor, zwei Pistolenschüsse erschütterten die Fenster; und Catharine, erstaunt über den endlosen Kampf, erhob sich erschrocken, aufrecht, blass, mit weit aufgerissenen Augen. Als der Hauptmann der Wache hinauseilen wollte, hielt sie ihn auf und sagte:
"Lass alle hier bleiben. Ich selbst werde gehen und sehen, was los ist."
Das ist, was passiert ist, oder besser gesagt, was passiert war. An diesem Morgen hatte De Mouy den Schlüssel von Henrys Zimmer aus den Händen von Orthon erhalten. In dieser mit Paspeln versehenen Taste war ihm eine Papierrolle aufgefallen. Er zog es mit einer Nadel heraus. Es war das Passwort des Louvre für diese Nacht.
Außerdem hatte Orthon ihm mündlich die Worte Henrys übermittelt, in der er De Mouy bat, um zehn Uhr zum König in den Louvre zu kommen.
Um halb neun legte De Mouy eine Rüstung an, deren Stärke er schon mehr als einmal Gelegenheit gehabt hatte zu testen; darüber knöpfte er ein seidenes Wams, befestigte es an seinem Schwert, steckte seine Pistolen in seinen Gürtel und warf über alles den roten Umhang von La Mole.
Wir haben gesehen, wie Heinrich, bevor er in seine Gemächer zurückkehrte, es für das Beste gehalten hatte, Margarete einen Besuch abzustatten, und wie er gerade rechtzeitig über die geheime Treppe ankam, um in Marguerites Schlafzimmer gegen La Mole zu laufen und im Schlafzimmer zu erscheinen Speisesaal vor dem König. Genau in diesem Moment passierte De Mouy dank des von Henry gesendeten Passworts und vor allem des berühmten roten Umhangs das Tor des Louvre.
Der junge Mann ging direkt zu den Gemächern des Königs von Navarra und imitierte, so gut er konnte, wie es seine Gewohnheit war, den Gang von La Mole. Er fand Orthon, der im Vorzimmer auf ihn wartete.
„Sire de Mouy“, sagte der Diener, „der König ist ausgegangen, aber er hat mir aufgetragen, Sie hereinzulassen und auf ihn zu warten. Wenn er zu spät zurückkommt, möchte er, dass Sie es wissen leg dich auf sein Bett."
De Mouy trat ein, ohne um weitere Erklärungen zu bitten, denn was Orthon ihm gerade gesagt hatte, war nur die Wiederholung dessen, was er bereits an diesem Morgen gehört hatte. Um sich die Zeit zu vertreiben, nahm er Feder und Tinte, näherte sich einer schönen Karte von Frankreich, die an der Wand hing, und machte sich an die Arbeit, die Haltepunkte zwischen Paris und Pau zu zählen und zu bestimmen. Aber das war nur die Arbeit einer Viertelstunde, und dann wusste De Mouy nicht, was er tun sollte.
Er machte zwei oder drei Runden im Zimmer, rieb sich die Augen, gähnte, setzte sich, stand auf und setzte sich wieder. Schließlich nutzte er Heinrichs Einladung und die Vertrautheit, die zwischen Prinzen und ihren Herren bestand, stellte seine Pistolen und die Lampe auf einen Tisch, streckte sich auf dem großen Bett mit den düsteren Vorhängen aus, das die Rückseite des Zimmers ausstattete, legte sich hin sein Schwert an seiner Seite, und sicher nicht überrascht zu sein, da ein Diener im Nebenzimmer war, fiel er in einen angenehmen Schlaf, dessen Lärm bald den riesigen Baldachin mit seinem Echo erklingen ließ. De Mouy schnarchte wie ein normaler alter Soldat, und darin hätte er es mit dem König von Navarra selbst aufnehmen können.
Da glitten sechs Männer, die Schwerter in der Hand und die Messer am Gürtel, lautlos in den Korridor, der durch eine kleine Tür mit den Gemächern von Catharine und durch eine große mit denen Heinrichs verbunden war.
Einer der sechs Männer ging den anderen voraus. Außer seinem bloßen Schwert und seinem Dolch, der stark wie ein Jagdmesser war, trug er seine treuen Pistolen, die mit silbernen Haken an seinem Gürtel befestigt waren.
Dieser Mann war Maurevel. Als er Henrys Tür erreicht hatte, blieb er stehen.
"Sind Sie absolut sicher, dass die Wachposten nicht im Korridor sind?" fragte er denjenigen, der anscheinend die kleine Bande befehligte.
"Kein einziger ist auf seinem Posten", antwortete der Leutnant.
"Sehr gut", sagte Maurevel. "Jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als eines herauszufinden - nämlich, ob der Gesuchte in seinem Zimmer ist."
"Aber", sagte der Leutnant und hielt die Hand fest, die Maurevel auf die Klinke der Tür gelegt hatte, "aber, Kapitän, diese Gemächer sind die des Königs von Navarra."
"Wer hat gesagt, dass sie es nicht sind?" fragte Maurevel.
Die Wachen sahen sich verwundert an, und der Leutnant trat zurück.
"Was!" rief er aus, "um diese Stunde jemanden im Louvre und in den Gemächern des Königs von Navarra verhaften?"
"Was sollen Sie sagen", sagte Maurevel, "sollte ich Ihnen sagen, dass Sie den König von Navarra höchstpersönlich verhaften werden?"
"Ich sollte sagen, Kapitän, dass es eine ernste Angelegenheit ist, und das ohne einen von König Karl IX. unterschriebenen Befehl."
„Lies das“, sagte Maurevel.
Und er zog aus seinem Wams den Befehl, den Catharine ihm gegeben hatte, und reichte ihn dem Leutnant.
"Sehr gut", antwortete dieser, nachdem er es gelesen hatte. "Ich habe nichts weiter zu sagen."
"Und du bist bereit?"
"Ich bin bereit."
"Und du?" fuhr Maurevel fort und wandte sich den anderen fünf Sbirros zu.
Alle grüßten respektvoll.
„Hören Sie mir also zu, meine Herren“, sagte Maurevel; "das ist mein Plan: zwei von euch werden an dieser Tür bleiben, zwei an der Tür des Schlafzimmers, und zwei werden mit mir gehen."
"Danach?" sagte der Leutnant.
„Achten Sie genau darauf: Wir haben den Befehl, den Gefangenen daran zu hindern, zu rufen, zu schreien oder sich zu widersetzen. Jeder Verstoß gegen diesen Befehl wird mit dem Tod bestraft.“
„Gut, gut, er hat volle Erlaubnis,“ sagte der Leutnant zu dem Mann, den er ausgewählt hatte, um Maurevel in das Zimmer des Königs zu folgen.
„Vorwärts“, sagte Maurevel.
"Armer Teufel des Königs von Navarra!" sagte einer der Männer. "Oben stand geschrieben, dass er dem nicht entgehen soll."
„Und hier auch“, sagte Maurevel, nahm Catharines Befehl aus der Hand des Leutnants und legte ihn ihm wieder an die Brust.
Maurevel steckte den Schlüssel, den Catharine ihm gegeben hatte, ins Schloss, ließ zwei Männer an der Außentür zurück, wie es vereinbart war, und betrat mit den vier anderen das Vorzimmer.
"Ah" sagte Maurevel, als er das laute Atmen des Schläfers hörte, dessen Geräusch sogar so weit reichte, "es scheint, dass wir finden werden, wonach wir suchen."
Orthon, der dachte, es sei sein Meister, der zurückkehrte, sprang sofort auf und fand sich in der ersten Kammer fünf bewaffneten Männern gegenüber.
Beim Anblick des finsteren Gesichts von Maurevel, der der Königsmörder genannt wurde, sprang der treue Diener zurück und stellte sich vor die zweite Tür:
"Wer bist du?" sagte er, "und was willst du?"
"Im Namen des Königs", erwiderte Maurevel, "wo ist Ihr Herr?"
"Mein Meister?"
"Ja, der König von Navarra."
„Der König von Navarra ist nicht in seinem Zimmer“, sagte Orthon und verriegelte die Tür mehr denn je, „also kannst du nicht eintreten.“
"Entschuldigungen, Lügen!" sagte Maurevel. "Komm, bleib zurück!"
Die Béarnais sind stur; dieser knurrte wie einer seiner eigenen Sennenhunde und ließ sich keineswegs einschüchtern:
"Du sollst nicht eintreten," sagte er; "Der König ist draußen."
Und er klammerte sich an die Tür.
Maurevel machte ein Zeichen. Die vier Männer packten den widerspenstigen Diener, rissen ihn von der Türschwelle, an der er sich festklammerte, und als er anfing, den Mund zu öffnen und zu schreien, schlug Maurevel eine Hand an die Lippen.
Orthon biss wütend auf den Attentäter, der mit einem dumpfen Schrei die Hand fallen ließ und den Griff seines Schwertes auf den Kopf des Dieners schlug. Orthon taumelte, fiel zurück und rief: „Hilfe! Hilfe! Hilfe!“
Dann erstarb seine Stimme. Er war ohnmächtig geworden.
Die Attentäter stiegen über seinen Körper, zwei blieben an der zweiten Tür stehen, und zwei betraten mit Maurevel das Schlafzimmer.
Im Schein der Lampe, die auf dem Nachttisch brannte, sahen sie das Bett.
Die Vorhänge waren zugezogen.
"Ach!" sagte der Leutnant, "er hat anscheinend aufgehört zu schnarchen."
"Sei schnell!" rief Maurevel.
Da ertönte hinter den Vorhängen, die gewaltsam zurückgeworfen wurden, ein scharfer Schrei, der eher dem Brüllen eines Löwen als einer menschlichen Stimme glich, und ein Mann erschien dort sitzend, mit einem Kürass bewaffnet, den Kopf mit einem Helm bedeckt, der reichte zu seinen Augen. Zwei Pistolen hielt er in der Hand, und sein Schwert lag auf seinen Knien.
Kaum nahm Maurevel diese Gestalt wahr und erkannte De Mouy, als ihm die Haare zu Berge standen; er wurde furchtbar bleich, Schaum stieg ihm auf die Lippen, und er trat zurück, als stünde er einem Gespenst gegenüber. Plötzlich erhob sich die bewaffnete Gestalt und trat vor, während Maurevel sich zurückzog, so dass letzterer aus der Position des Drohenden nun der Bedrohte wurde und umgekehrt.
"Ah, Schurke!" rief De Mouy mit dumpfer Stimme, "du bist also gekommen, um mich zu ermorden, wie du meinen Vater ermordet hast!"
Die beiden Wachen, die allein mit Maurevel den Raum betreten hatten, hörten diese schrecklichen Worte. Als sie ausgesprochen wurden, wurde Maurevel eine Pistole an die Stirn gesetzt. Letzterer sank auf die Knie, als De Mouy seine Hand auf den Abzug legte; der Schuss fiel, und einer der Wachen, die hinter ihm standen und die er durch diese Bewegung demaskiert hatte, fiel zu Boden, traf ihn ins Herz. Im gleichen Moment feuerte Maurevel zurück, aber die Kugel prallte von de Mouys Kürass ab.
Dann maß De Mouy die Entfernung ab, sprang nach vorne und spaltete mit der Schneide seines Breitschwerts den Kopf der zweiten Wache auf, und er drehte sich zu Maurevel um und kreuzte die Schwerter mit ihm.
Der Kampf war kurz, aber schrecklich. Beim vierten Durchgang spürte Maurevel den kalten Stahl in seiner Kehle. Er stieß einen unterdrückten Schrei aus und fiel nach hinten, wobei er die Lampe umwarf, die im Sturz erlosch.
Sofort nutzte De Mouy, stark und wendig wie einer von Homers Helden, die Dunkelheit aus und sprang mit gesenktem Kopf in das Vorzimmer, schlug eine Wache nieder, schob die andere beiseite und schoss wie ein Pfeil zwischen die beiden nach außen Tür. Er entging zwei Pistolenschüssen, deren Kugeln die Wand des Korridors streiften, und war von diesem Augenblick an sicher, denn eine geladene Pistole blieb ihm noch übrig außer dem Schwert, das so schreckliche Hiebe versetzt hatte.
Einen Augenblick zögerte er, unentschlossen, ob er zu Monsieur d'Alençon gehen sollte, dessen Zimmertür er gerade geöffnet hatte, oder ob er versuchen sollte, aus dem Louvre zu fliehen. Er entschied sich für letzteres, setzte seinen Weg fort, zunächst langsam, sprang zehn Stufen auf einmal, und als er das Tor erreichte, sprach er die beiden Passwörter aus und eilte weiter, wobei er rief:
"Geh nach oben, dort wird auf Befehl des Königs gemordet."
Er nutzte das Erstaunen, das seine Worte und das Geräusch der Pistolenschüsse bei der Wache auslösten, rannte weiter und verschwand in der Rue du Coq, ohne einen Kratzer abbekommen zu haben.
In diesem Moment hielt Catharine den Hauptmann der Wachen an und sagte:
"Bleiben Sie hier; ich selbst werde gehen und nachsehen, was los ist."
"Aber, Madame", erwiderte der Kapitän, "die Gefahr, der Ihre Majestät ausgesetzt ist, zwingt mich, Ihnen zu folgen."
„Bleiben Sie hier, Monsieur“, sagte Catharine in noch gebieterischerem Ton, „bleiben Sie hier.
Der Kapitän blieb, wo er war.
Catharine nahm eine Lampe, schlüpfte mit ihren nackten Füßen in ein Paar Samtpantoffeln, verließ ihr Zimmer, erreichte den Korridor, der immer noch voller Rauch war, und ging so unpassierbar und so kalt wie ein Schatten auf die Gemächer des Königs von Navarra zu.
Schweigen herrschte.
Catharine erreichte die Tür, trat über die Schwelle und sah zuerst Orthon, der im Vorzimmer ohnmächtig geworden war.
"Ah!" sagte sie, "hier ist der Diener; weiter unten werden wir wahrscheinlich den Herrn finden." Sie trat durch die zweite Tür ein.
Dann lief ihr Fuß gegen eine Leiche; sie senkte ihre Lampe; es war der Wachmann, dem der Kopf aufgeplatzt war. Er war tot.
Ein paar Meter weiter tat der von einer Kugel getroffene Leutnant seinen letzten Atemzug.
Schließlich lag vor dem Bett ein Mann, dessen Gesicht totenbleich war und der aus einer doppelten Wunde an der Kehle blutete. Er presste krampfhaft die Hände zusammen, um aufzustehen.
Es war Maurevel.
Catharine schauderte. Sie sah das leere Bett, sie sah sich im Zimmer um und suchte vergeblich nach der Leiche, die sie zwischen den drei Leichen zu finden hoffte.
Maurevel erkannte Catharine. Seine Augen waren schrecklich geweitet und er machte eine verzweifelte Geste in ihre Richtung.
„Nun,“ sagte sie flüsternd, „wo ist er? Was ist passiert? Unglücklicher! Hast du ihn entkommen lassen?“
Maurevel bemühte sich zu sprechen, aber ein unverständlicher Laut kam aus seiner Kehle, ein blutiger Schaum bedeckte seine Lippen, und er schüttelte den Kopf als Zeichen von Unfähigkeit und Schmerz.
"Sprich!" rief Catharine, „sprich! wenn nur ein Wort!“
Maurevel deutete auf seine Wunde, stieß erneut ein paar unartikulierte Keuchen aus, die in einem heiseren Rasseln endeten, und fiel in Ohnmacht.
Catharine sah sich um. Sie war umgeben von den Körpern der Toten und Sterbenden; Blut floss in alle Richtungen, und die Stille des Todes schwebte über allem.
Noch einmal sprach sie mit Maurevel, konnte ihn aber nicht wachrütteln; er war nicht nur still, sondern bewegungslos; ein Papier war in seinem Wams. Es war der vom König unterschriebene Haftbefehl. Catharine ergriff es und versteckte es in ihrer Brust. Da hörte sie einen leichten Schritt hinter sich, und als sie sich umdrehte, sah sie den Duc d'Alençon an der Tür stehen. Unwillkürlich hatte ihn der Lärm dorthin gezogen, und der Anblick vor ihm faszinierte ihn.
"Sie hier?" sagte sie.
"Ja, Madame. Um Gottes willen, was ist passiert?"
"Geh zurück in dein Zimmer, François; du wirst es früh genug wissen."
D'Alençon war von der Affäre nicht so unwissend, wie Catharine annahm.
Auf das Geräusch der ersten Schritte im Korridor hatte er gelauscht. Als er sah, wie einige Männer die Gemächer des Königs von Navarra betraten, und indem er dies mit einigen Worten Katharinas in Verbindung brachte, hatte er geahnt, was geschehen würde, und freute sich, einen so gefährlichen Feind durch eine stärkere Hand als seine eigene vernichtet zu haben . Kurz darauf hatten die Geräusche von Pistolenschüssen und die schnellen Schritte eines Laufenden seine Aufmerksamkeit erregt, und er hatte gesehen, wie der rote Umhang, der zu bekannt war, um nicht zu sein, in dem Lichtraum verschwand, der durch das Öffnen der Tür zur Treppe entstand anerkannt.
"De Mouy!" er schrie, "De Mouy in den Gemächern des Königs von Navarra! Na, das ist unmöglich! Kann es Monsieur de la Mole sein?"
Er wurde beunruhigt. Als er sich daran erinnerte, dass Marguerite ihm den jungen Mann empfohlen hatte, und sich vergewissern wollte, dass er es war, den er gerade gesehen hatte, stieg er eilig zum Zimmer der beiden jungen Männer hinauf. Es war frei. Aber in einer Ecke fand er den berühmten roten Umhang, der an der Wand hing. Sein Verdacht wurde bestätigt. Es war nicht La Mole, sondern De Mouy. Bleich und zitternd, der Hugenotte könnte entdeckt werden und die Geheimnisse der Verschwörung verraten, eilte er zum Tor des Louvre. Dort wurde ihm gesagt, dass der rote Umhang wohlbehalten entkommen sei und im Vorbeigehen geschrien habe, dass jemand im Louvre auf Befehl des Königs ermordet werde.
"Er irrt sich", murmelte D'Alençon; "Es ist im Auftrag der Königinmutter."
Als er zum Schauplatz des Kampfes zurückkehrte, fand er Catharine wie eine Hyäne zwischen den Toten umherirrt.
Auf Befehl seiner Mutter kehrte der junge Mann in seine Gemächer zurück und wirkte ruhig und gehorsam, trotz der aufgewühlten Gedanken, die ihm durch den Kopf gingen.
Aus Verzweiflung über das Scheitern dieses neuen Versuchs rief Catharine den Hauptmann der Wachen an, ließ die Leichen entfernen, befahl, Maurevel, der nur verwundet war, zu sich nach Hause zu bringen, und sagte ihnen, sie sollten den König nicht wecken.
"Oh!" murmelte sie, als sie in ihre Gemächer zurückkehrte, den Kopf an die Brust gesenkt, „er ist wieder entkommen. Die Hand Gottes ist über diesem Mann. Er wird regieren! Er wird regieren!“
Als sie ihr Zimmer betrat, fuhr sie sich mit der Hand über die Stirn und setzte ein gewöhnliches Lächeln auf.
"Was war los, Madame?" fragten alle außer Madame de Sauve, die zu verängstigt war, irgendwelche Fragen zu stellen.
"Nichts", antwortete Catharine; "ein Geräusch, das war alles."
"Oh!" rief Madame de Sauve und zeigte plötzlich auf den Boden, "Euer Majestät sagt, es sei nichts los, und jeder Schritt Eurer Majestät hinterlässt eine Blutspur auf dem Teppich!"
KAPITEL XXXV. EINE NACHT DER KÖNIGE.
Karl IX. ging zusammen mit Henry, der sich auf seinen Arm stützte, gefolgt von seinen vier Herren und vorausgehend von zwei Fackelträgern.
„Wenn ich den Louvre verlasse“, sagte der arme König, „empfinde ich eine ähnliche Freude wie beim Betreten eines schönen Waldes. Ich atme, ich lebe, ich bin frei.“
Heinrich lächelte.
"In diesem Fall", sagte er, "wäre Eure Majestät zwischen den Bergen des Béarn in Ihrem Element."
"Ja, und ich verstehe, dass Sie zu ihnen zurückkehren möchten; aber wenn Sie sehr darauf bedacht sind, Henriot", fügte Charles lachend hinzu, "mein Rat ist, vorsichtig zu sein, denn meine Mutter Catharine liebt Sie so sehr es ist absolut unmöglich für sie, ohne dich auszukommen."
"Was hat Eure Majestät heute Abend vor?" fragte Henry und änderte dieses gefährliche Gespräch.
„Ich möchte, dass du jemanden triffst, Henriot, und du sollst mir deine Meinung sagen.“
"Ich stehe auf Befehl Eurer Majestät."
"Rechts! Rechts! Wir nehmen die Rue des Barres."
Die beiden Könige, gefolgt von ihrer Eskorte, hatten die Rue de la Savonnerie passiert, als sie vor dem Hôtel de Condé zwei in große Mäntel gehüllte Männer aus einer Geheimtür heraustreten sahen, die einer von ihnen geräuschlos hinter sich schloss.
"Ach!" sagte der König zu Heinrich, der wie gewöhnlich alles gesehen, aber nicht gesprochen hatte, "das verdient Aufmerksamkeit."
"Warum sagst du das, Herr?" fragte der König von Navarra.
"Es ist nicht auf Ihrer Rechnung, Henriot. Sie sind Ihrer Frau sicher," fügte Charles mit einem Lächeln hinzu; "aber dein Cousin De Condé ist sich seiner nicht sicher, oder wenn ja, macht er einen Fehler, der Teufel!"
"Aber woher wissen Sie, Sire, dass es Madame de Condé ist, die diese Herren besucht haben?"
„Instinkt sagt es mir. Die Tatsache, dass die Männer in der Tür standen, ohne sich zu bewegen, bis sie uns sahen; dann der Schnitt des Umhangs des Kürzeren – beim Himmel!
"Was?"
„Nichts. Eine Idee, die ich hatte, das ist alles.
Er ging auf die beiden Männer zu, die, als sie ihn sahen, weggingen.
"Hallo die Herren!" rief der König; "Pause!"
"Sprichst du mit uns?" fragte eine Stimme, die Charles und seinen Begleiter erzittern ließ.
"Nun, Henriot", sagte Charles, "erkennst du die Stimme jetzt?"
"Sire", sagte Henry, "wenn Ihr Bruder, der Duc d'Anjou, nicht in La Rochelle wäre, würde ich schwören, dass er es war, der sprach."
"Nun", sagte Charles, "er ist nicht in La Rochelle, das ist alles."
"Aber wer ist bei ihm?"
"Erkennst du seinen Gefährten nicht?"
"Nein, Herr."
„Und doch ist seine Gestalt unverkennbar. Warte, du wirst sehen, wer er ist – hallo! Ich sage dir,“ rief der König, „hörst du nicht, beim Himmel?“
"Sind Sie die Wache, die Sie uns befehlen anzuhalten?" sagte der größere der beiden Männer und befreite seinen Arm aus den Falten seines Umhangs.
„Tu so, als ob wir die Wache wären,“ sagte der König, „und hör auf, wenn wir es dir sagen.“
Er beugte sich zu Henrys Ohr und fügte hinzu:
"Jetzt wirst du sehen, wie der Vulkan sein Feuer aussendet."
"Ihr seid acht", sagte der größere der beiden Männer und zeigte diesmal nicht nur seinen Arm, sondern auch sein Gesicht, "aber wärst du hundert, pass auf!"
"Ah! der Duc de Guise!" sagte Heinrich.
"Ah! unser Cousin von Lothringen," sagte der König; "Endlich werden Sie sich treffen! Wie glücklich!"
"Der König!" rief der Herzog.
Bei diesen Worten bedeckte sich der andere Mann mit seinem Umhang und stand regungslos da, nachdem er sich aus Respekt zuerst entblößt hatte.
"Sire", sagte der Duc de Guise, "ich habe gerade meiner Schwägerin Madame de Condé einen Besuch abgestattet."
„Ja – und Sie haben einen Ihrer Herren mitgebracht?
"Herr", erwiderte der Herzog, "Ihre Majestät kennt ihn nicht."
„Wir werden ihn jedoch treffen,“ sagte der König.
Er ging auf die andere Gestalt zu und bedeutete einem der Lakaien, eine Fackel zu bringen.
"Verzeih mir, Bruder!" sagte der Duc d'Anjou, öffnete seinen Umhang und verbeugte sich mit schlecht verhüllter Wut.
„Ah! Henry, bist du es? Aber nein, es ist nicht möglich, ich irre mich – mein Bruder von Anjou wäre nicht zu jemand anderem gegangen, bevor er mich zuerst besucht hätte. Er weiß das für königliche Prinzen, die zurückkehren zur Hauptstadt hat Paris nur einen Eingang, das Tor des Louvre."
"Verzeihen Sie mir, Herr," sagte der Duc d'Anjou; "Ich bitte Eure Majestät, meine Gedankenlosigkeit zu entschuldigen."
"Ah ja!" antwortete der König spöttisch; "Und was hast du, Bruder, im Hôtel de Condé gemacht?"
"Warum", sagte der König von Navarra in seiner schlauen Art, "was Ihre Majestät soeben angedeutet hat."
Und er lehnte sich zum König hinüber und beendete seinen Satz in einem Ausbruch von Gelächter.





























