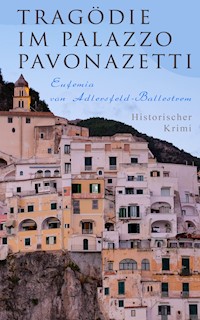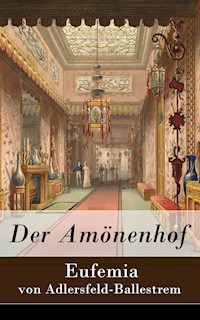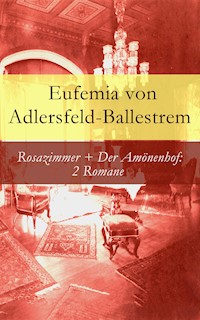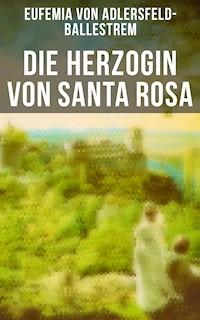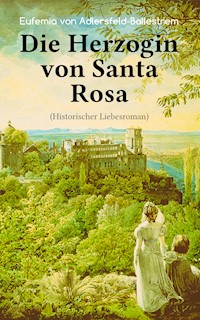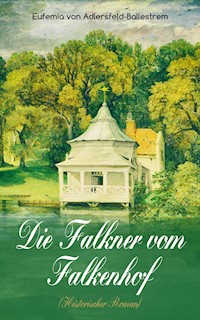1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Mit 'Maria Schnee' präsentiert die renommierte Autorin Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem einen fesselnden historischen Krimi, der im Wien des 19. Jahrhunderts spielt. In diesem Werk verbindet sie geschickt Elemente der Spannungsliteratur mit einer detaillierten Darstellung der damaligen Gesellschaftsstruktur und politischen Ereignisse. Der Leser wird durch eine mysteriöse Mordgeschichte in die Welt von Maria Schnee entführt, wo Intrigen und Geheimnisse die Handlung vorantreiben. Von Adlersfeld-Ballestrems Schreibstil ist präzise und eloquent, wodurch sie es schafft, die Atmosphäre der damaligen Zeit lebendig werden zu lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Maria Schnee
Inhaltsverzeichnis
Bis Jungschnee kommt in der SonnwendnachtDann hofft und – habt acht!
Auf der türkisblau leuchtenden Fläche des Genfer Sees zwischen Montreux und St. Gingolph lag an einem strahlenden Frühlingstage ein Boot, und in dem Boote ließen sich zwei Damen leis, kaum merklich, von dem glitzernden Wasser schaukeln. Ein gutes Stück ab von der Wasserbahn, welche die Dampfer zogen, lag der Kahn fast regungslos auf der schimmernden Fläche und regungslos wie das leichte Fahrzeug auf der grausigen Tiefe des Leman saßen die zwei jungen Gestalten darin, ganz vertieft, wie es schien, in den Anblick der unvergleichlichen Landschaft, in der sie selbst und ihr Boot zur Staffage gehörten.
Wer je diese Landschaft gesehen, und wenn er sie hundert und hundert Male wieder sieht, den wird ihr Zauber immer neu bestricken. Wohl gibt es zahlreiche andere Punkte am Genfer See, die das Auge begeistern und entzücken, aber keiner kann sich mit dem vollendeten, abgeschlossenen Bilde vergleichen, das gerade diese Stelle, der »bout du lac«, wie die Leute sie hier nennen, bietet. Eigentlich dürfte man sie nicht das »Ende des Sees« nennen, sondern den Anfang, weil hier, zwischen Villeneuve und Le Bouveret, die Rhone, weithin sichtbar, hineinströmt in den riesigen Seeboden, um ihn in Genf erst zu verlassen, ein stolzer Strom, der Südfrankreich durcheilend, sich ins Mittelmeer ergießt. Doch auf den Namen kommt es nicht an – »die Rose unter einem anderen Namen würde ebenso süß duften, wie unter diesem«, sagt Shakespeare. Ob Anfang, ob Ende – wenn man, das Gesicht der Rhonemündung zugekehrt, von Vevey kommend, auf dem See um die Ecke von La Tour de Peilz mit ihrem alten, efeuumsponnenen Savoyerschlosse biegt, da vergeht selbst dem Nörgler, der überall, wo immer er auch hinkommen mag, einen schöneren Punkt kennt, das leidige Vergleichen vor der siegenden Schönheit dieses Bildes! Rechts steigen die in ihrer Form so unvergleichlichen Savoyer Berge, voran der Grammont, mit grünen Wänden und Felsengipfeln auf aus dem blauen Wasser des Sees; das grüne, blühende, fruchtbare Rhonetal dehnt sich gradaus, bis wo der Zuckerhut des Mont Catogne ihm den Abschluß gibt; rechts von ihm erst die in der Sonne funkelnde bläuliche Fläche des Trientgletschers, vor die sich, der Löwe in dieser Gruppe, die fünfzackige, schneegekrönte Dent du Midi vorschiebt. Links vom Catogne, weit zurück, die Berge des Großen St. Bernhard mit dem im ewigen Schnee leuchtenden Mont Velan, dann, der Dent du Midi gegenüber, die kühne Spitze der Dent du Morcle mit ihrer imposanten Bergkette; noch weiter vor der grüne Abhang über Villeneuve, dann die der »Jungfrau« ähnliche prächtige Formation des Rocher de Naye mit der nadelartigen Dent de Jaman, als Trabanten, zu deren Füßen das reizende Les Avants gebettet liegt, wo im Mai die wilden Narzissen so üppig blühen, daß man von ferne meint, frischer Schnee wäre gefallen. Am rechten Ufer, mit dem Gesicht nach dem Rhonetal gekehrt, die Fischerdörfer St. Gingolph und Le Bouveret, links die unter dem Gesamtnamen »Montreux« das Ufer einfassenden Villen, Pracht-Hotelpaläste und Luxusbauten der Ortschaften Clarens, Veyteau, Territet, zwischen letzterem und Villeneuve die drohende Wasserfeste Chillon, zu der alljährlich Hunderttausende pilgern, von denen die meisten nicht wissen, warum sie das tun – (weil's im Baedeker steht). Und über dem strahlenden Uferbilde von Montreux wie ein gekröntes Haupt hoch oben das herrliche Caux, das tiefer gelegene, nicht minder reizende Glion, weiterhin auf rebenumwachsenem Hügel das mittelalterliche Schloß Chatellard, überragt von den Pleiaden – nein, wer das alles einmal gesehen, dem vergeht das Vergleichen und wäre er der größte Nörgler, den die geduldige Sonne bescheint, und wer's hundertmal gesehen, den entzückt's zum hunderthundertsten Male genau ebenso.
Die beiden jungen Damen im Kahn hatten lange geschwiegen und traumverloren das strahlende Bild betrachtet. Die Sonne hatte sich schon gesenkt und wollte, purpurnes Abendrot über den Höhenzug des Jura breitend, dahinter für heut zur Ruhe gehen; Fischerboote glitten leis über die nun in allen Farben wie Perlmutter schimmernde Wasserfläche, große Lastkähne, mit nur diesem See eigentümlichen lateinischen Segeln, wie riesige Möwen über das Wasser gleitend, kleine Segeljachten schwebten lautlos, wie Schemen darüber hin und die weiße Villa auf der grünen Insel vor Clarens tauchte in ein Lichtmeer wie von Purpur und Gold, das auch den beiden Frauen im Kahn einen merkwürdig prächtigen und charakteristischen Hintergrund verlieh, trotzdem die Jugend der beiden auch aus der reizlosesten Umgebung siegreich hervorgangen wäre.
Die eine, die, ein Buch in den zarten Händen, auf dem kissenbelegten Sitze saß, war eine jener vergeistigten Erscheinungen, wie Lenbach sie zu malen liebte, mit einem Kopfe wie eine Kamee, über der ganzen Gestalt der Hauch der geistigen und aristokratischen Vornehmheit, die sich auf jedes Detail ihrer raffiniert einfachen und doch so kostbaren Toilette übertrug. Die andere, die gerudert, trug nur einen sehr einfachen, fußfreien Lodenrock und eine rührend billige Bluse von blauem Batist, und trotzdem hätten nur wenige neben ihr die vornehme Eleganz der andern gesehen, – sie wirkte neben ihr wie das elektrische Licht neben der milden und doch vielen angenehmeren Flamme der Wachskerze.
Wie diese beiden zusammengekommen, sich gefunden, darüber hatte sich schon manch einer, der gern beobachtete, den Kopf zerbrochen, und die Fremdenliste gab so gar keinen Aufschluß darüber neben den Namen und Titeln, die gar keine sonderliche soziale Kluft vermuten ließen. Und das Benehmen der beiden einander gegenüber noch viel weniger und das Aussehen schon lange nicht trotz der ausgesprochenen Verschiedenheit der beiderseitigen Mittel.
Das Firmament, an dem diese zwei Sterne sich getroffen und nach einigem Auseinandergleiten der Bahnen sich zum gemeinsamen Laufe vereint, führte den Namen eines Töchterpensionats, das den Ruf genoß, die Sprossen der besten Kreise zu vollendeten Weltdamen sowohl wie zu modernen praktischen Frauen erziehen zu können. Die Dame, welche imstande war, nach beiden Zielen mit dem gleichen guten Erfolge arbeiten zu können, hatte eine Schwester, die sich jung mit einem vielversprechenden Offizier, dem Hauptmann von Seeburg-Am See verheiratet, aber bald mit Hinterlassung einer jungen Tochter gestorben war. Dies Mädchen hatte die treue Tante erst im Kreise ihrer Zöglinge mit erzogen und dann dem Vater zurückgegeben, der damals ein Regiment kommandierte. Ein Sturz vom Pferde beim Manöver nötigte den Oberst von Seeburg-Am See, den Abschied zu nehmen, den er mit dem Range eines Generalmajors und allen möglichen sonstigen Beweisen königlicher Gnade erhielt, aber alles das hinderte nicht, daß er den Folgen des verhängnisvollen Sturzes bald nach seiner Pensionierung erlag, und seine Tochter, nun eine mittellose Waise, kehrte in die Schule ihrer Tante zurück, um sich dort zum Lehrerinnenberuf vorzubereiten, zu dem sie nichts zog, als das harte Muß und der Umstand, daß die Tante ihr dazu die Mittel und Wege geben, beziehungsweise anbahnen konnte. In dem Pensionat des Fräulein von Sternberg befand sich damals auch eine wirkliche, echte und leibhaftige Prinzessin, die aber trotz ihres hohen Ranges und Zugehörigkeit zu einem mediatisierten Hause ebenso arm und verlassen war, wie die Nichte der Institutsvorsteherin. Der Prinz von Eichwald, ihr Vater, war als notorischer Verschwender unter Kuratel gestellt worden und noch zur guten Stunde unter Hinterlassung großartiger Schulden gestorben; seine Gemahlin hatte sich schon vor ihm übermüde dem unnützen Kampfe um das elende Dasein an dieses Mannes Seite durch den Tod entzogen. Nach seinem nicht eben rühmlichen Ende bezahlte der Chef des fürstlichen Hauses die Schulden und steckte die Waise, die seine Nichte im dritten Grade war, in das vielgerühmte und kostbare Erziehungsinstitut Sternberg, wo der sensitive Fremdling sich scheu in sich zurückzog, bis Fräulein von Seeburg, wie sie in schwarze Trauerkleider gehüllt, erschien, und an sie, die so ganz ihr Gegensatz erschien, schloß diese sensitive Mimose, das scheue Prinzeßchen, sich »mit klingendem Spiel und fliegenden Fahnen« bedingungslos an. Eine Mädchenfreundschaft, nichts weiter? Gewiß, aber eine mit Wurzeln, die weiter grünten und Zweige trieben, auch, als das Leben durch die räumliche Trennung der beiden die Blüten abgeschnitten. Das Prinzeßchen war nach vollendeten Lehrjahren – ein Blatt im Winde, – zu ihren Verwandten eingeladen worden und hatte das – der Meinung der Verwandten nach nämlich – »riesige Glück«, in der Person eines alten, verhutzelten und schwer reichen Diplomaten einen Freier zu finden, dessen Hand anzunehmen man keine allzuschwere Mühe hatte das junge, unerfahrene, schüchterne Mädchen zu überreden. Der alte Herr, der den Posten eines Botschafters bekleidete, war aber nicht nur ein geistreicher Diplomat, er war auch ein warmherziger und edler Mensch und bei ihm, der die Rolle des älteren Bruders mehr als die des Gatten betonte, kam der liebenswürdige und liebenswerte Charakter der fürstlichen Waise erst zur vollen Entwicklung. Nach kaum zweijähriger Ehe starb Graf Mirow und seine junge Witwe, die Erbin seines großen Vermögens, betrauerte ihn aufrichtig mit der ruhigen Trauer, wie sie vielleicht eine junge Nichte für einen lieben alten Onkel hat, der sie im Leben mit Zuckerzeug und sonstigen guten Gaben überschüttet hat. Und dabei hatte sie das Bewußtsein, ihm als Gegengabe stets ihr freundlichstes Lächeln gegeben zu haben, seinem Hause die anmutigste, liebenswürdigste Repräsentantin gewesen zu sein. Vielleicht hatte er auch nicht mehr verlangt und erwartet, der alte Herr, als er sich dieses im Verborgenen blühende Veilchen pflückte mit all seinem Duft und seiner Anmut, und wenn er es tat – – laut werden ließ er's nie vor ihr.
In all dieser Zeit, da Marie-Luise Eichwald die Rolle der Doyenne eines diplomatischen Korps mit jugendlicher Grazie und angeborener Würde ausfüllte, fand sie immer Zeit, ein paar herzliche Zeilen an die Freundin im Institut zu schreiben, deren kraftvoller, lebensprühender Natur sie so viel verdankte, deren Wesen und Erscheinung ihr so unendlich sympathisch war. Sie sann dabei unablässig auf Mittel und Wege, Fräulein von Seeburg in ihre Nähe zu bekommen, fand aber keine, denn sie wußte sehr genau, daß ihre Freundin die Mittel nicht hatte, um als Gast des Hauses sich dessen großem Rahmen anzupassen, und sie als Gesellschafterin zu engagieren und sie damit in den Hintergrund zu schieben, in den zweiten Rang des Haushalts sozusagen, dazu konnte sie sich einer Persönlichkeit gegenüber, wie es Fräulein von Seeburg war, nicht entschließen, ganz abgesehen davon, daß es sehr unwahrscheinlich war, daß sie einem solchen Rufe gefolgt wäre. Nachdem wieder ein Jahr, – das Trauerjahr für Seine Exzellenz den Grafen von Mirow, abgelaufen war, erschien seine junge, nun zweiundzwanzig Jahre alte Witwe eines schönen Frühlingstages in dem Institut und hatte eine Unterredung mit der Vorsteherin, die sich herzlich freute, ihre ehemalige Schülerin wiederzusehen. Nach dieser Unterredung wurde Fräulein von Seeburg gerufen, die nach glänzender Absolvierung ihrer Examina eben in das Lehrerkollegium des Instituts aufgenommen worden war, und nach einer stürmischen Begrüßung der Freundinnen lud Gräfin Mirow Fräulein von Seeburg ein, mit ihr zu reisen. Allein könne sie das nicht gut, wolle sie sich nicht unfreundlichen Kommentaren aussetzen; eine ihr fremde und unbequeme Ehrendame mochte sie nicht – da gäbe sie lieber das Reisen auf, bevor sie sich in dieser Weise bände und sich eine klirrende Kette an den Fuß schmiedete – wenn aber Fräulein von Seeburg mit ihr kommen wolle, dann wäre allen geholfen, vielleicht auch der lieben Freundin selbst, der eine gründliche Erholung nach den anstrengenden Arbeiten für die Examen nötiger sei, als sich direkt ins Joch des Unterrichtgebens spannen zu lassen. Diese Ansicht unterstützte Fräulein von Sternberg sehr energisch, denn sie liebte ihre Nichte, und gab ihr unbeschränkten Urlaub –: es wären genug arme Wesen da, die selig wären, die beurlaubte Lehrerin gegen deren Gehalt vertreten zu können. Fräulein von Seeburg, in dieser Weise freigegeben, nahm die Einladung von Herzen gern an – hinaus in die Welt, fremdes Land, fremdes Leben kennen zu lernen, das war ihre Sehnsucht, nicht aber, in dumpfer Schulstube kleinen Kindern das Abc einzupauken. Und so kam es, daß die beiden Freundinnen an jenem strahlenden Maitage hinausgerudert waren auf den Genfer See, denn Gräfin Mirow hatte im Grandhotel in Territet Wohnung genommen. Hier wollten sie bleiben, bis die Hitze sie in die Berge trieb, bis die vorrückende Saison es erlaubte, nach Zermatt vorzudringen, denn Fräulein von Seeburg hatte eine ganz unbezwingliche Sehnsucht nach der persönlichen Bekanntschaft des Matterhorns fallen lassen und darum stand das Matterhorn auch auf dem Programm – wenn's der Gipfel des Popokatepetel gewesen wäre, ja hätte er ebensogut auf dem Programm gestanden, denn Gräfin Mirow war heilsfroh, sich von den stärkeren Wünschen und der größeren Lebensfreude ihrer Freundin schieben zu lassen, ganz abgesehen davon, daß es ihr Herzenssache war, den leisesten Wunsch eines Wesens zu erfüllen, zu dem sie in ungeteilter Bewunderung, den schlichten Lodenrock und die billige Bluse inbegriffen, emporblickte.
Und es mußte wahr sein: diese einfachen Kleider, von Fräulein von Seeburg getragen, stellten rettungslos die kostbare, wenn auch raffiniert einfache Garderobe der jungen Witwe ins zweite Treffen; es gibt Menschen, die, in Sackleinwand gekleidet, königlich aussehen, wie es andere gibt, auf denen Samt und Goldbrokat herumhängen wie die Lumpen auf einer Vogelscheuche. Und Fräulein von Seeburg gehörte zu dieser ersteren Gattung; ihr schlanker Wuchs, ihre ungezwungene königliche Haltung voll natürlicher Grazie machte jedes Gewand zu einer »Toilette«, ihr wundervoller Kopf mit dem herrlichen roten Haar, das wellig und ungestüm fast sich aufbauschte und in der Sonne wie poliertes Kupfer leuchtete, ihre belebten, kühnen Züge, ihr milchweißer, fleckenloser Teint, ihre großen schwarzen Augen mit den tiefliegenden Wimpern und den dichten, graden schwarzen Brauen, dieser Kopf triumphierte siegreich über jegliche Hülle, die dies wunderbare Geschöpf immer tragen mochte, nach dem die Vorübergehenden sich unweigerlich, unbeschadet ihres Alters, Standes und Geschlechtes umdrehten, um ihm nachzusehen. So siegend saß sie auch hier im Boot, die schönen, jugendkräftigen Hände ohne Handschuh auf den Rudern, den Kopf unbedeckt, daß die rotgoldene Abendsonne eine wahre Glorie um ihr Haupt wob, aus welcher Funken zu sprühen schienen. Sie hatten eine ganze lange Zeit schweigend im Boot gesessen. Jede mit ihren Gedanken beschäftigt – denn das gehörte zu dem Abkommen ihres Beisammenseins, daß keine die andere krampfhaft zu amüsieren bemüht war, wenn sie aufgelegt war zum Schweigen. Gräfin Mirow hatte darum, diese schöne persönliche Freiheit benutzend, ein Buch mitgenommen, in dem sie nicht las und Fräulein von Seeburg war mit ihren Rudern beschäftigt, denn es hätte ihnen beiden viel, wenn nicht alles von der Freude dieser Wasserfahrten genommen, wenn sie einen Schiffer im Boote als sehr lästige Überfracht hätten mitführen müssen. Den roten Schein auf dem zarten, vergeistigten Blick der ihr gegenübersitzenden Freundin bemerkend, zog sie die Uhr – ein einfaches, silbernes Ding an schwarzseidener Schnur und warf einen Blick darauf.
»Man muß an die Heimkehr denken«, murmelte sie, tauchte die Ruder ins Wasser und wandte das Boot mit der Spitze Territet zu. Dabei kam sie selbst aber in das volle Licht der Abendsonne zu sitzen, in die sie mit ungeblendetem Blicke hineinsah wie in ein Element, in dem sie zu Hause war. Der schlanke, kräftige Körper bog sich, wenn die Ruder ins Wasser tauchten, zurück und bei jeder Bewegung flammte und lohte das rote Haar, das sie wie eine Königskrone auf der weißen Stirn trug. Das goldene Licht mußte eine wundersame, berauschende Wirkung auf sie haben, denn in ihren Augen blitzte es auf wie von Kampfesmut; die Ruder aus dem Wasser ziehend, daß die Tropfen davon hochauf sprühten, richtete sie sich auf und sang mit einer Altstimme von seltener Klangfülle hinaus in die Weite:
»Das Heerhorn ruft und der Waffen Klang – $[ANDOP]$gt;Die Schlachtrosse wiehern mutig – Nun singt ihn wieder, den alten Sang Und schlagt euch die Köpfe blutig! Das Rote Banner mit silberner Faust In die erste Reih, das dem Feinde graust, Die Brücke nieder und auf das Tor: Die Seeburger vor!«
»Aber Schneewittchen! Was ist denn das für ein wildes Lied? Das hab' ich ja noch nie von dir gehört!« rief Gräfin Mirow, die mit immer größer werdenden Augen zugehört. »Ein Lied! Eine Rhapsodie ist's!« Fräulein von Seeburg lachte. »Ein Erbstück ist's aus unsern Familienpapieren, fein säuberlich auf Pergament aufgeschrieben«, sagte sie, wieder die Ruder ins Wasser tauchend. »Ich hab's gern, denn es klingt so, als ob wir mal Anno Dunnemals, vor Olims Zeiten, eine Burg besessen hätten, Ritter und Reisige. Kannst du mich dir als Burgfräulein vorstellen, Marie-Lu, Preise beim Turnier verteilend?«
»Sehr gut kann ich dich mir so vorstellen, Schnee!«
»Ah – nicht wahr, großartig hätte ich das gemacht! Ja, das Lied –
– »Das rote Banner mit silberner Faust – –« (das ist nämlich unser Wappen!) »In die erste Reih, daß dem Feinde graust, Die Brücke nieder und auf das Tor –«
Das deutet doch ganz klar an, daß dazu eine Burg, unsre Burg gehörte. Mein Vater wußte auch etwas darüber, aber er mochte nicht darüber sprechen und dann habe ich von ihm ein Dokument in einer runden Blechkapsel, aber mein Vater hat mir empfohlen, es nicht eher zu lesen, als bis ich älter geworden bin, damit ich mir im jugendlichen Übermut nicht Raupen in den Kopf setze, falsche Hoffnungen und was weiß ich noch! Also wird wohl auch etwas von der Brücke und dem Tor darin stehen –«
»Und das hast du wirklich bis jetzt nicht gelesen?«
»So wesentlich älter bin ich doch seitdem nicht geworden – ich bekenne mich auch schuldig, daß ich gern noch zu falschen Hoffnungen neige«, war die nachdenkliche Antwort. »Und das Dokument ist greulich unleserlich geschrieben und ich hatte niemals Zeit. Sonntags? Ach, Sonntags war ich immer müde und hab' lieber auf der harten Schulbank in der leeren Klasse geschlafen, als mich mit dem Entziffern falscher Hoffnungen abgeplagt?«
»Ich möchte wissen, ob deine Familie mit den Seeburgs verwandt ist oder im Zusammenhange steht, die in Süddeutschland angesessen sind«, sagte Gräfin Mirow.
»Seeburgs in Süddeutschland? Von denen habe ich ja niemals etwas gehört!« rief die Gefragte erstaunt.
»Oh, das ist ein großes Haus, das herrliche Besitzungen haben soll. Reichsunmittelbar, weißt du, – also hoher Adel, der den regierenden Häusern ebenbürtig ist. Der Chef führt noch den alten Titel: ›Pfalzgraf‹ und seine Frau ist eine entfernte Tante von mir –«
»Was ist denn das, eine entfernte Tante?«
»Oh, – nicht meiner Mutter Schwester, sondern eine ihrer Kusinen im dritten Gliede, – wie soll man denn solche Dame anders nennen, als Tante?«
»Ja, ich weiß – Tante ist so eine Art Sammelname für alle möglichen unangenehmen weiblichen Verwandten. Also eine Tante von dir ist die Pfalzgräfin von Seeburg! Mein Vater hat nie von diesen anderen Seeburgs gesprochen. Nie! Ob er gewußt hat, daß sie existieren? Weißt du, welches Wappen sie haben?«
»So ungefähr. Der Schild ist geteilt; oben einen eisernen Handschuh, wegen Seeburg –«
»Zur Faust geballt?«
»Ich weiß nicht recht, – doch, ja! Eine eiserne Faust! Oder eine silberne – und unten einen silbernen Berg mit einer goldenen Sonne darüber auf blauem Grunde – wegen Sonnenberg. Seeburg und Sonnenberg.«
»Seeburg-Am See. Ob das Schloß der Pfalzgrafen wohl an einem See liegt?«
»Ich war nie dort. Aber gewiß liegt es an einem See – es hat wohl daher seinen Namen. Ich kenne auch meine Tante nicht außer durch ein paar Briefe, die wir hin und wieder gewechselt. Sie sollen eine sonderbare Rasse sein, die Seeburger.«
»Nun, damit können wir auch aufwarten«, rief Fräulein von Seeburg lachend. »Wir haben alle möglichen Spezialitäten, die doch stark unter die Sonderbarkeiten rangieren. Da ist zuerst das bewußte Dokument mit den falschen Hoffnungen. Trotz diesen wird es aufbewahrt, wie die größte Kostbarkeit und mit einer Feierlichkeit von Generation zu Generation vererbt, als stünde ein Königreich in Frage. Dann das Lied, das dich eben in Erstaunen versetzt, Marie-Lu! Das wird uns Seeburger Kindern gelehrt, sobald wir nur eben sprechen können. Das heißt diese Strophe. Es ist noch eine andere da, die so unverständlich ist, wie ein modernes allegorisches Gedicht von Maeterlinck. Wahrscheinlich fehlen ein paar erklärende Strophen, die verlorengegangen sind.«
»Kennst du diese Strophe, Schnee?«
»Freilich kenne ich sie. Paß mal auf!« Und auf die Ruder gestützt, bog sie sich vor und sang, das junge, schöne Gesicht mit den weit offenen dunklen Augen der Sonne zugewendet, auf eine eigene, erst eintönige und doch merkwürdig packende und aufregende Melodie, die sich in den letzten Zeilen zu einer verhaltenen, fast unheimlichen Kraft steigerte:
»Euch Seeburgern lacht nur ein Frühling! Nie Wird die Sonne euch blicken. Was andern der Sommer an Freuden lieh, wird im Schnee, im Schnee euch ersticken. Den Winter bringt jäh euch der uralte Schnee, Aus der Jugend ein Tag euch des Alters Weh, Bis Jungschnee kommt in der Sonnwendnacht – – Dann hofft – – und habt acht!«
»Wie seltsam. Aber ein Sinn ist da wirklich nicht drin«, meinte Gräfin Mirow mit einem leichten Schauer. »Es klingt fast wie eine Prophezeiung.«
»Nicht wahr? Der Prophet muß aber sehr zweiter Güte gewesen sein, denn von dem im Schnee erstickten Sommer haben wir eigentlich nie, in keiner Generation etwas gemerkt. Und das bringt mich auf die dritte unserer Eigentümlichkeiten: Es ist immer eins in der Familie ›Schnee‹ getauft worden.«
»Du hast mir immer einmal erzählen wollen, wie du zu diesem seltsamen Namen gekommen bist.«
»Er ist gar nicht einmal so selten – als Taufname. Als Rufname soll er in Spanien, in Italien, ja auch in Frankreich häufiger sein, als in Deutschland«, erwiderte Fräulein von Seeburg. »Du kennst ja die schöne Legende von Maria Schnee: wie der Papst Liberius und der römische Patrizier Johannes gleichzeitig in der Nacht vom 4. zum 5. August im Jahre 352 träumten, die Mutter Gottes träte an ihr Lager und befehle ihnen, eine Kirche auf der Stelle zu bauen, wo sie am folgenden Morgen frisch gefallenen Schnee finden würden. Der Papst wie der Patrizier suchten beide, ohne von ihren gleichzeitigen Träumen zu ahnen, am Morgen des 5. August und trafen sich auf dem Gipfel des Esquillin, wo sie das Wunder des frisch gefallenen Schnees fanden. Der Papst zeichnete mit seinem Stabe die Umrisse der Kirche in den Schnee, der Patrizier übernahm den Bau und die Kirche Santa Maria Maggiore del Neve steht heut noch in Rom – ich wollte, ich könnte sie sehen!«
»Wir wollen im Herbst hinfahren, Schnee!« rief Gräfin Mirow. »Ich kenne Rom ja auch noch nicht.«
»Im Herbst! Denkst du denn, Marie-Lu, daß ich dir bis zum Herbst auf der Tasche sitzen werde?«
»Ich denk's nicht nur, ich hoffe es auch«, war die herzliche, fast bittende Antwort. »Aber davon können wir später reden. Jetzt sind wir, meine ich, bei den Sonderbarkeiten derer von Seeburg, speziell bei dem Namen Schnee. Du wolltest mir sagen, warum du so genannt bist.«
»Nicht etwa zum Gedächtnis der reizenden Legende, Marie-Lu, auch nicht zur Erinnerung an eine besonders verehrte Ahne dieses Namens, sondern, damit es nie in Vergessenheit kommt, daß irgendeine Dame dieses Namens den Seeburgs ein himmelschreiendes Unrecht zugefügt hat. Gerade sehr christlich finde ich diese Bestimmung nicht, aber darum ist sie doch peinlichst befolgt worden, denn mein Vater war, weil er keine Schwester hatte, selbst Carl Maria Schnee getauft worden. Nun, mit mir, die ich die letzte Seeburgerin bin, erlischt diese Bestimmung, die der Haß erfunden, ganz von selbst, denn ich glaube nicht, daß die sonderbare Erbschaft in der weiblichen Linie fortgesetzt werden muß. Dann, eine fernere Sonderbarkeit von uns Seeburgern ist der Ring, den ich trage –«
Schnee streckte ihre linke Hand aus und ließ das Juwel an ihrem Goldfinger in der roten Abendsonne funkeln. Der Ring wäre zu groß und zu massig für diese schlanke, rassige Hand gewesen, wenn er nicht so merkwürdig gepaßt hätte. Er war sicher sehr alt und bedeckte das ganze Fingerglied: ein länglich-viereckiger flach geschliffener Smaragd von fleckenloser Qualität, einem Feuer und einer Farbe, wie er selten nur vorkommt, ruhte in einer Goldfassung von einer Zeichnung und einer Arbeit, die den Ehrgeiz eines Benvenuto Cellini vor Neid hätte erblassen lassen. Das dunkle Gold dieser Fassung, die zweifellos orientalischen Ursprungs war, hob das grüne Feuer des Steines, in dessen Fläche einige fremdartige Charaktere eingeschliffen waren, zu wunderbarem Effekt, denn der Smaragd bekam dadurch etwas Persönliches, Lebendiges fast und sprühte den Glanz der Abendsonne zurück, als hätte sie ihr Licht von ihm geliehen, nicht er das seine von ihr.
»Du hast diesen Ring im Institute nie angelegt«. sagte Gräfin Mirow, indem sie den Ring mit einem Gemisch von Bewunderung und Abneigung betrachtete, deren sie sich selbst ganz unbewußt war. »Freilich, – ein so auffallendes Juwel –«
»Das auf die Hand einer großen Dame gehört, nicht an die einer armen Lehrerin«, vollendete Schnee Seeburg den abgebrochenen Satz mit dem Tone der Selbstverständlichkeit, ohne Bitterkeit oder Schärfe. »Eben darum. Er ist auch ein Erbstück, dieser Ring, und wird oder wurde gehütet wie ein Kronjuwel. Das Glück der Seeburgs hängt davon ab, geht die Sage. Mein Vater hat ihn auch getragen –«
»Und da ist er dir nicht zu weit für deine schlanken Finger?«
»Nein, er paßt mir wie angegossen«, erwiderte Schnee, ihre Hand mit dem Ringe betrachtend. Und dann sah sie auf mit etwas wie von Staunen und Beunruhigung gemischtem Blick. »Jetzt, wo du mich darauf bringst, Marie-Lu, fällt es mir erst auf: Mein Vater zog den Ring von seiner starken, großen Hand – er war ja selbst ein so großer Mann – als er ihn mir übergab, ehe er starb – ganz ohne Mühe streifte er ihn von seinem Finger – und nun paßt er mir wie angemessen –«
»Es ist vielleicht der Zauberring, der Wunschring aus dem Märchen –«
»Es ist sehr sonderbar«, meinte Schnee kopfschüttelnd, indem sie den Ring betrachtete. »Und noch sonderbarer ist: ich habe ein Bild meines Großvaters, und darauf trägt er den Ring auf dem Zeigefinger! Und nie hat ihn der Goldschmied berührt zum Enger- oder Weitermachen. Es war nie eine Reparatur an diesem Ring nötig. Mein Vater zeigte ihn einst einem berühmten Archäologen, der ihm eine große Summe dafür bot: er meinte, der Ring wäre indischen Ursprungs aus einer sehr frühen Epoche und die Charaktere auf dem Smaragd deuteten auf brahmanische Formeln, die zu entziffern er leider nicht imstande war. Der Stein – ich liebe sein grünes Feuer – hat etwas so Sprechendes, nicht? Ich habe ja noch nicht viel Edelsteine in meinem Leben gesehen und weiß nicht, ob sie es alle so an sich haben, daß sie zu einem reden –«
»Aber Schnee, welcher Gedanke!« rief Gräfin Mirow halb lachend, halb ehrlich entsetzt. »Das fehlte noch, daß diese Steine zu einem sprächen!«
»So, also das tun sie nicht?« fragte Schnee verträumt. Dann muß es mit diesem Smaragd eine eigene Bewandtnis haben, denn er redet mit mir. Wenn ich im Institut mal Zeit hatte und allein war, dann habe ich mir den Ring vorgeholt und er hat mit mir gesprochen. Lach nicht, Marie-Lu –«
»Ich lache gar nicht. Das ist ja unheimlich –«
»Meinst du? Eigentlich hast du recht, aber ich habe nicht das Gefühl des Unheimlichen. Ich sehe alle möglichen Bilder an mir vorüberziehen und der Stein erzählt mir – was? Ich weiß es kaum mehr, denn ich habe später nicht mehr darüber nachgedacht – –«
»Schnee! Laß jetzt den Ring und fahre lieber fort mit der Aufzählung der Sonderbarkeiten Derer von Seeburg«, rief Gräfin Mirow mit einem leichten Schauer.
Ihre Gefährtin riß gewaltsam den Blick los von dem Smaragd und ihr weißes, schönes Gesicht verlor den Ausdruck des Gespannten, auf irgend etwas intensiv Lauschenden. Noch für einen Moment behielten die großen, Van-Dyck-braunen Augen den verträumten, verwirrten und halb erschrockenen Ausdruck, als ihr Blick aber auf das ängstlich-besorgte Gesicht der Gräfin fiel, da lachte sie hell auf und wenn sie ernst schon sicherlich schön war – lachend bekam das Gesicht einen unsäglichen Liebreiz von geradezu schillerndem Zauber.
Mit einer ihrer energischen Bewegungen ergriff sie wieder die Ruder, daß der leichte Kahn wie ein Pfeil über das Wasser flog.
»Sonderbarkeit Nummer vier der Seeburger ist, daß sie zu bestimmten Tageszeiten einen richtigen, ausgewachsenen Reckenhunger kriegen«, rief sie übermütig. »Und wenn wir jetzt nicht machen, daß wir heimkommen, dann können wir wieder ewig warten, bis man uns nachserviert, was die andern, pünktlichen Gäste übriggelassen haben. ›Hein?‹ Grässliche Redensart, dieses ›Hein?‹ hierzulande. Ich könnte den Leuten immer eine Ohrfeige geben, so oft ich's höre.«
»Es entspricht wohl genau unserm heimatlichen ›Hä?‹ Gebildete Leute sagen's aber doch hier wie da nicht.«
»Man muß es wenigstens hoffen, Marie-Lu, aber man muß auch darauf vorbereitet sein, den lieblichen Ton da zu hören, woher man ihn am allerwenigsten erwartet. Die vorausgesetzte Bildung macht einem oft so merkwürdige Überraschungen!«
Eine halbe Stunde kräftigen unausgesetzten Ruderns und die Damen konnten in den kleinen, wohlgeschützten Hafen neben der Schiffslände unterhalb des Grandhotels einfahren und ihr Fahrzeug dem Bootsmann übergeben. Dann stiegen sie hinauf zu der reizenden, blumen- und palmengeschmückten Terrasse und fanden, daß sie sich eilen mußten, wenn sie das Hors d'oeuvre ihres Diners noch rechtzeitig haben wollten, und Schnee erklärte sich sehr energisch dafür mit ihrem gesunden, nie verleugneten Appetit der Jugend, den das Rudern zum Hunger verschärft. Während also die Gräfin unter den Händen ihrer wohlgeschulten und gewandten Kammerzofe ihr Promenadenkleid mit einem Worthschen Schneiderwunder von grauem Chiffon mit schwarzen Spitzeninkrustationen vertauschte, besorgte Schnee Seeburg dasselbe Geschäft allein und bedeutend schneller, kaum einen Blick in den Spiegel werfend, weil ihre Augen hinaussahen auf den See und die Berge im Zauber der letzten Sonnenstrahlen.
»Und während solch ein Wunder draußen vorgeht, sitzt man in dem stickigen Saal da unten und muß die ewige ›fritture‹, den eisernen Bestand der Tischfolge aufriechen«, grollte sie und klopfte doch im nächsten Augenblick schon energisch an die Tür ihrer Freundin, um sie abzuholen. Und als sie darauf eintraten in den großen, eleganten, lichtgebadeten Saal und Platz nahmen an dem kleinen Tisch, an dem sie, wie alle zusammengehörigen Parteien im Hotel allein und abgetrennt von den übrigen Gästen, aßen, da sahen nur wenige auf die feine, vornehme Frau in dem Worthschen Schneiderwunder, das sicherlich eine Unsumme gekostet, aber alle sahen sie auf das große, schlanke Mädchen neben ihr im schlichten, einfachen weißen Voilekleide, das die leuchtende Haartracht auf ihrer weißen Stirn trug wie eine Kaiserkrone.
Und es war alle Tage dieselbe Sensation, wenn sie den Saal betraten, sei's zum Lunch im Hut und in der billigen Batistbluse, sei's zum Diner im Besten, was Schnee besaß. Dabei war sie sich's gänzlich unbewußt, daß ihr dieses leise Murmeln, das Kopfwenden, die vielen neugierigen, bewundernden und auch mißbilligenden Blicke galten. Sie setzte das, wenn sie es überhaupt bemerkte, auf das Konto ihrer Freundin und fand es ganz in der Ordnung und berechtigt, wenn man sie bemerkte als eine Prinzessin von Geburt, als die junge Witwe eines alten, weltbekannten Diplomaten, als seine steinreiche Erbin und als liebreizende und anmutige Frau. Die Gräfin Mirow, die in ihrer kurzen Ehe mehr von der Welt gesehen, als andere ihr ganzes Leben lang, sah sehr wohl den Eindruck, den die frappante Persönlichkeit ihrer Freundin überall machte, aber sie sah auch deren völlige Harmlosigkeit, ihre glänzende Unbewußtheit und hütete sich, eine Bemerkung fallen zu lassen, welche diese totale Harmlosigkeit ins Wanken bringen konnte, denn sie fand sehr mit Recht gerade diese einen der größten Reize von Schnee Seeburg. Nun hätte sie sich diesen vielen und oft recht wenig zurückhaltenden Blicken leicht dadurch entziehen können, daß sie sich und Schnee die Mahlzeiten oben in ihrem Salon servieren ließ, aber die Freundinnen waren übereingekommen, daß dies zwar sehr exklusiv und zurückhaltend, aber auch sträflich langweilig sei. Sie hatten ihre gegenseitige Gesellschaft so schon den ganzen Tag, und nach dem Grundsatz: Abwechslung ergötzt – zogen sie es vor, den Zusammenfluß der Fremden aller Nationen in dieser Riesenkarawanserei von einem Hotel im Speisesaal zu beobachten und über die einzelnen Personen und Gruppen ihre Beobachtungen und Vermutungen über Wer? Woher? und Was? anzustellen. Zwar wird dies Vergnügen durch das jetzt fast allgemein in den großen Hotels zur Anwendung gebrachte System des Servierens an separierten kleinen Tischen und Tischchen in etwas erschwert, aber es war doch immer noch amüsanter, als droben allein zu speisen. Vor unangenehmer und unerwünschter Nachbarschaft schützen die kleinen Tische ja sicherlich, aber sie berauben einen auch andererseits ebenso sicher der liebenswürdigen und angenehmen Bekanntschaften, die man an der Table d'hote oft machen kann und verurteilen gesellige und einer Ansprache bedürftige Naturen zu einem Schweigen und einer Einsamkeit, an der ihnen nicht das geringste gelegen ist.
»Wer ist sie?« das war die Frage, die sich immer wiederholte, sobald die beiden Damen erschienen.
»Der Rotkopf ist die Gesellschafterin der jungen Witwe, die es wahrscheinlich nicht bleiben will«, lautete die Auskunft der Mißgünstigen und der geborenen Klatschschwestern. »Eine Verwandte der Gräfin Mirow vermutlich«, die der Menschenfreundlicheren. »Eine arme Verwandte der Gräfin Mirow«, derer, die immer zuerst auf die Kleider der Leute sehen und längst die Schneiderrechnung der beiden in Gedanken verglichen hatten. »Eine Prinzeß inkognito«, die Naiven, deren ehrliche Bewunderung des Schönen, wo es ihnen begegnete, immer vor etwaigen weniger liebreichen Vermutungen Stellung nahm.
»Ob Prinzeß, ob Gesellschafterin – schön ist sie zum Schwärmen«, sagten die Künstler und die Laien, die das Aparte sahen und zu bewundern den Mut hatten.
»Viel zu auffallend für meinen Geschmack«, meinte der Neid, der sich ganz nackt nicht zu zeigen wagte.
»Hütet euch vor den Gezeichneten«, murmelte der unverhülltere Neid und der ganz nackte sagte: »Gefärbte Haare, natürlich! Kokottenmode. Und der Teint ganz käsig.«
»Als ob gefärbtes Haar je diesen Glanz hätte«, nahm sich die Bewunderung in ehrlicher Entrüstung der Verteidigung an. »Ja, wenn Sie diese milchweiße Haut ›käsig‹ nennen, was würden Sie dann erst sagen, wenn das Mädchen knallrote Backen hätte.«
»Aber rotes Haar und schwarze Augen sind so unnatürlich. Kunst!«
»Die Augen? Vielleicht haben Sie das Geheimnis, wie man Augen färbt – die Haare sind bestimmt Natur –«
Und so weiter. Wo die Sonne am hellsten scheint, sind die Schatten immer am tiefsten und wo die Schönheit zweifellos ist, da wird sie allemal am stärksten bekrittelt, am meisten bezweifelt. Das ist nun einmal nicht anders und wird auch nicht anders werden, so lange die Menschen nicht andere werden. Viele macht's ja glücklich, das Kritteln, Nörgeln und Hecheln, aber glücklicher sind doch die, so es nicht zu hören brauchen. Wenn nur der Zwischenträger nicht schon unterwegs wäre auf den Siebenmeilenstiefeln seines Vergnügens, den Sack voll Kränkung, Neid und Haß an seine richtige Adresse zu befördern; aber der schläft nie. Nie!
Und dann fanden sich auch Leute, aber wenige, welche die beiden Damen persönlich kannten, gelegentliche Bekanntschaften, die aber doch etwas nähere Auskunft geben konnten, Leute, die zu den großen Routs bei dem Botschafter eingeladen worden waren, denen der Verstorbene beim Empfange die Hand gegeben mit seinem liebenswürdigen Diplomatenlächeln, Leute, deren Kompliment die Gemahlin des Botschafters mit einem verbindlichen Neigen des Kopfes quittiert, und die sie vielleicht gefragt hatte, »wie es ihnen ginge«, folglich also Personen, die über Person, Verhältnisse und Charakter der Gräfin Mirow die allerkompetenteste und zuverlässigste Auskunft geben konnten. Und das taten sie denn auch aufs ausgiebigste bei ihrem dankbaren Publikum. Unterwegs, also auf dem allgemeinen Verkehrswege zwischen Clarens und Territet, besonders in Montreux, begegneten die Damen auch Leuten, welche sich zweimal nach ihnen umsahen, weil sie in »der Roten« die Tochter des Generals von Seeburg erkannt hatten; ein Offizier des Regiments, das der Verstorbene kommandiert, kam dabei an sie heran und erkundigte sich nach ihrem Befinden, wurde der Gräfin Mirow vorgestellt und von Schnee in harmloser Freude nach allen alten Bekannten ausgefragt. Aber der Offizier konnte den Fremden im Grandhotel leider keine Auskunft geben, weil er in einem billigeren Hotel in Vevey wohnte; sie trafen ihn dann noch einmal auf dem Dampfschiff und damit war ihr ganzer Verkehr während eines monatelangen Aufenthaltes in Territet erledigt, denn die sich auf die Intimen des Hauses Mirow aufspielten, hatten denn doch nicht die genügende Frechheit, sich persönlich der jungen, so zurückgezogen und zurückhaltend lebenden Witwe aufzudrängen.
»Bist du müde, Marie-Lu?« fragte Schnee Seeburg beim Dessert, ihrer Freundin zusehend, wie diese auf ihrem Teller einen »Japonais« zerbröckelte, worunter man sich aber nicht einen echten Japaner vorstellen darf, sondern einen köstlichen Kuchen, der eine Spezialität der Konditoreien am Genfer See ist und für den die Gräfin Mirow eine unleugbare Schwäche entwickelt hatte.
»Müde? Ich? Wovon denn? Weil ich zugesehen habe, wie du gerudert hast?« fragte sie, aufsehend. »Ich bitte dich, Schneewittchen! Da habe ich wirklich in Gedanken den ganzen Japonais zerkrümelt – ich habe nämlich bei unserer Heimkehr vorhin Briefe vorgefunden –«
»Briefe, die du erwartet hast?«
»Im Gegenteil, Briefe, die ich am allerletzten erwartet hätte«, erwiderte Gräfin Mirow mit einer an ihr ganz fremden Irritation, mit einem kleinen, fast unhörbaren Seufzer, und einem Ausdruck, der etwas Pathetisches hatte, setzte sie hinzu: »Briefe, die man erwartet, kommen selten, oder – – nie.«
»Man kann sie zwingen, zu kommen: durch Gedanken-Telegraphie«, sagte Schnee, mit sichtlichem Genuß ihrem Japonais zusprechend. »Ich habe davon gelesen; ein französischer Gelehrter – ich weiß seinen Namen nicht mehr – hält das nicht nur für möglich, sondern für direkt erwiesen. Du brauchst nur die Fähigkeit zu besitzen, deine Gedanken voll und ganz auf die Person zu konzentrieren, von der du einen Brief haben möchtest und der Gedanke durchfliegt den Raum wie ein Telegramm ohne Draht bis in das Gehirn der Person, die man gemeint. Die Person aber bildet sich natürlich ein, daß sie selbst den Gedanken gehabt, den Brief schreiben zu wollen. Ist das nicht wunderbar? Es frägt sich nur, ob es sich die Anstrengung der Gedankenkonzentrierung lohnt, ob der Brief auch das bringt, was man darin erwartet.«
»Ja natürlich – darauf kommt es wohl an«, murmelte Gräfin Mirow mit in die Ferne verlornem Blick.
»Sehr in Begeisterung versetzt scheinen dich die unerwarteten Briefe nicht zu haben«, meinte Schnee, indem sie, dem Beispiele ihrer Freundin folgend, die Serviette neben ihren Teller legte und so tat, als ob sie ihre Handschuhe anziehen wollte.
»Zu dem Zweck sind sie aber sicherlich geschrieben worden«, erwiderte Gräfin Mirow aufstehend. Als sie jedoch mit Schnee hinaustrat auf die Terrasse, auf der das elektrische Licht siegreich gegen den Mondschein stritt und ein babylonisches Sprachengewirr ebenso siegreich gegen Abendfrieden, Stimmung und intellektuellen Genuß zu Felde zog, da kehrte sie auf dem Fuße wieder um.
»Das halte ich heute nicht aus«, erklärte sie. »Schon das Diner da drinnen machte mich oft ganz desperat – ich wäre am liebsten davongelaufen. Die Briefe – sie haben mich gegen den Strich gebürstet, figürlich gesprochen, Schnee.«
»Ich kenne das, wenn man gegen den Strich gebürstet wird«, nickte Schnee voll Sympathie. »Alle Haare sind einem sozusagen dadurch gesträubt. Und die Zähne werden einem stumpf, und man fühlt sich miserabel. Weißt du was? Gehen wir noch etwas spazieren nach Chillon zu, das im Mondlicht ja einzig schön sein muß! Ein großartiger Gedanke, nicht? Und wenn wir müde werden, dann fahren wir mit dem elektrischen Tram zurück, oben auf dem Verdeck –« Gräfin Mirow mußte nun lachen. »Aber Schnee«, rief sie, »im Tram – was fällt dir ein!«
»Gott, tu doch nicht, Marie-Lu!« entgegnete Schnee mit sehr übermütig blitzenden Augen. »Du bist schrecklich gern im Tram gefahren, als wir noch im Institut zusammen waren und wenn's die Tante Vorsteherin nicht wußte. Damals ist deiner Durchlaucht damit nicht zu nahe getreten worden, wenigstens nicht, daß ich wüßte, und heute wird's ihr samt deiner Exzellenz auch nichts machen. Denn erstens sind wir hier in einem Lande, wo jeder machen kann, was er will, so lange es anständig ist, und zweitens fehlt den Leuten auch ganz das Verständnis dafür, daß eine Durchlaucht nicht das tun könnte, was alle Welt hier tut. Ich will dir aber zugeben, daß sowohl das Herauf- wie besonders das Herunterklettern vom Verdeck des Tram ein Vergnügen für die untern Passagiere ist, womit man als ›Exzellenz‹ sparsamer umgehen muß, als unsereins zum Beispiel es nötig hat.«
»Ich fürchte, man darf den Leuten dies Vergnügen in meiner Lage überhaupt nicht machen«, lächelte Gräfin Mirow. »Du hast gut reden, Schnee, daß man hier tun darf, was man will! Laß es bloß einmal etwas sein, das von meiner Linie abweicht, so kannst du Gift darauf nehmen, daß auch schon die Zeugen zur Stelle sind, die daheim erzählen: denken Sie nur, diese Mirow ist in Montreux immerfort auf dem Tram gefahren mit Krethi und Plethi zusammen –«
»'s ist doch besser, die Leute erzählen solche unschuldige Tatsachen, als sie erfinden sich irgendeine Niederträchtigkeit«, sagte Schnee mit Überzeugung. »Natürlich, daß wir hier mit italienischen Arbeitern und einheimischen Rüpeln im Tram Preßwurst spielen, das ist ja klar, aber wenn's dich sonst nicht geniert, dann kann's andern doch lange schon egal sein. Zum Vergnügen würde ich auf dem hiesigen Tram gewiß nicht fahren, denn die Wagen sind eng und niedrig, die Perrons klein und unbequem und das ganze Vehikel stößt und schaukelt, daß einer die Seekrankheit davon kriegen kann. Aber schließlich: schlecht gefahren ist, wenn man müde ist, immer besser, wie gut gelaufen. Wie steht's nun mit unserer Promenade?«
Gräfin Mirow war, durch die Kontroverse entschieden angeregt, mit Vergnügen dazu bereit, und nachdem die Damen Hüte aufgesetzt, schlenderten sie auf die Straße, nach Chillon hinaus. Ein einsamer Weg ist das nun freilich nicht, denn er ist der einzige für den ganzen Verkehr und wenn auch um diese Stunde keine Lastfuhrwerke mehr mit ihren peitschenknallenden Kutschern auf der immerhin schmalen Landstraße dahinrasselten, so gab's doch noch Fußgänger, heimkehrende Radler und staubaufwirbelnde, luftverpestende und ohrenbetäubende Automobile genug, um den Weg zu einem recht belebten zu machen. Wenn man aber keinen andern hat, dann nimmt man eben alles das mit, dem man nur durch ein Daheimbleiben entgehen kann, und freut sich trotzdem an dem einzig schönen Bilde, das sich einem bietet, wenn man die Häuser hinter sich hat und Chillon vor einem liegt, umspült von den raunenden Wassern des Leman, überragt von dem gezackten Kamm der Dent du Midi, um die das Mondlicht einen silbernen Schleier spinnt, der auch die andern Berge und die fernen Ufer geheimnisvoll umhüllt mit durchsichtigem Duft, während es auf dem leichtgekräuselten Wasser tanzt, daß es aussieht, als hätte eine verschwenderische Hand den See mit Goldflittern bestreut. Und wenn ein Maler das malt und die Leute in den Kunstausstellungen der Großstädte, die nie dort waren, sehen es, dann sagen sie: das ist unnatürlich; solche Beleuchtungen gibt es nicht; ganz abgesehen davon, daß es ganz unmodern ist, solche altmodische Beleuchtungen zu malen. Nun passiert es aber selbst heutzutage noch den allermodernsten Menschen, daß sie die silbernen Schleier sehen, die der Mond über die Berge spinnt, aber wenn dann ein Übermaler mit ganz besonders großem Maule kommt und sie anbrüllt: Ihr Esel, nicht silbern ist das Mondlicht, sondern dreckfarben. Habt ihr denn keine Augen, ihr Ignoranten, ihr? –dann salaamen sie in ihres Nichts durchbohrendem Gefühle an allen Gliedern zitternd, daß man sie für ungebildet halten könnte, und schwören allegesamt zu dem dreckfarbenen Monde der Übermaler, über die unser Herrgott sich doch eigentlich krank lachen muß.
Ich hoffe, er tut's!
Die beiden Freundinnen wandelten ziemlich schweigsam bis nach Chillon herab, dann hinter den tiefschwarze Schatten werfenden Mauern am wassergefüllten Wallgraben der Landseite entlang noch ein Stückchen nach Villeneuve zu und auch hier wandelten in Gruppen viele der Gäste des halbwegs liegenden Hotel Byron, um ihre »Promenade de digestion« nach dem späten, substantiellen ›Dinner‹ zu machen. Byron hatte recht: vom Ufer gesehen ist Chillon auf dieser Seite am malerischsten, denn nur von hier kann man die mächtige Ausdehnung der historischen Wasserfeste ahnen. Zwar fehlt die Dent du Midi von diesem Punkte als des Bildes Krönung, und darum findet man auch selten photographische und malerische Aufnahmen dieser Seite, aber den Riesen mit seiner charakteristischen Form ersetzen hier die vielschönen Berge des Savoyer Ufers und die große Fläche des Sees selbst. Auf einem Steinhaufen, der am Ufer lag, setzten die beiden Damen sich wie auf Verabredung hin und sahen lange schweigend hinaus auf das Wasser, auf dessen leichtgekräuselter Fläche das Mondlicht einen phantastischen Tanz ausführte. Schnee sah sehr wohl, daß ihrer Freundin inneres Gleichgewicht im Wanken war und störte mit keinem Worte den Prozeß des Aufruhrs in dieser sonst so ruhigen Seele, die etwas vom Noli me tangere hatte, so lange das Bedürfnis, sich mitzuteilen, noch nicht reif in ihr war. Das konnte Tage dauern oder auch nur Stunden, wie heut zum Beispiel, denn nach einer Weile sagte Gräfin Mirow mit einem leisen, kurzen Lachen, das in einem Tone erstarb, der wie ein Schluchzen klang:
»Sie wollen mich schon wieder verheiraten, Schnee!«
»Wollen sie? Wie rührend!« erwiderte Schnee lachend. »Wer sind denn diese ›Sie‹!«
»Dieselben, die Himmel und Erde in Bewegung setzten, um mir die Äbtissinnenstelle in dem Damenstift in Dingsda zu erkämpfen, womit sie mich mit Anstand und für immer losgeworden wären, und dann mit Dankeshymnen auf die Knie fielen, als mitten in diesem heißen Bemühen Graf Mirow erschien und um mich warb. Ich war achtzehn, er fast siebzig, – folglich die passendste Partie, die man sich denken konnte und darum redeten sie mir auch zu, wie einem Schafe, das Medizin nehmen soll«, sagte Marie-Luise mit leisem Schwanken ihrer sonst so ruhigen, klangvollen Stimme. »Nun«, fuhr sie noch etwas unsicherer fort, »der Greis, der über den Sommer hinweg die Hand nach dem Frühling ausgestreckt, hätte schlimm sein können, aber er war der liebste alte Mann, den ich noch kennen gelernt, ein Gentleman, der mich jeden Tag, den ich von ungefähr achthundert, die ich in seinem Hause verlebt, die Ehre und Dankbarkeit fühlen ließ, die ich ihm erwiesen, indem ich, – nicht einmal freiwillig, sondern nur auf einfach nicht mehr auszuhaltendes Zureden – seinen Namen, sein Haus, seinen Reichtum und seine ritterliche Behandlung angenommen! So war er, Schnee, und noch viel mehr: Freund, Vater, Berater, Bruder, alles in einer Person. Ich werd' ihn nie vergessen in diesen Eigenschaften, nie anders als mit Dankbarkeit des seltenen alten Mannes gedenken. Aber daß er so war, davon hatten ›sie‹ keine Ahnung. Wäre er ein notorischer Lump gewesen, ein moralischer, nota bene – sie hätten mir ebenso zugeredet, ihn zu nehmen, weil er ja so schweres Geld hatte. Sie haben schon bald, nachdem ich Witwe geworden war, angefangen anzudeuten, daß ich zu jung zum Alleinsein wäre und heut sind ›sie‹ nun offen damit herausgerückt, daß es ›ganz unpassend‹ für mich ist, das Alleinsein nämlich, weil ich reich bin, und daß ein ›natürlicher‹ Beschützer eine dringende Notwendigkeit für mich wäre. Der Beschützer ist auch schon auf Lager und wird mir mit einer Deutlichkeit gestochen, die eigentlich zum Lachen wäre, wenn man sich nicht darüber totärgern müßte –«
»Das fehlte gerade noch, Marie-Lu – bleib' du nur beim Lachen, das ist das einzig Richtige dabei«, fiel Schnee ein, indem sie mit gutem Beispiele vorausging. »Den Luxus des Lachens kannst du dir doch weiß Gott in diesem Falle gönnen! Hängst du von den Leuten noch ab? Nein! Stehst du unter ihrer Vormundschaft? Wiederum: Nein, sintemalen du seit einem Jahre majorenn bist, ganz dein eigener Herr und nur dir selbst verantwortlich für deine Entschlüsse. Hast du moralische Verpflichtungen gegen die, welche dich von ihrer Tasche und aus ihrem Hause abgeschoben haben an den ersten Bieter auf deine Hand, ohne zu fragen, ob es zu deinem Glücke ist oder nicht? Dies dritte ›Nein‹ kannst du gleich auch dreimal sagen. Also, da lach' doch und schreibe: ›Ihr seid zu freundlich, aber wenn ich heirate, was ich gar nicht verreden will –‹
»Doch, Schnee, doch –«
»I, woher denn! Niemand soll etwas verreden in diesem Leben, das habe ich an mir gesehen. Also – wo war ich denn? Laß mich doch ausreden, Marie-Lu! Richtig! Also: Wenn ich heirate, was ich gar nicht verreden will, so werde ich mir meinen künftigen Eheherrn ganz alleine aussuchen, – diesmal – und lehne mit Dank, aber ein für allemal, die Kandidaten ab, so auf eurer Liste stehen. Oder, wenn dir der Mut für dieses Schreiben fehlt, dann sag gar nichts und wenn der Auserwählte auf der Bildfläche erscheint, dann gibst du ihm einen Korb und damit basta. Heißt das, wenn du ihn wirklich nicht magst.«
Gräfin Mirow lachte wieder leise, aber diesmal klang's ganz natürlich und frei.
»Du bist eine Perle, Schnee«, rief sie heiter. »Wenn ich dich nicht hätte, was täte ich dann? Ich ließe mich wieder einschüchtern. Aber du hast ja so recht! Ich werde beides tun, schreiben und den Korb geben –«
»Man sachte mit die jungen Pferde, Marie-Lu, und das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet«, bat Schnee inständig. »Den Brief will ich dir sogar schreiben helfen, denn im Schwingen von passenden Reden bin ich dir über, magst du sagen, was du willst. Aber den Korb darfst du nicht ohne weiteres schon jetzt flechten und adressieren, denn wenn der Kandidat dir gefällt –«
»Das kann er schon, aber ich nehme ihn doch nicht –«
»Ja, wenn du eigensinnig sein willst –«
»Das bin ich nicht, Schnee, aber –«
»Aber?«
»Aber – wenn nun kein Platz mehr für ihn da ist –«
Sie brach kurz ab und Schnee sagte nichts. Sie rückte nur etwas näher heran auf den harten Steinen und streichelte leis die Hand Marie-Luisens – dann, als hätte sie damit schon eine Indiskretion begangen, rückte sie wieder zurück auf ihren Platz und sagte, als ob das Intermezzo überhaupt nicht stattgehabt hätte, sehr vergnügt und leicht:
»Haben sie dir den Kandidaten auch schon namhaft gemacht in ihrer Gründlichkeit?«
»Nun, nicht gerade mit dürren Worten, aber wie die Katze um den heißen Brei geht, so sind sie in dem Briefe doch so glorreich auf dem Kernpunkt gelandet, daß ich harmloser sein müßte, als ich stellenweise bin, wenn ich darüber weg gelesen hätte«, sagte Gräfin Mirow mit einem dankbaren Blick. »Sie erzählen mir so beiläufig nach der Eingangs-Homilie, daß ein entfernter Vetter von mir über Montreux reist und sich mir vorstellen wird – Personalbeschreibung und Leumundszeugnis sind gewissenhaft beigefügt nebst der ›vertraulichen‹ Mitteilung, daß seine Eltern nichts dringender wünschen, als seine Vermählung mit einer Frau, die ›so wie du, liebste Marie-Luise, im Feuer des Lebens geprüft und für echt befunden worden ist‹. Soll ich mich geschmeichelt fühlen, Schnee?«
»Und den Chauffeuren dieses Feuers eine Adresse stiften«, murmelte Schnee.
»Ja, und dann wurde mir, wieder ›vertraulich‹, die Versicherung gegeben, daß der betreffende junge Mann sich dem Wunsche seiner Eltern geneigt zeige, daß er aber das Wählen und Freien für zu langweilig erklärt hätte, hingegen sich herablassen wollte, sich persönlich zu überzeugen, ob unter den für ihn aufgestellten Kandidatinnen sich ›was Vernünftiges‹ befände –«
»Der Mensch muß ja ein Original sein – das ist ja zum Begraben!« jubelte Schnee. »Wenn du dessen Besuch abweist, dann sind wir geschiedene Leute, Marie-Lu, dann gönnst du mir eben kein Vergnügen mehr. Den muß ich kennen lernen!«
»Wirst du auch ohne diese furchtbaren Drohungen«, lachte Gräfin Mirow ganz angesteckt von dieser Heiterkeit. »Wenn er nämlich nicht schon da ist, dann wird er wohl morgen ankommen, denn – höre und staune – seine eigene Mutter meldet mir ihn in dem zweiten der unerwarteten Briefe an mit der evidenten Flunkerei, daß dieser liebe Hans-Georg bei, ich weiß nicht wem, eine Photographie von mir gesehen und seitdem keinen anderen Wunsch hat, als mich persönlich kennen zu lernen und mir die Hand zu küssen. Ein reizender Brief übrigens, aber dank dem andern merkt man darin die Absicht und wird verstimmt. Ohne den andern hätte ich das Bonbon ahnungslos und mit Vergnügen verschluckt. Ja, und bei dieser originellen Gelegenheit wirst du, Schnee, einen Namensvetter von dir kennen lernen, denn der junge Mann, der mich daraufhin ansehen will, ob ich ›was Vernünftiges‹ bin, ist kein anderer, als Hans-Georg, Erbgraf von Seeburg- Sonnenberg.«
»Sehr interessant«, nickte Schnee. »Vielleicht findet sich doch ein Verbindungsglied zwischen unseren Familien. Und wenn sich keins findet, dann schadet es auch nichts. Du, diese ganze Geschichte ist doch eigentlich die reine Kartoffelkomödie. Dies Anbandeln ist ja himmlisch! Suchen wir nun aber das Leitmotiv, – deine Photographie, in die sich besagter Erbgraf verschossen haben will, als eine notwendige Flunkerei der Frau Mutter vorläufig beiseite stellend, – was bleibt dann? Die Notwendigkeit für den Herrn Erbgrafen, sich eine reiche Erbin zu suchen?«
»Das ist's ja eben, was mir bei der ganzen Sache unerklärlich ist«, erwiderte Gräfin Mirow nachdenklich. »Die Seeburgs gehören zu den reichsten Magnaten des Landes! Entweder also–«, sie hielt kopfschüttelnd ein.
»Nun, entweder, die Geschichte mit der Photographie ist eine Tatsache, was ich ganz gut begreife, oder – der Herr Erbgraf hat es fertiggebracht, ein tüchtiges Loch in den Reichtum zu machen«, ergänzte Schnee. »Das soll nämlich schon vorgekommen sein. Wenn einer sich Mühe gibt, bringt er in dieser Beziehung die fabelhaftesten Dinge zuwege. Mein Vater hatte in seinem Regimente einen jungen Offizier, der nicht eher ruhte, als bis er seine Eltern und Geschwister, die alle zu den Reichen des Landes gehörten, an den Bettelstab gebracht hatte. Dies besorgt, beehrte er eine Millionenerbin mit seiner unwiderstehlichen Hand, brachte auch deren Kapital durch, ließ sich von ihr scheiden, wie sie nichts mehr hatte, und nachdem er erfolglos noch eine Zeitlang als Bummelzug gewirkt hatte, schoß er sich tot. Ich will aber nicht um die Welt damit die Vermutung aufstellen, daß der Erbgraf ein ähnlicher Liebling der Götter sein könnte, sondern nur den Beweis geben, daß einer, wenn er sich Mühe gibt, schnell und sicher mit dem größten Reichtum fertig werden kann. Wenn also eine Verbesserung der Finanzen das Motto für den Freiersmann nicht sein kann, dann wird dein ›süßes Ich‹ wohl wirklich der Magnet sein, der ihn hierherzieht. In diesem Falle aber weiß ich wirklich nicht, ob's nicht ehrlicher oder ehrenhafter wäre, ihm mit dem Zaunpfahl abzuwinken.«
»Ganz meine Ansicht«, rief Marie-Luise, sich erhebend. »Ich will heute noch an meine Tante schreiben und ihr sagen, daß – daß wir abreisen und Hans- Georg uns nicht mehr hier antrifft. Das wird sie schon verstehen, denn sie soll eine sehr kluge Frau sein, die Tante Pfalzgräfin. Und damit man nicht sagen kann, daß ich geflunkert habe, so können wir ja morgen oder übermorgen noch, für eine Woche oder so, nach Caux hinauf. Es soll sehr schön dort sein und wir wollten es uns ja sowieso mal ansehen. Bist du damit einverstanden, Schnee? Trotzdem du damit um das Vergnügen kommst, deinen Namensvetter kennen zu lernen?«
»Der Mensch kann nicht alles in der Welt haben«, erwiderte Schnee lachend, indem sie auch aufstand. »Und schließlich: wer weiß, ob die Wirklichkeit dann auch dem vorher entworfenen Bilde entsprochen hätte. Enttäuschungen hinterlassen oft Wunden und darum ist's weiser, ihnen schon vorher aus dem Wege zu gehen. Aber Spaß beiseite: ich meine, dein Weg ist der einzig richtige, wenn – wenn der Kandidat wirklich und wahrhaftig keine Aussicht hat – –«
»Wirklich und wahrhaftig – er hat keine«, sagte Marie-Luise mit einer so ruhigen und dabei heitern Entschiedenheit, daß wirklich kein Zweifel mehr blieb.
Dann, sich zum Rückweg wendend, hing sie ihren Arm in den der Freundin, und nachdem sie schweigend einige Schritte gegangen, begann sie leise und stockend: »Der Mondschein verlockt zum Märchenerzählen – willst du eins hören, Schnee? Komm, dort am Wallgraben, im Schatten des Oubliettenturms steht eine Bank, wenn mir recht ist – wenn wir nun schon einmal auf eigne Faust bei Mondschein spazieren gehen, dann können wir auch im Schatten von Chillon den Zauber der Maiennacht ausprobieren. Siehst du, da ist die Bank! Im Graben gurgeln die Wasser und um das Schloß plätschern die Wellen und der Ahorn über uns raunt und rauscht und der Mond wirft so phantastische Schatten auf die Mauern und Türme und Türmchen – ein rechter Platz, um Märchen zu erzählen, nicht? Du mußt mich nicht so fragend ansehen mit deinen großen, schwarzen Augen, Schnee – es kommt nun eben manchmal so über einen, wenn das Herz zu voll ist – – also, paß auf! Mein Märchen fängt an, wie die Ballade von Heine vom alten König, der eine junge Frau nahm, und dann kommt natürlich auch der junge Page – – weil aber mein Märchen in der Gegenwart spielt, da kannst du dir andre Titel ausdenken und den Pagen Attaché nennen. Dann ist das Märchen ganz modern, aber sonst bleibt es ganz altmodisch. Ganz, denn die junge Königin war eine sehr anständige Frau und der blonde Page – er war wirklich blond, einer von denen, welche die Ehre, die Treue und die Dankbarkeit auf ihr Panier geschrieben haben und sie auch im Herzen tragen. Und weil sie beide – die junge Königin, wie der blonde Page, loyal waren und bleiben wollten, da trennten sie sich – –
Nicht lange darauf befiel den alten König die Krankheit, an der er binnen wenigen Tagen starb, die Hand der Königin in der seinen, und in seinem Nachlaß fanden sich zwei Briefe; der eine war an den blonden Pagen gerichtet und wurde an ihn ohne Verweilen ausgeliefert, der andere war an die junge Königin und darin stand, daß der alte König ihr Geheimnis gekannt und er stolz sei auf ihre Treue und ihre Festigkeit und sonst noch etwas, das auch in dem Briefe an den blonden Pagen geschrieben stand – – beide Briefe waren aber gleich nach dem Eindruck geschrieben, den die – Entdeckung des Geheimnisses auf den alten König gemacht und er hatte wohl kaum geahnt, daß sie so bald schon an ihre Adresse gelangen würden. Aber manchmal kommt mir so der Gedanke, als hätte ihn doch ein Ahnen beschlichen, daß seine Tage gezählt waren, warum wohl hätte er diese Briefe sonst gleich geschrieben?
Sie sahen sich ganz flüchtig, die beiden Adressaten, als der gute, alte König begraben wurde – ein Händedruck nur und dann gingen sie auseinander und haben nicht wieder voneinander gehört. Das kommt wohl so im Leben, daß Briefe, die man erwartet, nie eintreffen, entweder, weil sie verloren gingen, oder weil sie gar nicht geschrieben worden sind. Die Gründe, warum, sind von himmelweitem Unterschied der Bedeutung, aber in der Wirkung bleibt sich's gleich. Ganz gleich, Schnee, das kannst du mir schon glauben. Und darum könnte selbst ein Kaiser sich dessen erinnern, daß die ehemalige Prinzeß Marie-Luise von Eichwald ihm laut Brief und Siegel ebenbürtig ist – sie würde ihm ihre Hand doch nicht geben, denn wenn auch die Briefe, die sie erwartet, nie eintreffen, so wird sie doch darauf warten und sollte sie darüber alt werden. – Damit ist mein Märchen zu Ende.« – –
»Das glaub' ich nicht!« rief Schnee, die Hände zusammenschlagend. »Mir ist, als schwebte die junge Königin eben nur durch den leeren Raum, der des Märchens zweiten Abschnitt im Buche von dem dritten trennt, der mit den Worten schließt: Und sie feierten drei Tage lang eine glänzende Hochzeit und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. Du weißt aber, Marie-Lu, daß in den leeren Raum zwischen zwei Absätzen oft drei kleine Sternchen gedruckt werden. Es ist mir schon immer aufgefallen, daß es Sternchen sind, wenn die Geschichte gut schließt – schau mal da hinauf, über dem Donjon, da stehen grad' drei Sterne nebeneinander, wie ausgerechnet! An die Sterne mußt du dich halten, Marie-Lu!«
»Wenn sie nur nicht so weit wären!«
»Nun, dann spanne deinen Glauben vor, der wird dich über Raum und Zeit tragen«, sagte Schnee herzlich und mit Zuversicht. »Ich weiß nicht, warum, aber ich habe Vertrauen in deinen blonden Pagen und bilde mir ein, daß alle die Briefe, die du vergebens erwartetest, längst schon geschrieben in seiner Mappe liegen. Er wird nur nicht gewagt haben, sie abzuschicken, und vielleicht will er dir auch Zeit lassen – ich kann das alles ganz gut verstehen und mir vorstellen. Es gibt gewiß solche Charaktere. Mein Vater war zum Beispiel solch einer. Vielleicht sind sie ja nicht vornehmer, als die, welche sagen: Das Leben ist kurz und verlorene Tage kommen nicht wieder, – aber die Naturen sind eben so verschieden. Und darum warte du nur ruhig auf deine Briefe, Marie-Lu, und – schreibe heut noch an die Tante Pfalzgräfin.«