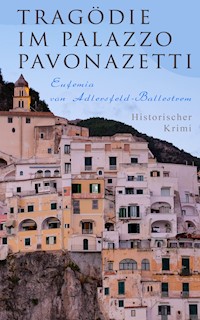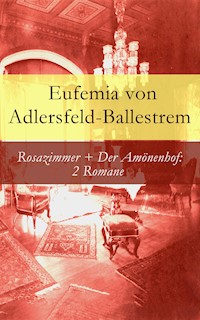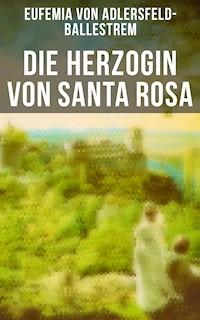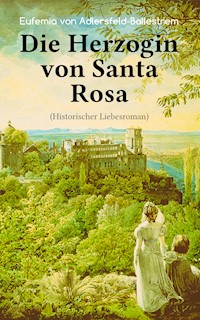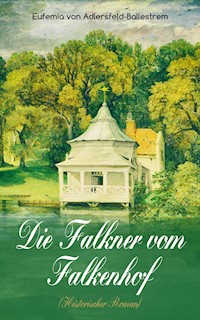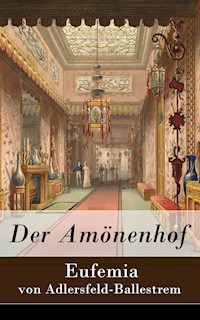
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Dieses eBook: "Der Amönenhof" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Anna Eufemia Carolina von Adlersfeld-Ballestrem (1854-1941) war eine deutsche Schriftstellerin. Um 1900 zählte sie zu den beliebtesten deutschen Unterhaltungsschriftstellerinnen. Aus dem Buch: "Friedrich XV., Herzog von Weißenfels, hatte seine Regierungsgeschäfte für heute erledigt, das heißt, er hatte seine schwungvolle Namensunterschrift unter ein halbes Dutzend Dokumente gesetzt und lehnte sich nun mit einem Gähnen in den bequemen Sessel vor seinem Schreibtisch zurück, das vielleicht unfürstlich, aber menschlich durchaus berechtigt war. Er durfte sich das gestatten, weil er sich allein in seinem Arbeitszimmer befand; er richtete dabei die Frage an das Schicksal, was er nun machen solle. Die durch seine Person vereinigten Herzogtümer von Weißenfels älterer und jüngerer Linie bezeichneten auf der Landkarte Deutschlands einen Flecken, den man bequem mit einem Fünfpfennigstück zudecken konnte; mithin war das "Regieren" derselben eine Arbeit, die sich im Maximalfalle über die Dauer einer Stunde pro Tag beim besten Willen nicht ausdehnen konnte. Die Residenzstadt mit ihrem imposanten Schlosse war ein kleines, verträumtes Nest, in dem das gesamte Militärkontingent des Landes in der Stärke eines ›Leib-Regimentes‹ Infanterie sein denkbar Möglichstes tat, um etwas Leben hineinzubringen. Der Hofstaat beschränkte sich auf wenige Hofchargen; die Empfänge im Schlosse waren Ereignisse, die sich unter dem Titel von zwei oder drei Hofbällen im Winter und ebensoviel Hofgartenkonzerten im Sommer in weiser Beschränkung abspielten. Man konnte also nicht behaupten, daß der Herzog und seine Gemahlin unter der Last ihrer Pflichten hätten zusammenbrechen müssen."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Amönenhof
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
Inhaltsverzeichnis
Friedrich XV., Herzog von Weißenfels, hatte seine Regierungsgeschäfte für heute erledigt, das heißt, er hatte seine schwungvolle Namensunterschrift unter ein halbes Dutzend Dokumente gesetzt und lehnte sich nun mit einem Gähnen in den bequemen Sessel vor seinem Schreibtisch zurück, das vielleicht unfürstlich, aber menschlich durchaus berechtigt war. Er durfte sich das gestatten, weil er sich allein in seinem Arbeitszimmer befand; er richtete dabei die Frage an das Schicksal, was er nun machen solle. Die durch seine Person vereinigten Herzogtümer von Weißenfels älterer und jüngerer Linie bezeichneten auf der Landkarte Deutschlands einen Flecken, den man bequem mit einem Fünfpfennigstück zudecken konnte; mithin war das »Regieren« derselben eine Arbeit, die sich im Maximalfalle über die Dauer einer Stunde pro Tag beim besten Willen nicht ausdehnen konnte. Die Residenzstadt mit ihrem imposanten Schlosse war ein kleines, verträumtes Nest, in dem das gesamte Militärkontingent des Landes in der Stärke eines ›Leib-Regimentes‹ Infanterie sein denkbar Möglichstes tat, um etwas Leben hineinzubringen. Der Hofstaat beschränkte sich auf wenige Hofchargen; die Empfänge im Schlosse waren Ereignisse, die sich unter dem Titel von zwei oder drei Hofbällen im Winter und ebensoviel Hofgartenkonzerten im Sommer in weiser Beschränkung abspielten. Man konnte also nicht behaupten, daß der Herzog und seine Gemahlin unter der Last ihrer Pflichten hätten zusammenbrechen müssen.
Friedrich XV., ein junger Mann, gähnte nochmals, daß Fafner, der Lindwurm in der Neidhöhle, ein Waisenknabe dagegen war, streckte seine langen Beine länger aus und murmelte:
»Was tun, spricht Zeus? Hm – tja! – reiten? Wenn man nur nicht immer diesen langweiligen, steifleinenen Adjutanten mitnehmen müßte! Verdirbt einem die ganze Landschaft, der Mensch – – was? Schon gleich fünf Uhr? Na, da wird man erst mal bei Elisabethchen 'ne Tasse Tee pietschen und sich dabei mit der schönen Theo 'n bißchen raufen.«
»Elisabethchen« aber war die reizende junge Gemahlin des Herzogs, und die »schöne Theo«, ihre Freundin, Gräfin Theodora Zimburg, die eben auf Besuch anwesend war. Wenn der Herzog mit dem Epitheton ornans »schön« eine gewisse Bewunderung ausdrückte, so darf man daraus beileibe keine falschen Schlüsse ziehen; denn er meinte das ganz im platonischen und harmlosen Freundschaftssinne. Friedrich XV. hatte seine Gemahlin aus reiner Liebe geheiratet. Er hatte sie auf einem Hoffeste in Berlin gesehen und ohne zu ahnen wer sie war, sich sofort sterblich in sie verliebt. »Die oder keine!« hatte er sich beim Anblick der anmutigen jungen Dame im Gefolge der Kaiserin gelobt, und – »sie und keine andere« wurde seine Frau. Die Verbindung mit ihr als der Erbin der jüngeren Linie Weißenfels war zwar von seiner, der älteren Linie, schon diplomatisch stark angestrebt, aber von ihm, als der Hauptperson, durch passive Resistenz abgelehnt worden. Als er sich ihr vorstellen ließ und dabei erfuhr, daß sie die gemiedene Erbin der jüngeren Linie war, die eben ihren ersten Flug in die Welt wagte, erleichterte das zwar nicht ganz unwesentlich sein fürstliches Gewissen, aber im großen und ganzen war es ohne Einfluß auf seine Gefühle. Da sie zum Glück rückhaltlos von der jungen Erbin erwidert wurden, so stand der Wiedervereinigung der seit ein paar Jahrhunderten getrennten Linien durchaus nichts mehr im Wege, und es wurde eine glänzende Hochzeit auf dem Weißenfels, der Stammburg des alten Geschlechtes, gefeiert.
Herzogin Elisabeth hatte ihre Erziehung in einer klösterlichen, sehr gründlich betriebenen Anstalt genossen und sich dort eng an eine Mitschülerin, die schon genannte Gräfin Theodora Zimburg, angeschlossen, die Tochter eines Generals, welcher außer seinem Gehalt wenig oder nichts besaß, aber es doch ermöglicht hatte, seinem einzigen Kinde eine gediegene und treffliche Erziehung in jener Anstalt zuteil werden zu lassen. Die beiden Freundinnen verloren fast gleichzeitig ihre Väter, wodurch Prinzeß Elisabeth Herzogin von Weißenfels jüngerer Linie und Gräfin Theo eine recht arme Waise wurde, die eine steinreiche Pate zu sich nahm, um ihr nicht lange darauf ihr ganzes Vermögen zu hinterlassen.
Nachdem Herzog Friedrich XV. also zu dem erleuchteten Entschlusse gekommen war, sich zu einem Spazierritt durch eine Tasse Tee bei seiner Gemahlin zu stärken, läutete er, übergab dem wartenden Kabinettssekretär die unterzeichneten Dokumente, und nachdem er sich im Spiegel überzeugt hatte, daß der Scheitel seines welligen Haares nichts von seiner Schönheit eingebüßt hatte, begab er sich nach den Privatgemächern der Herzogin und liebäugelte unterwegs noch ein wenig mit seiner Miniaturensammlung, die jedem Museum zur Zierde gereicht hätte, denn jeder Mensch hat zum mindesten ein Steckenpferd. Herzog Friedrichs Liebhaberei waren die Miniaturgemälde. Die reichlich gefüllten und wohlgeordneten Kästen bewiesen, daß er den Sport mit Geschmack und Verständnis betrieb. Erfrischt und immer wieder neu begeistert von dem Anblick seiner Schätze, durcheilte er sodann rasch die übrigen Räume seiner Privatwohnung. Das Vorzimmer seiner Gemahlin betretend, winkte er dem Lakaien vom Dienst ab, durchkreuzte ein paar Empfangszimmer und öffnete, ohne zu klopfen, die Tür zum Privatissimum der Herzogin, die tatsächlich allein mit ihrer Freundin vor einem reichlich besetzten Teetisch saß, bei seinem Erscheinen aber mit dem Ausruf aufsprang: »Friedel, du? Na, das ist doch mal ein gescheiter Einfall von dir!«, ihm ungeniert um den Hals fiel und ihm gleichzeitig ein Stück Kuchen, das sie gerade in der Hand hielt, in den Mund stopfte.
»Mmm!« machte der Herzog, wider Willen kauend, indem er sich den Magen strich und dann der lachend daneben sitzenden Gräfin Zimburg die Hand gab. »Hat unser Koch das zuwege gebracht?«
»Hat er, so unglaublich es scheinen mag«, nickte die Herzogin vergnügt. »Theo hat ihm das Rezept gegeben und ich den Befehl, es zu machen. Aber der Gute ist wie Mephisto: Ich mußte es dreimal sagen. Unser Hofkoch ist fürchterlich bockbeinig, lieber Friedel!«
»Ist er, mein Herzel«, bestätigte Friedrich XV., und seufzend setzte er hinzu: »Seitdem ich dieses schöne Land regiere, wünsche ich mir Knackwürste mit Meerrettich, aber gekriegt habe ich sie noch nicht, und Seine Hoheit der Erbprinz ist schon über ein Jahr alt.«
»Vielleicht ist der Herr Leibkoch der Meinung, daß Knackwürste für die Tafel Eurer Hoheit eine zu gemeine Speise sind«, bemerkte Theo lachend. »Ich werde Hoheit ein Postpaket dieser Delikatesse nebst einer Stange Meerrettich schicken.«
»Gräfin, Sie sind ein Engel! Aber, bitte, unter meiner höchsteigenen Adresse, sonst sehe ich doch nichts davon!« rief der Herzog mit Begeisterung. »Indes«, setzte er hinzu, den Kuchenteller zu sich heranziehend, »wir sind doch gottlob mal hier unter uns, und da wär's wirklich nett, wenn Sie die »Hoheit« schießen lassen und mich bei meinem ehrlichen Namen nennen wollten, wie wir's doch ausgemacht haben, nicht?«
»Gewiß, ich habe nur Angst, daß ich mich vor dem Hofstaat mal verplappern könnte. Die Gesichter möchte ich sehen, wenn ich Sie ›Friedel‹ nennen würde!« lachte Gräfin Theo, und das herzogliche Paar versicherte, daß sie das auch gern möchte. »Meine beschleunigte Abreise wäre die nächste Nummer des Programms!« setzte sie hinzu.
»Ach, und ich habe mir solche Mühe – vergebens! – gegeben, dich ganz hier festzuhalten!« jammerte die Herzogin. »Da hätte man doch mal eine Seele, mit der man ungeniert schwatzen und lachen könnte!«
»Wenn ich wüßte, unter welchem Titel wir Sie hier festhalten könnten, ich würde ihn durch allerhöchste Verfügung umgehend schaffen. Ich weiß es aber nicht«, sagte der Herzog.
»Vielleicht als Palastdame«, schlug die Herzogin vor. »Das wäre zwar hier eine neue Charge –«
»Worüber die Hühner des ganzen Landes Lachkrämpfe kriegen würden«, fiel die Gräfin Theo lustig ein.
»Nun, was das betrifft: Ich habe vorhin durch meine Unterschrift den Posten eines Oberhofmarschalls geschaffen, über den man sich bei den großen Höfen auch nicht schlecht lustig machen wird«, meinte der Herzog. »Das wäre dann in einem! Aber ich bin auch Ihrer Ansicht, Gräfin: Elisabeth hat viel mehr von Ihnen, wenn Sie von Zeit zu Zeit als Gast zu ihr kommen. Das ist ein unbestreitbarer Titel für einen intimen Verkehr und Ihre Selbständigkeit würde überdies durch jede mit den Haaren herbeigezogene Charge leiden. Ich bilde mir nämlich ein, für Sie wäre jede Abhängigkeit einfach unmöglich.«
Gräfin Theo lachte zwar zu dieser Behauptung, aber sie seufzte auch ein wenig hinterher, und dieses Gemisch von Gefühlen machte sie nicht minder anziehend, als sie es ohnedem sonst schon war. Wenn der Herzog sie bei sich »die schöne Theo« genannt hatte, so hatte er wirklich kaum zu viel gesagt. Ihre Bewegungen waren von jener natürlichen Anmut, die kein Tanzlehrer der ganzen Welt eindrillen kann. Von vollendeter Schönheit waren ihre großen, grauen Augen, mit den goldenen Lichtern darin in ihrer Umrahmung tiefdunkler Wimpern und Brauen, und dem frischen, freien und fröhlichen Ausdruck; und wenn Gräfin Theo lachte und dabei die schönsten weißen Zähne zeigte, dann war sie einfach unwiderstehlich.
»Ja«, gab sie nach jenem kleinen Seufzer zu, »ja, ich bekenne gern, daß die Selbständigkeit etwas sehr Schönes ist. Und doch – hätte mich nach Vaters Tode die Pate nicht zu sich genommen und zu ihrer Erbin gemacht, so wäre ich jetzt auch ein Glied in der langen Kette abhängiger Wesen. Elisabeth, du erinnerst dich gewiß noch an unsere Mitschülerin, die niedliche kleine Anna von Ried? Wir nannten sie scherzweise ›das Lumperl‹, weil sie so arg brav war. Der ist's recht schlecht gegangen, denn ihr Vormund hat ihr ganzes Vermögen verspekuliert, und nun schlägt sie sich tapfer als Sprachlehrerin durch. Eine Hilfe nimmt sie nicht an, – sie ist stolz wie Luzifer. Ich habe vor, sie aufzusuchen, wenn ich von hier abreise.«
»Oh, dann grüße das liebe Lumperl recht herzlich von mir!« sagte die Herzogin warm. »Könnte man denn wirklich gar nichts für sie tun?«
Der Herzog meinte nachdenklich: »Ihnen, Gräfin, möchte ich Energie keineswegs abstreiten – im Gegenteil, ich glaube, Sie haben davon mehr als genug. Aber Sie in einer abhängigen Stellung – nein, das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Keine drei Tage hielten Sie darin aus. Entweder würden Sie Ihrem Brotherrn den Stuhl vor die Tür setzen, oder –«
»Oder ich würde an die Luft gesetzt werden!« vollendete Theo halb lachend, halb empört. »Ich danke Euer Hoheit untertänigst für Ihre gute Meinung, aber ich – ich wette dagegen!«
»Sie haben gut wetten, da Sie nach menschlicher Berechnung nie in eine solche Lage kommen werden«, versetzte der Herzog lachend.
»Man kann nie wissen, wie die Feste fallen«, entgegnete Theo leise. »Die arme Anna von Ried war auch ein sehr wohlhabendes Mädchen, und wenn mir zum Glück ja kein unredlicher Vormund mein Vermögen verpretzeln kann, weil die Pate mich beim Antritt ihrer Erbschaft schon mit zwanzig Jahren mündig erklären ließ, so gibt es doch noch viele andere Fälle, bei denen man sein Geld verlieren kann. Gesetzt, es ginge mir so und ich käme in die Lage unserer Freundin, dann würde ich es genau so machen wie sie.« »Keine Spur! Dann kämst du zu uns!« rief die Herzogin lebhaft.
»Ob zu dir oder zu jemand anderem, bliebe sich gleich. Nach der gütigen Meinung deines Herrn Gemahls würde ich dann entweder von ihm – nach drei Tagen schon – oder sonst von wem hinausgeworfen werden, falls ich nicht vorher schon davonliefe!« – Der Herzog wollte sich vor Lachen ausschütten.
»Ich würde die Perle meiner Sammlung, das Miniatur der Jane Seymour von Holbein, gegen einen faulen Apfel wetten, daß die Herrlichkeit bald ein Ende hätte.«
»Und ich wette dagegen mein Miniatur der Ahne Amöne Zimburg von Schöpfer, um das mich Hoheit unverhohlen beneiden!« gab Theo rot vor Entrüstung zurück.
»Ach ja, den ›Schöpfer‹ hätte ich freilich gern«, erklärte der Herzog begeistert. »Schade, daß diese Wette nichts ist wie ein schöner Traum.«
»Hoheit sind wirklich ein Gemütsmensch!« meinte Theo, wider Willen lachend.
»Ja nun, wenn man einem Sammler den Mund auch so wässerig macht!« entschuldigte sich der Herzog. »Das kommt mir vor, als wenn man einem Hunde eine Wurst so hoch vorhält, wie er nicht springen kann. Elegant ist der Vergleich zwar nicht. Warum müssen wir uns eigentlich immer raufen, Gräfin?«
Die Herzogin fiel vergnügt ein: »Du sagst aber auch immer Dinge, Friedel, die meine arme Theo einfach zu heller Wut reizen müssen.«
»Na, Wut ist ja etwas zu viel gesagt«, lachte Theo, indem sie mit Behagen in ein Stück Kuchen biß.
»Solange dieser Zustand appetitreizend wirkt, ist er ja noch ganz gesund«, neckte der Herzog, indem er sich erhob. »Nachdem wir also unser tägliches Pensum erledigt haben, muß ich mich jetzt empfehlen; denn ich will noch einen ergiebigen Spazierritt machen. Also, nichts für ungut, Gräfin! Ja, fast hätte ich's vergessen, Sie zu fragen, ob der Graf Leo Zimburg ein naher Verwandter von Ihnen ist.«
»Er ist nur ein Namensvetter«, erwiderte Theo. »Die beiden Zimburger Linien sind schon seit Olims Zeiten ganz voneinander getrennt, – verfeindet, muß man sagen, und ein wahrer Lindwurm von einem Prozeß hat das zuwege gebracht. Der ist gewissermaßen zum Familienerbstück geworden, das ich dem Namen nach mit übernommen habe; von unserer Seite aus ist er aber während der letzten Generation wegen Mangel an Mitteln schlafen gegangen. Ich kenne die Existenz des Grafen Leo nur aus dem Gothaischen Almanach, – persönlich bin ich ihm nie begegnet. Warum fragten Hoheit?«
»Nur einer Notiz wegen, die ich kürzlich in der Zeitung fand und dir, Elisabeth, immer mitzuteilen vergaß«, erklärte der Herzog. Die Ruine Zimburg, der Stammsitz dieses Geschlechtes, liegt nämlich in der Nachbarschaft von Schloß Weißenfels, der Wiege unseres gemeinsamen Hauses, wie du weißt, und zu ihren Füßen Schloß Amönenhof, der frühere Besitz von Leo Zimburg. Er hat ihn an einen Großindustriellen, den ›Stahlkönig‹ Reudnitz, verkauft.«
»Ist es möglich?« rief die Herzogin überrascht. »Wieder einmal ein alter Familienbesitz, der in die Hände eines Neureichen gefallen ist. Wie schade! Ich erinnere mich sehr gut des alten Grafen, der ja eine Zeitlang Staatsminister von Weißenfels jüngere Linie war; ich weiß auch, daß die Rede davon war, daß es um die Finanzen des Amönenhofes nicht sonderlich gut stünde, weil Graf Leo, der Sohn des Ministers, viel verbraucht haben soll. Es tut mir leid, daß es zum Verkauf des Besitzes gekommen ist. Was mag aus Graf Leo geworden sein?«
»Er hat den Abschied genommen. Mehr weiß ich auch nicht«, erwiderte der Herzog. »Ich habe ihn in Berlin natürlich kennengelernt; er war ein netter Mensch – im besten Sinne. Näher bin ich ihm nicht getreten; er stand ja bei einem anderen Regiment. Ja, es tut mir leid, daß er, wie so viele andere, auch verkrachen mußte. Daß die Nachricht vom Amönenhof dich interessieren würde, wußte ich, Elisabeth. Ich erinnere mich übrigens auch des reizenden Schlosses am See. So, und nun aber muß ich mich wirklich empfehlen. Auf Wiedersehen!«
»Und was fangen wir jetzt an?« fragte die Herzogin, als sie mit ihrer Freundin wieder allein war. »Laß mal sehen – in – hm – ja, in einer Viertelstunde muß ich eine Abordnung von Damen empfangen, die mich um die Übernahme des Protektorats eines Wohltätigkeitsbasars bitten will. Ich habe nichts weiter dabei zu tun, als die fein säuberlich auswendig gelernte Ansprache der Präsidentin anzuhören und ein paar Worte zu erwidern; die Sache ist also nur ein kurzer Schmerz. Man nennt das ›regieren‹, Theo, mein Schatz! Ist diese Pflicht erledigt, dann könnten wir uns auch einen Happen frischer Luft gönnen und eine kleine Ausfahrt machen, wenn's dir recht ist.«
»Sehr recht ist mir's«, erklärte Theo bereitwilligst. »Soll ich mich jetzt zurückziehen?«
»Bewahre, – das hat Zeit, bis die Korona mir gemeldet wird. Eigentlich drückt mich nämlich eine – nun ja, eine etwas indiskrete Frage, die ich gerade an dich richten wollte, als Friedel herein platzte.«
»Immer heraus damit; unter Freundinnen gibt es doch keine indiskreten Fragen«, ermunterte Theo lächelnd.
»Nun, ich weiß nicht –«, meinte die Herzogin zögernd. »Es gibt Dinge, in die man sich das Hineintappen besser versagen sollte. Indes – kurz und gut: Irgendein kleines Vögelchen hat mir zugezwitschert: ›Eine Jungfrau, reich und schön, will nicht allein durchs Leben gehn'‹, unter dem Hinweis, daß der dazu nötige andere Teil schon keine bloße Schattengestalt mehr ist.«
»Wenn man auf das alles hören wollte, was einem die bekanntlich sehr schwatzhaften ›kleinen Vögelchen‹ vorzwitschern, dann müßte man viel Zeit übrig haben«, fiel Theo abweisend ein, und weil sie dabei nicht rot, sondern blaß wurde, so zog die kluge Herzogin ihre Schlüsse daraus.
»Schade!« meinte sie enttäuscht. »Denn siehst du, liebes Herz, weil ich selbst doch so glücklich geworden bin, so wünsche ich dir so von ganzem Herzen das gleiche. Und man sagt, daß Baron Bergfried als Diplomat eine große Zukunft vor sich habe, daß er ein hervorragend kluger Mann ist und eine äußerst anziehende Persönlichkeit dazu.«
»Das alles ist nicht zu leugnen, aber – –« gab Theo zögernd zu. »Nun, ich will dir reinen Wein einschenken. Ich habe Baron Bergfried im Hause meiner Pate kennengelernt, wo er mich entschieden, sogar auffällig, ausgezeichnet hat; aber irgendein entscheidendes Wort hat er nie gesprochen. Die Pate erzählte mir, daß er nicht ganz mittellos ist, jedoch eben nur so viel hat, um sich damit in seiner diplomatischen Laufbahn zu halten; er hingegen wußte, daß ich ein armes Mädchen war, und mochte wohl auch gehört haben, daß die Pate ihren Reichtum einer Stiftung hinterlassen würde, was sie auch selbst überall erzählt hat, ehe ich zu ihr kam. Kein Mensch, ich am allerwenigsten, konnte vermuten, daß sie mich zu ihrer Universalerbin einsetzen würde. Als das aber bekannt wurde, trug Baron Bergfried mir seine Hand an, und ich – das ist wohl die Schattenseite des Reichtums –, ich wurde mißtrauisch und gab ihm einen Korb. Er hat das aber nicht für endgültig angesehen; denn unlängst erst hat er seinen Antrag wiederholt, und – ja, das ist eben alles.«
»Doch nicht so ganz, Liebste«, sagte die Herzogin mit einem leisen Lächeln. »Erstens fehlt dabei doch noch der Schluß, und dann drängt sich mir die Frage auf, wie es um dein eigenes Herz steht – – Liebst du ihn?«
»Das ist's ja eben – ich weiß es nicht!« erklärte Theo offen. »Ich will es unumwunden eingestehen, daß er mir sehr imponiert hat – sowohl durch seine universale Bildung und nicht gewöhnliches Wissen, als auch durch seine schöne, vornehme Erscheinung. Hätte er mich vor dem Tode der Pate gefragt, so würde ich ohne Bedenken ›ja‹ gesagt haben. Aber dieses in mir erwachte Mißtrauen hält allen seinen glänzenden Eigenschaften nun das Gegengewicht. Wenn ich ihn sehe, wenn ich mit ihm spreche, dann neigt das Zünglein der Waage ihm zu; aber es war sicherlich kein kluger Diplomatenzug, daß er mir beide Anträge schriftlich gemacht hat; denn ist er mir aus den Augen, dann schnellt er in der Waagschale meiner Gefühle federleicht empor, und die andere zieht das Mißtrauen, daß es mein Geld ist, um das er wirbt, bleischwer herab. Und ich weiß auch nicht, ob er aufrichtig ist.«
»Also hast du ihm wieder einen Korb gegeben?« fragte die Herzogin nach einer kleinen Pause.
»N–nein, noch nicht«, erwiderte Theo zögernd. »Ich habe mir Bedenkzeit ausgebeten, und er hat sich dareingefügt. Eine Frist ist nicht ausgemacht, – die hat er mir offen lassen müssen. Ach«, setzte sie mit einer Bewegung der Ungeduld hinzu, »ich wollte, ich könnte ihn auf die Probe stellen, wie er's meint. Aber wie soll ich denn das anfangen? Die Zeiten sind vorbei, wo die Ritterfräulein ihren Freiern die Aufgabe stellten, um schmale Burgmauern zu reiten, mit Drachen zu kämpfen und andere gefährliche Liebesbeweise verlangten. Mir fällt rein gar nichts ein, was man als Ersatz dafür ansehen könnte. Und ich weiß auch selbst wahrhaftig nicht, ob ich mir's wünschen möchte, daß er eine solche Probe besteht – es ist zum Davonlaufen!«
Ein leises Klopfen unterbrach hier das Gespräch; das der Herzogin viel interessanter war als die Meldung, daß die Damen im Salon versammelt seien; mit einem herzlichen: »Auf Wiedersehen denn in einer halben Stunde!« trennten sie sich von ihrer Freundin, um ihren Pflichten als Landesmutter zu genügen.
2. Kapitel
Inhaltsverzeichnis
Am Mittagstische des Kommerzienrats Jakob Reudnitz auf Amönenhof herrscht jene gewitterschwüle Stimmung, die man als »ungemütlich« zu bezeichnen pflegt. Wenn der Kreis groß ist und dazwischen ein Mitglied der Tafelrunde mit der Miene eines Schlachtopfers sitzt und das tut, was man gemeinhin ›maulen‹ nennt, dann braucht die allgemeine Gemütlichkeit darunter nicht zu leiden, sondern nur die des ›Maulenden‹; besteht aber der ganze Kreis nur aus drei Personen, dann regiert die Ungemütlichkeit in vollstem Umfang und ungeschwächt.
Dem Kommerzienrat, einem mittelgroßen und etwas schmächtigen älteren Herrn mit angegrautem Haar und kurzgeschnittenem, fastweißem Vollbart hätte ein oberflächlicher Beobachter kaum den zielbewußten Charakter angesehen, durch den er sich vom schlichten Schlossergesellen zum weltmarktbeherrschenden Großindustriellen emporgearbeitet hatte. Er tat mit schöner Beharrlichkeit so, als merkte er nichts von einer herrschenden Ungemütlichkeit, aber aus dem Hause schaffte er sie damit doch nicht, besonders, da die Urheberin dieses Zustandes ihrerseits so tat, als säuselte der Wind in den Blättern, wenn er das Wort an sie richtete. Natürlich kann das nur ein weibliches Wesen zuwege bringen; denn ein Mann, und wäre er der allergrößte Ekel, wäre niemals imstande, mit Ausdauer die ›geknickte Lilie‹ zu spielen. In ihrem bürgerlichen Dasein hieß sie Cordula, Freiin von Ganting, Gan-Erbin auf Burg Ganting, und war die Schwester der etwa vor zwei Jahren verstorbenen Frau Reudnitz; seitdem vertrat sie aus eigener Machtvollkommenheit bei dem Kommerzienrat die Stelle der fehlenden Hausfrau und war zugleich die Ehrendame seiner Tochter. Ihre Nichte, ein achtzehnjähriges, bleichsüchtig und verschüchtert aussehendes schmächtiges Mädchen, mit einem kleinen, schmalen Gesichtchen, das zwar nicht absolut reizlos, aber herzlich unbedeutend war, saß wie ein naß gewordener, junger Spatz zwischen Vater und Tante, Sie ließ ein Paar allzu hellblaue Augen ängstlich zwischen beiden hin und her irren, ungewiß, ob sie für die eine oder die andere Partei eintreten durfte oder sollte, ob eins von beiden das etwa von ihr erwartete oder ob übersehen zu werden, die Rolle, die sie zweifellos spielte, nicht der bessere Teil sei.
Der Casus belli aber, der diese ungemütliche Stimmung schon seit mehr wie einer Woche ausgelöst hatte, war eine dritte, oder besser gesagt, vierte Person, die an der ganzen Sache so unschuldig war, wie ein Säugling im Steckkissen – eine Person, deren Erscheinen noch dazu für heute fällig war. Der Kommerzienrat hatte nämlich eines schönen Tages ohne vorbereitende Umschweife erklärt, daß er für seine Tochter Sabine eine junge Gefährtin und Gesellschafterin gesucht und gefunden und zunächst für die Sommermonate verpflichtet habe; demgemäß sei ein Zimmer, das er genau bezeichnete, neben dem seiner Tochter gelegen, zur Aufnahme der jungen Dame, Fräulein Anna von Ried, herzurichten, damit es bei ihrer Ankunft an dem und dem Tage bereit sei.
Das leichte Erröten freudiger Überraschung, das sich bei dieser Ankündigung über Sabinens blasses Gesichtchen ergossen, wich umgehend einer erschrockenen Blässe, als die Tante, die sich von ihrem ersten Erstaunen rasch erholte, zornesrot auffuhr: »Was? Ohne mich zu fragen, ohne eine so wichtige Angelegenheit vorher mit mir zu besprechen, hast du hinter meinem Rücken, über meinen Kopf weg eine – eine Gesellschafterin für Sabine engagiert?«
»Sehr richtig«, hatte der Kommerzienrat mit der Seelenruhe bestätigt, die er überhaupt während der ganzen kritischen Tage nie verloren hatte. »Ich begreife nur nicht ganz, was dich zu diesem Erstaunen veranlaßt; denn Sabine ist doch meine Tochter, und meine Sache ist es demnach, für sie zu tun, was ich für gut und richtig halte.«
»Nun, Sabine ist aber auch meiner einzigen, verewigten Schwester Kind, bei dem ich seit zwei Jahren Mutterstelle vertrete – ein Amt, das meine Schwester mir sterbend anvertraut hat!« versetzte Fräulein von Ganting heftig.
»So? Das ist mir neu! Hast du das schriftlich?« erkundigte sich der Kommerzienrat mit unerschütterlicher Ruhe. »Da meine liebe Frau leider unerwartet starb, als du zufällig mal nicht auf Besuch bei uns warst, muß sie dir also dieses Amt schriftlich übertragen haben; es wäre mir sehr lieb, wenn du mir dieses wichtige Dokument mal zeigen wolltest. «
»Ich – ich habe den Wunsch auf ihren erkalteten, stummen Lippen gelesen«, murmelte sie nach einer Pause unleugbarer Verlegenheit.
»Aha! Na, dann hast du mehr gelesen, wie ich; denn mit noch warmen Lippen versicherte mir deine Schwester, daß sie mir Sabine getrost zurücklasse, da sie mich für einen guten Vater hielte. Du warst ja dabei, Sabinchen, und kannst es der Tante bestätigen«, erwiderte Reudnitz. »Was nun meine Gründe anbelangt, die mich zu diesem Schritt bewogen haben, so liegen sie auf der Hand: Du und ich, wir sind über die erste Jugend heraus – eine Tatsache, die du anerkennen wirst, namentlich da du die ältere Schwester meiner seligen Frau bist. Jugend aber braucht Jugend, und darum ist es dringend geboten, daß mein Mädel die Gesellschaft einer Altersgenossin erhält, bevor sie unrettbar geistig verhuzelt. Ist das klar?«
Wieder leuchtete es in Sabinens Augen freudig auf; die kluge und berechnende Tante Cordula aber beging eine jener Dummheiten, denen auch der klügste oder »gerissenste« Mensch stellenweise unterworfen ist: Sie brach in Tränen aus.
»Daß du mir auch noch mein Alter vorwerfen mußt!« schluchzte sie. Nun aber war Reudnitz nichts so verhaßt, als ›ein Geheule um jeden Quark‹. Solche Tränen machten ihn nicht weich, sondern erreichten bei ihm nur das genaue Gegenteil der beabsichtigten Wirkung.
»Quatsch!« brummte er ziemlich deutlich in seinen Bart und setzte laut hinzu: »Das nennt man einen Grund zum Heulen mit den Haaren herbeiziehen, liebe Schwägerin! Laß es, bitte, bei diesem ersten Versuch bewenden; denn deine Tränen werden nicht das geringste ändern. Soweit mußt du mich endlich doch kennengelernt haben, daß ich nichts unüberlegt zu tun pflege.«
Cordula mußte wohl eingesehen haben, daß sie einen falschen Schachzug getan hatte; denn sie trocknete hastig ihre Augen und setzte das Gefecht auf einer anderen Seite fort.
»Ich möchte bestreiten, daß eine total fremde Person, von der wir absolut nichts wissen, eine geeignete Gesellschaft für ein so sorgsam behütetes Wesen, wie Sabine, ist«, sagte sie gereizter, als sie zeigen wollte.
»Bin ich von heute und gestern, daß du mir zutraust, keine Erkundigungen über eine Person einzuziehen, die ich meinem Kinde zur Gefährtin geben will?« fragte Reudnitz lachend. »Habe ich dir wirklich solch einen – harmlosen Eindruck gemacht? Das spricht nicht sehr für deine Beobachtungsgabe, aber ich kann dich darüber vollständig beruhigen. Nicht nur, daß ich über Fräulein von Rieds Familie, Vorleben, Charakter und Fähigkeiten sehr befriedigende Referenzen besitze, ich habe neulich sogar ihre persönliche Bekanntschaft gemacht und bin überzeugt, daß sie Sabine und dir ebenso gut gefallen wird, wie sie auf mich den besten Eindruck gemacht hat. Das genügt wohl.
»Es genügt mir nicht«, erklärte Fräulein von Ganting scharf. »Nun wir werden ja sehen, was dabei herauskommt. Das Ende vom Liede wird sein, daß du in die Netze einer schlauen, berechnenden Intrigantin fällst, und – nun, du wirst ja verstehen, was ich meine, ohne daß ich es ausspreche. Ich protestiere gegen diese Gesellschafterin, denn ich kenne die Sorte zur Genüge.«
»Schön! Ich nehme deinen Protest zur Kenntnis«, schmunzelte der Kommerzienrat. »Deine Kenntnis ›dieser Sorte‹ soll dir unbestritten bleiben, da du ja selbst in deinen jüngeren Jahren zu ihrer Zunft gehört hast, und natürlich über ihre Zwecke und Ziele genau Bescheid wissen mußt. Tja – man sucht bekanntlich niemand hinterm Ofen, wenn man nicht selber dahinter gesteckt hat.«
Ehe Tante Cordula, feuerrot geworden, eine Erwiderung finden konnte, war Reudnitz aufgestanden und zur Tür gegangen, wo er sich nochmals umdrehte und sehr betont sagte:
»Was deine Gefühle in dieser Sache auch sein mögen, werte Schwägerin, und so wenig verständlich mir dein Widerspruch ist – eins erwarte ich mit Nachdruck von dir: nämlich, daß Sabine nicht systematisch gegen eine Gefährtin aufgehetzt wird, ehe diese den Fuß auf meine Schwelle gesetzt hat. Ich hoffe, du hast mich verstanden! Komm, Sabinchen, wir wollen eine Kahnfahrt miteinander machen.«
Der Spieß, den der Kommerzienrat so wirkungsvoll gegen seine Schwägerin umgedreht hatte, verbesserte ihre Laune nicht, wie man sich leicht vorstellen kann. Ihr Widerstand gegen ein fremdes Element im Hause erklärte sich leicht daraus, daß sie dadurch nicht ganz ohne Berechtigung eine Verminderung ihres Einflusses auf ihre Nichte fürchtete, deren Wille bisher ganz unter dem ihrigen gestanden hatte, weil sie dem jungen Mädchen überhaupt keine Gelegenheit gestattete, einen eigenen Willen bei sich zu entdecken oder gar zur Geltung zu bringen. Cordula hatte seit dem Tode ihrer Schwester im Hause ihres Schwagers, den sie seiner bescheidenen Herkunft wegen entschieden für minderwertig hielt, mit souveräner Gewalt geherrscht, und seine Duldung des Status quo ihrer überlegenen Stellung zugeschrieben, dem Übergewicht der Aristokratin gegenüber dem Plebejer. Denn der Adelsstolz war eine ihrer hervorstechendsten Eigenschaften, und nie vergaß sie zu betonen, daß sie Gan-Erbin von Burg Ganting war. Daß sie als ein blutarmes Mitglied dieser ehedem freiherrlichen aber längst stark herabgekommenen Familie in deren Stiftung auf Burg Ganting eine höchst bescheidene Unterkunft gefunden, nachdem sie ihre Jugend und den größten Teil ihrer reiferen Jahre als Gesellschafterin in fremder Dienstbarkeit zugebracht hatte, tat ihrem Stolz auf ihre Gan-Erbschaft keinen Abbruch. Daß ihre jüngere Schwester sich herabgelassen, einen »Emporkömmling« zu heiraten, verurteilte sie zwar vor jedem, der's hören wollte, es hinderte sie aber durchaus nicht, sich möglichst oft an den Fleischtöpfen ihres Schwagers niederzulassen und endlich ganz daran Platz zu nehmen.
Cordula von Ganting war eine sehr stattliche Erscheinung; ihre stolzen, regelmäßigen Züge, die eine auffallende Ähnlichkeit mit der bekannten Büste der jüngeren Agrippina hatten, wären auch heute noch schön zu nennen gewesen, hätte sie nicht der leider recht weit verbreiteten Untugend gehuldigt, sich durch künstliche Mittel verjüngen zu wollen. Sie puderte sich ihr Gesicht, färbte sich ihre feingeschnittenen Lippen rot, und trug dazu noch eine kastanienbraune, schön frisierte Perücke, deren Preis ein riesiges Loch in ihre Ersparnisse gerissen haben mußte. Natürlich täuschte sie mit diesen Künsten niemand anders, als sich selbst; denn der natürliche Verfall der Züge wird durch künstliche Mittel nicht verhüllt, sondern nur um so auffallender.
Nach der ersten Schlacht, die Cordula mit ihrem Schwager um die Herrschaft über ihre Nichte geschlagen und verloren hatte, zog sie andere Saiten auf. Zunächst spielte sie die Rolle der Beleidigten, wozu sie nach seinem direkten Angriff Berechtigung zu haben glaubte und in seinen Augen wohl auch haben durfte; denn als er sie zum ersten Male danach wiedersah, gab er ihr die Hand und sagte gutmütig, wie er überhaupt war:
»Na, nichts für ungut, Schwägerin! Laß dir's zur Lehre dienen, daß man die Leute nicht reizen soll. Ich bin wahrhaftig der letzte, der jemand etwas vorwerfen würde, was ihm eigentlich nur zur Ehre gereichen kann. – Im übrigen bleibt's natürlich dabei.«
Cordula war viel zu klug und zu berechnend, um nicht einzusehen, daß dies eine Entschuldigung sein sollte, und daß es unweise wäre, sie nicht für eine solche anzunehmen. Da sie darnach die Rolle der Beleidigten nicht mehr spielen konnte, fiel sie auf die der »geknickten Lilie«. Sie sprach nicht, sie aß nicht – wenigstens nicht, wenn der Kommerzienrat dabei war – sie tat, als hörte sie nicht, wenn er mit ihr sprach, und zeigte sich ständig mit geröteten Augenlidern, deren Farbe höchst verdächtig der ihrer Lippen glich, nur etwas weniger stark aufgetragen. Damit erreichte sie auch, daß Reudnitz sie nach ein paar Tagen fragte, »was denn los sei? Ob ihr etwas fehle?« Und nach einem geschickten Zögern gestand sie, »es zehre an ihr, daß man ihr Sabine entfremden und entziehen wolle«.
»Stuß!« hatte der Kommerzienrat darauf gesagt und keine Notiz mehr von ihr genommen. Da sie aber der Meinung war, daß steter Tropfen den Stein höhlt, und die Zeit zudem drohend vorrückte, so beharrte sie in ihrer Rolle und erreichte damit glücklich jenen Zustand permanenter Ungemütlichkeit, von dem in dieser wahren Geschichte bereits die Rede war, ohne jedoch damit zu erreichen, was sie wollte.
Die ungemütliche Mittagsmahlzeit verlief genau nach dem Schema ihrer Vorgänger, seit die bevorstehende Ankunft von Fräulein von Ried als drohende Wolke den Horizont des Amönenhofs verdunkelte. Fräulein von Ganting schien den Höhepunkt ihrer melancholischen Niedergeschlagenheit erreicht zu haben, und wenn sie bisher von den ihr gereichten Speisen ein Minimum genommen, um es dann auf ihrem Teller unberührt liegen zu lassen, so lehnte sie heute auch das ab, so daß Sabine, die bisher nur eine stumme Zuschauerin war, nicht umhin konnte, ängstlich zu bemerken, »daß Tante es wirklich doch so nicht weiter treiben könnte, ohne ernstlichen Schaden an ihrer Gesundheit zu nehmen«. Kaum aber, daß Tantchen mit einem wehmütigen Lächeln und vielsagendem Kopfschütteln ihre Meinung mit ersterbender Stimme durch ein »Laß mich, Kind!« eingeleitet hatte, bemerkte der Kommerzienrat gemütlich:
»Zum Essen muß man niemand zwingen, Sabine, wenn er keinen Appetit hat. Die menschliche Natur weiß in solchen Fällen am besten, was ihr not tut. Wenn ich mir aber einen Rat erlauben darf, so wäre es der, es einmal mit Rizinusöl zu probieren.«
Cordula faltete ergeben ihre immer noch schönen, weißen, wohlgepflegten Hände, an denen einige alte Gantingsche Familienringe blitzten, und schlug ihre dunklen, schimmernden Augen zur Decke auf.
»Mir bricht das Herz, und dagegen wird mir – nein, ich kann es nicht wiederholen, was, verordnet!« hauchte sie im Theaterflüsterton.
»Siehste, das ist auch ein Zeichen innerer Störungen«, meinte Reudnitz teilnehmend. »Der Franzose nennt solche Zustände sehr treffend ›mal du coeur‹, weil man dabei das Gefühl des Herzbrechens hat. Solltest du kein Rizinusöl besitzen, – ich habe welches in meiner Hausapotheke. Es war das Allheilmittel meiner Mutter selig. Gut schmeckt's ja nicht, aber wenn man schwarzen Kaffee nachtrinkt, dann –«
Weiter kam er mit seiner Belehrung nicht, denn der Diener trat ein und überreichte ihm ein Telegramm. Reudnitz aß ruhig seine Erdbeeren auf, öffnete dann die Depesche, las sie, las sie noch einmal, machte dann »Hm!«, sah sich im Kreise um und zog die Augenbrauen hoch, was bei ihm immer ein Zeichen war, daß irgend etwas nicht ganz nach Wunsch ging.
»Doch nichts Unangenehmes, Vater?« fühlte Sabine sich verpflichtet ängstlich zu fragen.
»Hm!« machte der Kommerzienrat noch einmal. »Wie man's nehmen will. Telegraphiert mir da ein Sanitätsrat – wie heißt er? Müller! – ›Anna von Ried an typhösen Erscheinungen erkrankt im Städtischen Hospital. Krankheitsdauer unbestimmbar, voraussichtlich für längere Zeit dienstunfähig. Stellvertreterin mit besten Referenzen trifft wie verabredet Amönenhof ein ‹ – Da haben wir die Bescherung.«
»Die Arme!« wagte Sabine ihrer Teilnahme Worte zu geben.
» Ja, ja! Natürlich tut mir das arme Mädel auch sehr leid«, rief Reudnitz ungeduldig. »Mit der ›Bescherung‹ meinte ich ja auch nur –«
»Die Stellvertreterin«, fiel Tante Cordula mit wesentlich gestärkter Stimme ein. »Kennst du diese – Ungenannte?«
»Woher soll ich sie denn kennen? Man macht doch kontraktlich nicht gleich eine Stellvertretung aus, wenn man eine Person engagiert!« rief der Kommerzienrat heftig, fuhr aber dann ruhiger fort: »Es ist ja sehr nett und rücksichtsvoll von dem armen Mädel, daß sie einen nicht im Stich lassen will und gleich einen Ersatz abschickt, aber eigentlich – na ja, eigentlich hätte dieser Sanitätsrat doch erst anfragen müssen, ob's einem auch recht ist. Gegenorder nützt nichts mehr, denn der Ersatz, wer immer es auch ist, muß schon seit zwei Stunden unterwegs sein und trifft in weiteren zwei Stunden und zwanzig Minuten auf der Station Weißenfels ein. Hm! Da bleibt nichts anderes übrig, als daß ich selbst zur Abholung fahre; das heißt, ich werde mir die Stellvertreterin mal erst ansehen und ihr auf den Zahn fühlen. Ist nichts mit ihr, dann gibt man ihr das Reisegeld und meinetwegen auch eine Entschädigung und schickt sie mit dem nächsten Zuge wieder zurück. So wird's gemacht.«
»Ich will dir das sehr, sehr gern abnehmen, lieber Jakob«, sagte Tante Cordula liebenswürdig und mit scheinbar ganz wieder hergestellten Lebensgeistern.
»Ich danke vielmals, aber der liebe Jakob wird sich sehr, sehr gern selbst bemühen«, erwiderte Reudnitz verbindlich und kniff dabei ein Auge zu. »Erstens habe ich volles Vertrauen zu meiner Menschenkenntnis, und zweitens ordnet ein Mann Geschäftsfragen, wie sie sich notgedrungen ergeben, falls die Dame mir irgendwie nicht passen sollte, entschieden besser. Ich habe auch darin einige Erfahrung. Und drittens – überhaupt! Ich fürchte nämlich, daß die Ungenannte unter keinen Umständen Gnade vor deinen Augen finden dürfte.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, legte der alte Herr seine Serviette zusammen und stand auf.
»Schlage meinen Rat nicht ohne weiteres mit jugendlichem Übermut in den Wind, Cordula, sondern nimm Rizinusöl«, schmunzelte er mit funkelnden Äuglein und entfernte sich, um bei einer Zigarre die neue Lage mit Ruhe zu überlegen.
Nicht ohne eine gewisse Spannung fand er sich mit seinem Auto zu dem mit Fräulein von Ried verabredeten Schnellzuge auf der Station des Städtchens Weißenfels ein. Über seiner Handvoll Häuser mit dem uralten Rathaus in der Mitte, thronte auf waldigem Hügel die Stammburg und ehemalige Residenz der jüngeren Linie der nun vereinten Herzogtümer Weißenfels malerisch und imponierend.
Der Reiseverkehr von Weißenfels ist auch zur Zeit, da Sommerfrischler gern das idyllisch gelegene Städtchen aufsuchen, nicht gerade überwältigend, und da aus dem heransausenden Schnellzuge nur drei Personen ausstiegen, zwei Geschäftsreisende und eine Dame, so wurde es dem Kommerzienrat leicht gemacht, die Erwartete gleich festzustellen. Das tat er denn auch mit einem nur halb unterdrückten »Donnerwetter noch mal!«
Man macht sich von unbekannten Personen, mit denen man zusammenkommen soll, gern vorher ein ungefähres Bild, und dieses hatte bei Reudnitz sonderbarerweise die Gestalt einer eckigen und etwas ruppig aussehenden, »älteren jungen Dame« angenommen. Die Dame, die ihm auf dem Bahnsteig entgegentrat, sah wirklich wie das aus, was man unter dieser Bezeichnung versteht, vor allem aber war sie das Bild blühender Jugend, keineswegs »eckig« und von einer Schönheit, welche die mehr liebliche Erscheinung der erkrankten Anna von Ried sehr in den Schatten stellte.
Tannenschlank, im einfachen, aber tadellos gearbeiteten grauen Kostüm mit weißer Hemdbluse wäre sie bei ihrer aufrechten Haltung selbst im Gedränge nicht leicht zu übersehen gewesen. Der Kopf mit dem wundervollen, wie reife, goldene Ähren leuchtenden Haar unter dem einfachen Panamahut aber war wirklich bezaubernd; das reine Oval des Gesichtes wurde belebt und anziehend durch den Ausdruck innerer, echter Liebenswürdigkeit und Klugheit.
»Donnerwetter!« murmelte der Kommerzienrat noch einmal vor sich hin, und indem er den Hut zog, trat er ihr in den Weg und sagte mit leichter Unsicherheit: »Mein Name ist Reudnitz. Ich habe doch das Vergnügen, die – die Stellvertreterin von Fräulein von Ried vor mir zu sehen?«
»Ja, die bin ich«, erwiderte die junge Dame ohne jede Verlegenheit. ''Es ist wirklich sehr liebenswürdig von Ihnen, daß Sie selbst gekommen sind, Herr Kommerzienrat. Da ich nichts über eine Abholung erfahren hatte, so habe ich mich schon gefragt, wie man eigentlich nach Amönenhof gelangen könnte – per pedes oder mit Wagen.
»Letzteres ist unter Umständen wegen der Entfernung von reichlich zehn Kilometern vorzuziehen«, versetzte Reudnitz mit wachsendem Wohlgefallen; denn auch die wohlklingende Altstimme der immer noch Namenlosen tat seinem Ohre wohl. Aber er wollte und durfte sich nicht ohne weiteres durch solche Äußerlichkeiten beeinflussen lassen und setzte hastig hinzu: »Wenn es Ihnen also recht ist Fräulein – hm – Fräulein – –«
»Ich heiße Theodora Zöllner«, fiel sie lächelnd ein.
»Ah!« machte der Kommerzienrat. »In dem Telegramm des Sanitätsrats Müller war nämlich kein Name genannt. Tatsächlich nicht; es ist wohl in der Eile übersehen worden. Also, wenn es Ihnen recht ist, Fräulein Zöllner, dann wollen wir zunächst mal hier in den sogenannten Wartesaal erster Klasse eintreten und uns mit einer Tasse Tee, die ich dorthin bestellt habe, für den staubigen Weg nach Amönenhof stärken.«
»Und dabei erst mal schauen, wes Geistes Kind ich bin«, vollendete sie lachend. »Aber natürlich wollen Sie das, und ich finde es auch ganz gerechtfertigt. Wenn einem jemand so ohne Vorrede ins Haus geschickt wird, wie ich, da will man doch wissen, was das eigentlich für ein Geschöpf ist.«
»Nun«, meinte Reudnitz schmunzelnd, indem er die Tür zu dem wenig einladenden Raum öffnete, in dessen Mitte ein sauber gedeckter Teetisch stand. »Sie scheinen jedenfalls eine junge Dame zu sein, mit der sich's reden läßt. Da Sie die Sachlage ohne jede Ziererei beim rechten Namen nennen, so stehe ich nicht an zu sagen, daß mir das gefällt, ausnehmend gefällt. Vor allem aber: Welche Nachrichten bringen Sie von Fräulein von Ried mit?«
»Leider keine guten«, erwiderte Fräulein Zöllner, indem ein Schatten über ihr Gesicht flog. »Sanitätsrat Müller fürchtet, daß es im besten Falle eine langwierige Sache werden wird – – – Und das bringt mich auch gleich zu der Erklärung, die ich Ihnen schulde. Ich kam auf der Durchreise nach meiner Heimat nach X. mit der Absicht, meine Schulfreundin Anna von Ried aufzusuchen und ein paar Tage mit ihr zu verleben. Ich wußte natürlich, daß sie nach dem Verlust ihres Vermögens durch einen gewissenlosen Vormund mit Sprachunterricht ihren Lebensunterhalt verdiente, aber es war mir unbekannt, daß sie inzwischen – zunächst für den Sommer – eine Stellung als Gesellschafterin Ihrer Tochter, Herr Kommerzienrat angenommen hatte und dadurch in die Lage kam, den Ausfall der Stunden durch die Reisezeit nicht nur auszugleichen, sondern durch den Landaufenthalt auch ihre Gesundheit zu stärken, die in letzter Zeit schon viel zu wünschen übrig ließ. Tatsächlich fand ich das arme Ding in einem Zustand vor, der mich mit größter Besorgnis erfüllte; denn sie hatte meines Erachtens starkes Fieber und klagte auch über fast unerträgliche Kopfschmerzen. Trotzdem packte sie ihren Koffer, das heißt, sie schleppte die Sachen ziel- und zwecklos herum wie ein Mensch, der nicht mehr weiß, was er tut. Die Idee krank sein zu sollen, wies sie ordentlich angstvoll ab und meinte, es würde morgen alles wieder in Ordnung sein, müßte es sogar, denn sie könnte sich ihrer Verpflichtung nicht entziehen; es sei fast eine Lebensfrage für sie und so weiter. Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich denn auch Ihre Adresse, Herr Kommerzienrat, und wann Anna bei Ihnen erwartet wurde. Als ich dann in der Frühe des nächsten Tages wieder zu ihr kam, fand ich sie, unfähig aufzustehen, mit einem schrecklichen Fieber im Bette vor, und mein erstes war nun, nach einem Arzt zu schicken. Annas Pensionsgeberin, eine freundliche ältere Dame, die wohl sah, wie die Sache stand, telephonierte gleich an das städtische Hospital, dessen Chefarzt, Sanitätsrat Müller, rasch genug erschien und den sofortigen Transport der Kranken in das Hospital anordnete. Zufällig fand ich in Doktor Müller einen alten Freund, der mich schon als Kind gekannt und meinen Vater in seiner letzten Krankheit behandelt hat; daß er inzwischen nach Y. übergesiedelt war, hatte ich nicht gewußt. Er machte zu dem Zustande meiner Freundin ein recht bedenkliches Gesicht und erklärte ihn für typhös. Jedenfalls hatte sich ihr Befinden, als ich am Nachmittag im Hospital Erkundigungen über sie einzog, merklich verschlechtert, wozu auch ihre Unruhe beitrug, an der Abreise nach Amönenhof verhindert zu sein. Das brachte mich dann auf den Gedanken, ihr die Stellung dadurch zu sichern, daß ich für sie einsprang, und besprach es mit Doktor Müller, der sich dadurch auch eine relative Beruhigung der Kranken versprach und ihr die Sache in einem klaren Moment beibrachte – denn sie phantasierte, abwechselnd mit völligem Bewußtsein. Das Resultat war dann das Telegramm an Sie, Herr Kommerzienrat. Das ist in Kürze der Sachverhalt, und wenn Sie meinen, mich nicht brauchen zu können, so muß ich eben betrübt wieder abreisen und zusehen, wie ich das arme Wurm in dem Wahn lassen kann, daß ihr die Stelle bei Ihnen durch mich erhalten bleibt, bis sie wieder so weit ist, die Wahrheit vertragen zu können.«
Reudnitz hatte aufmerksam zugehört und die Sprecherin dabei scharf beobachtet. Der dabei gewonnene Eindruck war ein durchaus günstiger; denn, den Freibrief ihrer unleugbaren Schönheit ganz beiseite lassend, konnte er nicht umhin, sich zu gestehen, daß die einfache offene und klare Art, mit der sie ihre schlichte Erklärung abgab, sehr für sie einnahm. »Nun, ob ich Sie als Ersatz für Fräulein von Ried für wünschenswert halte, möchte ich gern mit ja beantworten«, sagte er freundlich. »Ich würde sogar nicht anstehen, Ihnen den Vorschlag zu machen, sofort nach Amönenhof zu fahren; denn mit ihrer Entschlossenheit scheinen Sie mir ganz die richtige Person für den Zweck zu sein, den ich mit Fräulein von Ried für meine Tochter im Auge hatte, aber –Sie müssen mir schon noch ein paar Fragen gestatten und sie im rechten Sinne auffassen. Daß Sanitätsrat Müller Ihre Anmeldung übernahm, dürfte ja eigentlich eine genügende Empfehlung sein; sein Telegramm erwähnte aber noch besonders ›beste Referenzen‹.«
»Damit meinte er wohl, dafür einstehen zu können, daß ich aus gutem Hause bin und mich des besten Leumunds erfreue, denn ich war bisher nie in Stellung«, erwiderte Fräulein Zöllner, rot werdend, was Reudnitz auf das Eingeständnis ihrer Unerfahrenheit schob. »Sie werden das vielleicht als ein Hindernis betrachten, was Doktor Müller übrigens auch tat. «
»Keineswegs«, beeilte sich der Kommerzienrat einzufallen. »Fräulein von Ried war ja auch bisher nicht in Stellung gewesen, und mir liegt sogar viel daran, meiner Tochter eine Gefährtin – verstehen Sie wohl, eine Gefährtin – zu geben, nicht aber, was man unter einer Gesellschafterin versteht, die schon in soundso viel Familien oder bei einzelnen Damen ihre Prüfungszeit der Selbstverleugnung abgelegt hat und, wie man so sagt, mit allen Hunden gehetzt ist. Der Ausdruck ist ja vielleicht ein bißchen drastisch –«
»Aber treffend«, versicherte Fräulein Zöllner lachend. »Mein Vater war Offizier und hat mich an ›drastische‹ Ausdrücke gewöhnt. Als er starb, kam ich zu einer Pate, die wegen ihrer Kraftausdrücke eine gewisse Berühmtheit genoß, und wenn ich die nicht vertragen hätte, wär's mit unserer Freundschaft aus gewesen. Sie ist auch vor einem Jahr gestorben und hat mir ihre paar Kröten hinterlassen, die mich in die Lage versetzt haben, in relativer Unabhängigkeit zu leben, so daß ich nicht gezwungen bin, irgendeine Stellung zu suchen. Und damit möchte ich noch einmal betonen, daß mein einziges Motiv, mich Ihnen aufzudrängen, der Wunsch und die Absicht war, meiner erkrankten Freundin den Posten bei Ihnen warm zu halten. Sie sehen, ich bin ganz offen, damit Sie nicht meinen, daß etwa Gewinnsucht oder die Notwendigkeit die Mutter des Gedankens war.
»Diese Offenheit macht Ihnen Ehre, Fräulein Zöllner, und ich stehe nicht an, Ihnen zu sagen, daß Ihre Erklärungen mir genügen. Da ja Doktor Müller jedenfalls auch die Verantwortung für Ihre Person übernimmt, so können wir unseren Vertrag für abgemacht erklären«, sagte Reudnitz, und rieb sich befriedigt die Hände. »Außerdem glaube ich mich auf meine ersten Eindrücke verlassen zu dürfen, –tja! Und was nun den finanziellen Teil der Sache betrifft, so wird Fräulein von Ried Ihnen jedenfalls gesagt haben, unter welchen Bedingungen sie ihr Amt in meinem Hause übernommen hat.
»Ja, das hat sie getan, aber ich möchte Sie bitten, das ausgemachte Gehalt nicht mir zu geben, sondern auf das Sparguthaben meiner Freundin in X, einzuzahlen«, erwiderte sie einfach. »Den kleinen Kampf, den ich darob mit ihr zu bestehen haben werde, will ich gern auf mich nehmen. Ich selbst brauche ja bei Ihnen nichts und setze demnach auch nichts zu.«
»Nun, wie Sie wollen. Das ist Ihre Privatsache und geht mich nichts an«, meinte Reudnitz. »Aber noch eins, ehe wir uns auf die Fahrt begeben: ich hatte mit Fräulein von Ried eine persönliche Unterredung, in welcher ich ihr vertraulich auseinandersetzte, um was es sich in ihrer Stellung handelte. Hat sie Ihnen darüber Mitteilungen gemacht?«
»Nicht ein Wort! Anna ist nicht die Person, vertrauliche Mitteilungen unterm sogenannten Siegel der Verschwiegenheit auszuplaudern, und ich darf wohl hinzufügen, daß ich auf dem gleichen Standpunkt stehe«, versicherte Theodors Zöllner sachlich.
»Um so besser!« rief Reudnitz befriedigt. »Da wir nun aber nicht wissen können, wie lange Ihre Stellvertretung dauern wird, so wird es schon notwendig sein, auch Sie einzuweihen. Das läßt sich jedoch mit drei Worten nicht gut machen, und der Weg bis Amönenhof ist mit meinem ›Daimler‹ rasch zurückgelegt; überdies möchte ich nicht, daß mein Fahrer hört, was ich Ihnen zu sagen habe, andererseits aber wäre es mir lieb, wenn Sie wüßten, wie der Hase läuft, ehe Sie mein Haus betreten. Sind Sie sehr ermüdet von der Reise?«
»Keine Spur!« verneinte sie lachend.
»Sie sehen auch nicht aus, als ob ein paar Stunden Eisenbahnfahrt Sie gleich umwerfen könnten«, bestätigte er zufrieden. »Ich schlage Ihnen also vor, daß wir an einem bestimmten Punkt aussteigen und den Rest des Weges durch den Wald zu Fuß zurücklegen, was bei dem schönen Maiwetter einen prächtigen Spaziergang von etwa einer halben Stunde ergibt. Sind Sie damit einverstanden?«
»Mit Vergnügen!« rief sie aus, und da der Tee, der nach dem Urteil beider nach Heusamen schmeckte, keine Sehnsucht nach mehr erweckte, so bestiegen sie das wartende Auto und fuhren davon.
»Ich glaube, der Amönenhof wird Ihnen gefallen«, sagte Reudnitz, als sie das holprige Pflaster von Weißenfels hinter sich hatten. »Ich habe den Besitz, der landwirtschaftlich gleich Null und eigentlich mehr ein Luxusartikel ist, vor einigen Monaten von einem Grafen Zimburg gekauft, in dessen Familie er seit mehreren Jahrhunderten war. Unter etwas sonderbaren Bedingungen gekauft, – doch davon gelegentlich mal später! Nachdem ich mich von meinen Geschäften etwas zurückgezogen und nur noch gewissermaßen die Hand darüber halte, kam mir die Sehnsucht nach frischer Luft, fern vom Werk und Büro und da wurde ich denn auf den Amönenhof aufmerksam gemacht. Das Haus und sein schöner Park gefielen mir gleich sehr gut; das Schloß wirkte auf meine Einbildungskraft, die Sie mir trockenem Geschäftsmenschen wahrscheinlich gar nicht zutrauen würden.«
»Warum nicht?« rief Fräulein Zöllner lebhaft. »Ich selbst besitze nämlich auch ein gutes Teil von dieser Gabe und möchte behaupten, daß ein Mensch ohne sie kein höher gestecktes Ziel erreichen kann. Sie hätten es sicher nicht zu dem gebracht, was Sie sind, wenn Sie sich in Ihrem Herzen nicht ein frisches, grünes Fleckchen erhalten und gepflegt hätten, auf das Sie sich vom Strudel der Welt und aus den Reihen trockener Ziffern zurückziehen und erholen könnten. Ich habe nämlich auch ein Paar ganz helle Augen, Herr Kommerzienrat, und damit in Ihnen bereits dieses grüne Eiland latenter Romantik entdeckt.«
»Wahrhaftig?« sagte Reudnitz lächelnd, aber bewegt. »Da müssen Sie wohl ein Sonntagskind sein. Nun, auf alle Fälle danke ich Ihnen herzlich für das gute Wort. Ja, ja, das grüne Eiland wäre wohl vorhanden, aber von vielen ist's in mir noch nicht entdeckt worden, darauf können Sie sich verlassen. Na, kurz und gut, das alte, verträumte Schloß – mit seiner bizarren Architektur, seiner Lage im Park und am See tat es mir an, und ich kaufte es. Innen wie außen trug es die Spuren großer Vernachlässigung, die aber ein genialer Architekt mit liebevoller Treue und großem Verständnis beseitigt hat, und ich gehöre auch nicht zu den emporgekommenen Barbaren, die sich einen solchen Besitz mit modernem Kram verschandeln. Die Einrichtung, soweit sie alt war, habe ich an Ort und Stelle gelassen, die Lücken mit liebevoll gesammelten Altertümern ausgefüllt –«
»Ah, ein neuer Beweis für Ihre Einbildungskraft!« warf Fräulein Zöllner ein.
»Von anderen Leuten Antiquitätenfexerei genannt«, lachte Reudnitz gut gelaunt. »Na, ich freue mich, daß Sie es wenigstens auf den richtigen Wert taxieren. Ein wenig habe ich der Neuzeit aber doch Konzessionen gemacht und die Elektrizität im Amönenhof eingeschmuggelt. Daß ich mir aber erlaubte, andere moderne Einrichtungen und hygienische Anforderungen, zum Beispiel reichlich verteilte Badeeinrichtungen, so diskret wie möglich einzuführen, tut Ihrer guten Meinung von der ›latenten Romantik‹ in meinem Herzen hoffentlich keinen Abbruch.«
»Im Gegenteil, das vermehrt nur meinen Respekt und läßt mich ein Behagen ahnen, das ich schmerzlich vermißt hätte«, versicherte Fräulein Zöllner vergnügt. »Doch ich weiß nun zwar, daß ich im Amönenhof elektrisches Licht und Badewannen finden werde, aber sonst tappe ich noch sehr im Dunkeln. Natürlich finde ich Ihr Fräulein Tochter dort, die ja für mich der Ausgangspunkt meiner Tätigkeit ist. Wenn Sie aber die Güte haben wollten, mir zu sagen –«
»Wir kommen noch darauf«, fiel Reudnitz ein. »Und da sind wir auch an der Stelle angelangt, wo wir aussteigen wollen. Halten Sie am Eingang der Schneise, Lehmann!« befahl er dem Fahrer, und als die Maschine an dem bezeichneten Punkte stillstand, sagte er: »Melden Sie dem gnädigen Fräulein und meiner Tochter, daß Fräulein Zöllner angekommen ist und ich mit ihr durch den Wald heimgehen wollte, da ich heute meinen Spaziergang noch nicht gemacht habe.«
»So«, begann er, nachdem er mit seiner Gefährtin aus der Schneise nach wenig Schritten in einen breiten, schattigen Waldweg eingebogen war, »jetzt können wir plaudern, das heißt, ich möchte Ihnen die Mitteilungen machen, die ich für notwendig zum Verständnis der Sachlage halte. Ich bin Witwer und habe nur ein Kind, meine achtzehnjährige Tochter Sabine. Meine vor zwei Jahren verstorbene Frau, eine geborene Freiin von Ganting, war nicht mehr jung, als ich sie heiratete, was ich nur erwähne, um damit zu erklären, daß unsere einzige Tochter nicht die Kraft und Lebensfülle geerbt hat, die eine junge Mutter Ihrem Kinde zu spenden vermag. Sabine war ein schwächliches Kind und ist heute noch ein recht zartes Pflänzchen, das wohl gepflegt sein will. Ihre Mutter war eine vortreffliche Frau, aber viel zu ängstlich um die leibliche Gesundheit unseres Sorgenkindes bemüht, als daß sie daneben noch die geistigen Fähigkeiten Sabinens ans Licht gebracht und angefeuert hätte. Als sie dann ziemlich unerwartet nach kurzer Krankheit starb, war Sabine gerade auch in einem Zustand, der großer Aufmerksamkeit bedurfte, und darum hieß ich es stillschweigend für den Augenblick willkommen, daß die Schwester meiner Frau, Fräulein Cordula von Ganting, die zum Begräbnis meiner Frau eingetroffen war, mir diese Sorge abnahm. Ich war damals gerade in ein wichtiges Unternehmen verwickelt, das meine ganze Aufmerksamkeit und Tatkraft in Anspruch nahm, und schob darum die Entscheidung darüber, wem meine Tochter am besten anzuvertrauen wäre, auf die lange Bank, um so mehr, als meine Schwägerin für ihre Nichte, was ihre gesundheitliche Fürsorge anbetraf, es wirklich an nichts fehlen ließ, auch nicht etwa in moralischer Beziehung, gewiß nicht! Sie besitzt eine gewisse Bildung, weiß über alles gut und klug zu reden; aber sie ist in Vorurteilen und veralteten Ansichten erstarrt, und wenn ich nicht für ein gesundes Gegengewicht gesorgt hätte, so wäre aus Sabine eine jener gesellschaftlichen Drahtpuppen geworden, wie sie zu Fräulein von Gantings Jugendzeit Mode waren – eine Sorte, die mir in der Seele zuwider ist, der jede Natürlichkeit heraus ›erzogen‹ wird, die nicht jung sein darf und sich in den Schranken eines engen Horizontes im Kreise drehen muß. Nämlich – – na ja, zum Kuckuck, zuwider, wie mir's ist, es vor einer Fremden aussprechen zu müssen– meine Schwägerin hat sich ungebeten und unverlangt bei mir niedergelassen. Sie hat nach der ersten Zeit der Trauer mein Haus für das ihrige betrachtet, und ich bin so schwach gewesen – aus falscher Pietät gegen die Verstorbene –, es dabei zu lassen. Nun ich aber meine Ruhe habe und das Geschäft mich nur noch in beschränktem Maße ablenkt, ist mir die Sache denn doch zu nahe getreten, um nicht eine Änderung herbeiführen zu müssen. Sabine verhutzelt und verkrüppelt ja moralisch in der Gesellschaft von uns zwei alten Leuten! Hat meine Schwägerin schon in der Stadt dafür gesorgt, daß Sabine isoliert wurde und keinen Anteil hatte an der Gesellschaft gleichaltriger Mädchen, an ihren Studien, unschuldigen Freuden und Dummheiten, wie die Jugend sie nun einmal begehen muß, um frisch und jung zu bleiben – hier in dieser Einsamkeit, die an nachbarlichem Verkehr so gut wie nichts hat, muß sie ja vollends versauern. Und da dachte ich mir, wenn ich ihr eine recht frische, junge Gefährtin geben könnte – eine nach meiner Wahl, nicht nach der meiner Schwägerin. Heimlich ging ich ans Werk, und das Glück wollte es, daß ich in Fräulein von Ried die Gesuchte fand. – Wenn Sie, liebes Fräulein, aber die sind, für die ich Sie nach kurzer Bekanntschaft halten möchte, dann sage ich: Es lebe die Stellvertretung? Sie haben verstanden, was ich meine?«
»Aber die Sache ist ja sonnenklar!« rief Fräulein Zöllner aus. »Ich muß vor allem natürlich alles tun, um mir das Vertrauen und die Freundschaft von Fräulein Sabine zu erwerben, was hoffentlich nicht übermäßig schwer ist, falls sie nicht allzusehr gegen ihre Gefährtin – voreingenommen worden ist.«
»Na, sehen Sie, so wollte ich's aufgefaßt haben, so hatte mich Ihre Freundin verstanden, so hatte ich den ersten Eindruck von Ihnen, daß sie mich verstehen würden!« rief Reudnitz lebhaft. »Nein, mit Sabine dürfte es Ihnen nicht zu schwer fallen, falls Sie's richtig anfangen und das Mädchen ein wenig studieren. Aber ich warne Sie: Sie werden einen schweren Stand bei meiner Schwägerin haben! Sie hat sich mit Händen und Füßen und noch bis heute mittag durch passive Resistenz gegen eine Gefährtin für Sabine gesträubt und wird ihren Einfluß, ihre Macht nur nach hartem und – rücksichtslosem Kampfe mit einer anderen teilen oder ganz abtreten. Das ist das Motiv ihres Widerstandes.«
»Nun, diese Warnung war ja schon aus Ihrer ganzen Darlegung der Verhältnisse herauszuhören«, erklärte Fräulein Zöllner lachend. »Auch gegen Angriffe aus dem Hinterhalt kann man sich einigermaßen schützen, wenn man nur weiß, daß sie einem drohen. Die Warnung davor nimmt der Gefahr schon ein gutes Teil ihrer Stärke. Im offenen Kampfe traue ich mir zu, meinen Mann zu stehen, und – wenn ich Ihnen dabei die Tante aus dem Hause graulen sollte, dann schadet das weiter auch nichts, gelt?«