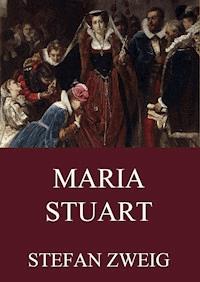
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Jazzybee VerlagHörbuch-Herausgeber: Hierax Medien
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Zweigs Biografie gehört auch heute noch zu den bekanntesten und besten Biografien der ehemaligen Königin von Schottland und Frankreich. Da Schottland zur Zeit ihrer Geburt von politischen und religiösen Unruhen erschüttert war, wurde Maria Stuart im Kindesalter nach Frankreich gebracht und an der Seite ihres künftigen Ehemanns Franz II. erzogen. Durch den frühen Tod von König Franz II. wurde sie bereits im Alter von 17 Jahren zur Witwe und kehrte nach dem langjährigen Aufenthalt in Frankreich 1561 nach Schottland zurück. Dort gelang es ihr nicht, die zahlreichen Spannungen unter den konkurrierenden Adelsfamilien zu befrieden. Nach der Ermordung ihres zweiten Gemahls Lord Darnley, an der ihr eine Mitschuld angelastet wurde, dankte sie 1567 zugunsten ihres Sohnes Jakob I. ab und ging ins Exil nach England. Ihre zweite Lebenshälfte war geprägt von einem fortwährenden Konflikt mit Königin Elisabeth I., der sich unter anderem auf einen Anspruch auf den englischen Königsthron zurückführen ließ. Nachdem Maria Stuart verdächtigt worden war, an einem geplanten Attentat auf die englische Königin beteiligt gewesen zu sein, wurde sie wegen Hochverrats 1587 hingerichtet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maria Stuart
Stefan Zweig
Inhalt:
Maria Stuart
Königin in der Wiege
Jugend in Frankreich
Königin, Witwe und dennoch Königin
Heimkehr nach Schottland
Der Stein kommt ins Rollen
Großer politischer Heiratsmarkt
Die zweite Heirat
Die Schicksalsnacht von Holyrood
Die verratenen Verräter
Furchtbare Verstrickung
Tragödie einer Leidenschaft
Der Weg zum Mord
Quos deus perdere vult ...
Der Weg ohne Ausweg
Die Absetzung
Abschied von der Freiheit
Ein Netz wird gewoben
Das Netz zieht sich zusammen
Die Jahre im Schatten
Die letzte Runde
Es wird Schluß gemacht
Elisabeth gegen Elisabeth
»In meinem Ende ist mein Anbeginn«
Nachspiel
Maria Stuart, S. Zweig
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849605308
www.jazzybee-verlag.de
Maria Stuart
Einleitung
Das Klare und Offenbare erklärt sich selbst, Geheimnis aber wirkt schöpferisch. Immer werden darum jene Gestalten und Geschehnisse der Geschichte nach abermaliger Deutung und Dichtung verlangen, die ein Schleier von Ungewißheit umschattet. Als das geradezu klassische Kronbeispiel für solchen unausschöpfbaren Geheimnisreiz eines historischen Problems darf die Lebenstragödie Maria Stuarts gelten. Kaum eine andere Frau der Weltgeschichte hat so viel Literatur gezeitigt, Dramen, Romane, Biographien und Diskussionen. Durch mehr als drei Jahrhunderte hat sie immer wieder die Dichter verlockt, die Gelehrten beschäftigt, und noch immer erzwingt sich mit unverminderter Kraft ihre Gestalt neue Gestaltung. Denn es ist der Sinn alles Verworrenen, nach der Klarheit sich zu sehnen, und alles Dunklen, nach dem Licht.
Aber auch ebenso gegensätzlich wie häufig ist das Lebengeheimnis Maria Stuarts gestaltet und gedeutet worden: es gibt vielleicht keine Frau, die in so abweichender Form gezeichnet worden wäre, bald als Mörderin, bald als Märtyrerin, bald als törichte Intrigantin, bald als himmlische Heilige. Allein diese Verschiedenheit ihres Bildes ist merkwürdigerweise nicht verschuldet durch Mangel an überliefertem Material, sondern durch seine verwirrende Überfülle. In die Tausende und Abertausende gehen die aufbewahrten Dokumente, Protokolle, Akten, Briefe und Berichte: immer von andern und immer mit neuem Eifer ist seit drei Jahrhunderten von Jahr zu Jahr der Prozeß um ihre Schuld oder Unschuld erneuert worden. Aber je gründlicher man die Dokumente durchforscht, um so schmerzlicher wird man an ihnen der Fragwürdigkeit aller historischen Zeugenschaft (und damit Darstellung) gewahr. Denn wenn auch handschriftlich echt und alt und archivalisch beglaubigt, muß ein Dokument darum durchaus noch nicht verläßlich und menschlich wahr sein. Kaum irgendwo deutlicher als im Falle Maria Stuarts vermag man festzustellen, in wie wilder Abweichung zur selben Stunde ein und dasselbe Geschehnis von zeitgenössischen Beobachtern berichtet werden kann. Gegen jedes dokumentarisch bezeugte Ja steht hier ein dokumentarisch bezeugtes Nein, gegen jede Anschuldigung eine Entschuldigung. Falsches ist Echtem, Erfundenes dem Tatsächlichen so verwirrend beigemengt, daß man eigentlich jede Art der Auffassung auf das glaubwürdigste darzutun imstande ist: wer beweisen will, daß sie an der Ermordung ihres Gatten mitschuldig war, kann Dutzende von Zeugenaussagen beibringen, und ebenso, wer sie als unbeteiligt darzustellen bemüht ist; für jede Ausmalung ihres Charakters sind die Farben im voraus gemischt. Mengt sich dann in solche Wirrnis der vorliegenden Berichte gar noch die Parteilichkeit der Politik oder des Nationalpatriotismus, so muß die Verzerrung des Bildes noch gewaltsamer werden. Ohnedies schon vermag sich die menschliche Natur, sobald zwischen zwei Menschen, zwei Ideen, zwei Weltanschauungen ein Streit um Sein oder Nichtsein geht, kaum der Versuchung zu entziehen, Partei zu nehmen, dem einen recht zu geben und dem andern unrecht, den einen schuldig zu nennen und den andern unschuldig. Gehören aber, wie in dem vorliegenden Falle, die Darsteller meist selbst noch einer der beiden kämpfenden Richtungen, Religionen oder Weltanschauungen an, so ist ihre Einseitigkeit beinahe zwanghaft vorausbestimmt; im allgemeinen haben die protestantischen Autoren alle Schuld restlos auf Maria Stuart, die katholischen auf Elisabeth gehäuft. Bei den englischen Darstellern erscheint sie beinahe immer als Mörderin, bei den schottischen als makelloses Opfer niederträchtiger Verleumdung. Die Kassettenbriefe, das strittigste Diskussionsobjekt, beeiden die einen ebenso unerschütterlich als echt wie die andern als Fälschung, bis in das kleinste Geschehen mengt sich die parteiische Farbgebung aufdringlich ein. Vielleicht hat darum der Nichtengländer und Nichtschotte, er, dem jene blutmäßige Einstellung und Verbundenheit fehlen, eine reinere und vorurteilslosere Möglichkeit zur Objektivität; vielleicht ist es ihm eher gegönnt, an diese Tragödie ausschließlich mit dem zugleich leidenschaftlichen und doch unparteiischen Interesse des Künstlers heranzutreten.
Freilich, auch er wäre verwegen, wollte er vorgeben, die Wahrheit, die ausschließliche Wahrheit über alle Lebensumstände Maria Stuarts zu wissen. Was er erreichen kann, ist nur ein Maximum von Wahrscheinlichkeit, und selbst was er mit bestem Wissen und Gewissen als Objektivität empfindet, wird noch immer subjektiv sein. Denn da die Quellen nicht rein fließen, wird er aus Trübem seine Klarheit zu gewinnen haben. Da die gleichzeitigen Berichte einander widersprechen, wird er bei jeder Einzelheit in diesem Prozeß zwischen Entlastungs- und Belastungszeugnissen wählen müssen. Und so vorsichtig er auch wählen mag, manchmal wird er doch am redlichsten tun, seine Meinung mit einem Fragezeichen zu versehen und einzugestehen, daß die eine oder andere Lebenstatsache Maria Stuarts im Sinne der Wahrheit dunkel geblieben ist und wohl auch für immer bleiben wird.
In dem vorliegenden Versuche ist darum strenge das Prinzip gewahrt, alle jene Aussagen überhaupt nicht zu verwerten, die auf der Folter oder sonst durch Angst oder Zwang abgerungen wurden: erpreßte Geständnisse darf ein wirklicher Wahrheitssucher nie als voll und gültig annehmen. Ebenso wurden die Berichte der Spione und Gesandten (beinahe dasselbe in jener Zeit) nur mit äußerster Vorsicht benützt und jedes Schriftstück von vorneweg angezweifelt; wenn dennoch hier die Ansicht vertreten ist, daß die Sonette und zum Großteil auch die Kassettenbriefe für echt zu halten seien, so geschieht es nach strengster Überprüfung und unter Vorlegung der persönlich überzeugenden Gründe. Überall, wo in den archivalischen Dokumenten gegensätzliche Behauptungen sich kreuzen, wurden beide auf Ursprung und politisches Motiv genau untersucht und, wenn eine Entscheidung zwischen einer und der anderen unvermeidlich war, als letzter Maßstab gesetzt, inwieweit die Einzelhandlung psychologisch mit dem Gesamtcharakter in Einklang zu bringen war.
Denn an sich ist der Charakter Maria Stuarts gar nicht so geheimnisvoll: er ist uneinheitlich nur in seinen äußeren Entwicklungen, innerlich aber vom Anfang bis zum Ende einlinig und klar. Maria Stuart gehört zu jenem sehr seltenen und erregenden Typus von Frauen, deren wirkliche Erlebnisfähigkeit auf eine ganz knappe Frist zusammengedrängt ist, die eine kurze, aber heftige Blüte haben, die sich nicht ausleben in einem ganzen Leben, sondern nur in dem engen und glühenden Raum einer einzigen Leidenschaft. Bis zum dreiundzwanzigsten Jahre atmet ihr Gefühl still und flach, und ebenso wogt es vom fünfundzwanzigsten an nicht ein einziges Mal mehr stark empor, dazwischen aber tobt sich in zwei knappen Jahren ein Ausbruch von elementarer Großartigkeit orkanisch aus, und aus mittlerem Schicksal erhebt sich plötzlich eine Tragödie antikischen Maßes, groß und gewaltig gestuft wie die Orestie. Nur in diesen zwei Jahren ist Maria Stuart wahrhaft eine tragödische Gestalt, nur unter diesem Druck reißt sie sich über sich selbst empor, ihr Leben durch dieses Übermaß zerstörend und zugleich dem Ewigen bewahrend. Und nur dank dieser einen Leidenschaft, die sie menschlich vernichtete, lebt ihr Name noch heute in Dichtung und Deutung fort.
Mit dieser besonders komprimierten Form des inneren Lebenslaufs auf einen einzigen so explosiven Augenblick ist einer jeden Darstellung Maria Stuarts eigentlich von vornherein Form und Rhythmus schon vorgeschrieben; der Nachbildner muß einzig bemüht sein, diese so steil aufschießende und jäh in sich zurückfallende Lebenskurve in ihrer ganzen überraschenden Einmaligkeit in Erscheinung zu bringen. Man empfindet es deshalb nicht als Widerspruch, wenn innerhalb dieses Buches die breiten Zeitspannen ihrer ersten dreiundzwanzig Jahre und wiederum die der fast zwanzig ihrer Gefangenschaft zusammen nicht mehr Raum einnehmen als die zwei Jahre ihrer leidenschaftlichen Tragödie. Denn nur scheinbar ist in der Sphäre eines gelebten Schicksals die äußere und die innere Zeit dieselbe; in Wahrheit bedingt einzig Erfülltheit mit Erlebnis das Maß einer Seele – anders zählt sie von innen den Ablauf der Stunden als der kalte Kalender. Berauscht von Gefühl, selig entspannt und mit Schicksal befruchtet, kann sie unendliche Fülle erfahren in kürzester Frist und abgelöst von der Leidenschaft wiederum endlose Jahre der Leere empfinden, als gleitende Schatten, als taubes Nichts. Darum zählen in einer Lebensgeschichte nur die gespannten, die entscheidenden Augenblicke, darum wird sie nur in ihnen und von ihnen aus gesehen richtig erzählt. Einzig dann, wenn ein Mensch seine ganzen Kräfte ins Spiel bringt, ist er für sich, ist er für die anderen wahrhaft lebendig; immer nur dann, wenn ihm innen die Seele lodert und glüht, wird er auch äußerlich Gestalt.
Dramatis personae
Erster Schauplatz Schottland 1542–1548
Zweiter Schauplatz Frankreich 1548–1561
Dritter Schauplatz Schottland 1561–1568
Vierter Schauplatz England 1568–1587
Schottland
James V.(1512–1542), Vater Maria StuartsMarie von Guise-Lothringen (1515–1560), seine Gattin, Mutter Maria Stuarts
Maria Stuart(1542–1587)
James Stuart, Earl of Moray(1533–1570), unehelicher Sohn James' V. mit Margret Douglas, der Tochter des Lord Erskine, Stiefbruder Maria Stuarts, Regent Schottlands vor und nach Maria Stuarts Regierung
Henry Darnley (Stuart)(1546–1567), Urenkel Heinrich VII. durch seine Mutter Lady Lennox, die Nichte Heinrichs VIII. Zweiter Gatte Maria Stuarts und als solcher zum Mitkönig von Schottland erhoben
James VI.(1566–1625), Sohn Maria Stuarts und Henry Darnleys. Nach dem Tode Maria Stuarts (1587) rechtmäßiger König von Schottland, nach dem Tode Elisabeths (1603) König von England als James I.
James Hepburn, Earl of Bothwell(1536–1578), später Duke of Orkney und dritter Gemahl Maria Stuarts
William Maitland of Lethington, Staatskanzler Maria Stuarts
James Melville, diplomatischer Vertrauensmann Maria Stuarts
James Douglas, Earl of Morton, Regent von Schottland nach Morays Ermordung, hingerichtet 1581
Mathew Stuart, Earl of Lennox, Vater Henry Darnleys, Hauptankläger Maria Stuarts nach dessen Ermordung
ArgyllArranMorton DouglasErskineGordonHarriesHuntlyKirkcaldy of GrangeLindsayMarRuthvendie Lords, bald Anhänger, bald Widersacher Maria Stuarts, unablässig miteinander und gegeneinander im Bunde, fast ausnahmslos auf gewaltsame Weise endend
Mary BeatonMary FlemingMary LivingstoneMary Seton die vier Marys, Jugendgespielinnen Maria Stuarts
###
John Knox(1505–1572), Prediger der »kirk«, Hauptgegner Maria Stuarts
David Rizzio, Musiker und Sekretär am Hofe Maria Stuarts, ermordet 1566
Pierre de Chastelard, französischer Dichter am Hofe Maria Stuarts, hingerichtet 1563
George Buchanan, Humanist und Erzieher James' VI., Verfasser der gehässigsten Pamphlete gegen Maria Stuart
Heinrich II.(1518–1559), seit 1547 König von Frankreich
Katharina von Medici(1519–1589), seine Gattin
Franz II.(1544–1560), deren ältester Sohn, erster Gatte Maria Stuarts
Karl IX.(1550–1574), jüngerer Bruder Franz' II., nach dessen Tode König von Frankreich
Frankreich
###
Kardinal von LothringenClaude de GuiseFrançois de GuiseHenri de Guise die vier Guisen
###
RonsardDu BellayBrantôme die Dichter, Verfasser von Werken zu Maria Stuarts Ehren
###
England
Heinrich VII.(1457–1509), seit 1485 König von England. Großvater und Urgroßvater Maria Stuarts und Darnleys
Heinrich VIII.(1491–1547), sein Sohn, seit 1509 König
Anna Boleyn(1507–1536), zweite Gemahlin Heinrich VIII., als Ehebrecherin erklärt und hingerichtet
Maria I.(1516–1558), Tochter Heinrichs VIII. aus der Ehe mit Katharina von Aragonien, nach dem Tode Eduards VI. (1553) Königin von England
Elisabeth(1533–1603), Tochter Heinrichs VIII. und Anna Boleyns, bei Lebzeiten ihres Vaters als Bastard erklärt, aber nach dem Tode ihrer Stiefschwester Maria (1558) Königin von England
Eduard VI.(1537–1553), Sohn Heinrichs VIII. aus dessen dritter Ehe mit Johanna Seymour, als Kind Maria Stuart verlobt, seit 1547 König
James I., Sohn Maria Stuarts, der Nachfolger Elisabeths
William Cecil, Lord Burleigh(1520–1598), der allmächtige und getreue Staatskanzler Elisabeths
Sir Francis Walsingham, Staatssekretär und Polizeiminister
William Davison, zweiter Sekretär
Robert Dudley, Earl of Leicester(1532–1588), Liebhaber und Vertrauensmann Elisabeths, von ihr als Gatte Maria Stuarts vorgeschlagen
Thomas Howard, Duke of Norfolk, der erste Adelige des Reiches, Bewerber um Maria Stuarts Hand
Talbot, Earl of Shrewsbury, von Elisabeth fünfzehn Jahre lang mit der Überwachung Maria Stuarts betraut
Amyas Poulet, der letzte Kerkermeister Maria Stuarts
Der Scharfrichter von London
Erstes Kapitel
Königin in der Wiege
1542–1548
Sechs Tage ist Maria Stuart alt, da sie Königin von Schottland wird: bereits im ersten Anfang erfüllt sich ihr Lebensgesetz, alles zu früh und ohne wissende Freude vom Schicksal geschenkt zu erhalten. An dem düsteren Dezembertag 1542, da sie im Schlosse von Linlithgow geboren wird, liegt gleichzeitig in dem nachbarlichen Schlosse zu Falkland ihr Vater, James V., auf dem Sterbebette, erst einunddreißig Jahre alt und doch schon vom Leben zerbrochen, der Krone müde, des Kampfes müde. Er war ein tapferer, ritterlicher Mann gewesen und ursprünglich heiteren Sinns, den Künsten, den Frauen leidenschaftlich freund und dem Volke vertraut; oft war er verkleidet zu den Festlichkeiten in die Dörfer gegangen, hatte getanzt und gescherzt mit den Bauern, und manche der schottischen Lieder und Balladen, die er gedichtet, lebten noch lange im Angedenken der Heimat fort. Aber dieser unselige Erbe eines unseligen Geschlechts war in eine wilde Zeit, in ein unbotmäßiges Land geboren und tragischem Geschick von Anfang an zubestimmt. Ein starkwilliger und rücksichtsloser Nachbar, Heinrich VIII., drängt ihn, die Reformation einzuführen, James V. aber bleibt der Kirche treu, und sofort nutzen die schottischen Adeligen, immer geneigt, ihrem Herrscher Schwierigkeiten zu schaffen, den Zwiespalt und treiben den frohmütigen und friedlichen Mann gegen seinen Willen unablässig in Unruhe und Krieg. Vier Jahre früher schon, als James V. um Marie von Guise als Gattin warb, hatte er klar das Verhängnis geschildert, das es bedeutet, König sein zu müssen gegen diesen halsstarrigen und raubgierigen Clan. »Madame«, hatte er in diesem erschütternd aufrichtigen Werbebrief geschrieben, »ich bin erst siebenundzwanzig Jahre alt, und das Leben bedrückt mich schon so sehr wie meine Krone ... Waise von Kindheit an, bin ich der Gefangene ehrgeiziger Adeliger gewesen; das mächtige Haus der Douglas hat mich lange in Knechtschaft gehalten, und ich hasse diesen Namen und jede Erinnerung daran. Archibald, Graf von Angus, Georg, sein Bruder, und alle seine verbannten Verwandten wühlen unausgesetzt den König von England gegen uns auf, es lebt kein Adeliger in meinem Staate, den er nicht mit seinen Versprechungen verführt oder durch Geld bestochen hätte. Es gibt keine Sicherheit für meine Person, keine Bürgschaft für meinen Willen und für die gerechten Gesetze. Alles das erschreckt mich, Madame, und ich erwarte von Ihnen Kraft und Rat. Ohne Geld, einzig auf die Unterstützungen beschränkt, die ich von Frankreich empfange, oder dank den geringfügigen Spenden meiner reichen Geistlichkeit, versuche ich, meine Schlösser auszuschmücken, meine Festungen zu erhalten und Schiffe zu bauen. Aber meine Barone betrachten einen König, der wirklich König sein will, als unerträglichen Rivalen. Trotz der Freundschaft des Königs von Frankreich und der Unterstützung seiner Truppen und trotz der Anhänglichkeit meines Volkes fürchte ich, den entscheidenden Sieg über meine Barone nicht erringen zu können. Ich würde alle Hindernisse überwinden, um den Weg der Gerechtigkeit und der Ruhe für diese Nation frei zu machen, und ich würde dieses mein Ziel vielleicht erreichen, stünden die Adeligen meines Landes allein. Aber der König von England sät zwischen sie und mich unablässig Zwietracht, und die Ketzereien, die er meinem Staate eingepflanzt hat, fressen verheerend bis in die Kreise der Kirche und des Volkes fort. Nun beruhte von je meine und meiner Ahnen Kraft einzig auf der Bürgerschaft der Städte und auf der Kirche, und ich muß mich fragen: Wird diese Kraft uns noch lange verbleiben?«
Alles Unheil, das der König in diesem Kassandrabrief vorausgesehen, erfüllt sich, und noch Schwereres fällt über ihn. Die beiden Söhne, die ihm Marie von Guise schenkt, sterben in der Wiege, und so sieht, gerade in den besten Mannesjahren, James V. noch immer keinen Erben für die Krone, die ihm von Jahr zu Jahr schmerzhafter die Stirne drückt. Schließlich treiben ihn gegen seinen Willen seine schottischen Barone in den Krieg mit dem übermächtigen England, um ihn dann in entscheidender Stunde verräterisch im Stiche zu lassen. Bei Solway Moss verliert Schottland nicht nur eine Schlacht, sondern auch seine Ehre: ohne recht zu kämpfen, laufen die führerlosen Truppen, verlassen von ihren Clansherren, jämmerlich auseinander; der König selbst aber, dieser sonst so ritterliche Mann, ringt in dieser Entscheidungsstunde längst nicht mehr mit fremden Feinden, sondern mit dem eigenen Tod. Fiebernd und müde liegt er zu Bett in dem Schlosse von Falkland, des sinnlosen Kampfes, des lästigen Lebens satt.
Da, an diesem trüben Wintertag, am 9. Dezember 1542, Nebel verdunkelt das Fenster, pocht ein Bote an die Tür. Er meldet dem Siechen, dem Sterbensmüden, eine Tochter sei ihm geboren, eine Erbin. Aber die ausgeschöpfte Seele James' V. hat nicht mehr Kraft zu Hoffnung und Freude. Warum ist es kein Sohn, kein Erbe? Der Todgeweihte kann in allem nur mehr Unglück erblicken, Tragik und Niedergang. Resigniert antwortet er: »Von einer Frau ist die Krone auf uns gekommen, mit einer Frau wird sie dahingehen.« Diese düstere Prophezeiung ist zugleich sein letztes Wort. Er seufzt nur mehr auf, dreht sich in seinem Bette zur Wand und gibt auf keine Frage mehr Antwort. Wenige Tage später ist er begraben und Maria Stuart, noch ehe sie recht die Augen ins Leben aufgeschlagen, Erbin seines Königreiches.
Aber es ist zwiefach dunkles Erbe, eine Stuart zu sein und eine Königin von Schottland, denn keinem Stuart ist bisher auf diesem Throne Glück beschieden gewesen oder Dauer. Zwei der Könige, James I. und James III., sind ermordet worden, zwei, James II. und James IV., auf dem Schlachtfeld gefallen, und zweien ihrer Nachfahren, diesem ahnungslosen Kinde und ihres Blutes Enkel, Karl I., hat das Schicksal noch Grausameres vorbehalten: das Schafott. Keinem aus diesem atridischen Geschlecht ist es gegönnt, die Höhe des Lebens zu erreichen, keinem leuchten Glück und Stern. Immer müssen die Stuarts im Kampf sein gegen die Feinde von außen, gegen die Feinde im Lande und gegen sich selbst, immer ist Unruhe um sie, Unruhe in ihnen. Friedlos wie sie selbst ist ihr Land, und die Ungetreuesten sind darin eben jene, die die Getreuesten sein sollten: die Lords und die Barone, dieses finstere und starke, dieses wilde und zügellose, dieses gierige und kriegsfrohe, dieses trotzige und unbeugsame Rittergeschlecht – »un pays barbare et une gent brutelle«, wie Ronsard, der Dichter, in dies nebelige Land verschlagen, unwillig klagt. Selber kleine Könige auf ihren Landsitzen und Schlössern, herrenmäßig und herdenmäßig ihre Bauern und Schäfer als Schlachtvieh mitschleppend auf ihre ewigen Kleinkämpfe und Raubzüge, kennen diese unbeschränkten Gebieter ihrer Clans keine andere Daseinsfreude als den Krieg, Streit ist ihre Lust, Eifersucht ihr Antrieb, Machtgier ihr Lebensgedanke. »Geld und Vorteil«, schreibt der französische Gesandte, »sind die einzigen Sirenen, denen die schottischen Lords lauschen. Ihnen Pflicht gegen ihre Fürsten, Ehre, Gerechtigkeit, Tugend, edle Handlungen predigen zu wollen hieße sie zum Lachen reizen.« Ähnlich den Condottieri Italiens in ihrer amoralischen Rauflust und Raublust, nur unkultivierter und hemmungsloser in ihren Instinkten, wühlen und streiten sie unablässig um den Vorrang, die alten mächtigen Clans der Gordons, der Hamiltons, der Arrans, der Maitlands, der Crawfords, der Lindsays, Lennox und Argylls. Bald scharen sie sich feindlich gegeneinander in jahrelangen Feuds, bald beschwören sie in feierlichen Bonds eine kurzfristige Treue, um sich gegen einen Dritten zusammenzuschließen, immer bilden sie Klüngel und Rotten, aber keiner hält innerlich zu keinem, und jeder, obwohl mit jedem versippt und verschwägert, bleibt des andern unerbittlicher Neidling und Feind. Etwas Heidnisches und Barbarisches lebt in ihren wilden Seelen ungebrochen weiter, gleichgültig, ob sie sich Protestanten oder Katholiken nennen – je wie es der Vorteil will –, in Wahrheit aber Enkelsöhne Macbeths und Macduffs sie alle, der blutigen Thane, wie sie Shakespeare großartig gesehen.
Nur bei einem Anlaß wird diese unzähmbare eifersüchtige Bande sofort einig: immer wenn es gilt, den gemeinsamen Herrn, den eigenen König niederzuhalten, denn ihnen allen ist Gehorsam gleich unerträglich und Treue gleich unbekannt. Wenn dieses »parcel of rascals« – Burns, der Urschotte, hat sie so gebrandmarkt – ein Schattenkönigtum über ihren Burgen und Besitzen überhaupt noch duldet, so geschieht dies einzig aus Eifersucht eines Clans gegen den andern. Die Gordons lassen den Stuarts nur deshalb die Krone, damit sie nicht an die Hamiltons falle, und die Hamiltons aus Eifersucht gegen die Gordons. Aber wehe, wenn ein König von Schottland einmal wirklich wagen will, Herrscher zu sein und Zucht und Ordnung im Lande zu erzwingen, wenn er im ersten Jugendmut dem Hochmut und der Raffgier der Lords entgegenzutreten sucht! Dann ballt sich sofort das feindselige Pack brüderlich zusammen, um seinen Herrscher machtlos zu machen, und gelingt es nicht mit dem Schwert, so besorgt verläßlich der Mörderdolch diesen Dienst.
Es ist ein tragisches, von düsteren Leidenschaften zerrissenes Land, finster und romantisch wie eine Ballade, dieses meerumfangene kleine Inselreich im letzten Norden Europas, und überdies noch ein armes Land. Denn alle Kraft zerstört hier der ewige Krieg. Die paar Städte, die eigentlich keine sind, sondern nur unter dem Schutz einer Festung zusammengekrochene Armeleutehäuser, können, weil immer wieder geplündert und verbrannt, nie zu Reichtum oder bloß zu bürgerlicher Wohlfahrt gelangen. Die Adelsburgen wieder, düster und gewalttätig noch heute in ihren Ruinen aufragend, stellen keine wirklichen Schlösser dar mit Prunk und höfischer Pracht; sie sind dem Krieg als uneinnehmbare Festungen zugedacht und nicht der milden Kunst der Gastlichkeit. Zwischen diesen wenigen großen Sippschaften und ihren Hörigen fehlt vollkommen die nährende, staatserhaltende Kraft eines schöpferischen Mittelstandes. Das einzige dichtbesiedelte Gebiet zwischen Tweed und Firth liegt zu nahe der englischen Grenze und wird immer wieder durch Einfälle zerstört und entvölkert. Im Norden aber kann man stundenlang wandern an verlassenen Seen, durch öde Weiden oder dunkle nordische Wälder, ohne ein Dorf zu sehen oder eine Burg oder eine Stadt. Nicht drängt sich wie in den überfüllten europäischen Ländern Ort an Ort, nicht tragen breite Straßen Verkehr und Handel ins Land, nicht wie in Holland und Spanien und England fahren von den bewimpelten Reeden Schiffe aus, um von fernen Ozeanen Gold und Gewürz heimzuführen; karg bringen sich hier noch mit Schafzucht und Fischfang und Jagd wie in patriarchalischen Zeiten die Leute durchs Leben: in Gesetz und Sitte, an Reichtum und Kultur steht das damalige Schottland hinter England und Europa zumindest um hundert Jahre zurück. Während in allen Küstenstädten mit dem Anbruch der Neuzeit schon die Banken und Börsen zu blühen beginnen, wird hier wie in biblischen Tagen aller Reichtum noch nach Land und Schafen gemessen; zehntausend besitzt James V., Maria Stuarts Vater, sie sind seine ganze Habe. Ihm eignet kein Kronschatz, er hat keine Armee, keine Leibgarde zur Sicherung seiner Macht, denn er könnte sie nicht bezahlen, und das Parlament, in dem die Lords entscheiden, wird nie seinem König wirkliche Machtmittel bewilligen. Alles, was dieser König über die nackte Notdurft besitzt, wird ihm von seinen reichen Verbündeten, von Frankreich und vom Papst, geliehen oder geschenkt, jeder Teppich, jeder Gobelin, jeder Leuchter in seinen Gemächern und Schlössern ist mit einer Demütigung erkauft.
Diese ewige Armut ist die eiternde Schwäre, die Schottland, diesem schönen edlen Lande, die politische Kraft aus dem Leibe saugt. Denn durch die Bedürftigkeit und Begehrlichkeit seiner Könige, seiner Soldaten, seiner Lords bleibt es ständig ein blutiger Spielball fremder Mächte. Wer gegen den König und für den Protestantismus streitet, erhält seinen Sold von London, wer für den Katholizismus und die Stuarts, von Paris, Madrid und Rom: alle diese auswärtigen Mächte zahlen gern und willig für das schottische Blut. Noch immer schwankt zwischen den beiden großen Nationen, zwischen England und Frankreich, die letzte Entscheidung, darum ist dieser nächste Nachbar Englands für Frankreich ein unersetzlicher Partner im Spiel. Jedesmal, wenn die englischen Armeen in die Normandie vorbrechen, zielt Frankreich schleunig mit diesem Dolch gegen Englands Rücken; sofort stoßen dann die allezeit kriegsfrohen Schotten über die »Border«, gegen ihre »auld enimies« vor, und auch in Friedenszeit bilden sie eine stete Bedrohung. Schottland militärisch zu stärken ist die ewige Sorge der französischen Politik und nichts darum natürlicher, als daß seinerseits England diese Macht durch Aufhetzung der Lords und ständige Rebellionen zu brechen trachtet. So wird dieses unglückselige Land zum blutigen Blachfeld eines hundertjährigen Krieges, und erst im Schicksal dieses noch ahnungslosen Kindes wird er sich endlich endgültig entscheiden.
Es ist ein prachtvoll dramatisches Symbol, daß dieser Kampf tatsächlich schon an Maria Stuarts Wiege beginnt. Noch kann dieses Wickelkind nicht sprechen, nicht denken, nicht fühlen, kaum seine winzigen Händchen im Steckkissen bewegen, und schon greift die Politik nach ihrem unentfalteten Körper, nach ihrer ahnungslosen Seele. Denn das ist Maria Stuarts Verhängnis, ewig gebannt zu sein in dieses rechnerische Spiel. Nie wird ihr gegönnt sein, ihr Ich, ihr Selbst unbekümmert auszuwirken, immer wird sie verstrickt bleiben in Politik, Objekt der Diplomatie, Spielball fremder Wünsche, immer nur Königin, Kronanwärterin, Verbündete oder Feindin sein. Kaum hat der Bote die beiden Nachrichten gemeinsam nach London gebracht, daß James V. gestorben und seine neugeborene Tochter Erbin und Königin von Schottland sei, so beschließt Heinrich VIII. von England, für seinen unmündigen Sohn und Erben Eduard eiligst um diese kostbare Braut zu werben; über einen noch unfertigen Körper, über eine noch schlafende Seele wird wie über eine Ware verfügt. Aber Politik rechnet niemals mit Gefühlen, sondern mit Kronen, Ländern und Erbrechten. Der einzelne Mensch ist für sie nicht vorhanden, er zählt nicht gegenüber den sichtlichen und sachlichen Werten des Weltspiels. In diesem besonderen Falle ist allerdings der Gedanke Heinrichs VIII., die Thronerbin Schottlands mit dem Thronerben Englands zu verloben, ein vernünftiger und sogar ein humaner. Denn längst schon hat dieser unablässige Krieg zwischen den Bruderländern keinen Sinn mehr. Auf derselben Insel im Weltmeer wohnhaft, vom selben Meere umschirmt und umstürmt, verwandter Rasse und ähnlich in den Lebensbedingungen, ist den Völkern Englands und Schottlands zweifellos eine einzige Aufgabe gesetzt: sich zu vereinigen; sinnfällig hat die Natur hier ihren Willen ausgesprochen. Nur die Eifersucht der beiden Dynastien, der Tudors und der Stuarts, steht diesem letzten Ziel noch hemmend entgegen; gelingt es aber nun, durch eine Heirat den Widerstreit der beiden Herrscherhäuser in Bindung zu verwandeln, so können die gemeinsamen Nachkommen der Stuarts und der Tudors zugleich Könige von England und Schottland und Irland sein, ein geeintes Großbritannien kann in den höheren Kampf eintreten: in das Ringen um die Oberherrschaft der Welt.
Aber Verhängnis: immer wenn in der Politik ausnahmsweise eine klare und logische Idee in Erscheinung tritt, wird sie durch törichte Ausführung verdorben. Im Anfang scheint alles trefflich zu glücken. Die Lords, denen rasch Geld in die Taschen geschoben wird, stimmen freudig dem Ehevertrag zu. Doch ein bloßes Pergament genügt dem gewitzten Heinrich VIII. nicht. Zu oft hat er die Heuchelei und Habgier dieser Ehrenmänner erprobt, um nicht zu wissen, daß diese Unzuverlässigen ein Vertrag niemals bindet und daß sie bei höherem Angebot sofort bereit sein werden, die Kindkönigin an den französischen Thronerben zu verschachern. Darum fordert er von den schottischen Unterhändlern als erste Bedingung die sofortige Aushändigung des unmündigen Kindes nach England. Aber wenn die Tudors mißtrauisch gegen die Stuarts, so sind es die Stuarts nicht minder gegen die Tudors, und besonders die Mutter Maria Stuarts wehrt sich gegen diesen Vertrag. Als eine Guise streng katholisch erzogen, will sie ihr Kind nicht ketzerischem Irrglauben ausliefern, und auch sonst hat sie nicht große Mühe, in dem Vertrag eine gefährliche Fußangel zu entdecken. Denn in einem geheimen Artikel haben sich die von Heinrich VIII. bestochenen schottischen Unterhändler verpflichtet, falls das Kind vorzeitig sterben sollte, dahin zu wirken, daß desungeachtet »die ganze Herrschaft und der Besitz des Königreichs« an Heinrich VIII. fallen solle: und dieser Punkt ist bedenklich. Denn von einem Manne, der bereits zweien seiner Frauen das Haupt auf den Block gelegt hat, kann man allenfalls erwarten, daß er, um rascher ein so wichtiges Erbe anzutreten, den Tod dieses Kindes vielleicht etwas vorzeitig und nicht ganz natürlich gestalten könnte; so weist die Königin als sorgliche Mutter die Auslieferung ihrer Tochter nach London ab. Nun wird aus der Brautwerbung beinahe ein Krieg. Heinrich VIII. schickt Truppen aus, um sich mit Gewalt des kostbaren Pfandes zu bemächtigen, und von der nackten Brutalität jenes Jahrhunderts gibt sein Befehl an die Armee ein grausames Bild. »Es ist der Wille Seiner Majestät, daß alles mit Feuer und Schwert ausgetilgt werde. Brennt Edinburgh nieder und macht es der Erde gleich, sobald ihr alles, was ihr könnt, daraus geholt und geplündert habt ... plündert Holyrood und so viele Städte und Dörfer um Edinburgh, als ihr vermögt, plündert und verbrennt und unterwerft Leith und alle anderen Städte, rottet Männer, Frauen und Kinder ohne Schonung aus, wo immer Widerstand geleistet wird.« Wie eine Hunnenschar brechen Heinrichs VIII. bewaffnete Banden über die Grenzen. Aber im letzten Augenblick werden Mutter und Kind auf das feste Schloß von Stirling in Sicherheit gebracht, und Heinrich VIII. muß sich mit einem Vertrag begnügen, in dem sich Schottland verpflichtet, Maria Stuart (immer wird sie wie ein Objekt verhandelt und verkauft) an dem Tage, da sie ihr zehntes Lebensjahr erreicht, nach England auszuliefern.
Abermals scheint alles auf das glücklichste geordnet. Aber Politik ist allezeit die Wissenschaft des Widersinns. Ihr widerstreben die einfachen, die natürlichen, die vernunftmäßigen Lösungen; Schwierigkeiten sind ihre liebste Lust, Zwist ist ihr Element. Bald beginnt die katholische Partei mit verdeckten Machenschaften, ob man das Kind – noch kann es nichts als lallen und lächeln – nicht doch lieber an den französischen Königssohn verschachern solle statt an den englischen, und als Heinrich VIII. stirbt, ist die Neigung, den Vertrag einzuhalten, bereits sehr gering. Jetzt aber fordert für den unmündigen König Eduard der englische Regent Somerset die Auslieferung der Kindbraut nach London, und wie Schottland Widerstand leistet, läßt er eine Armee vorrücken, damit die Lords die einzige Sprache vernehmen, die sie achten: die Gewalt. Am 10. September 1547 wird in der Schlacht – oder vielmehr Schlächterei – von Pinkie Cleugh die schottische Macht zerschmettert, mehr als zehntausend Tote bedecken das Feld. Noch hat Maria Stuart ihr fünftes Lebensjahr nicht erreicht, und schon ist um ihretwillen Blut in Strömen geflossen.
Wehrlos liegt jetzt Schottland den Engländern offen. Aber in dem ausgeplünderten Land ist wenig mehr zu rauben; für die Tudors enthält es eigentlich nur eine einzige Kostbarkeit: dieses Kind, das in sich selbst die Krone und das Kronrecht verkörpert. Doch zur Verzweiflung der englischen Spione ist Maria Stuart plötzlich spurlos aus dem Schlosse von Stirling verschwunden; niemand auch im vertrautesten Kreise weiß, wo die Königinmutter sie versteckt hält. Denn das schützende Nest ist unübertrefflich gut gewählt: bei Nacht und in größter Heimlichkeit hat man durch ganz sichere Diener das Kind in das Kloster Inchmahome bringen lassen, das auf einer kleinen Insel im See von Menteith, »dans le pays des sauvages«, wie der französische Botschafter berichtet, unwegsam verborgen liegt. Kein Steg führt zu dieser romantischen Stätte: mit einem Boot muß man die kostbare Fracht zum Inselufer hinübersetzen, und hier halten Fromme Hut, die selber niemals das Kloster verlassen. Dort, in völliger Verborgenheit, abgeschieden von der aufgeregten und unruhigen Welt, lebt das unwissende Kind im Schatten der Geschehnisse, während über Länder und Meere die Diplomatie geschäftig sein Schicksal webt. Denn Frankreich ist inzwischen drohend auf den Schauplatz getreten, um die völlige Unterjochung Schottlands durch England zu verhindern. Heinrich II., der Sohn Franz' I., sendet eine starke Flotte aus, und in seinem Namen wirbt der Generalleutnant des französischen Hilfskorps um die Hand Maria Stuarts für seinen Sohn und Thronerben Franz. Über Nacht ist das Schicksal dieses Kindes umgesprungen dank des politischen Windes, der scharf und kriegerisch über den Kanal stürmt: statt zur Königin von England ist die kleine Stuartstochter mit einmal zur Königin Frankreichs ausersehen. Kaum ist dieser neue und vorteilhaftere Handel gültig abgeschlossen, so wird am 7. August das kostbare Objekt dieses Schachers, das Kind Maria Stuart, fünf Jahre und acht Monate alt, nach Frankreich verpackt und verschickt, einem andern und ebenso unbekannten Gemahl für Lebenszeit verkauft. Abermals und nicht zum letztenmal formt und verwandelt fremder Wille ihr Schicksal.
Ahnungslosigkeit ist die Gnade der Kindheit. Was weiß ein dreijähriges, ein vierjähriges, ein fünfjähriges Kind von Krieg und Frieden, von Schlachten und Verträgen? Was sind ihm Namen wie Frankreich und England, wie Eduard und François, was all dieser wilde Wahn der Welt? Mit flatternden blonden Haaren läuft und spielt ein schlankbeiniges kleines Mädchen in den finsteren und hellen Räumen eines Schlosses, vier gleichaltrige Freundinnen zur Seite. Denn – ein reizender Gedanke inmitten einer barbarischen Zeit – von Anfang an hat man ihr vier gleichaltrige Gespielinnen mitgegeben, gewählt aus den vornehmsten Familien Schottlands, das Kleeblatt der vier Marys, Mary Fleming, Mary Beaton, Mary Livingstone und Mary Seton. Kinder, sind sie heute des Kindes lustige Gespielinnen, morgen werden sie Kameradinnen in der Fremde sein, damit ihr die Fremde nicht so fremd erscheine, später werden sie ihre Hofdamen werden und in zärtlicher Stimmung den Eid ablegen, nicht früher in den Ehestand zu treten, ehe sie nicht selber einen Gatten gewählt. Und wenn dann die drei andern im Unglück von ihr abfallen, eine wird sie weiter begleiten in das Exil und bis in ihre Todesstunde: ein Glanz seliger Kindheit leuchtet so hinüber bis in ihre dunkelste Stunde. Doch wie weit ist noch diese trübe und verschattete Zeit! Jetzt spielen die fünf Mädchen noch munter tagaus und tagein mitsammen im Schloß von Holyrood oder Stirling und wissen nichts von Hoheit und Würde und Königtum, nichts von seinem Stolz und seinen Gefahren. Dann aber kommt einmal ein Abend, und die kleine Maria wird hinausgetragen aus ihrem Kinderbettchen in die Nacht, ein Boot wartet an einem Teich, man rudert sie hinüber auf eine Insel, wo es still ist und gut – Inchmahome, Ort des Friedens. Fremde Männer grüßen sie dort, anders als andere Männer gekleidet, schwarz und in weiten wallenden Kutten. Aber sie sind freundlich und mild, sie singen schön in dem hohen Raum mit den farbigen Fenstern und das Kind gewöhnt sich ein. Doch abermals holt man sie weg eines Abends (immer wird Maria Stuart so reisen und fliehen müssen, des Nachts, aus einem Schicksal in das andere), und dann steht sie plötzlich auf einem hohen, mit weißen Segeln knatternden Schiff, umringt von fremden Kriegsleuten und bärtigen Matrosen. Aber warum sollte sie Angst haben, die kleine Maria? Alles ist ja sanft und freundlich und gut, der siebzehnjährige Stiefbruder James – einer der zahlreichen Bastarde, die James V. vor seiner ehelichen Zeit gezeugt – streichelt ihr das blonde Haar, und die vier Marys sind da, die geliebten Gespielinnen. So tollen und lachen unbesorgt zwischen den Kanonen des französischen Kriegsschiffes und den geharnischten Matrosen fünf kleine Mädchen, entzückt und beglückt wie Kinder von jeder unerwarteten Veränderung. Oben allerdings, im Mastkorb, steht ängstlich ein Seemann auf Ausguck: er weiß, die englische Flotte kreuzt im Kanal, um in letzter Stunde noch der englischen Königsbraut habhaft zu werden, ehe sie Braut des französischen Thronerben wird. Aber das Kind sieht nur das Nahe, das Neue, es sieht nur: das Meer ist blau, die Menschen sind freundlich, und stark und atmend wie ein riesiges Tier stößt sich das Schiff durch die Flut.
Am 13. August landet endlich die Galione in Roscoff, einem kleinen Hafen bei Brest. Die Boote fahren zum Ufer. Von dem bunten Abenteuer kindlich begeistert, lachend, übermütig und ahnungslos springt die noch nicht sechsjährige Königin von Schottland auf die französische Erde. Aber damit ist ihre Kindheit zu Ende, Pflicht und Prüfung beginnen.
Franz II., König von Frankreich
Zweites Kapitel
Jugend in Frankreich
1548–1559
Der französische Hof ist wohlerfahren in vornehmen Sitten und untadelig in der geheimnisvollen Wissenschaft der Zeremonien. Ein Heinrich II., ein Valois, weiß, was der Braut eines Dauphins an Würde gebührt. Noch vor ihrer Ankunft unterzeichnet er einen Erlaß, daß »la reinette«, daß die kleine Königin von Schottland von allen Städten und Orten auf ihrem Weg mit gleichen Ehren begrüßt werden solle, als ob sie seine eigene Tochter wäre. So erwartet Maria Stuart schon in Nantes eine Fülle bezaubernder Aufmerksamkeiten. Nicht nur sind an allen Straßenecken Galerien mit klassischen Emblemen, Göttinnen, Nymphen und Sirenen errichtet, nicht nur wird die Laune der Begleitmannschaft durch ein paar Fässer köstlichen Weines aufgelockert, nicht nur werden Feuerwerke und Artilleriesalven zu ihren Ehren abgefeuert – auch eine liliputanische Armee, hundertfünfzig kleine Kinder, alle unter acht Jahren, marschieren in ihren weißen Kleidchen, zu einer Art Ehrenregiment zusammengefaßt, mit Pfeifen und Trommeln, mit Miniaturpiken und Hellebarden jubelnd der kleinen Königin voran. Und so geht es von Ort zu Ort: in einer ununterbrochenen Folge von Festen gelangt die Kind-Königin Maria Stuart endlich nach Saint-Germain. Dort erblickt das noch nicht sechsjährige Mädchen zum erstenmal seinen Bräutigam, einen viereinhalbjährigen, schwachen, fahlen und rachitischen Knaben, den das vergiftete Blut von vornherein zu Siechtum und frühem Tode bestimmt und der scheu und schüchtern seine »Braut« begrüßt. Um so herzlicher aber empfangen sie die andern Mitglieder der königlichen Familie, von ihrer kindlichen Anmut entzückt, und Heinrich II. nennt sie in einem Briefe begeistert »la plus parfayt entfant que je vys jamès«.
Der französische Hof stellt in jenen Jahren einen der glänzendsten und großartigsten der Welt dar. Eben ist das Mittelalter mit seiner Verdüsterung dahingegangen, aber noch liegt ein letztes romantisches Leuchten sterbenden Rittertums auf diesem Übergangsgeschlecht. Noch wirken sich Kraft und Mut in der Freude an der Jagd, an Ringelstechen und Turnieren, an Abenteuer und Krieg in alter harter Art männlich aus, doch schon hat sich das Geistige Herrenrecht gewonnen im Kreise der Herrschenden und der Humanismus nach den Klöstern und Universitäten die Königsschlösser erobert. Von Italien her ist die Prunkliebe der Päpste, das geistig-sinnliche Genießertum der Renaissance, die Freude an den schönen Künsten siegreich nach Frankreich vorgedrungen, und so entsteht hier in dieser Weltminute eine fast einzigartige Bindung von Kraft und Schönheit, von Mut mit Sorglosigkeit: die hohe Kunst, den Tod nicht zu fürchten und dennoch das Leben sinnlich zu lieben. Natürlicher und freier als irgendwo gattet sich im französischen Wesen Temperament mit Leichtigkeit, die gallische »Chevalerie« wird wunderbar eins mit der klassischen Kultur der Renaissance. Zugleich wird von einem Edelmann gefordert, bei dem Turnier im Panzerrock den Gegner wuchtig mit der Lanze anzureiten und mit anmutvoller Wendung die künstlichsten Figuren des Tanzes vorbildlich auszuführen, er muß die rauhe Kriegswissenschaft ebenso meistern wie die zarten Gesetze der höfischen Courtoisie; dieselbe Hand, die den pfundigen Zweihänder im Nahkampf führt, muß verstehen, zärtlich die Laute zu schlagen und einer geliebten Frau Sonette zu schreiben: beides in einem zu sein, stark und zart, rauh und kultiviert, kampfgeübt und kunstgebildet, ist das Ideal der Zeit. Tagsüber setzen der König und seine Edelleute mit schäumenden Rüden stundenlang den Hirschen und Ebern nach, Speere werden gebrochen und Lanzen zerspellt, aber abends versammeln sich in den Sälen der großartig erneuerten Schlösser des Louvre oder von Saint-Germain, Blois und Amboise die Edelleute und Edeldamen zu geistiger Unterhaltung. Verse werden vorgelesen, Madrigale gesungen, Musik wird gemacht, in Maskenspielen der Geist der klassischen Literatur erweckt. Die Gegenwart der vielen schönen und geschmückten Frauen, das Werk von Dichtern und Malern wie Ronsard, Du Bellay und Clouet verleiht diesem fürstlichen Hofe eine einzige Farbigkeit und Freudigkeit, die sich in allen Formen der Kunst und des Lebens verschwenderisch ausdrückt. Wie überall in Europa vor dem unglückseligen Glaubenskrieg steht Frankreich damals vor einem Aufschwung zu großer Kultur.
Wer an solchem Hofe leben, und vor allem, wer an solchem Hofe dereinst als Gebieter herrschen soll, muß sich diesen neuen kulturellen Forderungen anpassen. Er muß zur Vollendung streben in allen Künsten und Wissenschaften, er muß seinen Geist ebenso zu schmeidigen wissen wie seinen Körper. Ewig wird es eines der herrlichsten Ruhmesblätter des Humanismus bleiben, daß er gerade jenen, die im obern Kreise des Lebens wirken wollen, Vertrautheit mit allen Künsten zur Pflicht macht. Kaum je zu einer Zeit wurde so eindringlich nicht nur bei den Männern von Stande, sondern auch bei den Edelfrauen – eine neue Epoche hat damit begonnen – auf vollendete Erziehung geachtet. Wie Maria von England und Elisabeth muß Maria Stuart ebenso die klassischen Sprachen studieren, Griechisch und Latein, wie die zeitgenössischen, Italienisch, Englisch und Spanisch. Aber dank eines hellen und geschwinden Geistes und der von ihren Ahnen ererbten Kulturfreude wird dem begabten Kinde jede Mühe zum Spiel. Bereits mit dreizehn Jahren rezitiert sie, die aus den Colloquien des Erasmus ihr Latein gelernt hat, vor dem ganzen Hof im Saale des Louvre eine selbstverfaßte lateinische Rede, und stolz kann ihr Oheim, der Kardinal von Lothringen, an Maria Stuarts Mutter, Marie von Guise, berichten: »Ihre Tochter ist so gewachsen und wächst jeden Tag so sehr an innerer Größe, Schönheit und Klugheit, daß sie bereits in allen guten und ehrenhaften Dingen so vollendet wie nur möglich ist und in diesem Königreich niemand unter den Töchtern des Adels oder der anderen Stände ihr zu vergleichen wäre. Ich darf melden, daß der König so großen Geschmack an ihr findet, daß er oft mehr als eine Stunde sich nur mit ihr befaßt, und sie weiß ihn mit klugen und vernünftigen Reden so gut zu unterhalten wie sonst eine Frau von fünfundzwanzig Jahren!« In der Tat ist die geistige Entwicklung Maria Stuarts eine ganz ungewöhnlich frühzeitige. Bald beherrscht sie das Französische mit derartiger Sicherheit, daß sie auch dichterischen Ausdruck wagen und die huldigenden Verse eines Ronsard und Du Bellay in würdiger Weise zu erwidern vermag; und nicht nur zu gelegentlichem höfischem Spiel, sondern gerade in den Augenblicken innerer Bedrängnis wird sie von nun ab ihr Gefühl am liebsten Versen anvertrauen, die Dichtung liebend und von allen Dichtern geliebt. Aber auch in allen anderen Kunstformen offenbart sie außerordentlichen Geschmack; sie singt anmutig zur Laute, ihr Tanz wird als bezaubernd gerühmt, ihre Stickereien sind Werke nicht nur einer geschickten, sondern auch besonders begabten Hand, ihre Kleidung bleibt diskret und wirkt nie überladen wie die pompösen Glockenroben, in denen Elisabeth stolziert; im schottischen Kilt wie im seidenen Staatskleide erscheint sie mit ihrer mädchenhaften Anmut gleich natürlich. Takt und Schönheitssinn sind bei Maria Stuart von Anfang an natürliche Gaben, und diese ihre hohe und doch nicht theatralische Haltung, die ihr für alle Zeiten die Aura des Poetischen verleiht, wird diese Stuartstochter selbst in den schlimmsten Stunden als kostbares Erbe ihres königlichen Bluts und ihrer fürstlichen Erziehung bewahren. Jedoch auch in sportlichen Dingen steht sie hinter den Gewandtesten dieses ritterlichen Hofes kaum zurück, eine unermüdliche Reiterin, eine leidenschaftliche Jägerin, eine geschickte Ballspielerin; ihr hochgewachsener, schlanker Mädchenkörper kennt bei aller Grazie kein Erschöpfen und Ermatten. Hell und heiter, sorglos und selig trinkt sie aus allen Bechern diese reiche und romantische Jugend, ohne zu ahnen, daß sie damit das reinste Glück ihres Lebens schon unbewußt erschöpft: kaum in einer anderen Gestalt hat das Frauenideal der französischen Renaissance so ritterlich-romantischen Ausdruck gefunden wie in diesem frohen und feurigen Königskind.
Nicht nur die Musen aber, sondern auch die Götter segnen diese Kindheit. Zu den erfreulichen geistigen Gaben ist Maria Stuart auch ungewöhnliche körperliche Anmut verliehen. Kaum wird das Kind zum Mädchen, zur Frau, so wetteifern bereits alle Dichter, ihre Schönheit zu preisen. »In ihrem fünfzehnten Jahr begann ihre Schönheit wie das Licht im hellen Mittag zu erscheinen«, verkündet Brantôme und noch leidenschaftlicher Du Bellay:
»En vôtre esprit le ciel s'est surmonté Nature et art ont en vôtre beauté Mis tout le beau dont la beauté s'assemble.«
Lope de Vega schwärmt: »Die Sterne entlehnen ihren schönsten Glanz ihrem Auge und ihren Zügen die Farben, die sie so wunderbar machen«, und Ronsard unterlegt Karl IX. bei dem Tode seines Bruders Franz die folgenden Worte beinahe neidvoller Bewunderung:
»Avoir joui d'une telle beauté Sein contre sein, valoit ta royauté«
und Du Bellay faßt all das Lob der vielen Beschreibungen und Gedichte in den beseligten Ausruf zusammen:
»Contentez vous mes yeux, Vous ne verrez jamais une chose pareille.«
Nun sind Dichter immer berufsmäßige Übertreiber, und besonders Hofdichter, sobald es gilt, die Vorzüge ihrer Herrscherin zu rühmen; neugierig blickt man darum die Bilder jener Zeit an, denen die meisterliche Hand Clouets Verläßlichkeit verbürgt, und ist weder enttäuscht noch völlig jener hymnischen Begeisterung gewonnen. Man sieht keine strahlende Schönheit, sondern eher eine pikante: ein zartes anmutiges Oval, dem die etwas spitze Nase jenen Reiz der leichten Unregelmäßigkeit verleiht, der ein Frauenantlitz immer besonders anziehend macht. Ein weiches dunkles Auge blickt Geheimnis und verschleierten Glanz, still und verschwiegen ruht der Mund: man muß zuerkennen, daß für dieses Fürstenkind die Natur tatsächlich ihr kostbarstes Material verwendet hat, eine wundervolle weiße, blanke, schimmernde Haut, aschblondes und üppiges Haar, das sich gefällig mit Perlen durchwirkt, lange, feine, schneehelle Hände, einen hohen, geschmeidigen Körper, »dont le corsage laissait entrevoir la neige de sa poitrine et dont le collet relevé droit decouvrait le pur modelé de ses épaules«. Kein Makel ist in diesem Gesicht zu finden, aber eben weil es so kühl fehllos, so glattwegs schön ist, fehlt ihm noch jeder entscheidende Zug. Man weiß nichts von diesem anmutigen Mädchen, wenn man in ihr Bildnis blickt, und sie selbst weiß noch nichts von ihrem wahren Wesen. Noch ist nicht von innen heraus dieses Antlitz mit Seele und Sinnlichkeit durchdrungen, noch spricht sich hier nicht die Frau in dieser Frau aus: freundlich und angenehm sieht ein hübsches, sanftes Pensionatsmädchen einen an.
Diese Unfertigkeit, diese Unerwachtheit bestätigen trotz ihres redseligen Überschwangs auch alle mündlichen Berichte. Denn gerade dadurch, daß sie immer nur die Tadellosigkeit, die besondere Wohlerzogenheit, den Fleiß und die Korrektheit Maria Stuarts rühmen, sprechen sie von ihr wie von einer Vorzugsschülerin. Man erfährt, daß sie vortrefflich lernt, daß sie liebenswürdig im Gespräche ist, manierlich und fromm, daß sie in allen Künsten und Spielen exzelliert, ohne für irgendeine Kunst eine besondere, eine entscheidende Begabung zu besitzen, daß sie brav und folgsam das einer Königsbraut vorgeschriebene Bildungspensum bewältigt. Aber immer sind es nur die gesellschaftlichen, die höfischen Vorzüge, die alle bewundern, das Unpersönliche in ihr statt des Persönlichen; von dem Menschen, von dem Charakter gibt kein einziger besondere Kunde, und dies bezeugt, daß das Eigentliche, das Wesentliche ihrer Natur vorläufig jedem Blick noch verschlossen blieb, einfach darum, weil es noch nicht aufgeblüht war. Noch jahrelang läßt die Wohlerzogenheit und Weltkultur der Prinzessin die innere Gewalt der Leidenschaft nicht ahnen, welcher die Seele der Frau, einmal im tiefsten berührt und erschlossen, fähig sein wird. Blank und kühl glänzt noch ihre Stirne, freundlich und zart lächelt ihr Mund, dunkel sinnt und sucht das Auge, das nur in die Welt und noch nicht in die eigene Tiefe geblickt: noch wissen die anderen, noch weiß Maria Stuart nichts von dem Erbe in ihrem Blut, noch nichts von ihren eigenen Gefahren. Immer enthüllt erst die Leidenschaft in einer Frau die innerste Seele, immer erst in der Liebe und im Leiden erreicht sie das eigene Maß.
Früher, als eigentlich vorausgesehen, wird, da das Kind sich so verheißungsvoll zur künftigen Fürstin entfaltet, die Hochzeit gerüstet: abermals ist es Maria Stuart zubestimmt, daß ihre Lebensuhr in jedem Sinne geschwinder laufen soll als die ihrer Altersgenossen. Zwar ist der vertragsmäßig ihr zugedachte Dauphin kaum vierzehn Jahre alt und überdies ein besonders schwächlicher, ein fahler, kranker Knabe. Aber die Politik ist hier ungeduldiger als die Natur, sie will und darf nicht warten. Man hat recht verdächtige Eile am französischen Königshofe, das Ehegeschäft abzuschließen, eben weil man um die Schwächlichkeit und die gefährliche Kränklichkeit dieses Erben aus den besorgten Berichten der Ärzte weiß. Und das Wichtigste an dieser Heirat ist für die Valois doch nur, sich die schottische Krone zu sichern; darum zerrt man so hastig die beiden Kinder an den Altar. In dem Ehevertrag, der gemeinsam mit den Abgesandten des schottischen Parlaments abgeschlossen wird, erhält der Dauphin die »matrimonial crown«, die Mitkönigskrone Schottlands, aber gleichzeitig pressen ihre Verwandten, die Guisen, der ihrer Verantwortung gar nicht bewußten fünfzehnjährigen Maria in aller Heimlichkeit noch ein zweites Dokument ab, das dem schottischen Parlament verborgen bleiben soll und in dem sie sich voraus verpflichten muß, im Falle vorzeitigen Todes, oder falls sie ohne Erben sterben sollte, ihr Land – als ob es ihr Privateigentum wäre – und sogar ihre Erbrechte auf England und Irland der französischen Krone zu vermachen.
Dieser Vertrag ist selbstverständlich – schon die Heimlichkeit der Unterzeichnung beweist es – eine Unehrlichkeit. Denn Maria Stuart hat gar kein Recht, willkürlich die Erbfolge zu ändern und ihr Vaterland im Falle ihres Todes einer fremden Dynastie wie einen Mantel oder eine sonstige Habe zu vermachen; aber die Oheime nötigen die noch ahnungslose Hand zur Unterschrift. Tragisches Symbol: die erste Unterschrift, die Maria Stuart unter dem Fingerdruck ihrer Verwandten auf ein politisches Dokument setzt, stellt zugleich die erste Lüge dieser im tiefsten aufrichtigen, vertrauensvollen und eindeutigen Natur dar. Doch um Königin zu werden, um Königin zu bleiben, wird es ihr von nun ab nie mehr erlaubt sein, völlig wahr zu bleiben: ein Mensch, der sich der Politik verschworen, gehört nicht mehr sich selbst und muß anderen Gesetzen gehorchen als den heiligen seiner Natur.
Großartig aber werden diese geheimen Machenschaften vor der Welt durch das prunkvolle Schauspiel der Hochzeitsfeier verdeckt. Seit mehr als zweihundert Jahren hat kein Dauphin von Frankreich innerhalb seiner Heimat geheiratet; so glaubt es der Hof von Valois sich schuldig zu sein, dem sonst nicht verwöhnten Volke ein Beispiel unerhörter Pracht zu geben. Katharina, die Mediceerin, kennt aus ihrer Heimat die von den ersten Künstlern entworfenen Festzüge der Renaissance und empfindet es als Ehrgeiz, auch die prunkvollsten ihrer Kindheit bei der Hochzeit ihres Kindes zu übertreffen: Paris wird an diesem 24. April 1558 die Feststadt der Welt. Vor Notre-Dame ist ein offener Pavillon mit einen ciel-royal aus blauer Zypernseide, durchwirkt mit goldenen Lilien, errichtet, zu dem ein blauer, gleichfalls mit Lilien bestickter Teppich führt. Musikanten marschieren voran, rot und gelb gewandet, auf mannigfachen Instrumenten spielend, dann folgt, jubelnd begrüßt, in den kostbarsten Kleidern, der königliche Zug. Vor den Augen des Volkes wird die Vermählung vollzogen, tausende und abertausende Blicke grüßen bewundernd die Braut an der Seite des schmächtigen fahlen Knaben, den sein Pomp fast erdrückt. Die Hofpoeten überbieten sich auch bei diesem Anlaß in ekstatischen Schilderungen ihrer Schönheit. »Sie erschien«, schreibt hymnisch Brantôme, der sonst lieber seine galanten Anekdoten erzählt, »hundertmal schöner als eine himmlische Göttin«, und vielleicht hat wirklich in jener Stunde der Glanz ihres Glückes dieser leidenschaftlich ehrgeizigen Frau eine besondere Aura verliehen. Denn in dieser Stunde genießt dies lächelnde, nach allen Seiten beglückt grüßende, dies herrlich junge und blühende Mädchen vielleicht den prunkvollsten Augenblick seines Lebens. Nie mehr wird Maria Stuart dermaßen von Reichtum, Bewunderung und Jubel umbrandet sein wie nun, da sie, an der Seite des ersten Fürstensohnes von ganz Europa, an der Spitze seiner köstlich geschmückten Reiterschar durch die Straßen zieht, die bis zu den Dächern hinauf donnern von Jubel und Begeisterung. Abends wird im Justizpalast öffentliche Tafel gehalten, ganz Paris darf jetzt, begeistert zudrängend, dieses junge Mädchen bewundern, das eine neue Krone zur Krone Frankreichs gebracht. Den ruhmreichen Tag beendet ein Ball, für welchen die Künstler die wunderbarsten Überraschungen ersonnen haben. Sechs ganz mit Gold geschmückte Schiffe, mit Segeln aus Silberstoff, künstlich die Bewegungen stürmischer Fahrt nachahmend, werden von unsichtbaren Maschinisten in den Saal hineingezogen. In jedem sitzt, in Gold gekleidet und mit damastener Maske, ein Prinz, und jeder führt mit galanter Geste eine der Frauen des Hofes in sein Schiff, Katharina von Medici, die Königin, Maria Stuart, die Thronfolgerin, dann die Königin von Navarra und die Prinzessinnen Elisabeth, Margarethe und Claudia. Glückliche Fahrt durchs Leben in Prunk und Pracht soll dieses Spiel symbolisch andeuten. Aber das Schicksal läßt sich durch menschliche Wünsche nicht meistern, und anderen, gefährlicheren Gestaden steuert von diesem einzig sorglosen Augenblick an das Lebensschiff Maria Stuarts zu.
Die erste Gefahr kommt völlig unvermutet. Zur Königin von Schottland ist Maria Stuart längst gesalbt, der Roi Dauphin, der Thronfolger Frankreichs, hat sie zur Gattin erhoben; damit schwebt schon eine zweite, eine noch kostbarere Krone unsichtbar über ihrem Haupte. Da hält ihr das Schicksal als verderbliche Versuchung eine dritte Krone hin, und sie greift in kindischer Art, mit unberatenen, mit verblendeten Händen nach ihrem trügerischen Glanz. Im selben Jahre 1558, da sie die Gattin des französischen Thronfolgers wird, stirbt Maria, die Königin von England, und sofort besteigt ihre Stiefschwester Elisabeth den englischen Thron. Aber ist Elisabeth wahrhaft die erbberechtigte Königin? Heinrich VIII., der frauenreiche Blaubart, hat drei Kinder hinterlassen, Eduard und zwei Töchter, von denen Maria aus seiner Ehe mit Katharina von Aragonien stammt und Elisabeth aus der Ehe mit Anna Boleyn. Nach dem frühen Tode Eduards wird Maria, weil die Ältere und aus unbezweifelbar rechtlicher Ehe geboren, die Erbin des Throns, aber ist es jetzt nach ihrem kinderlosen Tode auch Elisabeth? Ja, sagen die englischen Kronjuristen, denn der Bischof hat die Ehe geschlossen, der Papst sie anerkannt. Nein, sagen die französischen Kronjuristen, denn Heinrich VIII. hat nachträglich seine Ehe mit Anna Boleyn für ungültig erklären lassen und Elisabeth durch Parlamentsbeschluß als Bastard. Ist aber Elisabeth nach dieser – von der ganzen katholischen Welt bekräftigten Auffassung – als Bastard thronunwürdig, so steht jetzt der Anspruch auf den Königsthron von England niemandem andern zu als Maria Stuart, der Urenkelin Heinrichs VII.
Eine ungeheure und welthistorische Entscheidung fällt damit über Nacht in die Hände eines sechzehnjährigen unerfahrenen Mädchens. Maria Stuart hat zwei Möglichkeiten. Sie kann nachgiebig sein und politisch handeln, sie kann ihre Base Elisabeth als berechtigte Königin von England anerkennen und ihren eigenen Anspruch unterdrücken, der zweifellos nur mit der Waffe durchzufechten ist. Oder aber sie kann kühn und entschlossen Elisabeth eine Kronräuberin nennen und die französische, die schottische Armee aufbieten, um die Usurpatorin vom Throne gewaltsam herunterzustoßen. Verhängnisvollerweise wählen Maria Stuart und ihre Berater den dritten Weg, den unglückseligsten, den es in der Politik gibt: den Mittelweg. Statt eines kräftig entschlossenen Schlages gegen Elisabeth führt der französische Hof bloß einen prahlerischen Lufthieb: auf Befehl Heinrichs II. nimmt das Kronprinzenpaar in sein Wappen auch die englische Königskrone auf und Maria Stuart läßt sich späterhin öffentlich und in allen Urkunden »Regina Franciae, Scotiae, Angliae et Hiberniae« nennen. Man erhebt also den Anspruch, aber man verteidigt ihn nicht. Man bekriegt nicht Elisabeth, man verärgert sie bloß. Statt einer wirklichen Tat mit Eisen und Schwert wählt man die machtlose Geste eines Anspruchs auf bemaltem Holz und beschriebenem Papier; damit ist eine dauernde Zweideutigkeit geschaffen, denn in dieser Form ist der Anspruch Maria Stuarts auf den englischen Thron da und wieder nicht da. Je nach Belieben versteckt man ihn einmal und holt ihn das andere Mal wieder heraus. So antwortet Heinrich II. Elisabeth, als sie gemäß dem Vertrage die Rückgabe von Calais verlangt: »In diesem Falle muß Calais der Gemahlin des Dauphins, der Königin von Schottland, übergeben werden, die wir alle als Königin von England betrachten.« Aber andererseits rührte Heinrich II. keine Hand, um diesen Anspruch seiner Schwiegertochter zu verteidigen, sondern verhandelt weiter mit der angeblichen Thronräuberin wie mit einer gleichberechtigten Monarchin.
Durch diese törichte leere Geste, durch dies kindisch-eitle aufgemalte Wappen ist für Maria Stuart nichts erreicht und alles verdorben. Im Leben eines jeden Menschen gibt es Fehler, die nicht mehr gutzumachen sind. So hat auch hier durch diese eine im Kindesalter mehr aus Trotz und Eitelkeit als aus bewußter Überlegung begangene politische Ungeschicklichkeit Maria Stuart eigentlich ihr ganzes Leben zerstört, denn mit dieser einen Kränkung macht sie sich die mächtigste Frau Europas zur unversöhnlichen Feindin. Eine wirkliche Herrscherin kann alles erlauben und dulden, nur dies eine nicht, daß ein anderer ihr Herrscherrecht bezweifelt. Nichts ist darum natürlicher und man kann es Elisabeth nicht verdenken, wenn sie von dieser Stunde an Maria Stuart als die gefährlichste Rivalin betrachtet, als den Schatten hinter ihrem Thron. Was immer auch von dieser Stunde zwischen den beiden gesagt und geschrieben wird, muß Tünche sein und trügerische Wortmalerei, um die innere Gegnerschaft zu verdecken, aber darunter bleibt unheilbar der Riß. Immer richten Halbheiten und Unehrlichkeiten in der Politik und im Leben mehr Schaden an als die energischen und scharfen Entschlüsse. Die nur symbolisch hingemalte englische Krone im Wappenschilde Maria Stuarts hat mehr Blut verschuldet als ein wirklicher Krieg um die wirkliche Krone. Denn ein offener Kampf hätte die Sachlage einmal und endgültig entschieden, dieser aber, der hinterhältige, erneut sich immer wieder und verstört beiden Frauen die Herrschaft und das Leben.
Dieses verhängnisvolle Wappenschild mit dem englischen Hoheitsabzeichen wird auch im Juli 1559 stolz und sichtbar dem Roi Dauphin und der Reine Dauphine in Paris bei einem Turnier vorangetragen, das zur Feier des Friedens von Cateau-Cambrésis veranstaltet wird. Der ritterliche König Heinrich II. läßt es sich nicht nehmen, selbst eine Lanze »pour l'amour des dames« zu brechen, und jeder weiß, welche Dame er meint: Diana von Poitiers, die stolz und schön von ihrer Loge auf ihren königlichen Liebhaber niederblickt. Aber aus dem Spiel wird plötzlich furchtbarer Ernst. In diesem Zweikampf entscheidet sich Weltgeschichte. Denn der Kapitän der schottischen Leibwache Montgomery rennt, nachdem seine Lanze schon abgesplittert ist, mit ihrem Stumpf so ungeschickt heftig den König, seinen Spielgegner, an, daß ein Splitter durch das Visier tief ins Auge dringt und der König ohnmächtig von Pferde stürzt. Erst hält man die Verletzung noch für ungefährlich, aber die Besinnung kehrt nicht mehr wieder, entsetzt umsteht die Familie das Bett des Fiebernden. Einige Tage kämpft noch die kraftvolle Natur des tapferen Valois gegen den Tod; endlich, am 10. Juli, steht das Herz still.
Aber selbst im tiefsten Schmerz ehrt der französische Hof noch die Sitte als den obersten Herrn des Lebens. Wie die königliche Familie das Schloß verläßt, bleibt Katharina von Medici, die Gemahlin Heinrichs II., plötzlich an der Tür stehen. Nicht ihr gebührt seit dieser Stunde, die sie zur Witwe gemacht hat, der Vortritt mehr bei Hofe, sondern der Frau, welche die gleiche Stunde zur Königin erhoben. Mit zagem Schritt, befangen und verwirrt, muß Maria Stuart als Gattin des neuen Königs von Frankreich an der Königin von gestern vorbeischreiten. Und mit diesem einzigen Schritt hat sie, siebzehnjährig, alle Altersgenossinnen überholt und die höchste Stufe der Macht erreicht.
Drittes Kapitel
Königin, Witwe und dennoch Königin
Juli 1560 bis August 1561
Nichts hat die Lebenslinie Maria Stuarts so sehr ins Tragische gewendet, als daß ihr das Schicksal alles an irdischer Macht so trügerisch mühelos in die Hände gibt. Ihr Aufstieg erfolgt in derart raketenhaft geschwinder Kurve – mit sechs Tagen Königin von Schottland, mit sechs Jahren Braut eines der mächtigsten Prinzen Europas, mit siebzehn Jahren Königin von Frankreich –, daß sie das höchste Maß an äußerer Macht schon in Händen hält, noch ehe ihr inneres Leben wahrhaft begonnen hat. Alles fällt ihr aus unsichtbarem Füllhorn scheinbar unerschöpflich zu, und nichts davon ist durch eigenen Willen erworben, durch eigene Kraft erkämpft, nichts Mühe und nichts Verdienst, alles Erbe, Gnade und Geschenk. Wie im Traume, wo alles flughaft-farbig vorüberflieht, erlebt sie sich im Hochzeits-, im Krönungskleide, und ehe sie mit wachen Sinnen diesen verfrühten Frühling begreifen kann, ist er schon verblüht, verwelkt, vorüber, und sie erwacht enttäuscht, geplündert, beraubt, verstört. In einem Alter, da andere erst zu wünschen, zu hoffen, zu begehren beginnen, hat sie bereits alle Möglichkeiten des Triumphes durchschritten, ohne Zeit und Muße gehabt zu haben, ihn auch seelisch zu erfassen. In dieser Vorschnelle ihres Schicksals ist aber auch das Geheimnis ihrer Unruhe und Ungenügsamkeit im Samenkorn verschlossen: wer so früh die Erste eines Landes, einer Welt gewesen, wird sich nie mit kleinem Lebensmaß mehr bescheiden können. Nur schwache Naturen verzichten und vergessen, die starken aber fügen sich nicht und fordern auch das übermächtige Schicksal zum Kampfe heraus.
In der Tat, wie ein Traum geht diese kurze Königszeit in Frankreich dahin, wie ein hastiger, unruhiger, angstvoller, sorgenvoller Traum. Die Kathedrale von Reims, wo der Erzbischof dem blassen kranken Knaben die Krone auf das Haupt drückt und die schöne junge, mit allen Juwelen des Schatzes geschmückte Königin inmitten des Adels wie eine schmale, schlanke, noch nicht voll erblühte Lilie aufleuchtet, schenkt ihr einen einzigen, farbig vorstrahlenden Augenblick, sonst meldet die Chronik keine Feste und Fröhlichkeiten. Das Schicksal läßt Maria Stuart keine Zeit, jenen troubadourischen Hof der Künste und der Dichtung zu schaffen, von dem sie träumte, keine Zeit auch den Malern, das Bild des Monarchen und seiner schönen Gattin in Prunkgemälden festzuhalten, keine Zeit den Chronisten, ihren Charakter zu schildern, keine Zeit dem Volke, seine Herrscher kennen oder gar lieben zu lernen; wie zwei hastige Schatten, von bösem Wind gejagt, fliehen diese beiden Kindergestalten in der langen Reihe der Könige von Frankreich vorüber.
Denn Franz II. ist krank und von Anbeginn zu frühem Tode gezeichnet wie ein Baum im Wald. Ängstlich, mit schweren, müden, wie vom Schlaf aufgeschreckten Augen, blickt aus rundem, gedunsenem Gesicht ein fahler kleiner Knabe den Betrachter an, und ein plötzlich einsetzendes und darum unnatürliches Wachstum schwächt noch mehr seine Widerstandskraft. Ständig wachen die Ärzte um ihn und raten dringend zur Schonung. Jedoch in diesem Knaben pocht ein törichter, kindischer Ehrgeiz, hinter seiner schlanken, sehnigen Gemahlin, die Jagd und Sport leidenschaftlich liebt, nicht zurückzubleiben. Er zwingt sich gewaltsam zu hitzigen Ritten und körperlichen Anstrengungen, um sich Gesundheit und Männlichkeit vorzutäuschen; aber die Natur läßt sich nicht





























