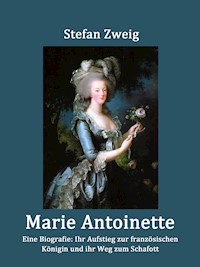
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die spannende Biografie der Marie Antoinette in Romanform mit zahlreichen zeitgenössischen Darstellungen. Aus dem Inhalt: Einleitung Ein Kind wird verheiratet Geheimnis des Alkovens Debüt in Versailles Der Kampf um ein Wort Die Eroberung von Paris Le Roi est mort, vive le Roi! Bildnis eines Königspaares Königin des Rokoko Trianon Die neue Gesellschaft Der Bruder besucht seine Schwester Mutterschaft Die Königin wird unbeliebt Der Blitzschlag ins Rokokotheater Die Halsbandaffäre Prozess und Urteil Das Volk erwacht, die Königin erwacht Der Sommer der Entscheidung Die Freunde fliehen Der Freund erscheint War er es, war er es nicht? Die letzte Nacht in Versailles Der Leichenwagen der Monarchie Selbstbesinnung Mirabeau Die Flucht wird vorbereitet Die Flucht nach Varennes Die Nacht in Varennes Rückfahrt Einer betrügt den Andern Der Freund erscheint zum letzten Mal Die Flucht in den Krieg Die letzten Schreie Der zehnte August Der Temple Marie Antoinette allein Die letzte Einsamkeit Die Conciergerie Der letzte Versuch Die große Infamie Der Prozess beginnt Die Verhandlung Die letzte Fahrt Die Totenklage Zeittafel Nachbemerkung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 694
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Marie Antoinette
Marie AntoinetteEinleitungEin Kind wird verheiratetGeheimnis des AlkovensDebüt in VersaillesDer Kampf um ein WortDie Eroberung von ParisLe Roi est mort, vive le Roi!Bildnis eines KönigspaaresKönigin des RokokoTrianonDie neue GesellschaftDer Bruder besucht seine SchwesterMutterschaftDie Königin wird unbeliebtDer Blitzschlag ins RokokotheaterDie HalsbandaffäreProzess und UrteilDas Volk erwacht, die Königin erwachtDer Sommer der EntscheidungDie Freunde fliehenDer Freund erscheintWar er es, war er es nicht? (Eine Zwischenfrage)Die letzte Nacht in VersaillesDer Leichenwagen der MonarchieSelbstbesinnungMirabeauDie Flucht wird vorbereitetDie Flucht nach VarennesDie Nacht in VarennesRückfahrtEiner betrügt den AndernDer Freund erscheint zum letzten MalDie Flucht in den KriegDie letzten SchreieDer zehnte AugustDer TempleMarie Antoinette alleinDie letzte EinsamkeitDie ConciergerieDer letzte VersuchDie große InfamieDer Prozess beginntDie VerhandlungDie letzte FahrtDie TotenklageZeittafelNachbemerkungImpressumMarie Antoinette
Stefan Zweig
Marie Antoinette im Jahr 1778Gemälde von Élisabeth Vigée-Lebrun
Einleitung
Die Geschichte der Königin Marie Antoinette schreiben, heißt einen mehr als hundertjährigen Prozess aufnehmen, in dem Ankläger und Verteidiger auf das Heftigste gegeneinander sprechen. Den leidenschaftlichen Ton der Diskussion verschuldeten die Ankläger. Um das Königtum zu treffen, musste die Revolution die Königin angreifen, und in der Königin die Frau. Nun wohnen Wahrhaftigkeit und Politik selten unter einem Dach, und wo zu demagogischem Zweck eine Gestalt gezeichnet werden soll, ist von den gefälligen Handlangern der öffentlichen Meinung wenig Gerechtigkeit zu erwarten. Kein Mittel, keine Verleumdung gegen Marie Antoinette wurde gespart, um sie auf die Guillotine zu bringen, jedes Laster, jede moralische Verworfenheit, jede Art der Perversität in Zeitungen, Broschüren und Büchern der „louve autrichienne“ unbedenklich zugeschrieben; selbst im eigenen Haus der Gerechtigkeit, im Gerichtssaal, verglich der öffentliche Ankläger die „Witwe Capet“ pathetisch mit den berühmtesten Lasterfrauen der Geschichte, mit Messalina, Agrippina und Fredegundis. Um so entschiedener erfolgte dann der Umschwung, als 1815 abermals ein Bourbone den französischen Thron bestieg; um der Dynastie zu schmeicheln, wird das dämonisierte Bild mit den öligsten Farben übermalt: keine Darstellung Marie Antoinettes aus dieser Zeit ohne Weihrauchwolke und Heiligenschein. Preislied folgt auf Preislied, Marie Antoinettes unberührbare Tugend wird ingrimmig verteidigt, ihr Opfermut, ihre Güte, ihr makelloses Heldentum in Vers und Prosa gefeiert; und reichlich mit Tränen genetzte Anekdotenschleier, meist von aristokratischen Händen geklöppelt, umhüllen das verklärte Antlitz der „reine martyre“, der Märtyrerkönigin.
Die seelische Wahrheit liegt hier wie meist in der Nähe der Mitte. Marie Antoinette war weder die große Heilige des Royalismus noch die Dirne, die „grue“ der Revolution, sondern ein mittlerer Charakter, eine eigentlich gewöhnliche Frau, nicht sonderlich klug, nicht sonderlich töricht, nicht Feuer und nicht Eis, ohne besondere Kraft zum Guten und ohne den geringsten Willen zum Bösen, die Durchschnittsfrau von gestern, heute und morgen, ohne Neigung zum Dämonischen, ohne Willen zum Heroischen und scheinbar darum kaum Gegenstand einer Tragödie. Aber die Geschichte, dieser große Demiurg, bedarf gar nicht eines heroischen Charakters als Hauptperson, um ein erschütterndes Drama emporzusteigern. Tragische Spannung, sie ergibt sich nicht nur aus dem Übermaß einer Gestalt, sondern jederzeit aus dem Missverhältnis eines Menschen zu seinem Schicksal. Sie kann dramatisch in Erscheinung treten, wenn ein übermächtiger Mensch, ein Held, ein Genius in Widerstreit gerät zur Umwelt, die sich zu eng, zu feindselig erweist für seine ihm eingeborene Aufgabe – ein Napoleon etwa, erstickend im winzigen Geviert von St. Helena, ein Beethoven, eingekerkert in seine Taubheit – immer und überall bei jeder großen Gestalt, die nicht ihr Maß und ihren Ausstrom findet. Aber ebenso ergibt sich Tragik, wenn eine mittlere oder gar schwächliche Natur in ein ungeheures Schicksal gerät, in persönliche Verantwortungen, die sie erdrücken und zermalmen, und diese Form des Tragischen will mir sogar die menschlich ergreifendere erscheinen. Denn der außerordentliche Mensch sucht unbewusst ein außerordentliches Schicksal; seiner überdimensionalen Natur ist es organisch gemäß, heroisch oder, nach Nietzsches Wort, „gefährlich“ zu leben; er fordert die Welt durch den ihm innewohnenden gewaltigen Anspruch gewaltsam heraus. So ist der geniale Charakter im Letzten nicht unschuldig an seinem Leiden, weil die Sendung in ihm diese Feuerprobe mystisch begehrt zur Auslösung einer letzten Kraft; wie der Sturm die Möwe, so trägt ihn sein starkes Schicksal stärker und höher empor. Der mittlere Charakter dagegen ist von Natur aus auf friedliche Lebensform gestellt, er will, er benötigt gar nicht größere Spannung, er möchte lieber ruhig und im Schatten leben, in Windstille und gemäßigten Schicksalstemperaturen; darum wehrt er sich, darum ängstigt er sich, darum flüchtet er, wenn ihn eine unsichtbare Hand in Erschütterung stößt. Er will keine welthistorischen Verantwortungen, im Gegenteil, er fürchtet sich vor ihnen; er sucht das Leiden nicht, sondern es wird ihm aufgenötigt; von außen, nicht von innen wird er gezwungen, größer zu sein als sein eigentliches Maß. Dieses Leiden des Nicht-Helden, des mittleren Menschen sehe ich, weil ihm der sichtliche Sinn fehlt, nicht als geringer an als das pathetische des wahrhaften Helden und vielleicht noch als erschütternder; denn der Jedermannsmensch muss es allein für sich austragen und hat nicht wie der Künstler die selige Rettung, seine Qual in Werk und überdauernde Form zu verwandeln.
Wie einen solchen mittleren Menschen aber manchmal das Schicksal aufzupflügen vermag und durch seine gebietende Faust über seine eigene Mittelmäßigkeit gewaltsam hinauszutreiben, dafür ist das Leben Marie Antoinettes vielleicht das einleuchtendste Beispiel der Geschichte. Die ersten dreißig ihrer achtunddreißig Jahre geht diese Frau gleichgültigen Weg, allerdings in einer auffälligen Sphäre; nie überschreitet sie im Guten, nie im Bösen das durchschnittliche Maß: eine laue Seele, ein mittlerer Charakter und, historisch gesehen, anfangs nur Statistenfigur. Ohne den Einbruch der Revolution in ihre heiter unbefangene Spielwelt hätte diese an sich unbedeutende Habsburgerin gelassen weitergelebt wie hundert Millionen Frauen aller Zeiten; sie hätte getanzt, geplaudert, geliebt, gelacht, sich aufgeputzt, Besuche gemacht und Almosen gegeben; sie hätte Kinder geboren und sich schließlich still in ein Bett gelegt, um zu sterben, ohne wahrhaft dem Weltgeist gelebt zu haben. Man hätte sie als Königin feierlich aufgebahrt, Hoftrauer getragen, aber dann wäre sie ebenso dem Gedächtnis der Menschheit entschwunden wie alle die unzähligen andern Prinzessinnen, die Marie-Adelaiden und Adelaide-Marien und die Anna-Katharinen und Katharina-Annen, deren Grabsteine mit lieblosen kalten Lettern ungelesen im Gotha stehen. Nie hätte ein lebendiger Mensch das Verlangen gefühlt, ihrer Gestalt, ihrer erloschenen Seele nachzufragen, niemand hätte gewusst, wer sie wirklich war, und – dies das Wesentlichste – nie hätte sie selber, Marie Antoinette, Königin von Frankreich, ohne ihre Prüfung gewusst und erfahren, wer sie gewesen. Denn es gehört zum Glück oder Unglück des mittleren Menschen, dass er von selbst keinen Zwang fühlt, sich auszumessen, dass er nicht Neugierde fühlt, nach sich selber zu fragen, ehe ihn das Schicksal fragt: Ungenützt lässt er seine Möglichkeiten in sich schlafen, seine eigentlichen Anlagen verkümmern, seine Kräfte wie Muskeln, die nie geübt werden, verweichlichen, bevor sie nicht Not zu wirklicher Abwehr spannt. Ein mittlerer Charakter muss erst herausgetrieben werden aus sich selber, um alles zu sein, was er sein könnte, und vielleicht mehr, als er selber früher ahnte und wusste; dafür hat das Schicksal keine andere Peitsche als das Unglück. Und so, wie sich ein Künstler manchmal mit Absicht einen äußerlich kleinen Vorwurf sucht, statt eines pathetisch weltumspannenden, um seine schöpferische Kraft zu erweisen, so sucht sich das Schicksal von Zeit zu Zeit den unbedeutenden Helden, um darzutun, dass es auch aus brüchigem Stoff die höchste Spannung, aus einer schwachen und unwilligen Seele eine große Tragödie zu entwickeln vermag. Eine solche Tragödie und eine der schönsten dieses ungewollten Heldentums heißt Marie Antoinette.
Denn mit welcher Kunst, mit welcher Erfindungskraft an Episoden, in wie ungeheuren historischen Spannungsdimensionen baut hier die Geschichte diesen mittleren Menschen in ihr Drama ein, wie wissend kontrapunktiert sie die Gegensätze um diese ursprünglich wenig ergiebige Hauptfigur! Mit diabolischer List verwöhnt sie erst diese Frau. Als Kind schon schenkt sie ihr einen Kaiserhof als Haus, der Halbwüchsigen eine Krone, der jungen Frau häuft sie verschwenderisch alle Gaben der Anmut, des Reichtums zu und gibt ihr überdies ein leichtes Herz, das nicht fragt nach Preis und Wert dieser Gaben. Jahrelang verwöhnt sie, verzärtelt sie dieses unbedachte Herz, bis ihm die Sinne schwinden und es immer sorgloser wird. Aber so rasch und leicht das Schicksal diese Frau auf die höchsten Höhen des Glücks emporreißt: um so raffiniert grausamer, um so langsamer lässt es sie dann fallen. Mit melodramatischer Krassheit stellt dieses Drama die äußersten Gegensätze Stirn an Stirn; es stößt sie aus einem hundertzimmerigen Kaiserhause in ein erbärmliches Gefängnisgelass, vom Königsthron auf das Schafott, aus der gläsern-goldenen Karosse auf den Schinderkarren, aus dem Luxus in die Entbehrung, aus Weltbeliebtheit in den Hass, aus Triumph in die Verleumdung, immer tiefer und tiefer und unerbittlich bis in die letzte Tiefe hinab. Und dieser kleine, dieser mittlere Mensch, plötzlich inmitten seiner Verwöhntheit überfallen, dieses unverständige Herz, es begreift nicht, was die fremde Macht mit ihm vorhat, es spürt nur eine harte Faust an sich kneten, eine glühende Kralle im gemarterten Fleisch; dieser ahnungslose Mensch, unwillig und ungewohnt alles Leidens, wehrt sich und will nicht, er stöhnt, er flüchtet, er sucht zu entkommen. Aber mit der Unerbittlichkeit eines Künstlers, der nicht ablässt, ehe er nicht seinem Stoff die höchste Spannung, die letzte Möglichkeit entrungen, lässt die wissende Hand des Unglücks nicht von Marie Antoinette, ehe sie diese weiche und unkräftige Seele nicht zu Härte und Haltung gehämmert, ehe sie nicht alles, was von Eltern und Urahnen an Größe in ihrer Seele verschüttet lag, plastisch herausgezwungen hat. Aufschreckend in ihrer Qual erkennt endlich die geprüfte Frau, die nie nach sich gefragt, die Verwandlung; sie spürt, gerade da ihre äußere Macht zu Ende geht, dass in ihr innen etwas Neues und Großes beginnt, das ohne jene Prüfung nicht möglich gewesen wäre. „Erst im Unglück weiß man wahrhaft, wer man ist“, diese halb stolzen, halb erschütterten Worte springen ihr plötzlich vom staunenden Munde: Eine Ahnung überkommt sie, dass eben durch dieses Leiden ihr kleines mittleres Leben als Beispiel für die Nachwelt lebt. Und an diesem Bewusstsein höherer Verpflichtung wächst ihr Charakter über sich selber hinaus. Kurz bevor die sterbliche Form zerbricht, ist das Kunstwerk, das überdauernde, gelungen, denn in der letzten, der allerletzten Lebensstunde erreicht Marie Antoinette, der mittlere Mensch, endlich tragödisches Maß und wird so groß wie sein Schicksal.
Ein Kind wird verheiratet
Maria Antonia von Österreich im Jahr 1769
Gemälde von Joseph Ducreux
Jahrhunderte lang haben Habsburg und Bourbon auf Dutzenden deutscher, italienischer, flandrischer Schlachtfelder um die Vorherrschaft Europas gerungen; endlich sind sie müde, alle beide. In zwölfter Stunde erkennen die alten Rivalen, dass ihre unersättliche Eifersucht nur andern Herrscherhäusern den Weg freigekämpft hat; schon greift von der englischen Insel ein Ketzervolk nach dem Imperium der Welt, schon wächst die protestantische Mark Brandenburg zu mächtigem Königtum, schon bereitet sich das halbheidnische Russland vor, seine Machtsphäre ins Unermessliche auszudehnen; wäre es nicht besser, so beginnen sich – wie immer zu spät – die Herrscher und ihre Diplomaten zu fragen, man hielte miteinander Frieden, statt abermals und abermals zugunsten ungläubiger Emporkömmlinge das verhängnisvolle Kriegsspiel zu erneuern? Choiseul am Hofe Ludwigs XV., Kaunitz als Berater Maria Theresias schmieden ein Bündnis, und damit es sich dauerhaft und nicht bloß als Atempause zwischen zwei Kriegen bewähre, schlagen sie vor, die beiden Dynastien Habsburg und Bourbon sollten sich durch Blut binden. An heiratsfähigen Prinzessinnen hat es im Hause Habsburg zu keiner Zeit gefehlt; auch diesmal steht eine reichhaltige Auswahl aller Alterslagen bereit. Zuerst erwägen die Minister, Ludwig XV. trotz seines großväterlichen Standes und seiner mehr als zweifelhaften Sitten mit einer habsburgischen Prinzessin zu vermählen, aber der Allerchristlichste König flüchtet rasch aus dem Bett der Pompadour in das einer andern Favoritin, der Dubarry. Auch Kaiser Joseph, zum zweiten Mal verwitwet, zeigt keine rechte Neigung, sich mit einer der drei altbackenen Töchter Ludwigs XV. verkuppeln zu lassen – so bleibt als natürlichste Verknüpfung die dritte, den heranwachsenden Dauphin, den Enkel Ludwigs XV. und zukünftigen Träger der französischen Krone, mit einer Tochter Maria Theresias zu verloben. 1766 kann die damals elfjährige Marie Antoinette bereits als ernstlich vorgeschlagen gelten; ausdrücklich schreibt der österreichische Botschafter am 24. Mai an die Kaiserin: „Der König hat sich in einer Art und Weise ausgesprochen, dass Eure Majestät das Projekt schon als gesichert und entschieden betrachten können.“ Aber Diplomaten wären nicht Diplomaten, setzten sie nicht ihren Stolz daran, einfache Dinge schwierig zu machen, und vor allem, jede wichtige Angelegenheit kunstvoll zu verzögern. Intrigen von Hof zu Hof werden eingeschaltet, ein Jahr, ein zweites, ein drittes, und Maria Theresia, nicht mit Unrecht argwöhnisch, fürchtet, ihr ungemütlicher Nachbar, Friedrich von Preußen, „le monstre“, wie sie ihn in herzhafter Erbitterung nennt, werde schließlich auch noch diesen für Österreichs Machtstellung so entscheidenden Plan mit einer seiner machiavellistischen Teufeleien durchkreuzen; so wendet sie alle Liebenswürdigkeit, Leidenschaft und List an, um den französischen Hof aus dem halben Versprechen nicht mehr herauszulassen. Mit der Unermüdlichkeit einer berufsmäßigen Heiratsvermittlerin, mit der zähen und unnachgiebigen Geduld ihrer Diplomatie lässt sie immer wieder die Vorzüge der Prinzessin nach Paris melden; sie überschüttet die Gesandten mit Höflichkeiten und Geschenken, damit sie endlich aus Versailles ein bindendes Eheangebot heimholen; mehr Kaiserin als Mutter, mehr auf die Mehrung der „Hausmacht“ bedacht als auf das Glück ihres Kindes, lässt sie sich auch durch die warnende Mitteilung ihres Gesandten nicht abhalten, die Natur habe dem Dauphin alle Gaben versagt: Er sei von sehr beschränktem Verstand, höchst ungeschlacht und völlig gefühllos. Aber wozu braucht eine Erzherzogin glücklich zu werden, wenn sie nur Königin wird? Je hitziger Maria Theresia auf Pakt und Brief drängt, desto überlegener hält der weltkluge König Ludwig XV. zurück; drei Jahre lang lässt er sich Bilder und Berichte über die kleine Erzherzogin schicken und erklärt sich grundsätzlich dem Heiratsplan geneigt. Aber er spricht nicht das erlösende Werbungswort, er bindet sich nicht.
Das ahnungslose Unterpfand dieses wichtigen Staatsgeschäftes, die elfjährige, die zwölfjährige, die dreizehnjährige Toinette, zart gewachsen, anmutig, schlank und unbezweifelbar hübsch, tollt und spielt unterdessen mit Schwestern und Brüdern und Freundinnen temperamentvoll in den Zimmern und Gärten von Schönbrunn; mit Studien, Büchern und Bildung befasst sie sich wenig. Ihre Gouvernanten und die Abbés, die sie erziehen sollen, versteht sie mit ihrer natürlichen Liebenswürdigkeit und quecksilbernen Munterkeit so geschickt um den Finger zu wickeln, dass sie allen Schulstunden entwischen kann. Mit Schrecken bemerkt eines Tages Maria Theresia, die sich bei der Fülle der Staatsgeschäfte nie um ein einzelnes Stück ihrer Kinderherde sorgfältig bekümmern konnte, dass die zukünftige Königin von Frankreich mit dreizehn Jahren weder Deutsch noch Französisch richtig zu schreiben versteht und nicht einmal mit den oberflächlichsten Kenntnissen in Geschichte und allgemeiner Bildung behaftet ist; mit den musikalischen Leistungen steht es nicht viel besser, obwohl kein Geringerer als Gluck ihr Klavierunterricht gab. In zwölfter Stunde soll jetzt das Versäumnis nachgeholt, die verspielte und faule Toinette zur gebildeten Dame heranerzogen werden. Wichtig für eine zukünftige Königin von Frankreich ist vor allem, dass sie anständig tanzt und mit gutem Akzent Französisch spricht; zu diesem Zweck engagiert Maria Theresia eiligst den großen Tanzmeister Noverre und zwei Schauspieler einer in Wien gastierenden französischen Truppe, den einen für die Aussprache, den andern für Gesang. Aber kaum meldet dies der französische Gesandte dem bourbonischen Hof, als schon ein entrüsteter Wink aus Versailles kommt: Eine zukünftige Königin von Frankreich dürfe nicht von Komödiantenpack unterrichtet werden. Hastig werden neue diplomatische Verhandlungen eingeleitet, denn Versailles betrachtet die Erziehung der vorgeschlagenen Braut des Dauphins bereits als eigene Angelegenheit, und nach langem Hin und Her wird auf Empfehlung des Bischofs von Orléans ein Abbé Vermond als Erzieher nach Wien gesandt; von ihm besitzen wir die ersten verlässlichen Berichte über die dreizehnjährige Erzherzogin. Er findet sie reizend und sympathisch: „Mit einem entzückenden Antlitz vereint sie alle erdenkbare Anmut der Haltung, und wenn sie, wie man hoffen darf, etwas wächst, wird sie alle Reize haben, die man für eine hohe Prinzessin wünschen kann. Ihr Charakter und ihr Gemüt sind ausgezeichnet.“ Bedeutend vorsichtiger äußert sich jedoch der brave Abbé über die tatsächlichen Kenntnisse und die Lernfreude seiner Schülerin. Verspielt, unaufmerksam, ausgelassen, von einer quecksilberigen Munterkeit, hat die kleine Marie Antoinette trotz leichtester Auffassung nie die geringste Neigung gezeigt, sich mit irgendeinem ernsten Gegenstand zu beschäftigen. „Sie hat mehr Verstand, als man lange bei ihr vermutet hat, doch leider ist dieser Verstand bis zum zwölften Jahre an keine Konzentration gewöhnt worden. Ein wenig Faulheit und viel Leichtfertigkeit haben mir den Unterricht bei ihr noch erschwert. Ich begann während sechs Wochen mit den Grundzügen der schönen Literatur, sie fasste gut auf, urteilte richtig, aber ich konnte sie nicht dazu bringen, tiefer in die Gegenstände einzudringen, obwohl ich fühlte, dass sie die Fähigkeiten dazu hätte. So sah ich schließlich ein, dass man sie nur erziehen kann, indem man sie gleichzeitig unterhält.“
Fast wörtlich werden noch zehn, noch zwanzig Jahre später alle Staatsmänner über diese Denkunwilligkeit bei großem Verstand, über dieses gelangweilte Davonhuschen aus jedem gründlichen Gespräch klagen; schon in der Dreizehnjährigen liegt die ganze Gefahr dieses Charakters, der alles könnte und nichts wahrhaft will, völlig zutage. Aber am französischen Hofe wird seit der Mätressenwirtschaft die Haltung einer Frau mehr geschätzt als ihr Gehalt; Marie Antoinette ist hübsch, sie ist repräsentativ und anständigen Charakters, – das genügt, und so geht denn endlich 1769 das lang ersehnte Schreiben Ludwigs XV. an Maria Theresia ab, in dem der König feierlich um die Hand der jungen Prinzessin für seinen Enkel, den zukünftigen Ludwig XVI., wirbt und als Termin der Heirat die Ostertage des nächsten Jahres vorschlägt. Beglückt stimmt Maria Theresia zu; nach vielen sorgenvollen Jahren erlebt die tragisch resignierte Frau noch einmal eine helle Stunde. Gesichert scheint ihr jetzt der Frieden des Reiches und damit Europas; mit Stafetten und Kurieren wird sogleich allen Höfen feierlich verkündet, dass Habsburg und Bourbon für ewige Zeiten aus Feinden Blutsverbündete geworden sind. „Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube“; noch einmal hat sich der alte Hausspruch der Habsburger bewährt.
Die Aufgabe der Diplomaten, sie ist glücklich beendet. Aber nun erst erkennt man: Dies war der Arbeit leichterer Teil. Denn Habsburg und Bourbon zu einer Verständigung zu überreden, Ludwig XV. und Maria Theresia zu versöhnen, welch ein Kinderspiel dies im Vergleich zu der ungeahnten Schwierigkeit, das französische und österreichische Hof- und Hauszeremoniell bei einer so repräsentativen Festlichkeit unter einen Hut zu bringen. Zwar haben die beiderseitigen Obersthofmeister und sonstigen Ordnungsfanatiker ein ganzes Jahr lang Zeit, das ungeheuer wichtige Protokoll der Hochzeitsfestivitäten in allen Paragrafen auszuarbeiten, aber was bedeutet ein flüchtiges, nur zwölfmonatiges Jahr für derart verzwickte Chinesen der Etikette. Ein Thronfolger von Frankreich heiratet eine österreichische Erzherzogin – welche welterschütternden Taktfragen löst solcher Anlass aus, wie tiefsinnig muss hier jede Einzelheit durchdacht werden, wie viel unwiderrufliche Fauxpas heißt es da durch Studium jahrhundertealter Dokumente vermeiden! Tag und Nacht sinnen die heiligen Hüter der Sitten und Gebräuche in Versailles und Schönbrunn mit dampfenden Köpfen; Tag und Nacht verhandeln die Gesandten wegen jeder einzelnen Einladung, Eilkuriere mit Vorschlägen und Gegenvorschlägen sausen hin und her, denn man bedenke, welche unübersehbare Katastrophe (ärger als sieben Kriege) könnte hereinbrechen, würde bei diesem erhabenen Anlass die Rangeitelkeit eines der hohen Häuser verletzt! In zahllosen Dissertationen rechtsüber, linksüber den Rhein erwägt und erörtert man heikle Doktorfragen, etwa diese, wessen Name an erster Stelle im Heiratskontrakt genannt sein solle, derjenige der Kaiserin von Österreich oder des Königs von Frankreich, wer zuerst unterzeichnen dürfe, welche Geschenke gegeben, welche Mitgift vereinbart werden solle, wer die Braut zu begleiten, wer sie zu empfangen habe, wie viel Kavaliere, Ehrendamen, Militärs, Gardereiter, Ober- und Unterkammerfrauen, Friseure, Beichtiger, Ärzte, Schreiber, Hofsekretäre und Waschfrauen dem Hochzeitszug einer Erzherzogin von Österreich bis zur Grenze gebühren und wie viele dann der französischen Thronfolgerin von der Grenze bis nach Versailles. Während aber die beiderseitigen Perücken über die Grundlinien der Grundfragen noch lange nicht einig sind, streiten ihrerseits schon, als gälte es den Schlüssel des Paradieses, an beiden Höfen die Kavaliere und ihre Damen untereinander, gegeneinander, übereinander um die Ehre, den Hochzeitszug, sei es begleiten, sei es empfangen zu dürfen, jeder Einzelne verteidigt seine Ansprüche mit einem ganzen Kodex von Pergamenten; und obwohl die Zeremonienmeister wie die Galeerensträflinge arbeiten, kommen sie doch innerhalb eines ganzen Jahres mit diesen weltwichtigsten Fragen des Vortritts und der Hofzulässigkeit nicht völlig zu Rand: Im letzten Augenblick wird zum Beispiel die Vorstellung des elsässischen Adels aus dem Programm gestrichen, um „die langwierigen Etikettefragen auszuschalten, die zu regeln keine Zeit mehr bleibt“. Und hätte königlicher Befehl das Datum nicht auf einen ganz bestimmten Tag festgesetzt, die österreichischen und französischen Zeremonienhüter wären bis zum heutigen Tage über die „richtige“ Form der Hochzeit noch nicht einig, und es hätte keine Königin Marie Antoinette und vielleicht keine Französische Revolution gegeben.
Auf beiden Seiten wird, obwohl Frankreich wie Österreich Sparsamkeit bitter nötig hätten, die Hochzeit auf höchsten Pomp und Prunk gestellt. Habsburg will hinter Bourbon und Bourbon hinter Habsburg nicht zurückbleiben. Das Palais der französischen Gesandtschaft in Wien erweist sich als zu klein für die fünfzehnhundert Gäste; Hunderte von Arbeitern errichten in fliegender Eile Anbauten, während gleichzeitig ein eigener Opernsaal in Versailles für die Hochzeitsfeier vorbereitet wird. Für die Hoflieferanten, für die Hofschneider, Juweliere, Karossenbauer kommt hüben und drüben gesegnete Zeit. Allein für die Einholung der Prinzessin bestellt Ludwig XV. bei dem Hoffournisseur Francien in Paris zwei Reisewagen von noch nie da gewesener Pracht: köstliches Holz und schimmernde Gläser, innen mit Samt ausgeschlagen, außen mit Malereien verschwenderisch geschmückt, von Kronen überwölbt und trotz dieses Prunks herrlich federnd und schon bei leichtestem Zuge fortrollend. Für den Dauphin und den königlichen Hof werden neue Paraderöcke angeschafft und mit kostbaren Juwelen durchstickt, der große Pitt, der herrlichste Diamant jener Zeit, schmückt den Hochzeitshut Ludwigs XV., und mit gleichem Luxus bereitet Maria Theresia den Trousseau ihrer Tochter: Spitzenwerk, eigens in Mecheln geklöppelt, zartestes Leinen, Seide und Juwelen. Endlich trifft der Gesandte Durfort als Brautwerber in Wien ein, herrliches Schauspiel für die leidenschaftlich schaulustigen Wiener: achtundvierzig sechsspännige Karossen, darunter die beiden gläsernen Wunderwerke, rollen langsam und gravitätisch durch die bekränzten Straßen zur Hofburg, hundertsiebentausend Dukaten haben allein die neuen Livreen der hundertsiebzehn Leibgarden und Lakaien gekostet, die den Brautwerber begleiten, der ganze Einzug nicht weniger als dreihundertfünfzigtausend. Von dieser Stunde an reiht sich Fest an Fest: öffentliche Werbung, feierlicher Verzicht Marie Antoinettes auf ihre österreichischen Rechte vor Evangelium, Kruzifix und brennenden Kerzen, Gratulationen des Hofes, der Universität, Parade der Armee, Théâtre paré, Empfang und Ball im Belvedere für dreitausend Personen, Gegenempfang und Souper für fünfzehnhundert Gäste im Liechtensteinpalais, endlich am 19. April die Eheschließung per procurationem in der Augustinerkirche, bei der Erzherzog Ferdinand den Dauphin vertritt. Dann noch ein zärtliches Familiensouper und am 21. feierlicher Abschied, letzte Umarmung. Und durch ein ehrfürchtiges Spalier fährt in der Karosse des französischen Königs die gewesene Erzherzogin von Österreich, Marie Antoinette, ihrem Schicksal entgegen.
Der Abschied von ihrer Tochter war Maria Theresia schwer geworden. Jahre und Jahre hat die alternde, abgemüdete Frau diese Heirat um der Mehrung der habsburgischen „Hausmacht“ Willen als das höchste Glück erstrebt, und doch macht in letzter Stunde das Schicksal ihr Sorge, das sie selbst ihrem Kinde bestimmt. Blickt man tiefer in ihre Briefe, in ihr Leben, so erkennt man: Diese tragische Herrscherin, der einzige große Monarch des österreichischen Hauses, trägt die Krone längst nur noch als Bürde. Mit unendlicher Mühe, in immerwährenden Kriegen hat sie das zusammengeheiratete und in gewissem Sinne künstliche Reich gegen Preußen und Türken, gegen Osten und Westen als Einheit behauptet, aber gerade jetzt, da es äußerlich gesichert scheint, sinkt ihr der Mut. Eine merkwürdige Ahnung bedrängt die ehrwürdige Frau, dieses Reich, dem sie ihre ganze Kraft und Leidenschaft gegeben, werde unter ihren Nachfolgern verfallen und zerfallen; sie weiß, hellsichtige und fast seherische Politikerin, wie locker dieses Gemisch zufällig gekoppelter Nationen gefügt ist und mit wie viel Vorsicht und Zurückhaltung, mit wie viel kluger Passivität einzig sein Bestand verlängert werden kann. Wer aber soll fortführen, was sie so sorglich begonnen hat? Tiefe Enttäuschungen an ihren Kindern haben einen Kassandrageist in ihr erweckt, bei ihnen allen vermisst sie, was die ureigenste Kraft ihres Wesens war, die große Geduld, das langsame sichere Planen und Beharren, das Verzichten-Können und das weise Sich-selbst-Beschränken. Aber von dem lothringischen Blut ihres Mannes muss eine heiße Unruhwelle in die Adern ihrer Kinder geströmt sein; alle sind sie bereit, für die Lust eines Augenblicks unabsehbare Möglichkeiten zu zerstören: ein kleines Geschlecht, unernst, ungläubig und nur um vergänglichen Erfolg bemüht. Ihr Sohn und Mitregent Joseph II. umschmeichelt voll Kronprinzenungeduld Friedrich den Großen, der sie ein Leben lang verfolgt und verhöhnt hat; er buhlt um Voltaire, den sie, die fromme Katholikin, als den Antichrist hasst; ihr anderes Kind, das sie gleichfalls für einen Thron bestimmt hat, die Erzherzogin Maria Amalia, hält, kaum nach Parma verheiratet, ganz Europa mit ihrer Leichtfertigkeit in Atem. In zwei Monaten zerrüttet sie die Finanzen, desorganisiert sie das Land, vergnügt sich mit Liebhabern. Und auch die andere Tochter in Neapel macht ihr wenig Ehre; keine von den Töchtern zeigt Ernst und sittliche Strenge, und das ungeheure Werk aufopfernder und pflichthafter Bemühung, dem die große Kaiserin ihr ganzes persönliches und privates Leben, jede Freude, jeden leichten Genuss unerbittlich aufgeopfert hatte, erscheint ihr sinnlos vollbracht. Am liebsten würde sie in ein Kloster flüchten, und nur aus Angst, aus dem richtigen Vorgefühl, der eilfertige Sohn werde mit unbedachtem Experimentieren sofort alles zerstören, was sie erbaut, hält die alte Kämpferin das Zepter fest, dessen ihre Hand längst müde geworden ist.
Auch über ihr Nesthäkchen Marie Antoinette gibt sich die starke Charakterkennerin keiner Täuschung hin; sie weiß um die Vorzüge – die große Gutmütigkeit und Herzlichkeit, die frische muntere Klugheit, das unverstellte humane Wesen – dieser ihrer jüngsten Tochter, sie kennt aber auch die Gefahren, ihre Unausgereiftheit, ihre Leichtfertigkeit, Verspieltheit, Zerfahrenheit. Um ihr näher zu kommen, um noch in letzter Stunde eine Königin aus diesem temperamentvollen Wildfang zu formen, lässt sie Marie Antoinette die letzten zwei Monate vor der Abreise in ihrem eigenen Zimmer schlafen: Sie sucht sie in langen Gesprächen auf ihre große Stellung vorzubereiten; und um die Hilfe des Himmels zu gewinnen, nimmt sie das Kind zu einer Wallfahrt nach Mariazell mit. Je näher indes die Stunde des Abschieds kommt, um so unruhiger wird die Kaiserin. Irgendeine finstere Ahnung verstört ihr das Herz, Ahnung kommenden Unheils, und sie setzt alle Kraft ein, die dunklen Mächte zu bannen. Vor der Abreise gibt sie Marie Antoinette eine ausführliche Verhaltungsvorschrift mit und nimmt dem achtlosen Kinde den Eid ab, sie jeden Monat sorgfältig zu überlesen. Sie schreibt außer dem offiziellen Brief noch einen privaten an Ludwig XV., in welchem die alte Frau den alten Mann beschwört, Nachsicht mit dem kindischen Unernst der Vierzehnjährigen zu haben. Aber noch immer ist ihre innere Unruhe nicht beschwichtigt. Noch kann Marie Antoinette nicht in Versailles angelangt sein, und schon wiederholt sie die Mahnung, jene Denkschrift zurate zu ziehen. „Ich erinnere Dich, meine geliebte Tochter, an jedem 21. des Monats jenes Blatt nachzulesen. Sei verlässlich in Hinblick auf diesen meinen Wunsch, ich bitte Dich darum; ich fürchte ja bei Dir nichts als Deine Nachlässigkeit im Beten und in der Lektüre und die daraus folgende Unachtsamkeit und Trägheit. Kämpfe gegen sie an ... und vergiss nicht Deine Mutter, die, wenn auch entfernt, nicht aufhören wird, bis zum letzten Atemzug um Dich besorgt zu sein.“ Mitten im Jubel der Welt über den Triumph ihrer Tochter geht die alte Frau in die Kirche und betet zu Gott, er möge ein Unheil wenden, das sie allein von allen vorausfühlt.
Während die riesige Kavalkade – dreihundertvierzig Pferde, die an jeder Poststation gewechselt werden müssen – langsam durch Oberösterreich, Bayern zieht und sich nach zahllosen Festen und Empfängen der Grenze nähert, hämmern Zimmerleute und Tapezierer auf der Rheininsel zwischen Kehl und Straßburg an einem sonderbaren Bau. Hier haben die Obersthofmeister von Versailles und Schönbrunn ihren großen Trumpf ausgespielt; nach endlosem Beraten, ob die feierliche Übergabe der Braut noch auf österreichischem Hoheitsgebiet oder erst auf französischem erfolgen solle, erfand ein Schlaukopf unter ihnen die salomonische Lösung, auf einer der kleinen unbewohnten Sandinseln im Rhein, zwischen Frankreich und Deutschland, in Niemandsland also, einen eigenen Holzpavillon für die festliche Übergabe zu erbauen, ein Wunder der Neutralität, zwei Vorzimmer auf der rechtsrheinischen Seite, die Marie Antoinette noch als Erzherzogin betritt, zwei Vorzimmer auf der linksrheinischen Seite, die sie nach der Zeremonie als Dauphine von Frankreich verlässt, und in der Mitte den großen Saal der feierlichen Übergabe, in dem sich die Erzherzogin endgültig in die Thronfolgerin Frankreichs verwandelt. Kostbare Tapisserien aus dem erzbischöflichen Palais verdecken die rasch aufgezimmerten hölzernen Wände, die Universität von Straßburg leiht einen Baldachin, die reiche Straßburger Bürgerschaft ihr schönstes Mobiliar. In dieses Heiligtum fürstlicher Pracht einzudringen, ist bürgerlichem Blick selbstverständlich verwehrt; ein paar Silberstücke jedoch machen Wächter allorts nachsichtig, und so schleichen einige Tage vor Marie Antoinettes Ankunft einige junge deutsche Studenten in die halbfertigen Räume, um ihrer Neugier Genüge zu tun. Und einer besonders, hochgewachsen, freien leidenschaftlichen Blicks, die Aura des Genius über der männlichen Stirn, kann sich nicht sattsehen an den köstlichen Gobelins, die nach Raffaels Kartons gefertigt sind; sie erregen in dem Jüngling, dem sich eben erst am Straßburger Münster der Geist der Gotik offenbart hatte, stürmische Lust, mit gleicher Liebe klassische Kunst zu begreifen. Begeistert erklärt er den weniger beredten Kameraden diese ihm unvermutet erschlossene Schönheitswelt italienischer Meister, aber plötzlich hält er inne, wird unmutig, die starke dunkle Braue wölkt sich fast zornig über dem eben noch befeuerten Blick. Denn jetzt erst ist er gewahr geworden, was diese Wandteppiche darstellen, in der Tat eine für ein Hochzeitsfest denkbar unpassende Legende, die Geschichte von Jason, Medea und Kreusa, das Erzbeispiel einer verhängnisvollen Eheschließung. „Was“, ruft der genialische Jüngling, ohne auf das Erstaunen der Umstehenden achtzuhaben, mit lauter Stimme aus, „ist es erlaubt, einer jungen Königin das Beispiel der grässlichsten Hochzeit, die vielleicht jemals vollzogen wurde, bei ihrem ersten Eintritt so unbesonnen vor Augen zu führen? Gibt es denn unter den französischen Architekten, Dekorateuren und Tapezierern gar keinen Menschen, der begreift, dass Bilder etwas vorstellen, dass Bilder auf Sinn und Gefühl wirken, dass sie Eindrücke machen, dass sie Ahnungen erregen? Ist es doch nicht anders, als hätte man dieser schönen und, wie man hört, lebenslustigen Dame das abscheulichste Gespenst bis an die Grenze entgegengeschickt.“ Mit Mühe gelingt es den Freunden, den Leidenschaftlichen zu beschwichtigen, beinahe mit Gewalt führen sie Goethe – denn kein anderer ist dieser junge Student – aus dem bretternen Haus. Bald aber naht jener „gewaltige Hof- und Prachtstrom“ des Hochzeitszuges und überschwemmt mit heiterm Gespräch und froher Gesinnung den geschmückten Raum, nicht ahnend, dass wenige Stunden zuvor das seherische Auge eines Dichters in diesem bunten Gewebe schon den schwarzen Faden des Verhängnisses erblickt.
Die Übergabe Marie Antoinettes soll Abschied von allen und allem veranschaulichen, was sie mit dem Hause Österreich verbindet; auch hierfür haben die Zeremonienmeister ein besonderes Symbol ersonnen: Nicht nur darf niemand ihres heimatlichen Gefolges sie über die unsichtbare Grenzlinie begleiten, die Etikette heischt sogar, dass sie keinen Faden heimatlicher Erzeugung, keinen Schuh, keinen Strumpf, kein Hemd, kein Band auf dem nackten Leibe behalten dürfe. Von dem Augenblicke an, da Marie Antoinette Dauphine von Frankreich wird, darf nur Stoff französischer Herkunft sie umhüllen. So muss sich im österreichischen Vorzimmer die Vierzehnjährige vor dem ganzen österreichischen Gefolge bis auf die Haut entkleiden; splitternackt leuchtet für einen Augenblick der zarte, noch unaufgeblühte Mädchenleib in dem dunklen Raum; dann wird ihr ein Hemd aus französischer Seide übergeworfen, Jupons aus Paris, Strümpfe aus Lyon, Schuhe des Hofkordonniers, Spitzen und Maschen; nichts darf sie als liebes Andenken zurückbehalten, nicht einen Ring, nicht ein Kreuz – würde die Welt der Etikette denn nicht einstürzen, bewahrte sie eine einzige Spange oder ein vertrautes Band? – nicht ein einziges von den seit Jahren gewohnten Gesichtern darf sie von jetzt an um sich sehen. Ist es ein Wunder, wenn in diesem Gefühl so jäh ins Fremde-gestoßen-Seins das kleine, von all diesem Pomp und Getue erschreckte Mädchen ganz kindhaft in Tränen ausbricht? Aber sofort heißt es wieder Haltung bewahren, denn Aufwallungen des Gefühls sind bei einer politischen Hochzeit nicht statthaft; drüben im andern Zimmer wartet schon die französische Suite, und es wäre beschämend, mit feuchten Augen, verweint und furchtsam diesem neuen Gefolge entgegenzutreten. Der Brautführer, Graf Starhemberg, reicht ihr zum entscheidenden Gange die Hand, und französisch gekleidet, zum letzten Mal gefolgt von ihrer österreichischen Suite, betritt sie, zwei letzte Minuten noch Österreicherin, den Saal der Übergabe, wo in hohem Staat und Prunk die bourbonische Abordnung sie erwartet. Der Brautwerber Ludwigs XV. hält eine feierliche Ansprache, das Protokoll wird verlesen, dann kommt – alle halten den Atem an – die große Zeremonie. Sie ist Schritt für Schritt errechnet wie ein Menuett, voraus geprobt und eingelernt. Der Tisch in der Mitte des Raumes stellt symbolisch die Grenze dar. Vor ihm stehen die Österreicher, hinter ihm die Franzosen. Zuerst lässt der österreichische Brautführer, Graf Starhemberg, die Hand Marie Antoinettes los; statt seiner ergreift sie der französische Brautführer und geleitet langsam, mit feierlichem Schritt das zitternde Mädchen um die Flanke des Tisches herum. Während dieser genau ausgesparten Minuten zieht sich, langsam nach rückwärts gehend, im selben Takt, wie die französische Suite der künftigen Königin entgegen schreitet, die österreichische Begleitung gegen die Eingangstür zurück, sodass genau in demselben Augenblick, da Marie Antoinette inmitten ihres neuen französischen Hofstaates steht, der österreichische bereits den Raum verlassen hat. Lautlos, musterhaft, gespenstig-großartig vollzieht sich diese Orgie der Etikette; nur im letzten Augenblick hält das kleine verschüchterte Mädchen dieser kalten Feierlichkeit nicht mehr stand. Und statt kühl gelassen den devoten Hof knicks ihrer neuen Gesellschaftsdame, der Komtesse de Noailles, entgegenzunehmen, wirft sie sich ihr schluchzend und wie Hilfe suchend in die Arme, eine schöne und rührende Geste der Verlassenheit, die vorzuschreiben alle Großkophtas der Repräsentation hüben und drüben vergaßen. Aber Gefühl ist nicht eingerechnet in die Logarithmen der höfischen Regeln, schon wartet draußen die gläserne Karosse, schon dröhnen vom Straßburger Münster die Glocken, schon donnern die Artilleriesalven, und, von Jubel umbrandet, verlässt Marie Antoinette für immer die sorglosen Gestade der Kindheit: Ihr Frauenschicksal beginnt.
Der Einzug Marie Antoinettes wird eine unvergessliche Feststunde für das mit Festen schon lange nicht mehr verwöhnte französische Volk. Seit Jahrzehnten hat Straßburg keine künftige Königin gesehen und vielleicht noch nie eine derart bezaubernde wie dieses junge Mädchen. Aschblonden Haars, schlanken Wuchses lacht und lächelt das Kind mit blauen, übermütigen Augen aus der gläsernen Karosse den unermesslichen Scharen zu, die, in schmucker elsässischer Landestracht aus allen Dörfern und Städten herangeströmt, den prunkvollen Zug umjubeln. Hunderte weiß gekleideter Kinder schreiten Blumen streuend dem Wagen vorauf, ein Triumphbogen ist aufgerichtet, die Tore sind bekränzt, auf dem Stadtplatz fließt Wein aus dem Brunnen, ganze Ochsen werden auf Spießen gebraten, Brot aus riesigen Körben an die Armen verteilt. Abends werden alle Häuser illuminiert, feurige Lichtschlangen züngeln den Münsterturm empor, durchsichtig erglüht das rötliche Spitzenwerk der göttlichen Kathedrale. Auf dem Rhein gleiten, Lampions wie glühende Orangen tragend, zahllose Schiffe und Barken mit farbigen Fackeln, in den Bäumen schimmern, von Lichtern angestrahlt, bunte Glaskugeln, und von der Insel her flammt, allen sichtbar, als Abschluss eines grandiosen Feuerwerks, inmitten mythologischer Figuren das verschlungene Monogramm des Dauphins und der Dauphine. Bis tief in die Nacht zieht das schaulustige Volk die Ufer und Straßen entlang, Musik dudelt und dröhnt, an hundert Stellen schwingen Männer und Mädchen sich munter im Tanz; ein goldenes Zeitalter des Glücks scheint mit dieser blonden Botin aus Österreich gekommen, und noch einmal hebt das verbitterte, verärgerte Volk Frankreichs sein Herz heiterer Hoffnung entgegen.
Aber auch dieses großartige Gemälde birgt einen kleinen versteckten Riss, auch hier hat ebenso wie in die Gobelins des Empfangssaales das Schicksal symbolisch ein Unheilszeichen eingewoben. Als am nächsten Tage Marie Antoinette vor der Abfahrt noch die Messe hören will, begrüßt sie am Portal der Kathedrale statt des ehrwürdigen Bischofs dessen Neffe und Koadjutor an der Spitze der Geistlichkeit. In seinem flutenden violetten Gewände etwas weibisch aussehend, hält der mondäne Priester eine galant-pathetische Ansprache – nicht umsonst hat ihn die Akademie in ihre Reihen gewählt –, die in den höfischen Sätzen gipfelt: „Sie sind für uns das lebendige Bildnis der verehrten Kaiserin, welche seit langem Europa ebenso bewundert, wie die Nachwelt sie verehren wird. Die Seele Maria Theresias vereint sich nun mit der Seele der Bourbonen.“ Ehrfürchtig ordnet sich nach der Begrüßung der Zug in den blau schimmernden Dom, der junge Priester geleitet die junge Prinzessin zum Altar und hebt mit feiner, beringter Liebhaberhand die Monstranz. Es ist Louis Prinz Rohan, der als Erster in Frankreich ihr Willkommen bietet, der spätere tragikomische Held der Halsbandaffäre, ihr gefährlichster Gegner, ihr verhängnisvollster Feind. Und die Hand, die jetzt segnend über ihrem Haupte schwebt, ist dieselbe, die ihr Krone und Ehre später in Schmutz und Verachtung schleudern wird.
Nicht lange darf Marie Antoinette in Straßburg, im halbheimatlichen Elsass, bleiben: Wenn ein König von Frankreich wartet, wäre jedes Zögern Verstoß. An brausenden Ufern des Jubels vorbei, durch Triumphpforten und bekränzte Tore steuert die Brautfahrt endlich dem ersten Ziel entgegen, dem Walde von Compiègne, wo mit riesiger Wagenburg die königliche Familie ihr neues Mitglied erwartet. Hofherren, Hofdamen, Offiziere, die Leibgarden, Trommler, Trompeter und Bläser, alle in neuen schimmernden Kleidern, stehen in bunter Rangordnung geschart; der ganze mailichte Wald leuchtet von diesem flackernden Farbenspiel. Kaum künden Fanfaren beider Gefolge das Nahen des Hochzeitszuges, so verlässt Ludwig XV. seine Karosse, um die Frau seines Enkels zu empfangen. Aber schon eilt mit ihrem viel bewunderten leichten Schritt Marie Antoinette ihm entgegen und kniet mit anmutigstem Knicks (nicht umsonst Schülerin des großen Tanzmeisters Noverre) vor dem Großvater ihres zukünftigen Gatten nieder. Der König, von seinem Hirschpark her ein guter Kenner frischen Mädchenfleisches und höchst empfänglich für graziöse Anmut, biegt sich zärtlich-zufrieden herab zu dem jungen blonden appetitlichen Ding, hebt die Enkelsbraut empor und küsst sie auf beide Wangen. Dann erst stellt er ihr den zukünftigen Gemahl vor, der, fünf Fuß zehn Zoll hoch, steifleinen und tölpelig-verlegen zur Seite steht, jetzt endlich die verschlafenen kurzsichtigen Augen hebt und ohne sonderliche Beflissenheit seine Braut, der Etikette gemäß, formell auf die Wange küsst. In der Karosse sitzt Marie Antoinette zwischen Großvater und Enkel, zwischen Ludwig XV. und dem zukünftigen Ludwig XVI. Der alte Herr scheint eher die Rolle des Bräutigams zu spielen, angeregt plaudert er und macht ihr sogar ein wenig den Hof, indes der zukünftige Gatte sich gelangweilt und stumm in seine Ecke drückt. Abends, da die Verlobten und per procurationem bereits Vermählten in ihren abgesonderten Zimmern schlafen gehen, hat der triste Liebhaber noch kein einziges zärtliches Wort zu diesem entzückenden Backfisch gesprochen, und in sein Tagebuch schreibt er als Resümee des entscheidenden Tages einzig die dürre Zeile: „Entrevue avec Madame la Dauphine.“
Sechsunddreißig Jahre später wird in eben demselben Wald von Compiègne ein anderer Herrscher Frankreichs, Napoleon, eine andere österreichische Erzherzogin, Marie Louise, als Gattin erwarten. Sie wird nicht so hübsch, nicht so knusperig wie Marie Antoinette sein, die rundliche, langweilig sanfte Marie Louise. Aber doch ergreift der energische Mann und Werber von der ihm zubestimmten Braut sofort zärtlich und stürmisch Besitz. Noch am selben Abend fragt er den Bischof, ob ihm die Wiener Heirat schon eheliche Rechte gäbe, und ohne die Antwort abzuwarten, zieht er die Folgerungen: Am nächsten Morgen frühstücken die beiden schon gemeinsam im Bett. Marie Antoinette aber ist im Wald in Compiègne keinem Liebhaber und keinem Mann begegnet: nur einem Staatsbräutigam.
Die zweite, die eigentliche Hochzeitsfeier findet am 16. Mai zu Versailles in der Kapelle Ludwigs XIV. statt. Ein solcher Hof- und Staatsakt des Allerchristlichsten Herrscherhauses bedeutet eine zu intime, zu familiäre, wie auch zu erlauchte und souveräne Angelegenheit, als dass man dem Volk erlaubte, dabei Zuschauer zu sein oder auch nur Spalier vor den Türen zu bilden. Nur adeliges Blut – mindestens hundertästiger Stammbaum berechtigt, den Kirchenraum zu betreten, der, strahlende Frühlingssonne hinter den bunten Gläsern, den gestickten Brokat, die schillernde Seide, die unermesslich ausgebreitete Pracht der erwählten Geschlechter wie ein letztes Fanal der alten Welt noch einmal überwältigend aufleuchten lässt. Der Erzbischof von Reims vollzieht die Trauung. Er segnet die dreizehn Goldstücke und den Hochzeitsring; der Dauphin steckt Marie Antoinette den Ring an den vierten Finger, überreicht ihr die Goldstücke, darauf knien beide hin, den Segen zu empfangen. Mit Orgelklang setzt die Messe ein, beim Paternoster wird ein silberner Baldachin über die Häupter des jungen Paares gehalten, dann erst unterzeichnet der König und in sorglicher Rangabstufung die gesamte Blutsverwandtschaft den Hochzeitspakt. Es wird ein ungeheuer langes, viel gefaltetes Dokument; noch heute sieht man auf dem verblichenen Pergament die stolprig und ungeschickt hingesetzten vier Worte: Marie Antoinette Josepha Jeanne, von der Kinderhand der Fünfzehnjährigen mühsam hingekritzelt, und daneben – abermals raunen alle: ein böses Omen – einen mächtigen Tintenklecks, der ihr und einzig ihr allein von allen Unterzeichnern aus der widerstrebenden Feder spritzt.
Marie Antoinette am ClavecinÖlgemälde von François Hubert Drouais
Nun, nach beendeter Zeremonie, wird gnädig auch dem Volk gestattet, sich am Feste der Monarchen mitzufreuen. Unzählbare Menschenmengen – halb Paris ist entvölkert – ergießen sich in die Gärten von Versailles, die heute auch dem profanum vulgus ihre Wasserkünste und Kaskaden, ihre Schattengänge und Wiesenflächen offenbaren; das Hauptgaudium soll das abendliche Feuerwerk sein, das großartigste, das man je an einem Königshofe gesehen hat. Doch der Himmel macht Feuerwerk auf eigene Rechnung. Finster, Unglück verheißend türmen sich nachmittags Wolken auf, ein Gewitter zuckt nieder, ungeheuer schüttet sich ein Platzregen aus, und in wildem Aufruhr strömt das Volk, um sein Schauspiel betrogen, nach Paris zurück. Indes schlotternd vor Kälteschauern Zehntausende über die Straßen flüchten, sturmgejagt, tumultuarisch und nass, und die Bäume, regengeschüttelt, im Park sich biegen, beginnt hinter den von vielen Tausend Kerzen erhellten Fenstern des neu erbauten „salle de spectacle“ in vorbildlichem, durch keinen Orkan und kein Weltbeben zu erschütterndem Zeremoniell das große Hochzeitsmahl: zum ersten Mal und letzten Mal versucht Ludwig XV. die Pracht seines großen Vorgängers Ludwigs XIV. zu übertreffen. Sechstausend erlesene Adelsgäste haben mit Mühe Eintrittskarten erkämpft, freilich nicht, um mitzuspeisen, sondern einzig, um ehrfürchtig von der Galerie zusehen zu dürfen, wie die zweiundzwanzig Angehörigen des Königshauses Messer und Gabel zum Munde führen. Alle sechstausend halten den Atem an, um die Erhabenheit dieses großen Schauspiels nicht zu stören; nur zart und gedämpft begleitet von den marmornen Arkaden ein Orchester von achtzig Musikern das fürstliche Mahl. Dann schreitet unter dem Salut der französischen Garden die ganze königliche Familie durch das demütig gebeugte Spalier des Adels: Die offizielle Feier ist zu Ende, und der königliche Bräutigam hat jetzt keine andere Pflicht als die jedes andern Ehemanns zu erfüllen. Zur rechten Hand die Dauphine, zur linken den Dauphin, führt der König das kindliche Paar (zusammen zählt es kaum dreißig Jahre) in sein Schlafgemach. Noch bis in die Brautstube drängt sich die Etikette ein, denn wer anders könnte dem Thronfolger das Nachthemd überreichen als der König von Frankreich in Person, und wer anders der Dauphine das ihre als die jüngst verheiratete Dame höchsten Ranges, in diesem Fall die Herzogin von Chartres? Dem Bette selbst aber darf nur ein einziger außer den Brautleuten nahen: Der Erzbischof von Reims, der es segnet und mit Weihwasser besprengt.
Endlich verlässt der Hof den intimen Raum; Ludwig und Marie Antoinette bleiben zum ersten Mal ehelich allein, und der Baldachin des Himmelbettes rauscht über ihnen nieder, brokatener Vorhang einer unsichtbaren Tragödie.
Geheimnis des Alkovens
Marie Antoinette im roten Jagdkostüm im Jahr 1771Gemälde von Joseph Kreuzinger
In jenem Bette geschieht nun zunächst – nichts. Und es gibt einen höchst fatalen Doppelsinn, wenn der junge Ehemann am nächsten Morgen in sein Tagebuch schreibt: „Rien.“ Weder die höfischen Zeremonien noch die erzbischöfliche Segnung des bräutlichen Bettes haben Gewalt gehabt über eine peinliche Hemmung der Natur des Dauphin, matrimonium non consummatum est, die Hochzeit wurde im eigentlichen Sinne nicht vollzogen, nicht heute, nicht morgen und nicht in den nächsten Jahren. Marie Antoinette hat einen „nonchalant mari“, einen nachlässigen Gatten, gefunden, und zunächst meint man, es sei nur Schüchternheit, Unerfahrenheit oder eine „nature tardive“ (wir würden heute sagen: eine infantile Zurückgebliebenheit), die den Sechzehnjährigen bei diesem bezaubernden jungen Mädchen unfähig macht. Nur nicht drängen und den seelisch Gehemmten beunruhigen, denkt die erfahrene Mutter und mahnt Antoinette, die eheliche Enttäuschung nicht schwer zu nehmen – „point d'humeur là-dessus“ schreibt sie im Mai 1771 und empfiehlt ihrer Tochter „caresses, cajolis“, Zärtlichkeiten, Liebkosungen, aber anderseits wieder nicht zu viel davon: „Trop d'empressement gâterait le tout.“ Als aber dieser Zustand schon ein Jahr, zwei Jahre andauert, beginnt die Kaiserin über diese „conduite si étrange“ des jungen Gatten unruhig zu werden. An seinem guten Willen ist nicht zu zweifeln, denn von Monat zu Monat zeigt sich der Dauphin seiner anmutigen Gattin immer zärtlicher zugetan, er erneuert unablässig seine nächtlichen Besuche, seine untauglichen Versuche, aber an der letzten entscheidenden Zärtlichkeit hemmt ihn irgendein „maudit charme“, eine geheimnisvolle fatale Störung. Die unbelehrte Antoinette meint, dies sei nur „maladresse et jeunesse“, nur Ungeschicklichkeit und Jugend; in ihrer Unerfahrenheit stellt sie, die Arme, sogar selbst die „üblen Gerüchte, die hierzulande über seine Unfähigkeit umgehen“, in entschiedene Abrede. Aber nun steckt sich die Mutter hinter die Sache. Sie lässt ihren Hofarzt van Swieten kommen und berät sich mit ihm über die „froideur extraordinaire du Dauphin“. Der zuckt die Achseln. Wenn es einem jungen Mädchen von solchem Liebreiz nicht gelinge, den Dauphin zu erhitzen, sei jedes medizinische Heilmittel ohne Wirkung. Brief auf Brief schreibt Maria Theresia nach Paris; schließlich nimmt König Ludwig XV., wohlerfahren und allzu geübt auf diesem Gebiete, seinen Enkel ins Gebet; der französische Hofarzt Lassone wird eingeweiht, der traurige Liebesheld untersucht, und nun stellt sich heraus, dass diese Impotenz des Dauphin keine seelisch bedingte sei, sondern auf einem unbedeutenden organischen Defekt (einer Phimosis) beruhe. „Quien dice que el frenillo sujeta tanto et prepucio que no cede a la introduccion y causa un dolor vivo en el, por el qual se retrahe S. M. del impulso que conviniera. Quien supone que el dicho prepucio esta tan cerrado que no puede explayarse para la dilatacion de la punta o cabeza de la parte, en virtud de lo que no llegua la ereccion al punto de elasticidad necessaria.“ (Geheimbericht des spanischen Gesandten.) Jetzt folgt Konsilium auf Konsilium, ob der Chirurg mit dem Operationsmesser eingreifen solle, – „pour lui rendre la voix“, wie man in den Vorzimmern zynisch flüstert. Auch Marie Antoinette, von ihren erfahrenen Freundinnen inzwischen aufgeklärt, tut das Möglichste, ihren Gatten zur chirurgischen Kur zu veranlassen. („Je travaille à le déterminer à la petite opération, dont on a déjà parlé et que je crois nécessaire“; 1775 an ihre Mutter.) Aber Ludwig XVI. – der Dauphin ist inzwischen zwar schon König geworden, doch nach fünf Jahren noch immer kein Ehemann – kann sich, seinem schwankenden Charakter gemäß, zu keiner energischen Tat entschließen. Er zaudert und zögert, versucht und versucht, und diese grässliche, widerliche, lächerliche Situation des ewigen Versuchens und ewigen Versagens zieht sich zur Schmach Marie Antoinettes, zum Hohn des ganzen Hofes, zur Wut Maria Theresias, zur Erniedrigung Ludwigs XVI. noch zwei weitere Jahre hin, im ganzen also sieben entsetzliche Jahre, bis schließlich Kaiser Joseph eigens nach Paris reist, um seinen nicht sehr mutigen Schwager zur Operation zu überreden. Dann erst gelingt es diesem traurigen Cäsar der Liebe, den Rubikon glücklich zu überschreiten. Aber das seelische Reich, das er endlich erobert, ist schon verwüstet durch diese sieben Jahre lächerlichen Kampfes, durch diese zweitausend Nächte, in denen Marie Antoinette als Frau und Gattin die äußerste Erniedrigung ihres Geschlechts erlitten hat.
Wäre es nicht zu vermeiden gewesen (fragt vielleicht manches empfindsame Gemüt), an dies heikle und heiligste Geheimnis des Alkovens zu rühren? Hätte es nicht genügt, die Tatsache des königlichen Versagens bis zur Unkenntlichkeit zu verschatten, zaghaft an der Tragödie des Ehebetts vorbeizuschleichen, bestenfalls verblümt vom „fehlenden Glück der Mütterlichkeit“ zu munkeln? Ist wirklich die Betonung solch intimster Einzelheiten unentbehrlich für eine charakterologische Darstellung? Jawohl, sie ist unentbehrlich, denn alle die Spannungen, Abhängigkeiten, Hörigkeiten und Feindseligkeiten, die sich allmählich zwischen dem König und der Königin, den Thronanwärtern und dem Hof herausbilden und weit ins Weltgeschichtliche hinüberreichen, sie bleiben unverständlich, wenn man nicht offenherzig an ihren eigentlichen Ursprung herangeht. Mehr weltgeschichtliche Folgeerscheinungen, als man gemeinhin zuzugeben gewillt ist, haben im Alkoven und hinter den Baldachinen der Königsbetten ihren Anfang genommen; kaum in irgendeinem andern Falle aber liegt die logische Kette zwischen privatestem Anlass und politisch-welthistorischer Auswirkung so eindeutig offen wie bei dieser intimen Tragikomödie, und jede charakterologische Darstellung bleibt unehrlich, die ein Geschehnis in den Schatten drückt, das Marie Antoinette selbst den „article essentiel“, den Hauptpunkt ihrer Sorgen und Erwartungen, genannt hat. Und dann: Deckt man wirklich ein Geheimnis auf, wenn man frei und ehrlich von der langjährigen ehelichen Unfähigkeit Ludwigs XVI. spricht? Durchaus nicht. Nur das neunzehnte Jahrhundert mit seiner krankhaften moralischen Sexualprüderie hat ein Nolimetangere aus jeder unbefangenen Erörterung physiologischer Verhältnisse gemacht. Im achtzehnten Jahrhundert aber, wie in allen früheren, galt Ehefähigkeit oder Eheunfähigkeit eines Königs, Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit einer Königin nicht als private, sondern als politische und Staatsangelegenheit, weil sie die „Erbfolge“ und damit das Schicksal des ganzen Landes entschied; das Bett gehörte so offenkundig mit zum menschlichen Dasein wie das Taufbecken oder der Sarg. In dem Briefwechsel Maria Theresias und Marie Antoinettes, der immerhin durch die Hand des Staatsarchivars und des Kopisten ging, sprachen damals eine Kaiserin von Österreich und eine Königin von Frankreich in voller Freiheit über alle Einzelheiten und Missgeschicke dieses sonderbaren Ehestandes. Beredt schildert Maria Theresia der Tochter die Vorteile des gemeinsamen Bettes und gibt kleine weibliche Winke, jede Gelegenheit zu intimer Vereinigung geschickt auszunutzen; die Tochter wiederum berichtet das Eintreffen oder Nichteintreffen des monatlichen Unwohlseins, das Versagen des Gatten, jedes „un petit mieux“, und schließlich triumphierend die Schwangerschaft. Einmal wird sogar der Komponist der Iphigenie, wird sogar Gluck, weil er früher abreist als der Kurier, mit der Übermittlung solcher intimer Neuigkeit betraut: Im achtzehnten Jahrhundert nimmt man natürliche Dinge noch völlig natürlich.
Aber wäre es nur die Mutter allein, die damals um jenes heimliche Versagen weiß! In Wirklichkeit schwatzen alle Kammerfrauen davon, alle Hofdamen, Kavaliere und Offiziere; die Diener wissen es und die Wäscherinnen am Hofe von Versailles, sogar an seinem eigenen Tisch muss der König manchen derben Scherz erdulden. Außerdem befassen sich, da die Zeugungsfähigkeit eines Bourbonen in Anbetracht der Erbfolge eine hochpolitische Angelegenheit darstellt, alle auswärtigen Höfe auf das Eindringlichste mit dieser Frage. In den Berichten des preußischen, des sächsischen, des sardinischen Gesandten finden sich ausführliche Erörterungen der heiklen Angelegenheit; der eifrigste unter ihnen, Graf Aranda, der spanische Gesandte, lässt sogar die Laken des königlichen Bettes durch bestochene Dienstleute untersuchen, um jenem physiologischen Ereignis nur möglichst genau auf die Spur zu kommen. Überall in ganz Europa lachen und spotten Fürsten und Könige brieflich und mündlich über ihren ungeschickten Standesgenossen; nicht nur in Versailles, sondern in ganz Paris und Frankreich ist die eheliche Blamage des Königs das Geheimnis Polichinells. Sie wird in allen Straßen besprochen, sie flattert als Libell von Hand zu Hand, und bei der Ernennung des Ministers Maurepas zirkuliert zur allgemeinen Erheiterung das muntere Couplet:
Maurepas était impuissant,Le Roi l'a rendu plus puissant.Le Ministre reconnaissantDit: Pour vous, Sire,Ce que je désire,D'en faire autant.
Aber was spaßhaft klingt, hat in Wahrheit schicksalshafte und gefährliche Bedeutung. Denn diese sieben Jahre des Versagens bestimmen seelisch den Charakter des Königs und der Königin und führen zu politischen Folgerungen, die ohne Kenntnis dieses Faktums unverständlich wären: Das Schicksal einer Ehe verbindet sich hier dem Weltgeschick.
Unverständlich bliebe vor allem die seelische Einstellung Ludwigs XVI. ohne Kenntnis jenes intimen Defekts. Denn mit geradezu klinischer Deutlichkeit zeigt sein menschlicher Habitus alle typischen Merkmale eines aus männlicher Schwäche stammenden Minderwertigkeitsgefühls. Weil im privaten, so fehlt diesem Gehemmten auch im öffentlichen Leben jede Kraft zu schöpferischer Tat. Er versteht nicht aufzutreten, er weiß keinen Willen zu zeigen und noch weniger ihn durchzusetzen; linkisch und scheu flüchtet der heimlich Beschämte vor jeder höfischen Geselligkeit und besonders vor dem Umgang mit Frauen, denn er weiß, dieser im Grunde biedere, rechtschaffene Mann, dass sein Missgeschick jedem am Hofe bekannt ist, und das ironische Lächeln der Eingeweihten verschreckt sein ganzes Gehaben. Manchmal versucht er, sich gewaltsam eine gewisse Autorität zu geben, einen Schein von Männlichkeit. Aber dann greift er immer eine Stufe zu hoch, wird grob, brüsk und brutal, typische Flucht in eine Geste der Kraftmeierei, die ihm niemand glaubt. Nie aber gelingt ihm ein freies, natürliches, selbstbewusstes Auftreten, und am wenigsten das majestätische. Weil er im Schlafgemach nicht den Mann, versteht er vor den anderen nicht den König zu spielen.
Dass dabei seine persönlichen Neigungen die allermännlichsten sind, die Jagd und körperliche Schwerarbeit er hat sich eine eigene Schmiedewerkstätte eingerichtet, seine Drehbank ist noch heute zu sehen –, widerspricht keineswegs dem klinischen Bild, sondern bestätigt es nur. Denn gerade, wer nicht Mann ist, liebt unbewusst den Männlichen zu spielen, gerade der heimlich Schwache trumpft gern vor den Menschen mit Stärke auf. Wenn er auf dampfendem Pferd stundenlang dem Eber nachjagt und durch die Wälder reitet, wenn er am Amboss seine Muskeln bis zur Müdigkeit erschöpft, so kompensiert da ein Kraftbewusstsein der rein körperhaften Stärke wohltuend die heimliche Schwäche: Als Hephaistos fühlt sich wohl, wer den Dienst der Venus schlecht versieht. Aber kaum zieht Ludwig die Galauniform an und tritt unter die Höflinge, da spürt er, dass diese Kraft nur eine der Muskeln, nicht eine des Herzens ist, und sofort wird er verlegen. Selten sieht man ihn lachen, selten ihn wirklich glücklich und vergnügt.
Am gefährlichsten aber wirkt sich dieses geheime Schwächegefühl charakterologisch im seelischen Verhältnis zu seiner Frau aus. Vieles an ihrem Verhalten widerstrebt seinem persönlichen Geschmack. Er mag ihre Gesellschaften nicht, ihn ärgern der ständige laute Vergnügungstrubel, ihre Verschwendung, ihre unköniglichen Frivolitäten. Ein wirklicher Mann wüsste da schleunig Abhilfe zu schaffen. Aber wie kann ein Mann vor einer Frau, die ihn allnächtlich beschämt, hilflos und als lächerlichen Versager erlebt, bei Tage den Herrn spielen? Weil männlich machtlos, bleibt Ludwig XVI. gegen seine Frau völlig wehrlos; im Gegenteil, je länger sein beschämender Zustand dauert, um so kläglicher gerät er in völlige Abhängigkeit, ja Hörigkeit. Sie kann von ihm verlangen, was sie will, immer wieder kauft er sich mit völlig schrankenloser Nachgiebigkeit von seinem geheimen Schuldgefühl los. Herrisch in ihr Leben einzugreifen, ihre offensichtlichen Torheiten zu verhindern, dazu fehlt ihm die Willenskraft, die im Letzten nichts anderes darstellt als den seelischen Ausdruck der körperlichen Potenz. Verzweifelt sehen die Minister, sieht die kaiserliche Mutter, sieht der ganze Hof, wie durch diese tragische Ohnmacht alle Macht in die Hände einer jungen wirbligen Frau gerät, die sie leichtfertig verzettelt. Aber ein Kräfteparallelogramm, in einer Ehe einmal bestimmt, bleibt erfahrungsgemäß als seelische Konstellation unabänderlich. Selbst als Ludwig XVI. wirklicher Gatte und Vater von Kindern wird, ist er, der Herr Frankreichs sein sollte, weiterhin der willenlose Knecht Marie Antoinettes, einzig weil er nicht rechtzeitig ihr Mann gewesen ist.
Nicht minder verhängnisvoll beeinflusst das sexuelle Versagen Ludwigs XVI. die seelische Entwicklung Marie Antoinettes. Gemäß der Gegensätzlichkeit der Geschlechter bringt ein und dieselbe Störung im männlichen und weiblichen Charakter genau gegensätzliche Erscheinungen hervor. Wo bei einem Mann die sexuelle Schlagkraft Störungen unterliegt, entsteht Gehemmtheit und Unsicherheit; wo der Frau die passive Hingabebereitschaft nichts hilft, muss zwanghaft Überreiztheit und Hemmungslosigkeit, eine flackrige Überlebendigkeit zutage treten. Von Natur aus ist Marie Antoinette eigentlich vollkommen normal, eine weibliche, eine zärtliche Frau, zu vielfacher Mutterschaft bestimmt, wahrscheinlich nur darauf wartend, sich einem wirklichen Manne zu fügen. Aber das Verhängnis will, dass gerade sie, die Empfindungsfähige und Empfindungswillige, in eine abnorme Ehe, dass sie an einen Nicht-Mann gerät. Allerdings, sie ist erst fünfzehnjährig zur Zeit der Eheschließung; an und für sich müsste da das ärgerliche Versagen ihres Mannes sich noch nicht als seelische Belastung äußern; denn wer dürfte diese Tatsache schon physiologisch unnatürlich nennen, dass ein Mädchen bis zum zweiundzwanzigsten Jahre jungfräulich bleibt! Was aber in diesem besondern Falle die Erschütterung und gefährliche Überhitzung ihres Nervenzustandes verursacht, ist, dass der von Staats wegen ihr zugeteilte Gatte sie diese sieben pseudoehelichen Jahre nicht im Zustande unbefangener und unberührter Keuschheit verbringen lässt, sondern dass in zweitausend Nächten sich an ihrem jungen Körper ein tölpischer und gehemmter Mann unablässig abmüht. Jahre hindurch wird ihre Sexualität fruchtlos in dieser unbefreienden, beschämenden und erniedrigenden Weise ohne eine einzige Erfüllung gereizt und gereizt. So bedarf es keines Nervenarztes, um festzustellen, dass ihre so verhängnisvolle Überlebendigkeit, dieses ewige Hin und Her und Niezufriedensein, dieses fahrige Jagen von Vergnügung zu Vergnügung, geradezu klinisch-typische Folgen jener ständigen sexuellen Aufreizung und sexuellen Unbefriedigtheit durch ihren Gatten darstellen. Weil nicht im tiefsten bewegt und beruhigt, muss die nach sieben Ehejahren noch immer nicht eroberte Frau ständig Bewegung und Unruhe um sich haben, und allmählich wird, was anfangs bloß kindisch muntere Verspieltheit gewesen, zu einer krampfigen, krankhaften und vom ganzen Hof als skandalös empfundenen Vergnügungswut, gegen die Maria Theresia und alle Freunde vergebens anzukämpfen suchen. Wie sich beim König die unerlöste Männlichkeit in grobe Schmiedearbeit und Jagdleidenschaft, in dumpfe und ermüdende Muskelanstrengung umsetzt, so flüchtet bei ihr die falsch eingesetzte und unverwertete Gefühlskraft in zärtliche Freundschaft zu Frauen, in Koketterien mit jungen Kavalieren, in Putzsucht und ähnliche unzulängliche Temperamentsbefriedigungen. Nächte um Nächte meidet sie das eheliche Bett, den traurigen Ort ihrer weiblichen Erniedrigung, und treibt sich, während ihr Gatte und Nicht-Gatte seine Jagdmüdigkeit breit ausschläft, bis vier Uhr, fünf Uhr morgens auf Opernredouten, in Spielsälen, bei Soupers und in zweifelhafter Gesellschaft herum, sich wärmend an fremden Feuern, unwürdige Königin, weil an einen unwerten Gatten geraten. Dass aber diese Frivolität eigentlich freudlos ist, ein bloßes Übertanzen und Überamüsieren einer inneren Enttäuschtheit, das verrät mancher Augenblick zorniger Melancholie und am stärksten einmal ihr Schrei, als ihre Verwandte, die Herzogin von Chartres, zuerst ein totes Kind zur Welt bringt. Da schreibt sie an ihre Mutter: „So furchtbar das auch sein muss, ich wollte, ich hielte wenigstens so weit.“ Lieber ein totes Kind, aber nur ein Kind! Nur endlich aus diesem zerstörenden, unwürdigen Zustand heraus, nur endlich wirkliche normale Frau ihres Mannes sein und nicht immer und immer noch Jungfrau nach siebenjähriger Ehe. Wer nicht die weibliche Verzweiflung hinter der Vergnügungswut dieser Frau versteht, kann die merkwürdige Wandlung weder erklären noch begreifen, die dann einsetzt, als Marie Antoinette endlich Frau und Mutter wird. Mit einem Mal werden die Nerven merklich ruhiger, eine andere, zweite Marie Antoinette entsteht, jene beherrschte und willenskräftige, kühne, die sie im zweiten Teil ihres Lebens wird. Aber diese Wandlung kommt schon zu spät. Wie in jeder Kindheit, sind auch in jeder Ehe die ersten Erlebnisse die entscheidenden. Und Jahrzehnte können nicht wettmachen, was im feinsten und überempfindlichen Stoff der Seele eine einzige winzige Störung verschuldet. Gerade diese innersten, die unsichtbaren Verwundungen des Gefühls kennen kein volles Gesunden.
All dies wäre aber nur private Tragödie, ein Missgeschick, wie es sich auch heute tagtäglich hinter geschlossenen Türen abspielt. In diesem einem Fall jedoch reichen die verhängnisvollen Folgen einer solchen ehelichen Peinlichkeit weit über das private Leben hinaus. Denn Mann und Frau sind hier König und Königin, sie stehen unentrinnbar im verzerrenden Hohlspiegel der öffentlichen Aufmerksamkeit; was bei andern vertraulich bleibt, nährt bei ihnen Schwatz und Kritik. Ein so mokanter Hof wie der französische begnügt sich natürlich nicht mit der bedauernden Feststellung des Missgeschicks, sondern schnuppert unablässig um die Frage herum, in welcher Weise sich Marie Antoinette für das Versagen ihres Gatten schadlos halte. Sie sehen eine reizende junge Frau, selbstbewusst und kokett, ein temperamentvolles Geschöpf, in dem das junge Blut braust, und wissen, an welche jämmerliche Schlafhaube diese himmlische Liebhaberin geraten ist: Nun beschäftigt das ganze müßige Türhüterpack nur eine Frage, mit wem sie den Gatten betrüge. Gerade weil es tatsächlich nichts zu berichten gibt, gerät die Ehre der Königin in frivoles Gerede. Ein Ausritt mit irgendeinem Kavalier, einem Lauzun oder Coigny, und schon haben ihn die müßigen Schwätzer zu ihrem Geliebten ernannt; eine morgendliche Promenade im Park mit den Hofdamen und Kavalieren, und sofort erzählt man von den unglaublichsten Orgien. Unablässig beschäftigt der Gedanke an das Liebesleben der enttäuschten Königin den ganzen Hof; aus dem Geschwätz werden Chansons und Libelle und Pamphlete und pornografische Gedichte. Erst stecken sich, hinter dem Fächer verborgen, die Hofdamen diese kantharidischen Verslein zu, dann summen sie frech aus dem Haus, werden gedruckt und geraten unter das Volk. Als dann die revolutionäre Propaganda beginnt, brauchen die jakobinischen Journalisten nicht lange nach Argumenten zu suchen, um Marie Antoinette als den Ausbund aller Ausschweifung, als schamlose Verbrecherin hinzustellen, und der öffentliche Ankläger braucht nur einen Griff in diese Pandorabüchse galanter Verleumdungen zu tun, um das schmale Haupt unter die Guillotine zu drücken.
Über eigenes Geschick, Ungeschick, Missgeschick reichen hier also die Folgen einer ehelichen Störung bis in das Weltgeschichtliche hinein: Die Zerstörung der königlichen Autorität hat in Wahrheit nicht mit der Bastille, sondern in Versailles begonnen. Denn dass diese Nachricht von dem Versagen des Königs und die boshaften Lügen von der sexuellen Unersättlichkeit der Königin so rasch und so weit aus dem Schlosse von Versailles zur Kenntnis der ganzen Nation kamen, war kein Zufall, sondern hat geheime familienpolitische Hintergründe. Es leben nämlich in diesem Palast vier oder fünf Personen, und zwar die nächsten Verwandten, die an der ehelichen Enttäuschung Marie Antoinettes persönliches Interesse haben. Vor allem sind es die beiden Brüder des Königs, denen es außerordentlich willkommen ist, dass durch diesen lächerlichen physiologischen Defekt und die Furcht Ludwigs XVI. vor dem Chirurgen nicht nur das normale Eheleben, sondern auch die normale Erbfolge zerstört wird, denn sie erblicken darin eine unerwartete Chance, selbst auf den Thron zu gelangen. Der nächstälteste Bruder Ludwigs XVI., der Graf von Provence und tatsächlich später Ludwig XVIII. – er hat sein Ziel erreicht, und Gott allein weiß, auf welchen krummen Wegen, – hat es nie verwinden können, als Zweiter zeitlebens hinter dem Thron stehen zu sollen, statt selber das Zepter zu halten; das Ausbleiben eines Thronerben würde ihn zum Regenten, wenn nicht zum Erben des Königs einsetzen, und seine Ungeduld ist kaum zu zügeln; da er aber gleichfalls ein zweifelhafter Gatte und kinderlos ist, hat auch der zweite Bruder, der Graf von Artois, Vorteil von der Zeugungsunfähigkeit seiner älteren Brüder, denn sie macht seine Söhne zu legitimen Thronerben. So genießen sie beide als Glücksfall, was das Unglück Marie Antoinettes ist, und je länger der grauenhafte Zustand dauert, um so sicherer fühlt sich ihre voreilige Anwartschaft. Darum dieser maßlose, dieser hemmungslose Hass, als im siebenten Jahre Marie Antoinette das Wunder plötzlicher Vermännlichung bei ihrem Gatten endlich zustande bringt und die eheliche Beziehung zwischen König und Königin völlig normal wird. Diesen furchtbaren Hieb, der alle seine Erwartungen niederschlägt, hat der Graf von Provence Marie Antoinette niemals verziehen; und was ihm nicht auf geraden Wegen zufallen wollte, hat er versucht, auf krummen zu erreichen: Seit Ludwig XVI. Vater geworden war, wurden sein Bruder und seine Verwandten seine gefährlichsten Gegner. Die Revolution hat gute Helfer bei Hof gehabt, prinzliche und fürstliche Hände haben ihr die Türen aufgetan und die besten Waffen in die Hand gedrückt; diese eine Alkovenepisode hat stärker als alle äußern Ereignisse die Autorität von innen her zersetzt und zum Zerfall gebracht. Fast immer ist es ja ein geheimes Schicksal, welches das äußerlich sichtbare und öffentliche heranzieht, fast jedes Weltgeschehnis Spiegelung inneren persönlichen Konflikts. Ständig gehört es zu den großen Kunstgeheimnissen der Geschichte, aus mikrobischem Anlass unabsehbare Folgerungen zu entwickeln, und es sollte nicht das letzte Mal sein, dass durch die vorübergehende sexuelle Störung eines einzelnen Mannes der ganze Kosmos in Unruhe geriet: die Impotenz Alexanders von Serbien, seine erotische Hörigkeit an seine Befreierin Draga Maschin, die Ermordung der beiden, die Berufung der Karageorgevitsch, die Verfeindung mit Österreich und der Weltkrieg sind eine ebenso unerbittlich logische Lawinenfolge. Denn aus Spinnweben flicht die Geschichte das unentrinnbare Netz des Schicksals; in ihrem wundervoll verkoppelten Triebwerk löst das kleinste Antriebsrad die ungeheuerlichsten Kräfte aus; so wird auch im Dasein Marie Antoinettes das Nichtige zum Gewaltigen, das scheinbar lächerliche Erlebnis der ersten Nächte und Ehejahre nicht nur formgebend für ihren Charakter, sondern für die Gestaltung der Welt.
Aber wie weit noch in der Ferne ballt sich dieses drohende Gewölk! Wie ferne sind noch alle diese Folgerungen und Verstrickungen von dem kindischen Sinn dieser Fünfzehnjährigen, die mit ihrem ungeschickten Kameraden arglos spaßt, die mit einem kleinen, munter klopfenden Herzen und hell-neugierigen Augen lächelnd meint, die Stufen eines Thrones emporzusteigen, – und am Ende steht das Schafott. Aber wem sie das schwarze Los von Anbeginn zugeteilt, dem geben die Götter keine Zeichen und Winke. Ahnungslos unbefangen lassen sie ihn seinen Weg schreiten, und von innen wächst ihm das Schicksal entgegen.
Debüt in Versailles
Porträt von Marie Antoinette mit einer Rose aus dem Jahr 1778Gemälde von Marie Louise Élisabeth Vigée-Lebrun
Noch heute wirkt Versailles als die großartigste und herausforderndste Geste der Autokratie; ganz ohne sichtlichen Anlass erhebt sich mitten im Lande abseits von der Hauptstadt auf einem künstlich errichteten Hügel ein riesiges Schloss und blickt mit Hunderten von Fenstern über künstlich geschaffene Kanäle und künstlich geschnittene Gärten ins Leere hinein. Kein Fluss, Handel und Wandel befördernd, strömt hier vorbei, keine Straßen, keine Bahnen treffen zusammen; völlig zufallshaft, die versteinerte Laune eines großen Herrn, hält dieser Palast seine sinnlos riesige Pracht dem verwunderten Blick entgegen.
Dies gerade aber wollte der cäsarische Wille Ludwigs XIV.: Seinem eigenen Selbstbewusstsein, seiner Neigung zur Selbstvergöttlichung einen schimmernden Altar errichten. Entschlossener Autokrat, machtherrischer Mensch, hatte er seinen Einheitswillen siegreich dem zerspaltenen Lande aufgezwungen, einem Reiche die Ordnung, einer Gesellschaft die Sitte, einem Hof die Etikette, einem Glauben die Einheit, der Sprache die Reinheit vorgeschrieben. Von seiner Person war dieser Vereinheitlichungswille ausgestrahlt, zu seiner Person sollte darum aller Glanz wieder zurückfluten. „Wo ich bin, da ist der Staat“, wo ich wohne, da ist der Mittelpunkt Frankreichs, der Nabel der Welt: Um diese völlige Uneingeschränktheit seiner Stellung zu versinnlichen, verlegt der Roi-soleil seinen Palast mit Absicht weg von Paris. Eben indem er seine Residenz völlig ins Leere stellt, betont er, ein König von Frankreich brauche nicht die Stadt, die Bürger, die Masse als Stütze oder Folie seiner Macht. Genug, dass er den Arm ausstreckt und gebietet, und schon entstehen auch aus Sumpf und Sand Gärten und Wald, Kaskaden und Grotten, der schönste und mächtigste Palast; von diesem astronomischen Punkt, den seine Willkür eigenmächtig gewählt, geht von nun ab die Sonne seines Reiches auf und unter. Versailles ist erbaut, um Frankreich sinnfällig zu beweisen, dass das Volk nichts ist und der König alles.





























