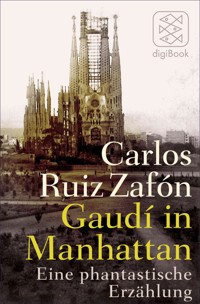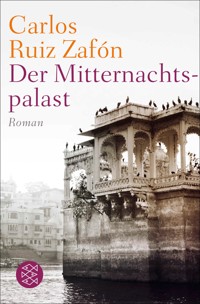8,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Óscar Drai das Mädchen Marina trifft, ahnt er nicht, dass sie sein Leben für immer verändern wird. Mit ihrem Vater lebt sie in einer alten Villa wie in einer vergangenen Zeit. Marina bringt Óscar auf die Spur einer mysteriösen Dame in Schwarz, und bald befinden sich die beiden mitten in einem Albtraum aus Trauer, Wut und Größenwahn, der alles Glück zu zerstören droht. Nur kurz vor seinen Weltbestsellern ›Der Schatten des Windes‹, ›Das Spiel des Engels‹ und ›Der Gefangene des Himmels‹ schuf Carlos Ruiz Zafón ›Marina‹. Erstmals beschwört Zafón sein unnachahmliches Barcelona herauf und erzählt die dramatische Geschichte eines jungen Mannes, der um sein Glück und seine große Liebe kämpft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Carlos Ruiz Zafón
Marina
Fischer e-books
Liebe Leser,
immer schon habe ich gedacht, jedem Schriftsteller seien, ob er es zugebe oder nicht, einige seiner Bücher besonders lieb. Diese Vorliebe hat selten etwas mit dem eigentlichen literarischen Wert des Werks zu tun oder mit der Aufnahme, die es seinerzeit beim Publikum gefunden hat, noch mit dem Glück oder Elend seiner Veröffentlichung. Ohne den genauen Grund dafür angeben zu können, fühlt man sich einigen seiner Geschöpfe schlicht näher als anderen. Unter all den Büchern, die ich publiziert habe, seit ich um 1992 diesen seltsamen Beruf des Romanautors ergriffen habe, ist Marina einer meiner Lieblinge.
Ich habe den Roman zwischen 1996 und 1997 in Los Angeles geschrieben. Damals war ich fast dreiunddreißig und wurde von der Ahnung beschlichen, dass das, was irgendein Armleuchter einmal als frühe Jugend bezeichnet hat, mir mit der Geschwindigkeit eines Ozeandampfers zu entgleiten drohte. Vorher hatte ich drei Romane für Jugendliche veröffentlicht, und kurz nach Beginn der Niederschrift von Marina wurde mir klar, dass dieses Buch anders sein würde, ein ehrgeizigerer und auch persönlicherer Roman, in dem ich zum ersten Mal den Schauplatz meines Barcelonas und meiner eigenen Erinnerung erkunden würde. Je weiter ich mit dem Schreiben kam, desto mehr erschien mir Marina als der Übergang zu einer anderen Form des Erzählens, wo ich schließlich das finden würde, was Schriftsteller gemeinhin ›ihre Stimme‹ zu nennen pflegen. Als ich fertig war, hatte ich den Eindruck, etwas in mir drin, etwas, von dem ich selbst heute noch nicht genau weiß, was es war, was ich aber täglich vermisse, sei für immer auf diesen Seiten zurückgeblieben.
Marina ist möglicherweise der am schwersten zu definierende und einzuordnende meiner Romane – und vielleicht auch der persönlichste von allen. Ironischerweise hat mir gerade seine Veröffentlichung am meisten Verdruss bereitet. Er hat zehn Jahre elender und oft unrechtmäßiger Ausgaben überlebt, die in einigen Fällen, ohne dass ich viel dagegen hätte tun können, viele Leser verwirrt haben, indem sie den Roman als etwas auszugeben versuchten, was er nicht war. Und dennoch entdecken weiterhin Leser jeden Alters und Standes auf seinen Seiten irgendetwas und finden Zugang zu diesem Dachgeschoss der Seele, von dem uns der Erzähler, Óscar, berichtet.
Endlich kommt Marina wieder nach Hause, und jetzt können die Leser den Bericht, den Óscar an ihrer Stelle verfasst hat, unter den Bedingungen entdecken, die sich sein Autor immer gewünscht hat. Vielleicht bin ich jetzt mit ihrer Hilfe in der Lage, zu verstehen, warum dieser Roman in meinem Geist weiterhin so gegenwärtig ist wie an dem Tag, an dem ich seine Niederschrift beendete, und ich werde mich, wie Marina sagen würde, wieder an das erinnern können, was nie geschah.
Carlos Ruiz Zafón
Marina sagte einmal zu mir, wir erinnerten uns nur an das, was nie geschehen sei. Es sollte eine Ewigkeit dauern, bis ich diese Worte begriff. Doch ich fange besser am Anfang an, und der ist in diesem Fall das Ende.
Im Mai 1980 verschwand ich eine Woche lang vom Erdboden. Sieben Tage und sieben Nächte wusste kein Mensch, wo ich mich befand. Freunde, Kameraden, Lehrer und selbst die Polizei stürzten sich in die Suche nach dem Flüchtigen, den einige schon für tot hielten, während andere dachten, er habe sich in einem Anfall von geistiger Umnachtung in übel beleumdeten Straßen verirrt.
Eine Woche später glaubte ein Zivilpolizist diesen Burschen zu erkennen – die Beschreibung passte. Der Verdächtige irrte im Francia-Bahnhof umher wie eine verlorene Seele in einer aus Eisen und Nebel geschmiedeten Kathedrale. Der Beamte trat mit Detektivmiene zu mir und fragte mich, ob ich Óscar Drai heiße und der spurlos aus seinem Internat verschwundene junge Mann sei. Ich nickte mit zusammengepressten Lippen. Ich erinnere mich noch an die Spiegelung des Bahnhofsgewölbes auf seinen Brillengläsern.
Wir setzten uns auf dem Bahnsteig auf eine Bank. Bedächtig steckte sich der Polizist eine Zigarette an und ließ sie glimmen, ohne sie an die Lippen zu führen. Er sagte, eine Menge Leute brenne darauf, mir viele Fragen zu stellen, für die ich mir besser gute Antworten ausdenke. Wieder nickte ich. Er schaute mir in die Augen und beobachtete mich. »Manchmal ist es keine gute Idee, die Wahrheit zu erzählen, Óscar«, sagte er. Er reichte mir einige Münzen und bat mich, meinen Tutor im Internat anzurufen. Das tat ich. Der Polizist wartete das Ende des Gesprächs ab, gab mir Geld für ein Taxi und wünschte mir Glück. Ich fragte ihn, woher er wisse, dass ich nicht abermals verschwinde. Er schaute mich lange an. »Es verschwinden nur Leute, die auch irgendwo hingehen können«, antwortete er bloß. Er begleitete mich auf die Straße hinaus, wo er sich verabschiedete, ohne mich zu fragen, wo ich gesteckt habe. Ich sah ihn auf dem Paseo de Colón davongehen. Der Qualm seiner noch nicht angerauchten Zigarette folgte ihm wie ein treues Hündchen.
An diesem Tag meißelte Gaudís Geist unmögliche Wolken auf ein Blau, das einen fast erblinden ließ. Mit einem Taxi fuhr ich zum Internat, wo mich vermutlich das Exekutionskommando erwartete.
Vier Wochen lang bearbeiteten mich Lehrer und Schulpsychologen, mein Geheimnis preiszugeben. Ich log und bot jedem das, was er hören wollte oder akzeptieren konnte. Mit der Zeit gaben alle vor, diese Episode vergessen zu haben. Ich folgte ihrem Beispiel. Nie erzählte ich jemandem die Wahrheit.
Damals wusste ich nicht, dass der Ozean der Zeit früher oder später die Erinnerungen anschwemmt, die wir in ihm versenkt haben. Fünfzehn Jahre später ist die Erinnerung an diesen Tag zu mir zurückgekehrt. Ich habe diesen jungen Burschen im Dunst des Francia-Bahnhofs umherirren sehen, und Marinas Name hat sich erneut wie eine frische Wunde entzündet.
Wir alle haben im Dachgeschoss der Seele ein Geheimnis unter Verschluss. Das hier ist das meine.
1
Ende der siebziger Jahre war Barcelona eine Fata Morgana von Boulevards und engen Gässchen, wo man allein beim Betreten eines Hausflurs oder eines Cafés dreißig oder vierzig Jahre in die Vergangenheit zurückreisen konnte. In dieser magischen Stadt verliefen Zeit und Erinnerung, Geschichte und Fiktion wie Aquarelle im Regen. Dort war es, wo Kathedralen und aus Fabeln entsprungene Häuser im Klang von nicht mehr existierenden Straßen die Kulisse zu dieser Geschichte bildeten.
Damals war ich ein fünfzehnjähriges Bürschchen, das in den Mauern eines Internats mit Heiligennamen an den Hängen der Straße nach Vallvidrera dahinschmachtete. In jenen Tagen sah das Viertel Sarriá noch wie ein kleines, an den Rändern einer modernistischen Metropolis gestrandetes Dorf aus. Meine Schule thronte am Ende einer Straße, die vom Paseo de la Bonanova aus bergan kletterte. Ihre monumentale Fassade hätte eher auf eine Burg als auf eine Lehranstalt schließen lassen. Die verwinkelte, lehmfarbene Silhouette war ein Puzzle aus Festungstürmen, Bögen und dunklen Flügeln.
Die Schule stand inmitten einer Zitadelle von Gärten, Brunnen, verschlammten Teichen, Höfen und verhexten Pinienbeständen. Darum herum beherbergten düstere Gebäude von gespenstischem Dunst verschleierte Schwimmbecken, stilleverzauberte Turnhallen und verwunschene Kapellen, in denen im Widerschein der Altarkerzen Heiligenbilder lächelten. Das Haus wies vier Stockwerke auf, die beiden Kellergeschosse und ein abgesperrter Zwischenstock nicht eingerechnet, in dem die wenigen Geistlichen hausten, die noch als Lehrer tätig waren. Die Zimmer der Internatsschüler lagen längs höhlenartiger Gänge im vierten Stock. Diese endlosen Galerien ruhten in stetigem Halbdunkel und geisterhaftem Echo.
Ich verbrachte meine Tage wachträumend in den Zimmern dieser ungeheuren Burg und wartete auf das Wunder, das sich täglich nachmittags um zwanzig nach fünf ereignete. Zu dieser magischen Stunde überzog die Sonne die hohen Fenster mit flüssigem Gold. Rasselnd verkündete die Glocke das Ende des Unterrichts, und wir hatten bis zum Abendessen im großen Speisesaal fast drei Stunden zu unserer freien Verfügung. Eigentlich sollte diese Zeit dem Studium und der geistigen Einkehr dienen. Ich kann mich nicht erinnern, mich auch nur an einem einzigen all meiner Tage an diesem Ort einer dieser edlen Aufgaben gewidmet zu haben.
Das war mein Lieblingsmoment. Der Kontrolle am Ausgang ein Schnippchen schlagend, zog ich los, um die Stadt zu erkunden. Ich machte es mir zur Gewohnheit, genau zur Essensstunde wieder im Internat zu sein, nachdem ich in zunehmender Dunkelheit durch alte Straßen und Boulevards geschlendert war. Diese langen Spaziergänge bescherten mir ein Gefühl berauschender Freiheit. Meine Phantasie überflügelte die Häuser und stieg zum Himmel empor. Für einige Stunden verflüchtigten sich Barcelonas Straßen, das Internat und mein düsteres Zimmer im vierten Stock. Für einige Stunden war ich, mit nur zwei Münzen in der Tasche, der glücklichste Mensch der Welt.
Oft führte mich mein Weg durch die damals sogenannte Wildnis von Sarriá, die nichts weiter war als eine Andeutung von verlorenem Wald im Niemandsland. Die meisten Herrschaftsvillen, die seinerzeit das Gelände nördlich des Paseo de la Bonanova besiedelt hatten, standen noch da, wenn auch nur als Ruinen. Die Straßen ums Internat herum umrissen eine Geisterstadt. Efeuüberwucherte Mauern versiegelten den Zugang zu wilden Gärten, in denen sich monumentale, von Unkraut und Vernachlässigung heimgesuchte Paläste erhoben, in welchen die Erinnerung wie hartnäckiger Nebel zu schweben schien. Viele dieser Kästen warteten auf ihren Abbruch, andere waren jahrelang ausgeplündert worden. In einigen jedoch gab es noch Menschen.
Sie waren die vergessenen Mitglieder heruntergekommener Geschlechter. Menschen, deren Name in der Vanguardia vier Spalten eingenommen hatte, als die Straßenbahnen noch den Argwohn moderner Erfindungen weckten. Geiseln ihrer moribunden Vergangenheit, die sich weigerten, das sinkende Schiff zu verlassen. Sie befürchteten, ihre Körper würden sich im Wind in Asche auflösen, wenn sie den Fuß auf Gebiet jenseits ihrer baufälligen Villen zu setzen wagten. Wie Gefangene welkten sie im Licht der Kandelaber dahin. Manchmal, wenn ich eiligen Schrittes an diesen verrosteten Gittertoren vorüberging, meinte ich, durch die verschossenen Fensterläden misstrauische Blicke zu spüren.
Eines Nachmittags Ende September 1979 beschloss ich, mich aufs Geratewohl in eine dieser von Jugendstilpalästchen übersäten Prachtstraßen zu wagen, die ich bisher noch nie bemerkt hatte. Sie beschrieb eine Kurve, die vor einem gewöhnlichen Gittertor endete. Jenseits erstreckte sich das, was von einem alten, jahrzehntelange Vernachlässigung offenbarenden Garten übriggeblieben war. Inmitten der Vegetation sah man die dunklen Umrisse eines zweistöckigen Hauses, das sich hinter einem Brunnen mit Skulpturen erhob, die die Zeit mit Moos überzogen hatte.
Langsam senkte sich die Dämmerung herab, und dieser Winkel kam mir etwas unheimlich vor, so von tödlicher Stille umgeben, in der nur die Brise eine wortlose Warnung vor sich hin murmelte. Mir wurde klar, dass ich in eine der »toten« Zonen des Viertels eingedrungen war. Ich dachte, am besten sei es, kehrtzumachen und zum Internat zurückzugehen. Ich war noch hin und her gerissen zwischen einer krankhaften Faszination durch diesen vergessenen Ort und dem gesunden Menschenverstand, als ich im Halbdunkel zwei gelbe Augen leuchten sah, die sich wie Dolche auf mich hefteten. Ich schluckte.
Vor dem Gittertor zeichnete sich reglos das grausamtene Fell einer Katze ab. In ihrer Schnauze rang ein Spatz mit dem Tod. Um den Hals trug sie ein silbernes Glöckchen. Einige Sekunden musterte mich ihr Blick. Dann machte sie kehrt und glitt durch die Metallstäbe davon. Ich sah sie, den Sperling auf seiner letzten Reise davontragend, in der Unendlichkeit dieses verdammten Edens verschwinden.
Der Anblick des hochmütigen, herausfordernden kleinen Raubtiers fesselte mich. Aufgrund seines glänzenden Fells und des Glöckchens vermutete ich, dass es sich um eine zahme Katze handelte. Vielleicht beherbergte dieses Haus mehr als nur die Geister eines verschwundenen Barcelonas. Ich trat näher und legte die Hände auf die Stäbe des Gittertors. Das Metall fühlte sich kalt an. Das letzte Licht der Abenddämmerung erhellte die Spur, die die Blutstropfen des Sperlings in dieser Wildnis hinterlassen hatten – scharlachrote Perlen, die den Weg durchs Labyrinth vorzeichneten. Wieder versuchte ich zu schlucken, doch mein Mund war ausgetrocknet. In meinen Schläfen hämmerte der Puls, als wüsste er etwas, was mir verborgen war. Da spürte ich unter meinem Gewicht das Tor nachgeben und bemerkte, dass es nicht abgeschlossen war.
Bei meinem ersten Schritt ins Innere beleuchtete der Mond die blassen Gesichter der steinernen Engel in der Mitte des Brunnens. Sie beobachteten mich. Meine Füße waren wie festgewurzelt. Ich wartete darauf, dass diese Wesen von ihren Podesten sprängen und zu Teufeln mit Wolfsklauen und Schlangenzungen würden. Nichts dergleichen geschah. Ich atmete tief und erwog die Möglichkeit, meine Phantasie zum Schweigen zu bringen oder aber, noch besser, meine zaghafte Erforschung dieses Besitzes abzubrechen. Doch jemand anders entschied für mich. Ein himmlischer Klang erfüllte die Schatten des Gartens wie ein Parfüm. Ich hörte, wie dieses sphärische Summen allmählich eine vom Klavier begleitete Arie ziselierte. Eine Frauenstimme – die schönste, die ich je gehört hatte.
Die Melodie schien mir vertraut, dennoch konnte ich sie nicht benennen. Die Musik kam aus dem Haus. Ich folgte ihrer hypnotischen Spur. Feine Schichten dunstigen Lichts sickerten aus der angelehnten Tür einer verglasten Veranda. Auf einem Fensterbrett im ersten Stock erkannte ich die auf mich gehefteten Augen der Katze. Ich trat zu der erleuchteten Veranda, woher dieser unbeschreibliche Klang kam. Im Inneren flackerte der schwache Abglanz von hundert Kerzen. Der Schein ließ den goldenen Trichter eines alten Grammophons erkennen, auf dem sich eine Schallplatte drehte. Ich ertappte mich dabei, wie ich, ohne zu überlegen, in die Veranda eindrang, gefesselt von dieser im Grammophon gefangenen Sirene. Auf dem Tisch mit dem Apparat erkannte ich einen glänzenden runden Gegenstand, eine Taschenuhr. Ich nahm sie und untersuchte sie im Kerzenlicht. Die Zeiger auf dem zersplitterten Zifferblatt waren stehengeblieben. Sie schien aus Gold zu sein und so alt wie das Haus, in dem ich mich jetzt befand. Etwas weiter entfernt stand mit dem Rücken zu mir ein riesiger Sessel vor einem Kamin, über dem ich das Ölbild einer weißgekleideten Frau erkennen konnte. Ihre großen Augen, traurig und unergründlich, beherrschten den ganzen Raum.
Unversehens zersprang der Zauber. Eine Gestalt erhob sich aus dem Sessel und wandte sich zu mir um. Weißes langes Haar und glühende Augen glänzten in der Dunkelheit. Ich sah zwei riesige weiße Hände, die sich mir entgegenstreckten. Von Panik gepackt, begann ich auf die Tür zuzulaufen, stieß dabei gegen das Grammophon und warf es um. Ich hörte, wie die Nadel über die Platte kratzte. Mit einem höllischen Klagelaut brach die himmlische Stimme. Ich stürzte in den Garten hinaus, während ich spürte, wie diese Hände mein Hemd berührten, und durchquerte ihn mit geflügelten Füßen und in meinen sämtlichen Poren brennender Angst. Keinen Augenblick blieb ich stehen. Ich lief und lief, ohne zurückzuschauen, bis mir ein stechender Schmerz die Seite durchbohrte und ich begriff, dass ich kaum noch atmen konnte. Da war ich schon mit kaltem Schweiß bedeckt, und in dreißig Meter Entfernung brannten die Lichter des Internats.
Ich glitt durch eine stets unbewachte Pforte neben der Küche und schleppte mich in mein Zimmer hinauf. Die anderen Schüler mussten schon seit geraumer Weile im Speisesaal sitzen. Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn, und nach und nach fand mein Herz zu seinem normalen Rhythmus zurück. Als ich eben ein wenig ruhiger geworden war, klopfte jemand an.
»Óscar, Zeit, zum Abendessen runterzukommen«, sagte einer der Tutoren, ein rationalistischer Jesuit namens Seguí, der es hasste, den Polizisten zu spielen.
»Sogleich, Pater«, antwortete ich. »Bloß eine Sekunde.«
Eilig schlüpfte ich ins vorgeschriebene Jackett und knipste das Licht in meinem Zimmer aus. Durchs Fenster sah ich das Gespenst des Mondes hoch über Barcelona. Erst da bemerkte ich, dass ich noch immer die goldene Uhr in der Hand hielt.
2
In den darauffolgenden Tagen wurden die verflixte Uhr und ich unzertrennliche Gefährten. Ich nahm sie überallhin mit, sogar beim Schlafen lag sie unter meinem Kopfkissen, da ich befürchtete, jemand könnte sie finden und sich nach ihrer Herkunft erkundigen. Ich hätte die Antwort schuldig bleiben müssen. »Ja, weil du sie nicht gefunden, sondern hast mitgehen lassen«, flüsterte mir eine anklagende Stimme zu. »Der Fachausdruck lautet Diebstahl und Hausfriedensbruch.« Merkwürdigerweise ähnelte diese Stimme sehr derjenigen des Synchronsprechers von Perry Mason.
Geduldig wartete ich jeden Abend, bis meine Kameraden eingeschlafen waren, um meinen Schatz zu studieren. Sobald Stille eingetreten war, betrachtete ich die Uhr aufmerksam im Licht einer Taschenlampe. Nicht alle Schuld der Welt hätte die Faszination schmälern können, die mir die Beute meines ersten Abenteuers im desorganisierten Verbrechen bescherte. Das Stück war schwer und schien aus massivem Gold gefertigt. Das zerbrochene Zifferblatt ließ einen harten Schlag oder Sturz erahnen, der das Uhrwerk zunichtegemacht und die Zeiger auf ewig zu sechs Uhr dreiundzwanzig verdammt haben musste. Auf der Rückseite war eine Inschrift eingraviert:
Für Germán, aus dem das Licht spricht.
K.A.
19-1-1964
Ich dachte, die Uhr sei bestimmt ein Vermögen wert, und wurde bald von Gewissensbissen heimgesucht. Die eingravierten Worte gaben mir das Gefühl, ein Dieb von Erinnerungen zu sein.
An einem regennassen Donnerstag beschloss ich, mein Geheimnis mit jemandem zu teilen. Mein bester Freund im Internat hatte durchdringende Augen und ein nervöses Temperament und wollte unbedingt JF genannt werden, obwohl die Abkürzung nichts mit seinem richtigen Namen zu tun hatte. JF hatte die Seele eines anarchistischen Poeten und einen so messerscharfen Geist, dass er sich damit oft in die Zunge schnitt. Er hatte eine schwächliche Konstitution, und wenn jemand im Umkreis von einem Kilometer das Wort Mikrobe aussprach, glaubte er schon, eine Infektion aufgelesen zu haben. Einmal suchte ich in einem Wörterbuch das Wort Hypochonder und machte ihm eine Kopie der Definition.
»Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber deine Biographie steht im Wörterbuch der Königlichen Akademie«, sagte ich.
Er sah rasch auf die Fotokopie und warf mir einen Blick wie ein Schürhaken zu.
»Schlag mal unter I wie Idiot nach, dann siehst du, dass ich nicht die einzige Berühmtheit bin«, antwortete er.
An diesem Tag schlichen JF und ich uns zur Stunde der mittäglichen Pause in die düstere Aula. Unsere Schritte auf dem Hauptgang weckten das Echo von hundert auf Zehenspitzen dahintänzelnden Schatten. Zwei harte Lichtkegel fielen auf die staubgeschwängerte Szenerie. Wir setzten uns in die Lichtung vor die leeren Stuhlreihen, die im Halbdunkel verschwammen. Der Regen krabbelte über die Scheiben des ersten Stocks.
»Also«, sagte JF, »was soll die Geheimniskrämerei?«
Wortlos zog ich die Uhr aus der Tasche und reichte sie ihm. Er hob die Brauen und prüfte sie einige Augenblicke eingehend. Dann gab er sie mir mit einem neugierigen Blick zurück.
»Was hältst du davon?«, fragte ich.
»Ich halte es für eine Uhr«, antwortete er. »Wer ist dieser Germán?«
»Keine Ahnung.«
Dann schilderte ich ihm in allen Einzelheiten mein Abenteuer einige Tage zuvor in dem verlotterten alten Haus. Er hörte mit der für ihn bezeichnenden, fast wissenschaftlichen Aufmerksamkeit und Geduld zu. Als ich fertig war, schien er das Ganze abzuwägen, ehe er seine ersten Eindrücke äußerte.
»Du hast sie also geklaut«, folgerte er.
»Das ist nicht der Punkt.«
»Da müsste man schauen, was dieser Germán dazu meint.«
»Wahrscheinlich ist dieser Germán schon seit Jahren tot«, sagte ich ohne große Überzeugung.
JF rieb sich das Kinn.
»Ich frage mich, was das Strafgesetzbuch zu vorsätzlichem Diebstahl von persönlichen Gegenständen und Uhren mit Widmung sagt«, meinte mein Freund.
»Vorsätzlich, so ein Quatsch«, protestierte ich. »Alles ging ganz schnell, ohne dass ich Zeit zum Nachdenken hatte. Als ich merkte, dass ich die Uhr hatte, war es schon zu spät. An meiner Stelle hättest du genau dasselbe getan.«
»An deiner Stelle hätte ich einen Herzstillstand erlitten«, präzisierte er, eher ein Mann der Worte als der Tat. »Angenommen, ich wäre überhaupt so verrückt gewesen, einer Teufelskatze zu folgen und in diesen alten Kasten einzudringen. Wer weiß, was für Keime man sich von so einem Vieh einfangen kann.«
Einige Sekunden schwiegen wir und hörten dem fernen Echo des Regens zu.
»Nun«, schloss JF, »geschehen ist geschehen. Du wirst ja wohl nicht noch einmal dorthin wollen, oder?«
Ich lächelte.
»Allein nicht.«
Mein Freund machte tellergroße Augen.
»O nein! Kommt nicht in Frage.«
Noch am selben Nachmittag nach Unterrichtsschluss schlichen JF und ich uns durch die Küchenpforte davon und peilten die geheimnisvolle Straße an, die zu dem kleinen Palast führte. Das Pflaster war von Pfützen und Laub übersät. Ein bedrohlicher Himmel lag wie ein Deckel über der Stadt. JF, der sich mir mit mehr als gemischten Gefühlen angeschlossen hatte, war blasser als sonst. Der Anblick dieses in der Vergangenheit gefangenen Winkels ließ seinen Magen zur Murmel schrumpfen. Die Stille war ohrenbetäubend.
»Ich glaube, am besten hauen wir wieder ab«, flüsterte er und trat ein paar Schritte zurück.
»Sei doch kein Hase.«
»Die Leute wissen Hasen gar nicht wirklich zu schätzen. Ohne sie gäbe es weder Ostereier noch …«
Auf einmal breitete sich Glöckchenklingeln im Wind aus. JF verstummte. Die gelben Katzenaugen beobachteten uns. Unversehens zischte das Tier wie eine Schlange und zeigte uns die Krallen. Seine Rückenhaare sträubten sich, und im Maul sahen wir die Zähne, die Tage zuvor einem Sperling den Garaus gemacht hatten. Ein ferner Blitz entzündete am Himmelsgewölbe einen Lichtfächer. JF und ich schauten uns an.
Eine Viertelstunde später saßen wir auf einer Bank am Teich im Internatskreuzgang. Die Uhr steckte weiterhin in meiner Jacketttasche. Schwerer denn je.
Dort blieb sie für den Rest der Woche, bis zum frühen Samstagmorgen. Kurz vor Tagesanbruch erwachte ich mit dem vagen Gefühl, von der im Grammophon gefangenen Stimme geträumt zu haben. Vor meinem Fenster ging Barcelona in scharlachroten Schatten auf, ein Wald aus Antennen und Zinnen. Ich sprang aus dem Bett und zog die vermaledeite Uhr, die mir in den letzten Tagen das Leben verhext hatte, unter dem Kopfkissen hervor. Wir sahen einander an. Schließlich wappnete ich mich mit der Entschlossenheit, zu der man sich nur durchringen kann, wenn es wahnwitzige Aufgaben zu lösen gilt, und nahm mir vor, dieser Situation ein Ende zu setzen. Ich würde die Uhr zurückbringen.
Leise zog ich mich an und schlich auf Zehenspitzen durch den dunklen Gang des vierten Stocks. Bis zehn oder elf Uhr würde niemand mein Fehlen bemerken. Und da hoffte ich, wieder zurück zu sein.
Draußen lagen die Straßen unter dem trüben Purpurmantel, der in Barcelona das Morgengrauen einhüllt. Ich ging bis zur Calle Margenat hinunter. Um mich herum erwachte Sarriá. Niedrige Wolken durchzogen das Viertel und fingen die ersten Lichter in einem goldenen Nimbus ein. In den Lücken des Dunstes zeichneten sich die Hausfassaden und das umherflatternde Laub ab.
Ich fand die Straße sogleich wieder. Einen Augenblick blieb ich stehen, um die Stille, den seltsamen Frieden in mich aufzunehmen, der an diesem verlorenen Ort der Stadt herrschte. Allmählich spürte ich, dass die Welt zusammen mit der Uhr in meiner Tasche stehengeblieben war, als ich hinter mir ein Geräusch vernahm.
Ich drehte mich um und hatte eine Vision wie in einem Traum.
3
Langsam löste sich ein Fahrrad aus dem Dunst. Ein junges Mädchen in einem weißen Kleid fuhr mir bergauf entgegen. Im durchscheinenden Licht des frühen Morgens waren durch die Baumwolle hindurch die Umrisse ihres Körpers zu erraten. Lange heublonde Haare verdeckten in Wellen ihr Gesicht. Reglos, wie ein halbgelähmter Idiot schaute ich zu, wie sie sich mir näherte. Zwei Meter vor mir blieb das Rad stehen. Meine Augen – oder meine Phantasie – erahnten die Konturen schlanker Beine, die sich auf den Boden stemmten. Mein Blick kletterte das Kleid hoch, das einem Bild von Sorolla zu entstammen schien, um dann bei den Augen innezuhalten, so tief grau, dass man hätte hineinfallen können. Sie ruhten mit sarkastischem Blick auf mir.
Ich lächelte und setzte das dümmlichste Gesicht auf, das ich zustande brachte.
»Du musst der mit der Uhr sein«, sagte das junge Mädchen in einem Ton, der zu ihrem starken Blick passte.
Ich schätzte sie auf mein Alter, vielleicht ein Jahr älter. Das Alter einer Frau zu erraten war für mich eine Kunst oder eine Wissenschaft, nie ein bloßer Zeitvertreib. Ihre Haut war so blass wie das Kleid.
»Wohnst du hier?«, stotterte ich und deutete auf das Gittertor.
Sie blinzelte nur. Ihre Augen durchbohrten mich mit solcher Wut, dass ich zwei Stunden brauchen würde, um zu merken, dass dies das bezauberndste Geschöpf war, das ich je im Leben gesehen hatte oder zu sehen hoffte. Aber das ist ein anderes Thema.
»Und wer bist du, dass du das fragst?«
»Vermutlich bin ich der mit der Uhr«, improvisierte ich. »Ich heiße Óscar. Óscar Drai. Ich bin gekommen, um sie zurückzubringen.«
Bevor sie etwas sagen konnte, zog ich die Uhr aus der Tasche und reichte sie ihr. Einige Sekunden schaute mich das junge Mädchen weiter an, ehe sie sie ergriff. Dabei sah ich, dass ihre Hand so weiß wie Schnee war und dass sie am entsprechenden Finger einen goldenen Ring trug.
»Sie war schon kaputt, als ich sie an mich nahm«, erklärte ich.
»Sie ist seit fünfzehn Jahren kaputt«, murmelte sie, ohne mich anzusehen.
Als sie schließlich aufschaute, musterte sie mich von oben bis unten wie ein altes Möbelstück. Etwas in ihren Augen sagte mir, dass sie mich nicht unbedingt für einen Dieb hielt, sondern vielmehr für einen Schwachsinnigen oder ganz gewöhnlichen Dummkopf. Das Idiotengesicht, das ich aufgesetzt hatte, mochte das Seinige dazu beitragen. Das Mädchen zog eine Braue in die Höhe, während sie rätselhaft lächelte und mir die Uhr zurückgab.
»Du hast sie mitgenommen, also sollst auch du sie ihrem Eigentümer zurückgeben.«
»Aber …«
»Die Uhr gehört nicht mir«, erklärte sie. »Sie gehört Germán.«
Die Nennung dieses Namens beschwor die riesige Silhouette mit der weißen Mähne herauf, die mich einige Tage zuvor in der Galerie des alten Hauses überrascht hatte.
»Germán?«
»Mein Vater.«
»Und du bist …?«, fragte ich.
»Seine Tochter.«
»Ich meine, wie du heißt.«
»Ich weiß ganz genau, was du meinst.«
Und sie stieg wieder aufs Rad und fuhr durchs Tor. Bevor sie sich im Garten verlor, wandte sie sich kurz um. Ihre Augen lachten mich lauthals aus. Ich seufzte und folgte ihr. Eine alte Bekannte hieß mich willkommen. Die Katze schaute mich mit ihrer üblichen Verachtung an. Gern wäre ich ein Dobermann gewesen.
Eskortiert von dem Tier, ging ich durch den Garten, bahnte mir einen Weg durch den Dschungel bis zu dem Brunnen mit den Cherubim. Dort war das Rad angelehnt, und seine Eigentümerin hievte eine Tüte aus dem Korb am Lenker. Es duftete nach frischem Brot. Sie zog eine Flasche Milch aus der Tüte und kniete nieder, um eine große Tasse auf dem Boden zu füllen. Das Tier schoss auf sein Frühstück zu. Das schien ein tägliches Ritual zu sein.
»Ich dachte, deine Katze frisst nur wehrlose Vögel«, sagte ich.
»Er jagt sie bloß. Er frisst sie nicht. Das ist eine Frage des Territoriums«, erklärte sie, als hätte sie ein Kind vor sich. »Was er wirklich mag, ist Milch. Nicht wahr, Kafka, Milch schmeckt dir?«
Zum Zeichen der Zustimmung leckte ihr das kafkaeske Katzentier die Hand. Sie lächelte warm, während sie ihm den Rücken streichelte. Dabei zeichneten sich in den Falten des Kleides ihre Muskeln ab. Nun schaute sie auf und ertappte mich dabei, wie ich sie anstarrte und mir mit der Zunge über die Lippen fuhr.
»Und du? Hast du gefrühstückt?«, fragte sie.
Ich schüttelte den Kopf.
»Dann hast du bestimmt Hunger. Dummköpfe haben immer Hunger«, sagte sie. »Komm rein und iss was. Es wird gut sein, etwas im Magen zu haben, wenn du Germán erklären willst, warum du ihm die Uhr gestohlen hast.«
Die Küche war ein großer Raum im hinteren Teil des Hauses. Mein unerwartetes Frühstück bestand aus Hörnchen, die das junge Mädchen aus der Konditorei Foix auf der Plaza de Sarriá mitgebracht hatte. Sie stellte eine riesige Tasse Milchkaffee vor mich hin und setzte sich mir gegenüber, während ich gierig diesen Festschmaus verzehrte. Sie betrachtete mich, als hätte sie einen hungrigen Bettler aufgenommen, mit einer Mischung aus Neugier, Mitleid und Argwohn. Sie selbst rührte keine Krume an.
»Ich hab dich schon mal in dieser Gegend gesehen«, bemerkte sie, ohne mich aus den Augen zu lassen. »Dich und diesen kleinen Jungen mit dem verschreckten Gesicht. Oft geht ihr durch die hintere Straße, wenn man euch im Internat freilässt. Manchmal bist du allein und trällerst geistesabwesend vor dich hin. Ich könnte wetten, ihr habt einen Mordsspaß in diesem Kerker …«
Eben wollte ich etwas Geistreiches antworten, als sich ein mächtiger Schatten wie eine Tintenwolke auf dem Tisch ausbreitete. Meine Gastgeberin schaute auf und lächelte. Ich blieb reglos sitzen, den Mund voller Hörnchen, der Puls zwei Kastagnetten.
»Wir haben Besuch«, verkündete sie amüsiert. »Papa, das ist Óscar Drai, Amateuruhrendieb. Óscar, das ist Germán, mein Vater.«
Ich schluckte alles auf einmal hinunter und wandte mich langsam um. Vor mir erhob sich eine Gestalt, die mir riesig erschien. Der Mann trug einen Anzug aus Alpakawolle mit Weste und Fliege. Eine säuberlich zurückgekämmte Mähne fiel ihm über die Schultern. Ein weißer Schnurrbart zierte sein Gesicht, das um zwei dunkle, traurige Augen herum von scharfen Linien durchfurcht war. Was ihn aber wirklich ausmachte, waren seine Hände. Weiße Engelshände mit schmalen, endlosen Fingern. Germán.
»Ich bin kein Dieb …«, presste ich nervös heraus. »Es gibt für alles eine Erklärung. Wenn ich es gewagt habe, in Ihr Haus einzudringen, dann, weil ich glaubte, es sei unbewohnt. Ich weiß auch nicht, was dann mit mir geschah, als ich drin war, ich hörte diese Musik, nun, äh, jedenfalls kam ich herein und sah die Uhr. Ich wollte sie eigentlich gar nicht mitnehmen, ich schwör’s Ihnen, aber ich bin erschrocken, und als ich sah, dass ich die Uhr hatte, war ich schon weit weg. Also, ich weiß nicht, ob ich mich klar ausdrücke …«
Das junge Mädchen lächelte verschmitzt. Dunkel und undurchdringlich bohrten sich Germáns Augen in meine. Ich nestelte in der Tasche und reichte ihm die Uhr in der Erwartung, der Mann werde jeden Augenblick zu schreien anfangen und mir mit der Polizei, den Zivilgardisten und dem Vormundschaftsgericht drohen.
»Ich glaube Ihnen«, sagte er liebenswürdig, nahm die Uhr und setzte sich zu uns an den Tisch.
Seine Stimme war sanft, beinahe unhörbar. Seine Tochter stellte auch vor ihn einen Teller mit zwei Hörnchen und eine Tasse Milchkaffee hin. Dabei küsste sie ihn auf die Stirn, und Germán umarmte sie. Ich beobachtete sie im hellen Licht, das durch die Fenster hereindrang. Germáns Gesicht, das ich mir als das eines brutalen Menschen vorgestellt hatte, wurde zärtlich, fast verletzlich. Er war außerordentlich schlank und lächelte mir freundlich zu, während er die Tasse zum Mund führte, und einen Augenblick lang konnte ich spüren, dass zwischen Vater und Tochter ein Strom von Zuneigung floss, die über Worte und Gesten hinausging. Ein Band des Schweigens und der Blicke einte sie in den Schatten dieses Hauses, am Ende einer vergessenen Straße, wo sie, weitab von der Welt, einer für den anderen sorgten.
Germán beendete sein Frühstück und bedankte sich herzlich bei mir, dass ich mir die Mühe gemacht habe, ihm seine Uhr zurückzubringen. So viel Liebenswürdigkeit verdoppelte mein Schuldgefühl.
»Nun, Óscar«, sagte er mit müder Stimme, »es war mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Ich hoffe, Sie haben irgendwann Lust, uns erneut zu besuchen.«
Ich verstand nicht, warum er mich beharrlich siezte. Etwas an ihm erzählte von anderen Zeiten, als diese Mähne noch geglänzt hatte und dieser jetzt alte Kasten ein Palast auf halbem Weg zwischen Sarriá und dem Himmel gewesen war. Er gab mir die Hand, verabschiedete sich und verschwand in diesem unergründlichen Labyrinth. Ich sah ihn mit leichtem Hinken durch den Flur davongehen. Seine Tochter blickte ihm nach, einen Anflug von Trauer verbergend.
»Germán ist nicht allzu gesund«, flüsterte sie. »Er wird schnell müde.«
Aber sofort verbannte sie die Melancholie aus ihrem Blick.
»Möchtest du noch irgendwas?«
»Es ist spät geworden«, sagte ich und kämpfte gegen die Versuchung an, unter irgendeinem Vorwand noch länger in ihrer Gesellschaft zu verweilen. »Ich glaube, ich geh jetzt am besten.«
Sie begleitete mich in den Garten hinaus. Das Morgenlicht hatte den Dunst vertrieben. Der beginnende Herbst färbte die Bäume kupfern. Wir gingen aufs Gittertor zu; Kafka schnurrte in der Sonne. Beim Tor angelangt, blieb das junge Mädchen auf dem Grundstück und ließ mich hinaus. Wir sahen uns schweigend an. Sie reichte mir die Hand, und ich ergriff sie. Unter der Samthaut konnte ich ihren Puls fühlen.
»Danke für alles«, sagte ich. »Und Verzeihung wegen …«
»Unwichtig.«
Ich zuckte die Schultern.
»Nun …«
Ich begann die Straße hinunterzugehen und spürte, wie die Magie dieses Hauses mit jedem Schritt mehr von mir abfiel. Auf einmal hörte ich ihre Stimme hinter mir:
»Óscar!«
Ich wandte mich um. Sie stand immer noch dort, hinter dem Gittertor. Zu ihren Füßen lag Kafka.
»Warum bist du neulich abends in unser Haus eingedrungen?«
Ich sah mich um, als erwartete ich, die Antwort aufs Pflaster geschrieben zu finden.
»Ich weiß es nicht«, gestand ich schließlich. »Das Geheimnis vermutlich …«
Sie lächelte rätselhaft.
»Du magst Geheimnisse?«
Ich nickte. Ich glaube, wenn sie mich gefragt hätte, ob ich Arsen mochte, hätte ich ebenfalls genickt.
»Hast du morgen was vor?«
Ich schüttelte den Kopf, weiterhin stumm. Gäbe es irgendetwas zu tun, so würde ich mir eine Ausrede einfallen lassen. Als Dieb war ich keinen Heller wert, aber im Lügen, muss ich gestehen, war ich schon immer ein Künstler gewesen.
»Dann erwarte ich dich hier, um neun«, sagte sie und verlor sich in den Schatten des Gartens.
»Warte!«
Mein Ruf hielt sie zurück.
»Du hast mir nicht gesagt, wie du heißt …«
»Marina … Bis morgen.«
Ich winkte ihr zu, aber sie war bereits verschwunden. Vergeblich wartete ich, dass sie sich nochmals zeigte. Die Sonne berührte die Himmelskuppel, und ich rechnete mir aus, dass es etwa zwölf Uhr mittags sein musste. Als ich sah, dass Marina nicht noch einmal kommen würde, ging ich ins Internat zurück. Die alten Haustüren im Viertel schienen mir vertraulich zuzulächeln. Ich konnte das Echo meiner Schritte hören, doch ich hätte schwören können, eine Handbreit über dem Boden zu wandeln.
4
Ich glaube, in meinem ganzen Leben war ich nie so pünktlich gewesen. Die Stadt steckte noch im Pyjama, als ich über die Plaza de Sarriá ging. Während es zur Neun-Uhr-Messe läutete, flog bei meinem Vorübergehen ein Schwarm Tauben auf. Eine Sonne wie auf einem Kalenderbild entzündete die Spuren nächtlichen Nieselregens. Kafka war mich am Anfang der Straße, die zum Haus führte, abholen gekommen. Eine Gruppe Spatzen hielt sich auf einer Mauer in weisem Abstand. Der Kater beobachtete sie mit geübter professioneller Gleichgültigkeit.
»Morgen, Kafka. Haben wir heute schon einen Mord begangen?«
Er antwortete mit einem Schnurren und führte mich wie ein phlegmatischer Butler durch den Garten zum Brunnen. Auf dessen Rand erkannte ich Marinas Gestalt in einem elfenbeinfarbenen, schulterfreien Kleid. Mit einer Füllfeder schrieb sie in ein ledergebundenes Buch. Ihr Gesicht verriet große Konzentration, und sie nahm mich überhaupt nicht wahr. Ihr Geist schien in einer anderen Welt zu weilen, so dass ich sie einige Augenblicke verzückt betrachten konnte. Ich hatte keinen Zweifel, dass diese Schlüsselbeine von Leonardo da Vinci entworfen worden waren, eine andere Erklärung war nicht möglich. Eifersüchtig brach Kafka mit einem Miauen die Magie. Der Füller hielt brüsk inne, Marina schaute auf und mir in die Augen und klappte das Buch zu.
»Bereit?«
Sie führte mich mit unbekanntem Ziel und geheimnisvollem Lächeln durch die Straßen von Sarriá.
»Wohin gehen wir?«, fragte ich nach einigen Minuten.
»Nur Geduld. Du wirst es schon sehen.«
Ich folgte ihr gehorsam, obwohl ich argwöhnte, einem im Moment noch unverständlichen Scherz aufzusitzen. Wir gingen zum Paseo de la Bonanova hinunter und von dort Richtung San Gervasio. Vor dem schwarzen Loch von Víctors Kneipe wärmte eine Gruppe junger Schnösel mit einem Bier in der Hand und hinter Sonnenbrillen verschanzt lässig die Sättel ihrer Vespas. Als wir vorübergingen, sahen sich einige von ihnen gemüßigt, ihre Ray Bans auf halbmast zu setzen, um Marina mit Röntgenblick zu erfassen. Blei sollt ihr fressen, dachte ich.
Dann bog Marina rechts in die Calle Dr. Roux ein. Wir gingen zwei Häuserblocks hinunter bis zu einem schmalen unasphaltierten Pfad, der bei der Nummer 112 begann. Noch immer stand das rätselhafte Lächeln auf ihren Lippen.
»Ist es hier?«, fragte ich gespannt.
Der Pfad schien zu Ende zu sein. Marina ging aber einfach weiter zu einem Weg, der zu einem zypressengesäumten Säulengang hinaufführte. Auf der anderen Seite lag unter bläulichen Schatten ein verhexter Garten voller Grabsteine, Kreuze und moosiger Mausoleen.
Der alte Friedhof von Sarriá ist einer der verstecktesten Winkel Barcelonas. Sucht man ihn auf einem Stadtplan, dann findet man ihn nicht. Fragt man Anwohner oder Taxifahrer, wie man hingelangt, dann wissen sie es ziemlich sicher nicht, obwohl alle schon von ihm gehört haben. Und wenn jemand es vielleicht wagt, ihn auf eigene Faust zu suchen, verirrt er sich höchstwahrscheinlich. Die wenigen, die das Geheimnis seiner Lage kennen, vermuten, dass dieser alte Friedhof eigentlich nichts weiter ist als eine Insel aus der Vergangenheit, die nach Lust und Laune auftaucht und wieder verschwindet.
Hierher führte mich Marina an diesem Septembersonntag, um mir ein Geheimnis zu offenbaren, das mich beinahe mit derselben Spannung erfüllte, wie ihre ganze Person es tat. Gemäß ihren Anweisungen setzten wir uns in eine etwas erhöhte verborgene Ecke im nördlichen Teil des Geländes. Ruhig saßen wir da und betrachteten Gräber und verwelkte Blumen. Marina sagte keinen Ton, und nach einigen Minuten wurde ich langsam ungeduldig. Das einzige Geheimnis, das sich mir stellte, war, was zum Teufel wir hier zu suchen hatten.
»Ziemlich tote Hose hier«, meinte ich ironisch.
»Geduld ist die Mutter der Wissenschaft«, entgegnete sie.
»Und die Patin des Wahnsinns. Hier gibt es weniger als nichts.«
Sie warf mir einen Blick zu, den ich nicht deuten konnte.
»Da täuschst du dich. Hier liegen die Erinnerungen Hunderter von Menschen, ihre Leben, Gefühle, Illusionen, ihre Abwesenheit, die Träume, die sie nie verwirklichen konnten, die Enttäuschungen, Irrtümer und unerwiderten Lieben, die ihnen das Leben vergiftet haben. All das ist hier – auf immer festgehalten.«
Ich schaute sie neugierig und ein wenig befangen an, ich wusste nicht genau, wovon sie eigentlich sprach. Für sie war es jedenfalls wichtig.
»Man kann vom Leben nichts verstehen, solange man den Tod nicht versteht«, sagte sie.
Wieder begriff ich nicht recht, was sie meinte.