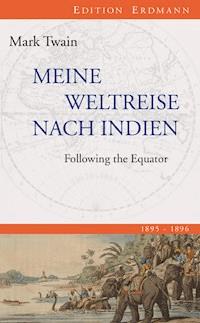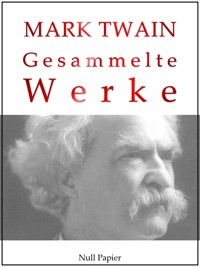
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gesammelte Werke bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Mit Aufsatz zu Leben und Werk Mark Twain ist einer der wichtigsten Schriftsteller der angelsächsischen Literatur. Seine bekanntesten Werke um Tom Sawyer und Huckleberry Finn, die heute noch häufig fälschlicherweise als reine Kinderwerke angesehen werden, wurden von vielen nachfolgenden Schriftstellern - u.a. Hemingway - als wegweisend bezeichnet. Neben seinen Abenteuergeschichten sind auch seine ausführlichen und sehr unterhaltsamen Reiseberichte in Erinnerung geblieben. In ihnen schilderte er lebendig die verschiedensten Regionen des Mittleren Westens der USA, aber auch Europa und andere Teile der Welt finden in seinen Reportagen Erwähnung. Twain war ein innovativer Autor, er war gut organisiert, sehr professionell und verdiente sich ein kleines Vermögen auf ausgedehnten Vorlesungsreisen, über die er dann wieder berichten konnte. Außerdem gilt er immer noch als der erste Autor der Welt, der ein Manuskript auf einer Schreibmaschine verfasste. Hier finden Sie eine nach Romanen, Essays, Reportagen, Reiseberichten und Erzählungen gegliederte Zusammenstellung der bekanntesten und wichtigsten Werke Mark Twains: u.a. Huckleberry Finns Abenteuer und Fahrten, Tom Sawyers Abenteuer und Streiche, Querkopf Wilson, Tom Sawyer als Detektiv, Lebensgeschichte, Auf dem Mississippi, Nach dem fernen Westen, Die Schrecken der deutschen Sprache, Reise um die Welt, Die 1.000.000 Pfundnote. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 3529
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mark Twain
Mark Twain
Gesammelte Werke
Mark Twain
Mark Twain
Gesammelte Werke
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]: Jürgen Schulze 3. Auflage, ISBN 978-3-954184-69-9
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Vorwort des Verlegers
Vorwort zur zweiten Auflage
Mark Twain -- Leben und Werk
Romane
Huckleberry Finns Abenteuer und Fahrten
Der amerikanische Prätendent
Tom Sawyers Abenteuer und Streiche
Querkopf Wilson
Tom Sawyer als Detektiv
Biographisches
Lebensgeschichte Mark Twains
Adams Tagebuch
Aus meiner Knabenzeit
Ritters Geschichte
Der Mann, der bei Gadsby’s abstieg
Die Geschichte des Invaliden
Auf dem Mississippi
Nach dem fernen Westen
Über frühreife Kinder
Redakteur und Berichterstatter
Allgemeine Antwort an Briefsteller
Antworten auf Zuschriften
Essays
Die Schrecken der deutschen Sprache
Ein Zwiegespräch
Eine Geschichte ohne Ende
Zeitungswesen in Tennessee
Der selige Benjamin Franklin
Meine Uhr
Einiges über Barbiere
Wie ein Schnupfen kuriert wird
Es ist gefährlich im Bette zu liegen
Kandidatenfreuden
Trinksprüche
Wohltun trägt Zinsen
Über Tagebücher
Über das Briefschreiben
Gedankentelegraphie
Reiseberichte
Meine Reise um die Welt -- Erste Abteilung
Meine Reise um die Welt -- Zweite Abteilung
Ein Besuch des Niagara
Ein türkisches Bad
Britische Festlichkeiten
Pariser Führer
Der deutsche Portier
Sonntagsheiligung in Deutschland
Eine Beobachtung in Paris
Wagnermusik
Eine Episode in Baden-Baden
Rezept für Schwarzwäldergeschichten
Tischrede bei einem Festessen der Amerikaner in London, zur Feier des vierten Juli
Die Besteigung des Riffelbergs
Ein Tischgespräch
Eine Rigibesteigung
Noch ein Landsmann
Berliner Eindrücke
Eine schlaflose Nacht
Die Hunde von Konstantinopel
Was mir der Professor erzählte
Kinderspiele
Duelle
Die Ameise
Tot oder lebendig
Prinzenverehrung
Reportagen
Ein Miniaturreich im Weltmeer
Michel Angelo
Die alten Meister
Des Kapitäns Bibel-Erklärung
Trauben- und Molkenkur
Ein Landsmann
Peinliche Ohrenmusik
Der große Rindfleisch-Kontrakt
Eduard Jackson und Vanderbilt
Staatswirtschaft
Ein geheimnisvoller Besuch
Brüder, knipst ein!
Ein merkwürdiger Vergnügungs-Ausflug
Erzählungen
Der Roman einer Eskimo-Maid
Mein Reisegefährte, der Reformator
Die Geschichte des Hausierers
Eine wahre Geschichte
Wie Hadleyburg verderbt wurde
Der gestohlene weiße Elefant
Die 1.000.000 Pfundnote
Mehr Glück als Verstand
Kinderkrankheiten
Frau Mc Williams beim Gewitter
Die Liebe des schönen Alonzo Fitz Clarence und der schönen Rosannah Ethelton
Die kapitolinische Venus
Wie der Verfasser in Newark angeführt wurde
Schonend beigebracht
Die Geschichte von einem guten kleinen Knaben
Index
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Gesammelte Werke bei Null Papier
Edgar Allan Poe - Gesammelte Werke
Franz Kafka - Gesammelte Werke
Stefan Zweig - Gesammelte Werke
E. T. A. Hoffmann - Gesammelte Werke
Georg Büchner - Gesammelte Werke
Joseph Roth - Gesammelte Werke
Mark Twain - Gesammelte Werke
Kurt Tucholsky - Gesammelte Werke
Rudyard Kipling - Gesammelte Werke
Rilke - Gesammelte Werke
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Vorwort des Verlegers
Als Ein-Mann-Verleger investiere ich in die Qualität meiner Veröffentlichungen und nicht in Werbung. Wenn Sie mich unterstützen möchten, schaffen Sie es am besten durch eine positive Bewertung. Und wenn es mal etwas zu kritisieren gibt, dann schreiben Sie mir doch bitte direkt, so erhalten Sie am schnellsten eine Reaktion.
Ihr
Jürgen Schulze, redaktion@null-papier.de
Immer bestens informiert:
null-papier.de/newsletter
Vorwort zur zweiten Auflage
Auf Anregung eines Leser, die ich absolut berechtigt finde, habe ich mich dazu entschlossen, die teilweise bis zu 50 Bildschirmseiten langen Inhaltsverzeichnisse meiner Werksammlungen drastisch zu entschlacken. Ich packe einfach Unterverzeichnisse und Indexverzeichnisse dazu, das erleichtert die Navigation erheblich.
Auf der obersten Ebene, dem Hauptinhaltsverzeichnis, erfolgt nur noch eine Aufteilung in Literaturgattungen (Romane, Kurzgeschichten, Lyrik und dergleichen), eine Ebene tiefer gelangt man dann zu der eigentlichen Titelübersicht.
Das alphabetisch geordnete Indexverzeichnis aller Titel - egal welcher Gattung - lässt sich weiterhin bequem und schnell über das Hauptinhaltsverzeichnis aufrufen.
Und für alle Twain-Fans habe ich einen neuen Roman hinzugefügt: »Der amerikanische Prätendent«
*
Mark Twain -- Leben und Werk
Das Leben des großen US-amerikanischen Schriftstellers Mark Twain ist geprägt von Brüchen. Der am 18. November 1835 in Florida geborene Autor kam als sechstes Kind von John Marshall Clemens und seiner Ehefrau Jane Lampton unter dem Namen Samuel Langhorne Clemens zur Welt. Vierjährig zog er mit seiner Familie an den Mississippi in das Städtchen Hannibal, das später eine große in seinem bekanntesten Werk spielen sollte. Familie Clemens gehörte nicht zu den Begüterten. Der Vater war wirtschaftlich nicht erfolgreich, sodass er sogar Jenny, die einzige Sklavin, verkaufen musste. Letztlich zog die Familie bei einem Apotheker ein und sorgte dort anstatt der Mietzahlungen für die Instandhaltung des Hauses. Als der Vater im Jahre 1846 verstarb, verließ Samuel die Schule und begann eine Lehre als Schriftsetzer. Bereits zu dieser Zeit begann er zu schreiben. Seine Geschichte »The Dandy Frightening the Squatter« wurde sogar veröffentlicht.
Reisejournalist, Lotse und Goldgräber
Mit 18 Jahren verließ Samuel Hannibal und reiste fortan als Schriftsetzer durch den Osten und Mittleren Westen der USA. Dabei finanzierte er seinen Lebensunterhalt durch das Schreiben von Reiseberichten für die Zeitung seines Bruders. Einen längeren Aufenthalt in New York nutzte er, um in Bibliotheken seine Allgemeinbildung zu verbessern. Von 1855 bis 1861 arbeitete Clemens als Lotse auf einem Mississippi-Dampfer. Als die Flussschifffahrt durch die Sezessionskriege zum Erliegen kam, kämpfte er für kurze Zeit aufseiten der Konföderierten, bevor er sich auf die Goldfelder von Virginia City absetzte. Da er beim Goldschürfen wenig erfolgreich war, begann er Geschichten zu schreiben, die vor allem den Klatsch zum Inhalt hatten, und die zum späteren Ruf des Wilden Westens maßgeblich beitrugen.
Die Geburtsstunde des »Mark Twain«
Der 3. Februar 1863 ist als Geburtsstunde des Mark Twain nachgewiesen. An diesem Tag unterzeichnete Clemens das erste Mal einen humorvollen Reisebericht mit dem Pseudonym, unter dem er in der ganzen Welt bekannt werden sollte. Der Begriff stammt aus der Seemannssprache und bedeutet »zwei Faden«, eine Angabe, um die Tiefe des Wassers unter dem Kiel zu messen. Mit 35 Jahren heiratete er Olivia Langdon, mit der er vier Kinder hatte, von denen allerdings nur eine Tochter ihn selbst überlebte. Mit seiner Familie lebte er in Connecticut. In Hartford war Harriet Beecher Stowe, Autorin von »Onkel Toms Hütte«, seine Nachbarin, die ihn in seiner Einstellung gegen die Sklaverei sehr bestärkte. 1874 erwarb Twain eine Schreibmaschine, auf der er sein wichtigstes Werk »Life on the Mississippi« schrieb. Er gilt damit als der erste Schriftsteller, der seinem Verlag einen auf der Maschine geschriebenen Roman übergab.
Lesereisen in die ganze Welt
Twain unternahm viele Reisen, sodass er nicht nur die USA, sondern auch andere Länder kennenlernte. Der schriftstellerische Erfolg setzte bald ein und verschaffte ihm den gesellschaftlichen Rang, nachdem er stets gestrebt hatte. Seine Geschichten verkauften sich gut, sodass er sich an einem Verlag beteiligen konnte. 1894 ging der Verlag allerdings in Konkurs und hinterließ Twain einen Berg von Schulden. Um diesen abzutragen, ging er auf Lesereisen in alle Welt. Dabei besuchte er auch die deutschen Städte Heidelberg und Berlin, wo er mehrere Monate lebte. Bekannt ist auch sein spitzzüngiger Aufsatz »Die Schrecken der deutschen Sprache«, in dem er sich mit den Tücken des Deutschen auseinandersetz (»Nach meiner Erfahrung braucht man zum Erlernen des Englischen 30 Stunden, des Französischen 30 Tage, des Deutschen 30 Jahre.«). Neun Monate verbrachte er in Wien und beschrieb dort mit sehr direkten Worten das antisemitisch geprägte Klima Österreichs. Am 21. April 1910 verstarb der große amerikanische Autor in Redding in Connecticut.
Die Verarbeitung der eigenen Kindheit
Kaum ein Schriftsteller seiner Zeit war so umstritten wie Mark Twain. Die einen hielten ihn für einen Klatschreporter, der banale Geschichten erzählte, die anderen schätzten seinen scharfen Blick für die Missstände in der Gesellschaft. Seine bekannteste Werke sind die »Mississippi Writings« zu denen »Tom Sawyer«, »Huckleberry Finn« und »Life on the Mississippi« gehören. Eigene Erfahrungen vom unterprivilegierten Leben am Mississippi bilden die Grundlage. So beruhen die Beschreibungen des Städtchens St. Petersburg, in dem Tom und Huckleberry ihr Unwesen treiben, auf dem Ort Hannibal, dem Wohnort der Familie Clemens. Die Bücher wurden zum Teil sehr entschärft als Leseausgaben für die Jugend in Umlauf gebracht, sodass Twain auch heute noch häufig in erster Linie als Kinderbuchautor gesehen wird. Dabei setzt sich Twain in diesen Büchern mit großem Sarkasmus und überspitzter Feder gegen die Zustände in seiner Heimat ein. Rassismus gegenüber Farbigen, Armut und mangelnde soziale Versorgung sind die Hauptthemen. »The prince and the pauper« (»Der Prinz und der Bettelknabe«) ist ein Beispiel für seine detaillierte Beschreibung des Lebens der unteren sozialen Schichten.
Der sozialkritische Journalist
Durch seine vielen verschiedenen Berufe und die zahlreichen Reisen konnte Mark Twain seinen Werken eine große Authentizität verleihen. Er wusste, wovon er schrieb, wenn er über die Arbeit von Goldgräbern oder rassistischen Auswüchsen gegenüber anderen Menschen wie Farbigen oder Juden berichtete. In seinem Werk zeigt sich häufig die journalistische Seite des Schriftstellers, der Missstände sieht und sie anprangert. Er setzte sich gegen die Herrschaft des Geldes ebenso wie gegen korrupte Senatoren, Übergriffe der Polizei und vor allem gegen religiöse Heuchelei ein. Seine Angriffe gegen finanziellen Reichtum relativierte er später, als er selbst den erhofften Aufstieg in die Gesellschaft geschafft hatte.
Kurzgeschichten und Reisen ins Mittelalter
Zu den lesenswerten Werken Twains gehört eine Reihe von Kurzgeschichten, in denen er sich in sarkastischer Form mit aktuellen und historischen Ereignissen auseinandersetzt. Einige historische Romane - darunter das bekannteste Buch »A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court« - runden das Werk des großen amerikanischen Schriftstellers ab. In diesem Roman erzählt Twain seine fiktiven Erlebnisse als Zeitreisender am Hofe des Königs Artus und mokiert sich dabei über abergläubische Ritter, den betrügerischeren Zauberer Merlin und andere Helden der Artussage. Außerdem sollte nicht vergessen werden, dass die englische Übersetzung des deutschen Kinderbuches »Struwwelpeter« von Mark Twain stammt.
Würdigung Twains
Das wichtigste Spätwerk Twains ist seine Biografie, die er 1898 im österreichischen Kaltenleutgeben verfasste. Anders als mit seinen spitzzüngigen Bemerkungen in früheren Werken zeigt sich der Autor hier von einer anderen Seite. Er setzt sich mit dem vorzeitigen Tod seiner Kinder und seiner Ehefrau auseinander und legt eine Altersweisheit an den Tag, die ihn mit seinem Leben versöhnte. Nach seinem Tode verlieh ihm die Universität Yale einen Ehrendoktortitel. Der große Autor des Zwanzigsten Jahrhunderts, Ernest Hemingway, lobt Twain Roman »Huckleberry Finn« als das Buch, von dem die gesamte amerikanische Literatur abstammt und nach dem es kein besseres gegeben habe. Für T. S. Eliot ist Huckleberry eine bleibende Symbolfigur. Unumstritten ist die literarische Bedeutung Twains, die ihm zu weltweitem Ruhm verhalf.
Romane
Huckleberry Finns Abenteuer und Fahrten
(The Adventures of Huckleberry Finn)
1. Kapitel
Huck soll sievilisiert werden -- Moses in den Schilfern -- Miss Watson -- Tom Sawyer wartet
Da ihr gewiß schon die Abenteuer von Tom Sawyer gelesen habt, so brauche ich mich euch nicht vorzustellen. Jenes Buch hat ein gewisser Mark Twain geschrieben und was drinsteht ist wahr -- wenigstens meistenteils. Hie und da hat er etwas dazugedichtet, aber das tut nichts. Ich kenne niemand, der nicht gelegentlich einmal ein bißchen lügen täte, ausgenommen etwa Tante Polly oder die Witwe Douglas oder Mary. Toms Tante Polly und seine Schwester Mary und die Witwe Douglas kommen alle in dem Buche vom Tom Sawyer vor, das wie gesagt, mit wenigen Ausnahmen eine wahre Geschichte ist. -- Am Ende von dieser Geschichte wird erzählt, wie Tom und ich das Geld fanden, das die Räuber in der Höhle verborgen hatten, wodurch wir nachher sehr reich wurden. Jeder von uns bekam sechstausend Dollars, lauter Gold. Es war ein großartiger Anblick, als wir das Geld auf einem Haufen liegen sahen. Kreisrichter Thatcher bewahrte meinen Teil auf und legte ihn auf Zinsen an, die jeden Tag einen Dollar für mich ausmachen. Ich weiß wahrhaftig nicht, was ich mit dem vielen Geld anfangen soll. Die Witwe Douglas nahm mich als Sohn an und will versuchen, mich zu sievilisieren wie sie sagt. Das schmeckt mir aber schlecht, kann ich euch sagen, das Leben wird mir furchtbar sauer in dem Hause mit der abscheulichen Regelmäßigkeit, wo immer um dieselbe Zeit gegessen und geschlafen werden soll, einen Tag wie den andern. Einmal bin ich auch schon durchgebrannt, bin in meine alten Lumpen gekrochen, und -- hast du nicht gesehen, war ich draußen im Wald und in der Freiheit. Tom Sawyer aber, mein alter Freund Tom, spürte mich wieder auf, versprach, er wolle eine Räuberbande gründen und ich solle Mitglied werden, wenn ich noch einmal zu der Witwe zurückkehre und mich weiter ›sievilisieren‹ lasse. Da tat ich’s denn.
Die Witwe vergoß Tränen, als ich mich wieder einstellte, nannte mich ein armes, verirrtes Schaf und sonst noch allerlei, womit sie aber nichts Schlimmes meinte. Sie steckte mich wieder in die neuen Kleider, in denen es mir immer ganz eng und schwül wird. Überhaupt ging’s nun vorwärts im alten Trab. Wenn die Witwe die Glocke läutete, mußte man zum Essen kommen. Saß man dann glücklich am Tisch, so konnte man nicht flott drauflos an die Arbeit gehen, Gott bewahre, da mußte man abwarten bis die Witwe den Kopf zwischen die Schultern gezogen und ein bißchen was vor sich hingemurmelt hatte. Damit wollte sie aber nichts über die Speisen sagen, o nein, die waren ganz gut soweit, nur mißfiel mir, daß alles besonders gekocht war und nicht Fleisch, Gemüse und Suppe alles durcheinander. Eigentlich mag ich das viel lieber, da kriegt man so einen tüchtigen Mund voll Brühe dabei und die hilft alles glatt hinunterspülen. Na, das ist Geschmacksache!
Nach dem Essen zog sie dann ein Buch heraus und las mir von Moses in den Schilfern vor und ich brannte drauf, alles von dem armen kleinen Kerl zu hören. Da, mit einemmal sagte sie, der sei schon eine ganze Weile tot. Na, da war ich aber böse und wollte nichts weiter wissen -- was gehen mich tote und begrabene Leute an? Die interessieren mich nicht mehr! --
Dann hätt’ ich gern einmal wieder geraucht und fragte die Witwe, ob ich’s dürfe. Da kam ich aber gut an! Sie sagte, das gehöre sich nicht für mich und sei überhaupt »eine gemeine und unsaubere Gewohnheit«, an die ich nicht mehr denken dürfe. So sind nun die Menschen! Sprechen über etwas, das sie gar nicht verstehen! Quält mich die Frau mit dem Moses, der sie weiter gar nichts angeht, der nicht einmal verwandt mit ihr war und mit dem jetzt nichts mehr anzufangen ist, und verbietet mir das Rauchen, das doch gewiß gar nicht so übel ist. Na, und dabei schnupft sie, aber das ist natürlich ganz was andres und kein Fehler, weil sie’s eben selbst tut.
Ihre Schwester, Miss Watson, eine ziemlich dürre, alte Jungfer, die gerade zu ihr gezogen war, machte nun einen Angriff auf mich, mit einem Lesebuch bewaffnet. Eine Stunde lang mußte ich ihr standhalten und dann löste sie die Witwe mit ihrem Moses wieder ab, und ich war nun sozusagen zwischen zwei Feuern. Lange konnte das nicht so weitergehen, und es trat denn auch glücklicherweise bald eine Stunde Pause ein. Nun langweilte ich mich aber schrecklich und wurde ganz unruhig. Alsbald begann Miss Watson: »Halt doch die Füße ruhig, Huckleberry«, oder »willst du keinen solchen Buckel machen, Huckleberry, sitz doch gerade!« und dann wieder »so recke dich doch nicht so, Huckleberry, und gähne nicht, als wolltest du die Welt verschlingen, wirst du denn nie Manieren lernen?«, und so schalt sie weiter bis ich ganz wild wurde. Dann fing sie an, mir von dem Ort zu erzählen, an den die bösen Menschen kommen, worauf ich sagte, ich wünschte mich auch dahin. Da wurde sie böse und zeterte gewaltig, so schlimm hatte ich’s aber gar nicht gemeint, ich wäre nur gern fortgewesen von ihr, irgendwo, der Ort war mir ganz einerlei, ich bin überhaupt nie sehr wählerisch. Sie aber lärmte weiter und sagte, ich sei ein böser Junge, wenn ich so etwas sagen könne, sie würde das nicht um die Welt über die Lippen bringen, ihr Leben solle so sein, daß sie dermaleinst mit Freuden in den Himmel fahre. Der Ort, mit ihr zusammen, schien mir nun gar nicht verlockend, und ich beschloß bei mir, das meinige zu tun, um nicht mit ihr zusammenzutreffen. Sagen tat ich aber nichts, das hätte die Sache nur schlimmer gemacht und doch nichts geholfen.
Sie war aber nun einmal am Himmel, dem Ort der Glückseligen, wie sie’s nannte, angelangt und teilte mir alles mit, was sie drüber wußte. Sie sagte, alles was man dort zu tun habe, sei, den ganzen Tag lang mit einer Harfe herumzumarschieren und dazu zu singen immer und ewig. Das leuchtete mir nun gar nicht ein, ich schwieg aber und fragte nur, ob sie meine, mein Freund Tom Sawyer werde auch dort hinkommen, was sie ziemlich bestimmt verneinte. Mich freute das nicht wenig, denn Tom und ich, wir beide müssen beisammen bleiben.
Miss Watson predigte immer weiter, und mir wurde dabei ganz elend zumute. Dann kamen die Nigger herein, es wurde gebetet, und jedermann ging zu Bett. Ich auch. Ich stieg mit meinem Stummel Kerze in mein Zimmer hinauf und stellte das Licht auf den Tisch. Dann setzte ich mich auf einen Stuhl vors Fenster und probierte, an etwas Lustiges zu denken. Das nützte aber wenig. Ich fühlte mich so allein, daß ich wünschte, ich wäre tot. Die Sterne glitzerten und blitzten, und die Blätter rauschten so schaurig auf den Bäumen. Ich hörte aus der Ferne eine Eule, deren Schrei jemandes Tod bedeutete, und dann einen Hund, dessen klägliches Geheul verkündete, daß einer im Sterben liege, und der Wind schien mir etwas klagen zu wollen, was ich nicht verstand, so daß ich bald am ganzen Leibe zitterte und mir der kalte Schweiß auf die Stirne trat. Die ganze Nacht schien von lauter armen, unglücklichen Geistern belebt, die keine Ruhe in ihren Gräbern fanden und nun da draußen herumheulten, jammerten und zähneklapperten. Mir wurde heiß und kalt, und ich hätte alles drum gegeben, wenn jemand bei mir gewesen wäre. Da kroch mir auch noch eine Spinne über die linke Schulter, ich schnellte sie weg und gerade ins Licht, und ehe ich noch zuspringen konnte, war sie verbrannt. Daß das ein schlimmes Zeichen ist, weiß jedes Kind, und mir schlotterten die Knie, als ich nun begann meine Kleider abzuwerfen. Ich drehte mich dreimal um mich selbst und schlug mich dabei jedesmal an die Brust, nahm dann einen Faden und band mir ein Büschel Haare zusammen, um die bösen Geister fernzuhalten; doch hatte ich kein großes Vertrauen zu diesen Mitteln. Sie nützen wohl, wenn man ein gefundenes Hufeisen wieder verliert, anstatt es über der Türe anzunageln, oder bei dergleichen kleineren Fällen; wenn man aber eine Spinne getötet hat, da weiß ich nicht, was man tun kann, um das Unglück fernzuhalten. So setzte ich mich zitternd auf den Bettrand und zündete mir zur Beruhigung mein Pfeifchen an. Das Haus war so still und die Witwe nicht in meiner Nähe. So saß ich lange, lange. Da schlug die Uhr von der Ferne -- bum -- bum -- bum -- bum, zwölfmal, und wieder war alles still, stiller als vorher. Plötzlich höre ich etwas unten im Garten unter den Bäumen, ein Rascheln und Knacken, ich halte den Atem an und lausche. Wieder hör’ ich’s, und dabei, leise wie ein Hauch, das schwächste ›Miau‹ einer Katze. »Miau, miau« tönt’s kläglich und langgezogen. Und »miau, miau« antworte ich ebenso kläglich, ebenso leise, schlüpfe rasch in meine Kleider, lösche das Licht aus und steige durch das Fenster auf das Schuppendach. Dann lasse ich mich zu Boden gleiten, krieche auf allen vieren nach den Schatten der Bäume, und da war richtig und leibhaftig Tom Sawyer, mein alter Tom, und wartete auf mich.
2. Kapitel
Die Jungen entwischen Jim! --Tom Sawyers Räuberbande -- Finstre Pläne!
Wir schlichen auf den Fußspitzen den kleinen Pfad hinab, der unter den Bäumen hin zur Rückseite des Gartens führt, wobei wir den Kopf ständig bücken mußten, um nicht von den Zweigen getroffen zu werden. Gerade als wir an der Küchentür vorüber wollen, muß ich natürlich über eine Wurzel stolpern und hinfallen, wodurch ein kleines Geräusch entstand. Jetzt hieß es still liegen und den Atem anhalten! Miss Watsons Nigger Jim saß an der Tür; wir konnten ihn ganz gut sehen, weil das Licht gerade hinter ihm stand. Er steht auf, streckt den Kopf heraus, horcht eine Minute lang und sagt dann: »Wer’s da?«
Dann horcht er wieder, und -- jetzt schleicht er sich auf den Zehenspitzen heraus und steht gerade zwischen uns, ich hätte ihn zwicken können, wenn ich gewollt hätte. Er steht, und wir liegen still wie die Mäuse, und so vergehen Minuten auf Minuten. An meinem Fuß fängt’s an mich zu jucken, und ich kann mich nicht kratzen. Jetzt juckt’s am Ohr, dann am Rücken, gerade zwischen den Schultern, es ist zum Tollwerden! Warum’s einen nur immer juckt, wenn man nicht kratzen kann oder darf! Darüber hab’ ich oft nachgedacht seitdem. Entweder wenn man bei feinen Leuten ist, oder bei einem Begräbnis, oder wenn einen der Lehrer was fragt, oder in der Kirche, oder wenn man im Bett liegt und will schlafen und kann nicht, kurz, wenn man irgendwo ist, wo man nicht kratzen kann und darf, da juckt’s einen gerade erst recht an hundert verschiedenen Stellen.
Endlich sagt Jim: »He da, wer ’s da? Ich mich lassen tothauen, ich haben was gehört! Aber Jim sein nicht so dumm! Jim sitzen hier hin und warten!«
Und damit pflanzt er sich gerade zwischen mich und Tom auf den Boden, lehnt den Rücken an einen Baum und streckt die Beine aus, daß das eine mich beinahe berührt. Jetzt beginnt mein Juck-Elend von neuem. Erst die Nase, bis mir die Tränen in den Augen stehen, ich wage nicht zu kratzen, dann allmählich jeder Körperteil, bis ich nicht weiß, wie ich stillhalten soll. Fünf, sechs Minuten geht das Elend so weiter, mir scheinen’s Stunden. Ich zähle schon elf verschiedene Orte, an denen ’s mich juckt. Gerade als ich denke, nun kannst du’s aber nicht mehr aushalten, höre ich Jim tief aufatmen, dann schnarchen und -- ich bin gerettet.
Tom gab mir jetzt ein Zeichen, er schnalzte leise mit den Lippen, und wir krochen auf allen vieren davon. Vielleicht zehn Fuß weit entfernt hielt Tom an und flüsterte mir zu, er wolle Jim zum Spaß am Baum festbinden. Ich sagte nein, ich wolle nicht, daß er aufwache, Lärm schlüge und man dann entdecken würde, daß ich nicht im Bett sei. Dann sagte Tom, er habe nicht genug Lichter und wolle sich deshalb in der Küche ein paar mitnehmen. Das wollte ich aus Angst vor Jim auch nicht erlauben, aber Tom bestand darauf, und so schlichen wir uns in die Küche, fanden die Lichter, und Tom legte fünf Cents zur Bezahlung auf den Tisch. Ich schwitzte nun förmlich vor Angst, fortzukommen, Tom aber ließ sich nicht halten und kroch zu Jim zurück, um ihm einen Streich zu spielen. Ich wartete, und die Zeit wurde mir sehr lang; alles war so still und unheimlich um mich herum.
Endlich kam Tom, und nun rannten wir eilig den Pfad hinunter und kletterten den steilen Hügel hinter dem Haus hinauf. Tom erzählte, daß er Jim mit einem Strick an den Baum gebunden und seinen Hut oben an einen Ast gehängt habe, der Kerl habe aber immer weitergeschlafen und sich nicht gerührt. Später behauptete Jim, die Hexen hätten ihn verzaubert und seien auf ihm über den ganzen Staat geritten. Dann hätten sie ihn wieder unter dem Baum niedergelassen und zum Zeichen, wer es getan, seinen Hut auf den Ast gehängt. Als Jim seine Geschichte das nächste Mal erzählte, waren die Hexen bis New Orleans auf ihm geritten, und jedesmal, sooft er es wieder erzählte, war der Ausflug weiter gewesen, bis er schließlich behauptete, daß der Ritt um die ganze Erde gegangen und sein Rücken ganz zerschunden worden sei. Jim war riesig stolz darauf und sah auf die anderen Nigger nur noch vornehm herab. Aus meilenweiter Ferne kamen Nigger herbei, um Jims Geschichte zu hören. Es gab keinen angeseheneren Neger in der Gegend, und die fremden Gäste glotzten ihn mit offenem Munde an wie ein Meerwunder. Die Nigger unterhalten sich gern im Dunkeln beim Herdfeuer über Hexen, sooft aber einer darüber seine Weisheit auskramte und Jim dazukam, dann rief er: »Ach, was wißt ihr von Hexen«, worauf jener Nigger beschämt in den Hintergrund schlich. Jim trug jenes Fünf-Cent Stück stets an einer Schnur um den Hals und behauptete, es sei ein Zaubermittel, das ihm der Teufel eigenhändig gegeben habe mit der Bemerkung, er könne damit jedermann heilen und Hexen herbeizaubern, soviel er wolle, wenn er einen gewissen Spruch dabei hersage. Auch das trug nicht wenig zur Erhöhung der Berühmtheit Jims bei.
Als Tom und ich oben auf dem Hügel ankamen, konnten wir gerade ins Dorf hinuntersehen, und da blinkten noch drei oder vier Lichter, wahrscheinlich bei Kranken. Über uns blitzten die Sterne, und drunten zog der Mississippi dahin, so breit und ohne Laut, es war großartig. Wir rannten dann auf der andern Seite den Hügel hinunter und fanden Joe Harper und Ben Rogers und noch ein paar Jungens, die auf uns warteten. Ein Boot wurde losgemacht, und wir ruderten den Fluß hinunter, bis dahin, wo der große Einschnitt im Ufer ist. Dort legten wir an.
Wir kletterten auf ein dichtes Buschwerk zu, und nun ließ Tom uns alle schwören, das Geheimnis nicht zu verraten, und zeigte uns ein Loch im Hügel. Wir steckten die Lichter an und krochen auf Händen und Knien hinein. So ging es ungefähr zweihundert Meter in einem engen Gange fort, bis sich die Höhle auftat. Tom tastete an den Wänden der Höhle umher und verschwand auf einmal unter einem Felsen, wo niemand eine Öffnung vermutet hatte. Wir folgten ihm durch einen schmalen Gang, bis wir in einen Raum gelangten, ungefähr wie ein Zimmer, nur etwas kalt, feucht und dumpfig, und da blieben wir dann.
Tom hielt nun eine feierliche Ansprache und sagte: »Hier wollen wir also eine Räuberbande gründen und sie Tom Sawyers Bande nennen. Jedermann, der beitreten will, muß einen Eid schwören und seinen Namen mit Blut unterschreiben!«
Alle waren dazu bereit, und so zog Tom einen Bogen Papier aus der Tasche, auf den er einen furchtbaren Eid geschrieben hatte, den er uns jetzt vorlas. Darin stand, daß jeder Junge treu zur Bande halten müsse und niemals deren Geheimnisse verraten dürfe bei Todesstrafe. Wenn irgend jemand irgendeinem von uns irgend etwas zuleid täte, müsse einer das Racheamt übernehmen, den man dazu erwähle, und er dürfe nicht essen und nicht schlafen, ehe er den Beleidiger und seine ganze Familie getötet und allen ein blutiges Kreuz in die Brust geritzt habe, was das Zeichen der Bande sein solle. Und niemand außer uns dürfe dies Zeichen benutzen, und wenn er es doch täte, solle er gerichtlich belangt, und wenn dies nichts helfe, einfach getötet werden. Wenn aber einer aus der Bande die Geheimnisse verrate, werde ihm der Hals abgeschnitten, der Körper verbrannt und die Asche in alle vier Winde zerstreut, sein Name dann dick mit Blut von der Liste gestrichen, ihn auszusprechen bei Strafe verboten und er selbst solle vergessen sein für immer und ewig. Wir alle fanden den Eidschwur prächtig und fragten Tom, ob er ihn ganz allein aus seinem eignen Kopf gemacht habe. Er sagte ja, zum größten Teil, einiges habe er auch in alten Piraten- und Räuberbüchern gefunden; jede ordentliche Bande schwöre einen solchen Eid.
Jetzt meinte einer, man solle doch auch die Familie töten von den Jungens, die das Geheimnis verrieten. Tom sagte, das sei eine gute Idee, nahm einen Bleistift und korrigierte es noch hinein in den Eidschwurbogen.
Da meinte Ben Rogers: »Ja, aber, hört einmal, wie ist denn das? Der da« -- dabei zeigte er auf mich -- »hat doch gar keine Familie nicht, wen sollen wir denn da töten?«
»Er hat doch auch einen Vater«, sagte Tom Sawyer.
»Den hat er wohl, aber wo ihn finden? Früher lag er manchmal betrunken in der Straße, aber seit einem Jahr hat ihn niemand hier herum gesehen!«
Nun berieten sie hin und her und hätten mich beinahe ausgestoßen, denn jeder, so sagten sie, müsse jemanden zum Töten haben, was dem einen recht, sei dem andern billig, und so saßen sie und überlegten, und ich heulte beinahe, so schämte ich mich. Da fiel mir plötzlich Miss Watson ein, und ich bot ihnen die zum Töten an, das leuchtete ihnen ein und alle riefen: »Das geht, die ist recht dazu, Huck kann eintreten!«
Dann nahmen wir Stecknadeln, stachen uns in die Finger und unterzeichneten unsern Namen mit unsrem Herzblut, wie Tom sagte.
»Nun«, meinte jetzt Ben Rogers, »auf was soll unsere Bande sich hauptsächlich verlegen?«
»Auf weiter nichts«, versetzte Tom, »als Raub und Mord und Totschlag!«
»Wen sollen wir denn berauben? Häuser -- oder Vieh -- oder --«
»Unsinn!« schrie Tom, »das nennt man diebsen und stehlen, nicht rauben und plündern! Wir wollen keine Diebe sein, sondern Räuber! Das ist viel vornehmer! Räuber und Wegelagerer! Wir überfallen die Postkutschen und Wagen auf der Landstraße, mit Masken vor dem Gesicht, und schlagen die Leute tot und nehmen ihnen Uhren und Geld ab!«
»Müssen wir immer alle tothauen?« »Gewiß, das ist am einfachsten. Ich hab’s auch schon anders gelesen, aber gewöhnlich machen sie’s so. Nur einige schleppt man hie und da in die Höhle und wartet, bis sie ranzioniert1 werden!«
»Ranzioniert? Was ist denn das?«
»Das weiß ich selber nicht, aber so hab’ ich’s gelesen, und so müssen wir’s machen!«
»Ho, ho, das können wir ja nicht, wenn wir nicht wissen, was es ist!«
»Ei zum Henker, wir müssen’s eben! Hab’ ich dir nicht gesagt, daß ich’s gelesen habe? Willst du’s anders machen, als es in den Büchern steht, und alles untereinanderbringen?«
»Oh, du hast gut reden, Tom Sawyer, aber wie in der Welt sollten wir die Burschen ranzionieren, wenn wir nicht wissen, wie man’s macht? Das möcht’ ich wissen! Wie zum Beispiel, denkst du dir’s eigentlich?«
»Ich -- ich weiß nicht, aber ich denke, wenn wir sie behalten, bis sie ranzioniert sind, so wird das heißen, bis sie tot sind!«
»Das läßt sich hören, das begreife ich, aber warum hast du das nicht gleich gesagt? Natürlich behalten wir sie, bis sie zu Tode ranzioniert sind. Sie werden uns aber genug zu schaffen machen, uns alles wegfressen und dabei immer auskneifen wollen!«
»Wie du schwatzest, Ben! Wie können sie auskneifen, wenn einer immer Wache steht, der bereit ist, sie niederzuschießen, wenn einer nur den Finger krumm macht?«
»Einer, der Wache steht? Das ist gut! Das freut mich! Also soll einer die ganze Nacht dastehen, ohne zu schlafen, und sie bewachen! Das ist eine gräßliche Dummheit. Warum nimmt man da nicht sofort einen Knüttel und ranzioniert sie, sobald sie hierherkommen?«
»Weil’s so nicht in den Büchern steht, darum! Ich frag’ dich, Ben Rogers, willst du alles den Regeln nach tun oder nicht? Darauf kommt’s an! Ich glaube, die Leute, die die Bücher schreiben, wissen besser, wie man’s macht, als du! Denkst du, sie könnten von dir etwas lernen? Noch lange nicht! Und drum wollen wir die Burschen genauso ranzionieren, wie’s da angegeben ist, und nicht ein bißchen anders!«
»Schon recht, mir liegt nichts dran, ich sage aber, es ist gräßlich dumm so. Sollen wir die Weiber auch töten?«
»Ben Rogers, wenn ich so dumm wäre wie du, hielt ich lieber den Mund! Die Weiber töten! Wer hat je so etwas gehört oder gelesen! Nein, die werden in die Höhle geschleppt, und man ist so höflich und rücksichtsvoll zu ihnen wie man kann. Nach einer Weile verlieben sie sich dann in einen und wollen gar nicht wieder fort.«
»Gut, damit bin ich einverstanden! Ich für mein Teil aber danke. Bald werden wir die ganze Höhle voll Weiber haben und voll Kerle, die auf’s Ranzionieren warten, so daß am Ende kein Platz mehr für die Räuber da sein wird. Ich seh’s schon kommen! Aber mach nur weiter, Tom, ich bin schon still!«
Der kleine Tommy Barnes war inzwischen eingeschlafen, und als sie ihn weckten, fürchtete er sich und weinte und wollte zu seiner Mama und gar kein Räuber mehr sein.
Da neckten sie ihn alle und hießen ihn Mamakind; das machte ihn ganz wild, und er schrie, nun wolle er auch alles sagen und alle Geheimnisse verraten. Da gab ihm Tom fünf Cents, um ihn stille zu machen, und sagte, nun gingen wir alle nach Hause und kämen nächste Woche wieder zusammen und dann wollten wir ein paar Leute berauben und töten.
Ben Rogers sagte, er könne nicht viel loskommen, nur an Sonntagen, und wollte deshalb gleich nächsten Sonntag anfangen. Aber die anderen Jungens meinten, am Sonntag schicke sich so etwas gar nicht, und so ließen wir’s sein. Sie machten aus, so bald wie möglich wieder zusammenzukommen und dann einen Tag zu bestimmen. Hierauf wählten wir noch Tom Sawyer zum Hauptmann und Joe Harper zum Unterhauptmann der Bande und brachen dann nach Hause auf.
Ich kletterte wieder auf’s Schuppendach und von da in meine Kammer, gerade als es anfing Tag zu werden. Meine neuen Kleider waren furchtbar schmutzig und voller Lehm, und ich war hundemüde.
Durch Lösegeld befreit, losgekauft <<<
3. Kapitel
Eine ordentliche Strafpredigt -- Die Gnade triumphiert -- Die Räuber Die Geister -- ›Eine von Toms Lügen!‹
Das setzte am andern Morgen eine ordentliche Strafpredigt für mich von Miss Watson über meine schmutzigen Kleider! Die Witwe aber, die zankte gar nicht, sondern putzte nur den Schmutz und Lehm weg und sah so traurig dabei aus, daß ich dachte, ich wolle eine Weile brav sein, wenn ich’s fertigbrächte. Dann nahm mich Miss Watson mit in ihr Zimmer und betete für mich, aber ich spürte nichts davon. Sie sagte mir, ich solle jeden Tag ordentlich beten, und um was ich bete, das bekäme ich. Das glaub ein anderer! Ich nicht. Ich hab’s probiert, aber was kam dabei heraus! Einmal kriegte ich wohl eine Angelrute, aber keine Haken dazu, und ich betete und betete drei- oder viermal, aber die Haken kamen nicht. Da bat ich Miss Watson, es für mich zu tun, die wurde aber böse und schimpfte mich einen Narren. Warum weiß ich nicht, sie sagte es mir nicht, und ich selbst konnt’s nicht herausfinden.
Ich hab’ dann lange im Wald gesessen und darüber nachgedacht. Sag’ ich zu mir selber: Wenn einer alles bekommen kann, um was er betet, warum bekommt dann der Nachbar Winn sein Geld nicht zurück, das er an seinen Schweinen verloren hat? Und die Witwe ihre silberne Schnupftabaksdose, die ihr gestohlen wurde? Und warum wird die dürre Miss Watson nicht dick? Nein, sag’ ich zu mir, da ist nichts dran, das ist Dunst. Und ich ging zur Witwe und sagte ihr’s, und die belehrte mich, man könne nur um geistliche Gaben beten! Da das viel zu hoch für mich war, so suchte sie mir’s deutlich zu machen: Ich müsse brav und gut sein und den andern helfen, wo ich könne, und nicht an mich, sondern immer nur an die andern denken. Damit war auch Miss Watson gemeint, wie mir’s schien. Ich ging hinaus in den Wald und überlegte mir die Sache noch einmal. Aber, meiner Seel’, dabei kommt nur was für die andern heraus und gar nichts für mich, und so ließ ich denn das Denken sein und quälte mich nicht länger damit. Zuweilen nahm mich die Witwe vor und erzählte mir von der gütigen, milden Vorsehung, die’s so gut mit dem Menschen meine und wie sie sich meiner in Gnaden erbarmen wolle, bis mir der Mund wässerte und die Augen naß wurden. Nachher kam wieder Miss Watson und ließ ihre Vorsehung donnern und blitzen, daß ich mich ordentlich duckte und den Kopf einzog. Es muß zwei Vorsehungen geben, dachte ich mir, und ein armer Kerl wie ich hat’s sicher bei der Witwe ihrer besser, denn bei Miss Watson’s ihrer ist er verloren. So dachte und dachte ich und nahm mir vor, zu der Witwe ihrer Vorsehung zu beten, wenn die sich überhaupt aus so einem armen, unwissenden und elenden Kerl, wie ich einer bin, etwas macht und sich nicht viel wohler befindet ohne mich.
Mein Alter war nun schon seit einem Jahre nicht mehr gesehen worden, was für mich nur eine Wohltat war; ich hatte wahrhaftig kein Heimweh nach ihm. Gewöhnlich walkte er mich durch, wenn er nüchtern war und mich erwischen konnte; ich versteckte mich deshalb meistens im Wald, sobald er wieder auftauchte. Eines Tages sagten die Leute, man habe meinen Vater im Flusse, etwas oberhalb der Stadt, ertrunken gefunden. Sie meinten wenigstens, er müsse es sein. Sie sagten, der Ertrunkene sei gerade so groß, so zerlumpt gewesen und habe so ungewöhnlich langes Haar gehabt, genau wie mein Alter, das Gesicht war nicht zu erkennen gewesen, es hatte zu lange im Wasser gelegen. Sie verscharrten ihn am Ufer, aber ich war nicht ruhig, glaubte nicht an den Tod des alten Mannes und dachte, der würde schon mal wieder irgendwo auftauchen, um mich zu quälen und zu hauen.
Wir spielten hie und da einmal Räuber, vielleicht einen Monat lang, und dann verzichtete ich auf das Vergnügen -- die anderen auch. Wir hatten keinen einzigen Menschen beraubt, keinen getötet, sondern immer nur so getan. Wir sprangen aus dem Wald, und jagten Sautreibern nach oder hinter Frauen her, die Gemüse in Karren zum Markte führten, nahmen aber nie irgend etwas oder irgend jemand in unsre Höhle mit. Tom Sawyer nannte das Zeug, das auf den Karren lag, Goldbarren und Edelsteine und ’s waren doch nur Rüben und Kartoffeln, und wir gingen dann zur Höhle zurück und nahmen den Mund voll und prahlten, was wir alles getan hätten, wieviel Kostbarkeiten geraubt und Leute getötet und Kreuze in die Brust geritzt. Aber allmählich fing die Sache an langweilig zu werden.
Eines Tages sandte Tom einen Jungen mit einem brennenden Kienspan, einem Feuerbrand, wie er es nannte, durch die Straßen der Stadt, das war das Zeichen für die Bande, sich zu versammeln. Als wir alle beieinander waren, teilte er uns mit, er habe gehört, daß anderntags ein ganzer Haufen spanischer Kaufleute und reicher Ah-raber, wie er sagte, samt zweihundert Elefanten und sechshundert Kamelen und über tausend Saumtieren -- was das für Tiere waren, wußte er selber nicht --, alle schwer mit Diamanten beladen im Höhlen-Grunde lagern wollten. Da nur eine kleine Bewachung von vielleicht vierhundert Soldaten dabei sei, sollten wir uns in Hinterhalt legen, die Mannschaft töten und die Diamanten rauben. Er gebot uns unsere Schwerter zu wetzen, die Flinten zu laden und uns bereitzuhalten. Er konnte niemals auch nur hinter einem alten Rübenkarren hersetzen, ohne daß die Schwerter und Flinten, die doch nur Holzlatten und Besenstiele waren, mit dabei sein mußten. Ich für meinen Teil glaubte nun nicht, daß wir es mit einem solchen Haufen Spanier und Ah-raber aufnehmen könnten, hatte aber große Lust, die Kamele und Elefanten zu sehen. Ich stellte mich also am Sonnabend zur bestimmten Stunde ein und legte mich mit in Hinterhalt. Tom kommandierte und wir brachen los, stürmten aus dem Wald und rannten den Hügel hinunter. Mit den Spaniern, den Ah-rabern, Kamelen, Elefanten aber war’s Essig. Nur eine Sonntags-Schulklasse hatte einen Ausflug gemacht und sich im Gras gelagert und noch dazu nichts als die allerkleinsten Mädchen. Wir jagten sie auf und rannten hinter den Kindern her, eroberten aber nur etwas Eingemachtes und ein paar Stückchen Kuchen, Ben griff nach einer Puppe und Joe nach einem Gesangbuch, aber als die Lehrerin kam, warfen wir die Sachen weg und rannten davon. Diamanten hatte ich ebensowenig gesehen und sagte das Tom auch. Es seien doch massenhaft dagewesen, erwiderte er, desgleichen Ah-raber und Kamele und alles. Warum haben wir’s dann aber nicht gesehen? fragte ich. Er sagte, wenn ich kein solcher Dummkopf wäre und ein Buch gelesen hätte, das Domkuischote oder ähnlich hieß, so wüßte ich warum, ohne ihn zu fragen. Er sagte, es sei alles nur Zauberei gewesen. Es wären Hunderte von Soldaten und Elefanten und Schätze dort gewesen, aber wir hätten mächtige Feinde, Zauberer, die uns zum Trotz alles in eine Kleinkinder-Sonntagsschule verwandelt hätten. Darauf meinte ich, das sei alles ganz schön, dann wollten wir einmal ordentlich gegen die Zauberer losgehen. Tom Sawyer sagte, ich sei ein Esel.
»So ein Zauberer«, sagte er, »würde ein ganzes Heer von Geistern zur Hilfe rufen, und die würden dich in Stücke hauen, ehe du Amen sagen könntest. Die sind so groß wie Bäume und so dick wie Kirchtürme.«
»Gut«, sagte ich, »laß uns doch ein paar Geister nehmen, die uns helfen, dann wollen wir die andern schon zwingen.«
»Wie willst du sie denn bekommen?«
»Das weiß ich nicht. Wie kriegen die sie denn?«
»Die? Oh, ganz einfach. Die reiben eine alte Blechlampe oder einen eisernen Ring, und dann kommen die Geister angesaust mit Donner und Blitz und Rauch, und was man ihnen befiehlt, das tun sie. Es ist ihnen eine Kleinigkeit, einen Kirchturm aus der Erde zu reißen und ihn dem nächsten besten um den Kopf zu hauen.«
»Wer befiehlt ihnen denn?«
»Nun, der Zauberer, der die Lampe oder den Ring reibt, und sie müssen tun, was er sagt. Wenn er ihnen sagt, sie sollen einen Palast bauen, vierzig Meilen lang und ganz aus Diamanten und ihn mit Brustzucker oder Hustenleder oder irgend etwas füllen und dann die Tochter vom Kaiser von China holen zum Heiraten und -- Gott weiß was noch -- sie müssen alles tun. Und wenn man den Palast woanders hingestellt haben will, müssen sie ihn rings im Lande herumschleppen, bis er an der rechten Stelle ist und ...«
»Aber«, sag’ ich, »warum sind sie denn solche Esel und behalten den Palast nicht für sich selber, anstatt damit herum zukutschieren für andre. Wegen mir könnte, wer wollte, eine alte Blechlampe oder einen eisernen Ring reiben, bis er schwarz würde, mir fiel’s gar nicht ein, deswegen zu ihm zu laufen und mir befehlen zu lassen.«
»Wie du jetzt wieder redest, Huck Finn, du müßtest eben kommen, wenn du ein Geist wärst und einer riebe den Ring, ob du wolltest oder nicht.«
»Was? Und dabei war’ ich so groß wie ein Baum und so dick wie ein Turm? Gut, ich käme, aber der riefe mich nicht zum zweitenmal, das kannst du mir glauben.«
»Pah, mit dir ist nicht zu reden, Huck Finn, du weißt und verstehst nicht -- du bist der vollkommenste Hohlkopf!«
Zwei oder drei Tage lang überlegte ich mir nun die Sache, und dann beschloß ich zu probieren, ob wirklich etwas dran sei. Ich verschaffte mir eine alte Blechlampe und einen eisernen Ring, ging hinaus in den Wald und rieb und rieb bis ich schwitzte wie ein Dampfkessel -- ich hätte so gerne einen Palast zum Verkaufen gehabt. Aber es war alles umsonst, es kam kein Donner und kein Blitz und kein Dampf und kein Rauch und am allerwenigsten ein Geist. Da begriff ich denn, daß all’ der Unsinn wieder einmal eine von Toms Lügen gewesen war. Er glaubt vielleicht an die Ah-raber und die Elefanten, ich aber denke anders -- es schmeckte alles zu sehr nach der Sonntagsschule.
4. Kapitel
»Langsam aber sicher« -- Huck und der Kreisrichter -- Aberglaube
So vergingen drei oder vier Monate, und wir waren nun mitten im Winter drin. Ich ging fleißig zur Schule, konnte buchstabieren, lesen, schreiben, das Einmaleins hersagen bis zu sechs mal sieben ist fünfunddreißig,1 weiter kam ich nicht und wäre auch wohl nie weiter gekommen, und wenn ich hundert Jahre dran gelernt hätte -- ich habe einmal kein Talent zur Mathe-maatik.
Erst verabscheute ich die Schule, dann gewöhnte ich mich allmählich dran. Strengte sie mich einmal übermäßig an, so schwänzte ich einen Tag, und die Prügel, die ich dafür anderntags bekam, taten mir gut und frischten mich auf. Je länger ich hinging, desto leichter wurde mir’s. Auch an der Witwe ihre Art gewöhnte ich mich nach und nach und ärgerte mich nicht mehr über alles. Nur das Wohnen in einem Hause und Schlafen im Bett wollte mir noch immer nicht hinunter, und eh’ das kalte Wetter kam, rannte ich manchmal des Nachts in den Wald und ruhte dort einmal gründlich aus. Ich liebte mein altes, freies Leben viel -- viel mehr als das neue, aber ich fing doch an, auch das ein klein wenig gern zu haben. Die Witwe und ich, wir kamen uns langsam aber sicher näher und waren ganz zufrieden miteinander. Sie sagte auch, sie schäme sich meiner gar nicht mehr.
Eines Morgens stieß ich beim Frühstück das Salzfaß um und wollte eben ein paar Körnchen von dem verschütteten Salz nehmen, um es über die linke Schulter zu werfen, damit es mir kein Unglück bringe, da kam mir Miss Watson zuvor: »Die Hand weg, Huckleberry«, zeterte sie, »du mußt auch immer Dummheiten machen!« Die Witwe wollte ein gutes Wort für mich einlegen, aber das konnte das Unglück nicht abhalten, das wußte ich nur zu gewiß. Als ich vom Tisch aufstand und mich drückte, war mir’s ganz unbehaglich und beklommen zumute. Ich mußte immer daran denken, wo mir wohl etwas Schlimmes zustoßen und was es sein werde. Ich weiß noch andre Mittel, um Unglück fernzuhalten, aber die ließen sich hier nicht anwenden und so hielt ich still und tat gar nichts, schlängelte mich, nur niedergeschlagen meines Weges weiter, immer auf der Hut vor irgend etwas Unbekanntem. Ich ging den Garten hinunter und kletterte über den hohen Bretterzaun. Es war in der Nacht frischer Schnee gefallen, und ich sah Fußspuren darin. Sie führten direkt vom Steinbruch hierher und rings um den Gartenzaun. Im Garten selbst sah ich nichts, und das machte mich stutzig. Was hatte einer da draußen herumzulungern? Ich wollte den Spuren nachgehen, bückte mich aber erst noch einmal, um sie zu untersuchen. Zuerst fiel mir nichts dran auf, dann aber, Herr, du mein Gott, da sah ich etwas, das mir bekannt war, und ich wußte sofort, was die Uhr geschlagen hatte. Am linken Absatz der Fußspur befand sich ein mir nur allzu bekanntes Kreuz aus dicken Nägeln, um den Bösen fernzuhalten.
In einer Sekunde war ich auf und davon und den Hügel hinunter. Von Zeit zu Zeit sah ich ahnungsvoll über die Schulter zurück, konnte aber niemand entdecken. Wie der Blitz rannte ich zum Kreisrichter, der mich mit den Worten empfing: »Junge, du bist ja ganz außer Atem. Kommst du wegen deiner Zinsen?«
»Nein«, sag’ ich, »hab’ ich denn wieder was zu bekommen?«
»O ja, gestern abend sind die vom letzten halben Jahr eingelaufen. Über hundertundfünfzig Dollar; ein ganzes Vermögen für dich, mein Junge. Ich lege dir die Zinsen aber wohl besser mit dem Kapital an, denn wenn du sie hast, gibst du sie auch aus.«
»O nein«, sag’ ich, »ich will sie gar nicht haben, die Zinsen nicht und auch die sechstausend nicht, Sie sollen’s behalten, Herr, ich will’s Ihnen geben, alles, alles!«
Er sah mich erstaunt an und schien mich nicht zu verstehen. Dann sagte er: »Wie -- wie meinst du das, Junge?«
Sag’ ich: »Fragen Sie mich, bitte, nichts weiter, Herr, aber nehmen Sie’s, bitte, nehmen Sie’s!«
Darauf er: »Junge, ich versteh’ dich nicht, was ist denn mit dir?«
Darauf ich: »Bitte, bitte nehmen Sie’s und fragen Sie mich nicht weiter -- dann muß ich Ihnen auch nichts vorschwindeln!«
Er dachte eine Weile nach, dann sagte er: »Holla, ich glaub’, ich hab’s. Du willst mir deine Ansprüche abtreten, verkaufen, nicht schenken. Das liegt dir im Sinn, nicht wahr?«
Und ohne weiteres schreibt er ein paar Zeilen auf ein Stück Papier, liest’s noch einmal durch und sagt dann: »Da -- sieh’ her. Es ist ein Vertrag, und es steht drin, daß ich dir deine Ansprüche abgekauft habe. Da hast du einen Dollar. Nun unterschreibe!«
Ich unterschrieb und trollte mich.
Miss Watsons Nigger Jim hatte eine haarige Kugel, so groß wie eine Faust, die einmal aus dem vierten Magen eines Ochsen herausgenommen worden war. Mit der konnte er wahrsagen, da sich ein Geist darin befand, der alles wußte. Ich ging also zu Jim am Abend und sagte ihm, mein Alter sei wieder im Land, ich habe seine Fußspuren im Schnee gefunden. Was ich wissen wollte, war, was der Alte im Schilde führte und wie lang er bleiben werde. Jim nahm seine haarige Kugel, brummte etwas drüber hin, hob sie in die Höhe und warf sie dann zu Boden. Sie fiel derb auf und rollte kaum einen Zoll weit von der Stelle. Noch einmal probierte es Jim und noch einmal und immer blieb es gleich. Jetzt kniete Jim nieder und legte sein Ohr an die Kugel und horchte, aber ’s wollte nichts sagen. Er sagte, manchmal redet es nicht ohne Geld. Ich bot ihm nun eine alte, nachgemachte Münze an, bei der überall das Messing durchsah, und die sich so fett und schlüpfrig anfühlte, daß sie mir niemand für echt abgenommen hätte. Von meinem Dollar schwieg ich natürlich, denn für die alte Kugel war wahrhaftig die schlechte Münze gut genug. Jim nahm die Münze, roch daran, rieb sie, biß hinein und versprach es einzurichten, daß die Haarkugel die Unechtheit nicht merke. Er sagte, er wolle eine rohe Kartoffel nehmen und die Münze hineinstecken und die Nacht über drin lassen, am andern Morgen sehe man dann kein Messing und fühle keine Fettigkeit und kein Mensch werde den Betrug merken, noch weniger eine Haarkugel. Das Ding mit der Kartoffel wußt’ ich, hatt’s nur vergessen im Moment.
Jim steckte also nun die Münze unter die Kugel und legte wieder das Ohr dran. Jetzt sei alles in Ordnung, sagte er, und die Kugel werde mir wahrsagen, soviel ich wolle. »Nur zu!« sag’ ich.
Und die Kugel sprach nun zu Jim, und Jim sagt’s mir wieder: »Deine alte Vater noch nix wissen, was wollen tun. Einmal wollen gehen, einmal wollen bleiben. Du sein ganz ruhig, Huck, lassen tun die alte Mann, wie er wollen. Sein da zwei Engels, fliegen um ihn rum. Sein der eine weiß, der andere schwarz. Wollen der weiß ihn führen gute Weg, kommen der schwarz und reißen ihn fort. Arme Jim, ich nix können sagen von Ende, ob schwarz, ob weiß! Bei dir aber allens sein gut. Du haben noch viel Angst im Leben, aber auch viel Freud! Werden kommen Krankheit und Unglück un dann Gesundheit un Glück! Sein deine Engels zwei Mädels, eine blond und eine braun, eine reich un eine arm. Werden du heiraten erst die arm un dann die reich! Du nix gehen zu nah an Wasser, sonst du müssen fallen rein un ganz ersaufen! Du hören arme, alte Jim, Huck, du nix vergessen, was er sagen!«
Das versprach ich denn auch hoch und heilig. Als ich an diesem Abend mein Licht angezündet hatte und damit in mein Zimmer trat -- saß da mein Alter in Lebensgröße!
Ja, Huck Finn hat’s nach diesem Exempel nicht sehr weit in der Rechenkunst gebracht! <<<
5. Kapitel
Hucks Vater -- Bekehrung -- Zärtlichkeiten
Ich hab’ mich stets vor ihm gefürchtet, er hat mich immer so tapfer gegerbt, aber diesmal merkt’ ich gleich, daß es anders war. Das heißt, zuerst schnappte ich nach Luft -- es nahm mir den Atem, ihn so plötzlich zu sehen; aber dann raffte ich mich schnell zusammen und trat näher.
Er war beinahe fünfzig und sah auch so aus. Sein Haar war lang und verwirrt und fettig und hing ihm übers Gesicht, daß seine Augen wie hinter Buschwerk hervorstachen. Es war noch ganz schwarz und kein bißchen grau, so war auch sein langer Schnauzbart. In seinem Gesicht, soweit man’s sehen konnte, war keine Farbe, es war ganz weiß, aber nicht von einem gewöhnlichen Weiß, sondern so, daß es einem übel machte, wenn man’s sah, daß es einem eine Gänsehaut über den Rücken jagte, so totenähnlich, so fischbauchartig war es. Seine Kleider -- waren Lumpen, weiter nichts. Er hatte den rechten Fuß aufs linke Knie gelegt, und der Stiefel sperrte das Maul so weit auf, daß zwei oder drei Zehen heraussahen, an denen er herumfingerte. Sein Hut, ein alter zerrissener Filzdeckel, lag auf dem Boden.
Ich starrte ihn an. Er hatte den Stuhl etwas hinten übergekippt und starrte mich wieder an. Endlich stellte ich das Licht hin und sah, daß das Fenster offen war; der Alte war also übers Schuppendach eingestiegen. Der verflixte Schuppen!
Der Alte folgte mir mit den Augen, ich spürte es, endlich sagte er: »Donnerwetter, feine Kleider -- sehr fein! Du bild’st dir wohl was drauf ein, he? Denkst, du bist ein Herr geworden, he?«
»Vielleicht -- vielleicht auch nicht«, sag’ ich.
»Wirst du mir wohl ordentlich antworten, he?« brüllt er, »du scheinst dir tüchtige Mücken in den Kopf gesetzt zu haben, seit wir uns nicht gesehen. Die treib’ ich dir aus, das laß dir gesagt sein! Du gehst auch in die Schule, hab’ ich mir sagen lassen, und kannst lesen und schreiben. Glaubst jetzt wohl, daß du besser bist als dein Vater, he, du Racker? Wart’ ich will dir kommen! Wer hat dir erlaubt dahinzugehen, wer, frag’ ich, wer hat dir’s erlaubt?«
»Die Witwe! Sie hat’s erlaubt!«
»Die Witwe, he? Und wer hat’s der Witwe erlaubt, daß sie ihre Nase in Dinge steckt, die sie absolut nichts angehen, wer, he?«
»Niemand!«
»Gut, der will ich’s zeigen! Und du, Bengel, infamer, du läßt das Schulegehen bleiben, verstanden? Ich werd’s den Leuten schon zeigen, was es heißt, einem solchen Flegel wie dir, in den Kopf zu setzen, er sei besser als sein Vater. Laß du dich wieder in der Schule erwischen! Deine Mutter hat nicht lesen und schreiben können, eh’ sie starb und keiner von der Familie konnt’s ich kann’s auch nicht, und da kommt so ein Racker und will besser sein als wir alle und bildet sich was drauf ein und tut sich dick damit. Das laß ich mir aber nicht gefallen, verstanden? Da -- zeig einmal, was du lesen kannst.«
Ich nahm ein Buch und stotterte etwas vom General Washington und dem Krieg. Eine Minute lang hörte er zu, dann versetzte er dem Buch einen Stoß, daß es in die andere Zimmerwand klatschte, und sagte: »Kann’s der Bengel ja wahrhaftig! Ich hätt’s nicht geglaubt, dacht’ es sei Geflunker. Aber du, wart, ich werd’ dir die Mücken austreiben, ich leid’s nicht, verstanden? Ich werde aufpassen, und erwisch’ ich dich an der Schule, mein feiner Herr, so gerb ich dir das Leder durch, daß du die Engel im Himmel pfeifen hörst! Nächstens wirst du noch fromm werden! Donnerwetter, so ein Sohn!«
Er griff nach einem kleinen blau und gelben Bildchen, auf dem ein Junge und ein paar Kühe abgemalt waren, und fragt: »Was ist das?«
»Das hab’ ich gekriegt, weil ich meine Aufgabe gut gelernt habe.«
Rasch war’s zerrissen, und er brüllt:
»Ich will dir was Beßres geben, wart’ ich werd’ dir ein Bild auf den Buckel malen.«
Nun saß er still und murmelte und brummte vor sich hin. Dann fängt er wieder an: »Hat man je schon so etwas erlebt! Das nenn’ ich einen feinen Herrn! Ein Bett, wahrhaftig, und Bettücher! Und ein Stückchen Teppich am Boden! Und der eigene Vater schläft bei den Schweinen oder wo er gerade hinkommt! Und das will ein Sohn sein! Wart, Kerl, die Mücken fliegen dir aus dem Kopf, eh’ du Amen sagen kannst, da sag’ ich dir. Mit dir werd’ ich noch fertig werden, Racker! Die Leute sagen auch, du hättest Geld! Wie ist das?«
»Die Leute lügen -- so ist das!«
»Ich sag’ dir, Bursche denk dran, daß du mit deinem Vater sprichst, bald bin ich fertig mit meiner Geduld, also sieh dich vor! Jetzt bin ich zwei Tage in der Stadt, und überall hab’ ich von deinem Geld gehört, schon weiter unten im Tal erzählten sie davon, und so muß doch was dran sein! Deshalb bin ich gekommen. Also morgen schaffst du mir das Geld, verstanden? -- Ich brauch’s!«
»Ich hab’ kein Geld!«
»Du lügst! Der Kreisrichter hat’s für dich, und du schaffst mir’s her -- ich brauch’s, sag’ ich dir!«
»Ich hab’ kein Geld! Frag den Kreisrichter selbst, der wird dir’s auch sagen!«
»Gut, ich werd’ ihn fragen, und er muß blechen, oder ich will wissen, wie’s damit steht. Was hast du in der Tasche, he? Ich will’s haben!«
»Ich hab’ nur einen einzigen Dollar, und den brauch’ ich, um --«
»Das ist ganz wurst, wozu du ihn brauchst, her damit! Raus!«
Er nahm ihn und biß hinein, um zu sehen, ob er echt sei, und sagte dann, er gehe in die Stadt, um sich Whisky zu holen, er habe den ganzen Tag noch keinen Tropfen über die Lippen gebracht, dabei roch er wie ein Schnapsladen. Dann kletterte er zum Fenster hinaus auf den Schuppen, steckte den Kopf wieder herein, fluchte noch einmal über meine Mücken und darüber, daß ich besser sein wolle als er, und als ich dachte, nun sei er sicher fort, erschien er noch einmal und erinnerte mich an die Schule und die versprochenen Prügel, wenn ich mich dort blicken lasse.
Am andern Tag war er betrunken, ging zum Kreisrichter und drohte ihm wegen des Geldes, das der nicht herausgeben wollte; er sagte, er wolle vor Gericht gehen und ihn dazu zwingen.
Der aber und die Witwe wollten, daß man mich meinem Alten wegnehme und eines von ihnen zu meinem Vormund mache. Und das wäre, meiner Seele, das beste gewesen. Aber da war ein neuer Ortsrichter gekommen, der kannte den alten Mann nicht und meinte, es sei unrecht, Familien zu trennen, er könne nichts tun, er wolle dem Vater das Kind nicht rauben. So mußten der Kreisrichter und die Witwe die Sache eben gehen lassen, wie’s ging.
Das war Wasser auf die Mühle meines Alten und stieg ihm riesig zu Kopf. Er drohte, er wolle mich schwarz und blau dreschen, wenn ich ihm nicht sofort Geld verschaffe. Ich lief also zum Kreisrichter und lieh mir drei Dollar von meinem Geld. Der Alte nahm’s betrank sich, lärmte, schimpfte, fluchte und spektakelte durch die Straßen der Stadt, bis sie ihn festnahmen und für eine Woche einsperrten. Das war ihm nun nichts Neues und genierte ihn weiter nicht. Wenn sie jetzt auch Meister über ihn seien, so bleibe er doch immerhin Herr und Meister seines Sohnes, meinte er, und werde das der ganzen Stadt und seinem Herrn Sohne selbst noch klar beweisen. Dem wolle er schon noch einheizen in seinem Leben!
Nach Verlauf der Strafzeit ließen sie ihn dann laufen. Der Ortsrichter aber sagte, er wolle einen neuen Menschen aus ihm machen, nahm ihn mit nach Hause, gab ihm saubere, ordentliche Kleider statt der Lumpen, behielt ihn zum Frühstück, Mittagessen und Abendbrot und schloß sozusagen dicke Freundschaft mit ihm. Nach dem Abendessen redete er dann auf ihn ein von Gott und dem letzten Gericht, der Bibel und dem Temperamentsverein1 bis der alte Mann zu schluchzen und zu weinen begann und sagte, er sei ein Narr gewesen all sein Leben lang, ein elender, erbärmlicher, lumpiger Narr! Jetzt aber gehe er in sich und wolle von neuem beginnen und ein Mann werden, dessen sich kein Mensch in der Welt zu schämen brauche, wenn ihm der Herr Richter nur helfen und ihn nicht verachten wolle. Der sagte, er möchte ihm um den Hals fallen für diese Worte und weinte vor Rührung, und seine Frau weinte mit. Mein Alter versicherte nun, er sei immer verkannt worden in seinem Leben; alles, was ein verlorener Mensch brauche, um gerettet zu werden, sei Sympathie; der Richter stimmte ihm zu, und dann weinten sie wieder.
Als es Zeit war zum Schlafengehen, erhob sich mein bekehrter Vater, hielt seine Hand hin und sagte: »Sehen Sie hier diese Hand, meine Herrn und Damen, nehmen Sie sie, schütteln Sie sie. Es war einstmals die Hand eines Schweines, aber sie ist’s nicht mehr, sie ist die Hand eines Mannes, der ein neues Leben begonnen hat und der eher sterben wird, als daß er ins alte zurückkehrt. Denken Sie an diese Worte, gedenken Sie dessen, der sie sagte. Es ist eine reine Hand jetzt, nehmen Sie, fürchten Sie nichts, schütteln Sie diese Hand!«
Der Richter, seine Frau und seine Kinder schüttelten sie der Reihe nach, und die Frau Richter küßte sie sogar. Dann sollte er noch ein feierliches Gelöbnis unterschreiben -- und er tat’s, indem er drei Kreuze druntersetzte. Der Richter bemerkte noch, das sei der schönste Tag seines Lebens, und dann führten sie meinen Alten