
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Das Drama beginnt mit einem Wecker, der morgens nicht klingelt und zwei Schulkindern, die verschlafen. Und dabei muss Evelyn eine wichtige Physikarbeit schreiben. Doch der Schulbus in die zwölf Kilometer entfernte Küstenstadt ist längst weg, als die beiden endlich aufwachen. Aber warum hat der Wecker nicht geklingelt? „Was ist denn hier los? Warum bist du noch nicht unterwegs, Evelyn? Bist du krank?“, fragte die Mutter und fasste nach dem Deckbett. Evelyn schüttelte den Kopf und schluchzte: „Verschlafen. Martin hat schuld, er hat den Wecker ...“ „Ach, Martin, musst du denn alles kaputt machen, was du in die Finger nimmst?“ „Ich hab ihn repariert! Evelyn hat mich darum gebeten.“ „Und warum klingelt er dann nicht, he?“ Evelyn sah den Bruder an, als wollte sie ihn fressen. Am liebsten hätte sie ihm noch eine gefeuert, doch in Gegenwart der Mutter wagte sie es nicht. Martin, der das wusste, hielt dem wütenden Blick seiner großen Schwester stand. Plötzlich schrillte es durchdringend aus Evelyns Zimmer herüber. Ein breites Grinsen zog Martins Gesicht auseinander. „Er klingelt doch, Schwesterchen, was willst du denn?“ Martin genoss seinen Triumph. „Aber “, Evelyn schnüffelte durch die Nase, „zwei Stunden zu spät, du ..., du Supertechniker!“ Wieder einmal hat Martin alles verpatzt. Überhaupt leistet sich der Zwölfjährige jede Menge Verrücktheiten, die seine Familie aufregen. Er findet nicht die gewünschte Anerkennung. Dann muss er sich auch noch wieder einmal seine ältere Schwester Evelyn vorhalten lassen, die etwas zu vermelden hat: „Ich habe noch etwas.“ Evelyns Bemerkung klang unendlich gelangweilt, als sie mit spitzen Fingern eine Urkunde auf den Schreibtisch schob. Dabei streifte sie Martin mit einem Blick, als wäre er der letzte Dreck. „Donnerwetter! Bravo!“ Der Vater sprang auf. „Das lass ich mir gefallen! Meine Tochter auf dem ersten Platz bei der Matheolympiade!“ „Gleich tret ich dir in deinen Allerwertesten!“, zischte Martin seiner Schwester zu. „Versuch es doch“, zischte Evelyn zurück, „du Versager!“ Versager! Ein Faustschlag hätte Martin nicht schmerzhafter treffen können als dieses Wort. Ich zeig’s ihr! schwor er sich, gleich nachher dresch ich ihr eine, dass sie, dass sie, na, mindestens heulen müsste sie! Aber ist Martin wirklich ein Versager? Jedenfalls darf er nicht mit seinen Eltern und seiner Schwester in den Urlaub fahren, sondern muss diese Zeit bei Tante Wally und ihren Hühnern verbringen. Aber vielleicht ist das auch ein Glück für Martin …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Barbara Kühl
Martin oder Zwei linke Hände
ISBN 978-3-86394-687-6 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1982 in Der Kinderbuchverlag Berlin
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta Foto: Erika Godemann
2014 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Vorsichtig tappte Martin den Gang entlang, der wie ein Tunnel in die Erde führte. Einem Schwimmer gleich breitete er die Arme aus und ruderte hinein in die Stille aus Watte, ruderte und schwebte.
„Ich muss es finden“, flüsterte Martin, „ich muss es finden ...“ Und er tastete und suchte in dem unheimlichen, scheinbar endlosen Gang. Irgendwo vor sich vermutete er eine Höhle, gleich würde sie sich vor ihm auftun. Er starrte in das Dunkel, dass die Augen schmerzten. Vergeblich. Martin wandte sich um. Doch auch da war nichts als Enge und undurchdringliche Finsternis, aus der die Angst herangeschlichen kam. Martin atmete mühsam und begann zu schwitzen.
„Ich gehe zurück“, beschloss er. Als er wieder nach der erdigen Wand fassen wollte, war sie verschwunden. Auch auf der anderen Seite griffen die Hände ins Leere. Voller Panik drehte Martin sich wie ein Kreisel. Wo war der Ausgang aus diesem schwarzen, unendlichen unterirdischen Gang? Plötzlich umfing ihn stechende Helligkeit. Die Dükermutter! durchfuhr es Martin, und ein heißer Schmerz brannte in seinem Gesicht.
„Du gemeiner Kerl!“, schrie jemand und schüttelte ihn. Das war nicht die Dükermutter, das war Evelyn, die ihren Bruder mit einer Ohrfeige weckte. Martin kniff die Augen zu und stellte sich schlafend. Wonach hatte er im Traum nur gesucht in dem unterirdischen Gang, wonach nur? Es musste etwas Besonderes gewesen sein, etwas Schönes, für das es sich lohnte, die Angst vor der Dükermutter zu überwinden.
„Mach endlich die Augen auf, ich weiß, dass du wach bist!“
Als Martin sich knurrend zur Wand drehte, zog ihm Evelyn mit einem Ruck das Oberbett weg. Martin sprang aus dem Bett und baute sich vor seiner Schwester auf.
„Du spinnst wohl, was? Gib das Bett her, los!“ Martin zerrte an dem Federbett und vollführte mit nackten Beinen eine Art Indianertanz auf dem kalten Fußboden.
„Warum hast du das getan? Warum?“, fauchte Evelyn. „Wie soll ich jetzt zur Schule kommen? Der Bus nach Boddentin ist längst weg.“
„Na und? Ist doch kein Drama, fährste eben morgen.“
„Morgen, morgen! Heute muss ich fahren, wir schreiben eine Physikarbeit.“
Martin sah seine Schwester einen Augenblick entgeistert an. „Du ..., du musst was am Kopf haben, Schwesterchen!“ Martin prustete los. „Eine verpasste Klassenarbeit! Ich würd mich freuen.“
„Weil du dämlich bist! Dumm und dämlich, du ..., du ...“ Evelyn begann zu heulen.
„Was ist denn hier los? Warum bist du noch nicht unterwegs, Evelyn? Bist du krank?“, fragte die Mutter und fasste nach dem Deckbett. Evelyn schüttelte den Kopf und schluchzte: „Verschlafen. Martin hat schuld, er hat den Wecker ...“
„Ach, Martin, musst du denn alles kaputt machen, was du in die Finger nimmst?“
„Ich hab ihn repariert! Evelyn hat mich darum gebeten.“
„Und warum klingelt er dann nicht, he?“ Evelyn sah den Bruder an, als wollte sie ihn fressen. Am liebsten hätte sie ihm noch eine gefeuert, doch in Gegenwart der Mutter wagte sie es nicht. Martin, der das wusste, hielt dem wütenden Blick seiner großen Schwester stand.
Plötzlich schrillte es durchdringend aus Evelyns Zimmer herüber. Ein breites Grinsen zog Martins Gesicht auseinander. „Er klingelt doch, Schwesterchen, was willst du denn?“ Martin genoss seinen Triumph.
„Aber ...“, Evelyn schnüffelte durch die Nase, „zwei Stunden zu spät, du ..., du Supertechniker!“
„Künstlerpech.“ Lässig hob Martin die Schultern und rollte die Augen. „Also Verzeihung, Schwesterchen, es tut mir leid.“ Martins Verbeugung wirkte linkisch und lächerlich, seine Worte jedoch klangen ehrlich und aufrichtig.
„Lass den Quatsch!“, sagte Evelyn und knuffte ihren Bruder. „Sag mir lieber, wie ich nach Boddentin komme.“
„Mit Gottfried und dem ,Schimmel“, er muss ihn nachher sowieso aus dem Stall holen.“
„Nenn deinen Vater nicht immer Gottfried! Du hast dir in letzter Zeit einen Umgangston angewöhnt! Respektlos ist gar kein Ausdruck dafür!“, tadelte die Mutter.
„Typisch halbstark“, flötete Evelyn und stolzierte mit wiegenden Hüften aus dem Zimmer. Sie hatte wieder Oberwasser. Martin hatte seinen Rüffel weg, und sie würde nachher vom Vater mit dem weißen Wartburg, dem „Schimmel“, in die neun Kilometer entfernte Küstenstadt gefahren werden. Seit September besuchte sie die EOS von Boddentin und kam nur an den Wochenenden nach Hause.
„Eingebildete Zicke!“, zischte Martin.
„Lern du erst einmal wie Evelyn, dann darfst du dir auch etwas einbilden.“
„Volltreffer!“, flüsterte Martin und schluckte. Eine heiße Welle überflutete ihn, und die Kränkung legte sich wie ein Stein in Kehle und Magen.
„Du wirst dich erkälten, Martin, wenn du noch lange mit nackten Füßen herumstehst. Kriech noch einen Moment ins Bett und wärm dich auf, bis Evelyn aus dem Bad kommt.“ Maria Lembke klapste ihrem Sohn auf den Po.
Er darf nicht krank werden, gerade jetzt nicht, überlegte Maria, wer sollte sich den ganzen Tag um den Jungen kümmern? In einer Woche erhielten die Mitglieder der LPG Tierproduktion nicht nur das Geld für die monatlich eingebrachten Arbeitseinheiten, sondern den oft recht hohen Betrag der Jahresendauszahlung. Das hieß Überstunden für sie und ihre Kolleginnen, das bedeutete Unruhe für die Familie. Und für Martin.
„Wasch dich ordentlich und vergiss nicht, die Zähne zu putzen!“, mahnte die Mutter, während sie Martins Zimmer verließ.
„Mama“, protestierte Martin beleidigt, „ich bin doch kein kleines Kind mehr! Ich bin zwölf Jahre alt!“
Als Martin vor dem Badezimmerspiegel Fratzen schnitt und sein Kinn vergeblich nach Bartfusseln absuchte, hörte er den Schimmel aus der Garage fahren. Gleichzeitig erklangen eilige Schritte auf der Treppe, und die Mutter erschien in der Tür. Eine helle Pelzjacke umhüllte die zierliche Gestalt, die dazu passende Mütze verdeckte Ohren und Haar bis auf eine winzige schwarze Stirnlocke. Wie hübsch sie ist! Ja, Mama sieht gut aus, fand Martin.
„Mach’s gut, Martin, ich werde den Wagen fahren, es hat tüchtig geschneit.“ Noch während sie redete, streifte sich die Mutter Handschuhe über. „Iss ordentlich und schließ um, wenn du gehst.“
Gleich wird sie mir einen Kuss geben wie jeden Morgen, dachte Martin. Sie muss sich ein wenig auf die Zehen stellen, wenn ich mich nicht zu ihr hinunterbeuge.
„Tschüs, Martin!“ Die Mutter stellte sich nicht auf die Zehen. Sie drehte sich um und lief, obwohl sie Stiefel trug, leicht und leise die Treppe hinunter.
Enttäuscht sah Martin ihr nach. Sie hat wieder lange Hosen an, stellte er fest, lange Hosen wie immer. Wann hat sie eigentlich das letzte Mal ein Kleid getragen? Ach, was geht’s mich an, soll Mama doch anziehen, was sie will! Brennende Röte stieg Martin bis unter den Haarschopf, denn ein Bild war plötzlich da und wollte sich nicht wegwischen lassen: Der rote LKW war um den Teich gekurvt und hielt hupend vor dem Haus. Mit aufgeregten Trippelschritten lief die Mutter aus der Gartenpforte. Sie trug ihr dunkelgrünes Kostüm und versuchte zweimal vergeblich, das Fahrzeug zu erklimmen. Hilflos und klein stand sie vor dem hohen Einstieg, aber sie gab nicht auf. Blitzschnell raffte sie den Rock bis über die Knie, und während sie einen Fuß auf den Tritt setzte, riss der Kostümrock fast in seiner ganzen Länge auf. Egon, der Fahrlehrer, griente bloß und meinte trocken: „Fahrschule ist eben keine Spazierfahrt.“ Der lange Hinnerk aber fasste einfach zu und hob die zierliche Maria Lembke in den LKW. „Nu ärgern Se sich man nicht, Frau Lembke, der stört nu nicht mehr beim Kuppeln und Bremsen“, versuchte Hinnerk in seiner weichen breiten Mecklenburger Mundart zu trösten, „wir wer’n das ja woll schaffen!“
Maria Lembke schaffte es. Es erstaunte Martin immer wieder, welch eine Energie, welch eiserner Wille in seiner Mutter steckte. Völlig zerschlagen kam sie jedes Mal nach mehreren Fahrstunden nach Hause, kaum noch in der Lage, Arme und Beine zu bewegen, mit denen sie den Fünftonner hinter dem riesigen Lenkrad gezwungen hatte, ihr zu gehorchen. Einmal weinte sie sogar vor Muskelschmerzen und Erschöpfung. Als Vater sie dabei überraschte, brauste er auf.
„Wozu musst du als Frau LKW fahren? Schluss damit! Warte, bis du die Fahrerlaubnis in Boddentin erwerben kannst!“
Doch die Mutter wollte nicht mehr warten, und Martin kannte den Grund. Sie hatte mit dem Fahrschulunterricht begonnen schon kurze Zeit nach dem schweren Unfall. Nur ungern erinnerte sich Martin daran.
2. Kapitel
Als Maria Lembke in das Zimmer des Vorsitzenden stürmte, um sich für ihre Verspätung zu entschuldigen, hockte Poltrin hinter seinem Schreibtisch, eingenebelt in dicken Tabaksqualm.
„Maria, endlich!“, stieß er hervor, sprang auf und schwenkte einen Bogen Papier. „Es hat geklappt! Du, die nehmen unsere Versuche wirklich ernst im Institut, die haben die Sache angekurbelt. ,Jushnij‘ heißt der Kolchos, liegt in der Ukraine, dicht bei Kiew. Hier, hier ungefähr muss das sein!“ Poltrin zerrte seine überraschte Mitarbeiterin zum Schreibtisch und pikte mit dem Pfeifenstiel aufgeregt auf die riesige Landkarte. Maria starrte auf den grünen Fleck und lächelte. Er freut sich, dachte sie, Poltrin freut sich wie ein kleiner Junge über ein neues Spielzeug. Und sie gönnte ihm das von ganzem Herzen.
„Maria, Mädchen, sag doch was!“ Der Vorsitzende richtete sich auf und sah seine Mitarbeiterin begeistert an. „Freust du dich denn gar nicht?“
Natürlich, wollte Maria sagen, doch sie hustete plötzlich los, und der Qualm trieb ihr die Tränen in die Augen.
„Weiß schon, weiß schon.“ Poltrin rannte zum Fenster und riss es auf. „Du rauchst nicht, du trinkst nicht ..., wir werden international, und du hustest bloß. Was bist du nur für ein Mensch, Maria? Na, setz dich!“
Heidi Brüsch brachte Kaffee und verschwand wortlos, als sie merkte, dass sie hier überflüssig war.
„Also nun mal im Klartext, Rudi“, forderte Maria, „was genau ist los?“
Und Poltrin erwähnte die Haltungs- und Fütterungsversuche, die die LPG Tierproduktion Pierstorf seit Jahren im Auftrag eines Forschungsinstitutes der DDR durchführt, er erzählte vom Kolchos „Jushnij“ in der Sowjetunion, der ebenfalls Jungrinder aufzieht und an einem Erfahrungsaustausch mit einem Betrieb in der DDR interessiert ist.
„Und der Betrieb sind wir! Wir, Maria, und nicht irgendeiner! Hier steht’s drin, im Brief von den Jushnij‘-Leuten. Lies mal.“ Und während der Vorsitzende Maria Lembke den Bogen hinüberschob, murmelte er: „Jushnij ..., Jushnij ..., müsste was mit ,Jugend‘ zu tun haben, oder?“ Maria verschluckte sich fast vor Lachen. „Süden“, sagte sie, „das heißt ganz einfach ,Süden‘!“
„Siehst du, Maria, dafür brauch ich dich. Du übersetzt mir den Brief, damit wir den Freundschaftsvertrag aufsetzen können. Und den übersetzt du mir dann auch gleich wieder. Und so weiter. Klar?“
Verdattert sah Maria ihren Chef an und den wie eine Pistole auf sie gerichteten Pfeifenstiel, betrachtete das Stück Papier mit den kyrillischen Buchstaben, blickte wieder hoch und schüttelte den Kopf.
„Unmöglich!“
„Nichts da, Kollegin Lembke, du machst das!“
„Ganz unmöglich!“, protestierte Maria noch einmal, „meine Sprachkenntnisse …“
„Sind die besten unter allen Mitarbeitern! In deiner Kaderakte steht es schwarz auf weiß: Berufswunsch — Dolmetscherin. Studium ein halbes Jahr vorfristig abgebrochen. Weitere Einwände?“
„Gottfried ..., seine Verletzung. Hast du das vergessen?“ Poltrin brauste auf. „Ich bitte dich, Maria, die Sache ist bereits ein Jahr her! Dein Mann ist in seinem Beruf voll arbeitsfähig, trotz der Prothese. Willst du dich für alle Zeiten zu seinem Kindermädchen machen? Hast du nicht schon einmal verzichtet — auch seinetwegen?“
Das waren harte Worte, und sie trafen Maria Lembke besonders schwer, weil sie spürte, dass Poltrin recht hatte. Trotzdem versuchte sie es noch einmal. „Ich hab zwei Kinder, und der Martin ist in einem Alter ..., der braucht mich jetzt besonders.“
„Gleich weine ich vor Mitleid, huh-huh!“ Poltrin lief rot an. „Wenn mir Heidi Brüsch das gesagt hätte, alleinstehend mit einjährigen Zwillingen, gut. Aber du, Maria? Komm doch endlich mal auf die Erde! Du kannst sowieso nicht ein Leben lang wie ein Sputnik nur um deine Familie kreisen. Sie ist wichtig, ja, aber nicht das Wichtigste überhaupt. Und jetzt bist du wichtig.“ Und während der Vorsitzende der LPG Tierproduktion Pierstorf in seine dicke Joppe schlüpfte, ließ er seine Kollegin, deren Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit er über alles schätzte, nicht einen Moment aus den Augen. Mit einer endgültigen Handbewegung legte er ihr den Brief in den Schoß.
„Da! Überleg es dir bis morgen. Ich muss jetzt raus zu Luden Ladehoff und seinen Rindviechern. Die angefahrene Blattsilage ist gefroren.“ In der Tür drehte sich Poltrin noch einmal um. „Und fang schon immer mit dem Übersetzen an. Bei ,INTERTEXT‘ dauert es mir zu lange.“ Weg war er.
Maria saß wie festgeleimt. „Er traut es mir zu“, flüsterte sie, „er traut mir diese Arbeit zu.“ Und plötzlich empfand sie — stärker als alle Bedenken — den Wunsch, nicht nur diesen einen Brief aus der russischen Sprache zu übersetzen. Diese Herausforderung anzunehmen, sich zu erproben konnte Freude machen.
3. Kapitel
Der Nordostwind pfiff und orgelte und trieb feine Schneekristalle in Böen über das Land. Martin hatte die „Pyramide“ auf der Anhöhe erreicht, die hier von Landvermessern errichtet worden war. Mit der Brust an eine der hölzernen Streben gelehnt, hielt Martin die Hände über die Augen, um sie vor dem beißenden Wind zu schützen. Irgendwo dort lag Boddentin. Irgendwo dort gluckste und schmatzte die Ostsee, umspülte wintermüde Fischkutter und Molen in dem kleinen Hafen, spuckte Steine und Tang, Muscheln und Quallen, ein bizarres Stück Holz und manchmal auch eine Flasche auf den Sand des Boddentiner Badestrandes — Strandgut. An sonnigen Tagen war trotz der Entfernung ein schmaler blauer Streifen Wassers mehr zu ahnen als zu sehen, heute jedoch bildeten Himmel, See und Erde ein einziges untrennbares Grau. Martin wandte sich um. Kiekebusch wirkte winzig klein in der jetzt öden weißen Winterlandschaft. Martin betrachtete die vier strohgedeckten Häuschen — undeutliche, graue Punkte. In dem kleinsten, an dessen Giebel sich aus Holz geschnitzte Pferdeköpfe kreuzten, hatte noch vor zwei Jahren Großvater Lembke gewohnt. Wie im Paradies, fand Martin damals, als er den Großvater besuchen durfte. Aber Großvater lebte nicht mehr. Mit dem Einzug in sein Haus ging für Martins Eltern ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Sie suchten die Abgeschiedenheit und glaubten, hier Ruhe zu finden vor der lärmenden Stadt.
Mich haben sie nicht gefragt, dachte Martin plötzlich, nein, sie haben mich nicht gefragt, ob ich immer hier leben möchte, jeden Tag, Sommer und Winter in einem Ortsteil mit vier Häusern um einen Teich, einer halb verfallenen Scheune, aber ohne Konsum. Rainer und Andreas, Steffi und der mickrige Maik — alle hatten mich beneidet, damals beim Umzug. Besucht mich mal im Paradies! Wie stolz hatte das geklungen. Aber sie waren in der Stadt geblieben. Nur Stinki hatte sich in den letzten Ferien einmal nach Kiekebusch verirrt. Kiekebusch! Ein jämmerliches Paradies, in dem man nicht einmal Kaugummi kaufen konnte.
Wenn doch wenigstens Jochen da wäre! Aber der hat noch nicht einmal geschrieben aus seinem Kurort, keinen Brief, keine Karte, nichts.
Der Schulweg hinüber nach Pierstorf erschien Martin plötzlich doppelt so weit. Für Evelyn, die Jeansprinzessin, hatte Gottfried gleich den Schimmel aus der Garage geholt und sogar aufs Frühstück verzichtet. Mama auch. Ich darf zur Chaussee latschen, mir die Beine abfrieren und auf den Bus warten, der sowieso nicht kommt bei dem Sauwetter.
Martin sah auf die Uhr. Zögernd löste er sich von dem pyramidenartigen hölzernen Festpunkt und wählte die Abkürzung quer über den verschneiten Sturzacker. Nach wenigen Minuten erreichte er einen der vielen von Weiden umstandenen Weiher und stapfte hinunter zum Eis. Wieder und wieder schleuderte er faustgroße Steine über die vom Wind blank gefegte Fläche. Plötzlich riss er sich dabei die Fellmütze vom Kopf — sie flog einige Meter hinaus auf den Teich. Verbiestert betrachtete Martin seine Kopfbedeckung, die auf dem Eis hockte wie eine Ente mit ausgebreiteten Flügeln. Hastig brach er einen verdorrten Ast von einer Weide und angelte nach der Mütze. Vergeblich, der Stock war zu kurz. Wieder langte Martin nach Steinen und feuerte nach Tante Wallys Weihnachtsgeschenk, ohne es zu treffen.
„So ein Mist!“ Martin zerknallte den Weidenstock auf dem Eis. Es hielt. Es hielt auch, als Martin einen Fuß darauf setzte und sich Schritt für Schritt vorwärts tastete.
„Gleich hab ich dich“, murmelte Martin. Die Eisdecke unter ihm bog sich, aber sie brach nicht. Er erreichte die Mütze und hob sie auf. Plötzlich lief ein widerliches Knirschen durch die gefrorene Fläche. Martin machte zwei, drei hastige Schritte und brach ein. Er versank bis über die Hüften in dem eisigen Wasser, warf sich auf die wegbrechenden Schollen und rutschte wieder hinein.
„Mamaaa!“ Martin schrie und kämpfte gegen das bröckelnde Eis. Die letzten Meter kroch er auf allen vieren dem Weiherrand zu. Erschöpft blieb er liegen, klappernd vor Entsetzen und Kälte. Dann taumelte er hoch, stemmte sich gegen den Nordostwind, der ihm den Atem nahm und durch seine nasse Kleidung fuhr. Um ihn her stiebte der Schnee, die Augen brannten und nahmen nichts wahr in dieser grauweißen eisigen Hölle.
Gegen den Wind! Gegen den Wind! hämmerte es in Martins Kopf. Er stolperte vorwärts, so schnell er konnte in den gefrierenden Sachen und scheuernden Stiefeln. Endlich entdeckte er vor sich die Stallgebäude des alten Teschenhofes. Wenig später riss er eine Tür auf und stürzte in den Hühnerstall.
4. Kapitel
Auf dem ehemaligen Teschenhof hatten nach Kriegsende mehrere Flüchtlingsfamilien Unterkunft gefunden. Ende der fünfziger Jahre war eines Nachts in der Schrotmühle Feuer ausgebrochen. Auch das Wohnhaus fing Feuer und brannte völlig nieder. Nur die Scheune und der große Viehstall konnten gerettet werden. Sie lagen parallel zueinander etwas außerhalb von Pierstorf. In beiden Gebäuden hatten die Eltern von Jochen Ladehoff bereits einige Generationen Jungrinder für die LPG Pierstorf aufgezogen. Die Scheune hatte man zu diesem Zweck mehrfach umgebaut und eine Zwischendecke eingezogen. Etwas abseits lag noch ein lang gestreckter, flacher Stall. Von der LPG gebaut, war er seit über zwanzig Jahren Königreich für ein paar Tausend piepsende Küken und spektakelnde Hühner. Und König war Wally Pfeffer, die zupacken konnte wie ein Mann, aber auch fluchen und schimpfen, wenn der Vorsitzende Poltrin auftauchte und von der geplanten modernen Geflügelanlage mit Käfighaltung sprach.
„Bleib mir ja vom Leib mit deiner technischen Revolution!“, wetterte Wally. „Meine Hühner legen vor Schreck lauter Windeier, wenn sie dich bloß sehen.“
Wally Pfeffer übertrieb immer ein bisschen.
„Tür zu, es zieht!“, schrie sie, ohne von ihrer Arbeit am Eiersammelband im Legehennenabteil aufzusehen.
„Tante Wally ...“, Martin schnatterte mit den Zähnen, „Tante Wally ...“
Wally Pfeffer sah hoch. „Martin! Teufel noch eins, wie siehst denn du aus!“
Martin fror jämmerlich und bibberte am ganzen Körper.
„Ich ... bin ... eingebrochen“, stieß er hervor.
„Typisch Martin Lembke!“ Tante Wally schaltete das Eierband aus. „Jeden Tag eine neue Verrücktichkeit!“
„Verrücktichkeit ...“, flüsterte Martin und verzog das Gesicht.
„Komm schon, du Held, oder hast du was gesagt?“ Martin schüttelte den Kopf, dem Weinen nahe. Breitbeinig folgte er Tante Wally in den Aufenthaltsraum.
„Ausziehen! Alles!“, kommandierte Tante Wally und befreite Martin rasch von der steif gewordenen Kleidung.
„Alles, hab ich gesagt!“, raunzte sie gutmütig, als Martin krampfhaft seine Unterhosen festhielt.
„Aber das ..., das geht doch nicht!“, stotterte er.
Tante Wally griente. „Und wie das geht! Hände weg, du trägst doch kein Staatsgeheimnis mit dir herum!“
Sie rubbelte und rieb den splitternackten Martin, bis sein Körper krebsrot wurde.
„So, nun die Strumpfhose! Aber fixing, fixing!“, kommandierte Tante Wally, als Martin maulte.
„Wie ich aussehe!“ Martin zog die Strumpfhose fast bis unters Kinn und starrte an sich herunter. Als Tante Wally ihm auch noch ihre kratzige Strickjacke über den nackten Oberkörper streifte, verdrehte Martin die Augen. „Mann, Tante Wally ...!“
„Na, nun aber! Keine Diskussionen! Komm!“
Martin, der sich wie eine Vogelscheuche fühlte, ging mit Tante Wally in eine der beiden Stallhälften, in der einige Tausend Küken aufgezogen wurden. Mehrere kegelförmige Schirmglucken hingen dicht über dem Stallboden und spendeten den Küken Wärme. Einen dieser Metallschirme schob Tante Wally hoch und scheuchte behutsam die goldgelben piepsenden Federbällchen unter die Nachbarschirme.
„Na los, du Riesenküken, setz dich hierher. Dein Haar muss auch trocknen. Ich brüh uns inzwischen Tee auf.“
„Du hast Ideen“, sagte Martin, als seine Tante die Schirmglucke ein wenig herunterzog. Da hockte er nun auf der Spreu wie Gulliver unter den Zwergen, doch ihm war warm, und er fühlte sich wohl trotz kratzender Strickjacke und Weiberstrumpfhose. Neugierig pickten einige Küken daran herum, und ein ganz vorwitziges Kerlchen spazierte Martins Bein hinauf, bis er es vorsichtig mit den Händen umschließen konnte. Wie weich doch so ein Wesen war! Und wie hilflos. Wenn Tante Wally nicht wäre ... Komisch, sie hat überhaupt nicht gemeckert, obwohl sie meinetwegen ihre Arbeit unterbrechen musste. Wie wohl Mama reagiert hätte? Ob sie so ruhig geblieben wäre wie Tante Wally?
„Trink schon“, sagte Tante Wally zu Martin, als sie in dem winzigen Aufenthaltsraum einander gegenübersaßen. Martin nahm einen Schluck und schnappte nach Luft.
„Mann, der feuert aber durch! Hast du da Schnaps reingekippt?“
„Schmeckt, was? Sollst mal sehen, wie schnell dir auch von innen warm wird. Eine Buddel ,Schluck' ist immer noch die beste Wärmflasche.“
Mit beiden Händen umfasste Martin die dickwandige Tasse, aus der heiße Dampfwölkchen aufstiegen. Bei jedem Schluck tränten ihm die Augen, und er beobachtete, wie Tante Wally genussvoll ihre Tasse leerte. Sie trinkt also auch bei der Arbeit Alkohol, überlegte Martin und glaubte zu verstehen, was seine Mutter meinte, wenn sie behauptete, Tante Wally sei mit einer Schnapsflasche verheiratet.
„Du, Tante Wally“, fragte er plötzlich, „was ist eigentlich eine Schnapsdrossel?“
Mit einem Ruck setzte Tante Wally ihre Tasse ab. Ihre Augen verengten sich zu einem Spalt, ihr Gesicht verschloss sich und zeigte unzählige harte Falten um Mund und Augen. Sie sah plötzlich sehr alt aus. Böse starrte sie ihren Neffen einen Augenblick an. Maria, mein Gott, Maria, was hast du dem Jungen bloß erzählt? Musst du auch ihn mir entfremden mit deiner spießigen Lebenseinstellung?
„Frag deine Mutter, Martin! Ja, frag sie nur, deine Mutter Maria, die weiß das am besten!“, sagte Tante Wally rau und zündete sich eine Zigarette an.


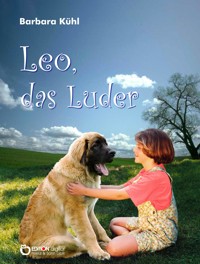















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










