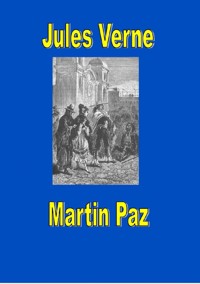
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In Peru kommt es zu einem Aufstand der Indianer gegen die Spanier und Mestizen im Land. Die schöne Sarah, deren Hochzeit von ihrem Stiefvater nach rein wirtschaftlichen Zwecken erfolgen soll, hat sich aber in den Indianer Martin Paz verliebt. Doch gibt es für das Liebespaar überhaupt eine Chance inmitten des blutigen Aufstandes? Jules Verne hat hier eine spannende Geschichte um ein Liebespaar geschrieben, die dem Leser ein Bild der Zeit vermittelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 80
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jules Verne
Martin Paz
Anmerkung zu dieser Ausgabe: Ich habe 1984 die Jules-Verne-Taschenbuchausgabe in 100 Bänden im Pawlak-Verlag betreut, nachdem meine Jules-Verne-Biografie bereits 1978 erschienen war. Eine Reihe von Texten Vernes gebe ich als durchgesehene Taschenbuchreihe neu heraus, gleichzeitig erscheinen die Bände als illustrierte Paperbacks im Format A 5. Alle Titel sind im Handel zu beziehen – überall, wo es Bücher gibt.
Thomas Ostwald
Jules Verne
Martin Paz
Edition Corsar D. u. Th. Ostwald
Braunschweig
In dieser Ausgabe werden Ausdrücke verwendet, die heute so nicht mehr üblich sind. Wir haben sie jedoch beibehalten, um die Texte nicht zu verändern.
Texte: © 2025 Copyright by Thomas Ostwald nach der Ausgabe des Hartleben-Verlages 1877 und der von mir betreuten Taschenbuchausgabe im Pawlak-Verlag 1984 durchgesehen und korrigiert
Umschlaggestaltung: © 2025 Copyright by
Thomas Ostwald
Edition Corsar
Dagmar u. Thomas Ostwald
Am Uhlenbusch 17
38108 Braunschweig
I.
Eben verschwand die Sonne hinter den schneeigen Gipfeln der Kordilleren, doch unter Perus schönem Himmel sättigte sich die Atmosphäre durch den leichten Schleier der Nacht mit einer lichtschimmernden Frische. Das war die Stunde, in der man nach europäischer Art und Weise leben und außerhalb der Verandas einen erquickenden Lufthauch aufsuchen konnte.
Während die ersten Sterne am Horizont aufzogen, füllten sich die Straßen Limas mit einer Menge Spaziergänger an, welche in ihrem leichten Mantel dahinwandelnd von den unbedeutendsten Dingen plauderten. Auf der Plaza-Mayor, dem alten Forum der Stadt der Könige, ging es sehr lebhaft zu. Die Handwerker benutzten die Abendkühle, um von der Arbeit des Tages zu ruhen, oder eilten geschäftig durch die Menge, wobei sie schreiend die Vorzüge ihrer Waren anpriesen. Die Frauen schwebten, sorgfältig verhüllt in den langen Schleiern, welche auch ihr Gesicht verdecken, mit eigentümlicher Grazie durch die Gruppen rauchender Männer. Einige Señoras in Balltoilette und mit reichem Haarschmuck aus lebenden Blumen brüsteten sich hingegossen in den offenen Wagen. Indianer streiften vorüber, ohne ein Auge zu erheben, da sie wohl wussten, dass sie zu niedrig geachtet wurden, um bemerkt zu werden, verrieten weder durch eine Geste noch durch ein Wort das dumpfe Verlangen, welches sie verzehrte, und kontrastierten dadurch merklich mit den ebenso wie sie selbst missachteten Mestizen, deren Protest gegen ihre soziale Stellung sich gern möglichst geräuschvoll Luft machte.
Die Spanier, diese stolzen Nachkommen Pizarros, gingen hoch erhobenen Hauptes umher, ganz wie zur Zeit, da ihre Vorfahren die Stadt der Könige gründeten. Ihre angeerbte Missachtung traf die Indianer, welche sie besiegt hatten, aber die Mestizen, die Sprösslinge ihrer Beziehungen zu den Eingeborenen der Neuen Welt, darum nicht weniger. Die Indianer hatten, wie alle zur Dienstbarkeit verurteilten Klassen, nur den einen Gedanken, ihre Fesseln zu sprengen, und ihre Abneigung kannte zwischen den Besiegern des alten Inkathrones und den Mestizen, einer Art Bourgeoisie voll widerwärtigen Stolzes, keinen Unterschied.
Diese Mestizen aber, Spanier durch ihre Verachtung der Indianer, Indianer durch den Hass, den sie den Spaniern geschworen, verzehrten sich selbst zwischen diesen beiden gleich lebhaften Gefühlen.
Zu ihnen gehörte auch die Gruppe junger Leute, welche nahe der hübschen Fontaine in der Mitte der Plaza-Mayor umher flanierte. Den Poncho, eine Art viereckig zugeschnittenes Stück Baumwollstoff mit einem Loch zum Durchstecken des Kopfes, malerisch über den Schultern, mit weiten buntgestreiften Beinkleidern und breitkrempigen Hüten aus Guayaquil-Stroh, plauderten sie, lachten und gestikulierten aufs Lebhafteste.
»Du hast ganz recht, Andreas«, fügte ein kleiner Mann von kriechendem, unterwürfigem Aussehen, den sie Millaflores nannten.
Dieser Millaflores war gleichsam der Parasit Andreas Certas, eines jungen Mestizen, des Sohnes eines reichen, bei einer der letzten Verschwörungen Lafuentas umgekommenen reichen Kaufmannes. Andreas Certa erbte ungeheure Reichtümer, die er freigebig zum Nutzen seiner Freunde verwendete, von welchen er nur unbedingte Willfährigkeit für seine Hände voll Gold verlangte.
»Was nützt dieser Wechsel der Machthaber, diese unaufhörlichen Pronunciamentos, welche Peru erschüttern? Ob Gambarra oder Santa-Cruz regiert, ist ja ganz unwichtig, so lange hier noch keine Gleichheit herrscht.«
»Wohl gesprochen! Bravo!«, rief der kleine Millaflores, der selbst unter einer Herrschaft der Gleichheit einem geistvollen Menschen doch niemals gleich geworden wäre.
»Wie!«, fuhr Andreas Certa fort,»Ich, der Sohn eines Handelsherrn, ich soll nur in einem mit Maultieren bespannten Wagen fahren dürfen? Haben meine Schiffe diesem Land nicht Reichtum und Wohlfahrt gebracht? Ist die nützliche Aristokratie des Geldes nicht mindestens ebenso viel wert, als die der inhaltlosen spanischen Titel?«
»O, es ist eine Schmach!«, antwortete ein junger Mestize, »und dort, seht einmal diesen Don Fernando, der in seiner Karosse mit zwei Pferden vorüberfährt! Don Ferdinand d'Aguillo! Er weiß kaum, womit er seinen Kutscher füttern soll, und brüstet sich hier wie ein Pfauhahn! Da ist auch noch ein anderer, der Marquis Don Vegal!«
Ein prächtiges Gespann lenkte eben auf die Plaza-Mayor ein; es war das des Marquis Don Vegal, Ritter von Alcantara, Malteser und Ritter des Ordens Karl's III. Der große Herr kam aber aus reiner Langeweile, nicht aus Prahlsucht hierher. Traurige Gedanken wohnten unter seiner tief gerunzelten Stirn, und er hörte nicht einmal die missgünstigen Bemerkungen der Mestizen, als seine feurigen vier Hengste sich einen Weg durch die Menschenmenge brachen.
»Ich hasse diesen Mann!«, sagte Andreas Certa.
»Wirst es nicht mehr lange nötig haben!«, antwortete einer der jungen Kavaliere.
»Nein, denn alle diese Vornehmen strahlen nur noch im letzten Schimmer ihres Luxus, und ich weiß es recht gut, wohin ihr Silberzeug und ihre Familienkleinodien wandern.«
»Jawohl! Du weißt etwas davon, Du, der das Haus des Juden Samuel so fleißig besuchst.«
»Und dort, in den Schuldbüchern des alten Juden, prangen die Namen jener Aristokraten, und sein Geldkasten strotzt von den Resten ihrer Schätze. Und von dem Tag ab, wo diese Spanier so bettelarm sein werden, wie ihr Cäsar von Bazan, werden wir gewonnenes Spiel haben.«
»Vorzüglich Du, Andreas«, ließ sich Millaflores vernehmen, »wenn Du Deine Millionen ins Treffen führst. Und Du wirst Deine Schätze noch verdoppeln!... Nun, wann wirst Du die schöne Tochter des alten Samuel heiraten, die doch eine Limenserin ist vom Scheitel bis zur Zehe und nichts Jüdisches an sich hat außer Ihrem Namen Sarah?« – »Nach einem Monat«, antwortete Andreas Certa, »und nach einem Monat wird es in Peru keinen Reichtum geben, der sich mit dem meinen messen könnte!«
»Warum aber«, fragte einer der jungen Mestizen, »willst Du nicht eine der jungen Spanierinnen von hoher Abkunft heiraten?«
»Weil ich diese Art Leute nicht weniger verachte, als ich sie hasse!«
Andreas Certa wollte es nicht zugestehen, dass er von mehreren vornehmen Familien, bei denen er sich Zutritt zu verschaffen gesucht hatte, jämmerlich abgewiesen worden war.
In diesem Augenblick wurde Andreas Certa von einem hochgewachsenen Mann mit halbergrauten Haaren, dessen Gliedmaßen aber eine große Muskelkraft verrieten, heftig mit dem Ellenbogen gestoßen.
Dieser Mann, ein Indianer aus den Bergen, trug eine braune Jacke, aus der ein grobleinenes Hemd mit breitem Kragen hervor sah, das über seiner rauen Brust offenstand; seine kurzen Beinkleider mit grünen Streifen endigten mit roten Kniebändern über den erdfarbenen Strümpfen; an den Füßen trug er Sandalen aus Büffelleder, und sein spitziger Hut erglänzte von großen, metallenen Schnallen. Nachdem er Andreas Certa gestoßen, sah er diesen auch noch ruhigen Blickes an.
»Elender Indianer!«, rief der Mestize und erhob schon die Hand. Seine Gefährten hielten ihn zurück, und Millaflores warnte:
»Andreas! Andreas! Nimm Dich in Acht!«
»Ein solcher erbärmlicher Sklave wagt es, mich zu stoßen.«
»Das ist ja ein Narr! Es ist der Sambo!«
Der Sambo fixierte den Mestizen, den er absichtlich gestoßen hatte, noch immer. Dieser ergriff in überschäumendem Zorn einen Dolch, den er im Gürtel trug, und wollte sich eben auf seinen Angreifer stürzen, als ein Kehllaut, ähnlich dem des peruanischen Hänflings, den Lärm der Spaziergänger übertönte und der Sambo eilig verschwand.
»Ebenso unverschämt, als feig!«, rief ihm Andreas Certa nach.
»Beruhige Dich«, sagte begütigend Millaflores. »Komm, wir wollen die Plaza-Mayor verlassen; die Frauen aus Lima sind hier zu hochmütig.«
Die Gesellschaft junger Leute wandte sich nach dem Hintergrund des Platzes. Die Nacht war gekommen, und die Limenserinnen verdienten mit Recht den Namen »tapadas«, denn unter dem sie dicht bedeckenden Schleier war man nicht mehr imstande, ihr Gesicht zu erkennen.
Die Plaza-Mayor zeigte sich jetzt belebter als je. Das Schreien und Lärmen wurde immer ärger. Die berittenen Wachen vor dem Mitteltor des vizeköniglichen Palastes am Nordende des Platzes hatten Mühe, mitten in diesem Gewoge und Gedränge von Menschen auf ihrem Posten auszuharren. Die verschiedensten Industrien schienen sich hier ein Rendezvous zu geben, und der ganze Platz bildete vielmehr einen ungeheuren Krammarkt von Waren jeder Art. Das Erdgeschoß im Palast des Vizekönigs und der ebenso mit Läden besetzte Unterbau der Kathedrale vollendeten das Gesamtbild eines offenen Bazars für alle Erzeugnisse der Tropenwelt.
Der Platz war infolgedessen sehr geräuschvoll; sobald aber der Angelus vom Glockenturm der Kathedrale ertönte, schwieg das Geräusch mit dem ersten Schlag. Dem lauten, lustigen Geschrei folgte das Geflüster des Gebetes. Die Frauen unterbrachen ihren Spaziergang und nahmen den Rosenkranz in die Hände.
Während alles stillstand und die Knie beugte, suchte sich eine alte Duenna, die ein junges Mädchen führte, mitten durch die unbewegliche Menge zu drängen, was nicht wenig unliebsame Bemerkungen über die beiden Störerinnen des Gebetes hervorrief. Das junge Mädchen wollte auch stehenbleiben, doch die Duenna zog sie mit sich fort.
»Seht diese Satanstochter«, raunte man neben ihr.
»Was ist's mit der verdammten Tänzerin?«
»Das ist noch eine der Weiber von »Carcaman«.
Plötzlich erfasst ein Maultiertreiber das Mädchen an der Schulter und will sie zum Niederknien zwingen; doch kaum hat er die Hand auf sie gelegt, als ein wuchtiger Arm ihn niederschlägt. Die blitzschnell verlaufende Szene erregte einiges Aufsehen.
»Fliehen Sie!«, flüstert da eine sanfte und ehrerbietige Stimme dem jungen Mädchen ins Ohr.
Diese dreht sich bleich vor Schrecken um und gewahrt einen jungen, hochgewachsenen Indianer, der mit gekreuzten Armen seinen Gegner ruhig erwartet.
»Bei meiner Seele, wir sind verloren!«, heult die Duenna.
Sie schleppt das junge Mädchen mit sich fort.





























