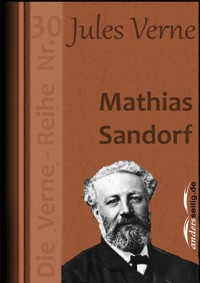
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: andersseitig.de
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jules-Verne-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die Handlung beginnt 1866 in Triest. Die mittellosen Gauner Sarcany aus Tripolis und Zirone finden auf einem ihrer Spaziergänge durch die Stadt eine Brieftaube, die eine Geheimbotschaft befördert. Sarcany will sehen, ob sie aus der Botschaft Kapital schlagen können. Sie lassen die Taube von einem Kirchturm aus frei und verfolgen sie mit den Augen bis zu ihrem Taubenschlag. Dieser befindet sich in einem Haus, das dem Grafen Ladislaus Szathmáry, einem ungarischen Adligen, gehört. Graf Szathmáry plant, mit seinen Freunden, dem Professor Stefan Báthory und dem Grafen Mathias Sandorf in Ungarn, ihrer Heimat, einen Volksaufstand gegen die Herrschaft Österreichs anzuzetteln. Mit Hilfe des dalmatinischen Bankiers Silas Toronthal lässt sich Sarcany von Graf Sandorf, der sich im Hause des Grafen Szathmáry aufhält, als Buchhalter einstellen. Im Schreibtisch des Grafen Szathmáry findet er die Schlüsselschablone zur Entzifferung der Geheimbotschaft. Sarcany und Toronthal entschlüsseln die Geheimbotschaft, die den geplanten Aufstand betrifft. Sarcany und Toronthal zeigen die Verschwörung an. Sie handeln jedoch nicht aus "Vaterlandsliebe", sondern aus materiellen Gründen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 807
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Jules Verne
Impressum
Covergestaltung:Johannes Krüger
Bearbeitung:Johannes Krüger
Digitalisierung:Gunter Pirntke
Herausgeber:Verlag Gunter Pirntke das-ebook24
ISBN:
Erster Theil.
Erstes Capitel. Die Brieftaube.
Triest, die Hauptstadt des Küstenlandes, theilt sich in zwei einander sehr wenig gleichende Städte: in eine neue und reiche, die Theresienstadt, die sich geradlinig am Rande der Bai erhebt, welcher der Mensch erst den festen Baugrund abringen mußte, und in eine alte, armselige; letztere ist unregelmäßig gebaut und liegt eingeklemmt zwischen dem Corso, der sie von der ersteren trennt, und den Abhängen der Höhen des Karst, dessen Gipfel eine malerisch ausschauende Citadelle krönt.
In den Hafen von Triest hinein ragt der Molo von San Carlo, an dem vorzugsweise die Handelsschiffe ankern. Dort sammeln sich mit Vorliebe, und oftmals in beunruhigender Anzahl, Gruppen von jenen Umherlungerern, welche nicht Haus und nicht Herd kennen, und deren Anzüge, Beinkleider, Jacken oder Westen der Taschen völlig entbehren könnten, weil ihre Eigenthümer niemals etwas besessen haben, was sie dort hinein hätten thun können und wahrscheinlich auch niemals dergleichen besitzen werden.
An jenem Tage aber, dem 18. Mai 1867, hat Einer oder der Andere vielleicht doch zwei Personen inmitten dieser Heimatlosen bemerkt, welche durch bessere Kleidungen sich auszeichneten. Es schien wenig wahrscheinlich, daß diese jemals wegen fehlender Gulden und Kreuzer in Verlegenheit gewesen waren, wenigstens sprach ihr Aussehen zu ihren Gunsten. Es waren, um der Wahrheit die Ehre zu geben, Männer, die auf Jeden einen günstigen Eindruck machen mußten.
Der Eine hieß Sarcany und nannte sich Tripolitaner, der Andere, ein Sicilianer, wurde Zirone gerufen. Nachdem Beide den Molo wenigstens zum zehnten Male abgeschritten hatten, machten sie auf der äußersten Spitze desselben Halt. Dort blickten sie nach dem Meere hinüber, welches westlich vom Golf von Triest den Horizont begrenzt, als müßte dort plötzlich das Schiff auftauchen, welches ihnen ihr Glück bringen sollte.
»Wie spät ist es?« fragte Zirone in seinem italienischen Dialect, den sein Gefährte ebenso geläufig sprach wie die Mundarten der übrigen Länder am Mittelmeer.
Sarcany gab keine Antwort.
»Was bin ich doch für ein Dummkopf! rief der Sicilianer. Es ist die Stunde, in der man Hunger verspürt, wenn man sein Frühstück einzunehmen vergessen hat.«
Die österreichischen, italienischen, slavischen Elemente zeigen sich in jenem Theile des österreichisch-ungarischen Reiches so miteinander vermischt, daß das Zusammenstehen unserer beiden Personen in keiner Weise die Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte, obwohl sie augenscheinlich sich als Fremde in jener Stadt aufhielten. Ueberdies konnte Niemand ahnen, daß ihre Taschen leer waren, denn sie trugen sich ziemlich stolz unter dem Kapuzenmantel, der ihnen bis auf die Stiefel hinabreichte.
Sarcany, der Jüngere von ihnen, von mittlerer Größe und gut gewachsen, mit eleganten Manieren und Bewegungen, stand im fünfundzwanzigsten Lebensjahre. Sarcany hieß er, ohne einen weiteren Zusatz. Einen Taufnamen führte er nicht. Und er war auch thatsächlich nicht getauft, da er, Afrikaner von Geburt, aus Tripolis oder Tunis stammte; trotzdem seine Gesichtsfarbe von einem dunklen Braun war, so glich er dennoch durch die Regelmäßigkeit der Züge mehr einem Weißen als einem Neger.
Wenn jemals eine Physiognomie täuschen kann, so war es bei Sarcany gewiß der Fall. Man hätte schon ein sehr scharfer Beobachter sein müssen, um aus diesem regelmäßig geformten Gesicht, den schwarzen und schönen Augen, der edlen Nase, dem wohlgeformten und von einem schwachen Barte beschatteten Munde die grenzenlose Verschlagenheit des jungen Mannes herauslesen zu können. Kein Auge wäre im Stande gewesen, auf diesem fast unbeweglichen Antlitze die Zeichen des Abscheu's, der Mißachtung zu erkennen, welche ein unentwegter Kampf gegen die Gesetze der Gesellschaft ihm einzugraben pflegt. Wenn die Physiognomiker behaupten – und zwar behalten sie in den meisten Fällen Recht – daß Jeder, der sich verstellt, seiner Geschicklichkeit zum Trotze, gegen sich selbst zeugt, so stellte Sarcany dieser Behauptung eine förmliche Verneinung entgegen. Wer ihn sah, konnte nicht ahnen, was er war, was er gewesen. Seine Erscheinung rief in nichts den unbezwingbaren Widerwillen wach, den Spitzbuben und Räuber einzuflößen pflegen. Er war deshalb nur um so gefährlicher.
Wer konnte wissen, was die Kindheit Sarcany's gewesen war? Gewiß die eines Ausgesetzten. Wie war er erzogen worden und von wem? In welcher tripolitanischen Höhle hatte er in den ersten Jahren seines Lebens sein Dasein gefristet? Welche Aufmerksamkeit bewahrte ihn vor den vielfachen, zerstörenden Krankheiten jenes entsetzlichen Klimas? Niemand fürwahr, wußte es zu sagen – vielleicht er selbst nicht einmal –; geboren durch Zufall, dem Zufalle überlassen, schien er bestimmt, dem Zufalle zu leben! Er hatte indessen während seiner Jünglingszeit eine gewisse praktische Bildung sich bereits anzueignen oder vielmehr zu empfangen gewußt; er dankte sie wahrscheinlich dem Umstande, daß sein bisheriges Leben ihn gezwungen hatte, die Welt zu durchstreifen, mit Leuten jeden Standes Gemeinschaft zu haben, Ausweg auf Ausweg zu finden, und wäre es nur, um des Tages Nothdurft zu befriedigen. So war er und in Folge verschiedener Umstände seit Jahren bereits mit einem der reichsten Häuser Triests in Verbindung gekommen, dem Hause des Banquiers Silas Toronthal, dessen Name mit dem Verlaufe unserer Geschichte eng verknüpft ist.
In dem Gefährten Sarcany's, dem Italiener Zirone, erblickt man nur einen von jenen Menschen, die Glauben und Gesetz nicht kennen, einen Abenteurer, der, zu allen Schandthaten bereit, dem ersten besten, wenn er gut zahlt, oder dem Nächsten, der noch besser zahlt, zu Diensten steht, gleichviel zu welchem Geschäfte. Sicilianer von Geburt und in den dreißiger Jahren stehend, war er ebenso fähig, schlechte Rathschläge zu ertheilen, als sie anzunehmen und namentlich, sie auszuführen. Wo er geboren wurde, würde er vielleicht verrathen haben, wenn er es gewußt hätte. Er gestand jedenfalls nicht gern ein, wo er zu Hause war, wenn er es überhaupt irgendwo war. In Sicilien hatte ihn eine von den Zufälligkeiten des Landstreicherlebens mit Sarcany in Verbindung gebracht. Sie waren dann gemeinsam in die Welt hinausgelaufen und hatten versucht, auf rechtem und auf unrechtem Wege ihr beiderseitiges Mißgeschick zu gemeinsamem Glück zu wenden. Zirone aber, ein großer, bärtiger Bursche mit sehr gebräuntem Teint und tiefschwarzem Haar, hatte nur mühsam die ihm angeborene Schurkerei zu verbergen gewußt, die seine stets halb geschlossenen Augen und das beständige Senken seines Kopfes verriethen. Unter einem Uebermaße von Schwatzhaftigkeit indessen suchte er seine Verschlagenheit zu verbergen. Er war im Uebrigen mehr heiter als traurig und ließ sich in demselben Maße gehen, als sein Genosse sich verschlossen zeigte.
An dem genannten Tage aber sprach auch Zirone nur mit einer bemerkbaren Mäßigung. Die Essensfrage erfüllte ihn sichtlich mit Unruhe. Der Abend vorher hatte gelegentlich einer kleinen Partie in einer Spielhölle niedrigen Ranges, woselbst sich das Glück allzu stiefmütterlich gezeigt, die Hilfsquellen Sarcany's völlig erschöpft. Beide wußten nicht, was nun werden sollte. Sie konnten nur auf den Zufall rechnen, und da diese Vorsehung der Lumpen sich nicht beeilte, auf dem Wege längs des Molos zu ihnen zu stoßen, so entschlossen sie sich, ihr durch die Straßen der Neustadt vorauszuwandern.
Dort auf den Plätzen, auf den Quais, auf den Promenaden diesseits und jenseits des Hafens, an den Landungsstellen des großen Canals, der Triest durchschneidet, geht, kommt, stößt sich, haftet und müht sich im Eifer des Geschäftes eine Bevölkerung von siebzigtausend Einwohnern italienischer Abstammung, deren Sprechweise, welche auch diejenige Venedigs ist, sich in dem kosmopolitischen Sprachenconcerte aller dieser Seeleute, Kaufleute, Commis, Handwerker verliert, in dem Idiome, das aus dem Deutschen, Französischen, Englischen und Slavischen hervorgegangen zu sein scheint.
Wenn auch diese Neustadt eine reiche ist, so soll damit durchaus nicht gesagt sein, daß diejenigen, welche man dort in den Straßen sieht, auch sämmtlich vom Glück begünstigte Sterbliche sind.
Sarcany und Zirone schwiegen erstlich...
Nein! Selbst die Geschicktesten würden nicht mit den englischen, armenischen, griechischen, jüdischen Kaufleuten wetteifern können, die das Pflaster Triests beherrschen und deren prächtige Paläste der Hauptstadt des österreichisch-ungarischen Reiches zur Zierde gereichen würden.
Wer wollte die armen Teufel zählen, die sich vom frühen Morgen bis zum späten Abend dort in den vom Geschäftsverkehr erfüllten Avenuen umhertreiben, die von hohen, fest wie die Geldspinden verschlossenen Baulichkeiten eingefaßt sind, in denen wiederum Waaren jeder Gattung zur Schau liegen, wie es bei der von der Natur so äußerst begünstigten Lage dieses Freihafens am Ende des Adriatischen Meeres nicht anders sein kann! Wie viele von denen, die sich auf den Molen aufgepflanzt haben, wo aus den Schiffen der gewaltigsten Schiffsgesellschaft Europas, des österreichischen Lloyd, Massen von Reichthümern aus allen Theilen der Welt ausgeladen werden, haben nicht gefrühstückt und werden vielleicht nicht zu Mittag speisen! Wie viel Elende schließlich, wie sie sich auch zu Hunderten in London, Liverpool, Marseille, Havre, Antwerpen, Livorno finden, mischen sich unter die behäbigen Rheder in der Nachbarschaft der Arsenale, deren Betreten ihnen verboten ist, zeigen sich auf dem Platze der Börse, die ihnen nie ihre Thore öffnen wird, zu Füßen der Stufen des Tergesteums, woselbst die Bureaux des Lloyd und die Lesezimmer sich befinden, in denen die Gesellschaft in völliger Eintracht mit den Handelskammern ihr Leben fristet!
Unleugbar lebt in allen Hafenstädten der alten und neuen Welt eine ganz besondere Gattung von Unglücklichen, die nur diesen großen Mittelpunkten des Verkehrs eigenthümlich ist. Man weiß nicht, woher diese kommen; man hat keine Ahnung, woher sie der Wind geführt hat. Sie selbst wissen nicht, wo sie enden werden. Die Zahl derjenigen unter ihnen, die einst bessere Tage gesehen haben, ist eine beträchtliche. Es finden sich in ihren Reihen auch viele Ausländer. Die Eisenbahnen und die Handelsschiffe haben sie als überflüssige Ballaststücke zurückgelassen und nun belästigen sie das öffentliche Leben, aus dem die Polizei sie nicht mehr vertreiben kann.
Sarcany und Zirone verließen also den Molo, nachdem sie noch einen letzten Blick auf den Golf bis zum Leuchtthurme hin, der sich auf dem Vorgebirge von Santa Teresa erhebt, geworfen hatten; sie nahmen ihren Weg am Teatro Communale vorüber den Park entlang und gelangten auf die Piazza Grande, wo sie eine Viertelstunde hindurch um das aus Steinen des benachbarten Karstgebirges gebildete Bassin, am Fußende der Statue Karls VI. promenirten.
Beide wendeten sich alsdann nach links. Zirone blickte den Vorübergehenden gerade so ins Gesicht, als empfände er den lebhaften Wunsch, sie auszuplündern. Sie durchschritten darauf das ungeheure Quadrat des Tergesteums genau zu der Zeit, als die Börse zu Ende war.
»Die da ist bald eben so leer, wie die unsrige,« fühlte sich Zirone veranlaßt lachend zu sagen, trotzdem ihn gar keine Lachlust anwandelte.
Der gleichgiltige Sarcany schien auch durchaus nicht die Absicht zu haben, den schlechten Witz seines Gefährten verstehen zu wollen, der seine Glieder mit hungrigem Gähnen streckte.
Dann gingen sie über den dreigespitzten Platz, auf dem sich das bronzene Standbild des Kaisers Leopold I. erhebt. Ein Pfiff Zirone's – so ein echtes Bummlerpfeifen – veranlaßte ein Volk blauer Tauben in die Luft zu steigen, die unter dem Porticus der alten Börse hausen, gerade wie in Venedig die grauen Tauben zwischen den Procuratien des alten Marcusplatzes nisten. Nicht weit davon streckt sich der Corso aus, der das neue vom alten Triest trennt.
Er bildet eine breite, doch nicht gerade elegante Straße mit wohl ausgestatteten Läden und gleicht mehr der Regent-Street Londons und dem Broadway New-Yorks, als dem Boulevard des Italiens in Paris. Man sieht sehr viele Menschen dort, auch zieht sich eine ganz stattliche Reihe von Wagen von der Piazza Grande bis zur Piazza della Legna, Namen, die den italienischen Ursprung der Stadt genugsam verrathen.
Während Sarcany scheinbar jeder Versuchung sich verschlossen zeigte, konnte Zirone an keinem Laden vorüber, ohne einen begehrlichen Blick auf die Begünstigten zu werfen, welchen es ihre Mittel erlaubten, jene zu betreten. Es gab da viele Dinge, die ihnen gewiß zugesagt hätten, namentlich bei den Händlern mit Lebensmitteln und in den Wirthshäusern, wo das Bier in Strömen fließt, mehr als in jeder anderen Stadt der österreichischen Monarchie.
»Auf diesem Corso werden Durst und Hunger noch fühlbarer,« bemerkte der Sicilianer, dessen Sprache wie ein Geklapper dürren Holzes zwischen seinen ausgetrockneten Lippen klang.
Sarcany beantwortete diesen Einwand nur durch ein Zucken der Achseln.
Sie bogen in die erste Straße auf der linken Seite ein, gelangten an das Ufer des Canals und überschritten diesen auf dem Ponte Rosso – einer Drehbrücke; dann gingen sie die Quais wieder hinauf, an denen selbst Schiffe mit starkem Wassergange anlegen können. Dort wurden sie unendlich weniger von der Anziehungskraft der Auslagen der Krämer belästigt. Auf der Höhe der Kirche San Antonio angelangt, wendete sich Sarcany plötzlich nach rechts. Sein Genosse folgte ihm, ohne einen Einwand zu erheben. Sie gelangten wieder auf den Corso und streiften von dort abenteuernd durch die alte Stadt, in deren engen Straßen die Wagen vielfach nicht mehr vorwärts kommen, da die ersteren sich an den unteren Abhängen des Karstes hinaufziehen; jene sind auch meistens in einer Weise angelegt, daß man von der fürchterlichen Bora, dem heftigen eisigen Windstrome des Nordostens, nichts zu befürchten hat. In diesem alten Triest mußten sich Sarcany und Zirone – diese beiden Habenichtse – mehr zu Hause fühlen, als inmitten der wohlhabenden Viertel der Neustadt.
Hier wohnten sie auch seit ihrer Ankunft in der Hauptstadt Istriens in der Verborgenheit eines bescheidenen Gasthauses, nicht weit von der Kirche Santa Maria Maggiore. Da aber der bis dahin noch unbezahlte Hotelier in Folge des Anwachsens der Tagesrechnung etwas zudringlich geworden war, so vermieden sie dieses gefährliche Kap; sie überschritten den Platz und spazierten eine kurze Zeit hindurch um den Arco di Ricardo herum.
Auf die Dauer aber konnte sie das Studium dieser Ueberreste römischer Architektur nicht befriedigen. Da auch der Zufall ersichtlich zögerte, hier in diesen wenig belebten Straßen zu ihnen zu stoßen, so begannen sie, Einer hinter dem Anderen, die rauhen Fußwege hinaufzuklimmen, welche fast bis auf den Gipfel des Karstes zur Terrasse der Kathedrale führen.
»Eine ganz besondere Idee das, hier hinaufzuklettern,« murmelte Zirone und zog den Ueberrock am Gürtel fester zusammen.
Aber er verließ seinen jüngeren Gefährten trotzdem nicht, und man hätte von unten gut erkennen können, wie sie sich über die Stufen hinaufwanden, welche man zu Unrecht Straßen genannt hat und welche die Böschungen des Karstes zu Schanden machen. Zehn Minuten später erreichten sie, noch abgespannter und hungriger als zuvor, die Terrasse.
Von diesem Punkte genießt man einen prächtigen Ausblick über den Golf bis zum offenen Meere, auf den von ein- und ausfahrenden Fischerfahrzeugen, von gehenden und kommenden Dampfern und Handelsschiffen belebten Hafen; das Auge umspannt die ganze Stadt, die Vorstädte, die letzten, an den Hügel sich lehnenden Häuser, die auf den Höhen zerstreut umherliegenden Landhäuser.
Das Alles konnte jedoch unsere Abenteurer nicht reizen. Sie hatten schon genug andere Aussichten bewundert und überdies waren sie diesmal nur hinaufgestiegen um ihren Verdruß und ihr Elend hier spazieren zu führen! Zirone namentlich hätte ein Umherschlendern vor den kostbaren Läden des Corso vorgezogen. Da auch hier oben ihr Suchen dem Zufalle und seinen glückspendenden Gelegenheiten galt, so mußten sie sich auch hier, ohne zu große Ungeduld zeigen zu können, auf das Warten verlegen.
Am äußersten Ende des Stufenganges, der zur Terrasse führt, lag nahe der byzantinischen Kathedrale von San Giusto ein eingefriedeter Raum, der einst ein Kirchhof gewesen, jetzt zum Alterthumsmuseum geworden war. Es befanden sich dort keine Gräber mehr, sondern nur noch Bruchstücke von Grabsteinen; unter den tief herabhängenden Zweigen schöner Bäume ruhten römische Obelisken, mittelalterliche Gedächtnißsäulen, Ueberreste von Triglyphen und Metopen aus verschiedenen Zeitabschnitten der Renaissance, verglaste Cuben, in denen noch Aschenreste erkenntlich waren, durcheinander im Grase.
Das Thor, welches zu besagtem Raume führte, stand offen. Sarcany brauchte es nur zurückzustoßen. Er trat, gefolgt von Zirone, ein, der sich damit begnügte, folgendes melancholische Erzeugniß seines Nachdenkens laut werden zu lassen:
»Wenn wir die Absicht hätten, unser Leben zu enden, so wäre das hier ein passender Ort!
– Und wenn man es Dir vorschlagen würde? fragte Sarcany ironisch.
– So würde ich mich dessen weigern, lieber Kamerad! Man möge mir nur einen guten Tag unter zehn schlechten bereiten, mehr verlange ich nicht.
– Du wirst ihn erhalten und mehr noch.
– Mögen alle Heiligen Italiens Dich hören, und Gott weiß, daß man sie nach Hunderten zählt!
– Komme nur,« anwortete Sarcany.
Sie betraten eine halbkreisartig zwischen zwei Reihen von Urnen angelegte Allee und ließen sich auf eine große römische Einsatzrose nieder, welche sich nur wenig über den Boden erhob.
Sie schwiegen erstlich – was Sarcany ganz besonders behagte, kaum aber seinem Genossen. Zirone ergriff denn auch bald, nach einem ein- oder zweimaligen, schlecht unterdrückten Gähnen, das Wort und sagte:
»Gottes Blut! Dieser Zufall, auf den wir dummer Weise rechneten, beeilt sich wirklich nicht mit seinem Kommen!«
Sarcany schwieg.
»Was ist das für ein Einfall, fuhr Zirone unbeirrt fort, ihn hier inmitten dieser Ruinen suchen zu wollen? Ich fürchte nur zu sehr, daß wir auf falscher Fährte sind. Kamerad! Welcher Teufel könnte sich auch hier auf diesem alten Kirchhofe verpflichten? Nicht einmal die armen Seelen brauchen ihn, da sie ihre sterbliche Hülle bereits verlassen haben! Und wenn ich mich erst einmal dort unten befinden werde, so soll mich ein versäumtes Mittagbrot oder ein aussichtsloses Abendessen wenig kümmern! Komm', lass' uns weitergehen!«
Sarcany, der, in tiefes Nachdenken versanken, den Blick theilnahmslos in die Ferne gerichtet hatte, athmete kaum.
Zirone ließ einige Minuten verstreichen, dann aber konnte er seine angeborene Schwatzhaftigkeit nicht mehr zügeln:
»Sarcany, meinte er, weißt Du, in welcher Gestalt ich diesen Zufall, der heute ganz und gar seiner alten Kinder vergißt, am liebsten sehen möchte? In der Gestalt eines der Kassenboten des Hauses Toronthal; er müßte hierher kommen, mit einem von Banknoten strotzenden Portefeuille und uns dieses Portefeuille im Auftrage seines Banquiers übergeben mit tausend Entschuldigungen, daß er uns so lange habe warten lassen.
– Höre auf, Zirone! erwiderte Sarcany unter heftigem Zusammenziehen der Augenbrauen. Ich wiederhole Dir hiermit zum letzten Male, daß wir von Silas Toronthal nichts mehr zu erwarten haben.
– Bist Du Deiner Sache auch gewiß?
– Ja! Der Kredit, den ich bei ihm hatte, ist jetzt vollständig erschöpft, und auf meine letzten Bitten hat er mir eine endgiltige Absage ertheilt.
– Das ist schlimm!
– Sehr schlimm, aber es ist nun einmal so!
– Gut, fing Zirone von Neuem an. Wenn Dein Kredit erschöpft ist, so mußt Du unleugbar einen solchen besessen haben! Worauf beruhte denn dieser Kredit? Darauf, daß Du mehrere Male Deine Intelligenz und Deinen Eifer in den Dienst des Bankhauses bei einigen gewissen – delicaten Geschäften gestellt hast. Auch hat sich Toronthal während der ersten Monate unseres Aufenthaltes in Triest gerade nicht zu verschlossen im Punkte der Geldfrage gezeigt. Ich kann es also nicht glauben, daß Du nicht von irgend einer Seite her noch Einfluß auf ihn besitzen solltest, und wenn Du ihm drohtest...
– Wenn ich das könnte, hätte ich es schon gethan, antwortete Sarcany achselzuckend, und Du brauchtest nicht einem Mittagessen nachzujagen. Nein, ich schwöre es Dir, daß ich diesen Toronthal nicht in den Händen habe, aber es kann noch dahin kommen und an dem Tage soll er mir Kapital, Zinsen und Zinseszinsen von dem zahlen, dessen er sich heute weigert. Ich glaube übrigens, daß die Geschäfte seines Hauses augenblicklich ein wenig verwickelt liegen und daß seine Fonds in zweifelhafte Unternehmungen gesteckt sind. Die Nachwirkung einiger Fallissements in Deutschland, in Berlin und in München macht sich auch in Triest fühlbar und mir wollte es scheinen, was man auch immer sagen möge, daß Silas Toronthal bei meinem letzten Besuche in etwas gedrückter Stimmung sich befand Wir wollen die Fluth ruhig sich verlaufen lassen und wenn sie verlaufen sein wird...
– Schön, rief Zirone aus, bis dahin aber können wir nichts weiter als Wasser trinken. Sarcany, meine Meinung ist, daß Du noch einen letzten Versuch bei Toronthal machst. Man muß noch einmal an seine Geldkiste pochen und versuchen, wenigstens die Summe zu erhalten, die wir für eine Rückkehr nach Sicilien – über Malta benöthigen.
– Und was wollen wir in Sicilien?
– Das ist nun meine Sache. Ich kenne das Land und könnte auch eine Bande Malteser hinüberführen, entschlossene, vorurtheilslose Jungens, mit denen sich schon etwas anfangen ließe. Tausend Teufel! Wenn es hier nichts zu unternehmen gibt, so lass' uns abreisen und diesen verdammten Banquier zwingen, uns unsere Reisekosten zu bezahlen! So wenig Du auch aus ihm ziehen kannst, so viel wird es sein, daß er Dich lieber anderswo als in Triest weiß.«
Sarcany ließ den Kopf sinken.
»Ueberlege nur! So kann das nicht mehr weiter gehen! Wir sind am Ende angelangt,« setzte Zirone hinzu.
Er war aufgestanden und stampfte auf dem Boden umher, gerade als hätte er es mit einer Rabenmutter zu thun, die ihn nicht länger ernähren wollte.
In diesem Augenblicke wurde seine Aufmerksamkeit von einem Vogel abgelenkt, der außerhalb des umfriedeten Ortes ängstlich umherflatterte. Es war eine Taube, deren ermüdete Flügel kaum noch zuckten und die sich immer mehr gegen den Boden senkte.
Zirone fragte sich gewiß nicht, zu welcher der hundertsiebzig Gattungen Tauben, welche das ornithologische Namensverzeichniß jetzt kennt, dieser Vogel gehörte, er sah nur eines, daß es ein eßbarer Gegenstand war. Er verschlang ihn bereits mit den Blicken, nachdem er seinem Gefährten ein Zeichen mit der Hand gegeben.
Das Thier war ersichtlich am Ende seiner Kräfte angelangt. Es blieb schon an den Vorsprüngen der Kathedrale hängen, deren Façade von einem hohen
Die Taube fiel zu Boden.
viereckigen Thurme älteren Ursprunges flankirt wird. Es konnte nicht weiter, und zum Fallen geneigt, ließ es sich zuerst auf das Dach einer kleinen Nische nieder, welche das Bildniß des heiligen Justus schützt; seine ermüdeten Füße aber gaben ihm dort keinen Halt und so ließ es sich bis zum Capitäl einer antiken Säule niedergleiten, welche in die von dem Thurme und der Façade des Bauwerkes gebildete Ecke eingefügt war.
Triest. – Der Molo San Carlo.
Während Sarcany noch immer unbeweglich und schweigsam kaum sich damit beschäftigte, der Taube Aufmerksamkeit zu schenken, ließ sie Zirone nicht aus den Augen. Sie kam aus dem Norden. Ein weiter Flug hatte diesen Zustand der Erschöpfung verursacht. Ersichtlich führte sie ihr Instinct einem noch entfernteren Ziele zu. Sie nahm auch sogleich ihren Flug wieder auf; die Curve aber die sie ähnlich einer Flintenkugel beschrieb, nöthigte sie zu einer abermaligen Rast genau auf den niedrig hängenden Zweigen eines der Bäume des alten Kirchhofes.
Zirone war entschlossen, sich des Thieres zu bemächtigen und fast kriechend näherte er sich leise dem Baume. Bald hatte er die Basis eines knorrigen Baumstumpfes erreicht, von der aus er ohne Mühe bis zur Vergabelung gelangen konnte. Hier kauerte er unbeweglich stumm in der Haltung eines Hundes nieder, der einem über seinem Kopfe verborgenen Stück Wildpret auflauert.
Die Taube, welche ihn nicht bemerkt hatte, wollte von Neuem auffliegen; aber die Kräfte ließen sie wiederum im Stiche und wenige Schritte nur vom Baume entfernt fiel sie zu Boden.
Mit einem Sprunge vorwärts stürzen, den Arm ausstrecken und den Vogel in der Hand haben, war für den Sicilianer das Werk eines Augenblickes. Es war nur natürlich, daß er sich sofort anschickte, dem armen Thiere das Lebenslicht auszublasen, plötzlich aber hielt er inne; er stieß einen Ruf der Ueberraschung aus und kam dann in aller Eile zu Sarcany gelaufen.
»Eine Brieftaube! rief er.
– Was weiter? Eine, die ihre letzte Reise gemacht haben wird, meinte Sarcany.
– Zweifellos, gab Zirone zur Antwort. Um so schlimmer für die, denen das Billet, welches unter dem Flügel steckt, zukommen sollte.
– Ein Billet? fuhr Sarcany empor. Warte, Zirone, warte! Das verdient einen Aufschub.«
Und er hielt die Hand desselben fest, die sich bereits um den Hals des Thieres schloß. Dann nahm er das Beutelchen, das bereits von Zirone losgelöst worden war, öffnete es und zog ein chiffrirtes Billet hervor.
Es enthielt nur achtzehn Worte, die, wie folgt, auf drei senkrechte Zeilen vertheilt worden waren:
ihnalzzaemenruiopn
arnurotrvreemtqssl
odxhnpestleveeuart
aeeeilenniosnoupvg
spesdrerssurouitse
eedgnetoeedtartuee
Von einem Abgangs- und einem Bestimmungsort verlautete auf dem Zettel nichts. Würde es möglich sein, den Sinn der achtzehn, aus einer gleichen Anzahl von Buchstaben bestehenden Worte ohne Kenntniß des dazugehörigen Schlüssels zu enträthseln? Wenig Wahrscheinlichkeit war dafür vorhanden, wenigstens gehörte ein geschickter Dechiffreur dazu; es fehlte also wenig, daß das Billet sich als nicht entzifferbar erwies.
Sarcany stand vor dieser Geheimschrift, die ihn in nichts belehrte, zuerst sehr enttäuscht, dann sehr betroffen. Enthielt das Briefchen irgend eine wichtige Nachricht, vielleicht sehr bloßstellender Natur? Man konnte, ja man mußte es lediglich aus den Vorsichtsmaßregeln annehmen, die für den Fall getroffen waren, daß es in andere Hände als in diejenigen des Adressaten gelangen könnte und dann nicht gelesen werden dürfte. Ferner bewies die Benützung des außerordentlichen Instinctes der Brieftaube, und nicht die Benützung der Post oder des Telegraphendrahtes, daß es sich um eine Angelegenheit handelte, welche ein zuverlässiges Schweigen zur Bedingung machte.
»In diesen Zeilen ruht vielleicht ein Geheimniß, sagte Sarcany, welches unser Glück ausmachen kann.
– Dann wäre also, antwortete Zirone, diese Taube die Darstellerin des Zufalles, dem wir heute Vormittag lange genug nachgelaufen sind. Gottes Blut! Und ich wollte sie erwürgen!... Wie die Sache aber liegt, ist es das Wichtigste, daß wir den Boten haben und nichts soll uns daran hindern, uns diesen Boten schmecken zu lassen.
– Nur keine Uebereilung, Zirone, rief Sarcany, der so noch einmal dem Vogel das Leben rettete. Vielleicht besitzen wir in diesem Vogel eine Handhabe, die es uns ermöglicht, die Bekanntschaft mit dem Adressaten des Billets zu machen, vorausgesetzt natürlich, daß er in Triest wohnt.
– Und was dann? Jener wird Dir doch nicht erlauben, zu lesen, was dieser Brief enthält, Sarcany?
– Nein, Zirone.
– Wir wissen auch nicht, woher er stammt.
– Allerdings nicht. Aber wenn ich von zwei Leuten, die Briefe miteinander wechseln, einen kenne, so kann mir dieser Umstand behilflich sein, den zweiten kennen zu lernen. Mit einem Worte, ich glaube, man darf dieses Thier nicht tödten, sondern muß im Gegentheil ihm seine Kräfte wiedergeben, daß es an seinen Bestimmungsort gelangt.
– Mit dem Billet? fragte Zirone.
– Mit dem Billet, von dem ich aber zuvor eine genaue Abschrift nehmen werde; diese werde ich so lange bei mir behalten, bis die Gelegenheit gekommen sein wird, sie nutzbar zu machen.«
Sarcany zog ein Notizbuch aus seiner Tasche und copirte mit einem Bleistift das Schreiben. Da er wohl wußte, daß in den meisten Fällen die sichtbare Einordnung der Schriftzüge der Geheimschriften wohl bewahrt bleiben muß, so ließ er es sich angelegen sein, die Wortstellung genau nachzuahmen. Als das geschehen, behielt er die Abschrift in seinem Notizbuche, das Billet selbst steckte er wieder in den kleinen Sack und letzteren unter den Flügel der Taube.
Zirone sah ihm zu, er konnte indessen die Hoffnungen auf das Glück nicht theilen, welches dieser Vorfall herbeiführen sollte.
»Und was nun? fragte er.
– Jetzt, erwiderte Sarcany, lasse Deine Sorgfalt dem Boten angedeihen.«
Die Taube war mehr durch Hunger, als von der Ermüdung mitgenommen. Auch waren die Flügel unverletzt und zeigten weder einen Bruch noch eine Beschädigung; es bewies das also, daß ihre augenblickliche Schwäche nicht durch ein Schrotkorn eines Jägers oder durch den Steinwurf eines nichtsnutzigen Jungen veranlaßt worden war. Sie hatte Hunger und Durst, sonst fehlte ihr nichts.
Zirone sachte also und fand zu ebener Erde einige Körner, welche das Thier gierig verschluckte; mit fünf oder sechs Tropfen aus einer kleinen Wasseransammlung, welche der letzte Regenguß in einem Bruchstücke antiker Töpferarbeit zurückgelassen hatte, stillte es seinen Durst. Eine halbe Stunde nach ihrer Ergreifung war somit die gestärkte und ausgeruhte Taube im Stande, ihren unterbrochenen Flug wieder aufzunehmen.
»Wenn sie noch weit zu fliegen hat, ließ Sarcany sich hören, wenn ihre Bestimmung sie noch über Triest hinausführt, so geht es uns wenig an, ob sie unterwegs fällt; denn wir würden sie doch bald aus den Augen verlieren und können ihr unmöglich folgen. Wenn sie aber zu einem Triester Hause gehört, dort erwartet wird und daselbst sich niederlassen muß, so ist sie gekräftigt genug, um es erreichen zu können, denn sie hat bis dahin nur eine oder zwei Minuten zu fliegen.–
– Du hast vollständig recht, antwortete der Sicilianer. Aber werden wir auch bis dahin, wo sie ihren Schlag hat, blicken können, selbst wenn sie nur bis Triest und nicht weiter fliegt?
– Wir wollen wenigstens unser Möglichstes in dieser Hinsicht thun« meinte Sarcany gelassen.
Es geschah Folgendes:
Die aus zwei alten romanischen Kirchen bestehende Kathedrale, von denen die eine der heiligen Jungfrau, die andere dem Schutzpatrone von Triest, dem heiligen Justus geweiht ist, wird von einem hohen Thurme geschützt, der sich auf der Ecke jenes Theiles der Façade erhebt, in welcher sich die große Einsatzrose befindet; unterhalb dieser öffnet sich das Hauptthor des Gebäudes. Dieser Thurm beherrscht das Plateau des Karstes und die Stadt breitet sich unter ihm, wie eine in Relief gearbeitete Karte aus. Von diesem hochgelegenen Punkte aus übersieht man mit Leichtigkeit das Geviert ihrer Hausdächer, von den Abhängen des Hügels an bis zum Ufer des Golfes. Es war also nicht unmöglich, dem Fluge der Taube zu folgen, wenn man sie von der Spitze jenes Thurmes aus auffliegen ließ, und zweifellos, daß man das Haus auf dem sie sich dann niederließe, gut erkennen würde, vorausgesetzt eben, daß ihr Bestimmungsort Triest, und nicht eine andere Stadt der istrischen Halbinsel war.
Der Versuch mußte gelingen. Wenigstens verdiente er eine Probe. Es war vorläufig nichts weiter zu thun, als dem Thiere die Freiheit wiederzugeben.
Sarcany und Zirone verließen also den alten Kirchhof, überschritten den kleinen Platz vor der Kirche und wendeten sich dem Thurme zu. Eine der Spitzbogenthüren stand offen – zufällig diejenige, welche sich unter dem senkrecht unter der Nische des heiligen Justus befindlichen antiken Traufdache aufthut. Beide Männer traten ein und begannen die rohen Stufen der Wendeltreppe hinaufzusteigen, welche zu dem oberen Stockwerke führen.
Sie brauchten zwei bis drei Minuten, ehe sie den Ausblick erreichten, der sich unter dem Dache des Thurmes selbst befindet, da diesem eine äußere Gallerie fehlt. Hier oben sind auf jeder Seite des Thurmes zwei Fenster angebracht; sie geben dem Besucher die Möglichkeit, den Blick nach allen Seiten schweifen zu lassen, so weit der doppelte Horizont des Meeres und des Gebirges es gestattet.
Sarcany und Zirone postirten sich an dasjenige Fenster, welches in der Richtung nach Nordwest, direct auf Triest zu gelegen ist.
Die Uhr in dem alten Schlosse aus dem sechzehnten Jahrhundert, welches auf der Rückseite der Kathedrale den Karst krönt, schlug gerade die vierte Stunde. Es war also noch heller Tag. Inmitten einer klaren Luft sank die Sonne langsam zum Adriatischen Meere hinab und die meisten Häuser der Stadt wurden auf der Seite, die dem Thurme zugekehrt war, von ihren Strahlen übergossen.
Die Umstände lagen also so günstig als irgend möglich.
Sarcany nahm die Taube zwischen seine Hände, er ließ ihr edelmüthig noch eine letzte Liebkosung zu Theil werden und warf sie in die Luft.
Sie regte die Flügel, doch ließ sie sich zuerst pfeilschnell hinab, wohl aus Furcht, ein zu jäher Sturz könnte ihrem lustigen Botendienste ein Ende machen.
Ein lauter Aufschrei der Enttäuschung entfuhr dem sehr aufgeregten Sicilianer.
»Ha, sie erhebt sich wieder!« rief Sarcany.
Und in der That, die Taube begann in der unteren Luftschicht ihr Gleichgewicht wiederzufinden; sie schlug einen Haken und wandte sich in schräger Richtung dem nordwestlichen Theile der Stadt zu.
Sarcany und Zirone ließen sie nicht aus den Augen.
Der Flug des Thieres, welches von einem wunderbaren Instinct geleitet wurde, zeigte kein Schwanken. Man fühlte, daß sie dahin flog, wohin sie zu fliegen hatte, dorthin, wo sie schon vor einer Stunde eingetroffen wäre, wäre ihr nicht unter den Bäumen des alten Kirchhofes ein gezwungener Aufenthalt bereitet worden.
Sarcany und sein Genosse beobachteten die Taube mit einer fast ängstlichen Aufmerksamkeit. Sie fragten sich, ob sie wohl über die Mauern der Stadt hinaus fliegen würde, in welchem Falle ihr Vorhaben zu Wasser geworden wäre.
Sie hatten Glück.
»Ich sehe sie noch immer! rief Zirone, der ein ungemein scharfes Auge besaß.
– Wir müssen namentlich aufpassen, antwortete Sarcany, wo sie sich niederlassen wird, um danach die Lage der Dinge genau feststellen zu können.«
Einige Minuten nach ihrem Auffluge senkte sich die Taube auf ein Haus, dessen Giebel die anderen überragte. Es lag inmitten der Baumgruppe, in welcher sich auch das Hospital und der öffentliche Park befinden. Dort schlüpfte sie in ein Mansardenfenster, wie man deutlich erkennen konnte, über welchem eine Wetterfahne aus Schmiedeeisen sich drehte, die gewiß aus der Hand von Quentin Messys hervorgegangen wäre, wenn Triest in Flamland gelegen hätte.
Einen allgemeinen Ueberblick hatte man nun gewonnen, und es konnte nicht sehr schwer fallen, wenn man die leicht erkennbare Wetterfahne zum Ausgangspunkte der Operationen nahm, den Giebel aufzufinden, in welchem besagtes Mansardenfenster angebracht war, und somit das Haus, in welchem der Empfänger des Billets wohnte.
Sarcany und Zirone stiegen schnell hinunter; sie gingen durch die Abhänge des Karstes und einige kurze Straßen entlang, die sie zur Piazza della Legna brachten. Dort mußten sie sich weiter orientiren, um die Häusergruppe ausfindig machen zu können, aus der sich der östliche Stadttheil zusammensetzt.
Angelangt an dem Zusammenflusse der zwei größten Adern der Stadt, der Corsia Stadion, die zum öffentlichen Garten führt, und dem Acquedotto, einer schönen Baumallee, durch die man zu der großen Bierwirthschaft des Boschetto gelangt, waren unsere Abenteurer einen Augenblick im Zweifel, welche Richtung sie einschlagen sollten. Mußte man sich nach links oder rechts wenden? Instinctiv schlugen sie die Richtung nach rechts ein, mit der Absicht, die Häuser der Allee nach einander in Augenschein zu nehmen, deren Baumgipfel, wie sie bemerkt hatten, die Wetterfahne überragte.
Sie gingen also den Acquedotto entlang und beobachteten dabei genau die verschiedenen Häuser und Giebel, ohne indessen finden zu können, was sie suchten. So gelangten sie bis an das Ende der Allee.
»Da ist sie!« rief endlich Zirone.
Und er zeigte auf eine Wetterfahne, welche der Seewind um ihren eisernen Ständer drehte; unterhalb derselben war ein Dachfenster zu sehen, durch das einige Tauben ein und ausschlüpften.
Da war also kein Irrthum möglich. Dort war es gewesen, wo sich die Brieftaube niedergelassen hatte.
Das bescheiden aussehende Haus verlor sich hinter dem Baumschmucke des Acquedotto, der den Anziehungspunkt desselben bildet.
Sarcany zog in den benachbarten Läden einige Erkundigungen ein und hatte bald erfahren, was er wissen wollte.
Das Haus gehörte und wurde schon seit einer Reihe von Jahren bewohnt vom Grafen Ladislaus Zathmar.
»Wer ist der Graf Zathmar? fragte Zirone, dem dieser Name nichts bedeutete.
– Es ist eben der Graf Zathmar, erwiderte Sarcany.
– Wir könnten vielleicht fragen...
– Später, Zirone, nur nichts überstürzen. Nachdenken, Ruhe bewahren und jetzt in unsere Herberge.
– Ja... jetzt ist ja auch die Stunde gekommen, wo Diejenigen, welche das Recht dazu haben, sich zum Mittagessen hinsetzen, bemerkte Zirone mit Ironie.
Sarcany und Zirone ließen sie nicht aus den Augen.
– Wenn wir auch heute nicht zu Mittag essen, antwortete Sarcany, so werden wir vielleicht morgen diniren
– Bei wem?
– Wer weiß, Zirone? Vielleicht beim Grafen Zathmar.«
Sie schlenderten langsam dahin – wozu auch eilen? – und hatten bald ihr bescheidenes Hotel erreicht, das trotzdem noch zu kostbar für sie war, denn sie konnten ja nicht einmal ihr Nachtquartier bezahlen.
Zweites Capitel. Graf Mathias Sandorf.
Die Ungarn oder Magyaren kamen gegen das neunte Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung ins Land. Sie bilden noch den dritten Theil der ganzen Bevölkerung Ungarns – mehr als fünf Millionen Seelen. Ob sie nun spanischen Ursprunges sind, ägyptischen oder barbarischen, ob sie von den Hunnen Attilas stammen oder von den nordischen Finnen – die Meinungen stehen sich schroff gegenüber – es thut wenig zur Sache. Zu beachten ist nur, daß die Ungarn keine Slaven sind, aber auch keine Deutschen.
Sie haben auch ihre Religion zu erhalten gewußt und sich seit dem elften Jahrhunderte als eifrige Katholiken gezeigt – damals empfingen sie den neuen Glauben. Sie sprechen auch noch ihre alte Sprache, die sanfte, harmoniereiche Muttersprache, die jeden Gegenstand mit den Reizen der Poesie schmückt; sie ist nicht so reich als die deutsche, aber geschlossener, energischer, eine Sprache, die vom vierzehnten bis zum sechzehnten Jahrhundert das Latein in den Gesetzen und Verordnungen verdrängte und eine Zukunft als Sprache des Volkes vor sich sah.
Am 21. Jänner 1699 kam Ungarn und Siebenbürgen durch den Vertrag von Carlowitz an Oesterreich.
Zwanzig Jahre später erklärte die pragmatische Sanction feierlich, daß die Staaten Oesterreich-Ungarn unzertrennlich seien. In Ermangelung eines Sohnes sollte die Krone auch auf die Tochter übergehen können, nach dem Gesetze der Primogenitur. Dank diesem neuen Statute bestieg Maria Theresia im Jahre 1740 den Thron ihres Vaters Karl VI, des letzten Sprossen der männlichen Linie des Hauses Oesterreich.
Die Ungarn mußten sich der Gewalt fügen.
Zu der Zeit, in welcher unsere Erzählung anhebt, gab es einen hochgeborenen Ungarn, dessen Leben nur der Hoffnung galt, seinem Lande die einstige Selbständigkeit wiederzugeben. Er hatte in seiner Jugend noch Kossuth gekannt und obwohl seine Abstammung und seine Erziehung ihn hinderten, in wichtigen politischen Fragen mit diesem denselben Strang zu ziehen, so hatte er dennoch das große Herz dieses Vaterlandsfreundes bewundern müssen.
Der Graf Mathias Sandorf bewohnte in einem der Comitate Siebenbürgens, im District von Fogaras, ein altes Schloß feudalen Ursprunges. Dieses Schloß, auf einer der nördlichen Spitzen der östlichen Karpathen errichtet, welche Siebenbürgen von der Walachei trennen, erhob sich auf dieser zerklüfteten Gebirgskette in seiner ganzen wilden Schönheit, wie einer solcher letzten Zufluchtsorte, in denen sich Verschworene bis zum Aeußersten halten können.
Benachbarte Minen, deren Gehalte an Eisen und Kupfererzen sorgfältig ausgebeutet wurden, bildeten für den Besitzer des Schlosses Artenak eine sehr bedeutende Einnahmequelle. Diese Domäne umfaßte einen Theil des Districtes von Fogaras, dessen gesammte Bevölkerung sich auf wenigstens zweiundsiebzigtausend Einwohner beläuft. Diese Städter und Bauern machten kein Hehl daraus, daß sie dem Grafen wandellos treu ergeben waren; für die Wohlthaten, die er dem Lande erwiesen, dankten sie ihm mit grenzenloser Anhänglichkeit. Daher war dieses Schloß der Gegenstand einer ganz besonderen Ueberwachung, welche von der ungarischen Kanzlei in Wien, die völlig unabhängig von den anderen Ministerien des Reiches arbeitet, in Scene gesetzt worden war. Man kannte hohen Ortes die Ansichten des Herrn von Artenak und fühlte sich dieserhalb beunruhigt, wenn nicht gar wegen der Persönlichkeit des Grafen selbst.
Mathias Sandorf war damals fünfunddreißig Jahre alt. Seine Figur, die etwas über das Durchschnittsmaß hinausging, verrieth eine bedeutende Muskelstärke. Auf breiten Schultern ruhte ein Kopf mit einer edlen und stolzen Haltung. Das etwas eckige Gesicht, dessen Farbe eine warm angehauchte war, zeigte den magyarischen Typus in voller Reinheit. Die Lebhaftigkeit seiner Bewegungen, die Knappheit seiner Rede, der feste und gemessene Blick seines Auges, die lebendige Circulation seines Blutes, welche sich den Nasenflügeln mittheilte, ein schwaches Zucken in den Mundwinkeln, ein gewohnheitsmäßiges Lächeln auf den Lippen, das untrügliche Zeichen von Güte, eine gewisse Aufgeräumtheit im Gespräche und in den Geberden – alles das kündete eine freimüthige und hochherzige Natur an.
Einer der hervorragendsten Charakterzüge des Grafen Sandorf war, daß er noch nie eine Beleidigung verziehen hatte und nie eine solche verzeihen konnte, welcher seine Freunde zum Opfer fielen, während er sich um seiner selbst willen sehr unbesorgt zeigte und bei Gelegenheit sogar zu einem ihm zugefügten Unrecht gute Miene zu machen im Stande war. Er besaß einen in hohem Grade entwickelten Gerechtigkeitssinn und haßte jede Treulosigkeit. Daraus entsprang bei ihm eine persönliche Unversöhnlichkeit. Er gehörte durchaus nicht zu denen, welche Gott allein die Sorge überlassen, die Strafen in dieser Welt auszutheilen.
Es muß hier betont werden, daß Mathias Sandorf eine sehr ernste Erziehung genossen hatte. Anstatt der ihm durch sein Vermögen gebotenen Muße zu fröhnen, war er seinen Liebhabereien gefolgt, die ihn zum Studium der physikalischen und medicinischen Wissenschaften führten. Er wäre ein sehr talentirter Arzt geworden, wenn die Nothwendigkeit, davon leben zu müssen, ihm Kranke in die Behandlung gegeben hätte. Er begnügte sich daher damit, ein von den Gelehrten sehr geschätzter Chemiker zu sein. Die Pester Universität, die Akademie der Wissenschaften in Preßburg, die königliche Bergbauakademie in Schemnitz, die Normalschule in Temesvar hatten ihn nacheinander zu ihren begabtesten Schülern gezählt. Dieses vom Studium erfüllte Leben vervollständigte und bestärkte seine natürlichen Anlagen. Es machte aus ihm einen Mann in der weitgehendsten Bedeutung des Wortes. Als ein solcher wurde er auch von allen denjenigen betrachtet, die ihn kannten, und ganz besonders von seinen Professoren an den verschiedenen Schulen und Universitäten des Königreiches, welche seine Freunde geblieben waren.
Einst herrschten im Schlosse von Artenak Heiterkeit, Leben und Bewegung. Auf dem rauhen Bergrücken dort gaben sich die Jäger Siebenbürgens gern ein Stelldichein. Große und gefährliche Treibjagden wurden dort abgehalten, bei welchen die nach Kampf lüsternen Instincte des Grafen ihre vollkommene Befriedigung fanden, denn auf dem Felde der Politik hatten sie voraussichtlich keine Uebung zu erwarten. Er hielt sich bei Seite und betrachtete nahebei den Verlauf der Dinge. Er schien sich nur um sich selbst zu kümmern, seine Aufmerksamkeit zwischen seinen Studien und jenem Leben auf großem Fuße zu theilen, welches ihm sein stattliches Vermögen zu führen erlaubte.
Damals lebte Gräfin Réna Sandorf noch. Sie war die Seele aller gesellschaftlichen Vereinigungen auf Schloß Artenak. Fünfzehn Monate vor Beginn unserer Geschichte jedoch hatte sie der Tod in voller Jugend und Schönheit dahingerafft; dem Grafen war nur ein kleines Töchterchen geblieben, das jetzt zwei Jahre zählte.
Graf Sandorf traf dieser Schicksalsschlag furchtbar. Lange Zeit hindurch blieb er jedem Troste verschlossen. Im Schlosse wurde es still und einsam. Sein Herr lebte dort unter dem Eindrucke des tiefen Schmerzes wie in einem Kloster. Seine ganze Sorge galt seinem Kinde, welches den Händen der Frau des gräflichen Intendanten, Rosena Landeck, anvertraut wurde. Dieses noch junge, vortreffliche Geschöpf widmete sich ausschließlich dem Dienste der einzigen Erbin der Sandorf's, ihre Bemühungen glichen denen einer zweiten Mutter.
Während der ersten Monate seiner Witwerschaft verließ Graf Sandorf Schloß Artenak nicht. Er schöpfte Sammlung aus den Erinnerungen an die Vergangenheit und lebte von diesen. Dann gewann der Gedanke an die untergeordnete Stellung seines Vaterlandes in Europa in ihm die Oberhand.
Der französisch-italienische Krieg von 1859 hatte der österreichischen Macht einen heftigen Stoß versetzt.
Dieses Unglück wurde nach sieben Jahren, 1866, noch durch die Niederlage von Sadowa vermehrt. An dieses Oesterreich, welches seine italienischen Besitzungen verloren hatte, an dieses von zwei Seiten besiegte Oesterreich sah sich Ungarn noch gefesselt. Die Siege von Custozza und Lissa hatten in den Augen der Ungarn die Schlappe von Sadowa nicht zu tilgen vermocht.
Graf Sandorf hatte während des folgenden Jahres sorgfältig das politische Terrain gemustert und erkannt, daß eine auf Theilung des Reiches gerichtete Bewegung vielleicht gelingen könnte.
Der Augenblick zum Handeln war also gekommen. Am 3. Mai desselben Jahres, 1867, hatte er sein Töchterchen umarmt, es der sorgsamen Pflege von Frau Rosena Landeck überantwortet und sein Schloß Artenak verlassen. Er war nach Pest gereist woselbst er sich mit Freunden und Parteigenossen in Verbindung setzte und vorbereitende Verfügungen traf; einige Tage später war er in Triest eingetroffen, um daselbst die Ereignisse abzuwarten.
Hier sollte sich die Centralstelle der Verschwörung befinden. Von hier sollten alle Fäden, welche sämmtlich Graf Sandorf in der Hand hatte, auslaufen. In dieser Stadt konnten die Führer der Verschwörung, vielleicht weil sie weniger beobachtet wurden, mit größerer Sicherheit arbeiten, jedenfalls aber mit mehr Freiheit, um dieses patriotische Werk zu einem glücklichen Ende zu führen.
In Triest lebten zwei der intimsten Freunde des Grafen. Von demselben Gedanken erfüllt, waren sie entschlossen, dieser Unternehmung bis zum Ende treu zu bleiben. Graf Ladislaus Zathmar und Professor Stephan Bathory waren ebenfalls Ungarn und von vornehmer Abkunft. Beide, wohl zehn Jahre älter als der Graf, standen vermögenslos da. Der Eine bezog einige dürftige Einkünfte aus einem kleinen Landgute im Comitate von Liptó, das zum Kreise jenseits der Donau gehört; der Andere lehrte Physik in Triest und lebte nur von dem Ertrage des ertheilten Unterrichtes.
Ladislaus Zathmar bewohnte das von Sarcany und Zirone entdeckte Haus im Acquedotto, ein bescheidenes Heim, welches er dem Grafen Mathias Sandorf zur freien Verfügung gestellt hatte während der ganzen Zeit, welche dieser fern von seinem Schlosse Artenak zubringen würde, das heißt also, bis zum Ende der beschlossenen Bewegung, wie immer diese auch ausfallen würde. Ein fünfundfünfzigjähriger Ungar, Namens Borik, stellte das gesammte Hauspersonal vor. Er war ein Mann, der seinem Herrn ebenso ergeben war, wie der Intendant Landeck dem Grafen Sandorf.
Stephan Bathory hatte eine nicht weniger bescheidene Wohnung in der Corsia Stadion inne, also fast in demselben Stadttheile wie Graf Zathmar. Sein ganzes Interesse drehte sich um seine Frau und seinen Sohn Peter, der damals acht Jahre alt war.
Bathory gehörte zwar nicht in gerader Linie, jedoch nachweislich zu dem Stamme jener magyarischen Fürsten, welche im sechzehnten Jahrhunderte den Thron Siebenbürgens innehatten. Die Familie hatte sich gespalten und seit jener Zeit in zahlreiche Abzweigungen verloren, und man wäre sicherlich erstaunt gewesen, einen der letzten Abkömmlinge in einem bescheidenen Professor der Preßburger Akademie wiederzufinden. Davon ganz abgesehen, war Stephan Bathory ein Gelehrter ersten Ranges, einer von denen, die in der Zurückgezogenheit leben und durch ihre Arbeiten berühmt werden »Inclusum labor illustrat«, diese Devise, die man dem Seidenwurm ertheilt, hätte auch die seinige sein können. Eines Tages zwangen ihn seine politischen Ansichten, aus denen er kein Hehl machte, seine Entlassung zu fordern, und damals war es, als er sich in Triest als unabhängiger Professor mit seiner Frau niederließ, welche ihm in seinen Prüfungen wacker zur Seite gestanden war.
In der Behausung von Ladislaus Zathmar vereinigten sich seit der Ankunft des Grafen Sandorf die drei Freunde, obgleich der Letztere absichtlich darauf bestanden hatte, eine Wohnung im Palazzo Modello – oder richtiger Hôtel Delorme – auf der Piazza Grande für sich zu miethen. Die Polizei hatte keine Ahnung davon, daß das Haus im Acquedotto die Centralstelle einer Verschwörung war, welche zahlreiche Anhänger in den größten Städten des Reiches hatte.
Ladislaus Zathmar und Stephan Bathory hatten sich ohne Bedenken zu ergebenen Bundesgenossen des Grafen Sandorf bekannt. Sie hatten ebenso, wie er, eingesehen, daß die Umstände sehr wohl einer Bewegung dienlich sein könnten, welche Ungarn die Machtstellung in Europa wiedergeben würde, die es ehrgeizig für sich erstrebte. Dieser Plan kostete sie vielleicht ihr Leben, das wußten sie wohl, doch ließen sie sich deshalb von ihrem Vorhaben nicht abhalten. Das Haus im Acquedotto wurde also der Sammelplatz der hervorragendsten Führer der Verschwörung. Eine große Zahl von Parteigängern, aus den verschiedensten Theilen des Landes hierher entboten, holten sich von hier ihre Befehle. Ein Brieftaubendienst, der zur Ueberbringung von Mittheilungen eingerichtet wurde, stellte eine schnelle und sichere Verbindung zwischen Triest und den bedeutendsten Städten Ungarns und Siebenbürgens her, als es sich um Unterweisungen zu handeln begann, welche weder der Post noch dem Telegraphen anvertraut werden durften. Kurz die Vorsichtsmaßregeln waren so vorzüglich getroffen, daß auf die Verschwörer bis dahin auch nicht der geringste Verdacht gefallen war.
Uebrigens wurde auch, wie man weiß, die Correspondenz nur in chiffrirter Sprache geführt, und zwar nach einer Methode, die, weil sie Geheimhaltung erforderte, eine unbedingte Sicherheit gewährte.
Drei Tage nach der Ankunft jener Brieftaube, deren Billet von Sarcany aufgefangen war, am 21. Mai, gegen acht Uhr Abends, befanden sich Ladislaus Zathmar und Stephan Bathory im Arbeitscabinet in der Erwartung der Rückkehr von Mathias Sandorf. Seine persönlichen Angelegenheiten hatten ihn jüngst genöthigt, nach Siebenbürgen und auf sein Schloß Artenak zurückzukehren; die Reise war ihm aber insofern von Nutzen, als sie ihm ermöglichte, mit seinen Freunden in Klausenburg, der Hauptstadt der Provinz, conferiren zu können, und nun sollte er am besagten Tage von dort wieder eintreffen, nachdem er jenen den Inhalt der Depesche mitgetheilt, von der Sarcany eine Abschrift genommen hatte.
Seit der Abreise des Grafen Sandorf waren noch andere Briefe zwischen Triest und Budapest ausgetauscht, auch waren mehrere chiffrirte Billets durch Tauben überbracht worden. Gerade in diesem Augenblicke beschäftigte sich Ladislaus Zathmar damit, die Geheimschrift mit derjenigen Einrichtung in verständliche Worte zu bringen, die unter Bezeichnung der »Gitter« bekannt ist.
Ladislaus Zathmar und Stephan Bathory befanden sich im Arbeitscabinet.
Diese Depeschen waren in Wahrheit nach einem sehr einfachen System erdacht worden, nach demjenigen der Buchstabenumstellung. In diesem System behält jeder Buchstabe seinen alphabetischen Werth, b bedeutet also auch b, o heißt o und so fort. Aber die Buchstaben werden der Reihe nach umgestellt gemäß den leeren oder besetzten Feldern des Gitters, welches, auf die Depesche gelegt, die Buchstaben nur in der Reihenfolge erscheinen läßt, nach der sie zu
Unsere Parteigänger sind in der Majorität.
lesen sind und die übrigen verdeckt. Diese Gitter sind schon vor Alters angewendet, doch neuerdings nach dem System des Oberst Fleißner sehr vervollständigt worden; sie gelten bis jetzt noch als das beste und sicherste Verfahren, wenn es sich darum handelt, eine unentzifferbare Geheimschrift zu erhalten. Alle anderen Umkehrungsmethoden – gleichviel, ob es Systeme mit unveränderlicher Basis oder einfache Schlüsselsysteme sind, bei welchen jeder Buchstabe des Alphabets stets durch denselben Buchstaben oder durch dasselbe Zeichen angedeutet wird oder Systeme mit veränderlicher Basis oder doppelte Schlüsselsysteme, bei denen man bei jedem Buchstaben mit dem Alphabete wechselt – gewähren keine ausschließliche Sicherheit. Einzelne geübte Entzifferer sind im Stande, in dieser Art von Ermittlungen dadurch Wunderdinge zu leisten, daß sie mit einer Wahrscheinlichkeitsberechnung oder einem bloßen Umhertappen operiren. Sie stützen sich auf nichts weiter als auf die Buchstaben, deren häufigerer Gebrauch auch ein zahlreicheres Vorkommen in der Gesammtheit bedingt – e in der französischen, englischen und deutschen, o in der spanischen, a in der russischen, e und i in der italienischen Sprache – und kommen so dahin, den Buchstaben im chiffrirten Texte die Bedeutung unterzulegen, welche sie in dem übertragenen Wortlaute haben. Es gibt wenige, nach diesen Methoden chiffrirte Depeschen, welche ihren klugen Berechnungen sich verschließen können.
Es scheint doch, daß die Gitter oder die chiffrirten Wörterbücher – das heißt also solche, in denen gewisse gebräuchliche Worte, welche geschlossene Redensarten bedeuten, durch Zahlen angegeben werden – die vollkommensten Garantien für die Unmöglichkeit der Entzifferung bieten. Aber diese beiden Systeme haben einen bedenklichen Nachtheil: sie erfordern ein absolutes Geheimhalten oder vielmehr die Verpflichtung, wo man auch immer sein möge, niemals in die Hände Fremder die Zurichtungen oder Bücher fallen zu lassen, welche zu ihrer Herstellung dienen. Während man ohne Gitter oder Wörterbuch nie dahin kommen kann, diese Depeschen zu lesen, ist alle Welt im Stande, sie zu verstehen, sobald das Wörterbuch oder das Gitter gestohlen worden ist.
Mit Hilfe eines Gitters also, beziehungsweise eines Ausschnittes aus Pappe, welcher an mehreren Stellen durchlöchert war, wurden die Correspondenzen des Grafen Sandorf und seiner Genossen hergestellt; durch ein Uebermaß von Vorsicht aber konnten ihnen selbst dann keine Unannehmlichkeiten entstehen, wenn die Gitter, welche er und seine Freunde benützten, verloren gingen oder gestohlen wurden; denn jede Depesche wurde sofort, nachdem sie der eine oder der andere Theil gelesen, vernichtet. Es konnte also niemals eine Spur dieses Complottes zurückbleiben, für welches die edelsten Herren, die Magnaten Ungarns, zugleich mit den Vertretern der Bürgerschaft und des Volkes ihren Kopf einsetzten.
Gerade als Ladislaus Zathmar die letzten Depeschen verbrennen wollte, wurde leise an der Thüre des Cabinets geklopft.
Borik war es, der den Grafen Sandorf hereinführte, welcher zu Fuß vom nahen Bahnhofe gekommen war.
Ladislaus Zathmar eilte sofort auf ihn zu:
»Der Erfolg Ihrer Reise, Mathias? fragte er mit der Hast eines Mannes der vor allen Dingen beruhigt sein will.
– Sie ist geglückt, Zathmar, antwortete Graf Sandorf. Ich konnte nicht an den Gesinnungen meiner siebenbürgischen Freunde zweifeln und wir dürfen uns ihrer Hilfe versichert halten.
– Hast Du ihnen den Inhalt der uns vor drei Tagen aus Budapest zugegangenen Depesche mitgetheilt? ergriff Bathory das Wort, dessen Freundschaft mit dem Grafen sich bis auf die vertrauliche Anrede erstreckte.
– Ja, Stephan, sie sind unterrichtet. Sie sind auch bereit. Beim ersten Signal brechen sie los. Innerhalb zweier Stunden sind wir die Herren von Budapest, in einem halben Tage die Herren der größten Comitate diesseits und jenseits der Theiß, in einem Tage ist Siebenbürgen und der Bereich der Militärgrenze unser. Dann werden acht Millionen Ungarn ihre Unabhängigkeit wiedergewonnen haben!
– Und die Regierung? fragte Bathory.
– Unsere Parteigänger sind in der Majorität, antwortete Mathias Sandorf. Sie werden auch die neue Regierung bilden, welche die Leitung der Geschäfte in die Hand nehmen wird. Alles wird regelrecht und ohne Schwierigkeiten von statten gehen, da die Comitate, was ihre Verwaltung anbelangt, kaum von der Krone abhängen und ihre Chefs die Polizeigewalt besitzen.
– Aber der stellvertretende Rath des Königreiches, welchem der Paladin in Budapest vorsteht...? warf Ladislaus Zathmar ein.
– Dem Paladin und dem Rath wird die Möglichkeit genommen, einzuschreiten...
– Und auch die Möglichkeit, mit der ungarischen Kanzlei in Wien zu correspondiren?
– Ja! Alle Maßregeln sind so getroffen, daß durch die Gleichzeitigkeit unserer Bewegungen auch der Erfolg gesichert wird.
– Der Erfolg! rief Stephan Bathory.
– Ja, der Erfolg! erwiderte Graf Sandorf. In der Armee ist alles, was unseren Blutes, ungarischen Blutes ist, für uns! Wo gibt es einen Abkömmling der alten Magyaren, dessen Herz nicht höher schlägt beim Anblicke der Fahne Rudolf's und Corvin's?«
Mathias Sandorf sprach diese Worte mit dem Tone edelster Begeisterung.
»Aber bis dahin, fuhr er fort, wollen wir nichts vernachlässigen, um jeden Verdacht zu vermeiden. Seien wir klug, um so stärker werden wir sein! – Habt Ihr in Triest nichts Verdächtiges gehört?
– Nein, erwiderte Ladislaus Zathmar. Man redet hier ausschließlich von den Arbeiten, welche der Staat in Pola ausführen läßt.«
Seit fünfzehn Jahren bereits hatte die österreichische Regierung in der Befürchtung eines möglichen Verlustes von Venetien – der in der That eingetreten ist – die Absicht, in Pola, also am südlichsten Ende Istriens, ungeheure Arsenale und einen Kriegshafen anlegen zu lassen, um von hier aus den ganzen inneren Theil der Adria beherrschen zu können. Trotz der Einwände von Triest, dessen Hafen durch dieses Project minderwerthig wurde, wurden die Arbeiten mit einer fieberhaften Hast weitergeführt. Mathias Sandorf und seine Freunde konnten also annehmen, daß die Triestiner geneigt sein würden, ihnen zu folgen, im Falle die Trennungsbewegung sich bis zu ihnen erstrecken sollte.
Das Geheimniß dieser Verschwörung zu Gunsten der ungarischen Selbstständigkeit war jedenfalls gut gehütet. Nichts konnte bei der Polizei Verdacht rege machen, daß die vornehmsten Verschworenen sich in dem bescheidenen Hause der Acquedotto-Allee vereinigten.
Es schien also, als ob alles vorgesehen war, um die Bewegung gelingen zu lassen und als gälte es, nur noch den passenden Augenblick zum Handeln abzuwarten. Die chiffrirte Correspondenz zwischen Triest und den Großstädten Ungarns und Siebenbürgens wurde voraussichtlich von nun an sehr selten oder gar nicht geführt, falls nicht unvorhergesehene Ereignisse eintreten würden. Die gefiederten Boten hatten wahrscheinlich für die Folge keine Depeschen mehr zu überbringen, da die letzten Maßregeln vereinbart worden waren. Im Uebermaße von Vorsicht hatte man noch vorsorglicher Weise ihren Zufluchtsort im Hause Zathmar's verschlossen.–
Es muß noch bemerkt werden, daß das Geld ebenso der Lebensnerv der Verschwörungen, wie derjenige der Kriege ist. Es ist von Wichtigkeit, daß es den Verschwörern in der Stunde der Erhebung nicht fehlt. Bei dieser Gelegenheit konnte es unsre Bekannten nicht im Stiche lassen.
Wir wissen, daß Ladislaus Zathmar und Stephan Bathory wohl ihr Leben der Unabhängigkeit ihres Landes zum Opfer bringen konnten, aber nicht ihr Vermögen, weil sie nur sehr schwache persönliche Einnahmequellen besaßen. Graf Sandorf aber war ungeheuer reich und bereit, zugleich mit seinem Leben sein ganzes Hab und Gut für die Bedürfnisse seiner Sache zu opfern. Er hatte bereits vor einigen Monaten, durch Vermittlung seines Intendanten Landeck eine beträchtliche Summe als Anleihe auf seine Besitzungen aufgebracht – mehr als zwei Millionen Gulden.
Es war indessen nothwendig, daß diese Summe stets zur Verfügung gehalten wurde und daß er sie von einem Tage zum andern in Empfang nehmen konnte. Deshalb war sie in Triest auf seinen Namen hinterlegt worden bei einem Bankhause, dessen Ehrenhaftigkeit und Solidität, bis zur Stunde unangetastet, über jeden Zweifel erhaben waren. Dieses Haus war dasjenige des Banquiers Toronthal, von welchem Sarcany und Zirone bei ihrer Rast auf dem Kirchhofe der oberen Stadt gerade gesprochen hatten.
Dieser zufällige Umstand sollte bedenkliche Folgen nach sich ziehen, wie man aus dem Verlaufe dieser Geschichte sehen wird.
Auf eindringliches Fragen des Grafen Zathmar und Stephan Bathory's nach diesem Gelde gelegentlich ihrer jüngsten Unterredung antwortete ihnen Mathias Sandorf, daß er beabsichtige, in aller Kürze dem Banquier Silas Toronthal einen Besuch abzustatten und diesen zu ersuchen, ihm seine Fonds in kürzester Frist zur Verfügung halten zu wollen.
Gewisse Ereignisse schienen wirklich Graf Sandorf bald veranlassen zu sollen, das erwartete Signal von Triest aus zu geben, um so eher, als man annehmen durfte, daß das Haus Zathmar's an jenem Abende der Gegenstand einer Ueberwachung gewesen war, welche beunruhigen konnte.
Als Graf Sandorf und Stephan Bathory gegen acht Uhr fortgingen, der eine, um seine Wohnung in der Corsia Stadion, der andere, um das Hotel Delorme aufzusuchen, glaubten sie zwei Männer im Dunkel der Bäume zu bemerken, die ihnen in kurzer Entfernung folgten und so manövrirten, daß sie möglichst nicht gesehen wurden.
Drittes Capitel. Das Haus Toronthal.
Das gesellschaftliche Leben ist in Triest gleich Null. Die Verschiedenheit der Rassen und der Stände machen es, daß man sich gegenseitig wenig sieht. Die österreichischen Beamten möchten je nach der Stellung, die sie im amtlichen Leben bekleiden, die erste Rolle spielen. Es sind dies durchschnittlich achtbare, wohlunterrichtete, wohlwollende Leute, aber ihr Gehalt ist ein knapper und ihrer Stellung nicht entsprechend; sie können daher mit den Kaufleuten und Finanzmännern nicht wetteifern. Da man in den reichen Familien nur selten empfängt und die officiellen Vereinigungen fast stets verunglücken, so haben sich die ersteren genöthigt gesehen, den äußeren Luxus zu pflegen, in den Straßen der Stadt in Gestalt von prächtigen Equipagen, im Theater durch kostbare Toiletten und verschwenderischen Aufwand von Brillanten, den ihre Frauen in den Logen des Teatro Communale oder der Armonia zur Schau tragen.
Zu diesen wohlhabenden Familien gehörte zu jener Zeit auch die des Banquiers Silas Toronthal.
Der Chef dieses Hauses, dessen Ansehen sich über Oesterreich-Ungarn hinaus erstreckte, war damals siebenunddreißig Jahre alt. Er bewohnte mit seiner noch um einige Jahre jüngeren Gattin ein Palais in der Allee des Acquedotto.
Silas Toronthal galt für sehr reich und er mußte es sein. Kühne und glückliche Speculationen an der Börse, eine rege Geschäftsverbindung mit dem österreichischen Lloyd und anderen großen Häusern, wichtige Anleihen, deren Emissionen ihm anvertraut waren, mußten viel Geld in seinen Kassen zurückgelassen haben. Hieraus entstammte auch die Großartigkeit des Hausstandes, die viel von sich reden machte.
Trotzdem war es möglich, wie wir es schon Sarcany zu Zirone sagen hörten, daß die Geschäfte von Silas Toronthal dazumal ein wenig verwickelt lagen – wenigstens für den Augenblick. Es mochte das daher rühren, daß er vor sieben Jahren den Rückschlag auszuhalten gehabt hatte, den die Unruhen des französisch-italienischen Krieges der Bank und der Börse beibrachten, dann in neuerer Zeit hatte ihn der Niedergang der öffentlichen Fonds auf den ersten Bankplätzen, besonders auf denen Oesterreich-Ungarns, Wien, Budapest, Triest, eine Folge des Feldzuges, dem Sadowa ein Ende machte, ernsthafte Prüfungen durchmachen lassen. Zweifellos hatte auch die Verpflichtung, die bei ihm in baaren Geldern hinterlegten Summen zurückzahlen zu müssen, ihm bedenkliche Verlegenheiten bereitet. Aber eben so gewiß war, daß er sich von dieser Krisis wieder erholt hatte, und wenn es wahr war, was Sarcany sagte, so mußte er sich in neue gefährliche Speculationen eingelassen haben, welche die Solidität seines Hauses aufs Spiel setzten.
Und in der That hatte sich Silas Toronthal seit wenigen Monaten, wenigstens nach der moralischen Seite hin, wesentlich geändert. So sehr er sich auch zu beherrschen verstand, sein Aussehen war trotzdem ohne sein Wissen ein anderes geworden. Er war nicht mehr, wie einst, Herr über sich selbst. Beobachter hätten bemerken können, daß er den Leuten nicht mehr ins Gesicht zu sehen wagte, so wie es einst bei ihm Gewohnheit gewesen war, sondern sie mit halbgeschlossenem Auge und von der Seite anblickte. Diese Anzeichen waren auch der Aufmerksamkeit seiner Frau nicht entgangen, einer stets kränklichen Dame, die keine Energie besaß, sich ihrem Gatten willenlos unterwarf und, der Absicht desselben gemäß, nur eine sehr oberflächliche Idee von dessen Geschäft hatte.





























