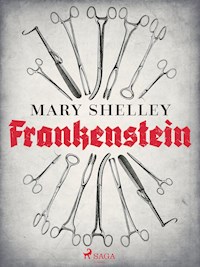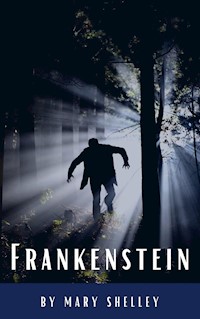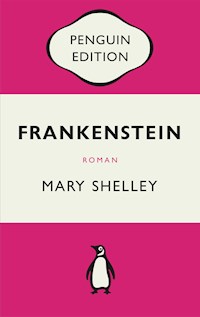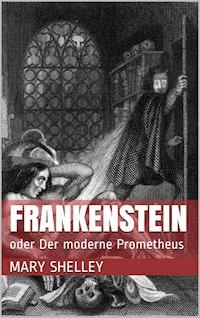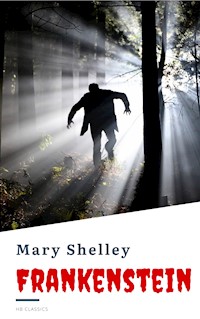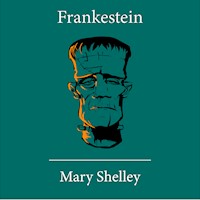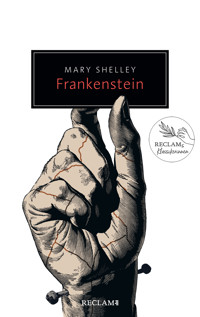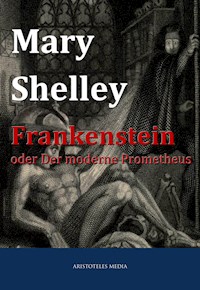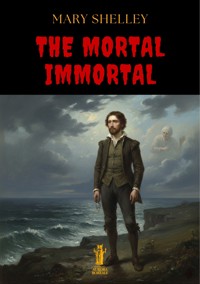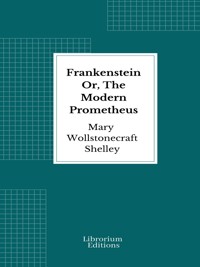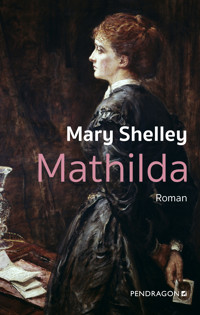
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mary Shelleys vergessener Roman »Mathilda« Mary Shelley schrieb mit »Frankenstein« einen wegweisenden Roman der Schwarzen Romantik. Auch in dem nachfolgenden Werk »Mathilda«, das erst über hundert Jahre später posthum veröffentlicht wurde, verarbeitete sie Themen wie Obsession, Empfindsamkeit und die Erhabenheit er Natur. Die junge Mathilda wächst nach dem Tod ihrer Mutter einsam und ohne Zuwendung auf. Erst als ihr Vater aus seinem selbst auferlegten Exil zurückkehrt, wagt sie, auf Glück zu hoffen. Doch nach wenigen gemeinsamen Wochen legt sich ein Schatten über die Beziehung der beiden, und Mathilda droht in einen noch tieferen Abgrund zu stürzen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mary Shelley • Mathilda
Mary Shelley
Mathilda
Aus dem Englischen übersetzt und mit einem Nachwort von Stefan Weidle
1. Kapitel
Florenz, den 9. November 1819
Es ist erst vier Uhr am Nachmittag, doch herrscht tiefer Winter und die Sonne ist bereits untergegangen: Keine Wolke steht am frostigen Himmel, um ihre schrägen letzten Strahlen aufzunehmen, dennoch ist die Luft selbst erfüllt von einem zarten Rosenschein, der sich über den Schnee am Boden breitet. Ich lebe in einem bescheidenen Landhaus auf einer weiten, einsamen Heide; kein Laut des Lebens dringt bis zu mir. Ich schaue auf die in Weiß gehüllte trostlose Ebene mit nur ein paar schwarzen Flecken, welche die Mittagssonne auf den Spitzen der steilen Hügel ausgeschnitten hat, an Stellen, wo der Schnee dünner liegen blieb als auf der Ebene. Wenige Vögel picken auf den eisbedeckten Teichen – der strenge Frost dauert schon lange an.
Ich befinde mich in einem seltsamen Zustand. Ich bin allein, ganz allein in dieser Welt – der Pesthauch des Unglücks ist über mich hinweggezogen und hat mich ausgedörrt; ich weiß, dass ich bald sterbe und bin froh, ja glücklich. Ich fühle meinen Puls, er rast, ich lege die dünne Hand auf meine Wange, sie glüht: Der sachte, bewegliche Lebenshauch in mir versprüht sein letztes Feuer. Den Schnee des nächsten Winters werde ich nicht mehr sehen, und ich glaube, auch die belebende Wärme des kommenden Sommers werde ich nicht spüren. In dieser Gewissheit beginne ich mit der Niederschrift meiner traurigen Geschichte. Vielleicht stürbe eine solche Geschichte wie diese besser mit ihrer Schöpferin, doch ein Impuls, den ich selbst nicht verstehe, leitet mich, und ich bin körperlich wie geistig zu schwach, ihm zu widerstehen. Als das Leben in mir noch Kraft hatte, meinte ich, es sei ein heiliger Schrecken in meiner Erzählung, der jede Weitergabe unmöglich machte – doch nun, im Angesicht des Todes, wische ich den geheimnisvollen Schrecken weg. Es ist wie im Eumenidenhain, den nur Todgeweihte betreten dürfen – und Ödipus ist ein solcher.
Was schreibe ich? Ich muss meine Gedanken sammeln. Ich weiß nicht, ob irgendjemand diese Seiten lesen wird außer Ihnen, mein Freund, der sie nach meinem Tod empfangen wird. Ich richte sie nicht an Sie allein, denn es macht mir Freude, auch unsere Freundschaft zu beschreiben, was sinnlos wäre, blieben Sie mein einziger Leser. Daher werde ich meine Geschichte so erzählen, als wäre sie an einen Fremden gerichtet. Sie haben mich oft nach dem Grund für mein Leben in Einsamkeit, für meine Tränen und vor allem für mein undurchdringliches, abweisendes Schweigen gefragt. Lebend wagte ich es nicht, im Tode aber lüfte ich den Schleier. Manche werden diese Blätter unberührt zur Seite legen; Ihnen aber, Woodville, lieber, naher Freund, werden sie teuer sein – als kostbares Vermächtnis einer jungen Frau mit gebrochenem Herzen, die noch im Sterben voll warmer Dankbarkeit für Sie ist: Ihre Tränen werden auf die Worte fallen, in die mein Unglück geflossen ist. Ich weiß, so wird es sein, und solange noch Leben in mir ist, danke ich Ihnen für Ihr Mitfühlen.
Doch genug davon. Ich beginne mit meinem Bericht, das ist meine letzte Pflicht, und ich hoffe, meine Kraft reicht aus, sie zu erfüllen. Es geht nicht um Untaten; meine Verfehlungen sind leicht zu verzeihen, denn sie entsprangen nicht bösem Willen, sondern fehlendem Urteilsvermögen. Und ich glaube, nur wenige würden behaupten, ich hätte durch klügeres Verhalten und bessere Einsicht all das Unheil abwenden können, dessen Opfer ich geworden bin. Mein Schicksal stand unter dem Gestirn der Notwendigkeit, eines entsetzlichen Zwangs. Es hätte stärkerer Arme bedurft denn meiner, stärkerer als menschlicher Arme, glaube ich, jene schwere eiserne Kette zu brechen, die mich umschloss – mich, die einst voll Freude war, voller Liebe und Güte –, die mich band ans Elend, das enden muss und mit meinem baldigen Tod enden wird. Doch ich lasse mich gehen, meine Geschichte ist noch nicht erzählt. Ich ruhe ein paar Augenblicke aus, reibe mir die Augen und versuche, das Dunkel des Unglücks um mich zu durchdringen und Gefühle aus meiner Vergangenheit gegenwärtig werden zu lassen.
Ich wurde in England geboren. Mein Vater entstammte einer vornehmen Familie; er hatte seinen eigenen Vater früh verloren und wurde von einer schwachen Mutter erzogen, mit all der Nachgiebigkeit, die sie einem reichen Adligen schuldig zu sein meinte. Er wurde nach Eton geschickt, und danach bezog er die Universität; schon von Kindheit an standen ihm bedeutende Geldsummen zur freien Verfügung, daher genoss er bereits in früher Jugend jene Unabhängigkeit, die ein Junge seiner Herkunft stets in seiner Schule erwirbt. Unter dem Einfluss dieser Umstände fanden seine Leidenschaften einen fruchtbaren Boden vor, worin sie je nachdem als Blumen oder als Unkraut Wurzeln schlagen konnten. Seit jeher an Selbstständigkeit gewohnt, bildete er früh einen starken Charakter heraus und wies Eigenarten auf, welche ein einfühlsamer Betrachter leicht als Samen für spätere Tugenden oder auch Unglücksfälle erkennen konnte. Die unbekümmerte Zügellosigkeit, mit der er große Summen für schnell vergessene Launen ausgab – aufgrund ihrer Anziehungskraft hielt er sie für wahre Leidenschaften – zeigte sich auch in einer grenzenlosen Großzügigkeit. Während er sich mit Hingabe den Bedürfnissen anderer widmete, wurden gleichzeitig auch seine eigenen Begierden vollauf befriedigt. Er gab sein Geld, doch opferte er damit keinen seiner eigenen Wünsche; er gab seine Zeit, ohne ihr einen Wert beizumessen, und seine Zuneigungen, die er gern auf jede mögliche Weise entfachen ließ.
Ich will damit nicht sagen, dass wenn seine eigenen Bedürfnisse mit denen anderer in Wettstreit gerieten, er selbstsüchtig handelte, doch dazu ist es schließlich auch nie gekommen. Er wuchs im Reichtum auf und genoss dessen Vorzüge; alle Welt liebte ihn und wollte ihm gefällig sein. Dabei tat er alles, um seine Freunde zu beglücken – ihre Freuden waren auch die seinen; und wenn er mehr Aufmerksamkeit auf die Gefühle anderer richtete, als es unter Schuljungen üblich ist, so deshalb, weil sein Naturell nur dann froh sein konnte, wenn alle um ihn her frei von Not und Kummer waren, wie er selbst es war.
In der Schule verschafften ihm Nachahmung und eigene Fähigkeiten gute Zeugnisse und eine herausgehobene Stellung unter seinen Kameraden; an der Universität legte er die Bücher beiseite, weil er meinte, andere Lektionen lernen zu müssen als die aus Lehrbüchern. Er stand an der Schwelle ins Leben und war jung genug, um das Studium als Fessel anzusehen, allein dazu bestimmt, widerspenstige Jungen zu zähmen und sie vor Missetaten zu bewahren, ohne eine wirkliche Verbindung zum Leben herzustellen – dessen Unterrichtsfächern wie Reiten, Jagd etc. folgte er mit weit mehr Interesse. So stürzte er sich in sämtliche Verrücktheiten des Studentenlebens, doch war sein Herz zu fest geformt, um davon verdorben zu werden – es mag sprunghaft gewesen sein, aber niemals kalt. Er war ein treuer, mitfühlender Freund, doch war er niemandem begegnet, der, ihm überlegen oder wenigstens ebenbürtig, seinen Geist erweitern oder nach neuen gedanklichen Ufern steuern konnte. Allen um ihn her fühlte er sich an Entschlusskraft weit voraus: Seine Begabungen, seine gesellschaftliche Stellung und sein Reichtum machten ihn zum Anführer seines Kreises, und in dieser Rolle fühlte er sich wohl und genoss sie, ja, er hielt sie für die einzige, die es in dieser Welt wert war, innezuhaben. In einer eigenartigen Verengung des Blicks betrachtete er die Welt allein in der Verbindung zu seinem kleinen Kreis von Freunden. Alle Meinungen, die aus diesem Kreis herausgesprengt wurden, galten ihm als verrückt und überholt, und so wurde er zugleich dogmatisch und ängstlich, nicht übereinzustimmen mit den einzigen Empfindungen, die er als fundamental ansah. Den meisten Beobachtern erschien er als über jede Kritik erhaben und bereit, sich über die Abhängigkeit von Vorurteilen der Masse zu erheben. Doch während er erhobenen Hauptes über den Rest der Welt hinwegschritt, duckte er sich in einer Art von unbewusster Demut unter seinen Kreis, und niemals äußerte der Anführer eine Meinung oder ein Gefühl, wenn er nicht sichergehen konnte, dass seine Kameraden ihm zustimmen würden.
Doch ein Geheimnis bewahrte er vor diesen teuren Freunden; ein Geheimnis, an dem er schon seit frühester Jugend wuchs, und so sehr er seine Kommilitonen auch schätzte, würde er es deren Zartheit und Empfindsamkeit keinesfalls anvertrauen. Er liebte. Er fürchtete, die Stärke seiner Leidenschaft könnte ihn zum Gespött machen, und er ertrug den Gedanken nicht, dass sie etwas als trivial und vorübergehend abstempelten, von dem er wusste, es war sein Leben.
Ein Mann mit schmalem Vermögen und drei hübschen Töchtern lebte nahe seines Familiensitzes. Die älteste der drei war bei Weitem die schönste, doch Schönheit war in ihrem Fall nur eine Dreingabe zu ihren anderen Vorzügen: Ihr Verstand war klar und stark und ihre Haltung von geradezu engelhafter Freundlichkeit. Sie und mein Vater waren seit ihrer Kindheit Spielkameraden gewesen. Selbst so früh schon war Diana ein Liebling seiner Mutter, und die Eingenommenheit für das schöne und lebhafte Mädchen wuchs noch mit den Jahren. Während seiner Schul- und Semesterferien waren sie ununterbrochen zusammen. Romane und all die anderen Methoden, die sich die Jugend zunutze macht, Leidenschaften zu kennen, ohne sie schon gelebt zu haben, hatten einen großen Einfluss auf ihn, der so sensibel war für alle sinnlichen Eindrücke. Mit elf Jahren war Diana seine bevorzugte Spielkameradin, aber schon da sprach er in der Sprache der Liebe mit ihr. Obwohl sie zwei Jahre älter war als er, wirkte sie durch die Art ihrer Erziehung kindlicher, zumindest was das Verständnis und den Ausdruck von Gefühlen anlangte; sie nahm seine Beteuerungen in aller Unschuld hin und erwiderte sie, ohne sich ihrer Bedeutung bewusst zu sein. Sie hatte nie Romane gelesen und war stets nur mit ihren jüngeren Schwestern zusammen, wie konnte sie da den Unterschied zwischen Liebe und Freundschaft kennen? Als sie schließlich gelernt hatte, den wahren Grund seines Verhaltens ihr gegenüber zu lesen, besaß er ja schon ihre Zuneigung, und sie fürchtete nur noch, andere Beziehungen oder Unentschlossenheit könnten seine kindlichen Schwüre brechen.
Doch diese wurden von Tag zu Tag fester und zärtlicher. Die Leidenschaft war mit ihm gewachsen, hatte sich um jede Tätigkeit und jede Empfindung gewunden, nur der Tod konnte sie beenden. Niemand wusste von ihrer Liebe außer ihren eigenen Herzen, und doch scheute er sogar hier, wie in allen anderen Dingen, die Kritik seiner Kameraden, etwa dass er unter seinem gesellschaftlichen Stand liebe. Nichts war aber je fähig, seinen Vorsatz zu erschüttern, sich mit ihr zu vereinen, sobald er genügend Mut aufbringen würde, alle diese Hürden zu überwinden.
Diana war seiner tiefen Zuneigung würdig. Nur wenige hatten ein so reines Herz und eine so hingebungsvolle Seele, verbunden mit dem Vertrauen auf ihre eigene Redlichkeit wie auf die der anderen. Von Geburt an hatte sie zurückgezogen gelebt. Sie verlor ihre Mutter, als sie noch sehr jung war, doch ihr Vater hatte sich mit großer Kraft ihrer Erziehung gewidmet – mit durchaus eigentümlichen Ideen, welche das von ihm gewählte System der Ausbildung beeinflussten. Sie kannte sich bei griechischen und römischen Helden gut aus, auch mit den englischen, die vor mehreren Jahrhunderten gelebt hatten, doch wusste sie so gut wie gar nichts über ihre eigene Zeit: Sie hatte kaum Autoren gelesen, die während der letzten fünfzig Jahre oder mehr geschrieben hatten, doch mit dieser einen Ausnahme war sie sehr belesen. Auch wenn sie weniger eingeweiht schien in die Rätsel des Lebens und der sie umgebenden Gesellschaft, ruhte ihr Wissen auf tieferen Fundamenten; und selbst wenn ihre Schönheit und Sanftheit ihn nicht schon in ihren Bann gezogen hätten, wäre er von ihrem Geist hingerissen worden. Er sah sie als seine Führerin, und seine Verehrung war so groß, dass er sein Wesen um jenes Empfinden von Unterlegenheit erweiterte, mit dem sie ihn immer wieder beeindruckte.
Als er neunzehn war, starb seine Mutter. Aus diesem Anlass verließ er die Universität, schüttelte für eine gewisse Zeit seine alten Freunde ab und zog sich in die Nachbarschaft von Diana zurück, wo er Trost fand in ihrer sanften Stimme und Zärtlichkeit. Diese kurzzeitige Trennung von seinen Kameraden flößte ihm den Mut ein, seine Unabhängigkeit zu verfolgen. Er spürte, dass sie wohl über seine Heiratspläne spotten mochten, dies jedoch nicht mehr öffentlich tun würden, sobald die Hochzeit vollzogen war; daher suchte er die Zustimmung seines Vormunds, die nicht leicht zu erlangen war, und die des Vaters der Braut, welche gerne erteilt wurde. Und so war er, ohne irgendjemanden sonst von seinen Absichten zu unterrichten, kurz nach seinem zwanzigsten Geburtstag Dianas Gatte geworden.
Er liebte sie leidenschaftlich, und ihre Zärtlichkeit breitete einen Zauber über ihn, der ihm verbot, an irgendetwas außer an sie zu denken. Er lud einige seiner Studienfreunde zu sich ein, doch ihre Gewöhnlichkeit stieß ihn ab. Diana hatte das Netz zerrissen, welches ihn in seiner Jugend festhielt: Er war zum Mann geworden und verstand nicht mehr, wie er je in die leeren Phrasen und Gedankenhülsen seiner Gefährten hatte einstimmen, wie er gar ihr Urteil hatte fürchten können. Er beendete seine alten Freundschaften nicht aus einer Laune heraus, sondern weil sie ihren Wert verloren hatten. Diana besetzte sein ganzes Herz: Es schien, als habe er durch die Verbindung mit ihr eine neue und bessere Seele erhalten. Sie wurde zu seiner Wegweiserin, bei der er lernte, worauf es im Leben wirklich ankam. Durch ihre sanften Belehrungen entledigte er sich seiner alten Bestrebungen und formte sich allmählich zu einem verantwortungsbewussten Menschen, zu einem wertvollen Mitglied der Gesellschaft, einem Patrioten. Er entschied sich bewusst für Wahrhaftigkeit und Rechtschaffenheit. Freilich liebte er sie um ihrer Schönheit und Freundlichkeit willen, doch noch mehr wegen ihrer in seinen Augen überlegenen Weisheit. Sie lasen und lernten und ritten zusammen; nie waren sie getrennt, und nur selten durfte sich ein Dritter zu ihnen gesellen.
So erstieg mein Vater, im Überfluss geboren, der nie versiegt war, ohne all die Kümmernisse und Schwierigkeiten, die den Menschen bestimmt zu sein scheinen, den Gipfel des Glücks. Um ihn glänzte Sonnenschein, schöne Wölkchen ließen den Ausblick geradezu göttlich wirken, und doch verbargen sie bloß die raue Wirklichkeit, die unter ihnen lag. Fünfzehn Monate nach der Hochzeit kam ich auf die Welt, und meine Mutter verließ sie ein paar Tage später.
Eine Schwester meines Vaters war zu dieser Zeit bei ihm. Sie war fast fünfzehn Jahre älter als er und stammte aus einer früheren Ehe seines Vaters. Als dieser starb, wurde das Kind von Verwandten der Mutter aufgenommen; die Geschwister hatten einander so gut wie nie gesehen und waren in ihrem Wesen höchst unterschiedlich. Jene Tante, in deren Obhut ich dann gegeben wurde, hat mir oft erzählt, welche Wirkung diese Katastrophe auf den starken, aber auch empfindsamen Charakter meines Vaters hatte. Vom Augenblick des Todes meiner Mutter an bis zu seiner Abreise hörte sie kein einziges Wort von ihm: In tiefste Trauer vergraben, nahm er niemanden und nichts wahr. Stundenlang liefen ihm Tränen über die Wangen, übermannt von einer fürchterlichen Schwermut. Alles um ihn herum schien in Bezug auf ihn jegliche Existenz verloren zu haben, und nur ein einziger Umstand konnte ihn aus seiner reglosen, stummen Verzweiflung herausreißen: Er weigerte sich, mich zu sehen. Alle anderen waren Luft für ihn, doch wenn meine Tante ihn aus seiner Lethargie holen wollte und mich deshalb in sein Zimmer brachte, stand er sofort auf und ging aufgebracht aus dem Raum. Nach einem Monat verließ er plötzlich sein Haus, und ohne einen Diener reiste er aus diesem Teil des Landes ab, ohne irgendjemanden schriftlich oder mündlich über seine Absichten in Kenntnis zu setzen. Meine Tante machte sich große Sorgen um ihn und atmete erst auf, als sie einen Brief von ihm erhielt, er kam aus Hamburg.
Wie oft habe ich über diesem Brief geweint – bis zu meinem sechzehnten Lebensjahr war er das einzige Erinnerungsstück an meine Eltern. »Verzeih mir«, so begann er, »den Kummer, den ich Dir zweifellos bereitet habe: Aber auf dieser unglücklichen Insel, wo alles ihren Geist atmete, ihren Geist, den ich für immer verloren habe, hatte sich ein Bann auf mich gelegt. Er ist nun gebrochen: Ich habe England für viele Jahre verlassen, vielleicht gar für immer. Doch um Dich davon zu überzeugen, dass ich nicht allein selbstsüchtig handle, bleibe ich in dieser Stadt, bis Du mir alle Maßnahmen, die Du für notwendig erachtest, brieflich dargelegt hast. Wenn ich aber von hier weggehe, dann erwarte nicht, wieder von mir zu hören: Ich muss alle Fesseln, die noch existieren, lösen. Ich werde ein Nomadenleben führen, als Wanderer meiner Straße ziehen, einsam und ohne Gruß – allein! allein!« In einem anderen Abschnitt des Briefes erwähnte er mich: »Was nun jenes arme Geschöpfchen anlangt, dessen Anblick, dessen bloße Erwähnung ich kaum ertrug, so lasse ich sie unter Deinem Schutz. Kümmere Dich um sie, sorge für sie! Vielleicht nehme ich sie eines Tages von Dir weg; doch die Zukunft ist finster, gestalte die Gegenwart angenehm für sie.«
Mein Vater blieb drei Monate in Hamburg; als er abreiste, änderte er seinen Namen. Meine Tante fand nie heraus, wie er sich nun nannte, und konnte nur aufgrund schwacher Hinweise vermuten, dass er sich über Deutschland und Ungarn in die Türkei begeben hatte.
So ist dieser überragende Geist, der Interesse und hohe Erwartungen bei all denen geweckt hatte, die ihn kannten und schätzten, von heute auf morgen vom Erdboden verschwunden. Er existierte nur noch für sich selbst. Seine Freunde erinnerten sich an ihn als ein schillerndes Bild, das niemals wieder vor ihre Augen treten würde. Die Erinnerung an das, was er gewesen war, verblasste mit den Jahren; und er, der ein Teil von ihnen und ihren Hoffnungen gewesen war, zählte fortan nicht mehr unter die Lebenden.
2. Kapitel
Ich komme jetzt zu meiner eigenen Geschichte. Über die Anfänge meines Lebens gibt es kaum etwas zu berichten, und ich will mich kurzfassen; doch ich muss ein wenig auf die Jahre meiner Kindheit eingehen, um zu erklären, wie es kam, dass mit dem Erlöschen einer Hoffnung das ganze Leben seine Farbe verlor, und wie es geschah, dass mit dem Verlust der einzigen Liebe, die mir gestattet war, meine gesamte Existenz verdorrte.
Wie schon gesagt, war meine Tante völlig anders als mein Vater. Ich glaube, sie hatte, ohne einen Arg im Busen zu tragen, das kälteste Herz, das je in einer Brust schlug: Es war jeglicher Art der Liebe völlig unfähig. Sie nahm mich bei sich auf, weil sie das für ihre Pflicht hielt, doch hatte sie zu lange allein und ungestört von Kindergeschrei gelebt, um jetzt zuzulassen, dass ich ihre Ruhe störte. Sie hatte nie geheiratet, und die letzten fünf Jahre mutterseelenallein auf einem von ihrer Mutter ererbten Anwesen am Ufer des Loch Lomond in Schottland gelebt. In seinen Briefen hatte mein Vater den Wunsch geäußert, sie solle mit mir auf dem Stammsitz der Familie in einem bildschönen Landstrich nahe Richmond in Yorkshire wohnen. Sie widersetzte sich diesem Vorschlag, und sobald sie die Angelegenheiten, die mit der Ausreise ihres Bruders zu tun hatten, geregelt hatte, verließ auch sie England und nahm mich mit auf ihr Anwesen in Schottland.
Die Fürsorge für mich, als ich noch ein Säugling war und auch noch später bis zu meinem achten Lebensjahr, oblag einer Zofe meiner Mutter, die uns zu diesem Zwecke in unser Refugium begleitet hatte. Ich wurde in einem abgelegenen Flügel des Hauses untergebracht und sah meine Tante nur zu festgelegten Zeiten. Das geschah zweimal täglich; um Mittag kam sie in mein Kinderzimmer, und nach dem Abendessen wurde ich zu ihr gebracht. Sie umarmte oder küsste mich nie und wirkte während der ganzen Zeit meiner Anwesenheit, als fürchte sie, jeden Moment durch eine kindliche Unart gestört zu werden. Meine liebe Gouvernante gab mir immer genaue Verhaltensregeln, bevor wir zur Tante in den Salon kamen. Die Furcht, die der kalte Blick und die paar formelhaften Worte der Tante in mir hervorriefen, war so groß, dass ich nur selten meine Regeln übertrat oder mich aus der mustergültigen Ruhe löste, die ich während der kurzen Besuche bewahren sollte. Unter Aufsicht meiner lieben Gouvernante rannte ich durch den Park und über die angrenzenden Felder. Als Geschöpf der tiefsten Liebe besaß ich schon in frühesten Kinderjahren ein besonders empfindsames Gemüt. Ich kann nicht mehr sagen, mit welcher Leidenschaft ich alles um mich herum liebte, auch unbelebte Dinge. Ich spürte wohl eine eigene Zuneigung zu jedem einzelnen Baum in unserem Park; jedes Tier, das da lebte, kannte mich, und ich liebte sie alle. Starb eines, erfüllte sein Tod mein Kinderherz mit Qualen. Ich weiß nicht mehr, wie vielen Vögeln ich während unserer langen harten Wintermonate das Leben gerettet habe oder wie viele Hasen und Kaninchen ich vor den Attacken unserer Hunde bewahrt oder nach Bissen gesund gepflegt habe.