
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dragonfly
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Flügelloser Leser, du bist drauf und dran, ein außergewöhnliches Wesen kennenzulernen …
Maximilian Flügelschlag will keinen Ärger. Denn die Leute fürchten sich vor ihm. Seine wunderschönen, indigofarben schimmernden Flügel, langen Antennen und vielen Arme machen ihnen Angst. Dabei ist er nichts weiter als ein sanftmütiges Wesen, das zufälligerweise aussieht wie eine Küchenschabe. Er möchte beweisen, dass er ein gutes Herz hat. Deshalb lässt er Kaitlin und Jonno, die verzweifelt auf der Suche nach einem Versteck sind, in sein Haus. Was er nicht weiß: Gefährliche Mächte haben es auf seine flügellosen Freunde und das Geheimnis, das sie mit sich tragen, abgesehen. Kann es in der grauen Stadt Trost, eingepfercht unter dem Kraftfeld der Herrscherin, einen Ausweg für sie geben?
Unerwartete Wendungen, eine faszinierende Welt und feiner Humor – das ist Angie Sage in Bestform!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zum Autor
Angie Sage ist in London geboren und lebt in Cornwall. Sie liebt das Meer, gruselige alte Häuser und Zeitreisen (der einfachste Weg: Geschichtsbücher lesen). Sie ist die Autorin der weltweiten Bestseller-Serie rund um Septimus Heap, die in 33 Sprachen übersetzt wurde und sich allein in den USA mehr als 3,5 Millionen Mal verkauft hat.
HarperCollins®
Copyright © 2020 DRAGONFLY in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
Alle Rechte für die deutschsprachige Ausgabe vorbehalten Copyright Text © 2019 Angie Sage Originaltitel: Maximillian Fly Erschienen bei Katherine Tegen Books, an imprint of HarperCollins Publishers, US
Publishes by arrangement with HarperCollins Publishers L.L.C., New York Aus dem Englischen von Katrin Segerer und Hanna Christine Fliedner
Covergestaltung: Nina Dulleck E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783748850199
www.dragonfly-verlag.de Facebook: facebook.de/dragonflyverlag Instagram: @dragonflyverlag
Widmung
Für L. V. mit Liebe
Kapitel 1 Maximilian Flügelschlag
M
Guten Tag, Maximilian Flügelschlag mein Name. Ich bin ein gutes Wesen. Auch wenn manche behaupten, ich sei schlecht.
Doch ich sehe schon, du glaubst mir nicht. Mein Panzer und mein breiter, flacher Kopf gefallen dir nicht, und selbst meine wunderschönen indigofarben schimmernden Flügel können dich nicht von meiner Güte überzeugen. Mir ist bewusst, dass Menschen wie du mich Schabe nennen – obgleich auch ich ein Mensch bin. Auch ich war einst ein weicher, flügelloser Säugling wie du. Trotzdem würdest du mich ohne zu zögern zertreten, wäre ich nur klein genug. Ha! Zum Glück bin ich viel größer als du und, wie man mir erzählt hat, recht Furcht einflößend. Denken wir also nicht weiter über zertretende Schuhe und zermalmte Panzer nach. Davon bekomme ich Mandibelzucken.
Ich nehme alles wahr. Auch den Ekel, der über dein Gesicht huscht, wenn du dir vorstellst, wie ich aussehe. Das schmerzt mich, denn ich bin ein sensibles Geschöpf. Ich möchte dir beweisen, dass ich gut bin, so wie du – oder so wie du zu sein glaubst. Ach, aber ich bin auch ein vergessliches Geschöpf! Ich habe vergessen, dass du mich gar nicht sehen kannst. Nun, dann male ich dir eben mit Worten ein Bild.
Gerade fliege ich schnell und tief über die Dächer unserer Stadt, eines düsteren Ortes namens Trost. Der Nebel kommt heute Abend später, bisher liegt nur ein feiner Dunstschleier in der Luft. Unter mir ziehen die unbeleuchteten Straßenschluchten vorbei, die wuchernden Pflanzen auf den Dächern, die wie Schildkrötenpanzer glänzen. Ich halte Ausschau nach meinem eigenen lieben Dach. Ah, da ist es ja: das schmale ganz am Ende der Reihe, mit den Gauben wie kleine Käferaugen, den steinernen Mäuerchen vorne und hinten und dem Schornstein aus hellen Ziegeln, der so hoch aufragt wie ein Leuchtturm. Ich mag mein Dach. Den orangefarbenen Astroanzug hingegen, der letzte Woche vom Himmel gefallen ist, mag ich ganz und gar nicht. Inzwischen ist er bis zum vorderen Mäuerchen hinuntergerollt und ruht nun in der breiten Regenrinne davor wie ein verschrumpelter Luftballon. Ach, Astros sind schrecklich …
Aber sieh nur! Dort unten ist etwas, das uns von solch trübseligen Gedanken ablenken kann: eine Verfolgungsjagd. Zwei Silberlinge hasten durch die dunklen Straßen. Sie gehören zur Crew des berüchtigten Silberschiffs, mit dem jedes Jahr eine Gruppe von Kindern aus der Stadt gebracht wird. Keines kehrt je zurück. Drei Vollstrecker sind ihnen auf den Fersen, in ihren glänzenden CarboTex-Rüstungen wirken sie aalglatt und gefährlich. Die Silberlinge rennen, so schnell sie können, springen über Sträucher und ducken sich unter Ästen hindurch. Der Größere der beiden zieht den Kleineren an der Hand mit sich. Diese Angelegenheit betrifft mich zwar im Grunde nicht, doch vermutlich hast du das Gefühl, sie beträfe dich, schließlich handelt es sich um junge Flügellose, deine Artgenossen. Darum will ich deine Neugier befriedigen und dir gleichzeitig beweisen, dass ich wirklich gut bin. So haben wir beide etwas davon.
Um deinetwillen, mein blinder Passagier, werde ich also beschreiben, was sich vor meinen Augen abspielt. Der kleine Silberling hat angehalten. Er hüpft auf einem Bein und stößt ein schrilles Wimmern aus. Das erscheint mir bei einer Flucht wenig hilfreich. Nun hievt sich der große Silberling den kleinen auf den Rücken und spurtet weiter wie ein seltsamer, zweiköpfiger Mutant. Er ist erstaunlich schnell – aber schnell genug?
Ich fürchte nicht. Die Vollstrecker sind älter und fitter, und sie holen auf. Es handelt sich um den üblichen Dreiertrupp, ausgerüstet mit Taschenlampe, Netz und Rammbock. Du fragst dich vielleicht, warum sie die Flüchtenden nicht einfach niederschießen, aber Vollstrecker tragen keine Schusswaffen. Sie müssen ihre Beute lebend zurückbringen – und nicht allzu übel zugerichtet.
Oh, mir kommt eine Idee. Was würdest du davon halten, wenn ich den Ausreißern meine Hilfe anböte? Das wäre allerdings nicht ganz ungefährlich für mich – junge Flügellose bedeuten in der Regel Ärger für uns Menschen, die man Schaben nennt. Lass uns eine Abmachung treffen. Ich, Maximilian Flügelschlag, werde den beiden Zuflucht gewähren. Die finden sie hier sicher nirgendwo anders. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter: Ich werde den Silberlingen helfen, diesem abscheulichen Silberschiff zu entkommen, mit dem sie Trost sonst bald für immer den Rücken kehren müssten.
Aber nur, wenn sie schlau genug sind, mich zu entdecken.
Ich lande so behutsam auf meinem Dachfirst, dass nicht einmal die Ratte ein Stück weiter sich rührt. Sorgfältig falte ich die Flügel ein, schiebe mir das Nachtsichtgerät auf die Stirn und erwidere den Blick des unverschämten Nagers, bis er wegschaut. Unter keinen Umständen sollte man eine Ratte im Wettstarren gewinnen lassen.
Ungefähr in der Mitte des Dachs befindet sich mein Fenster, das ich offen gelassen habe, und mich überfällt der Drang, einfach in die kühle Stille meines Zuhauses abzutauchen. Doch ich habe unsere Abmachung nicht vergessen. Darum will ich nachsehen, wie weit die jungen Flügellosen inzwischen gekommen sind.
Obwohl die Ratte das Wettstarren verloren hat, wirkt sie amüsiert, als ich die rutschigen Ziegel hinunterschlittere und in die Regenrinne vor dem rückwärtigen Mäuerchen kullere. Wie entwürdigend! Vorsichtig rappele ich mich auf und luge über die Brüstung nach unten. Die Flügellosen schlagen sich gar nicht schlecht. Eben biegen sie in die Düstergasse ein, über die man an der Seite meines Hauses vorbei zu den Gärten gelangt. Allmählich wird es interessant, nicht wahr? Ich setze die Nachtsichtbrille wieder auf und spähe in die Dunkelheit. Jetzt ähneln meine Augen denen der Nachtschaben, diesen verachtenswerten Kreaturen, die uns Schaben in Verruf bringen. Nun gut, alles hat seine Vor- und Nachteile.
Lass mich dir berichten, was weiter geschieht: Der große Silberling hat einen langen Zopf, also handelt es sich wohl um ein Mädchen. Der kleine auf ihrem Rücken hat kurze Haare, deshalb kann ich sein Geschlecht nicht bestimmen. Sie stellen sich tatsächlich recht schlau an. Soeben hat das Mädchen bemerkt, dass mein Gartentor unverschlossen ist. Wie aufregend! Sie schlüpft hindurch und ist sogar so gewieft, es sorgsam hinter sich zuzuziehen. Nun befinden sich die beiden in meinem Garten, laufen über den Pfad in Richtung Haus. Doch als die Große die Stufen zur tief liegenden Terrasse vor meinem Keller betritt, stolpert sie. Ich fürchte, sie wird ihre Last nicht viel länger tragen können.
Jenseits meines schmalen Gartens ragen die heruntergekommenen Rückseiten der Nachbarhäuser auf. Ich suche die schmutzigen Fenster nach Zeichen von Beobachtern ab, dem verräterischen Leuchten einer Kerze, einer Bewegung hinter dem Vorhang. Trost ist voll von Menschen, die nur zu gerne die Belohnung für zwei flüchtige Silberlinge einstreichen würden. Doch ich entdecke niemanden. Die dunklen Zimmer sind leer. Und wer kostbares Licht hat, verschwendet es nicht, um hinaus in die Nacht zu starren.
Da! Drei finstere Gestalten huschen durch die Düstergasse wie der Nachtnebel – die Vollstrecker lassen sich nicht abschütteln. Zum Glück eilen sie an meinem Gartentor vorbei. Das leise Trappeln ihrer Schleichschuhe hallt von den Backsteinmauern wider. Leider ist diese Nachricht nicht so erfreulich, wie man meinen könnte, denn das Sträßchen ist eine Sackgasse. Die Vollstrecker werden umdrehen und zurückkehren, diesmal methodischer suchen und dann … herrje. Klick-klick.
Auf der Treppe vor meinem Keller rutscht derweil der kleine Silberling vom Rücken des großen und hüpft linkisch auf und ab. Er hat sich wohl am Fuß verletzt. Warum trägt er auch keine Schuhe? Das ist sehr unvernünftig. Die Füße von Flügellosen sind weich und meiner Meinung nach für ihren Zweck völlig ungeeignet. Wachsam schaut das Mädchen sich um und hilft dem Verletzten die Stufen hinunter bis zur Kellertür, wo er zusammensinkt. Sie bedeutet ihm, leise zu sein – und das sollte er tunlichst beherzigen, denn die Lauschgeräte der Vollstrecker schlagen beim kleinsten Geräusch an. Ich beuge mich weiter vor, um zu sehen, was die Flügellosen als Nächstes tun.
Kapitel 2 Kaitlin Drew
K
Eine Nachtschabe beobachtet uns. Ich erkenne sie an dem grünlichen Schimmer ihrer Augen. Sie lauert in der Dunkelheit auf dem Dach. Aus Geschichten über Nachtschaben weiß ich, dass sie ihre Beute zunächst gründlich taxieren, um zu entscheiden, ob sie dich im Ganzen packen oder dir bloß den Kopf abreißen und sich damit zufriedengeben. Genau das tut sie gerade: Sie taxiert uns.
Dieser Ort hier ist gefährlich.
Ich klappe das Messer meines Multitools aus. Mein kleiner Bruder mustert mich misstrauisch. Jonno ist ein dünnes Kerlchen mit großen, runden Augen wie ein verschrecktes Kaninchen, und er schaut mich an, als wollte ich das Messer gegen ihn richten. Ich riskiere einen raschen Blick nach oben. Der grüne Schimmer über der Brüstung ist noch da.
Bisher bin ich erst ein einziges Mal einer Nachtschabe begegnet. Sie hat sich aus dem Nebel geschält wie ein gigantisches weißes Gespenst. Man soll stillhalten, wenn sie im Sturzflug auf einen zukommen. Stehen bleiben. Und im letzten Augenblick die Klinge zwischen das zweite und dritte Segment rammen. Denn dort sitzt das Herz. Aber Schaben sind riesig. Was passiert wohl, wenn so ein Ding auf mich fällt und ihr Blut in Strömen über mich läuft und … Stopp, Kaitlin, es reicht, sage ich mir. Genug jetzt.
Ich muss uns so schnell wie möglich in dieses Haus bringen, aber ich weiß nicht, wie. Wir befinden uns auf einer Terrasse. Sie ist feucht und rutschig, und nach drinnen führen nur zwei vergitterte Fenster und eine rostige Sicherheitstür. Darüber ragt eine schmutzstarrende Klinkerfassade auf, vier weitere Stockwerke. Durch deren marode Fenster käme ich ohne Probleme, aber da hochzuklettern ist unmöglich. Ich muss es hier unten versuchen, das ist unsere einzige Chance. Trotz der Gitterstäbe. Die Tür ist bestimmt abgeschlossen. Niemand lässt nachts seine Tür auf.
»Bleib hier«, flüstere ich Jonno ins Ohr. »Und keinen Mucks! Du weißt doch noch, was ich dir gesagt habe, oder? Die bringen uns um.«
Jonno nickt, zu ängstlich, um zu sprechen – das hoffe ich zumindest. Ich lasse ihn in den Schatten zurück und schleiche zur Tür. Abgeschlossen. Klar. Ich klappe die Klinge ein und den Dietrich aus. Es funktioniert! Kaum habe ich das Schloss ein bisschen bearbeitet, macht es klick. Nur lässt die Tür sich trotzdem nicht bewegen. Auf der Innenseite müssen Riegel sein, und dagegen kann ich nichts ausrichten. Also gehe ich zum nächstgelegenen Fenster. Die Gitterstäbe stehen dicht beieinander, und nicht mal ich bin dünn genug, um dazwischen durchzupassen. Also, zumindest mein Kopf nicht. Wenn ich es allerdings schaffen würde, einen Stab zu entfernen – nur einen! –, könnten wir uns hineinzwängen. Ich versuche es mit dem Schraubenzieher des Multitools. Nichts zu machen. Die Scheiben sind vielleicht alt und gesprungen, aber das Gitter davor ist neu und fest in der Wand verankert.
Jonno wimmert. Ich erstarre. Was, wenn die Vollstrecker ihn hören? Das Trappeln ihrer Stiefel dringt durch die Stille. Mir läuft es eiskalt den Rücken hinunter. Sie sind uns auf der Spur, und sie werden uns finden. Vollstrecker geben niemals auf.
Ganz leise ziehe ich mich wieder zu Jonno in die dunkelste Ecke zurück. Als ich mich neben ihn auf den feuchten Steinboden setze, bemerke ich das Blut, das aus seiner Socke rinnt. Es hat schon eine kleine Pfütze gebildet. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Jonnos Segelschuhe waren ihm viel zu groß. Damit er schneller rennen kann, habe ich ihn gezwungen, sie auszuziehen. Ich nehme ihn in den Arm, aber er reagiert nicht. Er hat sich ganz klein zusammengekauert und umklammert seinen Teddybären. Wenn du dich bloß von deinem kostbaren Tedward hättest trennen lassen, wärst du jetzt nicht hier, würde ich am liebsten sagen.
Das kann ich allerdings nicht, denn nun quietscht kaum vernehmlich ein Tor, und leise Schritte ertönen auf dem Gartenweg, langsam und zielstrebig. Die Vollstrecker beeilen sich nicht. Dafür gibt es auch keinen Grund. Sie wissen, dass sie uns kriegen. Vorsichtig spähe ich hoch zum Mäuerchen auf dem Dach. Die Nachtschabe ist weg. Immerhin etwas.
Plötzlich gleitet ein greller Lichtstrahl über die Hauswand. Die Vollstrecker müssen direkt über uns sein. In ein paar Sekunden steigen sie die Stufen herab und entdecken uns, egal, wie eng wir uns gegen die Wand drücken. Und ich weiß genau, was dann geschieht. Im Geiste gehe ich durch, was ich zu tun habe. Ich muss schnell sprechen, bevor sie uns knebeln, ihnen klarmachen, dass Jonno verletzt ist und sie ihn nicht ins Netz stecken dürfen, dass er nichts dafür kann, dass er gar nicht mitkommen wollte. Aber zuallererst muss ich irgendwie diesen dummen Bären loswerden. Ganz behutsam versuche ich, Jonno den Teddy zu entwinden, aber er verstärkt seinen Griff. Ich sehe ihn flehend an und sage lautlos: »Bitte, Jonno, bitte!« Stur schüttelt er den Kopf und umklammert Tedward nur noch fester. Jetzt bin ich richtig verzweifelt. Wenn sie Tedward finden, war alles umsonst. Alles. Ich will noch einen letzten Versuch starten, als ich ein Rascheln hinter der Kellertür höre, das Geräusch von Riegeln, die zurückgeschoben werden. Dann öffnet sich die Tür einen Spalt. Ich kann es kaum glauben. Jemand hilft uns! Der Spalt wird größer, gerade groß genug für Jonno und mich. Ich ziehe ihn auf die Beine, aber er sackt wieder zusammen, also hebe ich ihn hoch und stolpere durch die Tür. Sie fällt hinter uns ins Schloss.
Im Inneren ist es dunkel und riecht komisch. Meine Beine fühlen sich an wie Wackelpudding, und auf einmal kann ich Jonno nicht mehr halten. Kurz bevor er mir entgleitet, packt mich etwas am Arm. Greifzangen!
Kapitel 3 Hintertürchen
M
Guten Tag, Maximilian Flügelschlag wieder hier. Ich habe etwas Törichtes getan. Ich habe dem Ärger Tür und Tor geöffnet. Mama hat recht. Ich bin ein Narr.
Ich schließe den Riegel und blicke auf das Knäuel zu meinen Füßen. Das Mädchen ist bereit zum Sprung, wie ein gefährliches Tier kauert es auf meinem Türvorleger. Der kleine Silberling – ein Junge, glaube ich – hat sich eingerollt wie eine Schnecke, die ihr Haus verloren hat.
Draußen schleichen Schritte auf meine Kellertür zu. Ich sage mir, dass Vollstrecker nichts weiter sind als widerliche Parasiten – denn so benehmen sie sich –, doch in Wahrheit habe ich große Angst. In ein paar Sekunden werden sie diese Tür aufbrechen, die jungen Flügellosen knebeln und in ihr Netz stecken. Und danach reißen sie mir vermutlich aus reinem Vergnügen alle drei Arme aus.
Ein ohrenbetäubender Schlag trifft meine gute alte Tür, aber sie bewegt sich keinen Millimeter. Es folgt der elektronische Stimmverzerrer, den alle Vollstrecker – ich meine, Parasiten – verwenden. Die Stimme ist kalt und unheimlich und spricht genau dieselben Worte wie damals, als das Haus der verrückten Katzenfrau gegenüber durchsucht wurde: »Aufmachen, im Namen des Wachturms! Dies ist ein Befehl. Eine Missachtung wird als Geständnis betrachtet, dass alle im Haus befindlichen Personen Verräter sind. Verräter werden eliminiert. Aufmachen, im Namen des Wachturms!«
Ich denke, ich werde lieber nicht aufmachen. Stattdessen trete ich auf das Mädchen zu, um ihr aufzuhelfen. Ihre Hand schießt vor, merkwürdig dünn, scharf und glänzend. Einen Moment lang bin ich verwirrt, dann begreife ich, dass sie ein Messer hält. Wie empörend! Nach allem, was ich riskiert habe, bedroht sie mich. Ich springe zurück, und ein weiterer Schlag geht auf die Tür nieder. Die Waffe des Mädchens zittert unsicher.
Draußen ertönt die elektronische Warnung von Neuem. Es wird noch eine dritte folgen, danach lassen sie den Rammbock sprechen. Herrje, das ist nicht gut, gar nicht gut. Klick-klick. Ich sollte fliehen, solange ich noch kann. Doch als ich die Silberlinge auf meinem Türvorleger betrachte, sehe ich die Furcht in ihren Augen – ihren dunkelgrauen Augen, die meinen recht ähnlich sind. Plötzlich fällt mir meine Nachtsichtbrille wieder ein. Aha! Vielleicht erinnere ich sie zu sehr an eine Nachtschabe. Rasch nehme ich die Brille ab, und genau in diesem Moment dringt der Strahl einer Taschenlampe durchs Fenster und zerteilt die Dunkelheit.
K
Im Lichtstrahl sehe ich, wie die Schabe sich die Augen ausreißt. Ich brauche einen Moment, bis mir klar wird, dass sie eine Brille aufhatte. Und dass sie mit diesem indigofarbenen Panzer definitiv keine Nachtschabe sein kann. Das ist beruhigend.
In der Mitte des flachen Kopfes sitzen ihre richtigen Augen. Sie sind auffallend menschlich und grau, genau wie meine. Beinahe ängstlich schaut die Schabe mich an. Sie ist beeindruckend groß und wirkt stark, aber gleichzeitig merkwürdig zierlich. Die elegant geschwungenen Flügel rahmen einen langen, segmentierten Oberkörper ein. Er läuft spitz zu und geht in sehnige Beine über, die in karierten Schabenleggings stecken. Die breiten, etwas platten Füße sind nackt und von harter Insektenhaut bedeckt. Oben hat die Schabe ein vollständiges Paar Arme, in der Mitte entdecke ich nur einen. Der andere fehlt. Nervös zwirbelt sie einen ihrer Fühler zwischen den Fingern der rechten oberen Hand. Der Fühler hat einen Knick, und die Finger – vier plus Daumen, genau wie bei uns – sind ebenfalls von Insektenhaut überzogen. Mehr kann ich nicht erkennen, denn der Strahl der Taschenlampe dreht ab, und wir stehen wieder im Dunkeln.
Plötzlich ruft draußen jemand: »Blut!«
Jetzt ist es aus. In Gedanken zähle ich die zehn Sekunden mit, die es dauert, Blut zu identifizieren. Und wie auf Kommando ertönt bei zehn: »Es gehört dem Jungen. Sie sind hier. Wir haben sie!« Und gleich danach ein Furcht einflößendes Wummern an der Tür.
In der darauffolgenden Stille höre ich eine Stimme dicht neben meinem Ohr. Eine Schabenstimme, dünn und leicht blechern, wie ein altes Radio. »Ich möchte euch helfen.« Die Schabe macht ein nervöses Klick-Geräusch. »Ihr müsst euch verstecken. Ich weiß einen sicheren Ort, kommt mit.«
Ich ziehe Jonno auf die Beine, und er humpelt vorwärts, Tedward fest an sich gedrückt. Ab und zu wimmert er vor Angst, während die Schabe uns durch den dunklen Kellergang in die Tiefen des Hauses führt. Plötzlich hält sie an und sagt: »Gebt mir eure Halstücher. Beide. Schnell.«
Was bleibt mir anderes übrig? Ich knote die Tücher los.
»Rieche ich da Blut?«, fragt die Schabe.
»Jonno hat sich am Fuß verletzt«, antworte ich.
»Gut.«
»Gut?« Ich werde wütend. »Was soll daran gut …« Der Beginn der dritten Warnung schneidet mir das Wort ab. Sobald sie ausgesprochen ist, sind wir vor dem Gesetz so gut wie tot, das ist mir klar. Und der Schabe auch, das sehe ich ihr an.
Unruhig schaut sie durch den Flur. »Tränke ein Halstuch mit Blut, schnell, schnell!« Wieder ein Klicken – die Schabe zittert! Sie hat genauso viel Angst vor den Vollstreckern wie wir.
»Tritt auf dein Halstuch, Jonno«, wispere ich.
Jonno rührt sich nicht. Mit schreckgeweiteten Augen starrt er mich an, als wäre er in einem Albtraum gefangen. Ich knie mich hin und wische mit dem Stoff über seine Socke, dann reiche ich beide Tücher an die Schabe weiter. Jonnos hält sie mit ausgestrecktem Arm von sich, als würde es schlecht riechen.
Draußen erschallt der letzte Satz der Warnung: »Aufmachen, im Namen des Wachturms!« Stille. Aus dem Augenwinkel sehe ich die Schabe eine Luke in der Wand aufklappen und einen Hebel herunterdrücken. Mit einem Schnappen tut sich eine kleine Tür in der Wandvertäfelung auf. Dahinter liegt ein pechschwarzes Loch, aus dem ein modriger Geruch dringt. Etwas Hartes pikst mir in den Rücken, und die Schabe schiebt mich vorwärts.
»Versteckt euch. Bitte«, sagt sie mit ihrer blechernen Stimme.
Unter normalen Umständen würde ich diesen Raum niemals freiwillig betreten, aber wir haben nicht besonders viele Optionen. Auf der einen Seite die Vollstrecker, auf der anderen ein Ort, an dem wir uns vor ihnen verstecken können. Auch wenn er wie ein Gefängnis wirkt. Jonno sträubt sich, doch ich zerre ihn mit mir.
»Ruhig«, weist die Schabe mich an, als spräche sie mit einem ungezogenen Hund. Dann schließt sich die Tür, und wir sind allein in der Dunkelheit.
Kapitel 4 Hin und her und wieder hin
M
Guten Tag, Maximilian Flügelschlag noch einmal. Ich muss mich sputen. Nachdem ich meine Nachtsichtbrille wieder aufgesetzt habe, haste ich die Treppe hinauf und klettere aus dem Dachfenster. Geräuschlos gleite ich hinunter zum Garten des Hauses nebenan – die Deckflügel habe ich ausgebreitet und bewege nur die weichen Hautflügel – und deponiere das beschmutzte Halstuch auf der Mauer. Dabei sehe ich, wie ein Parasit gerade den Rammbock ansetzt. Meine gute alte Tür wird wohl nicht viel länger standhalten.
Ich hebe einen kleinen Stein auf und fliege wieder los. Die Parasiten sind so auf die Zerstörung meiner Tür fixiert, dass sie meine Anwesenheit erst bemerken, als der Stein den mit dem Netz am Kopf trifft. Er blickt auf und brüllt mit der unmenschlich verzerrten Stimme: »Schabe!«
Der gleißende Strahl der Taschenlampe schwenkt nach oben und erfasst mich. Nun starren alle drei zu mir herauf. Ich bedeute ihnen, dass auf Nachbars Gartenmauer etwas von Interesse zu finden sein könnte. Der Taschenlampenstrahl dreht ab, und das Silberschiffsymbol auf dem Halstuch blitzt auf wie die Laterne eines Leuchtturms.
»Ihr Pfeifen, wie kann man so was übersehen?«, schimpft Netz.
»Das war vorhin noch nicht da, ich schwör’s«, beteuert Taschenlampe.
»Mehr ist wahrscheinlich nicht übrig«, meint Rammbock. »Das Drecksvieh hat sich ein leckeres Abendessen gegönnt und uns die Verpackung dagelassen.«
Sein Gerede ist empörend, aber ich darf mich nicht beklagen, schließlich hat er die gewünschte Schlussfolgerung gezogen. Langsam fliege ich weiter und lande auf dem Dach nebenan, um das Geschehen zu beobachten.
Die Parasiten identifizieren das Blut auf dem Halstuch, dann schwärmen sie über die Mauer. Mit Genugtuung höre ich, wie die Tür meines Schaben hassenden Nachbarn fällt. Ich warte, bis die Parasiten im Haus verschwunden sind, ehe ich das zweite Halstuch durch eins der oberen Fenster werfe und den Rückzug antrete. Als ich durch das Dachfenster in mein ruhiges, friedliches Heim gleite, bin ich beinahe versucht, die Kinder für heute Nacht dort zu lassen, wo sie sind, und direkt in mein Nest zu schlüpfen. Doch versprochen ist versprochen. Sie waren schlau genug, mich zu entdecken, darum müssen sie jetzt nicht allein im Dunkeln bleiben.
Schweren Herzens rappele ich mich von der Landematte auf und gehe nach unten.
J
Tedward und ich sind gefangen. Draußen ist eine riesige Schabe, und bald kommt sie rein und frisst uns. Mein Fuß tut so weh!
K
In der Kammer ist es stockfinster und stinkt nach Verwesung. Jonno wimmert leise. Ich sage ihm, dass alles gut wird, obwohl ich genau weiß, dass es nicht stimmt. In Wahrheit muss ich mich echt zusammenreißen, um nicht in Panik auszubrechen. Vorsichtig taste ich mich an der feuchten Mauer entlang bis zur Tür, durch die die Schabe uns gedrängt hat. Sie ist fest verschlossen. Dann das Gleiche in die andere Richtung. Hier entdecke ich Gitterstäbe. Oh, oh. Ich strecke den Arm hindurch und spüre nichts als Leere. Das kühle Metall führt unten bis zum Boden und oben bis zu einer gewölbten Steindecke. Es gibt kein Entkommen. Offensichtlich sind wir im Vorratskeller einer Nachtschabe gelandet.
Ich kenne Geschichten von gemeinen Schaben, die Futter für Nachtschaben sammeln. Und – wie manche behaupten – für sich selbst. Genau das ist hier passiert. Jonno und ich sind Futter.
Verzweifelt werfe ich mich gegen die Tür. Aber sie bewegt sich keinen Millimeter. Natürlich. Die dumpfen Stöße des Rammbocks sind verstummt, alles ist still. Wahrscheinlich sind die Vollstrecker inzwischen im Haus und suchen uns. Schweren Herzens treffe ich eine Entscheidung. Unsere einzige Chance, hier lebend rauszukommen, ist, so viel Lärm wie möglich zu machen, damit sie uns hören. Also fange ich an zu brüllen und gegen die Tür zu hämmern.
M
Ich höre lautes Hämmern und Brüllen und fühle mich schuldig. Ich habe die Flügellosen allein gelassen, und die Parasiten haben sie entdeckt. Ich habe unsere Abmachung gebrochen, mein blinder Passagier. Mama hat recht: Ich bin ein schlechtes Wesen.
Ich stürme so schnell die Treppe hinunter, dass ich mir einen Riss im Hautflügel zuziehe, und stelle erstaunt fest, wie wütend ich bin. Wie können diese Parasiten es wagen, meine unschuldigen Silberlinge zu bedrohen? Ich haste um die Ecke, hinter der ich meine jungen Gäste im grässlichen Netz der Vollstrecker vermute. Doch der Flur ist leer, und trotzdem geht das Hämmern und Brüllen weiter.
Erst jetzt erkenne ich, dass die Geräusche aus dem Eingang zum Untergrund kommen, wo ich die Kinder zu ihrer Sicherheit versteckt habe. Irgendetwas muss sich aus dem Tunnel heraufgeschlichen und sie erschreckt haben. Eine Bluhuteule vielleicht? Oder eine Mooderspinne? Eilig betätige ich den Hebel. Die Tür geht auf. Das Mädchen fällt heraus und schreit dabei so laut, dass mir die Hörorgane klingeln. Sie schubst mich heftig, und ich stolpere zurück und pralle gegen die Wand. Mein Panzer knirscht, ich fürchte, ich habe mir etwas angeknackst. In mancherlei Hinsicht sind wir Schaben sehr empfindlich. Unser Exoskelett ist leicht und hart, aber auch sehr starr. Ihr Flügellosen habt so viel Fleischpolster, dass ihr euch über solche Dinge keine Gedanken machen müsst.
Das Mädchen sprintet durch den Flur, den kleinen Jungen im Schlepptau, wirft sich gegen die Kellertür und zerrt am Riegel. Sie will hinaus. Ich verstehe nicht recht, warum, aber offensichtlich ist sie in großer Not, deshalb werde ich ihr zur Hand gehen. Als ich mich ihr nähere, stößt sie ein hässliches Geräusch aus, doch ich lasse mich nicht entmutigen, schließlich bin ich ein hilfsbereites Geschöpf. Ich öffne den Riegel, drehe den Schlüssel und trete zurück. Meine arme, misshandelte Tür schwingt auf. Mit einer Verbeugung weise ich den Weg nach draußen.
Klick-klick. Du stimmst mir hoffentlich zu, dass ich mein Bestes getan habe.
K
An der frischen Nachtluft ebbt meine Panik ein bisschen ab, und mir wird klar, dass gerade etwas Seltsames passiert ist: Die Schabe hat uns die Tür aufgemacht. Und sich sogar verbeugt, als wir an ihr vorbei nach draußen gestürmt sind. Langsam frage ich mich, ob ich sie wohl falsch eingeschätzt habe. Vielleicht war das alles ein Riesenfehler …
Was ebenfalls merkwürdig ist: Ich höre Krachen und Klirren aus dem Haus nebenan. Die Vollstrecker wüten dort drüben. Sobald sie einen Blick aus dem Fenster werfen, sehen sie uns.
Schnell gehe ich unsere Möglichkeiten durch. Ich könnte Tedward über die Mauer in einen anderen Garten schleudern und hoffen, dass ihn niemand findet. Allerdings lässt Jonno diesen Bären nicht los, ohne Zeter und Mordio zu schreien, das wird also nicht funktionieren. Wir könnten auch einfach losrennen – nur wohin? Überall sind Patrouillen unterwegs, ganz zu schweigen von den Nachtschaben, und noch gibt es keine Spur vom Nebel, der uns verstecken könnte. Seien wir mal ehrlich, wir haben keine Chance da draußen.
M
Ehrlich gestanden kommt es mir ganz gelegen, dass die jungen Ausreißer fortwollen – mitsamt dem unerhört schmutzigen Plüschobjekt, das der Junge umklammert. So kann ich mich nach all dem nervenaufreibenden Trubel auf eine friedliche Nacht freuen. Doch ich fürchte, es wird ihnen nicht gut ergehen. Verloren stehen sie auf meiner Terrasse und halten sich an den Händen. Das stimmt mich traurig. Langsam schließe ich die Tür und winke zum Abschied, um ihnen Glück zu wünschen.
K
Langsam schließt die Schabe die Kellertür, und es fühlt sich an, als würde sich ein Freund verabschieden. Wehmütig winkt sie uns noch einmal zu, und endlich kapiere ich: Sie ist auf unserer Seite.
Also stürze ich zur Tür und flehe sie an, uns wieder reinzulassen.
M
Ich bin ein treudoofer Trottel, wie Mama einmal gesagt hat. Nun möchte das Mädchen wieder herein. Und nur wegen meiner Abmachung mit dir, mein blinder Passagier, öffne ich die Tür, verneige mich abermals und lasse die Störenfriede erneut in mein Heim. Der kleine Junge mit dem widerlichen Pelzknäuel sackt sofort in sich zusammen. Zum Glück bleibt er ruhig, doch das Mädchen wirft sich auf ihn und stößt seltsame Würgegeräusche aus.
Ich schließe ab und lege den Riegel vor. Klick-klick. So viel zu meiner friedlichen Nacht.
Kapitel 5 Blut auf dem Boden
K
Die Schabe lässt uns wieder rein, mit einem Gesichtsausdruck, der mich irgendwie an Paps erinnert. So hat er früher immer geguckt, wenn ich etwas richtig Dummes angestellt hatte. Wir stolpern zurück ins Haus. Jonno sinkt zu Boden und liegt so still da, dass ich Angst bekomme. Ich falle neben ihm auf die Knie und breche peinlicherweise in Tränen aus.
Die Schabe macht ihr Klick-klick-Geräusch und verschließt die Tür. Mal wieder.
M
Klick-klick. Nun ist mein Boden voll Flügelloser. Und Blut. So viel Blut. Für eine Nachtschabe zweifellos ein Genuss, für mich jedoch das Gegenteil. Ich hege eine Abneigung gegen alle Arten von Flüssigkeiten, die ihr Weichlinge absondert. Ganz besonders gegen Blut. Und ich weiß genug über Medizin, um zu erkennen, dass eine solche Menge für mich unerfreulich sein mag – für die Person, die sie verliert, ist sie jedoch höchst gefährlich. Vermutlich hat der Junge ein Blutgefäß tief in seinem Fuß verletzt. Das ist der Haken daran, wenn man von außen so nachgiebig ist.
Klick-klick. Es muss etwas geschehen.
K
Ich versuche noch, dieses lächerliche Geflenne unter Kontrolle zu kriegen und Jonno zu helfen, als die Schabe plötzlich wieder spricht. Mit ihrer blechernen Stimme sagt sie: »Bitte steht auf.« Sie klingt so alarmiert, dass mich das schlechte Gewissen packt. Endlich gewinne ich den Kampf gegen die Tränen und komme auf die Beine. Sie fühlen sich ganz zittrig an, als könnten sie jeden Moment unter mir wegklappen. Ich schwanke, stütze mich an der Wand ab und schaue der Schabe in die Augen. Sie erwidert meinen Blick. Ich erkenne Sorge und Verwunderung, gemischt mit einer Prise Ärger.
»Die Lage ist ernst«, sagt sie. »Das ist sehr viel Blut.« Sie deutet mit einem Fühler auf den Boden und klick-klickt schon wieder.
Ich habe den Eindruck, Blut ist ihr zuwider. Und wir vielleicht ebenfalls. Aber sie will es sich aus Höflichkeit nicht anmerken lassen.
»Es tut mir leid«, erkläre ich. »Mein Bruder ist in eine Scherbe getreten.«
Klick-klick, macht die Schabe nervös. Klick-klick.
Der Strahl einer Taschenlampe dringt in den Flur. Wir sehen uns an, dann senken wir den Blick zum Lichtstreifen auf dem Boden.
Die Vollstrecker sind zurück.
M
Die Parasiten haben das Nachbarhaus offenbar zu ihrer Zufriedenheit zerstört. Natürlich haben sie nicht gefunden, was sie suchen, darum werden sie sich nun mit Gewalt Zutritt zu diesem hier verschaffen. Das Mädchen und ich wechseln einen Blick, und erstaunlicherweise scheinen wir uns in diesem kurzen Moment ohne Worte zu verstehen.
»Bitte bring deinen Bruder nach oben«, sage ich. »Schnell, folge mir.«
Der Kleine liegt reglos auf dem Boden. Sie versucht, ihn hochzuhieven, spricht mit ihm, doch er zeigt keine Reaktion. Ich wappne mich innerlich. »Wenn du gestattest.« Damit schlinge ich meine drei oberen Gliedmaßen um ihn und sein übel riechendes Stoffknäuel. Er ist zugleich schwer und weich. Und warum müssen ungepanzerte Menschen eigentlich immer so feuchtwarm sein?
K
Die Schabe hebt Jonno hoch. Ihr breiter, lippenloser Mund verzieht sich, wahrscheinlich vor Ekel wegen Tedward. Er ist alles andere als ein niedlicher Teddybär. Sein Fell ist verklebt von Jonnos ständigem Nasenbluten, und er stinkt bestialisch, weil Jonno ihn mal vollgekotzt hat. Bisher war das ideal, um Leute von Tedward fernzuhalten, aber jetzt schäme ich mich dafür. Ich folge der Schabe eine Holztreppe hinauf. Auf halbem Weg sehe ich wieder den Taschenlampenstrahl. Er gleitet über die Stelle, an der wir gerade noch standen. Das war knapp.
J
Ich träume, dass Tedward und ich von einer Schabe ins Bett gebracht werden. Sie hat einen abgeknickten Fühler, der mich am Ohr kitzelt.
K
Ich höre auf, die Stockwerke zu zählen. Als wir endlich ganz oben ankommen, öffnet die Schabe eine Tür mit dem Fuß. Wir betreten ein kleines Zimmer mit Dachschräge und Holzbalken. Es ist fast leer, bis auf einen Stapel sorgfältig zusammengefalteter Decken in der Ecke. Durch die auf dem Boden verteilten Teppiche und die geblümten Vorhänge wirkt es trotzdem gemütlich. Ich bekomme eine Gänsehaut: Genau die gleichen Vorhänge hatte ich in meinem Zimmer zu Hause. Also, ganz früher. In unserem richtigen Zuhause am Stadtrand neben den Feldern.
Die Schabe deutet mit den spitzen Fingern in die Ecke und fragt: »Könntest du ein paar Decken für deinen Bruder holen?«, während sie Jonno sanft auf einen weichen Teppich bettet. Anschließend deckt sie ihn und Tedward mit einem dicken, blau karierten Plaid zu und schiebt ein zweites unter seinen Kopf, so behutsam, dass mir fast schon wieder die Tränen kommen.
Plötzlich dröhnt ein ohrenbetäubender Krach herauf. Wir wissen beide, was das heißt.
Die Vollstrecker sind im Haus.
M
Die Vollstrecker sind in mein Heim eingedrungen – das Haus, in dem zu leben ich laut Mama nicht wert bin. Nun weiß ich, dass sie recht hat, denn ich habe Unheil darüber gebracht.
Das Mädchen spricht. »Bitte. Bitte helfen Sie uns!« Allmählich gewöhne ich mich an die konturlosen Züge mit den glänzenden grauen Augen und kann ihren Ausdruck besser deuten. Sie hat Angst. Ob sie wohl auch die Angst in meinen Augen erkennt? Meine Gedanken rasen, während ich verzweifelt nach einer Möglichkeit suche, uns diese abscheulichen Parasiten vom Hals zu schaffen.
Da kommt mir eine Idee. »Die Jacke deines Bruders«, sage ich. »Und deine. Beschmutze sie mit Blut. Schnell!«
Sie begreift sofort und zieht ihrem Bruder die Jacke aus. Der umklammert seinen Bären, als wollte sie ihm auch den entwenden. Es gefällt mir, dass er sich nicht von ihm trennen will, obgleich er vor Dreck starrt – man sollte sich niemals von seinem Bären trennen. Das Mädchen wringt die durchweichte Socke ihres Bruders über den Jacken aus und knüllt sie zusammen. Dann nehme ich sie an mich. Sie sind ekelerregend, für meine Zwecke jedoch gut geeignet.
»Ich werde jetzt gehen«, erkläre ich. »Und die Tür abschließen.« Das tue ich nicht, um meine Ausreißer vor den Vollstreckern zu schützen, denn gegen die sind Türen nutzlos. Aber mein Ziel wird sich nicht ohne das ein oder andere unerfreuliche Geräusch erreichen lassen, und das sollen die jungen Silberlinge nicht hören. Vielleicht ist es eitel, doch ich möchte ungern auf eine Stufe mit den Nachtschaben gestellt werden.
Ich drehe den Schlüssel im Schloss, setze die Nachtsichtbrille wieder auf und mache mich schweren Herzens auf den Weg. Während ich die Treppe hinuntersteige, wird der Lärm der Verwüstung lauter. Auf dem Absatz des ersten Stocks schließlich höre ich etwas, das mir das Herz bricht: klirrendes Porzellan.
Ich weiß genau, was das bedeutet – Mamas Ein und Alles, ihre geliebte Sammlung Meissener Porzellan, wird zerstört. Ich male mir aus, wie die Teekanne mit den tanzenden Fischen, die Blumenuhr und die goldenen Putten mit den schimmernden blauen Flügeln in Scherben liegen, und kann es kaum ertragen. Um meinetwillen könnte ich wohl nicht töten, auch nicht um der jungen Ausreißer willen, aber für Mama schon. Für Mama schon!
K
Die Schabe ist weg, und ich mache mir große Sorgen um sie. Gewissenhaft überprüfe ich, ob unsere Tür tatsächlich abgeschlossen ist, obwohl sie die Vollstrecker ungefähr so lange aufhalten wird wie ein Blatt Papier. Dann lasse ich mich zu Boden sinken. Gerade kann ich nichts weiter tun. Unsere Zukunft liegt in den Händen einer Schabe.
Moment, da gibt es doch etwas!
Auf Zehenspitzen schleiche ich rüber zu Jonno. Er hat sich unter seiner Decke eingerollt wie eine Assel und die Augen geschlossen. Sein Gesicht wirkt blass und ausgezehrt. Versuchsweise zupfe ich an Tedwards Pfote. Jonno reagiert nicht. Es ist mies, ihn so zu hintergehen, aber ich tue es ja auch für ihn. Vorsichtig entwinde ich Tedward seinem Griff. Jonno jammert leise im Schlaf. »Ganz ruhig, es ist alles gut«, flüstere ich. Seine plötzlich freie Hand wandert nach oben, und wie früher als Kleinkind steckt er sich den Daumen in den Mund.
Schnell hole ich mein Multitool raus und lockere die Nähte unter Tedwards rechtem Arm, bis das Loch groß genug ist, um die extralange Pinzette hineinzuschieben. Ich taste umher, finde, was ich suche, und ziehe. Zum Vorschein kommt eine flache Silberscheibe mit goldenen Linien auf der einen Seite. Laut Mam ist es eine Direkte Stromkreisunterbrechung, kurz DiSk. Ohne diese Platine kann das Silberschiff die Stadt nicht verlassen. Und so lange sind Jonno und ich und die gesamte Crew in Sicherheit.
Die DiSk wiegt schwer in meiner Hand, und mir wird ganz komisch zumute beim Gedanken, dass Mam sie zuletzt berührt hat. Sie hat sie nämlich gestohlen und sie Tedward statt seines Brummmechanismus eingesetzt. Die Nähte, die ich gerade gelockert habe, waren ihr Werk. Tedward zuzunähen war genau genommen so ziemlich das Letzte, was Mam je getan hat. Ich betrachte die DiSk, will irgendeine Spur von ihr entdecken, aber da ist nur ein leises, elektrisches Summen. Mam gibt es nicht mehr.
Kapitel 6 Scherben
M
Ich stehe oben auf meiner Kellertreppe und blicke auf die Parasiten hinab. Ich sehe zwei. Auf den ersten Blick wirken sie recht einnehmend: Sie verbergen ihre flügellose Weichheit hinter Panzern aus glänzendem CarboTex, und Helme verdecken ihre Gesichter, verflachen ihre Züge und verwandeln ihre Köpfe in glatte Ovale. Ihr Betragen allerdings ist abstoßend. Einer wütet noch immer in Mamas Porzellanzimmer, ich höre das silberhelle Klirren. Es ist unerträglich.
Die beiden anderen schwärmen gerade zur Treppe. Der vordere trägt die Taschenlampe, der hintere das Netz. Sie sind so mit ihrer Niedertracht beschäftigt, dass sie mich hier oben auf dem dunklen Absatz überhaupt nicht bemerken, bis ich die Flügel über den Kopf erhebe – eine klassische Drohgebärde der Nachtschaben. Die Parasiten schauen auf und erstarren. Ich weiß, dass sie nur meinen Umriss und die spiegelnde Brille erkennen. Der vordere lässt die Taschenlampe fallen, sie klappert die Stufen hinunter und rollt über den steinernen Boden. Ich kann das Entsetzen hinter ihren Visieren nicht sehen, aber ich spüre es. Und das ist äußerst genugtuend.
Netz erholt sich zuerst. Wahrscheinlich ist es ein weibliches Exemplar, die sind furchtloser. Sie drängt sich vor, auf mich zu. »Aus dem Weg«, sagt sie. Doch sie ist nicht so mutig, wie sie tut. Trotz des Stimmverzerrers hört man, dass ihre Kehle vor Angst wie zugeschnürt ist.
Der dritte Parasit taucht aus Mamas Porzellanzimmer auf und stutzt, als er die Situation erfasst. Dann schreit er los. Der Stimmverzerrer verwandelt den Schrei in etwas Unmenschliches. Das ist meine Gelegenheit. Ich schwenke die blutigen Jacken und schleudere sie ihnen entgegen. Netz fängt sie auf und stopft sie in die Tasche an ihrem Gürtel. Doch statt wie gehofft anschließend zu verschwinden, bleiben die Parasiten, wo sie sind, und starren mich an. Sie haben wohl erkannt, dass ich keine Nachtschabe bin. Das macht es schwieriger.
Ich muss also nachlegen. Ich gehe einen Schritt auf sie zu, und sie weichen einen zurück. Noch ein Schritt vor, noch einer zurück. Und ein dritter. Da werde ich misstrauisch: Ihre Bewegungen wirken einstudiert, das ist irgendeine Art Manöver.
K
Unten ertönt ein Schrei. Hoch und schrill, wie ein falscher Ton auf einer Flöte. Das muss die Schabe sein. Tomas hat mir mal erzählt, wie eine von Vollstreckern in die Enge gedrängt worden ist. Sie haben ihr die Arme ausgerissen, und sie hat gekreischt wie der Teekessel über unserem illegalen Feuer. Ich mag gar nicht daran denken, dass die Schabe vielleicht ihre Gliedmaßen verliert. Ich muss mich auf das Wesentliche konzentrieren, wie Mam immer gesagt hat, und die DiSk verstecken, denn jeden Moment werden die Vollstrecker das Haus auf der Suche nach uns kurz und klein schlagen.
Aber das Zimmer ist so winzig, wo soll sie hin? Panisch schiebe ich sie einfach in den Deckenstapel unter den Dachbalken. Ich hoffe, Mam wäre damit zufrieden. Dort ist sie bestimmt sicher. Sobald sie uns haben, werden sie nicht weitersuchen.
M
Netz pfeift hoch und schrill, und plötzlich schießen alle drei auf mich zu wie Ratten. Ich bin froh, dass sie zuerst angreifen, schließlich sollst du, mein blinder Passagier, nicht denken, ich würde grundlos töten. Ich lasse mich in Kampfhaltung fallen, ziehe mein Stilett aus der Scheide unter den Hautflügeln und stoße das Geräusch aus, das alle Flügellosen fürchten. Ich fauche.
Das Fauchen einer Schabe hat eine schmerzhafte Frequenz, doch offenbar tragen die Parasiten Ohrstöpsel, denn sie zeigen keinerlei Reaktion. Netz holt einen langen, dünnen Wurfspieß aus dem Gürtel und zielt auf die ungeschützte Stelle zwischen meiner Brust und dem Hinterleib. Es ist ein tödlicher Wurf, ich kann mich gerade noch wegdrehen. Der Spieß durchschlägt einen Hautflügel und bohrt sich zitternd in die Treppenstufe.
Du wirst hoffentlich bestätigen, dass ich nun in Notwehr handele.
Die Parasiten scharen sich für den Todesstoß zusammen. Sie rechnen fest mit ihrem Erfolg. Natürlich tun sie das. Ich wirke zerbrechlich, meine Arme sind spindeldürr, und ja, sie lassen sich sehr leicht ausreißen, wenn man den richtigen Winkel erwischt. Allerdings verfüge ich über eine überraschende Stärke und scheue mich nicht, sie einzusetzen. Blitzschnell stürme ich die Treppe hinunter und werfe mich mit voller Wucht gegen die beiden vorderen Parasiten. Sie prallen gegen das Geländer, und das Holz bricht mit einem scharfen Knacken. Halb springe, halb rutsche ich die untersten Stufen hinab, direkt auf den Porzellanschänder zu. Er weiß, was ihm blüht, und schreit noch einmal panisch auf. Es ist sein letzter Schrei.
Ich stürze mich auf ihn, schleudere ihn zu Boden und stoße das Stilett in die Lücke zwischen Brustpanzer und Rücken seiner Rüstung. Es ist vorbei. Ruhig und sauber. Und bisher ohne Blut. Mamas Boden ist frei von Ausflüssen, aber voll von glitzernden Porzellansplittern. Ich ziehe die Klinge wieder heraus und wische sie am CarboTex ab. Als ich mich aufrappele und umdrehe, sehe ich, dass die übrigen beiden Parasiten unser kleines Schauspiel fassungslos beobachten.
Keine-Taschenlampe-mehr sagt zu Netz: »Raus hier, schnell!«
Netz protestiert: »Aber wir haben sie noch nicht gefunden.«
»Weil die Schabe sie zuerst gefunden hat. Du hast doch die Jacken zum Beweis.«
»Das reicht nicht.«
Ich beschließe, dass die beiden die Details ihrer garstigen Mission anderswo ausdiskutieren können. Mit erhobenen Flügeln und gezücktem Dolch rücke ich vor. Da wirbeln sie herum und flüchten durch meine arme, malträtierte Tür, die zerbrochen in den Angeln hängt. Mein Blick wandert zurück zum toten Parasiten auf der Schwelle des Porzellanzimmers. Inzwischen leckt er doch. Ich seufze. Noch ein Mensch, dem ich hinterherputzen muss. Flügellose sind so … undicht.
Ich schleife den Parasiten hinaus in die Düstergasse und kehre zurück in mein verwüstetes Heim.
Ich brauche dringend ein Staubbad.
K
Jetzt ist es schon seit Ewigkeiten still. Aber ich bin bereit. Da, Schritte auf der Treppe. Sie kommen!
Ich klappe die Klinge meines Multitools aus. Sie glitzert im Mondlicht. Dann presse ich mich an die Wand und warte. Ich hasse diese Leute. Ich hasse sie dafür, was sie meiner Familie angetan haben. Mir ist klar, dass ich nicht gewinnen werde, aber vielleicht kann ich zumindest einen von ihnen erledigen.
M
Ich schleppe mich die letzten Stufen zum Dachboden hinauf, wo schon das nächste Problem auf mich wartet – die jungen Flügellosen, mit denen Kummer und Leid über meine Schwelle gepurzelt sind.
Doch keine Sorge, ich weiß, dass ich mir das selbst zuzuschreiben habe. Ich habe sie in mein Haus gelassen. Nicht sie haben sich gewaltsam Zutritt verschafft und Mamas wertvolle Sammlung zerstört. Es ist nicht ihre Schuld. Das muss ich mir in Erinnerung rufen. Ich bin ein gutes Wesen. Nicht schlecht. Klick-klick.
Auf dem Treppenabsatz halte ich kurz inne, um mich zu sammeln. Dann trete ich zur Tür, hinter der die beiden Ausreißer versteckt sind, schließe auf und öffne sie. Im Zimmer ist es seltsam still. Der Bruder liegt noch dort, wo ich ihn zurückgelassen habe, mit geschlossenen Augen und dem Bären im Arm, aber die Schwester ist nirgendwo zu sehen.
Ich mache einen Schritt, und plötzlich schießt blitzender Stahl auf mich zu – ein Messer, und dahinter das Mädchen. Schon wieder. Verrat der übelsten Sorte! Ich springe zurück, hinaus aus dem Zimmer, weg von der Klinge, und stolpere. Und während ich die Stufen hinunterkugele, sinne ich über die Niedertracht der Flügellosen und meine eigene Torheit nach.
K
Ach du …! Es war die Schabe. Ich habe die Schabe abgestochen. Oh nein, nein, bitte nicht!
Ich stürme die Treppe hinunter. Die Schabe liegt zusammengekrümmt auf dem nächsten Absatz wie ein gepanzerter Ball. Das machen sie anscheinend, wenn sie sterben. Ich habe sie getötet! Ich knie mich neben sie und streichele ihr die glatten, schillernden Flügel. Sie fühlen sich gut an.
»Es tut mir leid«, flüstere ich. »Es tut mir schrecklich leid. Ich habe dich nicht erkannt. Ich dachte, du wärst einer von ihnen. Dich würde ich doch nie verletzen, niemals!«



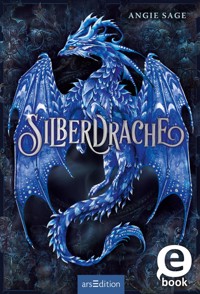













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











