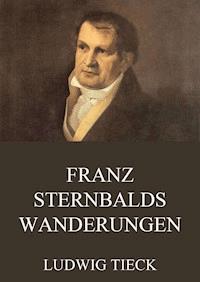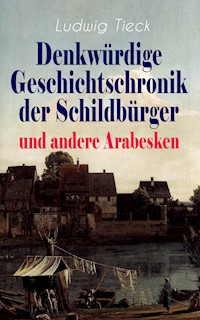Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Dies ist der erste von drei Bänden mit den schönsten Erzählungen des 1853 in berlin verstorbenen Schriftstellers der Romantik. Enthalten sind folgende Erzählungen: Das Zauberschloß Die Ahnenprobe Der Gelehrte. Der Mondsüchtige Der Wassermensch Der wiederkehrende griechische Kaiser Des Lebens Überfluß
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meine Erzählungen, Band 1
Ludwig Tieck
Inhalt:
Ludwig Tieck – Biografie und Bibliografie
Das Zauberschloß
Die Ahnenprobe
Der Gelehrte.
Der Mondsüchtige
Erster Brief.
Zweiter Brief.
Der Oheim an den Neffen.
Der Neffe an den Onkel.
Der Onkel an den Neffen.
Der Neffe an den Onkel.
Der Wassermensch
Der wiederkehrende griechische Kaiser
Des Lebens Überfluß
Meine Erzählungen, Band 1, L. Tieck
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849637644
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Ludwig Tieck – Biografie und Bibliografie
Dichter der romantischen Schule, geb. 31. Mai 1773 in Berlin, gest. daselbst 28. April 1853, Sohn eines Seilermeisters, besuchte seit 1782 das damals unter Gedikes Leitung stehende Friedrichswerdersche Gymnasium, wo er sich eng an Wackenroder anschloß, und studierte darauf in Halle, Göttingen und kurze Zeit in Erlangen Geschichte, Philologie, alte und neue Literatur. Nach Berlin zurückgekehrt, lebte er von dem Ertrag seiner schriftstellerischen Arbeiten, die er größtenteils im Verlag des Aufklärers Nicolai veröffentlichte. So erschienen in rascher Reihenfolge die Erzählungen und Romane: »Peter Lebrecht, eine Geschichte ohne Abenteuerlichkeiten« (Berl. 1795, 2 Bde.), »William Lovell« (das. 1795–96, 3 Bde.; vgl. Haßler, L. Tiecks Jugendroman »William Lovell« und der »Paysan perverti« des Rétif de la Bretonne, Dissertation, Greifsw. 1903) und »Abdallah« (das. 1796), ferner Novellen meist satirischen Inhalts in der Sammlung »Straußfedern« (1795–98), worauf er, seinen Übergang zur eigentlichen Romantik vollziehend, die bald dramatisch-satirische, bald schlicht erzählende Bearbeitung alter Volkssagen und Märchen unternahm und unter dem Titel: »Volksmärchen von Peter Lebrecht« (das. 1797, 3 Bde.) veröffentlichte. Den größten Erfolg errangen unter diesen Dichtungen die unheimlich düstere Erzählung »Der blonde Eckert« und das phantastisch-satirische Drama »Der gestiefelte Kater«. Die Richtung, die in seinen Schriften immer deutlicher hervortrat, mußte ihn in schroffen Gegensatz zu Nicolai sowie zu Iffland, dem Leiter des Berliner Theaters, bringen, während die Romantiker ihn begeistert anpriesen als ein Genie, das Goethe ebenbürtig sei. Nachdem er sich 1798 in Hamburg mit einer Tochter des Predigers Alberti verheiratet hatte, verweilte er 1799–1800 in Jena, wo er zu den beiden Schlegel, Hardenberg (Novalis), Brentano, Fichte und Schelling in freundschaftliche Beziehungen trat, auch Goethe und Schiller kennen lernte, nahm 1801 mit Fr. v. Schlegel seinen Wohnsitz in Dresden und lebte seit 1802 meist auf dem Gute Ziebingen bei Frankfurt a. O., mit dessen Besitzern (erst v. Burgsdorff, dann Graf Finkenstein) er eng befreundet war. Doch unterbrach er diesen Aufenthalt durch längere Reisen nach Italien, wo er die deutschen Handschriften der vatikanischen Bibliothek studierte (1805), sowie nach Dresden, Wien und München (1808–10). Während dieses Zeitraums waren erschienen: »Franz Sternbalds Wanderungen« (Berl. 1798), ein die altdeutsche Kunst verherrlichender Roman, an dem auch sein Freund Wackenroder Anteil hatte, »Prinz Zerbino, oder die Reise nach dem guten Geschmack« (Jena 1799), und »Romantische Dichtungen« (das. 1799–1800, 2 Bde.) mit dem Trauerspiel »Leben und Tod der heil. Genoveva« (separat, Berl. 1820) sowie das nach einem alten Volksbuch gearbeitete Lustspiel »Kaiser Octavianus« (Jena 1804), weitschweifige Dichtungen, in denen das erzählende und namentlich das lyrische Element überwiegt, aber aus einem Gewirr mannigfaltigster metrischer Ausdrucksformen gelegentlich doch echte Schönheit hervorleuchtet (vgl. Ranftl, L. Tiecks »Genoveva« als romantische Dichtung betrachtet, Graz 1899). Von den zahlreichen Übersetzungen und Bearbeitungen fremder Werke, die T. damals veröffentlichte, seien erwähnt: die fehlerhaften »Minnelieder aus der schwäbischen Vorzeit« (Berl. 1803), die gelungene Verdeutschung des »Don Quichotte« von Cervantes (das. 1799–1804, 4 Bde.), die wertvolle Übersetzung einer Anzahl Shakespeare zugeschriebener, aber zweifelhafter Stücke u. d. T.: »Altenglisches Theater« (das. 1811, 2 Bde.) u. a. Auch gab er u. d. T.: »Phantasus« (Berl. 1812–17, 3 Bde.; 2. Ausg., das. 1844–45, 3 Bde.) eine Sammlung früherer Märchen und Schauspiele, vermehrt mit neuen Erzählungen und dem Märchenschauspiel »Fortunat«, heraus, welche die deutsche Lesewelt lebhaft für T. interessierte. Das Kriegsjahr 1813 sah den Dichter in Prag; nach dem Frieden unternahm er größere Reisen nach London und Paris, hauptsächlich im Interesse eines großen Hauptwerks über Shakespeare, das er leider nie vollendete. 1819 verließ er dauernd seine ländliche Einsamkeit und nahm seinen Wohnsitz in Dresden, wo nun die produktivste und wirkungsreichste Periode seines Dichterlebens begann. Trotz des Gegensatzes, in dem sich Tiecks geistige Vornehmheit zur Trivialität der Dresdener Belletristik befand, gelang es ihm, hauptsächlich durch seine fast allabendlich stattfindenden dramatischen Vorlesungen, in denen er sich als Meister in der Kunst des Vortrags bewährte, einen Kreis um sich zu sammeln, der seine Anschauungen von der Kunst als maßgebend anerkannte. Als Dramaturg des Hoftheaters (seit 1825) gewann er eine bedeutende Wirksamkeit, die ihm freilich durch Angriffe der Gegenpartei mannigfach verleidet wurde. In der Novellendichtung, der sich T. in dieser Dresdener Zeit vor allem widmete, leistete er zum Teil Vortreffliches; aber er bahnte auch jener bedenklichen Gesprächsnovellistik den Weg, in der das epische Element fast ganz hinter dem reflektierenden zurücktritt. Zu den bedeutendsten zählen: »Die Gemälde«, »Die Reisenden«, »Der Alte vom Berge«, »Die Gesellschaft auf dem Lande«, »Die Verlobung«, »Musikalische Leiden und Freuden«, »Des Lebens Überfluß« u. a. Unter den historischen haben »Der griechische Kaiser«, »Dichterleben«, »Der Tod des Dichters« und vor allen der großartig angelegte, leider unvollendete »Aufruhr in den Cevennen« Anspruch auf bleibende Bedeutung. In allen diesen Novellen befriedigt nicht nur meist die einfache Anmut der Darstellungsweise, sondern auch die Mannigfaltigkeit lebendiger und typischer Charaktere und der Tiefsinn der poetischen Idee. Sein letztes größeres Werk: »Vittoria Accorombona« (Bresl. 1840), entstand unter den Einwirkungen der neufranzösischen Romantik und hinterließ trotz der Farbenpracht einen überwiegend peinlichen Eindruck.
T. übernahm in Dresden auch die Herausgabe und Vollendung der von A. W. v. Schlegel begonnenen Shakespeare-Übertragung (Berl. 1825–33, 9 Bde.), doch hat er selber nur die Anmerkungen beigesteuert. Die Übersetzungen A. W. v. Schlegels (s. d.) wurden zum Teil mit eigenmächtigen Änderungen wieder abgedruckt, die übrigen Stücke übersetzten Tiecks Tochter Dorothea (geb. 1799) und Wolf Graf von Baudissin (s. d.). Diese beiden verdeutschten auch noch sechs weitere Stücke des alten englischen Theaters, die T. als »Shakespeares Vorschule« (Leipz. 1823–29, 2 Bde.) mit ausführlicher literarhistorischer Einleitung herausgab. Ebenso stammen aus dieser Zeit mehrere mit Einleitungen versehene Ausgaben von Werken deutscher Dichter, auf die er die Aufmerksamkeit von neuem hinlenken wollte. So hatte er schon 1817 eine Sammlung älterer Bühnenstücke u. d. T.: »Deutsches Theater« veröffentlicht (Berl., 2 Bde.). Dann gab er die hinterlassenen Schriften Heinrichs v. Kleist (Berl. 1821) heraus, denen die »Gesammelten Werke« desselben Dichters (das. 1826, 3 Bde.) folgten, ferner Schnabels Roman »Die Insel Felsenburg« (Bresl. 1827) und die »Gesammelten Schriften« von J. M. R. Lenz (Berl. 1828, 3 Bde.). Aus seiner dramaturgisch-kritischen Tätigkeit erwuchsen die wertvollen »Dramaturgischen Blätter« (Bresl. 1825–26, 2 Bde.; Bd. 3, Leipz. 1852; vollständige Ausg., das. 1852, 2 Tle.). 1837 verlor T. seine Frau, seine Tochter Dorothea starb 21. Febr. 1841. In demselben Jahre wurde er vom König Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin berufen, wo er, durch Kränklichkeit zumeist an das Haus gefesselt, ein zwar ehrenvolles und sorgenfreies, aber im ganzen sehr resigniertes Alter verlebte. Sein Bildnis s. Tafel »Deutsche Romantiker« (Bd. 17). Seine »Schriften« erschienen in 20 Bänden (Berl. 1828–46), seine »Kritischen Schriften« in 2 Bänden (Leipz. 1848), »Gesammelte Novellen« in 12 Bänden (Berl. 1852–54), »Nachgelassene Schriften« in 2 Bänden (Leipz. 1855). »Ausgewählte Werke« Tiecks gaben Welti (Stuttg. 1886–1888, 8 Bde.), Klee (mit Biographie, Einleitungen und Anmerkungen, Leipz. 1892, 3 Bde.) und Witkowski (mit Einleitung, das. 1903, 4 Bde.) heraus. Aus Tiecks Nachlaß, der sich in der Berliner Bibliothek befindet, veröffentlichte Bolte mehrere Übersetzungen englischer Dramen, unter andern »Mucedorus« (Berl. 1893). Die Ungleichheit von Tiecks Leistungen ist z. T. auf sein improvisatorisches Arbeiten zurückzuführen, das ihn selten zu reiner Ausgestaltung seiner geist-, phantasie- und lebensvollen Entwürfe gelangen ließ; die Gesamtheit seiner Schriften verrät deutlich die Weite und Größe seines Talents. R. Köpke, der T. in den letzten Berliner Jahren nahe stand, veröffentlichte eine ausführliche Biographie u. d. T.: »Ludwig T., Erinnerungen aus dem Leben etc.« (Leipz. 1855, 2 Bde.). Vgl. außerdem H. v. Friesen, Ludwig T., Erinnerungen (hauptsächlich aus der Dresdener Zeit, Wien 1871, 2 Bde.); »Briefe an Ludwig T.« (hrsg. von K. v. Holtei, Bresl. 1864, 4 Bde.); Ad. Stern, Ludwig T. in Dresden (in dem Werk »Zur Literatur der Gegenwart«, Leipz. 1880); Steiner, Ludwig T. und die Volksbücher (Berl. 1893); Garnier, Zur Entwicklungsgeschichte der Novellendichtung Tiecks (Gieß. 1899); Mießner, L. Tiecks Lyrik (Berl. 1902); Ederheimer, Jak. Böhmes Einfluß auf T. und Novalis (Heidelb. 1904); Koldewey, Wackenroder und sein Einfluß auf T. (Leipz. 1904); Günther, Romantische Kritik und Satire bei Ludwig T. (das. 1907). – Tiecks Schwester Sophie T., geb. 1775 in Berlin, verheiratete sich 1799 mit Aug. Ferd. Bernhardi (s. d.), von dem sie 1805 wieder geschieden wurde, lebte dann in Süddeutschland und mit ihren Brüdern, dem Dichter und dem Bildhauer, längere Zeit in Rom, später in Wien, München und Dresden. 1810 schloß sie eine zweite Ehe mit einem Esthländer, v. Knorring, dem sie in dessen Heimat folgte, und starb dort 1836. Sie hat außer Gedichten, z. B. dem Epos »Flore und Blanchefleur« (hrsg. von A. W. v. Schlegel, Berl. 1822), auch Schauspiele und einige Romane, wie »Evremont« (hrsg. von Ludw. T., das. 1836), geschrieben.
Das Zauberschloß
Nur nicht auf diese Art räsonnirt! rief der alte Freimund aus; das Leben läßt sich einmal nicht so betrachten und noch weniger nach einigen Maximen einrichten. Hast Du nicht die Fähigkeit, jeden einzelnen Fall recht als einen einzelnen, aus seinen fernen und nächsten Bedingnissen herausgestalteten, zu erwägen, ihn mit Geschicklichkeit nach seinen Umständen zu lenken, und ihn so seiner Bestimmung entgegenzuschicken, so wirst Du niemals ein brauchbarer Geschäftsmann werden, ja auch als Privat immer nur an Zufälligkeit laboriren, ohne Deines Lebens froh zu werden.
Zufälligkeit, Zufälle! antwortete ihm Schwieger: diese sind es ja eben, die uns allenthalben zu thun machen. Und vollends, wenn nun gar, indem noch obenein, wenn etwa – –
Donnerwetter! rief Freimund, indem ihm der Wachsstock aus der Hand fiel, mit welchem er mühsam in einen Wandschrank hineinleuchtete; Sebastian! Angezündet!
Der Diener kam, hob die Wachsscheere vom Boden auf, und Freimund legte tiefathmend das lange thönerne Rohr, an welchem er geraucht hatte, auf den Tisch. Mit einem Seufzer setzte er sich auf das Sofa, in tiefen Gedanken verloren. Der Diener brachte das Licht, Freimund nahm es in die Linke, die Pfeife in die Rechte, und ging wieder an den Schrank, mühsam und ängstlich in Papieren suchend, indem ihm große Schweißtropfen von der Stirne rannen. Es war in den heißesten Tagen des Julius und dem Kramenden war es sehr mühsam, das Licht zu lenken, mit der rechten Hand die Akten zu sondern, sie anders zu packen und schnell einzusehn und wieder, auf Augenblicke mindestens, die Pfeife festzuhalten, die immer dem klemmenden Munde zu entfallen drohte. Wenn es heller Sommertag ist, fing Schwieger bescheidenen Tones an, indem die Sonne scheint, dazu auch der Schrank dem Fenster gegenüber steht, und man das Rauchen nicht lassen will, so könnte unmaßgeblich das Licht, und die ganze Qual, die es macht, als überflüssig erscheinen.
Freimund drehte sich mit einem verwunderten Gesichte herum, sah dem alten Freunde mit aufgerissenem Auge ins Antlitz, setzte das brennende Licht verdrüßlich auf den Tisch und sagte halb lachend, halb zornig: Dummer Mensch! Konntest Du mir denn das nicht früher sagen?
Einem Salomo, antwortete jener, der Alles so genau kalkuliren und im weisheitsvollen Leben sich durch Nichts will stören lassen, sagen wollen, er brauche am hellen Tage keine Kerze, hieße sich doch zu viel herausnehmen.
Es ist zu toll! rief Freimund aus, und auch Sebastian erinnert mich nicht daran.
Wozu? antwortete Schwieger; sieh, Freund, Du, der zerstreuteste aller Menschen, nimmst es ja Jedem übel, der Dich auf diese Schwäche aufmerksam machen will. Neulich, als Du in Geschäften über Land reisen mußtest, als Du die Nacht gearbeitet hattest, und dort an Deinem Tische saßest – Sebastian! so riefst Du laut und heftig; der Alte kam; wir fahren gleich! Sieh nach, ob die Sonne schon aufgegangen ist. Sebastian ging, um aus dem andern Zimmer auf den Balkon zu treten. Dummkopf! Einfaltspinsel! Erschreckt kehrte Bastian um. Immer zerstreut und gedankenlos! schreist Du wieder; da, das Licht genommen! Der Alte, ohne die Miene zu verziehen, nahm die Kerze, leuchtete in das Morgenroth hinein, kam zurück und sagte: Alles hell und klar, der Wind hat's Licht ausgeblasen, konnte aber auch im Finstern die aufgehende Sonne bemerken. Du hörtest nicht einmal auf seine unschuldige Bosheit und sprangst in den Wagen, und als ich Dich beim Abschied bitten wollte, Deinen Leuten keine solche Blöße zu geben, warst Du gegen mich grob, und vergaßest alsbald wieder, wovon die Rede gewesen war. Du hast genug mit Dir selber zu kämpfen, es braucht keines Zufalls und keiner Verwicklung, um Deine Plane zu kreuzen und Dich zu beängstigen.
Freimund setzte sich verdrüßlich nieder. Kann man denn wohl Alles, wenn man viele Geschäfte betreibt, so genau im Kopfe behalten? Eines verdrängt das Andre, fuhr er schmollend fort, und so jetzt: die Verheirathung meiner Tochter ist es ja doch vorzüglich, die mich in diese Unruhe bringt. Aussteuer, guter Rath, väterliche Zärtlichkeit, das Vermögen, das ihr zukommt, Beredsamkeit, sie zu stimmen, Abrathen von einer dummen Liebe, und dabei noch alle die Arbeiten, die mir als königlichem Rathe auf dem Halse liegen.
Wenn man Dich erinnern darf, fing Schwieger wieder an: was suchtest Du so emsig und auf so complicirte Weise?
Der Alte fuhr auf. Schweig mit Deinen Erinnerungen! rief er, es ist das Dokument über die zehntausend Thaler, die meine Tochter haben soll, – wenn es fort ist – es kann auch drüben, – doch nein! es muß hier stecken. Nur jetzt gleich, denn ich hatte es wirklich schon wieder vergessen.
Er suchte von neuem mit großem Eifer. Bald war der Schrank ziemlich ausgeräumt, die Papiere, Akten, Briefe lagen auf dem Boden zerstreut, indeß Schwieger behaglich auf dem Sofa saß und mit großer Gemüthsruhe diesem Treiben zuschaute. Was das für ein ordentlicher Geschäftsmann ist! sagte er endlich schmunzelnd; wie er doch jedem, noch so kleinen Blättchen in der größten Eile sein Plätzchen anzuweisen versteht!
Endlich! endlich! rief Freimund triumphirend aus; ich wußte ja, daß das Ding hier stecken mußte! Meine Ordnung ist nur eine etwas andere, als die der übrigen Menschen.
Und es ist wirklich Dein Ernst, Deine Tochter mit dem Herrn von Dobern zu vermählen? Und Du weißt doch –
Alles weiß ich! rief Freimund unwillig und den alten Freund unterbrechend. Sie wird, sie muß. Der Mann ist wohlhabend, angenehm, wird eine sehr gute Karriere machen, sie liebt Niemand, und wenn auch: Du kennst meine Grundsätze darüber! am wenigsten kann von dem jungen Hauptmann die Rede seyn; dessen Vater mich so tödtlich beleidigt hat.
Der Diener ward herbeigerufen, damit die Papiere wieder in den Schrank konnten gepackt werden. Zugleich erschien der junge Mansfeld, ein Freund des Hauses, der den beiden Alten sehr behülflich war, indeß der träge Schwieger aller Verwirrung und Unruhe gelassen zusah, ohne auch nur die Miene zu machen, als wenn er seinen Beistand anbieten wollte. Halt da! halt da! rief plötzlich Freimund; hergegeben! das ist wegen meines kleinen Gütchens der Kaufcontract, den habe ich auch schon die ganze Woche vergeblich gesucht.
Das Zauberschloß? fragte Mansfeld; wir sollen es, wie Sie gewünscht haben, morgen einweihen?
Ja, sagte Freimund, aber lassen Sie mir nur den dummen Namen weg, wenn wir Freunde bleiben sollen; Graupenheim heißt das Ding, und den rechtlichen alten Namen soll es auch behalten. Alle jene losen Mährchen, die man dem kleinen Hause hat aufhängen wollen, sind eben so schlecht erfunden, als unwahrscheinlich und abgeschmackt. Das ist auch ein rechtes Zeichen der Zeit, daß dergleichen Thorheiten jetzt geliebt und als etwas Besondres angesehen werden, oft sogar von Leuten, die nicht zu dem belletristischen Wesen gehören.
Erlauben Sie, geehrter Herr Rath, rief Mansfeld aus, uns jungen Leuten der neuen, erleuchteten Welt werden Sie doch zulassen müssen, daß wir die Dinge anders, als unsre Vorfahren ansehn dürfen. Sehn Sie, alter Herr, so wie diese mit der blanken baaren Vernunft zufrieden waren, ja selbst mit dem klaren Verstande, ohne sich um die Tiefen der Philosophie zu kümmern, so begnügten sie sich auch mit seichtem Spaß und oberflächlichen Erfindungen, ohne von Phantasie und deren Wundern etwas zu erfahren. Bester Mann, diese Geheimnisse, die Geisterwelt, die Psychologie, der Magnetismus, die Erscheinungen, die den Somnambulen werden, der prophetische Schlaf, die große Einsicht in die Natur und deren neu entdeckte Kräfte, – kommen Sie, ich will nur eine einzige Erzählung unsers geistreichen Hoffmann vorlesen, und Sie sollen als ein anderer Mensch von Ihrem Stuhle aufstehn!
Lassen Sie mich zufrieden, erwiederte Freimund, ich habe mehr zu thun, als mir durch Gespenstergeschichten die Zeit zu vertreiben, und mich durch Schauder bei diesem heißen Wetter abkühlen zu lassen. Gehen Sie zu meinen Weibsleuten, dort kommen Sie mit dergleichen Schnurren besser an.
Der junge Mansfeld befolgte gern diesen Rath, er verließ freudig die beiden grämlichen Alten, um sich zur Tochter des Hauses zu begeben, die mit der Mutter und einer jungen Freundin im kühlen Gartenzimmer mit weiblichen Arbeiten beschäftigt waren. Sie empfingen ihn freundlich, weil er ihnen immer etwas Neues zu erzählen wußte, vorzüglich aber die blonde Jugendfreundin Louisens, deren Wohlwollen fast die Miene der Zärtlichkeit annahm. Graupenheim, nahm Mansfeld das Wort, ist nunmehr Ihr Eigenthum, und ich freue mich, daß wir uns morgen Alle dort treffen werden, um die Besitznahme feierlich und mit einem Feste zu begehen.
Mir ist es leid um diesen Kauf, antwortete die Mutter; mein Mann, der doch älter wird, läßt sich mit zu verschiedenen Geschäften ein, sein Gedächtniß wird schwächer, die Verwaltung des Hauses hier, des großen Gutes und nun noch –
Und zwar, fiel Louise ein, ein so gespenstisches Nest, das in so üblem Rufe steht, wo Geister umgehen, Mord und Todtschlag vorgefallen ist, wo ich mich grauen werde, nur einen Augenblick, vollends in der Nacht, einmal allein zu seyn.
O allerliebst! rief die muntre Henriette, und klatschte in die Hände: – nein, liebstes Mütterchen, zu einem solchen Besitz muß ich Ihnen und meiner Louise Glück wünschen! Was ich mir das immer gewünscht habe, ein solches Sommerhaus zu bewohnen, wo es etwas unheimlich zugeht, wo einem alle die guten und schlechten Romane der Miß Radcliff in jeder dunkeln Stube, in einer Buchenlaube, oder in einem unterirdischen Gange beifallen! Statt daß man sonst fragt: sind die Schwalben schon eingekehrt? ist der Storch in sein altes Nest wieder gekommen? erkundigt man sich nun: Geht es Heuer viel um? Gerathen die Schauder in diesem Herbste gut? Was macht Ihr lieber guter Spuk? Läßt sich das graue Männchen wieder sehn? Welche Späße haben sich dies Jahr die Unterirdischen ausgedacht? Nein, nein, da muß ich bei Euch wohnen, und mein Stübchen muß recht einsam liegen! Abends, beim dämmernden Lampenschein lieset uns dann Mansfeld etwas recht Grauerliches vor, wir Alle entsetzen uns, keiner will zu Bette gehen, endlich nimmt man mit Herzklopfen Abschied, und ich sitze nun allein da und fahre vor meinem eigenen Schatten zurück und wage nicht das Licht zu putzen oder auszulöschen. Nun hört man's auf dem Gange schleichen, die Bäume rauschen so sonderbar, es schlägt so dumpf zwölf in der Ferne, – aber bei alle dem sagen Sie uns doch, Mansfeld, was hat man denn eigentlich gegen das allerliebste Häuschen, das in einer so schönen Gegend liegt?
Kindereien, antwortete Mansfeld, etwas Meuchelmord, ein grauser Fluch, ein so alltägliches Schicksalswesen, wie wir es in hundert Tragödien sehn, eine Sühne, die noch erwartet wird und die vielleicht die schöne Louise oder die muthwillige Henriette dort abbüßen und erfüllen müssen. Wer von uns nun etwa noch dort in Verzweiflung stirbt, wer noch in den Strudel dieser furchtbaren Begebenheiten hineingezogen wird, wer von uns den Andern, Sie verehrteste Frau von Freimund zum Beispiel, mit einem uralten Dolch ermorden, oder mit einer Limonade vergiften wird, das steht bei den Göttern.
Nein, lieber Herr Mansfeld, sagte die Mutter sehr verdrüßlich, einen solchen Spaß will ich mir verbeten haben. Mit solchen Dingen muß man niemals scherzen wollen, es geschieht ohnehin Unglück und Böses genug in der Welt, man braucht es nicht noch herauszufordern. Aber neugierig bin ich immer gewesen, was es mit dem Hause eigentlich für eine Bewandniß hat, was man sich wenigstens davon erzählt, und wenn Sie das wissen, mein junger Herr, so theilen Sie es uns mit. Noch ist es hell, wir sind nicht abergläubisch, die Sache wird auch, wie es so oft in der Welt geschieht, daß man Alles vergrößert und die blinde Furcht sich selber ohne Noth das Unbedeutende schrecklich ausmalt, so etwas Besonderes nicht seyn.
Wir haben, fing Mansfeld an, die gewisse Nachricht, daß die Gründung des Hauses jetzt etwa vor hundert und siebenzig Jahren mag geschehen seyn. Sie kennen die Gegend. Ueber dem Flusse hebt sich der weinbelaubte Hügel, mit Obst und Korn dazwischen, oben dann Waldparthieen, und zwischen diesen das anmuthige Haus, das der gemeine Mann nur das Zauberschlößchen nennt. Im dreißigjährigen Kriege soll hier, weil dieser Punkt den Fluß und das Ufer bestreicht, eine schwedische Schanze gewesen seyn. Nach dem Frieden baute ein alter Obrist sich hier an und wohnte mit seiner Familie in einem bequemen Hause. Nun traf es sich, daß die Tochter dieses Kriegsmannes, ein junges schönes Mädchen von achtzehn bis neunzehn Jahren, sich ohne Wissen und wider den Willen ihres Vaters in einen jungen Hauptmann verliebt und sich mit ihm versprochen hatte, dem der alte Obrist einen tödtlichen Haß geschworen, weil der Vater des Geliebten ihn vor vielen Jahren einmal empfindlich gekränkt und beleidigt haben mochte. Ein sehr reicher Gutsbesitzer hielt um das Mädchen an, und der Vater zwang die Tochter, diesem das Jawort zu geben. –
Louise wurde roth und die Mutter verlegen, Henriette lachte etwas zu schalkhaft und bedeutsam, und nach einer kleinen Pause fuhr Mansfeld, dem die Verlegenheit der beiden Frauen nicht entgangen war, in seiner Geschichtserzählung also fort: – Natürlich nun die gewöhnliche Verzweiflung, der junge Mann wüthend, die Tochter in Thränen, auf Schicksal, auf Himmel wird von beiden gelästert, was in jeder Lage immer unschicklich bleibt.
Eine sehr wahre Bemerkung, fügte jetzt die Mutter an, die die Tochter aufmerksam betrachtet hatte; doch ist die Geschichte, mein junger Herr, noch viel unbedeutender, als ich es mir vorgestellt, ich dächte also, wir ließen sie ganz fahren, denn ich bin gar nicht mehr neugierig.
Geduld, gnädige Frau, rief der junge Mann: das Bisherige war nur die erste einleitende Einleitung; sogleich werde ich Ihnen mit einigen gräßlichen Materialien aufwarten. – Der Jüngling, in der Angst und Verzweiflung, ohne Rath und Hülfe, von aller Welt verlassen und von seiner wüthenden Leidenschaft zu den verzweifeltsten Entschlüssen angetrieben, ruft, da der Himmel ihm nicht helfen will, die Hölle auf, giebt sich dem bösen Prinzip, von den poetischen Naturen Satan, Teufel und noch mit manchen andern Namen genannt, zu eigen: – so sagt die Tradition. – Indeß mag es seyn, wie es will, es entsteht wenigstens am Abend und in der Nacht ein solches Hexenwetter, Sturm, Regen, Gewitter, Blitz auf Blitz und Schlag auf Schlag, Geheul von Gespenstern, unsäglicher Wirrwarr, daß alle Hochzeitgäste, von blinder Angst ergriffen, durcheinanderlaufen, und endlich, wie das Toben nachläßt, man sich etwas beruhigt, der Bräutigam auch seine Sinne wiedergefunden hat, ist die Braut verschwunden.
Verschwunden? rief Louise verwundert aus.
Verschwunden, fuhr Mansfeld ruhig fort, ich erlaube mir keine Veränderung, sondern ich gebe Ihnen die Geschichte ganz so, wie sie im Munde des gemeinen Mannes lebt. Der Bruder, ein heftiger junger Mann, meint, unten am Abhang, dem Flusse zu, die weiße Gestalt seiner Schwester in der Windesbraut zu sehn, er springt vom Söller hinunter, ihr nach, und liegt zerschmettert, oder mit gebrochenem Halse unten, nicht fern vom Flusse, wo er erst mit Aufgang des Morgens gefunden wird.
Nun Gottlob, rief Henriette aus, einen Bruder, liebe Louise, haben wir wenigstens in Deiner Familie nicht; denn sonst hat diese Geschichte so etwas Anzügliches, oder Anwendbares, woraus man schon ein Exempel nehmen könnte.
Liebe Henriette, sagte die Mutter mit einiger Empfindlichkeit, Sie rechnen doch etwas zu viel darauf, daß mein Mann nicht zugegen ist und ich mich immer allzu nachsichtig zeige.
Beste Mutter, seufzte Louise, ist es nicht schon genug, daß Henriette mich kränkt? Und Sie, Herr Mansfeld, – diese Art, – ich weiß nicht –
O unglückseligster aller Legendenerzähler! rief der junge Mann aus, was kann ich denn für meine Geschichte, die erst zu langweilig und nun zu interessant gefunden wird! Ich setze Nichts hinzu, lasse Nichts hinweg, arbeite Nichts um, sondern folge so schlicht und ehrbar der alten Sage, daß ich, ohne auf einseitige Kritiken oder beschränktes Bedürfniß Rücksicht zu nehmen, tugendsam, sittig, still, einfältig und vor allen Dingen rechtgläubig in der Tradition vom Zauberschlößchen also fortfahre: der Vater, ein greiser Greis, stand mit seinem weißen, fluthenden Haar in der Zerstörung furchtbar einsam da, verfluchte die Tochter und die ganze Nachkommenschaft, und forderte den Himmel auf, die Unthat bis in das zehnte und zwanzigste Glied zu rächen, daß der Vater den Sohn, und der Sohn den Vater ermorden müsse, bis kein Sprößling des vermaledeieten Hauses mehr übrig sei. So starb er selbst in Verwünschungen, – und der Bräutigam hat – sich nachher anderswo vermählt.
Louise lächelte und Henriette lachte laut auf. O meine Damen, rief der Erzähler empfindlich, es kränkt, wenn man statt Thränen des Grauens, statt bleicher, verzerrter Angesichter, mit allen Materialien des Furchtbaren nur Lachen erregt. – Wie es sich nun denken läßt, wurde jener Ehemann, der den Pakt mit dem Bösen eingegangen war, weder tugendhaft noch glücklich: die junge Frau, von dem Unglück ihrer Familie tief erschüttert, war melancholisch, besonders da sie immer deutlicher die unheimliche Verbindung ihres Gatten spürte, und ihre Trauer wuchs fast bis zur Verzweiflung, als sie nun alle Tugenden des verschmähten Bräutigams immer heller glänzen sah, als sich ihr das schöne Glück jener Ehe immer deutlicher entwickelte. Unfriede, Zwist, täglicher Zank machten jede angenehme Häuslichkeit unmöglich, und die Kinder, die in diesem Elend heranwuchsen, waren so wenig zart, kindlich und lieblich, daß sie im Gegentheil schon früh alle Anlagen zu Bösewichtern verriethen.
O welches Glück der Liebe! sagte Henriette, betrachte nur dieses Gemälde, meine Louise, um Dich auf die rechte Bahn lenken zu lassen. Der Herr von Dobern, ein großer, schlanker, etwas finsterer und fast zu brünetter Mann von acht und vierzig Jahren, der niemals lächelt, niemals witzig ist, stets auf solide und auch wohl tugendhafte Handlungen sinnt, – und gegenüber Dein Carl, Hauptmann, leicht aufbrausend, liebenswürdig und eben darum verdächtig, der leichtsinnige Sohn eines noch leichtsinnigeren Vaters, – kannst Du denn wirklich noch wählen und zaudern?
Gut, daß mein Mann nicht zugegen ist, sagte die Mutter.
Der, antwortete schnippisch Henriette, wird doch immer wieder freundlich, wenn ich ihn recht freundlich ansehe. Der vortreffliche Herr von Freimund vergißt es nur täglich wieder von neuem: wie sehr er mich eigentlich liebt. – Aber weiter, mein Freund, in dieser schicksalsvollsten Schicksalsgeschichte.
Was ist noch zu erzählen? fuhr Mansfeld fort: Elend über Elend, Zwiespalt in der Familie, Bruder- und Schwesterhaß, Verfolgung, Neid. Der Fluch des Vaters, des alten, ging leider nur zu buchstäblich in Erfüllung. Die Enkel, als die frühere Generation gestorben war, zeichneten sich alle, wenn sie keine Bösewichter waren, durch Gebrechen des Geistes und des Körpers aus, Zwerge, Lahme, Bucklichte aller Art gab es in diesem Hause im Ueberfluß; manche wurden vor der Zeit kindisch, andre konnten gleich in der Jugend nichts begreifen, manchen versagte das Gedächtniß, einige waren wieder so zerstreut, daß sie ihren eigenen Namen zu Zeiten vergaßen.
Herr Mansfeld! rief die Mutter zornig, Sie vergessen sich und was Sie meinem guten, trefflichen Manne schuldig sind. Er ist kein Sprößling aus dieser Familie, wenn er gleich durch Kauf das unglückliche Gut an sich gebracht hat.
O weh! o weh! seufzte der Erzähler: kann man denn nichts Weltgeschichtliches, Romantisches, Zauberisches und Magisches erzählen oder andeuten, ohne irgend eine Wunde des Hörenden zu berühren? Ich schwöre noch einmal, daß ich nicht an unsern geehrten Freund gedacht habe, dessen Zerstreutheit, oder Abwesenheit, oder wie wir es nennen wollen, im Gegentheil von zu großem Fleiß und angestrengter Tugend herrührt und nichts mit dem Fluch oder den Sünden der Voreltern zu schaffen hat.
Fahren Sie nur fort, sagte Henriette, mit Entschuldigung wird die Sache nur schlimmer.
Wie gesagt, erzählte Mansfeld, Elend und Gebrechen so wie neue Sünden pflanzten sich, wie immer neu wucherndes Unkraut, in der gleichsam verzauberten Familie fort, und es blieb dunkel, wie viel von der Saat jenem Bösen gehöre, der mit dem Stammvater den Pakt damals abgeschlossen hatte. Endlich kam Haus und Erbe an einen jungen, schönen Mann von ausgezeichneten Tugenden –
Hier widerspricht sich nun die alte Sage vollkommen, warf Louise ein, und der Fluch scheint also längst getilgt.
Nur Geduld, rief der Erzähler, Sie werden sehn, wie der Fürst der Finsterniß das Geschlecht noch einmal zu Klarheit und Glanz auftauchen läßt, um den Untergang desselben noch tragischer zu machen. Dieser junge treffliche Mann war Soldat, er wohnte meist auf jenem kleinen Gute, welches ihm der Vater, ein würdiger Obrist, aber im Dienst eines andern Fürsten abgetreten hatte.
Also wieder ein würdiger Mann, sagte Henriette, und ich will wetten, der junge Mann ist ebenfalls Hauptmann.
Allerdings und ebenfalls, erwiederte Mansfeld, mögen Sie auch lachen, wie Sie wollen. Dieser junge Hauptmann also, in jeder ritterlichen Tugend geprüft, lebte, liebte, klagte, und war in seinem Glücke höchst unglücklich, denn wie ihn sein Mädchen auch anbetete, so war sein strenger Vater, ohne eben wichtige Ursache zu haben, der Verbindung doch mit der ganzen Kraft seines Charakters entgegen.
Das alte Lied, bemerkte Henriette; man verwundert sich sogar schon, wenn die Sache in einer Erzählung einmal anders erscheint.
Weil die jungen Leute, fügte die Mutter hinzu, immer nur auf ihrem Eigensinn beharren, den sie Liebe nennen: weil verständige Eltern, zu welchen auch Dein Vater, Louise, gehört, an die sogenannte Liebe nicht glauben wollen.
Ich weiß, sagte Mansfeld, Herr von Freimund hat darüber ein eigenes, merkwürdiges System, welches er uns jungen Leuten auch zuweilen vorträgt, um uns den Kopf zurecht zu setzen. Liebe, pflegt er zu sagen, ist nur als Leidenschaft und Raserei jenen tollköpfigen Poeten erlaubt, die uns dann jene fürchterlichen Tragödien ausarbeiten, welche uns die Haare aufsträuben und Thränen erregen, welche Trauerstücke einmal einem wohleingerichteten Staate eben so nothwendig als die Narrenhäuser sind. Ehen aber sollen nur nach Vernunft, Convenienz und Bequemlichkeit geschlossen werden, damit sie wahrhaft Glück hervorbringen und auch den Kindern wieder mittheilen können. Der Jüngling oder das Mädchen, welche geständig sind, daß sie lieben, setzen sich der Verachtung eines jeden Vernünftigen aus, und jeder ehrbare Bürger und Staatsdiener sollte auf ihre Beschimpfung und Bestrafung antragen. Wie man ansteckende Fieber, Wahnsinn oder ähnliche Unfälle behandelt, so und nicht anders sollte man mit denen umgehen, die sich für verliebt ausgeben. Hätten nur sechs Paare erst am Pranger gestanden, so würde die Furcht diese abgeschmackte Sitte bald vermindern und in einiger Zeit ganz vertilgen. Die spanische Inquisition sollte auf einige Zeit für diese giftige Lehre von der Liebe nachgeahmt und hierher verpflanzt werden. Eheleute, die sich mit Convenienz vermählen, um das Vermögen zu vergrößern und das Glück des Lebens im sichern Wohlstande zu finden und zu genießen, die sich erst bei und nach der Hochzeit kennen lernen: diese nur erleben die wahre Zärtlichkeit, die mit der Hochachtung ein und dasselbe Gefühl wird, diese nur verstehn es auch, die gegenseitigen Fehler zu übersehen und zu ertragen. Diese werden aber jene unsittliche Leidenschaft, die in unsern Tagen so oft für die Blüthe des Lebens gelten soll, eben so, wie der ächte Philosoph, verachten. – Nicht wahr, gnädige Frau, so lauten die Grundsätze Ihres Gemahls, und er hat auch gewiß nur in diesem Sinne als Bräutigam und junger Gatte Verlobung und Flitterwochen mit Ihnen durchlebt.
O junge, junge übermüthige Menschen, sagte die Mutter halb beschämt, halb lächelnd; ihr werdet auch einmal alt werden und hoffentlich alsdann anders seyn. Mein Mann hat sich seit ewigen Jahren allerhand Grillen und Flausen ausgesonnen, die er wohl jetzt ernsthaft meinen möchte. Hätte er immer so gedacht, so wären wir wohl nie mit einander bekannt geworden.
Louise stand auf und umarmte ihre Mutter heftig. Was ist Dir, Kind, rief diese, was weinest Du; was schluchzest Du denn? Wahrhaftig, wenn viele Bücher so gelesen werden, wie unser kleiner Zirkel hier die unzusammenhängende Geschichte anhört, so kann man sich vorstellen, welche Verwirrung durch Romane in Kopf und Herzen von unzähligen jungen Leuten erregt werden mag.
O Mutter! klagte Louise, so eben waren Sie noch so gut! Und nun sprechen Sie in demselben Augenblicke fast wie der Vater. – Doch weiter, mein lieber Mansfeld, sonst kommt Ihre Erzählung niemals zu Ende.
Wie Sie befehlen, nahm der Erzähler das Wort; auch ist nur wenig noch zu sagen übrig. – Der junge Hauptmann, der als der letzte der sonderbaren Familie das Zauberschloß bewohnte, war, wie schon bemerkt, ein trefflicher junger Mann. Nur litt er viel von den Gespenstern des einsamen Hauses. Bald, wenn eine kleine Gesellschaft am Herbstabend versammelt war und sich des Gesprächs, oder der Vorlesung eines guten Buches erfreute, streckte sich eine lange, bleiche, dürre Todtenhand aus der Mauer und fuhr dem Nächstsitzenden mit Eiseskälte über den Nacken. Ein andermal sah sich die Gesellschaft plötzlich durch einen kleinen, aschgrauen, im Winkel sitzenden Mann vermehrt, der, wenn alle in Schauder aufgelöst waren, wieder eben so plötzlich verschwand, als er erschienen war. In den Nächten hörte man oft seufzen und weinen, dann wieder mit Ketten klirren. Wie seltsames, gespenstisches Nachtgevögel schlug es an die Fenster und schwirrte in den Zweigen der nahen Bäume. Kein Dienstbote wollte bleiben, kein Nachbar wollte mehr das verdächtige Haus besuchen. Ein alter tauber Gärtner, der zugleich den Castellan vorstellte, war am Ende der einzige, der Muth genug behielt, es mit der ganzen Schaar der Geister aufzunehmen. Das Sonderbarste aber war, daß jener Pakt, her schon vor hundert Jahren die Familie unglücklich gemacht hatte, noch fortzudauern schien. Wenigstens versicherten alle Hausleute, sie hätten es erlebt, wie der junge Hauptmann sich unsichtbar machen könne. Er war oft plötzlich verschwunden, zu andern Zeiten war er wieder zugegen ohne daß ihn irgend Jemand hatte kommen oder sich entfernen sehn. Darum fürchtete alle Welt diesen jungen Mann, und Jeder war überzeugt, er müsse ein elendes und tragisches Ende nehmen. So kam es denn auch und zwar entsetzlicher, als es irgend ein Freund oder Feind hatte ahnden können. – Es war jetzt an der Zeit, daß er seinem Vater zum Trotz sich mit seiner Geliebten verbinden wollte. Sie, die unabhängig war, und die, ohne Eltern, von den entfernteren Verwandten sich Nichts wollte vorschreiben lassen, wohnte in der Nähe des verrufenen Zauberschlosses. Sie besuchte ihn dort auch oft in Gesellschaft von einigen Freundinnen, oder wenn er weibliche Gesellschaft, Verwandte und Bekannte bei sich hatte. Man sprach schon von der Vermählung, als der letzte Krieg mit Frankreich ausbrach, in welchem Deutschland seine Selbstständigkeit durch die seltensten und edelsten Opfer wieder errang. Der junge Hauptmann, Enthusiast wie alle Jünglinge jener Tage, trat sogleich, einer der ersten, als Freiwilliger ein. Der Krieg wälzte sich hieher. Der Vater, als Diener seines Fürsten, war auf der französischen Seite. Keiner wußte vom andern. denn der Lauf der Posten war unterbrochen. Es traf sich, daß die Geliebte, verlassen, bedrängt, von Gerüchten und dem immer näher rückenden Feinde beängstiget, hieher, nach dem Zauberschlosse, zum Bräutigam, ihre Zuflucht nahm. Er war entfernt. Wie verwundert, wie schmerzlich bewegt war er, als er sie in seiner Heimath fand, als sich sein Corps, dazu beordert, hierher bewegte. Rath, Hülfe, Nachfrage, Alles war zu spät, denn jede Stunde war die Erzeugerin wichtiger und trauriger Begebenheiten. Der Hauptmann sicherte die Geängstete, so gut er es vermochte, in seinem kleinen Hause. Schon hörte man von allen Seiten schießen, schon sah man in der Nacht ringsum Kriegsfeuer lodern. Jetzt zeigte sich, dem Strome gegenüber, eine große Abtheilung des feindlichen Heeres. Die Gegend um das Zauberschloß wurde noch mehr befestigt, man wußte aber, daß man sich gegen die Uebermacht nicht würde halten können. Die Braut konnte aber nicht nach der Stadt oder nach einem entfernteren Orte gesandt werden, weil die Franzosen ringsum die Gegend schon besetzt hatten. Sie beschloß, mit dem Geliebten zu sterben. Jetzt wurde von jenseit mit Granaten und Kanonen auf die diesseitigen Verschanzungen gewirkt. Die deutsche Parthei, zwar die Minderzahl, erwiderte kräftig, und ihr Muth war so fest, als wenn sie des Sieges gewiß sei. Boote, Kähne, Schiffe mit Mannschaft, mit Kanonen besetzt, wurden vom Ufer losgelassen, um sich der tapfer vertheidigten Position, die zugleich die Stadt beschirmte, zu bemächtigen. Der Hauptmann stand mit einem Theil seiner Mannschaft unten, hart am Ufer des Flusses, um den Uebergang des Feindes zu verhindern. Ein großes Boot kommt näher, in ihm ein vornehmer alter Offizier der Gegenparthei. Sie erkennen sich gegenseitig, der Vater ist es, der dem Sohne zuruft, sich gefangen zu ergeben, oder sich dem Heere des französischen Kaisers anzuschließen. Der Sohn, schmerzlich bewegt, so dem Vater gegenüber zu stehen, erwiedert, wie der Soldat es muß. Er zieht sich auf die Anhöhe zurück, und sieht nur, daß der Vater gerettet werden möge. Dieser landet. Flinten, Büchsen, Kanonen, alles arbeitet mörderlich hinauf und hinunter. Schon ist die erste Anhöhe erstiegen, die Uniform des Vaters, sein Feldzeichen ist von oben genau zu erkennen, und um so mehr, je mehr er sich dem Zauberschlosse nähert. Man rückt höher, die zweite Anhöhe ist, allem Widerstände zum Trotz, eingenommen. Man fährt Kanonen hinauf. Der Vater selbst kommandirt und richtet nach dem Schlößchen, ein Schuß fällt, und im innern Gemache stürzt die Braut, mit zerschmettertem Haupte, zu Boden. Da ergreift ein ungeheurer Schmerz den Sohn; er zielt mit der Flinte, drückt ab, und der Vater fällt und liegt in seinem Blute. Das Pistol aus dem Gürtel reißend, in Verzweiflung die Mündung vor die Stirn setzend, noch einmal den Namen Louise, der Geliebten, nennend, liegt der Hauptmann getödtet neben der unseligsten aller Bräute.
Um Gottes Willen! schrie Louise laut und kreischend auf. Die Mutter lief zu ihr und nahm sie in die Arme. Böser Mensch, sagte sie, so mein Kind zu ängstigen und zu erschrecken!
Nein, es ist unerträglich, rief Louise, noch blaß und zitternd aus, alle diese neumodigen Geschichten sind mir mehr als verhaßt; eine schreckliche Angst ergreift uns, wenn so das Leben und Alles, was den Inhalt desselben ausmachen kann, auf eine unsinnige Spitze hinaufgetrieben wird, um das als das Vergänglichste und Aberwitzigste hinzustellen, was als das Festeste und Nochwendigste uns immerdar trösten und beruhigen muß.
Sonderbar! sagte Mansfeld; ich soll etwas allgemein Bekanntes erzählen, und werde von meinen Zuhörerinnen, die es mir befohlen haben, nach der Reihe ausgescholten. Und doch ist es nur der Name Louise, der Sie, Theuerste, zuletzt so über die Gebühr erschreckt hat, denn sonst ist für unser Jahrzehend diese Geschichte eine fast alltägliche zu nennen. Während meines Vortrages haben Sie sich überhaupt den Fehler zu Schulden kommen lassen, daß Sie sich alle immer mit den dargestellten Personen verwechselten; darüber ist das reine unbestochene Interesse verloren gegangen. – Das Schlößchen selbst wurde aber bei diesen Kriegsvorfällen fast ganz zerschossen und verbrannt; es ist erst nach dem Frieden wieder von einem weitläufigen Verwandten des letzten Besitzers hergestellt worden, und zwar in der Art und Weise, wie wir es Alle kennen. Daß aber seitdem der Spuk wilder als jemals tobt, daß Kobolde Tag und Nacht das Haus und selbst die Gegend beunruhigen, daß Pferde dort wild und Hunde und Stiere toll werden, daß alle Sorten von Geistern sich zeigen und Ahndungen, Stimmen, Geschrei, Geheul dort rumoren und ihr Wesen treiben, ist Jedem begreiflich und nichts weniger als räthselhaft, der nur etwas mit der Etikette und den ganz natürlichen Folgen solcher unnatürlichen Blutschuld und so gräßlichen Mordes bekannt ist.
Und in dem unglückseligen Hause, klagte die Mutter weinend, sollen wir nun wohnen?
Louise sagte: der Eigentümer, wie mir schon gestern Herr Mansfeld sagte, soll es bloß wegen des tausendfachen Elends, was er dort schon erlebt, meinem Vater verkauft haben.
Alles, fügte Mansfeld hinzu, ist noch lange nicht gesagt und geschildert, denn dazu wird mehr Zeit erfordert. Entsetzlich ist es auf jeden Fall und kann wieder neue tragische Folgen nach sich ziehen.
Ja, ja, sagte der alte Freimund, der schon seit einiger Zeit in der Dämmerung des Hintergrundes stand, ohne daß einer sein Eintreten bemerkt hatte, so ist es, und die Einweihung des furchtbaren Ortes, so wie das Verlöbniß meiner Tochter soll heute oder morgen gefeiert werden. Und ohne Widerrede zwar und ohne den Einspruch irgend eines dummen Gespenstes.
*
Der Hauptmann Carl von Wildenstein saß am Fenster seiner Wohnung, neben ihm sein Freund Ferdinand. Die Reiter begaben sich nach vollendetem Manöver in ihre Quartiere und zogen durch das lichte, offene Städtchen mit fröhlicher Feldmusik. Carl war finster und übel gelaunt, er schien sehnlich jemand zu erwarten, denn immer wieder sah er mit gespanntem Auge nach dem Ausgang der Gasse, die ins Feld hinausführte. Ich bin in der bedrängtesten Lage von der Welt, rief er endlich aus: keine Nachricht von ihr, und mein Vater, der mir helfen sollte, läßt auch auf sich warten! Der alte Mann, der über Alles lacht, meint immer, es werde sich schon geben, für jedes Unglück sei auch ein Mittel da, man müsse niemals die Hoffnung aufgeben, am wenigsten verzweifeln. Als wenn hier noch viel zu erwarten wäre! Auf welchen Zufall soll ich denn rechnen? – Endlich! rief er mit fröhlicher Stimme. Ein Note kam keuchend und ermüdet an, und übergab einen kleinen Brief. Mit jedem Worte, das der Hauptmann vom Blatte gierig las, ward seine Miene finsterer, seufzend faltete er das Papier wieder zusammen und warf sich mit dem Ausdruck des bittersten Verdrusses in den Stuhl. Nun? fragte Ferdinand, keine Hülfe, kein Trost, keine Aussicht? Lies selbst! antwortete der Hauptmann: mein Sinnen ist zu Ende; wenn kein Zufall, kein Glück vom Himmel fällt, so kommt aller Rath zu spät.
Ferdinand las: »Mein Geliebter, wie es werden soll, begreife ich nicht. Mein Vater ist dem Deinigen unversöhnlicher, als jemals; morgen sollen wir auf dem sogenannten Zauberschlosse, dem neu angekauften kleinen Gute, Nachmittag und Abend zubringen. Das Fest der Einweihung soll zugleich durch den Herrn von Dobern verherrlicht werden, an den schon geschrieben ist, und welcher gewiß nicht ausbleiben wird. Kommt er, so weiß ich nicht, wie ich dieser verhaßten Verlobung, die am nehmlichen Abend, morgen, ausgesprochen werden soll, entgehen kann. Denn mein Vater nimmt keine Einwendungen an, und selbst das Vermitteln des Deinigen würde uns nicht weiter führen, man würde den General gewiß nicht anhören, ihn sogar nicht vorlassen, wenn er auch persönlich erscheinen wollte. An meiner Mutter habe ich auch keine Hülfe, die, ob sie gleich das Verfahren des Vaters nicht ganz rechtfertigen kann, doch viel zu schwach ist, mit einem bestimmten Widerspruch gegen ihn aufzutreten. Du bist als Soldat gebunden: und sollten wir denn wagen, der Welt ein Aergerniß zu geben, damit Du Dich nachher Dein Leben hindurch unglücklich fühltest? Wenn ich mich auch krank stellte, und mein Befinden ist in der That so, daß nicht viel Heuchelei nöthig wäre, so würde auch dies nicht weiter führen, denn über alle diese Schwachheiten, wie er sie nennt, lacht nur mein Vater. Wenn der verhaßte Bräutigam sich nur nicht meldete, so wäre wohl die nächste und sicherste Hoffnung, daß der Vater auf einige Tage, vielleicht auf länger, die ganze Sache vergessen würde, so wie es ihm so oft begegnet. Aber wie schwach ist dieser Trost! denn der Verhaßte, dessen Ankunft ich fürchte, ist nicht so zerstreut und vergeßlich. Ich bin der Verzweiflung nahe. Weißt Du keinen Rath und keine Hülfe, so bin ich verloren! Mit Thränen umarme ich Dich.
Louise.«
Eine so verwünschte Situation, rief Ferdinand, wie es nur irgend eine im Leben geben kann! Wäre sie nur fort, aus dem Hause, irgend wohin entflohn, oder entführt.
Den Muth hat sie leider nicht, antwortete der Hauptmann, und ich darf keinen Schritt thun, der mich als Officier compromittirt.
So können wir also nur lamentiren, erwiederte der Freund. Wie kommt aber nur dieser seltsame Haß in Eure Familien? Dein Vater, der General, ist ja die Güte selbst und so heitern Frohsinns, daß er mit allen Menschen leicht zu leben weiß, er ist mit Niemand verfeindet, und so wie man mir den Rath Freimund geschildert hat, ist er auch nicht von jenen Zornwüthigen, die überhaupt in unsern Tagen wohl nicht so zahlreich sind, als sie in vorigen Zeiten mögen herumgetobt haben.
Die Sache, erzählte der Hauptmann, ist lächerlich, wenn sie nicht mein Unglück herbeigeführt hätte. Der Handel, der den alten Freimund so empört und zum unversöhnlichen Feinde meines Vaters gemacht hat, ist schon vor siebzehn Jahren, oder noch längerer Zeit vorgefallen. Mein Vater stand damals als Major in jener großen Stadt an der Gränze. Freimund war dort Assessor. Die beiden Männer lebten als Freunde, so ungleich sie auch waren. Freimund war ernsthaft, verschlossen, ganz und gar den Geschäften hingegeben, Spaß, Muthwille, Laune und alle jene Schwänke und lustigen kleinen Abenteuer, die eine tolle Jugend unternimmt und veranlaßt, waren ihm verhaßt und verächtlich; führte er sein Geschäft und Leben mit einem fast steifen Ernst, so wurde er nicht selten in seiner Feierlichkeit um so mehr beschämt, wenn sein zerstreutes Wesen, das ihn schon damals charakterisirte, Scenen und komische Situationen herbeiführte, die Witz und Laune selber nicht lächerlicher hätten erfinden können. Doch war mein Vater der Erfinder eines Spaßes, den ich nicht loben mag und der die beiden Männer auf immer trennte. Das Militär und verschiedene vom Adel hatten in jener Stadt ein Privattheater errichtet, und mein Vater, wohl gebaut, heiter, belesen, mit einer schönen und ausdrucksvollen Stimme begab, galt in jenen Cirkeln für den Gelehrtesten und für den, welcher in den schönen Künsten die meiste Erfahrung hatte und das sicherste Urtheil besaß. So kam es denn, daß, ohne daß er es gesucht hatte, er nicht nur der vorzüglichste Schauspieler, sondern auch der Director der Anstalt wurde. Die höheren Stände nahmen an diesem Vergnügen den lebhaftesten Antheil, da sie seit lange eines guten wirklichen Theaters hatten entbehren müssen. Freimund ärgerte sich an dieser Unterhaltung, als störende Unziemlichkeit, die manchem Beamten unverhältnißmäßig viele Zeit koste, die den jungen Leuten ein eitles Vertrauen in den Kopf setze auf ein Talent, das sie doch nicht hätten, die Liebschaften abgerechnet, die sich dort anspönnen, so wie die Intriguen, die gegen Eltern und Vormünder in den Gang kommen müßten. Mein Vater suchte ihn zu begütigen und ihm die Sache aus einem froheren Gesichtspunkte vorzustellen, aber vergebens. Seine bittere Kritik war vielen Theilnehmern verdrüßlich, weil sich durch seine laut ausgesprochenen moralischen Betrachtungen manche junge, schöne Mädchen aus guten Häusern abhalten ließen, so öffentlich vor den Augen der ganzen Stadt in verliebten oder schalkhaften Rollen aufzutreten. Es ward daher der Stolz und die Aufgabe, welche die Eitelkeit vieler Mitglieder spornte, den strengen Moralisten, der bis jetzt noch nie einen Zuschauer hatte abgeben wollen, selber anzuwerben und zum Auftreten und Spielen irgend einer komischen Rolle zu bewegen. Diese Anträge wies er aber mit Zorn und Hohn zurück. Mein Vater, übermüthig sich vertrauend, ging mit den reichsten der Theilnehmer eine hohe Wette ein, daß er den Stoiker dennoch, und zwar recht bald zum Auftreten bewegen würde. Freimund hörte von dieser Anmaßung und schalt meinen Vater, der sein Geld an eine so tolle und widersinnige Wette verlieren müsse, da er ihm sein Ehrenwort gebe, daß er niemals, unter keiner Bedingung, in ein so unziemliches Ansinnen einwilligen würde. »Nun gut, sagte mein Vater lachend, so habe ich denn freilich eine bedeutende Summe verloren, und ich setze mich Deinem rechtmäßigen Tadel um so mehr aus, da ich schon Vater bin, und meine junge, schöne Frau mich gewiß mit noch mehr Erben beschenken wird. Doch, Freund, so groß ist meine Wuth zu wetten nun einmal, daß ich Dir dasselbe Spiel anbiete, wette auch mit mir, ich will auch Dir abgewinnen, oder Du sollst ebenfalls von meinem Leichtsinn Deinen Vortheil ziehen.« Freimund mußte selbst über diesen tollen Vorschlag lachen, weigerte sich lange, war aber gezwungen, endlich nachzugeben, und eine ziemlich hohe Summe wurde festgesetzt, die mein Vater verlor oder gewann, wenn innerhalb eines Jahres Freimund auf der Bühne mitspielend erschienen sei, oder eben so lange hartnäckig sein Auftreten verweigert habe. So vergingen einige Wochen. Mein Vater hatte aber nicht sowohl auf das theatralische Talent seines Freundes, oder auf jene Lust gerechnet, die auch wohl einmal den Ungeschickten antreibt, die Bretter zu betreten, als vielmehr auf jene Gabe der Zerstreutheit und des Vergessens, die dem fleißigen Freimund zuweilen selbst bei seinen Arbeiten störend war. Ein heiteres Lustspiel ward wieder gegeben, eines von jenen locker zusammengesetzten, in denen Scenen ohne Nachtheil fehlen können, wie man auch, ohne das Gedicht zu stören, andre hinein legen kann. Der Saal war überfüllt, mein Vater, der Regisseur war, hatte mit denen, die im Wechsel der Scene zunächst auftreten sollten, eine vorläufige unbestimmte Abrede getroffen. In einem Billet hatte er Freimund benachrichtigt, er müsse ihn noch an diesem Abend, wegen eines sehr nothwendigen Geschäftes, sprechen, er bäte ihn daher dringend, auf dem Theater selbst zu ihm zu kommen, wo er ihm in der Garderobe, oder hinter den Coulissen Alles das mittheilen wolle, woran ihnen beiden sehr viel gelegen sei und das keinen Aufschub vertrage. Zur bestimmten Stunde kam Freimund, und der Bediente meines Vaters führte ihn hinter den Scenen zu der Coulisse heraus, wo mein Vater schon, auf dem Theater, an einem Tische saß und durch einen extemporirten Monolog die Zwischenzeit ausgefüllt hatte. Der zerstreute Freimund, der wohl noch niemals auf einem Theater gewesen war, setzte sich ruhig und sicher meinem Vater gegenüber, und verlangte das so nöthige und dringende Anliegen zu erfahren. Mein Vater trug nun eine Sache vor, die im Stücke selbst auch abgehandelt wurde und die spielenden Personen in Verlegenheit setzte. Freimund gab als Rechtsgelehrter Rath und Entscheidung, sprach bestimmt, ganz in seinem Charakter, mit dem mürrischen Humor, den er nur selten ablegt, und ergötzte die Zuschauer, die über sein Auftreten höchlichst erfreut waren, ungemein. Mein Vater, der immer gefürchtet hatte, Freimund würde gleich in der ersten Rede die Hinterlist bemerken und den Saal voller Zuschauer wahrnehmen, spann nun die Scene weiter aus, da der arglose Mitspieler in dem festen Vertrauen war, er säße weit hinter der Bühne, und keinen Blick nach den Zuschauern hinwendete. Die Freude dieser wurde aber bis zum Entzücken erhöht, als in übermüthigster Laune mein Vater, nachdem das erste Thema erschöpft war, die Bosheit so weit trieb, jene Bitte, daß Freimund sein schönes Talent doch einmal auf dem Theater versuchen möge, jetzt zu wiederholen. Freimund gerieth in seinen gewöhnlichen Eifer, stand auf und sagte im Zorn alle die Reden und Betrachtungen her, die man von ihm schon sonst gehört hatte: er soll, so erzählte man, damals ganz vortrefflich gespielt haben. Als die Scene lang genug zum allgemeinen Ergötzen gewährt hatte, brach er auf und rief nach dem Bedienten, der ihn wieder aus den labyrinthischen Gängen des dummen, dämmernden und doch blendenden Theaters auf die verständige, redliche Straße hinaus geleiten sollte. Der Bediente erschien und er ging. Aber nun erhob sich vom Saale her ein so rauschender Beifall, ein solches Schreien, Bravorufen und Toben, daß der arme Getäuschte wohl seine Blicke dahin richten mußte, von woher dieser laute Sturm brüllte. Nun merkte er, daß er die ganze Zeit über auf dem Theater gestanden und gehandelt hatte. Er schoß einen wüthenden Blick auf meinen Vater und lief ab, nachdem er im Zorn erst mit dem Kopf gegen die Coulisse gerannt war. Ein ungeheures Schreien: »Herr Freimund heraus!« ertönte aus allen Kehlen. Fächer klatschten, Tücher wehten, Stöcke und Hände und Füße arbeiteten und das wilde, erschreckende Geschrei der lachenden und begeisterten Zuschauer vermehrte sich mit jeder Minute. Betäubt stand Freimund an der Scene, ein Mitspielender faßte ihn an der Hand und führte jenen, der nicht wußte, wie ihm geschah, an das Proscenium, wo der Jubel, das Klatschen und Bravorufen ihn von neuem, wo möglich noch verstärkt, empfing. Mein Vater bereute jetzt den zu weit getriebenen Scherz, und wollte den geängsteten Freund zurückführen, dieser stieß ihn aber mit dem Ausdruck des größten Abscheus von sich und rannte nach seiner Wohnung. Am folgenden Morgen erhielt mein Vater von Freimund jene ansehnliche Summe, um welche sie gewettet hatten, nebst einem kurzen Billet, in welchem statt des vertraulichen Du, welches unter den Freunden geherrscht hatte, das fremdere Sie sich vernehmen ließ. Freimund schrieb, er könne vielleicht als Advokat gegen den Gewinn der Wette Einwendungen machen, da es noch nicht so ausgemacht sei, ob er eigentlich als Comödiant gespielt habe, indessen sei ihm unter jetzigen Umständen dieser Verlust gleichgültig, und er sende ihn daher gern, zugleich schicke er aber auch die bisherige Freundschaft mit, die ihnen Beiden jetzt nur lästig fallen könne. Er ließ sich nicht wieder öffentlich sehen und die Regierung gab seinen dringenden Bitten nach, ihn nach zwei Wochen dorthin zu versetzen, wo er seitdem gelebt hat. Alle Versuche meines Vaters, sich ihm wieder zu nähern, alle seine Bitten, wie die von Befreundeten, sind vergeblich gewesen. Mein Vater war mit seinem ansehnlichen Gewinn, der diesen Verlust nach sich zog, nur sehr wenig zufrieden, das Theater gab ihm keine Freude mehr, welches auch einging, da er es nicht mehr betreten wollte, und so machte mein Vater die traurige Erfahrung, daß auch der heitere Muth sich, trunken und über das Maß hinausgetrieben, am gutmüthigen Freunde eben so versündigen könne, wie Neid, Bosheit und alle finstern Leidenschaften in ihrer Empörung es nur vermögen. Wissen konnte er damals freilich nicht, daß dieser zu weit getriebene Scherz auch die Freude meines Lebens vergiften würde.
Armer Freund! rief Ferdinand nach dieser Erzählung aus. Der Haß des Mannes läßt sich freilich auf diese Weise erklären und auch entschuldigen.
Sie wollten das Zimmer verlassen, als ihnen der Reitknecht des Generals entgegentrat und dem Hauptmann einen Brief überreichte. Schnell löste dieser das Siegel und las zu seinem Erstaunen folgende Zeilen:
»Geliebter Sohn,
Dein Elend geht mir zu Herzen. Kann man unglücklicher seyn, als Du es bist? Und das trostlose Gefühl, daß ich Dir nicht helfen kann, und mich in dieser Hinsicht so ganz ohnmächtig fühlen muß! Was Deinen Wunsch betrifft, Dir das bezeichnete Capital zu übermachen, so bin ich dermalen völlig unfähig, dieses Dein Gesuch zu erfüllen. Ich weiß wohl, und verstehe Dich, wenn Du mir schreibst, daß nach Bezahlung dieser Deiner Schulden Du ein frisches, andres, besseres Leben von vorn anfangen könntest. Weiß ich es doch auch aus meiner Jugend, daß man niemals so viel Credit hat, als wenn man alte, oft bemahnte Schulden endlich abstößt; die vormaligen unhöflichen Gläubiger werden dann plötzlich so artig, daß sie dem noch kürzlich mit Verlegenheit Bittenden die rückgezahlten Summen fast aufdrängen und neue Gelder hinzufügen wollen. Das ist aber alsdann das Gefährliche der neuen Lebensbahn, daß sie nach einem Jahre, kommt vollends Regenwetter und vielfältiges Gewitter oder gar Hagelschlag hinzu, so ausgefahren, unbrauchbar und abscheulich ist, daß die besten Wagen, mit herrlichem Vorspann, in dem Morast stecken bleiben, und der kürzlich Lebensmuthige sich jämmerlicher fühlt, als nur jemals. Das ist eine Ursache von den vielen, aus denen ich Dir, beim besten Willen, kein Geld senden kann, oder möchte, selbst wenn ich es hätte, wie ich es denn nicht habe. Dann habe ich auch noch einige andre Betrachtungen angestellt. Du bist verliebt, zum Sterben, zur Verzweiflung. Gut, ich kann Nichts dagegen einwenden, ich bin selbst jung gewesen, und Du kennst meine Gesinnungen über dieses Capitel. Aber – entweder Du liebst so unsterblich und himmlisch überirdisch, um zu heirathen, das heißt, um ein solider Mann, ein Hausvater zu werden, Kinder zu erzeugen und zu erziehn, und allen Einwohnern der Stadt, wenigstens der Gasse, in welcher Du wohnst, als ein Muster zu erscheinen. Gut und schön. Aber dabei Schulden? Verheimlichte? die der Vater nun nach zwei langen verschwiegenen Jahren so ohne nähere Untersuchung bezahlen soll? Da sehe ich keinen Zusammenhang, kein dramatisches Motiv, Nichts, was diese so unsolide Sache erklären oder rechtfertigen könnte. – Oder, Du liebst als ein hoffnungsloser Verzweifelter. Geziemt es denn einem desperaten Schwärmer, prosaische Schulden zu haben? Das klingt wieder nicht zusammen. Denke Dir den verzweifelten Schäfer Chrysostomus im Don Quixote, oder den Werther, oder Siegwart, oder den uralten verliebten Macias, selbst Romeo, der schon irdischer ist, Petrarca gar nicht einmal zu erwähnen; wenn diese in ihrer überschwenglichen Liebespein bei ihren Anverwandten oder Vorgesetzten angehalten hätten, unsentimentale Schulden zu bezahlen! Sieh, mein Sohn, in dieser hohen Poesie des Lebens und des verklärten Herzens muß so etwas prosaisch Gemeines gar nicht einmal genannt werden, wie Poins auch nicht Unrecht hat, daß Harry's Durst nach Dünnbier, indem er kaum den Percy erschlagen hat, etwas ganz Ungeziemliches sei. Um Dir aber einigermaßen genug zu thun, habe ich die beiden vortrefflichen Rappen, Deine Wagenpferde, hier behalten: Du, ein Cavallerist, dem ich und der Fürst brauchbare Pferde halten, brauchst keine Equipage. Ich habe die beiden trefflichen Renner verkauft, und zwar unter dem Preise, um nur etwas Geld in die Hand zu bekommen, damit diejenigen Deiner Schulden, die Du mir als die allerdringendsten bezeichnest, zu tilgen. Seltsam ist es übrigens, daß der Mann, den Du gern zum Schwiegervater hättest, der sich aber auf keine Weise dazu hergeben will, die raschen Wagenpferde gekauft hat, weil er sie unter dem Preise haben konnte. Zwar weiß er es nicht, denn ein Fremder war der Unterhändler, daß sie uns gehören. Hätte er es erfahren, hätte er sie gewiß nicht genommen. Deinen jungen, schmächtigen, katzenartigen, schnellen und gewandten Jockei habe ich auch deshalb lieber in meinen eigenen Dienst genommen, damit er Dir keine unnöthige Ausgabe mehr verursachen möge. Du siehst vielleicht früher, als Du es denkst. Deinen
zärtlichen Vater.«
Das ist es, sagte der Hauptmann, wenn man einen witzigen Vater hat! Die Rappen schwatzt er mir ab, um sie kennen zu lernen, verkauft sie, behält meinen Jungen dort, und Alles zu meinem Besten! Mit den Pferden war vielleicht eine Entführung zu veranstalten, – jetzt – o ich bin in Verzweiflung!
Der General ist aber, warf der Freund ein, weder lieblos noch einfältig – –
Halten wir uns, seufzte der Hauptmann, noch etwas an diesem schwachen Anker.
*
Im heißen Wetter war der junge Mansfeld mit dem alten Schwieger den Fluß hinunter gefahren. In einiger Entfernung vom romantisch gelegenen Häuschen verließen sie das Boot, erstiegen den Hügel und wanderten langsam der einsamen Wohnung zu. Die Familie Freimunds wollte im Wagen folgen und Sebastian sollte die neugekauften Rappen regieren. In einem Küchenwagen wurden Wein, einige Pasteten, Gefrornes, und was sonst bei der Hitze am schönen Abend angenehm erquicken konnte, nachgeführt. Der Bräutigam, so hoffte der Vater, würde dann mit der sinkenden Sonne, vielleicht etwas später, ebenfalls eintreffen.
Schwieger stieg keuchend den Hügel hinan. Warum, sagte er, als er oben stand, können dergleichen Expeditionen, wie eine Verlobung, nicht drinnen in der Stadt, in den bekannten vier Pfählen des Hauses vorgenommen werden? Aber zu Wasser gehen, sich hier hinan quälen, wohl gar im Freien essen, und dann Nachts spät, in einem stoßenden Wagen zurück, zur ungewohnten Stunde sich niederlegen, um wahrscheinlich gar nicht zu schlafen! Unser Freimund ist sonst ein solider, vernünftiger Mann, der aber doch auch seine excentrischen Seiten hat.
Die hat jeder Mensch, bemerkte Mansfeld, auch der trockenste, wenn man nur Gelegenheit hat, ihn näher kennen zu lernen, so wie es wohl keinen noch so phantastischen giebt, an welchem nicht irgendwo der Pedant zu entdecken wäre. Diese Mischung macht unsere Thorheit erträglich und unsere Tugend mild.
Das Leben selbst, erwiederte der träge Schwieger, ist aber schon mühsam genug; warum noch Nesseln hineinsäen, die wir Rosen nennen? Hier soll das Essen und das Trinken herausgeschleppt werden, wir müssen darnach wandern, die andern in der Hitze fahren, Wein und Speisen verderben, die Menschen werden müde und matt, wer weiß, ob das Wetter sich erhält, – und dies sind dann die sogenannten Vergnügungen der thörichten Menschenkinder!
Wenn Sie nicht verdrüßlich wären, antwortete Mansfeld. so würden Sie die Sache gewiß anders ansehn: betrachten Sie die schöne heitre Landschaft, den glänzenden Strom, diese Weinhügel, die lispelnden und rauschenden Wälder, den dunkeln, blauen Himmel.
Und die müden Beine, rief Schwieger, die zwischen allen diesen Herrlichkeiten humpeln und stampfen, als wollten sie diese Blumen des Gemüthes in den Boden fest rammen. Es fehlte noch, daß Sie schildern und beschreiben.