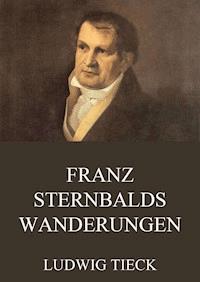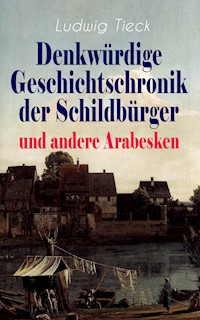Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Dies ist der dritte von drei Bänden mit den schönsten Erzählungen des 1853 in berlin verstorbenen Schriftstellers der Romantik. Enthalten sind folgende Erzählungen: Peter Lebrecht Pietro von Abano Weihnachtsabend Das grüne Band Almansur Ryno Der Naturfreund
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 534
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meine Erzählungen, Band 3
Ludwig Tieck
Inhalt:
Ludwig Tieck – Biografie und Bibliografie
Peter Lebrecht
Erster Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Eilftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes oder letztes Kapitel
Zweiter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Eilftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Pietro von Abano
Weihnachtsabend
Das grüne Band
Almansur
Ryno
Der Naturfreund
Meine Erzählungen, Band 3, L. Tieck
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849637705
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Ludwig Tieck – Biografie und Bibliografie
Dichter der romantischen Schule, geb. 31. Mai 1773 in Berlin, gest. daselbst 28. April 1853, Sohn eines Seilermeisters, besuchte seit 1782 das damals unter Gedikes Leitung stehende Friedrichswerdersche Gymnasium, wo er sich eng an Wackenroder anschloß, und studierte darauf in Halle, Göttingen und kurze Zeit in Erlangen Geschichte, Philologie, alte und neue Literatur. Nach Berlin zurückgekehrt, lebte er von dem Ertrag seiner schriftstellerischen Arbeiten, die er größtenteils im Verlag des Aufklärers Nicolai veröffentlichte. So erschienen in rascher Reihenfolge die Erzählungen und Romane: »Peter Lebrecht, eine Geschichte ohne Abenteuerlichkeiten« (Berl. 1795, 2 Bde.), »William Lovell« (das. 1795–96, 3 Bde.; vgl. Haßler, L. Tiecks Jugendroman »William Lovell« und der »Paysan perverti« des Rétif de la Bretonne, Dissertation, Greifsw. 1903) und »Abdallah« (das. 1796), ferner Novellen meist satirischen Inhalts in der Sammlung »Straußfedern« (1795–98), worauf er, seinen Übergang zur eigentlichen Romantik vollziehend, die bald dramatisch-satirische, bald schlicht erzählende Bearbeitung alter Volkssagen und Märchen unternahm und unter dem Titel: »Volksmärchen von Peter Lebrecht« (das. 1797, 3 Bde.) veröffentlichte. Den größten Erfolg errangen unter diesen Dichtungen die unheimlich düstere Erzählung »Der blonde Eckert« und das phantastisch-satirische Drama »Der gestiefelte Kater«. Die Richtung, die in seinen Schriften immer deutlicher hervortrat, mußte ihn in schroffen Gegensatz zu Nicolai sowie zu Iffland, dem Leiter des Berliner Theaters, bringen, während die Romantiker ihn begeistert anpriesen als ein Genie, das Goethe ebenbürtig sei. Nachdem er sich 1798 in Hamburg mit einer Tochter des Predigers Alberti verheiratet hatte, verweilte er 1799–1800 in Jena, wo er zu den beiden Schlegel, Hardenberg (Novalis), Brentano, Fichte und Schelling in freundschaftliche Beziehungen trat, auch Goethe und Schiller kennen lernte, nahm 1801 mit Fr. v. Schlegel seinen Wohnsitz in Dresden und lebte seit 1802 meist auf dem Gute Ziebingen bei Frankfurt a. O., mit dessen Besitzern (erst v. Burgsdorff, dann Graf Finkenstein) er eng befreundet war. Doch unterbrach er diesen Aufenthalt durch längere Reisen nach Italien, wo er die deutschen Handschriften der vatikanischen Bibliothek studierte (1805), sowie nach Dresden, Wien und München (1808–10). Während dieses Zeitraums waren erschienen: »Franz Sternbalds Wanderungen« (Berl. 1798), ein die altdeutsche Kunst verherrlichender Roman, an dem auch sein Freund Wackenroder Anteil hatte, »Prinz Zerbino, oder die Reise nach dem guten Geschmack« (Jena 1799), und »Romantische Dichtungen« (das. 1799–1800, 2 Bde.) mit dem Trauerspiel »Leben und Tod der heil. Genoveva« (separat, Berl. 1820) sowie das nach einem alten Volksbuch gearbeitete Lustspiel »Kaiser Octavianus« (Jena 1804), weitschweifige Dichtungen, in denen das erzählende und namentlich das lyrische Element überwiegt, aber aus einem Gewirr mannigfaltigster metrischer Ausdrucksformen gelegentlich doch echte Schönheit hervorleuchtet (vgl. Ranftl, L. Tiecks »Genoveva« als romantische Dichtung betrachtet, Graz 1899). Von den zahlreichen Übersetzungen und Bearbeitungen fremder Werke, die T. damals veröffentlichte, seien erwähnt: die fehlerhaften »Minnelieder aus der schwäbischen Vorzeit« (Berl. 1803), die gelungene Verdeutschung des »Don Quichotte« von Cervantes (das. 1799–1804, 4 Bde.), die wertvolle Übersetzung einer Anzahl Shakespeare zugeschriebener, aber zweifelhafter Stücke u. d. T.: »Altenglisches Theater« (das. 1811, 2 Bde.) u. a. Auch gab er u. d. T.: »Phantasus« (Berl. 1812–17, 3 Bde.; 2. Ausg., das. 1844–45, 3 Bde.) eine Sammlung früherer Märchen und Schauspiele, vermehrt mit neuen Erzählungen und dem Märchenschauspiel »Fortunat«, heraus, welche die deutsche Lesewelt lebhaft für T. interessierte. Das Kriegsjahr 1813 sah den Dichter in Prag; nach dem Frieden unternahm er größere Reisen nach London und Paris, hauptsächlich im Interesse eines großen Hauptwerks über Shakespeare, das er leider nie vollendete. 1819 verließ er dauernd seine ländliche Einsamkeit und nahm seinen Wohnsitz in Dresden, wo nun die produktivste und wirkungsreichste Periode seines Dichterlebens begann. Trotz des Gegensatzes, in dem sich Tiecks geistige Vornehmheit zur Trivialität der Dresdener Belletristik befand, gelang es ihm, hauptsächlich durch seine fast allabendlich stattfindenden dramatischen Vorlesungen, in denen er sich als Meister in der Kunst des Vortrags bewährte, einen Kreis um sich zu sammeln, der seine Anschauungen von der Kunst als maßgebend anerkannte. Als Dramaturg des Hoftheaters (seit 1825) gewann er eine bedeutende Wirksamkeit, die ihm freilich durch Angriffe der Gegenpartei mannigfach verleidet wurde. In der Novellendichtung, der sich T. in dieser Dresdener Zeit vor allem widmete, leistete er zum Teil Vortreffliches; aber er bahnte auch jener bedenklichen Gesprächsnovellistik den Weg, in der das epische Element fast ganz hinter dem reflektierenden zurücktritt. Zu den bedeutendsten zählen: »Die Gemälde«, »Die Reisenden«, »Der Alte vom Berge«, »Die Gesellschaft auf dem Lande«, »Die Verlobung«, »Musikalische Leiden und Freuden«, »Des Lebens Überfluß« u. a. Unter den historischen haben »Der griechische Kaiser«, »Dichterleben«, »Der Tod des Dichters« und vor allen der großartig angelegte, leider unvollendete »Aufruhr in den Cevennen« Anspruch auf bleibende Bedeutung. In allen diesen Novellen befriedigt nicht nur meist die einfache Anmut der Darstellungsweise, sondern auch die Mannigfaltigkeit lebendiger und typischer Charaktere und der Tiefsinn der poetischen Idee. Sein letztes größeres Werk: »Vittoria Accorombona« (Bresl. 1840), entstand unter den Einwirkungen der neufranzösischen Romantik und hinterließ trotz der Farbenpracht einen überwiegend peinlichen Eindruck.
T. übernahm in Dresden auch die Herausgabe und Vollendung der von A. W. v. Schlegel begonnenen Shakespeare-Übertragung (Berl. 1825–33, 9 Bde.), doch hat er selber nur die Anmerkungen beigesteuert. Die Übersetzungen A. W. v. Schlegels (s. d.) wurden zum Teil mit eigenmächtigen Änderungen wieder abgedruckt, die übrigen Stücke übersetzten Tiecks Tochter Dorothea (geb. 1799) und Wolf Graf von Baudissin (s. d.). Diese beiden verdeutschten auch noch sechs weitere Stücke des alten englischen Theaters, die T. als »Shakespeares Vorschule« (Leipz. 1823–29, 2 Bde.) mit ausführlicher literarhistorischer Einleitung herausgab. Ebenso stammen aus dieser Zeit mehrere mit Einleitungen versehene Ausgaben von Werken deutscher Dichter, auf die er die Aufmerksamkeit von neuem hinlenken wollte. So hatte er schon 1817 eine Sammlung älterer Bühnenstücke u. d. T.: »Deutsches Theater« veröffentlicht (Berl., 2 Bde.). Dann gab er die hinterlassenen Schriften Heinrichs v. Kleist (Berl. 1821) heraus, denen die »Gesammelten Werke« desselben Dichters (das. 1826, 3 Bde.) folgten, ferner Schnabels Roman »Die Insel Felsenburg« (Bresl. 1827) und die »Gesammelten Schriften« von J. M. R. Lenz (Berl. 1828, 3 Bde.). Aus seiner dramaturgisch-kritischen Tätigkeit erwuchsen die wertvollen »Dramaturgischen Blätter« (Bresl. 1825–26, 2 Bde.; Bd. 3, Leipz. 1852; vollständige Ausg., das. 1852, 2 Tle.). 1837 verlor T. seine Frau, seine Tochter Dorothea starb 21. Febr. 1841. In demselben Jahre wurde er vom König Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin berufen, wo er, durch Kränklichkeit zumeist an das Haus gefesselt, ein zwar ehrenvolles und sorgenfreies, aber im ganzen sehr resigniertes Alter verlebte. Sein Bildnis s. Tafel »Deutsche Romantiker« (Bd. 17). Seine »Schriften« erschienen in 20 Bänden (Berl. 1828–46), seine »Kritischen Schriften« in 2 Bänden (Leipz. 1848), »Gesammelte Novellen« in 12 Bänden (Berl. 1852–54), »Nachgelassene Schriften« in 2 Bänden (Leipz. 1855). »Ausgewählte Werke« Tiecks gaben Welti (Stuttg. 1886–1888, 8 Bde.), Klee (mit Biographie, Einleitungen und Anmerkungen, Leipz. 1892, 3 Bde.) und Witkowski (mit Einleitung, das. 1903, 4 Bde.) heraus. Aus Tiecks Nachlaß, der sich in der Berliner Bibliothek befindet, veröffentlichte Bolte mehrere Übersetzungen englischer Dramen, unter andern »Mucedorus« (Berl. 1893). Die Ungleichheit von Tiecks Leistungen ist z. T. auf sein improvisatorisches Arbeiten zurückzuführen, das ihn selten zu reiner Ausgestaltung seiner geist-, phantasie- und lebensvollen Entwürfe gelangen ließ; die Gesamtheit seiner Schriften verrät deutlich die Weite und Größe seines Talents. R. Köpke, der T. in den letzten Berliner Jahren nahe stand, veröffentlichte eine ausführliche Biographie u. d. T.: »Ludwig T., Erinnerungen aus dem Leben etc.« (Leipz. 1855, 2 Bde.). Vgl. außerdem H. v. Friesen, Ludwig T., Erinnerungen (hauptsächlich aus der Dresdener Zeit, Wien 1871, 2 Bde.); »Briefe an Ludwig T.« (hrsg. von K. v. Holtei, Bresl. 1864, 4 Bde.); Ad. Stern, Ludwig T. in Dresden (in dem Werk »Zur Literatur der Gegenwart«, Leipz. 1880); Steiner, Ludwig T. und die Volksbücher (Berl. 1893); Garnier, Zur Entwicklungsgeschichte der Novellendichtung Tiecks (Gieß. 1899); Mießner, L. Tiecks Lyrik (Berl. 1902); Ederheimer, Jak. Böhmes Einfluß auf T. und Novalis (Heidelb. 1904); Koldewey, Wackenroder und sein Einfluß auf T. (Leipz. 1904); Günther, Romantische Kritik und Satire bei Ludwig T. (das. 1907). – Tiecks Schwester Sophie T., geb. 1775 in Berlin, verheiratete sich 1799 mit Aug. Ferd. Bernhardi (s. d.), von dem sie 1805 wieder geschieden wurde, lebte dann in Süddeutschland und mit ihren Brüdern, dem Dichter und dem Bildhauer, längere Zeit in Rom, später in Wien, München und Dresden. 1810 schloß sie eine zweite Ehe mit einem Esthländer, v. Knorring, dem sie in dessen Heimat folgte, und starb dort 1836. Sie hat außer Gedichten, z. B. dem Epos »Flore und Blanchefleur« (hrsg. von A. W. v. Schlegel, Berl. 1822), auch Schauspiele und einige Romane, wie »Evremont« (hrsg. von Ludw. T., das. 1836), geschrieben.
Peter Lebrecht
Erster Teil
Erstes Kapitel
Vorrede
Lieber Leser, du glaubst nicht, mit welcher innigen Wehmut ich dich diese Blätter in die Hand nehmen sehe, denn ich weiß es voraus, daß du sie wieder wegwerfen wirst, sobald du nur einige flüchtige Blicke hineingetan hast. Da mir aber deine Bekanntschaft gar zu teuer ist, so will ich wenigstens vorher alles mögliche versuchen um dich festzuhalten; lies daher wenigstens das erste Kapitel, und wenn wir uns nachher nicht wiedersehen sollten, so lebe tausendmal wohl. –
Um deine Gunst zu gewinnen, müßte ich meine Erzählung ungefähr folgendermaßen anfangen:
»Der Sturmwind rasselte in den Fenstern der alten Burg Wallenstein. – Die Mitternacht lag schwarz über dem Gefilde ausgestreckt, und Wolken jagten sich durch den Himmel, als Ritter Karl von Wallenstein auf seinem schwarzen Rosse die Burg verließ, und unverdrossen dem pfeifenden Winde entgegentrabte. – Als er um die Ecke des Waldes bog, hört er neben sich ein Geräusch, sein Roß bäumte, und eine weißliche Schattengestalt drängte sich aus den Gebüschen hervor.« – –
Ich wette, du wirst es mir nicht vergeben können, daß ich diese interessante abenteuerliche und ungeheuerliche Geschichte nicht fortsetze, ob ich gleich, wie das der Fall bei den neueren Romanschreibern ist, selbst nicht weiß, wie sie fortfahren, oder gar endigen sollte.
In medias reswill ich gerissen sein! rufen die Leser, und die Dichter tun ihnen hierin auch so sehr den Willen, daß ihre Erfindungen weder Anfang noch Ende haben. Der Leser aber ist zufrieden, wenn es ihm nur recht schauerlich und grauerlich zumute wird. Riesen, Zwerge, Gespenster, Hexen, etwas Mord und Totschlag, Mondschein und Sonnenuntergang, dies mit Liebe und Empfindsamkeit versüßlicht, um es glatter hinterzubringen, sind ungefähr die Ingredienzien, aus denen das ganze Heer der neusten Erzählungen, vom Petermännchen bis zur Burg Otranto, vom Genius bis zum Hechelkrämer, besteht. Der Marquis von Grosse hat dem Geschmack aller Lesegesellschaften eine andere Richtung gegeben, aber sie haben sich zugleich an seinem spanischen Winde den Magen verdorben; mit Herrn Spieß hat man sich gewöhnt, überall und nirgends zu sein; und keine Erzählung darf jetzt mehr Anspruch machen, gelesen zu werden, wenn der Leser nicht vorhersieht, daß ihm wenigstens die Haare dabei bergan stehen werden.
Um kurz zu sein, lieber Leser, will ich dir nur mit dürren Worten sagen: daß in der unbedeutenden Geschichte meines bisherigen Lebens, die ich dir jetzt erzählen will, kein Geist oder Unhold auftritt ich habe auch keine Burg zerstört, und keinen Riesen erlegt; sei versichert, ich sage dies nicht aus Zurückhaltung, denn wäre es der Fall gewesen, ich würde dir alles, der Wahrheit nach, erzählen.
Auch muß ich dir leider noch bekennen, daß ich mich in keine geheime Gesellschaft habe einweihen lassen; ich kann dir also keine mystischen und hieroglyphischen Zeremonien beschreiben, ich kann dir nicht das Vergnügen machen, Sachen zu erzählen, von denen du nicht eine Silbe verstehst. –
Musäus faßte die glückliche Idee, durch seine Volksmärchen das Gewimmere und Gewinsle der Siegwartianer zu übertönen. Es ist ihm auch wirklich so sehr gelungen, daß das pecus imitatorum unzählbar ist. Alles hat sich rasch die Tränen der Empfindsamkeit aus den Augen gewischt, die Zypressen und Myrten im Haare sind verwelkt, statt der Seufzer hört man Donnerschläge, statt eines Billet doux oder eines Händedrucks, nichts als Gespenster und Teufel! –
Das ist jetzt auf der großen Chaussee der Messen ein Fahren und Reiten! Hier ein Schriftsteller, der mit seinem Helden geradewegs in die Hölle hineinjägt; dort eine Kutsche, hinter der, statt des Lakais, ein glänzender Genius steht; dort galoppiert ein andrer, und hat seinen Helden auf dem Pferde vor sich; dort wird einer sogar auf einem Esel fortgeschleppt, und droht in jedem Augenblick herunterzufallen; – o Himmel! man ist in einer beständigen Gefahr, zertreten zu werden! – Wohin ich sehe, nichts als Revolutionen, Kriege, Schlachten, und höllische Heerscharen! – Nein, ich vermeide diese geräuschvolle Landstraße, und schlage dafür lieber einen kleinen Fußsteig ein – was tut's, wenn ich auch ohne Gesellschaft gehe; vielleicht begegnet mir doch noch ein guter unbefangener Mensch, der sich, ebenso wie ich, vor jenen schrecklichen Poltergeistern fürchtet! –
Aber wird es nicht bald Zeit werden, meine versprochene Geschichte anzufangen? – Ich sehe, die Leser, die mir noch übriggeblieben sind, fangen auch schon an zu blättern, und sich wenigstens nach einigen Vorfällen umzusehn. – Zuvor muß ich aber doch noch um eine kleine Geduld ersuchen. –
Ich weiß nämlich nicht, ob die Lektüre meiner Leser nicht zuweilen in manche Fächer hineingeraten ist wo man sich daran gewöhnt, Schriftsteller recht viel von sich selbst sprechen zu hören. Doch, Sie werden ja wohl in manchen unsrer deutschen Journale bewandert sein.
Ich heiße, wie Sie vielleicht schon werden gemerkt haben, Lebrecht; ich wohne auf einem kleinen Landhause, in einer ziemlich schönen Gegend. Ich schreibe diese Geschichte also nicht aus einem Gefängnisse, noch weniger den Tag vor meiner Hinrichtung, ob es Ihnen gleich vielleicht außerordentlich vielen Spaß machen würde. Ich bin nicht melancholisch, noch engbrüstig, ebensowenig bin ich verliebt, sondern meine gute junge Frau sitzt neben mir, und wir sprechen beständig ohne Enthusiasmus oder zärtliche Ausrufungen miteinander; – ja, ich weiß am Ende wahrlich nicht, wo das Interesse für meine Erzählung herkommen soll. –
Sehn Sie, meine Geschichte ist zwar nicht ganz gewöhnlich und alltäglich, aber es fehlt ihr doch das eigentlich Abenteuerliche, um sie anziehend zu machen; – die einzige Hoffnung, meine schöne Leserinnen, die mir übrigbleibt, ist, daß Sie gerade von der Langeweile so geplagt werden, daß Sie mich aus bloßer Verzweiflung lesen.
Ich muß Ihnen also zuvörderst bekennen, daß ich ein Mitglied der katholischen Kirche bin. –
Nicht wahr, Sie lachen über die albernen Vorurteile, daß ich dies noch mit in Anschlag bringe?
Freilich ist man jetzt so aufgeklärt, daß man gar keinen Unterschied unter den Religionsparteien mehr macht; man fängt selbst an, die Juden nicht mehr für eine andere Art von Menschen zu halten; die beliebten Unterredungen und Dispüten drehen sich alle um diesen Gegenstand; man schätzt jede andre Religion mehr, als die, zu welcher sich unsre Eltern bekennen, ohne weder mit der einen noch der andern Partei bekannt zu sein – o was haben wir nicht in den neuern Zeiten für Fortschritte in der Toleranz gemacht!
Aber ich habe nun schon viele der eifrigsten Bekenner der Toleranz gesehen, die einen andern Menschen darum haßten, weil er ein Aristokrat nach ihrer Meinung war; jener wütete wieder gegen den Demokraten.
Ach, die meisten Menschen müssen immer einen Titel haben, unter welchem sie leben können. Der verfolgte Parteigeist ist aus der Religion in die Politik übergegangen; der Himmel verhüte, daß wir hier nicht ebenso entehrende Verirrungen des menschlichen Herzens erleben! –
Ich bin also, um es dem Leser noch einmal zu wiederholen, Katholik; (Demokraten und Aristokraten kannte man in jenem Zeitpunkt noch nicht, in welchen meine Geschichte fällt;) und zum Verständnis dieser Geschichte ist es notwendig, daß der Leser die Rubrik wisse, unter welcher ich als Bekenner des Christentums stehe; darum wird er mir die Mitteilung dieser Nachricht verzeihen.
Ich erinnere mich mit Vergnügen der Vergangenheit; möge es dem Leser nicht beschwerlich fallen, mir zuzuhören. –
Und nun zu meiner Geschichte. –
Diejenigen, die dies erste Kapitel gelesen haben, werden wahrscheinlich auch die folgenden lesen, denn ich habe mit Vorbedacht das langweiligste vorangestellt. –
Zweites Kapitel
Meine Jugend – Erziehung – Universitätsjahre – ich bekomme eine Hofmeisterstelle
Man sieht sogleich, daß ich mich nicht sehr bei der Erzählung meiner Jugendgeschichte aufzuhalten denke, ob sie gleich, in der Manier vieler unsrer Romanschreiber dargestellt, einen mäßigen Band füllen könnte. – Aber ich denke, das lesende Publikum hat schon seit lange genug und übergenug an den pädagogischen Untersuchungen, Erzählungen von Universitätsvorfällen, und dergleichen. Ich verstehe es nicht, alle diese Armseligkeiten wichtig zu machen, darum will ich nur schnell darüber hingehn. –
Als zuerst meine Gedanken erwachten, traf ich mich in einem kleinen Hause eines Dorfes. Ich erinnere mich noch deutlich einer Weide, die vor unsrer Türe stand, und in deren Zweigen der Schein der Sonne flimmerte. Ein bräunlicher Mann, den ich Vater, und eine sehr freundliche Frau, die ich Mutter nannte, waren meine täglichen Gesellschafter. Außerdem hatte ich noch einen Bruder und eine Schwester.
Ich lebte den einen Tag fort, wie den andern, und auf diese Art wird man nach und nach älter, man weiß selbst nicht wie es geschieht. Ich half meinem Vater in Kleinigkeiten auf dem Felde, oder meiner Mutter in der Wirtschaft, oder schlug mich mit meinem Bruder herum. Kurz, mir verging die Zeit sehr geschwind, und ich hatte nie Ursache über Langeweile zu klagen.
Meine Erziehung war die einfachste, und vielleicht auch die beste von der Welt. Ich stand früh auf, und ging früh wieder schlafen. An Bewegung fehlte es mir nicht; meine Mutter Marthe schlug mich zuweilen, wenn ich unartig war, trotz ihrer Freundlichkeit, sonst ließ sie mir allen möglichen Willen. Ich sprang, lief und kletterte; fiel ich, so war es meine eigene Schuld, und mein eigener Schade; bekam ich von einem größern jungen, den ich geneckt hatte, Schläge, so bedauerte mich niemand; hatt ich mich am Abend unter meinen kleinen Freunden verspätet und erkältet, so war ich am folgenden Abend desto vorsichtiger.
Marthe hatte kein pädagogisches Werk studiert, aber sie erzog mich ganz nach ihrem geraden Menschenverstande, und ich danke es ihr noch heute, daß man mich nach keinem Elementarwerk oder Kinderfreunde, in keinem Philantropin oder Schnepfenthal verbildete, daß man mich nicht schon im sechsten Jahre zum Philosophen machte, um zeitlebens ein Kind zu bleiben, wie das bei so manchen Produkten unsrer modernen Erziehung der Fall ist. –
Die Gegend des Dorfes war schön und abwechselnd; und auf meinen einsamen Spaziergängen erwachte zuweilen ein gewisses dunkles Gefühl in mir, ein Drang, etwas mehr zu wissen und zu erfahren, als ich bisher gelernt hatte. Vorzüglich, wenn die Glocke die Leute zur Kirche einlud, und nun die alten Frauen, ihren Rosenkranz still betend, daherwackelten, befiel mich eine Art von heiligem Grauen, noch mehr aber, wenn der Priester nun selber kam, und sich jeder im Zuge ehrfurchtsvoll vor ihm neigte, und ich nachher aus der Ferne den Gesang aus der Kirche vernahm. – Bei jeder Mönchskutte empfand ich eine unwillkürliche Ehrfurcht, und trotz dieser entstand bald der Wunsch in mir, auch einst so einherzutreten, und von jedem Vorübergehenden den Zoll der Ehrerbietung einzusammeln. Ich hing im stillen diesem Wunsche immer mehr nach, und erwachte oft sehr unangenehm aus meinen schönen Träumen, wenn der Vater mich mit aufs Feld nahm, um ihm in seiner Arbeit zu helfen.
So tief liegt die Sucht, sich über seine Nachbarn zu erheben, in der Seele des Menschen. Ich schien auch für den Stand, den ich mir wünschte, wie geboren. In meiner Kindheit war es gar nicht meine Sache, viel über einen Gegenstand nachzudenken, oder wohl gar an irgend etwas zu zweifeln. Marthe mochte mir noch so ungeheure Märchen erzählen, ich hätte mich für die Authentizität des Siegfried und der Haimonskinder totschlagen lassen; jeden Fremden, den ich durch unser Dorf wandern sah, betrachtete ich sehr genau, ob es nicht etwa der ewige Jude Ahasverus sei.
Man erstaunte über meine großen und seltenen Talente zum geistlichen Stande; besonders gewann mich der Pater Bonifaz eines benachbarten Klosters sehr lieb. Er sah meine tiefe Andacht in der Kirche, die Festigkeit meines Glaubens, meinen Abscheu gegen jede Art von Ketzerei – o wie viel Mühe gab sich der gute Mann, mich vollends für die gute Sache zu gewinnen!
»Dieser Knabe«, rief oft Bonifaz in hoher Begeisterung, »ich ahnde es, wird einst ein Schutzgeist und Reformator der rechtgläubigen Kirche werden; ein Schwert in der Hand Gottes gegen die Ketzer, eine Geißel gegen die Freigeister und Gotteslästerer, ein Vernichter der Rezensenten und Literaturzeitungen, eine Qualmbüchse den Fackeln der Aufklärer!«
Ich verstand zwar von diesen Deklamationen nichts, aber doch nahm ich mir vor, die Prophezeiung meines teuren Bonifaz nicht zuschanden werden zu lassen.
Der Pater nahm itzt selbst die Mühe auf sich, mich zu unterrichten, da ich in der Schule des Dorfes kein vorzüglicher Gelehrter werden konnte. Er bemerkte bald, daß ihm meine Fähigkeiten den Unterricht sehr erleichterten, denn ich lernte in sehr kurzer Zeit Lesen und Schreiben, auch begriff ich bald so viel vom Lateinischen, daß ich meinem Lehrer sehr verfängliche Fragen vorlegte, die er sich nicht zu beantworten getraute.
Meine Eltern sahen mich als ein Wundertier an, und wurden ernstlich darauf bedacht, meine ungeheuren Talente nicht ganz verlorengehen zu lassen. Pater Bonifaz schlug ihnen vor, mich in die nächste Stadt auf ein Gymnasium zu schicken, und dieser Vorschlag ward bald von ihnen genehmigt. Als mir dieser Entschluß angekündigt ward, erfuhr ich zugleich einen andern Umstand, der eigentlich für mich von der größten Wichtigkeit hätte sein sollen.
Meine Mutter sagte mir nämlich, daß sie und mein Vater nicht meine wahren, sondern nur meine Pflegeeltern wären, daß sie mir aber den Namen meines wirklichen Vaters, verschiedener Ursachen wegen, nicht nennen könne; dieser wünsche indessen, daß ich mich dem geistlichen Stande widme, und wolle mich daher studieren lassen.
Diese Nachricht machte eben keinen besondern und bleibenden Eindruck auf mich, so überraschend sie vielleicht jedem andern Kinde gewesen sein würde. – Meine Eltern gaben mir ihren Segen und ihre Tränen mit auf den Weg Pater Bonifaz hielt eine lange sehr rührende Rede, und ich reiste nach der Stadt ab.
In dieser Stadt war zugleich eine katholische Universität, und ich hatte also gleich die bequemste Gelegenheit, vom Schüler zum Juristen zu avancieren, denn so nannte man hier die Studenten, da man unter dem Namen Student jedweden Schüler begriff.
Man hatte mich an den Professor X... gewiesen, und dieser nahm sich meiner fast väterlich an; an ihn war das Geld adressiert, das ich vierteljährlich empfing; und ihm hab ich vorzüglich die Aufklärung meines finstern Kopfes zu verdanken. Er zerstreute nach und nach die schwarzen Phantome, die durch Bonifaz bei mir einheimisch geworden waren, ein Sonnenstrahl der Vernunft fiel in die dunkeln Gänge des Aberglaubens, und ich ward unmerklich ein ganz andres Wesen.
So lebt ich ein Jahr nach dem andern, und war ziemlich fleißig. Ich verließ die Schule, und ward nun im eigentlichsten Verstande Jurist, denn die Theologie war mir itzt zuwider. – Ich vollendete den Kursus, und stand nun da, als ein förmlich gemachter Mann, aber ohne irgend zu wissen, was ich nun in der Welt mit meiner Gelehrsamkeit anfangen solle. Ich hatte mich mit hunderterlei Sachen angefüllt, ohne mich nur ein einzigesmal zu fragen: wozu?
Glücklicherweise hatte ich neben den juristischen Wissenschaften auch Sprachen und etwas Philosophie studiert; und mein Beschützer, der Professor X... tat mir itzt einen Vorschlag, den ich sogleich mit beiden Händen ergriff.
Aus W.... hatte ihm der Präsident von Blumbach geschrieben er sei für seine Söhne um einen Hofmeister verlegen, und bäte ihn also, ihm ein schickliches Subjekt vorzuschlagen. X... warf seine Augen auf mich, ich ward vom Präsidenten angenommen; X... gab mir noch manchen guten Rat mit, womit ich aber noch nicht recht umzugehen wußte, und so machte ich mich auf den Weg nach der großen Stadt W....
Drittes Kapitel
Der Leser wird sehen, daß ich ein Narr bin
Ich setzte mich mit großer Zufriedenheit in den Wagen, der mich an den Ort meiner Bestimmung bringen sollte. Ich ward in eine mir ganz unbekannte Welt hineingefahren, ohne Menschenkenntnis und Kenntnis meiner selbst, ohne genau zu wissen, wer ich sei; nur mit dem Namen Lebrecht ausgestattet, der, wenn er mir auch eigentlich nicht zukam, mir doch immer als Vorschrift dienen konnte, nach der ich handelte.
Indem der Wagen fuhr und der Kutscher fluchte, fing ich an bei mir selbst zu überlegen, von welcher Art meine künftige Beschäftigung sein würde, und ob ich dem Amte auch wohl gewachsen wäre, das man mir anvertraute. – Ich ließ alle meine Kenntnisse und Talente die Revue passieren, und war nicht wenig mit mir selbst zufrieden, als ich die ganze große Masse übersah.
»Ich verstehe Latein und Griechisch«, sagte ich ziemlich laut zu mir selbst, doch so, daß es der Kutscher nicht hören konnte; »etwas Französisch, die Geschichte der alten und neuen Welt kann ich an den Fingern hererzählen, dabei bin ich ein guter Jurist, und verstehe vortrefflich mit den Atquis und Ergos umzugehn. Habe ich nicht einmal disputiert und dreimal opponiert? Ließ ich nicht zur Freude der ganzen Universität den Disputanten neulich in das scharfsinnigste Dilemma laufen, daß er weder vornoch rückwärts konnte?«
Ich bekam eine ordentliche Ehrfurcht vor mir selber, denn ich hatte noch nie die Bilanz zwischen dem, was ich wußte und nicht wußte, so genau gezogen. Ich hatte das Schicksal der meisten jungen Leute, die den ersten Ausflug in die Welt versuchen. Sie haben sich von Jugend auf nur mit sich selbst beschäftigt und sich doch kaum von einer Seite kennen lernen, sie bemerken an sich selbst nur Vorzüge, an jedem andern nur Fehler. Mit der Miene der Unparteilichkeit treten sie auf die Waagschale, um zu wiegen, wieviel sie wert sind: mit selbstgefälligem Lächeln blicken sie umher, da sie so tief niedersinken, und bemerken nicht, daß auf die andere Schale noch keine Gewichte gestellt sind.
Die Straße war sehr besucht und jedermann, der vorbeiging, grüßte mich sehr freundlich und ehrerbietig; wer vorbeifuhr, sahe neugierig in den Wagen hinein und machte nicht selten ein spöttisches Gesicht. Doch ich ließ mich alles dies nicht kümmern.
Es war ein schönes Frühlingswetter und die Gegend, durch welche ich reiste, angenehm und abwechselnd. Meine Phantasie ward von den reizenden Gegenständen, die mich umgaben, angefrischt, ich erinnerte mich gerade zur rechten Zeit, daß ich auch ein paarmal Verse gemacht hätte, um in eine Menge von süßen Träumen zu fallen. Ich hatte mancherlei sehr empfindsame Sachen gelesen und die menschliche Gesellschaft kam mir als eine große, zärtliche Familie vor, in welcher sich nur zuweilen ein Kind vom rechten Wege verliert und nur der Zärtlichkeit bedarf, um sogleich wieder zurückgeführt zu werden. Ich nahm mir also vor, ein recht edler, fein empfindender Mensch zu werden, um recht viele Verirrte wieder auf den rechten Weg zu bringen; mir stiegen die Tränen in die Augen, wenn ich mir die vielen Edeltaten lebhaft vorstellte, die ich gewiß noch verüben würde. Besonders aber ward mein Herz gerührt, wenn ich überlegte, welche innige und zärtliche Herzensfreunde ich aus meinen künftigen Eleven bilden müßte, wie vielen Dank mir die Eltern schuldig sein würden, welchen Nutzen der Staat aus meiner Erziehungskunst zöge, wie die ganze Welt meiner künftig mit Ehrfurcht und Rührung erwähnen sollte.
»Ja«, rief ich in meinem Enthusiasmus aus – »die Menschen sind gut, wenn man ihnen nur mit Liebe entgegenkömmt, die Welt ist schön, wenn man nur zu leben versteht! – Ja, ich werde glücklich sein, mein Glück im Glücke meiner Brüder suchen. – O kommt an mein Herz, ihr Unglücklichen und Leidenden, hier findet ihr Trost und Hülfe; kommt an meine Brust, ihr Verfolgten und Verirrten, hier findet ihr keinen Haß und keine Unversöhnlichkeit! Die lauterste, reinste Menschenliebe springt für euch in diesem Herzen.«
Ich streckte meine Arme sehnsuchtsvoll aus, es schien als wenn die sonnenbeglänzte Welt meiner Umarmung entgegenstrebe.
Der Fuhrmann, der im letzten Wirtshause etwas zuviel getrunken hatte, wollte in einen Nebenweg einlenken – unglücklicherweise lief das Hinterrad über einen Erdhügel, die Pferde gingen weiter – der Wagen knackte und fiel in demselben Augenblicke um.
Der Fuhrmann raffte sich auf, sah seine Kutsche auf einen Augenblick an und fing dann auf die kaltblütigste Weise von der Welt an, die gräßlichsten Flüche auszustoßen. Nach seinen Exklamationen war niemand als der Teufel mit allen höllischen Geistern an diesem Vorfalle schuld. Vom Schreck betäubt, lag ich noch immer im Wagen, bis mich der ergrimmte Fuhrmann hervorzog und sich dann Mühe gab, den Wagen wieder aufzurichten.
»Ist Er denn toll?« rief ich im höchsten Unwillen aus, als ich wieder auf den Beinen stand und zur Besinnung gekommen war.
»Haben Sie sich Schaden getan, junger Herr?« fragte der Fuhrmann ganz phlegmatisch.
»Nein, aber –«
»Nun, so wollen wir Gott danken, daß es noch so glücklich abgelaufen ist.«
»Ach, was! glücklich abgelaufen! – Ich saß in Gedanken und erschrak nicht wenig. – Künftig trink Er nicht soviel.«
»Nun, nun – wenn der Wagen nur erst wieder stünde!«
»So lange zu trinken, bis man zum Vieh wird und nicht mehr den Weg sehen kann! Pfui!«
»Nun, so vergeben Sie's mir nur, es soll nicht wieder geschehn.«
Ich zankte aber immer weiter fort und ward mit jedem Worte heftiger. Der Fuhrmann wußte nicht, ob er verdrüßlich oder beschämt aussehn sollte, da ich aber immer fortdeklamierte und in meinem Feuereifer von der Sünde sprach, daß er das Leben eines Menschen ohne Not in Gefahr setze, nahm er endlich ein sehr demütiges Gesicht an und bat tausendmal um Verzeihung. – Einige Bauern, die hinzugekommen waren, halfen den Wagen wieder aufrichten; besänftigt setzte ich mich wieder hinein und fuhr weiter.
Ich wurde itzt erst gewahr, daß die Hand des Fuhrmanns blute, er klagte mir auch, daß er sich beim Fallen den Arm etwas verrenkt habe. Nun erst fiel mir die Tirade wieder ein, die mir halb im Halse war stecken geblieben, und ich hätte meinerseits herzlich gerne den Fuhrmann wieder um Verzeihung bitten mögen.
»Ei der schönen Vorsätze!« sprach ich zu mir selber, aber weit leiser, als ich die vorige Deklamation hergesagt hatte. – »Kaum fällt der Wagen um, so bist du auch schon aus deiner Menschenfreundlichkeit herausgefallen! ei was würde erst ein wirkliches Unglück auf dein zartes Herz wirken! – Warum gehörte denn dieser Fuhrmann nun nicht zu jenen Brüdern, die du so feurig an deine Brust drücken wolltest? – Weil er dir einen kleinen Schreck gemacht hatte. – Wahrlich meine Phantasien haben mich mehr berauscht, als ihn der Branntewein, und in meiner Trunkenheit handle ich dreimal inkonsequenter als er.« –
Mein Kopf sank um volle dreißig Grad auf meine Brust hinab, meine Atquis und Ergos kamen mir nicht mehr halb so respektabel vor, und daß ich Verse machte, hatte ich rein vergessen. – Auf dieser Reise, die mehrere Tage dauerte, machte ich mehrere ähnliche Erfahrungen. Mein Stolz fing nach und nach an etwas abzunehmen, und ich habe es bei mir jederzeit gefühlt, daß eine Reise mich bescheidner, klüger und menschenfreundlicher gemacht hat. Der weite gewölbte Himmel über mir sagt mir jederzeit, wie armselig ich mich mit meiner Eitelkeit in die Größe der Natur verliere, jeder Berg macht mich auf meine winzige Person aufmerksam. In jeder Schenke sieht man Menschen, die in so vielen Sachen mit ihrem geraden Sinne weiter reichen, als wir mit allen unsern feinen und geläuterten Gedanken: bei unsrer Sucht, mit unserer hohen Aufklärung zu prahlen, wird man alle Augenblicke mit der Nase darauf gestoßen, daß man noch voller Vorurteile stecke. Sobald ich die Stadt mit ihren Häusern und dem Gedränge ihrer Menschen aus den Augen verliere, fange ich auch an, mehr in mich selbst zurückzugehn: die Armseligkeiten, die in der Gesellschaft immer noch einen Anschein von Wichtigkeit behalten, verlieren sich in der klaren Natur – ich sehe den Glücklichen und den Unglücklichen meinem Herzen nähergerückt, ich versuche es, die lästige bunte Kleidung, die uns von Jugend auf angeschnürt wird, abzustreifen, und als einfacher Mensch dazustehn.
Es kömmt mir daher immer sonderbar vor, daß viele Leute von ihren Reisen närrischer, vorurteilsvoller, eitler und menschenfeindlicher zurückkommen, als sie sie antraten. – Aber diese treiben sich meist nur im Gewühl der Menschen umher sie fahren schnell der Hütte vorüber nach der Stadt zu, um in der Bereicherung ihrer Menschenkenntnis sich durch keine Nichtswürdigkeit aufhalten zu lassen. Sie lachen, gähnen und verleumden in der großen Welt und denken gar nicht daran, wie elend klein diese große Welt gegen Gottes freie große Welt ist. –
Nachdem wir sieben Tage gefahren waren, grüßten uns die Leute nicht mehr, die bei uns vorbeigingen: wir kamen an die Tore von W.... – Ich werde auf Tod und Leben examiniert und eine ganze Stunde visitiert. Man fand nichts Verdächtiges an meiner Person und in meinem Koffer und ließ mich fahren. Ich stieg in einem Gasthofe ab.
Viertes Kapitel
Ich trete als Hofmeister auf
Ich zog mein bestes Kleid an, überlegte meine Komplimente und ließ mich beim Präsidenten melden. Ich hatte nicht sehr lange im Vorzimmer gewartet, als ein ziemlich großer und ziemlich starker Mann mit einer trocken freundlichen Miene hereintrat und sich nach den ersten Verbeugungen freute mich kennenzulernen und daß ich angekommen sei. Ich erwiderte, beides sei meine Schuldigkeit, und auf seinen Befehl geschehen, wobei ich die Verbeugungen nicht sparte, und in einer unaufhörlichen Verlegenheit war.
»Der Professor X...«, sagte der Präsident sehr verbindlich, »hat mir viel von Ihren Talenten und Kenntnissen gesagt und auf seine Empfehlung –«
Ich ward rot, verbeugte mich und hustete.
»Und ich hoffe, daß Sie meine Erwartungen nicht –«
Ich hustete stärker, ward noch röter und verbeugte mich noch tiefer.
»Ich schätze mich also glücklich, daß ein junger Mann –«
Ich brachte in meinem Husten so viele Variationen an, als nur irgend möglich war.
Es wird selten der Fall sein, daß, wenn jemand recht sehr verlegen ist, es nicht auch der andre werden sollte, der mit ihm spricht. Die Verlegenheit ist ebenso ansteckend, wie Lachen, Melancholie, Gähnen und der Schnupfen. Der Präsident erwartete eine große Menge von Gegenkomplimenten, und da diese ausblieben, mein Katarrh und die Röte in meinem Gesicht aber mit jeder Sekunde zunahmen, ich mich auch einigemal beim Ausscharren in die Fußdecke verwickelte, und er wahrscheinlich fürchtete, ich würde mich aus lauter Bescheidenheit noch zuletzt in den Wandspiegel retirieren: so wußte er am Ende selber nicht recht, was er sprechen sollte; er sahe sich genötigt, von meinen Lobeserhebungen abzubrechen und das Gespräch auf meine Reise zu lenken.
Nun hatte ich mir freilich wohl eine ganze Stunde vorher den Kopf zerbrochen, was ich dem Präsidenten sagen wollte, und es fehlte mir wahrlich nicht an Schmeicheleien und Komplimenten; aber mit einem Komplimente gut umzugehn, ist ebenso schwer, wie mit einem Waldhorn. Wer es nicht zu blasen versteht, mag es zehnmal an den Mund setzen, es bleibt stumm; oder bringt man ja einen Ton heraus, so erscheint, statt der süßen Akzente ein so rauher, unfreundlicher Schall, daß man sich die Ohren zuhält. – Ich habe oft Leute, die Sottisen sehr kaltblütig und witzig beantworten konnten, bei einem ungeschickt angebrachten Komplimente so rot werden sehn, daß ich mich in ihre Seele schämte, wie viele Feindschaften sind nicht schon entstanden, weil jemand dem andern eine Süßigkeit von der verkehrten Seite präsentiert hat!
So tat mir nun wahrlich von allen den schönen Sachen, die ich sagen wollte, die Zungenspitze weh. Ich hoffte immer noch einen Nebenweg zu finden, wo ich einlenken könnte; aber vergebens, das Gespräch ging stets geradeaus. – Die Sache war, daß ich mir den Präsidenten ganz anders vorgestellt hatte, als ich ihn fand. Ich hatte mir ihn als einen steifen, trocknen, stolzen alten Mann gedacht; ich hatte mir daher eine Menge captationes benevolentiae gedrechselt, um ihn mir geneigt zu machen, ich hatte Umwege zu seinem Herzen gesucht, so richtig auf Menschenkenntnis und die gewöhnlichen Vorurteile des Adels kalkuliert, so fein und neu, daß es mir eine herzliche Freude gemacht hatte. Dabei war ich mir so groß und hoch über ihm erhaben vorgekommen, daß ich seine Schwächen zu meinem Vorteil zu nutzen verstehe und ihn dennoch glauben mache, wie sehr ich ihn verehre. Und nun alles gerade umgekehrt! – Er tritt mir zuvorkommend entgegen, er ist freundlich und sagt mir eine Höflichkeit über die andre, er scheint zu glauben, daß ich ihm mit meiner Reise den größten Gefallen von der Welt getan habe: dadurch, daß ich auf diese Art erhoben ward, sank ich in mir selbst ganz unbeschreiblich. Ich wußte meine Rolle vortrefflich auswendig, aber als ich auf das Theater trat, ward ein andres Stück gegeben, und ich war nicht Schauspieler genug, um aus dem Stegreife gut zu spielen.
Ich erzählte nun meine Reise so interessant, als es mir nur immer möglich war, der Präsident schien auch Vergnügen daran zu finden, endlich kam er wieder auf die Ursache meiner Reise zurück.
»Ich glaube«, sagte er, »daß man einem Manne von Talenten, der die Erziehung der Kinder übernimmt, nie genug danken könne. Ich finde es also billig, daß man ihm seine Lage, die sehr viele Unannehmlichkeiten hat, so angenehm als möglich mache; Sie wohnen natürlicherweise in meinem Hause und essen an meinem Tische. Die übrigen Bedürfnisse erhalten Sie ebenfalls und außerdem jährlich zweihundert Taler. – Sind Sie damit zufrieden?«
Wer war zufriedener, als ich, und ich glaube, daß mich viele Hofmeister beneiden werden.
»Ich habe zwei Söhne«, fuhr der Präsident fort, »die beide sehr gut geartet sind, und deren Liebe und Zuneigung Sie sich also sehr bald erwerben werden. Sie werden die Neigungen und den Charakter eines jeden kennenlernen und ihn darnach behandeln; ich traue Ihnen Menschenkenntnis genug zu –«
Ich war unschlüssig, ob ich rot werden sollte. –
»Um mit Kindern richtig zu verfahren, die es noch nicht gelernt haben sich zu maskieren.«
Ich ward bis über die Ohren rot.
»Den Jüngsten werden Sie etwas wild und ausgelassen finden, aber er ist nichts weniger als boshaft, und der Älteste, darf ich ungescheut behaupten, ist ein ganz vorzüglicher Kopf, ein wahres Genie; Sie werden selbst über den Knaben erstaunen, er hat für seine Jahre schon außerordentlich viel geleistet. – Ich habe außerdem noch eine Tochter, für die ich aber eine besondere Erzieherin habe. – Ich hoffe meine Söhne sollen unter Ihrer Leitung bald sehr weit kommen.«
Ich verbeugte mich wieder: der Präsident ging in sein Zimmer und ich in meinen Gasthof zurück. Ich zog noch an demselben Tage in das Haus des Präsidenten und machte meine Einrichtungen: am folgenden Morgen sollte ich den Kindern und der Frau Gemahlin vorgestellt werden.
Ich setzte mich in einen Sessel und betrachtete die eleganten Möbeln meines Zimmers, dann überlegte ich meine Lage und zukünftigen Pflichten. – Der Präsident war ein gütiger Mann, er hatte mir auch eine Stelle versprochen, wenn ich mehrere Jahre das Amt eines Pädagogen verwaltet hatte, von seiner Großmut konnte ich eine etwas mehr als mittelmäßige Versorgung erwarten. Die Perspektive meines Lebens war in der Tat die heiterste.
Meine Bestimmung kam mir groß und ehrenvoll vor. Ich ließ durch meinen Kopf noch einmal die pädagogischen Bemerkungen gehn, die ich entweder gelesen, oder selbst gemacht hatte, um sie in meiner jetzigen Lage anzuwenden. Ich nahm mir vor, ein völliges System zu erbauen, nach welchem ich meine Zöglinge zu edlen, großen und verständigen Menschen bildete, und ich fiel gar nicht auf die Frage: ob ich die rechte Bedeutung dieser drei Worte auch wohl verstehe? – Der älteste Sohn war ein Genie – was ließ sich von diesem nicht alles erwarten? Ich konnte wohl gar so glücklich sein, der Hofmeister eines Menschen zu werden, der eine Epoche in der Weltgeschichte machte. – Ich legte mich erst spät mit den angenehmsten Vorstellungen schlafen und erwartete sehnlichst den andern Morgen.
Hätte ich freilich damals schon gewußt, daß es in jeder Familie wenigstens ein Genie gibt, so wäre vielleicht vieles Große von meinen stolzen Träumen zusammengesunken.
Fünftes Kapitel
Die Präsidentin und die übrigen Hausgenossen
Man kann sich vorstellen, daß ich nicht zu lange im Bette blieb, und daß ich mich so gut herauszuputzen suchte, als es mir nur immer möglich war. Ich stand lange vor dem Spiegel, musterte meinen Anzug, so wie meine Manieren, und nahm mir fest vor, die heutige Unterredung nicht wieder so, wie die gestrige, verderben zu lassen: ich beschloß, mich mit allen meinen Kräften zusammenzunehmen. Ich muß noch jetzt über mich lächeln, wenn ich daran denke, wie oft ich in meinem Gedächtnisse einige Komplimente wiederholte, damit sie mir nicht wieder unter den Händen verlorengingen.
Als ich fertig war, meldete mich der Bediente. – Ich trat in das Zimmer der Präsidentin und fand die gnädige Frau in einem graziösen Negligé am Teetisch. Ich machte meine Verbeugungen und sie die ihrigen, jedes von uns auf seine eigene Art, ich als untertäniger Diener, sie als gnädige Beschützerin, die sich aber in der Herablassung zu Geringern sehr glücklich fand. – Es ließe sich ein eigenes weitläuftiges Kapitel über die verschiedenen Beugungen, Neigungen und Kopfbewegungen schreiben: vielleicht, daß es der Leser im zweiten Teile dieser wahrhaftigen Geschichte findet, denn wenn ich ihn hier mit meinen Reflexionen schon wieder unterbrechen wollte, so würde ich mir mit vollem Rechte seinen Unwillen zuziehen.
Nachdem die ersten Eingangsredensarten vorüber waren, die sich bei jeder neuen Bekanntschaft mehr oder weniger ähnlich sehen, fragte mich die Präsidentin mit einem leichthingeworfenen Tone: »Nun, wie gefallen Sie sich in W....?«
Nichts in der Welt hätte mir erwünschter kommen können. – »Noch nie habe ich mich so glücklich gefühlt«, antwortete ich triumphierend, »als seit ich die Ehre habe in Ihrem Hause zu sein.« –
Und nun fuhr ich fort weiter auseinanderzusetzen, wie mir daher W.... ganz außerordentlich reizend vorkommen müßte. Wenn ich mich in zu große Schmeicheleien hineinverirrte, so kam mir die Präsidentin auf halbem Weg entgegen, um mich wieder zurechtzuweisen. – Eine jede zeremoniöse Unterredung kömmt mir immer vor, wie ein Strom, auf welchem unaufhörlich Eisschollen gegen eine Brücke anschwimmen. Man sieht immer schon aus der Ferne ein großes, gewaltiges Kompliment einherschwimmen, aber alle Schollen laufen gegen die Eisbrecher auf und fallen so in den Strom zurück. – Auch diese Eisbrecher können von sehr verschiedener Art und Beschaffenheit sein, sie können in einer Verbeugung, einem Lächeln, in einem Gegenkomplimente bestehen, oder auch darin, daß man das Kompliment des andern gar nicht zu verstehen scheint; diese letztern sind von der allerzerstörendsten Gattung.
Die Präsidentin war eine Frau von mittlern Jahren, mittler Statur, mittelmäßiger Schönheit, mittelmäßigem Verstande; – kurz, man sieht sie gehörte zu den mittelmäßigen Leuten, deren Zahl in der Weit die größte ist, ob sich gleich keiner selbst unter diese Rubrik einschreiben will.
Wir schwatzten zusammen bis zum Mittagsessen, und ich war heute mit mir selber ganz außerordentlich zufrieden. Mein Witz ward zwar in einigen kleinen Vorpostengefechten geschlagen, aber doch ward keine von meinen Batterien zum Schweigen gebracht, noch weniger verlor ich ein Haupttreffen. Ich schien der Präsidentin spaßhaft genug vorzukommen, und wir wurden endlich zum Essen abgerufen.
Man sagte mir, daß die Familie alle Tage in einem bestimmten Saale zusammen äße; die Familie bestand aus dem Präsidenten, seiner Frau, einer Tochter und seinen zweien Söhnen! man tat mir die Ehre an, mich von diesem Tage auch dazuzurechnen, so wie die Erzieherin der kleinen Fräulein von Blumbach.
Die Söhne wurden an meine Seite gesetzt, und ich sahe wechselsweise bald den einen, bald den andern an, um das Genie herauszufinden, aber ich konnte aus mir selber nicht klug werden, als mir beide wie ganz gewöhnliche Kinder vorkamen. Aus dem, was sie zuweilen sagten, schien sogar eine Art von Dummheit hervorzuleuchten, von der aber weder Papa noch Mama Notiz nahmen.
Die Tochter schien ein ganz artiges, niedliches, kleines Mädchen zu sein; da sie mit meinen Amtsgeschäften nichts zu tun hatte, bekümmerte ich mich wenig um sie. Desto öfter aber und ganz unwillkürlich fielen meine Augen auf ihre Gouvernante. Ich hatte mir diese unter dem Charakter einer gewöhnlichen französischen Mamsell gedacht, sie war mir daher in meiner Vorstellung immer äußerst uninteressant vorgekommen: ich fand aber jetzt, daß sie eine Deutsche sei und daß ihre Augen so wie ihr Gesicht außerordentlich viel Anziehendes hätten. Mir fielen hundert Stellen vom wunderbaren Zuge der Sympathie ein, die ich bis jetzt immer für baren Unsinn erklärt hatte. Ihr schönes blaues Auge ruhte zuweilen auf mir und ich konnte ihren Blick nicht ein einzigmal aushalten, mir war jedesmal, als wenn mir die Sonne ins Gesicht schiene. Ihre blonden Haare fielen in ungekünstelten Locken auf den weißen Nacken hinab, in ihrem Wesen herrschte eine unbeschreibliche Sanftheit, die fast ans Melancholische grenzte. Ein Wort, das sie sagte, klang wie Musik in meinen Ohren.
Meine Frau hat mir über die Schulter gesehn, und mir jetzt eben lächelnd die Feder aus der Hand genommen; ich muß daher mit meiner Beschreibung aufhören, ich hoffe überdies, daß jeder Leser sich die Person hinzudenken wird; kann er es aber nicht, so darf er nur irgendeine von den weitläuftigen Beschreibungen in den neuesten Romanen nachschlagen.
Ich bemerkte, daß noch ein Gedeck übrig sei, und war auf die Person sehr neugierig, die noch erscheinen sollte. Endlich erschien ein sehr wohlgewachsener, junger Mensch, den die Frau vom Hause als Herr von Bärenklau begrüßte. Er setzte sich auf den leeren Stuhl neben der liebenswürdigen Erzieherin, und ich war bald mit mir selber einig, daß er, trotz seinem einnehmenden Wesen, diese Stelle nicht verdiene.
Ich glaubte zu sehen, daß seine feurigen Augen oft den sanften Blicken des Mädchens begegneten und ich hatte Gelegenheit, eine Menge von Bemerkungen zu machen, von denen die vorzüglichste war, daß ich gegen den Herrn von Bärenklau ein sehr linksches und ungeschicktes Benehmen habe. Diese Bemerkung tat meiner Eitelkeit außerordentlich wehe, ich glaubte daher am Ende, das gewandte Wesen des Herrn von Bärenklau sei nur ein Zeichen, daß er kein so gründlicher Philosoph sei, als ich.
Als wir gegessen hatten, ging ich mit meinen beiden hoffnungsvollen Zöglingen auf mein Zimmer. Ich fand nun bald, worin das Genie des Altesten bestand: er hatte nämlich ein ganz außerordentliches Gedächtnis für Vokabeln, Namen und Phrasen, bei denen er sich aber gar nichts dachte. Er sagte mir den größten Teil der lateinischen Grammatik mit einer Fertigkeit her, die mich in Erstaunen würde gesetzt haben, wenn ich nicht kurz vorher ein Kunstpferd gesehn, dessen viele und wunderbaren Künste auch auf das Gedächtnis berechnet waren. Ich fand bald, daß der Jüngste, ungeachtet er nur wenig wußte, weit mehr Verstand als sein Bruder hatte, den man durch unzeitiges Lob zu einem eingebildeten phlegmatischen Narren gemacht hatte.
Wozu denn die vielen Charakterschilderungen? höre ich verdrüßlich meine Leser ausrufen. – Am Ende ist alles das unnütz und hat weiter gar keinen Bezug auf Ihre Geschichte, Herr Verfasser, die an sich schon langweilig genug ist. –
Nun, haben Sie nur Geduld. – Sie können jetzt weder von dem einen, noch dem andern urteilen, denn, meine teuern Leser, Sie stehn immer noch in der Ankündigung oder dem ersten Akte.
So hätten Sie das so einrichten sollen, daß sich die Charaktere Ihrer Personen in Handlungen zeigen. Dadurch hätte Ihr Buch an Langeweile verloren und Ihre Personen an Interesse gewonnen.
Wenn nun diese Personen aber damals gerade gar nichts taten, oder wenigstens nichts vornahmen, was ich bemerkte? – Ich will doch lieber etwas langweilig werden, als Sie mit Lügen amüsieren.
So hätten Sie Ihre Geschichte gar nicht schreiben sollen, denn so wie sie bis jetzt erscheint, verdient sie es durchaus nicht. – Es ist eine Alltagsgeschichte von der alltäglichsten Art.
Habe ich denn aber das nicht gleich in meinem ersten Warnungs-Kapitel gesagt? –
Doch, ich wende mich wieder zu meiner Erzählung.
Sechstes Kapitel
Ich werde verliebt
»Gottlob!« hör ich die ungeduldigen Leserinnen rufen, indem sie dies Kapitel aufschlagen, »der langweilige Mensch fängt nun vielleicht an interessanter zu werden!« – Ich muß aber bekennen, daß bei so vielen Schriftstellern nichts langweiliger und ermüdender ist, als die detaillierten Beschreibungen des verliebten Approchierens: wie sie vom Blick zum Händedruck, vom Händedruck zum Kusse und von diesem endlich weiter übergehen; dann sich wieder mit der Vielgeliebten entzweien, einen eifersüchtigen Zweispruch halten, und sich nach vielen Debatten wieder zu einer Aussöhnung bequemen, die der Leser schon über zwei ganze Bogen voraussahe. Wer diese Offizialberichte von dem Kriege der Liebe gern liest, der überschlage dieses Kapitel, denn ich habe mir vorgenommen, nur sehr im allgemeinen über meine Liebe zu sprechen.
Der Leser wird es gewiß schon erraten haben, daß ich in niemand anders, als die schöne Gouvernante verliebt wurde. Meine Augen trafen immer öfter und öfter die ihrigen, mit jedem Tage entdeckte ich neue Vollkommenheiten an ihr, mit jedem Tage entwickelte sich ihre schöne Seele reizender. – Ich bemerkte sehr bald, daß ihr Blick dem meinigen häufiger begegnete, daß sie rot ward, wenn mein Auge auf ihrer Gestalt verweilte, daß sie oft meine Gesellschaft suchte, und doch im Gespräche mit mir in eine Art von Verlegenheit geriet. Ich schloß aber aus allen diesen Bemerkungen bei weitem nicht so viel, als ich mit vollem Rechte hätte schließen können: ich hielt alles mehr für Zufälligkeit und wagte es gar nicht, diese Zeichen auf eine günstige Art für mich auszulegen. – In mir selber ging eine wunderbare Veränderung vor. – Meine Lehrstunden, die ich bis jetzt mit großem Eifer gehalten hatte, fingen an mir Langeweile zu machen; meine Zöglinge erschienen mir um ein großes Teil einfältiger; alle meine enthusiastischen Entwürfe kamen mir albern und abgeschmackt vor. Dagegen stieg die Waagschale auf der andern Seite um vieles mehr, als sie auf der einen sank: es kam mir vor, als wenn meine Seele eine große Revolution erlitten hätte, es ging ein Licht in mir auf, das alles erleuchtete, was bis dahin dunkel und verworren in mir gelegen hatte. Es hatte sich mir plötzlich ein helles kristallenes Glas vor die Augen geschoben und ich sahe itzt die Welt weit schöner und reizender als ehedem.
Die Liebe ist bei den meisten Menschen die erste bewegende Kraft, die ihre Fähigkeiten entwickelt, und dem trägen, einförmigen Gange des gewöhnlichen Lebens einen neuen, raschen Schwung gibt. Sie ist überhaupt das größte und notwendigste Rad in der menschlichen Gesellschaft. Was ist es anders, als die Liebe, um welche sich das Interesse der ganzen Welt dreht? Ist sie nicht der eigentliche Mittelpunkt, um welchen alle Wünsche und Plane der Sterblichen laufen? Die Liebe ist ein Gegenstand, über den sich niemand zu Ende spricht; ihre Jugend ist unverwelklich, selbst der Greis erinnert sich am Ende seiner Laufbahn noch mit Entzücken der Stunden, in welchen er im Morgenrote stand, das diese Gottheit um ihn her goß. Staaten und Familien werden durch diesen großen Magnet in ihrem Gange erhalten, und die Schwärmerei einiger Philosophen ist ebenso natürlich als verzeihlich, wenn sie den Zusammenhang des ganzen Weltgebäudes durch eine große allgemeine Liebe erklären wollten.
Nur wenigen Menschen gelingt es, sich von dem Gesetze der Liebe frei zu machen und sie sind für unglücklich zu erklären; ihnen ist das Licht ausgelöscht, das uns armen Sterblichen durch das trübe Labyrinth des Lebens leuchten muß, sie stehen so albern und ohne Absicht in der Welt da, wie ein Tauber in einem Konzertsaale. – So weit die Sonne scheint, ist Liebe das reinste Element der menschlichen Seele und selbst der Grönländer und Hottentotte ergreifen dies reizende Band, um sich an die Gesellschaft der übrigen Menschen zu reihen.
Es ist sehr gewöhnlich, daß ein Verliebter (vorzüglich bei seiner ersten Liebe) meint, die ganze Welt sei für seine Leidenschaft blind. Das ganze Haus wußte schon, daß ich verliebt war, ehe ich es mir noch selbst gesagt hatte. Ganz vorzüglich richtete der Herr von Bärenklau seine Augen auf mich, die als die Augen eines Nebenbuhlers noch unendlich scharfsichtiger waren, als die der übrigen Leute im Hausei er sprach von jetzt an entweder sehr kurz und unfreundlich mit mir, oder, wenn er mich nur irgend vermeiden konnte, ging er mir sorgfältig aus dem Wegei ohne es selbst zu wissen, tat ich das nämliche.
Louise hatte indes meine Liebe ebenfalls bemerkt, und sie näherte sich mir mit jedem Tage etwas mehr. Wir wurden oft ganz von ungefähr im Garten oder Zimmer in lange freundschaftliche Gespräche verwickelt, und ein jedes von uns trug redlich das Seinige dazu bei, das Gespräch so lange währen zu lassen, als es nur immer möglich war. Wie ein Feuerlärmen erschreckte mich oft die Stimme des Bedienten, der uns zum Essen abrief, und zu meinen Eleven und Lehrstunden ging ich mit so schwerem Herzen, als wenn ich in ein Gefängnis wandern müßte. Mein Zimmer kam mir eng und finster vor, die Gesellschaft eines jeden Menschen langweilig; während des Unterrichts hatte ich keine Ruhe und versprach mich in jeder Minute, wenn ich wußte, daß sie mit der Präsidentin im Garten war. Mit einem Worte ich lernte den schweren Dienst, zu welchem die meisten Menschen irgend einmal in ihrem Leben abgerichtet werden.
Der Herr von Bärenklau verlor seinen Witz und seine gute Laune. Er saß stumm und verdrüßlich bei Tische, oder blieb gar aus; er war zerstreut, sprach verkehrt, oder antwortete auf eine vorgelegte Frage gar nichts, indes ich, als der triumphierende Sieger, ihm gegenübersaß und mich in den muntern Augen Louisens spiegelte, kaum aß und trank, wenig sprach und viel seufzte. –
Ich denke jetzt daran, daß diese Tischgesellschaft für den Präsidenten außerordentlich langweilig muß gewesen sein, denn auch Louise nahm nur an wenigen Sachen Anteil: damals aber fiel mir dieser Gedanke gar nicht ein.
An einem Nachmittage, als ich mit Louisen vorzüglich lange gesprochen hatte, begegnete mir der Herr von Bärenklau auf dem Saale, er schien mich diesmal gesucht zu haben, da er mir sonst immer auswich, und dies war auch wirklich der Fall.
»So in Eile, Herr Lebrecht?« fragte er mich.
»Daß ich nicht sagen könnte«, antwortete ich ihm halb verlegen: denn seine Gesellschaft war mir vorzüglich jetzt sehr zuwider, da ich den Kopf ganz voll von dem hatte, was ich soeben mit Louisen gesprochen hatte.
»Sie kommen von Louisen?« fragte er in einem halb spöttischen Ton.
»Ihnen aufzuwarten.«
Bärenklau: »Herr Lebrecht, ich kann es, und mag es Ihnen auch nicht länger bergen, daß Sie mich durch Ihre Vertraulichkeit mit Louisen aufs äußerste beleidigen.«
Ich stand ganz erschrocken vor ihm. – »Durch welche Vertraulichkeit?« wollte ich ihn fragen, aber in der Zerstreuung sagte ich: »Wieso?«
Bärenklau: »Weil ich sie liebe, weil sie es weiß, daß ich sie liebe: weil ich ihr meine Hand anbieten will.«
Ich war wie aus den Wolken gefallen.
»Und Sie«, fuhr mein Nebenbuhler hitziger fort, »kommen hieher, um auf eine sehr alberne Art die Rolle ihres Liebhabers zu spielen, um zu seufzen und zu schmachten, mir ihre Zuneigung zu entziehn, und – wer sind Sie? Was für ein Glück besitzen Sie, das Sie ihr anbieten könnten? – Sie sind Herr Lebrecht, und weiter nichts, und von Ihrer Liebe möchten Sie gar armselige Zinsen ziehn.«
Itzt hob ich nach und nach den Kopf in die Höhe, denn mein Blut fing an warm zu werden.
»Ich hoffe«, fuhr Bärenklau fort, »Sie werden unser Gespräch nicht vergessen, und dieser Herr Lebrecht wird mir nicht von neuem Ursach geben, mich über ihn zu beklagen.«
Er wollte gehn, als ich mich erhitzt zu ihm wandte. »Mein Herr«, sagte ich sehr zornig, »Sie haben kein Recht zu diesem Betragen, Sie nennen meinen Namen da mit einer Verachtung, die mich beleidigen soll; Sie wollen mich den großen Unterschied unsers Standes fühlen lassen – aber wahrhaftig, ich habe ihn noch nie so wenig gefühlt, als gerade in diesem Augenblicke. – Ich habe mich meines bürgerlichen Namens nicht zu schämen und ich danke Gott sogar für diesen Namen, da er mir beständig eine Vorschrift meines Verhaltens sein kann. – Sind Sie denn wirklich auch auf Ihren Namen stolz? Bärenklau, Greifenhahn, und so manche adeliche Familiennamen sind nicht so unschuldig und löblich, als mein schlichter Name Peter Lebrecht! Sie deuten nur auf Raub und Mord und Unterdrückung. – Auf Ihre übrigen Äußerungen mag ich Ihnen gar nicht antworten, aber ich hoffe, Sie werden unser Gespräch nicht vergessen, und dieser Herr von Bärenklau wird mir nicht wieder Ursach geben, mich über ihn zu beklagen.«
Bärenklau sahe mich eine Weile an dann lachte er laut auf und ging lachend fort. – Ich ging in mein Zimmer und kam mir vor wie der große Alexander; ich ging lange heftig auf und ab, und setzte mich erst in einen Sessel zur Ruhe, als die Sonne der Vernunft durch den Nebel der Leidenschaften brach, und ich mir außerordentlich abgeschmackt vorkam. Ich nahm mir hunderterlei Sachen vor, machte Plane und verwarf sie wieder, und war den ganzen Tag, so wie den darauf folgenden, äußerst verdrüßlich. Doch hatte das alles den Erfolg, daß ich nun wenigstens mit mir selber über den Satz einig ward: ich sei wirklich verliebt.
Siebentes Kapitel
Liebesgeständnisse
Es fing jetzt eine Periode meines Lebens an, in welcher ich einen Tag nach dem andern verträumte, ohne die große Summe zusammenzuzählen, die aus diesen einzelnen Tagen endlich entstand. Das Geschäft meines Lebens schien mir nur darin zu bestehen, die schöne Louise Wertheim zu lieben: müßig kam ich mir nur dann vor, wenn ich sie nicht sahe. Man mochte mir ein Geschäft auftragen, welches man wollte, man mochte mit mir sprechen, was man wollte, es mochte vorfallen, was da wollte, so waren meine Gedanken doch stets und unaufhörlich nach ihr hin gerichtet, so wie die Nadel des Kompasses stets nach Norden zeigt, man mag ihn auch drehen und wenden, wie man will.
Ich war itzt schon seit einem Jahre im Hause des Präsidenten. Ich hielt täglich Lehrstunden mit meinen Zöglingen, die freilich mit jedem Tage etwas mehr lernten, aber nichts weniger als außerordentliche Talente zeigten; ich sah täglich den Präsidenten und seine Gemahlin und was mir vorzüglich wichtig war, täglich Louisen. Ich fing jetzt an zu bemerken, daß sie mich allen ihren übrigen Bekanntschaften vorzog, daß sich ihr Gesicht jedesmal erheiterte, wenn ich im Garten oder im Zimmer zu ihr trat. Ich überlegte, um welche Zeit ich wohl imstande sein würde, ihr als der Gebieterin meines Herzens, ein Glück anzubieten, das nicht ganz unter dem Mittelmäßigen sei: es war das erstemal in meinem Leben, daß ich Plane machte und an die Zukunft dachte aber die Liebe, die so oft blind ist, öffnet uns auch sehr oft die Augen über manche Gegenstände, bei denen wir sonst immer vorbeigegangen sein würden, ohne sie zu bemerken.
Zuweilen kam sie mir so liebenswürdig vor, daß ich ihr in der größten Gesellschaft hätte um den Hals fallen mögen, mit ihr vor den Altar treten, und meine Hand in die ihrige legen lassen. Aber mir fiel noch glücklicherweise in meinem Enthusiasmus jedesmal ein, daß man mich für einen ausgemachten Narren halten würde. Fremde Augen sehn immer in unsre Liebe durch ein schlecht geschliffenes Glas hinein, alle Gegenstände erscheinen ihnen dunkel, verkehrt und zerrissen.
Ich hatte seit einem Jahre Louisen geliebt, und schmeichelte mir schon seit lange mit ihrer Gegenliebe. Aber unerachtet unsrer täglichen Zusammenkünfte waren wir noch gar nicht darauf gefallen, uns gegeneinander zu erklären; ich nahm mir an einem schönen Tage recht fest vor, ganz gründlich von meiner Geliebten selbst zu erfahren, wie ich mit ihr stehe. Der Präsident war mit seiner Frau gerade ausgefahren, der Herr von Bärenklau war auf einige Tage verreist, um einen kranken Onkel zu besuchen, ich war mit Louisen im Hause allein und hatte so die beste Gelegenheit, mich ungestört mit ihr über einen Punkt zu erklären, der mir so außerordentlich wichtig war.