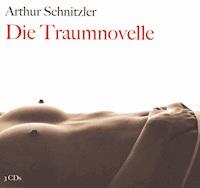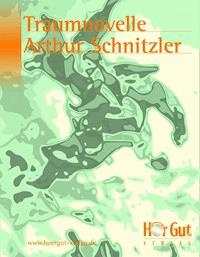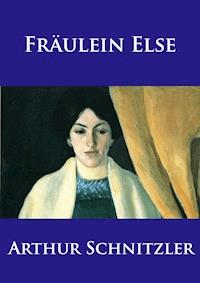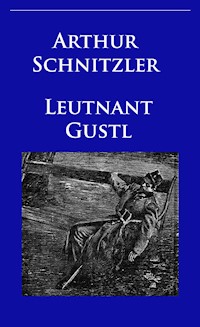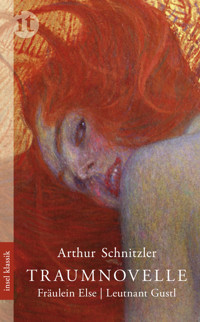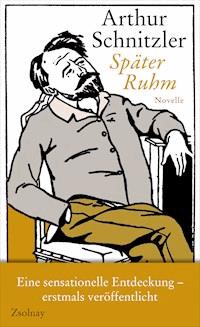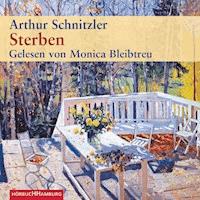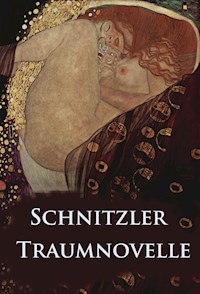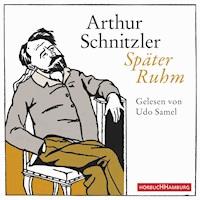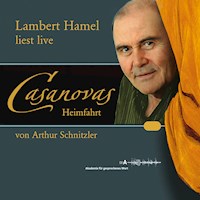Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist Band 4 von 4 der besten Erzählungen des österreichischen Erzählers und bedeutendsten Vertreters der Wiener Moderne. Enthalten sind: Der tote Gabriel Das Tagebuch der Redegonda Der Mörder Die dreifache Warnung Die Hirtenflöte Frau Beate und ihr Sohn Doktor Gräsler, Badearzt Der letzte Brief eines Literaten Casanovas Heimfahrt Fräulein Else Die Frau des Richters Traumnovelle Spiel im Morgengrauen Der Sekundant Flucht in die Finsternis
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1374
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meine Erzählungen, Band 4
Arthur Schnitzler
Inhalt:
Arthur Schnitzler – Biografie und Bibliografie
Der tote Gabriel
Das Tagebuch der Redegonda
Der Mörder
Die dreifache Warnung
Die Hirtenflöte
I
II
III
IV
V
VI
VII
Frau Beate und ihr Sohn
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Doktor Gräsler, Badearzt
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Der letzte Brief eines Literaten
Casanovas Heimfahrt
Fräulein Else
Die Frau des Richters
I
II
III
IV
V
Traumnovelle
I
II
III
IV
V
VI
VII
Spiel im Morgengrauen
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Der Sekundant
Flucht in die Finsternis
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
Meine Erzählungen, Band 4, A. Schnitzler
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849635565
Dieses Werk bzw. Inhalt und Zusammenstellung steht unter einer Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland Lizenz. Die Details der Lizenz und zu der Weiterverwertung dieses Werks finden Sie unter http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/. Der Inhalt und die Zusammenstellung oder Teile davon wurden der TextGrid-Datenbank entnommen, wo der Inhalt und die Zusammenstellung oder Teile davon ebenfalls unter voriger Lizenz verfügbar sind. Eine bereits bestehende Allgemeinfreiheit der Texte bleibt von der Lizensierung unberührt.
www.jazzybee-verlag.de
Arthur Schnitzler – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 15. Mai 1862 in Wien, gest. 21. Oktober 1931 ebenda, studierte Medizin, wurde zum Doktor promoviert, widmete sich aber bald ausschließlich der Literatur. Er lebt in Wien. Schon sein Erstlingswerk »Anatol« (Berl. 1893, 8. Aufl. 1905), das aus einer Reihe von dramatischen Dialogen besteht, verriet in der Verbindung von leichtfertiger Erotik, scharfer Beobachtung und überaus graziöser Darstellung die Eigenart von Schnitzlers starkem Talent. In ähnlichem Geiste gehalten sind die geistvollen Einakter »Der grüne Kakadu«, »Paracelsus« und »Die Gefährtin« (Berl. 1899, 3. Aufl. 1900), »Lebendige Stunden« (darin der ausgezeichnete Einakter »Literatur«, das. 1902, 5. Aufl. 1903) und »Marionetten« (ebenfalls drei Einakter, das. 1906), und dieselbe, auf die Länge etwas ermüdende Schilderung des Liebeslebens gewisser Wiener Kreise findet sich in den Schauspielen »Liebelei« (das. 1895, 4. Aufl. 1901), »Das Vermächtnis« (das. 1901), »Freiwild« (das. 1895, 2. umgearbeitete Aufl. 1902), »Das Märchen« (das. 1902) und auch, trotz zum Teil veränderten Milieus, in den neuern Werken größeren Stils: »Der Schleier der Beatrice« (das. 1901), »Der Ruf des Lebens« (das. 1905, 2. Aufl. 1906), »Der einsame Weg« (das. 1904, 4. Aufl. 1906) und der Komödie »Zwischenspiel« (das. 1906). Auch aus Schnitzlers erzählenden Werken »Sterben« (Berl. 1895, 4. Aufl. 1904), »Frau Berta Garlan« (das. 1901, 4. Aufl. 1904), »Leutnant Gustl« (das. 1901, 12. Aufl. 1906), »Die Frau des Weisen« (das. 1898, 6. Aufl. 1906) und »Die griechische Tänzerin« (Wien 1905) weht uns derselbe Geist entgegen, der sich schließlich in den (zuerst nur durch einen Privatdruck verbreiteten) sehr gewagten zehn Dialogen »Reigen« (das. 1903) in gar zu unbekümmerter Freiheit offenbart. Zuletzt erschien: »Dämmerseelen«, Novellen (1.–7. Aufl., Berl. 1907). Vgl. Salkind, Arthur S. (Leipz. 1907).
Der tote Gabriel
Sie tanzte an ihm vorüber, im Arme eines Herrn, den er nicht kannte, neigte ganz leise den Kopf, und lächelte. Ferdinand Neumann verbeugte sich tiefer, als es sonst seine Art war. Sie ist auch da, dachte er verwundert und fühlte sich mit einem Male freier als vorher. Wenn Irene es über sich vermochte, schon vier Wochen nach Gabriels Tod in weißem Kleide mit einem beliebigen unbekannten Herrn durch einen lichten Saal zu schweben, so durfte er sich's auch nicht länger übelnehmen, an diesen Ort der lauten Freude gekommen zu sein. Heute abends zum erstenmal nach vier Wochen stiller Zurückgezogenheit war er von dem Wunsch erfaßt worden, wieder unter Menschen zu gehen. Zur angenehmen Überraschung seiner Eltern, die sich ihres Sohnes tiefe Verstimmung über den Tod eines doch nur flüchtigen Bekannten kaum zu erklären gewußt hatten, war er zum Abendessen im Frack erschienen, hatte die Absicht geäußert, den Juristenball zu besuchen, und entfernte sich bald mit dem angenehmen Gefühl, den guten alten Leuten ohne besondere Mühe eine kleine Freude bereitet zu haben.
Im Fiaker, der ihn nach den Sophiensälen führte, wurde ihm wieder etwas beklommen ums Herz. Er dachte der Nacht, in der er von Wilhelminens Fenster aus drüben am Stadtparkgitter eine dunkle Gestalt hatte auf und ab wandeln sehen; des Morgens, an dem er, noch im Bette liegend, die Nachricht von dem Selbstmord Gabriels in der Zeitung gefunden; der Stunde, da ihm Wilhelmine den ergreifenden Brief zu lesen gegeben, in dem Gabriel von ihr, ohne ein Wort des Vorwurfs, ewigen Abschied genommen hatte. Auch während er über die breite Treppe emporstieg, und selbst im Saal beim Rauschen der Musik war ihm nicht heiterer zumute geworden; erst Irenens Anblick hatte seine Stimmung erhellt.
Er kannte Irene schon einige Jahre, ohne je ein sonderliches Interesse an ihr genommen zu haben, und wie allen Bekannten des Hauses war auch ihm ihre Neigung zu Gabriel kein Geheimnis geblieben. Als Ferdinand ein paar Tage vor Weihnachten im Hause ihrer Eltern zu Gaste gewesen war, hatte sie mit ihrer angenehmen, dunklen Stimme ein paar Lieder gesungen. Gabriel hatte sie auf dem Klavier begleitet, und Ferdinand erinnerte sich deutlich, daß er sich gefragt hatte: Warum heiratet denn der gute Junge nicht das liebe, einfache Geschöpf, statt sich an diese großartige Wilhelmine zu hängen, die ihn sicher demnächst betrügen wird? Daß gerade er vom Schicksal ausersehen war, diese Ahnung wahr zu machen, das hatte Ferdinand an jenem Tage freilich noch nicht geahnt. Doch was den wahren Anteil seiner Schuld an Gabriels Tod anbelangte, so hatte Anastasius Treuenhof, der Versteher aller irdischen und göttlichen Dinge, sofort festgestellt, daß ihm in dieser ganzen Angelegenheit nicht die Rolle eines Individuums, sondern die eines Prinzips zugefallen, daß daher wohl zu gelinder Wehmut, keineswegs aber zu ernsthafter Reue ein Anlaß vorhanden sei. Immerhin war es ein peinlicher Augenblick für Ferdinand gewesen, als er mit Wilhelmine an Gabriels Grabe stand, auf dem noch die welkenden Kränze lagen und seine Begleiterin plötzlich mit jenem Tonfall, den er von der Bühne her so gut kannte, zu ihm, dem Tränen über die Wangen liefen, die Worte sprach: »Ja, du Schuft, nun kannst du freilich weinen.« Eine Stunde später schwor sie allerdings, daß um seinetwillen auch Bessere als Gabriel hätten sterben dürfen, und in den letzten Tagen schien es Ferdinand manchmal, als hätte sie alles Traurige, was geschehen war, einfach vergessen. Treuenhof wußte auch diesen seltsamen Umstand zu erklären, und zwar damit, daß die Frauen mit den Urelementen verwandter als die Männer und daher von Anbeginn dazu geschaffen wären, das Unabänderliche mit Ruhe hinzunehmen.
Zum zweitenmal tanzte Irene an Ferdinand vorüber, und wieder lächelte sie. Aber ihr Lächeln schien ein anderes als das erstemal; beziehungsreicher, grüßender, und ihr Blick blieb auf Ferdinand haften, während sie schon wieder davonschwebte und mit ihrem Tänzer in der Menge verschwand. Als der Walzer zu Ende war, spazierte Ferdinand im Saal herum, fragte sich, was ihn eigentlich hergelockt hatte, und ob es der Mühe wert gewesen war, die edle Melancholie seines Daseins, der in der letzten Zeit die leidenschaftlichen Stunden in Wilhelminens Armen nur einen düstern Reiz mehr verliehen, von der rauschenden Banalität dieses Ballabends stören zu lassen. Und er bekam plötzlich Sehnsucht, sich nicht nur von dem Balle zu entfernen, sondern in den allernächsten Tagen, vielleicht morgen, die Stadt zu verlassen und eine Reise nach dem Süden anzutreten, nach Sizilien oder Ägypten. Er überlegte eben, ob er vor seiner Abfahrt Wilhelminen Lebewohl sagen sollte – als plötzlich Irene vor ihm stand. Leicht neigte sie den Kopf und erwiderte seinen Gruß; er reichte ihr den Arm und führte sie durch das Gedränge im Saal die wenigen Stufen hinauf zu dem breiten Gang mit den gedeckten Tischen, der rings um den Tanzsaal lief. Eben fing die Musik wieder an und beim ersten Schwellen der Akkorde sagte Irene leise: »Er ist tot – und wir zwei sind da.« Ferdinand erschrak ein wenig, beschleunigte unwillkürlich seine Schritte und bemerkte endlich: »Es ist heute das erstemal seither, daß ich unter so vielen Menschen bin.«
»Für mich ist's heute schon das drittemal,« erwiderte Irene mit klarer Stimme. »Einmal bin ich im Theater gewesen und einmal auf einer Soiree.«
»War es amüsant?« fragte Ferdinand.
»Ich weiß es nicht. Irgendwer hat Klavier gespielt, irgendein anderer hat komische Sachen vorgetragen, und dann hat man getanzt.«
»Ja es ist immer dasselbe,« bemerkte Ferdinand.
Sie standen vor einer Tür. »Ich bin zur Quadrille engagiert,« sagte Irene, »aber ich will sie nicht tanzen. Flüchten wir auf die Galerie.« Ferdinand führte Irene über die schmale, kühle Wendeltreppe hinauf. Er sah einzelne feine Puderstäubchen auf Irenens Schultern. Das schwarze Haar trug sie in einem schweren Knoten tief im Nacken. Ihr Arm lag leicht in dem seinen. Die Tür zur Galerie stand offen, in der ersten Loge saß ein Kellner, der sich nun eilig erhob.
»Ich will ein Glas Champagner trinken,« sagte Irene.
O! dachte Ferdinand – sollte sie interessanter sein, als ich vermutete? Oder ist es Affektation?
Er bestellte den Wein, dann rückte er ihr einen Sessel zurecht, so daß man sie von unten nicht sehen konnte.
»Sie waren sein Freund?« fragte Irene und sah ihm fest ins Auge.
»Sein Freund? Das kann man eigentlich nicht sagen. Jedenfalls waren unsere Beziehungen in den letzten Jahren nur sehr lose.« Und er dachte: Wie sonderbar sie mich ansieht. Sollte sie ahnen, daß ich ... Doch er sprach weiter: »Vor fünf oder sechs Jahren habe ich zugleich mit ihm an der Universität einige Vorlesungen gehört. Wir haben nämlich beide Jus studiert, überflüssigerweise. Dann, vor drei Jahren, im Herbst, haben wir miteinander eine Radpartie gemacht, von Innsbruck aus, wo wir uns ganz zufällig getroffen hatten. Über den Brenner. In Verona haben wir uns wieder getrennt. Ich bin nach Hause gereist, er nach Rom.«
Irene nickte manchmal, als wenn sie lauter bekannte Dinge zu hören bekäme. Ferdinand fuhr fort: »In Rom hat er übrigens sein erstes Stück geschrieben, vielmehr das erste, das aufgeführt wurde.«
»Ja,« sagte Irene.
»Er hat nicht viel Glück gehabt,« bemerkte Ferdinand. Der Champagner stand auf dem Tisch. Ferdinand schenkte ein. Sie ließen die Gläser aneinanderklingen, und während sie tranken, sahen sie einander ernst ins Auge, als gälte das erste Glas dem Gedächtnis des Entschwundenen. Dann setzte Irene das Glas nieder und sagte ruhig: »Wegen der Bischof hat er sich umgebracht.«
»Das wird behauptet,« erwiderte Ferdinand einfach und empfand Befriedigung darüber, daß er sich mit keiner Miene verriet.
Die Einleitungsklänge der Quadrille schmetterten so heftig, daß die Champagnerkelche leise bebten.
»Kennen Sie die Bischof persönlich?« fragte Irene.
»Ja,« erwiderte Ferdinand. Also, sie hat keine Ahnung, dachte er. Natürlich. Wenn sie es ahnte, tränke sie wohl nicht hier heroben mit mir Champagner. Oder vielleicht erst recht ...?
»Ich habe die Bischof neulich als Medea gesehen,« sagte Irene. »Nur ihretwegen bin ich ins Theater gegangen. Seit der Premiere des Stückes von Gabriel im vorigen Winter hatte ich sie nicht auf der Bühne gesehen. Damals hat die Geschichte wohl angefangen?«
Ferdinand zuckte die Achseln, er wußte gar nichts. Und er stellte fest: »Sie ist eine große Künstlerin.«
»Das ist wohl möglich,« erwiderte Irene, »aber ich glaube nicht, daß sie darum das Recht hat ...«
»Was für ein Recht?« fragte Ferdinand, während er die Gläser von neuem füllte.
»Das Recht, einen Menschen in den Tod zu treiben,« schloß Irene und blickte ins Leere.
»Ja, mein Fräulein,« sagte Ferdinand bedächtig, »wo hier einerseits das Recht, andererseits die Verantwortung anfängt, das läßt sich schwer entscheiden. Und wenn man die näheren Umstände nicht kennt, wie kann man da ... Jedenfalls gehört Fräulein Bischof zu den Wesen, die, wie soll ich nur sagen, mit den Elementargeistern verwandter sind als wir anderen Menschen, und man darf an solche Geschöpfe wahrscheinlich nicht das gleiche Maß legen wie an unsereinen.«
Irene hatte ihren kleinen altmodischen Elfenbeinfächer auf den Tisch gelegt, nahm ihn nun wieder auf und führte ihn an Wange und Stirn, wie zur Kühlung. Dann trank sie ihr Glas auf einen Zug aus und sagte: »Daß sie ihm nicht treu geblieben ist – nun, das ist ja vielleicht zu verstehen. Aber warum ist sie nicht aufrichtig zu ihm gewesen? Warum hat sie ihm nicht gesagt: Es ist aus. Ich liebe einen andern, laß uns scheiden. Es hätte ihm gewiß sehr weh getan, aber in den Tod getrieben hätt' es ihn nicht.«
»Wer weiß,« sagte Ferdinand langsam.
»Gewiß nicht,« wiederholte Irene hart. »Nur der Ekel war es, der ihn dahin gejagt hat. Der Ekel. Daß er denken mußte: dieselben Worte, die ich heute gehört, dieselben Zärtlichkeiten, die ich heute empfangen ...« Ein Zucken ging durch ihren Körper, ihr Blick schweifte über die Brüstung in den Saal hinaus, und sie schwieg.
Ferdinand sah sie an und begriff nicht, daß sich irgendein Mensch auf Erden Wilhelminens wegen umbringen konnte, der von diesem Mädchen geliebt war. Er zweifelte in diesem Moment auch stärker als je, daß Gabriel jemals Talent gehabt hätte. Freilich konnte er sich des Stückes nur dunkel entsinnen, in dem Wilhelmine voriges Jahr die Hauptrolle gespielt hatte, und nach dessen Mißerfolg sie, wie zur Entschädigung, Gabriels Geliebte geworden war. Sehr leise sagte Irene jetzt, mit abgewandtem Blick: »Sie haben also in den letzten Jahren nicht mit ihm verkehrt?«
»Wenig,« erwiderte Ferdinand. »Erst im letzten Herbst sind wir wieder einige Male zusammengekommen. Ich bin ihm zufällig einmal auf dem Ring begegnet. Er war gerade in Gesellschaft der Bischof, und wir haben dann alle drei im Volksgarten miteinander soupiert. Es war ein sehr gemütlicher Abend. Man konnte noch im Freien sitzen, obwohl es schon Ende Oktober war. Dann sind wir noch ein paarmal zusammen gewesen nach diesem Abend – ein- oder zweimal sogar oben bei Fräulein Bischof. Ja, es hatte gewissermaßen den Anschein, als wenn man einander wiedergefunden hätte nach langer Zeit. Aber es wurde nichts daraus.« Ferdinand sah an Irene vorbei und lächelte.
»Nun will ich Ihnen etwas erzählen,« sagte Irene. »Ich hatte die Absicht, Fräulein Bischof zu besuchen.«
»Wie?« rief Ferdinand und betrachtete Irenens Stirn, die sehr weiß war und höher, als Mädchenstirnen zu sein pflegen.
Die Quadrille war zu Ende, und die Musik schwieg. Lärmend von unten drang das Gewirr der Stimmen. Einige gleichgültige Worte, als hätten sie die Kraft sich von den anderen loszulösen, drangen deutlicher herauf.
»Ich war sogar fest entschlossen,« sagte Irene, während sie den elfenbeinernen Fächer auf- und zuklappte. »Aber – denken Sie, wie kindisch, im letzten Moment versagte mir immer der Mut.«
»Warum wollten Sie sie denn besuchen?« fragte Ferdinand.
»Warum? Das ist doch sehr einfach. Ich wollte sie eben von Angesicht zu Angesicht sehen, ihre Stimme hören, wollte wissen, wie sie im gewöhnlichen Leben spricht und sich bewegt, sie um allerlei alltägliche Dinge fragen. Begreifen Sie denn das nicht?« fügte sie plötzlich heftig hinzu, lachte kurz, trank einen Schluck aus ihrem Glase und redete weiter. »Es interessiert einen doch, wie diese Frauen eigentlich sind, diese geheimnisvollen, die man mit anderem Maße messen muß, wie Sie behaupten, die, für die gute Menschen sich umbringen, und die drei Tage später wieder auf der Bühne stehen, so herrlich und so groß, als hätte sich nichts auf der Welt verändert.«
Zwei Herren gingen vorüber, blieben stehen, wandten sich um und starrten Irene an.
Ferdinand war ärgerlich und entschlossen, wenn diese Ungezogenheit nur eine Sekunde länger andauerte, aufzustehen und die beiden Herren zur Rede zu stellen. Und er sah sich schon Karten wechseln, Zeugen empfangen, im Morgengrauen durch den Prater fahren, durch die Brust getroffen auf die feuchte Erde sinken, und endlich Wilhelminen mit irgendeinem Komödianten an seinem Grabe stehen. Aber noch vor Ablauf der Sekunde, die er den Herren Frist gegönnt hatte, starrten sie nicht mehr und spazierten weiter. Und Ferdinand hörte wieder Irenens Stimme: »Jetzt hätte ich Mut,« sagte sie mit einem seltsamen, wie verzweifelten Lächeln.
»Wozu Mut?« fragte Ferdinand.
»Mut, das Fräulein Bischof zu besuchen.«
»Das Fräulein Bischof zu besuchen ... jetzt –?«
»Ja, gerade jetzt. Was denken Sie dazu?« Und sie wiegte die Schultern im Takte der Musik. »Oder sollen wir Walzer tanzen?«
»Immerhin liegt es näher,« meinte Ferdinand.
»Ist es nicht sonderbar,« sagte Irene mit lustigen Augen. »Was hat sich denn geändert, seitdem wir hier in der Loge sitzen und Champagner trinken? Nichts. Nicht das geringste. Und plötzlich kommt einem vor, daß der Tod gar nicht so Schreckliches ist, als man sich gewöhnlich vorstellt. Sehen Sie; ohne weiteres könnte ich mich hier herunterstürzen – oder auch von einem Turm. Wie nichts erscheint mir das. Ein Spaß. Und wie gut bekannt wir zwei miteinander geworden sind! Aber das verdanken Sie nur Gabriel.«
»Ich habe mir nie eingebildet, ...« sagte Ferdinand verbindlich lächelnd und merkte, daß er ein wenig Herzklopfen hatte.
Irenens Augen waren nicht mehr lustig, sie waren groß, schwarz und ernst, »Und wissen Sie, wie ich mir das dachte,« sagte sie, ohne auf ihn zu hören. »Ich wollte mich als angehende Künstlerin vorstellen oder einfach als glühende Verehrerin. Schon lange sehne ich mich ... schon lange schmachte ich danach ... in der Art wollte ich beginnen. Sie sind doch alle sehr eitel diese Frauen, nicht?«
»Das gehört zum Beruf,« erwiderte Ferdinand.
»Ah, ich hätte ihr so geschmeichelt, daß sie ganz entzückt gewesen wäre und mich gewiß aufgefordert hätte, wiederzukommen ... Und ich wär' auch wiedergekommen, öfters sogar, ganz intim wären wir geworden, Freundinnen geradezu; bis ich ihr eines Tages ... – ja – bis ich ihr's ins Gesicht geschrien hätte, in irgend einer Stunde: ›Wissen Sie auch, was Sie getan haben ... Wissen Sie, was Sie sind? Eine Mörderin! Ja, das sind Sie, Fräulein Bischof.‹«
Ferdinand betrachtete sie mit Staunen und dachte wieder: Was für ein Narr dieser Gabriel gewesen ist.
Die Quadrille war aus, unten summte und rauschte es, und alles kam von ferner als vorher. Zwei Paare spazierten vorbei, setzten sich gar nicht weit zu einem der Tische an der Wand, unterhielten sich und lachten ganz laut. Dann fing die Musik wieder an; es klang und schwoll durch den Raum.
»Und wenn ich jetzt zu ihr hinginge?« fragte Irene.
»Jetzt?«
»Was denken Sie, empfinge sie mich?«
»Es wäre eine sonderbare Stunde,« sagte Ferdinand lächelnd.
»Ach, es kann noch lange nicht Mitternacht sein, und sie hat ja heute gespielt.«
»Sie wissen das?«
»Was ist daran verwunderlich, steht es nicht in der Zeitung? Sie wird eben erst nach Hause gekommen sein. Wäre es nicht die einfachste Sache von der Welt? Man läßt sich melden, erzählt irgendeine Geschichte oder ganz einfach die Wahrheit. Ja. Ich komme geradewegs von einem Ball, meine Sehnsucht, Sie kennen zu lernen, war unüberwindlich, nur einmal wollt' ich die göttliche Hand küssen ... und so weiter. – Indessen wartet unten der Wagen, noch vor der großen Pause ist man zurück. Kein Mensch hat es bemerkt.«
»Wenn Sie dazu bereit sind, Fräulein,« sagte Ferdinand, »so erlauben Sie mir wohl, Sie zu begleiten.«
Irene sah ihn an. Der Ausdruck seiner Mienen war entschlossen und erregt. »Sie glauben doch nicht, daß ich wirklich ...«
»Aber von einem Turm zu springen, Fräulein, dazu hätten Sie Mut genug? ...«
Irene schaute ihm ins Auge, und plötzlich stand sie auf. »Dann aber gleich,« sagte sie, und über ihre Stirn lief ein dunkler Schatten.
Ferdinand rief den Kellner, bezahlte, reichte Irene den Arm und führte sie über die zwei Treppen hinab in die Vorhalle. Dort half er ihr in den hellgrauen Mantel, sie schlug den Pelzkragen in die Höhe und nahm ein Spitzentuch über den Kopf. Ohne ein Wort miteinander zu reden, traten beide unter das Tor in die Einfahrt. Ein Wagen fuhr herbei, und lautlos über die beschneite Straße rollten sie ihrem Ziele zu.
Ferdinand sah Irene zuweilen von der Seite an. Sie saß regungslos, und aus ihrem verhüllten Gesicht starrten die Augen ins Dunkle. Als nach wenigen Minuten der Wagen vor dem Hause auf dem Parkring stehenblieb, wartete Irene, bis Ferdinand geklingelt hatte und das Tor geöffnet war. Dann erst stieg sie aus, und beide gingen langsam die Treppen hinauf. Ferdinand fühlte sich wie aus einem Traum erwachen, als das wohlbekannte Kammermädchen vor ihm stand und ihn und seine Begleiterin verwundert betrachtete.
»Bitte, fragen Sie das Fräulein,« sagte Ferdinand, »ob sie die Güte haben möchte, uns zu empfangen.«
Das Mädchen lächelte dumm und führte das Paar in den Salon. Die Flammen des Deckenlusters strahlten auf, und Ferdinand sah Irene und sich selbst wie zwei fremde Menschen in dem venezianischen Spiegel schweben, der schiefgeneigt über dem schwarzen, glänzenden Flügel hing. Plötzlich fuhr ihm ein Gedanke durch den Kopf. Wie, wenn Irene sich nur darum hieher hätte fuhren lassen, um Wilhelmine zu ermorden. Der Einfall schwand so schnell, als er gekommen war; aber jedenfalls erschien ihm das junge Mädchen, wie es neben ihm stand und ihm das Spitzentuch langsam vom Kopf herabglitt, völlig verändert, ja, wie irgendein fremdes Wesen, dessen Stimme er noch nicht einmal kannte.
Eine Tür öffnete sich, und Wilhelmine trat ein in einem glatten samtnen Hauskleid, das den Hals frei ließ. Sie reichte Ferdinand die Hand und betrachtete ihn und das Fräulein mit Blicken, die eher Heiterkeit als Verwunderung ausdrückten. Ferdinand versuchte den Anlaß des nächtlichen Besuches mit scherzhaften Worten zu erklären. Er berichtete, wie seine Begleiterin während des Tanzes von nichts anderem gesprochen hatte, als von ihrer Bewunderung für Fräulein Bischof, und wie er sich in einer Art von Faschingslaune erbötig gemacht hatte, das Fräulein zu nachtschlafender Stunde in das Haus der Wunderbaren zu geleiten – auf die Gefahr hin, daß sie beide gleich wieder die Treppe hinunterbefördert würden.
»Was fällt Ihnen ein,« erwiderte Wilhelmine, »im Gegenteil, ich bin entzückt,« und sie reichte Irene die Hand. »Nur muß ich die Herrschaften bitten, mir beim Abendessen Gesellschaft zu leisten, ich komme nämlich eben aus dem Theater.« Man begab sich in den Nebenraum, wo unter einer grünlichen Kristallglocke drei matte Glühlampen einen nur zur Hälfte gedeckten Tisch beleuchteten. Während Ferdinand seinen Pelz ablegte und ihn auf den Diwan warf, nahm Wilhelmine Irene den Mantel selbst von den Schultern und hing ihn über eine Stuhllehne. Hierauf nahm sie Gläser aus der Kredenz, füllte sie mit weißem Wein, stellte sie vor Ferdinand und Irene hin, dann erst setzte sie sich nieder, nahm sich ruhig ein Stück kaltes Fleisch auf den Teller, zerschnitt es, sagte »Erlauben Sie« und begann zu essen. Von Zeit zu Zeit warf sie einen gutmütigen, wie von fern lächelnden Blick auf Irene und Ferdinand.
Sie findet es natürlich selbstverständlich, dachte Ferdinand ein wenig enttäuscht. Und wenn ich mit der Kaiserin von China gekommen wäre und ihr jetzt meine Ernennung zum Mandarin mitteilte, es käme ihr auch nicht sonderbar vor. Schade eigentlich. »Denn Frauen, die niemals staunen, gehören niemandem ganz ...« Es war ein Wort von Treuenhof, das ihm ziemlich ungenau durch den Kopf ging.
»War es lustig auf dem Ball?« fragte Wilhelmine. Ferdinand berichtete, daß der Saal überfüllt wäre, meist von häßlichen Menschen, und auch mit der Musik war' es nicht zum Besten bestellt. Er redete so hin. Wilhelmine blickte ihm wohlgelaunt ins Gesicht und wandte sich an Irene mit der Frage, ob ihr Begleiter ein flotter Tänzer wäre.
Irene nickte und lächelte. Ihr »Ja« war beinahe unhörbar.
»Sie haben heute ›Feodora‹ gespielt, Fräulein?« fragte Ferdinand, um das Gespräch nicht stocken zu lassen. »War es gut besucht?«
»Ausverkauft«, erwiderte Wilhelmine.
Irene sprach: »Als Feodora habe ich Sie leider noch nicht gesehen, Fräulein Bischof. Aber neulich als Medea. Es war herrlich.«
»Heißen Dank,« entgegnete Wilhelmine.
Irene äußerte noch einige Worte der Bewunderung, dann fragte sie Wilhelmine nach ihren Lieblingsrollen und schien ihren Antworten mit Anteilnahme zu lauschen; endlich kam es zu einem oberflächlich wirren Gespräch darüber, wer der größere Schauspieler sei, der in der darzustellenden Gestalt sich völlig verliere oder der über seiner Rolle stehe. Hier erwähnte Ferdinand, daß er mit einem jungen Komiker bekannt gewesen sei, der ihm selbst erzählt hatte, wie er eine gewisse höchst lustige Rolle gerade am Begräbnistage seines Vaters wirkungsvoller gespielt hätte als je.
»Sie haben ja nette Freunde,« bemerkte hierauf Wilhelmine und steckte eine Orangenschnitte in den Mund.
Wie ist es nun eigentlich? dachte Ferdinand. Hat Fräulein Irene vergessen, daß sie Wilhelmine ins Gesicht eine Mörderin heißen wollte ... Und weiß Wilhelmine überhaupt noch, daß ich ihr Geliebter bin, ich, der mit einer fremden jungen Dame ihr mitten in der Nacht einen Besuch abstattet..?
»Sie haben ein so reges Interesse fürs Theater, Fräulein,« bemerkte Wilhelmine, »sollten Sie vielleicht einmal daran gedacht haben, selbst diese Karriere einzuschlagen?«
Irene schüttelte den Kopf. »Ich habe leider kein Talent.«
»Nun danken Sie Gott,« sagte Wilhelmine, »es ist ein Sumpf.«
Und jetzt, während sie begann, von den Niederträchtigkeiten zu erzählen, die man als Künstlerin von allen Seiten zu erdulden habe, sah Ferdinand, wie Irene, gleichsam gebannt, zu einer Tür hinschaute, die angelehnt war und durch deren Spalt es bläulich hereinschimmerte. Und er bemerkte, wie Irenens. Antlitz, das bisher regungslos gewesen war, unter seiner Blässe sich leise zu bewegen, wie die schweigenden Lippen seltsam zu zucken begannen. Und ihm war, als gewahrte er in ihren weit geöffneten Augen eine frevelhafte Lust, in das bläuliche Zimmer einzudringen und ihr Gesicht in den Polster zu graben, auf dem Gabriels Haupt einmal geruht hatte. Dann fiel ihm ein, daß ein längeres Ausbleiben Irenens, wenn es schon bis jetzt unbemerkt geblieben sein mochte, immerhin von unangenehmen Folgen für sie und vielleicht auch für ihn begleitet sein könnte; und er rückte seinen Sessel.
Irene wandte sich ihm zu, wie aus einem Traum erwachend. Noch war ein Nachklang von Wilhelminens letzten Worten in der Luft, die keiner gehört hatte.
»Es ist wohl Zeit, daß wir gehen,« sagte Irene und erhob sich.
»Ich bedaure sehr,« erwiderte Wilhelmine, »daß ich nicht länger das Vergnügen habe.«
Irene betrachtete sie mit einem ruhig prüfenden Blick.
»Nun, mein Kind?« fragte Wilhelmine.
»Es ist sonderbar,« sagte Irene, »wie Sie mich an ein Bild erinnern, Fräulein, das bei uns zu Hause hängt. Es stellt eine kroatische oder slowakische Bäuerin vor, die auf einer beschneiten Landstraße vor einem Heiligenbild betet.«
Wilhelmine nickte gedankenvoll, als erinnerte sie sich ganz deutlich des Wintertages, an dem sie irgendwo in Kroatien vor jenem Heiligenbild im Schnee gekniet war. Dann ließ sie es sich nicht nehmen, Irenen selbst den Mantel um die Schultern zu legen und begleitete ihre Gäste ins Vorzimmer. »Nun tanzen Sie lustig weiter,« sagte sie. »Das heißt, wenn Sie wirklich auf den Ball zurückfahren.«
Irene wurde totenblaß, aber sie lächelte.
»Man muß sich vor ihm hüten,« fügte Wilhelmine hinzu und warf einen Blick auf Ferdinand, den ersten, in dem irgend etwas wie die Erinnerung in die vergangene Nacht lag.
Ferdinand erwiderte nichts und fühlte nur, wie Irene ihn und Wilhelmine mit einem und demselben dunklen Blick umfaßte.
Das Stubenmädchen erschien, Wilhelmine reichte nochmals ihren Gästen die Hand, sprach die Hoffnung aus, das junge Mädchen bald wieder bei sich zu sehen, und lächelte Ferdinand an, als hätte sie ein verabredetes Spiel gegen ihn gewonnen.
Von dem Stubenmädchen mit der Kerze geleitet, schweigend, schritten Ferdinand und Irene die Treppe hinunter. Bald schloß sich das Haustor hinter ihnen. Der Kutscher öffnete den Schlag, Irene stieg ein, Ferdinand setzte sich an ihre Seite. Die Pferde trabten durch den stillen Schnee. Von einer Straßenlaterne fiel plötzlich ein Strahl auf Irenens Antlitz. Ferdinand sah, wie sie ihn anstarrte und die Lippen halb öffnete.
»Also Sie,« sagte sie leise. Und es war ihm, als bebte Staunen, Grauen, Haß in ihrer Stimme. Sie waren im Dunkeln. Wenn sie einen Dolch bei sich hätte, dachte Ferdinand, ob sie ihn mir ins Herz stieße ...? Wie man's auch nimmt, dazu kam ich recht unschuldig. War ich nicht vielmehr ein Prinzip, als ... Und er überlegte, ob er nicht versuchen sollte, ihr die Sache zu erklären. Nicht etwa, um sich zu rechtfertigen, sondern eher, weil dieses kluge Geschöpf es wohl verdiente, in die tieferen Zusammenhänge der ganzen Geschichte eingeweiht zu werden.
Plötzlich fühlte er sich umklammert und auf seinen Lippen die Irenens, wild, heiß und süß. Es war ein Kuß, wie er noch niemals einen gefühlt zu haben glaubte, so duftend und so geheimnisvoll; und er wollte nicht enden. Erst als der Wagen stehenblieb, löste sich Mund von Mund.
Ferdinand verließ den Wagen und war Irenen beim Aussteigen behilflich.
»Sie werden mir nicht folgen,« sagte sie hart, und war auch schon in der Halle verschwunden. Ferdinand blieb draußen stehen. Er dachte keinen Augenblick daran, ihren Befehl zu mißachten. Er fühlte ganz deutlich und mit plötzlichem Schmerz, daß es vorbei war und daß diesem Kuß nichts folgen konnte. –
Drei Tage später berichtete er sein Abenteuer Anastasius Treuenhof, dem man nichts zu verschweigen brauchte, da Diskretion ihm gegenüber geradeso kindisch gewesen wäre wie vor dem lieben Gott.
»Es ist schade,« sagte Anastasius nach kurzem Besinnen, »daß sie nicht Ihre Geliebte geworden ist. Euer Kind hätte mich interessiert. Kinder der Liebe haben wir genug, Kinder der Gleichgültigkeit allzuviel, an Kindern des Hasses herrscht ein fühlbarer Mangel. Und es ist nicht unmöglich, daß uns gerade von ihnen das Heil kommen wird.«
»Sie glauben also,« fragte Ferdinand ...
»Nun was denn bilden Sie sich ein?« entgegnete Anastasius streng.
Ferdinand senkte das Haupt und schwieg.
Im übrigen hatte er sein Schlafwagenbillett nach Triest in der Tasche, von dort ging es dann weiter nach Alexandrien, Kairo, Assuan ... Seit drei Tagen begriff er auch, daß Menschen aus hoffnungsloser Liebe sterben können ... andere natürlich ... andere.
Das Tagebuch der Redegonda
Gestern nachts, als ich mich auf dem Heimweg für eine Weile im Stadtpark auf einer Bank niedergelassen hatte, sah ich plötzlich in der anderen Ecke einen Herrn lehnen, von dessen Gegenwart ich vorher nicht das geringste bemerkt hatte. Da zu dieser späten Stunde an leeren Bänken im Park durchaus kein Mangel war, kam mir das Erscheinen dieses nächtlichen Nachbars etwas verdächtig vor; und eben machte ich Anstalten, mich zu entfernen, als der fremde Herr, der einen langen grauen Überzieher und gelbe Handschuhe trug, den Hut lüftete, mich beim Namen nannte und mir einen guten Abend wünschte. Nun erkannte ich ihn, recht angenehm überrascht. Es war Dr. Gottfried Wehwald, ein junger Mann von guten Manieren, ja sogar von einer gewissen Vornehmheit des Auftretens, die zumindest ihm selbst eine immerwährende stille Befriedigung zu gewähren schien. Vor etwa vier Jahren war er als Konzeptspraktikant aus der Wiener Statthalterei nach einer kleinen niederösterreichischen Landstadt versetzt worden, tauchte aber von Zeit zu Zeit wieder unter seinen Freunden im Caféhause auf, wo er stets mit jener gemäßigten Herzlichkeit begrüßt wurde, die seiner eleganten Zurückhaltung gegenüber geboten war. Daher fand ich es auch angezeigt, obzwar ich ihn seit Weihnachten nicht gesehen hatte, keinerlei Befremden über Stunde und Ort unserer Begegnung zu äußern; liebenswürdig, aber anscheinend gleichgültig erwiderte ich seinen Gruß und schickte mich eben an, mit ihm ein Gespräch zu eröffnen, wie es sich für Männer von Welt geziemt, die am Ende auch ein zufälliges Wiedersehen in Australien nicht aus der Fassung bringen dürfte, als er mit einer abwehrenden Handbewegung kurz bemerkte: »Verzeihen Sie, werter Freund aber meine Zeit ist gemessen und ich habe mich nur zu dem Zwecke hier eingefunden, um Ihnen eine etwas sonderbare Geschichte zu erzählen, vorausgesetzt natürlich, daß Sie geneigt sein sollten, sie anzuhören.«
Nicht ohne Verwunderung über diese Anrede erklärte ich mich trotzdem sofort dazu bereit, konnte aber nicht umhin, meinem Befremden Ausdruck zu verleihen, daß Dr. Wehwald mich nicht im Caféhause aufgesucht habe, ferner wieso er ihm gelungen war, mich nächtlicherweise hier im Stadtpark aufzufinden und endlich, warum gerade ich zu der Ehre ausersehen sei, seine Geschichte anzuhören.
»Die Beantwortung der beiden ersten Fragen,« erwiderte er mit ungewohnter Herbheit, »wird sich im Laufe meines Berichtes von selbst ergeben. Daß aber meine Wahl gerade auf Sie fiel, werter Freund (er nannte mich nun einmal nicht anders), hat seinen Grund darin, daß Sie sich meines Wissens auch schriftstellerisch betätigen und ich daher glaube, auf eine Veröffentlichung meiner merkwürdigen, aber ziemlich zwanglosen Mitteilungen in leidlicher Form rechnen zu dürfen.«
Ich wehrte bescheiden ab, worauf Dr. Wehwald mit einem sonderbaren Zucken um die Nasenflügel ohne weitere Einleitung begann: »Die Heldin meiner Geschichte heißt Redegonda. Sie war die Gattin eines Rittmeisters, Baron T. vom Dragonerregiment X, das in unserer kleinen Stadt Z. garnisonierte.« (Er nannte tatsächlich nur diese Anfangsbuchstaben, obwohl mir nicht nur der Name der kleinen Stadt, sondern aus Gründen, die bald ersichtlich sein werden, auch der Name des Rittmeisters und die Nummer des Regiments keine Geheimnisse bedeuteten.) »Redegonda«, fuhr Dr. Wehwald fort, »war eine Dame von außerordentlicher Schönheit und ich verliebte mich in sie, wie man zu sagen pflegt, auf den ersten Blick. Leider war mir jede Gelegenheit versagt, ihre persönliche Bekanntschaft zu machen, da die Offiziere mit der Zivilbevölkerung beinahe gar keinen Verkehr pflegten und an dieser Exklusivität selbst gegenüber uns Herren von der politischen Behörde in fast verletzender Weise festhielten. So sah ich Redegonda immer nur von weitem; sah sie allein oder an der Seite ihres Gemahls, nicht selten in Gesellschaft anderer Offiziere und Offiziersdamen, durch die Straßen spazieren, erblickte sie manchmal an einem Fenster ihrer auf dem Hauptplatze gelegenen Wohnung, oder sah sie abends in einem holpernden Wagen nach dem kleinen Theater fahren, wo ich dann das Glück hatte, sie vom Parkett aus in ihrer Loge zu beobachten, die von den jungen Offizieren in den Zwischenakten gerne besucht wurde. Zuweilen war mir, als geruhe sie, mich zu bemerken. Aber ihr Blick streifte immer nur so flüchtig über mich hin, daß ich daraus keine weiteren Schlüsse ziehen konnte. Schon hatte ich die Hoffnung aufgegeben, ihr jemals meine Anbetung zu Füßen legen zu dürfen, als sie mir an einem wundervollen Herbstvormittag in dem kleinen parkartigen Wäldchen, das sich vom östlichen Stadttor aus weit ins Land hinaus erstreckte, vollkommen unerwartet entgegenkam. Mit einem unmerklichen Lächeln ging sie an mir vorüber, vielleicht ohne mich überhaupt zu gewahren und war bald wieder hinter dem gelblichen Laub verschwunden. Ich hatte sie an mir vorübergehen lassen, ohne nur die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, daß ich sie hätte grüßen oder gar das Wort an sie richten können; und auch jetzt, da sie mir entschwunden war, dachte ich nicht daran, die Unterlassung eines Versuchs zu bereuen, dem keinesfalls ein Erfolg hätte beschieden sein können. Aber nun geschah etwas Sonderbares: Ich fühlte mich nämlich plötzlich gezwungen, mir vorzustellen, was daraus geworden wäre, wenn ich den Mut gefunden hätte, ihr in den Weg zu treten und sie anzureden. Und meine Phantasie spiegelte mir vor, daß Redegonda, fern davon mich abzuweisen, ihre Befriedigung über meine Kühnheit keineswegs zu verbergen suchte, es im Laufe eines lebhaften Gespräches an Klagen über die Leere ihres Daseins, die Minderwertigkeit ihres Verkehrs nicht fehlen ließ und endlich ihrer Freude Ausdruck gab, in mir eine verständnisvolle mitfühlende Seele gefunden zu haben. Und so verheißungsvoll war der Blick, den sie zum Abschied auf mir ruhen ließ, daß mir, der ich all dies, auch den Abschiedsblick, nur in meiner Einbildung erlebt hatte, am Abend desselben Tages, da ich sie in ihrer Loge wiedersah, nicht anders zumute war, als schwebe ein köstliches Geheimnis zwischen uns beiden. Sie werden sich nicht wundern, werter Freund, daß ich, der nun einmal von der Kraft seiner Einbildung eine so außerordentliche Probe bekommen hatte, jener ersten Begegnung auf die gleiche Art bald weitere folgen ließ, und daß sich unsere Unterhaltungen von Wiedersehen zu Wiedersehen freundschaftlicher, vertrauter, ja inniger gestalteten, bis eines schönen Tages unter entblätterten Ästen die angebetete Frau in meine sehnsüchtigen Arme sank. Nun ließ ich meinen beglückenden Wahn immer weiterspielen, und so dauerte es nicht mehr lange, bis Redegonda mich in meiner kleinen, am Ende der Stadt gelegenen Wohnung besuchte und mir Seligkeiten beschieden waren, wie sie mir die armselige Wirklichkeit nie so berauschend zu bieten vermocht hätte. Auch an Gefahren fehlte es nicht, unser Abenteuer zu würzen. So geschah es einmal im Laufe des Winters, daß der Rittmeister an uns vorbeisprengte, als wir auf der Landstraße im Schlitten pelzverhüllt in die Nacht hineinfuhren; und schon damals stieg ahnungsvoll in meinen Sinnen auf, was sich bald in ganzer Schicksalsschwere erfüllen sollte. In den ersten Frühlingstagen erfuhr man in der Stadt, daß das Dragonerregiment, dem Redegondas Gatte angehörte, nach Galizien versetzt werden wollte. Meine, nein, unsere Verzweiflung war grenzenlos. Nichts blieb unbesprochen, was unter solchen außergewöhnlichen Umständen zwischen Liebenden erwogen zu werden pflegt: gemeinsame Flucht, gemeinsamer Tod, schmerzliches Fügen ins Unvermeidliche. Doch der letzte Abend erschien, ohne daß ein fester Entschluß gefaßt worden wäre. Ich erwartete Redegonda in meinem blumengeschmückten Zimmer. Daß für alle Möglichkeiten vorgesorgt sei, war mein Koffer gepackt, mein Revolver schußbereit, meine Abschiedsbriefe geschrieben. Dies alles, mein werter Freund, ist die Wahrheit. Denn so völlig war ich unter die Herrschaft meines Wahns geraten, daß ich das Erscheinen der Geliebten an diesem Abend, dem letzten vor dem Abmarsch des Regiments, nicht nur für möglich hielt, sondern daß ich es geradezu erwartete. Nicht wie sonst gelang es mir, ihr Schattenbild herbeizulocken, die Himmlische in meine Arme zu träumen; nein, mir war als hielte etwas Unberechenbares, vielleicht Furchtbares, sie daheim zurück; hundertmal ging ich zur Wohnungstüre, horchte auf die Treppe hinaus, blickte aus dem Fenster, Redegondas Nahen schon auf der Straße zu erspähen; ja, in meiner Ungeduld war ich nahe daran, davonzustürzen, Redegonda zu suchen, sie mir zu holen, trotzig mit dem Recht des Liebenden und Geliebten sie dem Gatten abzufordern, – bis ich endlich, wie von Fieber geschüttelt, auf meinen Diwan niedersank. Da plötzlich, es war nahe an Mitternacht, tönte draußen die Klingel. Nun aber fühlte ich mein Herz stillestehen. Denn daß die Klingel tönte, verstehen Sie mich wohl, war keine Einbildung mehr. Sie tönte ein zweites und ein drittes Mal und erweckte mich schrill und unwidersprechlich zum völligen Bewußtsein der Wirklichkeit. Aber in demselben Augenblick, da ich erkannte, daß mein Abenteuer bis zu diesem Abend nur eine seltsame Reihe von Träumen bedeutet hatte, fühlte ich die kühnste Hoffnung in mir erwachen: Daß Redegonda, durch die Macht meiner Wünsche in den Tiefen ihrer Seele ergriffen, in eigener Gestalt herbeigelockt, herbeigezwungen, draußen vor meiner Schwelle stünde, daß ich sie in der nächsten Minute leibhaftig in den Armen halten würde. In dieser köstlichen Erwartung ging ich zur Türe und öffnete. Aber es war nicht Redegonda, die vor mir stand, es war Redegondas Gatte; er selbst, so wahrhaft und lebendig, wie Sie hier mir gegenüber auf dieser Bank sitzen, und blickte mir starr ins Gesicht. Mir blieb natürlich nichts übrig, als ihn in mein Zimmer treten zu lassen, wo ich ihn einlud, Platz zu nehmen. Er aber blieb aufrecht stehen, und mit unsäglichem Hohn um die Lippen sprach er: ›Sie erwarten Redegonda. Leider ist sie am Erscheinen verhindert. Sie ist nämlich tot.‹ ›Tot,‹ wiederholte ich, und die Welt stand still. Der Rittmeister sprach unbeirrt weiter: ›Vor einer Stunde fand ich sie an ihrem Schreibtisch sitzend, dies kleine Buch vor sich, das ich der Einfachheit halber gleich mitgebracht habe. Wahrscheinlich war es der Schreck, der sie tötete, als ich so unvermutet in ihr Zimmer trat. Hier diese Zeilen sind die letzten, die sie niederschrieb. Bitte!‹ Er reichte mir ein offenes, in violettes Leder gebundenes Büchlein, und ich las die folgenden Worte: ›Nun verlasse ich mein Heim auf immer, der Geliebte wartet.‹ Ich nickte nur, langsam, wie zur Bestätigung. ›Sie werden erraten haben,‹ fuhr der Rittmeister fort, ›daß es Redegondas Tagebuch ist, das Sie in der Hand haben. Vielleicht haben Sie die Güte, es durchzublättern, um jeden Versuch des Leugnens als aussichtslos zu unterlassen.‹ Ich blätterte, nein, ich las. Beinahe eine Stunde las ich, an den Schreibtisch gelehnt, während der Rittmeister regungslos auf dem Diwan saß; las die ganze Geschichte unserer Liebe, diese holde, wundersame Geschichte, – in all ihren Einzelheiten; von dem Herbstmorgen an, da ich im Wald zum erstenmal das Wort an Redegonda gerichtet hatte, las von unserem ersten Kuß, von unseren Spaziergängen, unseren Fahrten ins Land hinein, unseren Wonnestunden in meinem blumengeschmückten Zimmer, von unseren Flucht- und Todesplänen, unserem Glück und unserer Verzweiflung. Alles stand in diesen Blättern aufgezeichnet, alles – was ich niemals in Wirklichkeit, – und doch alles genau so, wie ich es in meiner Einbildung erlebt hatte. Und ich fand das durchaus nicht so unerklärlich, wie Sie es, werter Freund, in diesem Augenblick offenbar zu finden scheinen. Denn ich ahnte mit einemmal, daß Redegonda mich ebenso geliebt hatte wie ich sie und daß ihr dadurch die geheimnisvolle Macht geworden war, die Erlebnisse meiner Phantasie in der ihren alle mitzuleben. Und da sie als Weib den Urgründen des Lebens, dort wo Wunsch und Erfüllung eines sind, näher war als ich, war sie wahrscheinlich im tiefsten überzeugt gewesen, alles das, was nun in ihrem violetten Büchlein aufgezeichnet stand, wirklich durchlebt zu haben. Aber noch etwas anderes hielt ich für möglich: daß dieses ganze Tagebuch nicht mehr oder nicht weniger bedeutete, als eine auserlesene Rache, die sie an mir nahm. Rache für meine Unentschlossenheit, die meine, unsere Träume nicht hatte zur Wahrheit werden lassen; ja, daß ihr plötzlicher Tod das Werk ihres Willens und daß es ihre Absicht gewesen war, das verräterische Tagebuch dem betrogenen Gatten auf solche Weise in die Hände zu spielen. Aber ich hatte keine Zeit, mich mit der Lösung dieser Fragen lange aufzuhalten, für den Rittmeister konnte ja doch nur eine, die natürliche Erklärung gelten; so tat ich denn, was die Umstände verlangten, und stellte mich ihm mit den in solchen Fällen üblichen Worten zur Verfügung.«
»Ohne den Versuch« –
»Zu leugnen?!« unterbrach mich Dr. Wehwald herb. »Oh! Selbst wenn ein solcher Versuch die leiseste Aussicht auf Erfolg geboten hätte, er wäre mir kläglich erschienen. Denn ich fühlte mich durchaus verantwortlich für alle Folgen eines Abenteuers, das ich hatte erleben wollen und das zu erleben ich nur zu feig gewesen. – ›Mir liegt daran,‹ sprach der Rittmeister, ›unsern Handel auszutragen, noch eh Redegondas Tod bekannt wird. Es ist ein Uhr früh, um drei Uhr wird die Zusammenkunft unserer Zeugen stattfinden, um fünf soll die Sache erledigt sein.‹ Wieder nickt' ich zum Zeichen des Einverständnisses. Der Rittmeister entfernte sich mit kühlem Gruß. Ich ordnete meine Papiere, verließ das Haus, holte zwei mir bekannte Herren von der Bezirkshauptmannschaft aus den Betten – einer war ein Graf – teilte ihnen nicht mehr mit als nötig war, um sie zur raschen Erledigung der Angelegenheit zu veranlassen, spazierte dann auf dem Hauptplatz gegenüber den dunklen Fenstern auf und ab, hinter denen ich Redegondas Leichnam liegen wußte, und hatte das sichre Gefühl, der Erfüllung meines Schicksals entgegenzugehen. Um fünf Uhr früh in dem kleinen Wäldchen ganz nahe der Stelle, wo ich Redegonda zum ersten Male hätte sprechen können, standen wir einander gegenüber, die Pistole in der Hand, der Rittmeister und ich.«
»Und Sie haben ihn getötet?«
»Nein. Meine Kugel fuhr hart an seiner Schläfe vorbei. Er aber traf mich mitten ins Herz. Ich war auf der Stelle tot, wie man zu sagen pflegt.«
»Oh!« rief ich stöhnend mit einem ratlosen Blick auf meinen sonderbaren Nachbar. Aber dieser Blick fand ihn nicht mehr. Denn Dr. Wehwald saß nicht mehr in der Ecke der Bank. Ja, ich habe Grund zu vermuten, daß er überhaupt niemals dort gesessen hatte. Hingegen erinnerte ich mich sofort, daß gestern abends im Caféhaus viel von einem Duell die Rede gewesen, in dem unser Freund, Dr. Wehwald, von einem Rittmeister namens Teuerheim erschossen worden war. Der Umstand, daß Frau Redegonda noch am selben Tage mit einem jungen Leutnant des Regiments spurlos verschwunden war, gab der kleinen Gesellschaft trotz der ernsten Stimmung, in der sie sich befand, zu einer Art von wehmütiger Heiterkeit Anlaß, und jemand sprach die Vermutung aus, daß Dr. Wehwald, den wir immer als ein Muster von Korrektheit, Diskretion und Vornehmheit gekannt hatte, ganz in seinem Stil, halb mit seinem, halb gegen seinen Willen, für einen anderen, Glücklicheren, den Tod hatte erleiden müssen.
Was jedoch die Erscheinung des Dr. Wehwald auf der Stadtparkbank anbelangt, so hätte sie gewiß an eindrucksvoller Seltsamkeit erheblich gewonnen, wenn sie sich mir vor dem ritterlichen Ende des Urbildes gezeigt hätte. Und ich will nicht verhehlen, daß der Gedanke, durch diese ganz unbedeutende Verschiebung die Wirkung meines Berichtes zu steigern, mir anfangs nicht ganz ferne gelegen war. Doch nach einiger Überlegung scheute ich vor der Möglichkeit des Vorwurfs zurück, daß ich durch eine solche, den Tatsachen nicht ganz entsprechende Darstellung der Mystik, dem Spiritismus und anderen gefährlichen Dingen neue Beweise in die Hand gespielt hätte, sah Anfragen voraus, ob meine Erzählung wahr oder erfunden wäre, ja, ob ich Vorfälle solcher Art überhaupt für denkbar hielte – und hätte mich vor der peinlichen Wahl gefunden, je nach meiner Antwort als Okkultist oder als Schwindler erklärt zu werden. Darum habe ich es am Ende vorgezogen die Geschichte meiner nächtlichen Begegnung so aufzuzeichnen, wie sie sich zugetragen, freilich auf die Gefahr hin, daß viele Leute trotzdem an ihrer Wahrheit zweifeln werden, – in jenem weithin verbreiteten Mißtrauen, das Dichtern nun einmal entgegengebracht zu werden pflegt, wenn auch mit weniger Grund als den meisten anderen Menschen.
Der Mörder
Ein junger Mann, Doktor beider Rechte, ohne seinen Beruf auszuüben, elternlos, in behaglichen Umständen lebend, als liebenswürdiger Gesellschafter wohl gelitten, stand nun seit mehr als einem Jahre in Beziehungen zu einem Mädchen geringerer Abkunft, das, ohne Verwandtschaft gleich ihm, keinerlei Rücksichten auf die Meinung der Welt zu nehmen genötigt war. Gleich zu Beginn der Bekanntschaft, weniger aus Güte oder Leidenschaft als aus dem Bedürfnis, sich seines neuen Glückes auf möglichst ungestörte Weise zu erfreuen, hatte Alfred die Geliebte veranlaßt, ihre Stellung als Korrespondentin in einem ansehnlichen Wiener Warenhause aufzugeben. Doch nachdem er sich längere Zeit hindurch, von ihrer dankbaren Zärtlichkeit umschmeichelt, im bequemsten Genüsse gemeinsamer Freiheit wohler befunden hatte als in irgendeinem früheren Verhältnis, begann er nun allmählich jene ihm wohlbekannte verheißungsvolle Unruhe zu verspüren, wie sie ihm sonst das nahe Ende einer Liebesbeziehung anzukündigen pflegt, ein Ende, das nur in diesem Falle vorläufig nicht abzusehen schien. Schon sah er sich im Geiste als Schicksalsgenossen eines Jugendfreundes, der, vor Jahren in eine Verbindung ähnlicher Art verstrickt, nun als verdrossener Familienvater ein zurückgezogenes und beschränktes Leben zu fuhren gezwungen war; und manche Stunden, die ihm ohne Ahnungen solcher Art an der Seite eines anmutigen und sanften Wesens, wie Elise es war, das reinste Vergnügen hätten gewähren müssen, begannen ihm Langeweile und Pein zu bereiten. Wohl war ihm die Fähigkeit und, was er sich noch höher anrechnen mochte, die Rücksicht eigen, Elise von solchen Stimmungen nichts merken zu lassen, immerhin aber hatten sie die Wirkung, ihn wieder öfter die Geselligkeit jener gutbürgerlichen Kreise aufsuchen zu lassen, denen er im Laufe des letzten Jahres sich beinahe völlig entfremdet hatte. Und als ihm bei Gelegenheit einer Tanzunterhaltung eine vielumworbene junge Dame, die Tochter eines begüterten Fabrikbesitzers, mit auffallender Freundlichkeit entgegenkam, und er so plötzlich die leichte Möglichkeit einer Verbindung vor sich sah, die seiner Stellung und seinem Vermögen angemessen war, begann er jene andere, die wie ein heiter zwangloses Abenteuer angefangen, als lästige Fessel zu empfinden, die ein junger Mann von seinen Vorzügen unbedenklich abschütteln dürfte. Doch die lächelnde Ruhe, mit der Elise ihn immer wieder empfing, ihre sich stets gleichbleibende Hingabe in den spärlicher werdenden Stunden des Zusammenseins, die ahnungslose Sicherheit, mit der sie ihn aus ihren Armen in eine ihr unbekannte Welt entließ, all dies drängte ihm nicht nur jedesmal das Abschiedswort von den Lippen, zu dem er sich vorher stets fest entschlossen glaubte, sondern erfüllte ihn mit einer Art von quälendem Mitleid, dessen kaum bewußte Äußerungen einer so herzlich vertrauenden Frau wie Elise nur als neue und innigere Zeichen seiner Neigung erscheinen mußten. Und so kam es dahin, daß Elise sich niemals heißer von ihm angebetet glaubte, als wenn er von einer neuen Begegnung mit Adele, wenn er durch bebt von der Erinnerung süßfragender Blicke, verheißender Händedrücke und zuletzt im Rausch der ersten heimlichen Brautküsse in jenes stille, ihm allein und seiner treulosen Liebe geweihte Heim zurückgekehrt war; und statt mit dem Lebewohl, das er sich noch auf der Schwelle vorgenommen, verließ Alfred die Geliebte allmorgendlich mit erneuten Schwüren ewigen Angehörens.
So liefen die Tage durch beide Abenteuer hin; endlich blieb nur mehr zu entscheiden, welcher Abend für die unvermeidlich gewordene Aussprache mit Elisen besser gewählt wäre, der vor oder der nach der Verlobung mit Adelen; und an dem ersten dieser beiden Abende, da ja doch noch eine Frist vor ihm lag, erschien Alfred in einer durch die Gewohnheit seines Doppelspiels fast beruhigten Seelenverfassung bei der Geliebten.
Er fand sie blaß, wie er sie vorher niemals gesehen, in der Ecke des Diwans lehnen; auch erhob sie sich nicht wie sonst bei seinem Eintritt, um ihm Stirn und Mund zum Willkommskuß zu bieten, sondern zeigte ein müdes, etwas gezwungenes Lächeln, so daß zugleich mit einem Gefühl der Erleichterung die Vermutung in Alfred aufstieg, die Nachricht von seiner bevorstehenden Verlobung sei trotz aller Geheimhaltung nach der rätselhaften Art der Gerüchte doch schon bis zu ihr gedrungen. Aber auf seine sich überstürzenden Fragen erfuhr er nichts anderes, als daß Elise, was sie ihm bisher verschwiegen, von Zeit zu Zeit an Herzkrämpfen leide, von denen sie sich sonst rasch zu erholen pflegte, deren Nachwirkung aber diesmal länger anzuhalten drohe als je. Alfred, im Bewußtsein seiner schuldvollen Vorsätze, war von dieser Eröffnung so heftig berührt, daß er sich in Ausdrücken der Teilnahme, in Beweisen von Güte gar nicht genug tun konnte; und vor Mitternacht, ohne zu begreifen, wie es so weit gekommen, hatte er mit Elisen den Plan einer gemeinsamen Reise entworfen, auf der sie gewiß dauernde Genesung von ihren üblen Zufällen finden sollte.
Niemals so zärtlich geliebt, nie aber auch so durchtränkt von eigener Zärtlichkeit hatte er je von ihr Abschied genommen als in dieser Nacht, so daß er auf dem Heimweg ernstlich einen Absagebrief an Adele erwog, in dem er seine Flucht aus Verlobung und Eheband wie ein Gebot seiner für ein dauernd stilles Glück nicht geschaffenen unsteten Natur zu entschuldigen gedachte. Die kunstvollen Verschlingungen der Sätze verfolgten ihn noch in den Schlaf; aber schon das Morgenlicht, das durch die Spalten der Jalousien auf seiner Decke spielte, ließ ihm die aufgewandte Mühe ebenso töricht als überflüssig erscheinen. Ja, er war kaum zu staunen fähig, daß ihm nun die leidende Geliebte der verflossenen Nacht traumhaft fern wie eine Verlassene erschien, während Adele blühend im Duft unermeßlicher Sehnsucht vor seiner Seele stand. Um die Mittagsstunde brachte er dem Vater Adelens seine Werbung vor, die wohl sehr freundlich, aber doch nicht mit völliger Zustimmung aufgenommen wurde. In gutmütig spöttischer Anspielung auf des Bewerbers oft versuchte Jugend stellte der Vater vielmehr die Forderung, Alfred möge sich vorerst für ein Jahr auf Reisen begeben, um so in der Entfernung die Kraft und die Widerstandsfähigkeit seiner Gefühle zu prüfen, und er widersetzte sich sogar dem Vorschlag eines Briefwechsels zwischen den jungen Leuten, um die Möglichkeit einer Selbsttäuschung auch auf diesem Wege mit Sicherheit ausgeschaltet zu wissen. Wenn Alfred mit den Absichten von heute wiederkehrte, und wenn er dann bei Adelen die gleichen Empfindungen wiederfände, die sie heute zu hegen überzeugt sei, so werde der sofortigen Vermählung des jungen Paares von seiner Seite nicht das geringste im Wege stehen. Alfred, der sich diesen Bedingungen nur widerstrebend zu fügen schien, nahm sie in Wahrheit, wie eine neue Fristerstreckung des Geschicks innerlich aufatmend entgegen, und nach kurzem Besinnen erklärte er, unter diesen Umständen sich schon heute verabschieden zu wollen, wäre es auch nur, um damit zugleich das Ende der geforderten Trennungszeit näher heranzurücken. Adele schien zuerst von dieser unerwarteten Fügsamkeit verletzt zu sein, doch nach einer kurzen vom Vater verstatteten Unterredung unter vier Augen hatte Alfred seine Braut dahin gebracht, daß sie ihn um seiner Liebesklugheit willen bewunderte und ihn mit Schwüren der Treue, ja mit Tränen in den Augen in eine gefährliche Trennungsferne entließ.
Kaum auf die Straße gelangt, begann Alfred schon allerlei Möglichkeiten zu erwägen, die im Laufe dieses ihm zur Verfügung stehenden Jahres eine Lösung seiner Beziehungen zu Elisen herbeiführen könnten. Und sein Drang, die schwierigsten Angelegenheiten des Lebens ohne tätiges Eingreifen zu erledigen, war so übermächtig, daß jener nicht nur über seine Eitelkeit den Sieg davontrug, sondern auch dem Aufschweben düsterer Ahnungen günstig war, vor denen sein wehleidiges Wesen sonst gerne zurückschreckte. In dem Zwang ungewohnt engen Zusammenseins, wie es die Reise mit sich brachte, so dachte er, könnte es wohl geschehen, daß Elise, erkaltend, sich allmählich von ihm abwendete; und auch das Herzleiden der Geliebten bot den Ausblick auf eine freilich unerwünschtere Art der Befreiung. Bald aber wies er beides, Hoffnung wie Befürchtung, mit so heftiger Bewegung von sich, daß am Ende nichts in ihm war als die kindlichfreudige Erwartung einer bunten Lustfahrt ins Weite in Gesellschaft eines liebenswürdig anhänglichen Geschöpfes; und noch am Abend des gleichen Tages plauderte er mit der arglosen Geliebten in heiterster Laune über die reizvollen Aussichten der bevorstehenden Reise.
Da der Frühling im Anzug war, suchte Alfred mit Elisen zuerst die milden Ufer des Genfersees auf. Später stiegen sie zu kühleren Gebirgshöhen empor, verbrachten den Spätsommer in einem englischen Seebad, besuchten im Herbst holländische und deutsche Städte, um endlich dem einbrechenden trüberen Wetter unter den Trost südlicher Sonne zu entfliehen. Bis dahin war nicht nur Elise, die über die nahe Umgebung Wiens früher nicht hinausgekommen war, wie eine köstlich Träumende an der Hand ihres geliebten Führers durch dieses Jahr der Wunder geschwebt; auch Alfred, so klar er sich immerfort der Zukunft mit ihren nur aufgeschobenen Schwierigkeiten bewußt war, hatte, von dem Glück Elisens wie mitgefangen, sich der anmutigen Gegenwart unbedenklich hingegeben. Und während er zu Beginn der Reise Begegnungen mit Bekannten vorsichtig auszuweichen gesuchtes möglichst vermieden hatte, mit Elisen sich auf belebteren Promenaden und in den Speisesälen großer Hotels zu zeigen, forderte er später mit einer gewissen Absichtlichkeit das Schicksal heraus und war gerne gefaßt, durch eine Depesche seiner Braut des Treubruchs bezichtigt und damit zwar eines noch immer heiß ersehnten Besitzes, zugleich aber alles Zwiespalts, aller Unruhe und aller Verantwortung ledig zu werden. Doch keine Depesche, noch sonst eine Nachricht aus der Heimat drang zu ihm, denn Adele hielt sich gegen Alfreds eitle Erwartung so streng wie er selbst nach der vom Vater geforderten Übereinkunft.
Doch es kam die Stunde, in der, für Alfred wenigstens dies Wunderjahr ein jähes Ende nahm und mit einem Male zauberlos, ja öder als irgendein anderes, das er erlebt, in der Zeit stillezustehen schien. Dies ereignete sich im Botanischen Garten zu Palermo an einem hellen Herbsttag, da Elise, die bis dahin sich frisch, lebhaft und blühend gezeigt hatte, plötzlich mit beiden Händen an ihr Herz griff, den Geliebten angstvoll anblickte und sofort wieder lächelte, als sei sie sich's wie einer Pflicht bewußt, ihm keinerlei Ungelegenheiten zu verursachen. Dies aber, statt ihn zu rühren, füllte ihn mit Erbitterung, die er freilich vorerst unter der Miene des Besorgten zu verbergen wußte. Er warf ihr vor, ohne selbst daran zu glauben, daß sie ihm dergleichen Zufälle gewiß schon etliche Male geheimgehalten, gab seiner Kränkung Ausdruck, daß sie ihn offenbar für herzlos hielte, beschwor sie, heute noch, sofort, mit ihm einen Arzt aufzusuchen, und war recht froh, als sie diesen Vorschlag mit Rücksicht auf ihr geringes Vertrauen zu den Heilkünstlern des Landes ablehnte. Doch als sie plötzlich, wie überströmend von Dankbarkeit und Liebe, hier, unter freiem Himmel, auf der Bank, an der Leute vorübergingen, seine Hand an ihre Lippen drückte, fühlte er, gleich einer fliegenden Welle, Haß durch seine Pulse jagen, dessen Vorhandensein ihn zwar selbst in Erstaunen setzte, den er aber bald vor sich mit der Erinnerung vieler Stunden der Langweile und Leere entschuldigte, an denen die Reise, wie er mit einmal zu wissen glaubte, allzu reich gewesen war. Zugleich flammte ein so glühendes Verlangen nach Adelen in ihm auf, daß er, allen Abmachungen zu Trotz, noch am gleichen Tag eine Depesche an sie sandte, in der er sie um ein Wort nach Genua anflehte und die er unterschrieb: Ewig der Deine.
Wenige Tage später fand er in Genua ihre Erwiderung, die lautete: Und ich die Deine für ebensolang. Mit dem zerknitterten Blatt auf dem Herzen, das ihm nun trotz des fragwürdig scherzhaften Tones den Inbegriff aller Hoffnungen bedeutete, trat er in Elisens Begleitung die Fahrt nach Ceylon an, die als voraussichtlich schönster Teil der Reise an deren Ende gesetzt war. Elise hätte von verschlagenerer Gemütsart sein müssen, als sie war, wenn sie auf dieser Fahrt zu ahnen vermocht hätte, daß nur das kühne Spiel von Alfreds Einbildungskraft ihr reichere Wonnen des Geliebtseins schenkte als je zuvor; wenn sie gewußt hätte, daß nicht sie selbst es mehr war, die nun in den schweigenden dunklen Meeresnächten an seinem Halse lag, sondern die ferne, durch seine Sehnsucht in aller Lebensfülle herbeigezauberte Braut. Doch auf der endlich erreichten glühenden Insel, in der dumpfen Gleichförmigkeit des letzten Aufenthaltes, da er erkannte, daß die allzu stürmisch aufgeforderte Phantasie ihm den Dienst versagen wollte, begann er sich von Elisen fernzuhalten und war tückisch genug, eine neue leichte Mahnung des Herzleidens, das sie beim ersten Betreten des festen Bodens angewandelt, als die Ursache seiner Zurückhaltung anzugeben. Sie nahm es hin wie alles, was von ihm kam, als Zeichen einer Liebe, die ihr nun allen Sinn und alle Seligkeit des Daseins bedeutete. Und wenn sie, unter dem wilden Glanz eines blaugoldenen Himmels, fest an ihn geschmiegt und geborgen, durch die rauschenden Schatten der Wälder fuhr, wußte sie nicht, daß ihr Begleiter nur die einsame Stunde herbeiwünschte, in der ihm, ungestört von Elisen, Gelegenheit geboten war, mit fliegender Feder beschwörende, sengende Worte an eine andere auf das Papier zu werfen, von deren Dasein in der Welt Elise bis zu diesem Augenblick nichts ahnte und niemals etwas ahnen sollte. In solchen Stunden des Alleinseins stieg sein Verlangen nach der Entfernten so mächtig an, daß er die Eine, die Nahe, die ihm Gehörende, die, mit der er nun bald ein Jahr lang die Welt durchquerte, bis auf die Züge des Antlitzes, ja bis auf die Stimme zu vergessen vermochte. Und als er in der Nacht vor dem Antritt der Heimreise, aus dem Schreibzimmer kommend, Elise in einem neuen schweren Anfall halb bewußtlos auf das Bett hingestreckt fand, erkannte er, was er sonst eher wie eine leise Angst in sich zu fühlen geglaubt hatte, mit leichtem, beinahe süßem Grauen als die nie erloschene, finster glimmende Hoffnung seiner Seele. Dennoch sandte er ohne Aufschub und in wirklich schmerzlicher Erregung nach dem Arzt, der unverzüglich erschien und der Kranken durch eine Morphiumeinspritzung Linderung verschaffte. Dem vermeintlichen Gatten aber, der die nun bedenklich gewordene Reise aus gewichtigen Gründen nicht aufschieben zu können erklärte, gab er ein Billett mit, das die Leidende der besonderen Sorgfalt des Schiffsarztes empfahl.