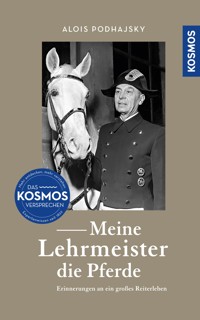
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Egal ob Warmblut, Araber oder Shetland-Pony – Bodenarbeit gymnastiziert jedes Pferd, schafft Vertrauen und bringt Abwechslung in den Alltag von Pferd und Reiter. Das Pferd entwickelt ein besseres Körpergefühl und wird zum aufmerksamen, selbstsicheren Partner. Sigrid Schöpe erklärt Bodenarbeit Schritt für Schritt – von einfachen Lektionen, die das Pferd bereits effektiv trainieren, bis zu Zirkustricks, damit auch bei Fortgeschrittenen keine Langeweile aufkommt. Mit kleinem Schrecktraining zur Nervenstärkung von Pferd und Mensch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Ähnliche
Titel
Meine Lehrmeister die Pferde
Erinnerungen an ein großes Reiterleben
Alois Podhajsky
KOSMOS
Impressum
Alle Angaben in diesem Buch erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sorgfalt bei der Umsetzung ist indes dennoch geboten. Verlag und Autoren übernehmen keinerlei Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die aus der Anwendung der vorgestellten Materialien und Methoden entstehen könnten. Dabei müssen geltende rechtliche Bestimmungen und Vorschriften berücksichtigt und eingehalten werden.
Distanzierungserklärung
Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.
Unser gesamtes Programm finden Sie unter kosmos.de.
Über Neuigkeiten informieren Sie regelmäßig unsere Newsletter kosmos.de/newsletter.
Umschlagsabbildung: © getty images (ullstein bild Dtl.)
© 2023, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG
Pfizerstraße 5–7, 70184 Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-440-50785-8
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
VORWORT
Gerne komme ich dem Wunsch meines Freundes Berthold Spangenberg nach, eine Reitlehre ganz eigener Art zu schreiben. Sie ist leicht faßlich und, guten Willen vorausgesetzt, auch zu befolgen. Gewiß ist sie weder akademisch noch streng systematisch, denn diejenigen, welche sie vortragen würden, wenn sie nur sprechen könnten, legen auf diese Eigenschaften wenig Wert. Mit anderen Worten: Ich will, aus meinen Erfahrungen schöpfend, berichten, welche Reitlehren mir meine Pferde erteilten, und diese meine treuesten »Reitlehrer« den Lesern vorstellen.
Mit Freuden sehe ich immer wieder, daß trotz fortschreitender Mechanisierung unseres Lebens der Sinn der Menschen für die Schönheit der Natur und ihrer Lebewesen erhalten geblieben ist, ja sich vielleicht noch geschärft hat.
Nie wurde mir diese Tatsache deutlicher bewußt als bei den wiederholten Vorführungen der Spanischen Hofreitschule in New York. In dieser gigantischen Weltstadt, in der alles, einschließlich der ewigen Hast, überdimensional erscheint, konnten die Menschen still sitzen, die Bewegungen der weißen Pferde bewundern und ihr Wesen studieren. Ein alter Stammgast des Madison Square Garden sagte mir anschließend: »In Ihren Lipizzanern habe ich hier das erste Mal glückliche Pferde gesehen!«
Auch die Liebe zum Tier ist in unserer oft nüchtern erscheinenden Zeit viel inniger geworden. Besonders in den Großstädten läßt sich dies täglich beobachten. Nicht minder weist die Ausbreitung des Reitsports darauf hin.
Diese Beobachtungen erleichtern mir den Versuch, dem Menschen das Pferd näherzubringen, ihm den Blick in die Tierpsyche freizumachen und vor allem aber die Unbefangenheit zu fördern, mit der wir der Tierwelt entgegentreten sollten.
Dieses Buch wünscht also nicht, Begebenheiten meines Lebens festzuhalten, die schon in meiner Autobiographie »Ein Leben für die Lipizzaner« zu lesen sind, oder gar eine neue Reitlehre aufzubauen. Eine Reitlehre habe ich bereits in dem Werk »Die klassische Reitkunst« niedergelegt. Das vorliegende Buch will in einer Geschichte meiner Pferde das Verhältnis von Mensch und Pferd beleuchten. Diese Betrachtungen aus ungewohntem Blickwinkel und die in eigenen Erfahrungen gesammelten Ratschläge mögen dem Leser von Nutzen sein, der in dem ihm anvertrauten Pferd nicht nur den Mitarbeiter, sondern auch den Freund finden will.
MENSCH UND PFERD
Im Leben jedes einzelnen von uns spielen die Lehrer eine große Rolle. Wie groß sie ist, kann ich ermessen, denn ich habe meine Jugend in der weitläufigen und vielsprachigen österreichisch-ungarischen Monarchie verbracht, und ich mußte mich durch die vielen dienstlichen Versetzungen meines Vaters mit Lehrern der verschiedensten Nationalitäten vertraut machen. Es gibt gute Lehrer, die einem bis ins hohe Alter als nachahmenswerte Vorbilder erscheinen, und schlechte, derer man sich nur ungern erinnert. Tatsächlich kann man aber von beiden lernen. Vom schlechten Lehrer, wie man nicht vorgehen darf, wenn man das Vertrauen seiner Schüler gewinnen will, und von den guten, wie man mit Einfühlung und Liebe eine überlieferte Lehre an den Schüler weitergeben und für kommende Generationen erhalten kann.
Nicht von jenen Lehrern will ich berichten, die mir in Galizien ein schlechtes Deutsch beibrachten, für das mich dann in Wien, der ersten deutschsprachigen Garnison meines Vaters, die Mittelschulprofessoren rügten und mich vor meinen Klassenkameraden lächerlich machten, sondern von den vierbeinigen Lehrmeistern, die ich dank meiner Liebe zum Reitsport kennen, verstehen und achten lernen sollte.
Damit soll keineswegs behauptet werden, daß alle Pferde in die Gruppe der guten Lehrer einzureihen sind. Ich denke da besonders an jene Angehörige des Furiosostammes, einer in der ersten Republik Österreich gezüchteten Halbblutrasse, die zu Beginn der Arbeit voll des Temperaments und Übermuts waren, jede Gelegenheit wahrnahmen, sich ihrer Reiter zu entledigen, sodaß diese nur damit beschäftigt waren, ein Abgeworfenwerden nach Möglichkeit zu verhindern. Nach der ersten Viertelstunde beruhigten sie sich dann, waren aber gleichzeitig so abgekämpft, daß alle Bewegungen an Glanz verloren und sie einen ganz müden Eindruck machten. Sie also lehrten höchstens, wie man am besten dem Abwerfen vorbeugen kann, etwas zu wenig seitens eines Geschöpfs, in dem man gern den Lehrmeister sehen möchte.
Aber ich hatte auch zweibeinige Reitlehrer, die nicht zu den guten zählten, weil sie vom Schüler mehr verlangten, als sie selber zu leisten imstande waren. Als erstes muß der Reitlehrer durch sein Können zum Vorbild seines Schülers werden, dann wird dieser auch willig und vorbehaltlos allen Anordnungen Folge leisten. Andererseits wird ein Lehrer, der all das, was er lehrt, auch beherrscht, nie mehr von seinem Schüler verlangen, als dieser zu leisten vermag. Es ist menschlich, daß der Schüler immer eine Entschuldigung oder Erklärung für mangelndes Können sucht. Ist der Lehrer nicht imstande, selbst vorzuzeigen, was er verlangt, dann werden alle Beanstandungen an dem Gedanken abprallen: »Du kannst es ja selber nicht!« Am schlimmsten ist es aber, wenn ein Lehrer, der selbst dauernd zu grober Behandlung des Pferdes neigt, den Schüler wegen eines gleichartigen Vorgangs rügt oder gar anschreit. Der Angeschrieene denkt dann wohl an das Sprüchlein vom Wasser predigen und Wein trinken und wird dem Lehrer keine Achtung entgegenbringen.
Wenn über die Intelligenz unserer Haustiere, insbesondere von Hund und Pferd, gesprochen wird, begegnet man verschiedenen Ansichten darüber, welches der beiden Tiere dem Menschen enger verbunden ist. Es wird oft behauptet, daß der Hund dem Pferd an Intelligenz und Verständnis überlegen sei. Ich bin der Meinung, daß dieser Vergleich nicht gerecht ist, denn der Hund nimmt in unserem Leben einen viel breiteren Raum ein, er ist immer um uns, und wir beschäftigen uns viel mehr mit ihm und vor allem, ohne ständig Forderungen an ihn zu stellen. Das Pferd hingegen kann unser tägliches Leben nicht in dieser Weise teilen, es wird nur für wenige Stunden aus dem Stall geholt, um ein festgelegtes Arbeitsprogramm zu absolvieren und danach wieder sich selbst überlassen zu bleiben. Doch wenn sich der Reiter bemüht, in seinem Pferd nicht nur ein Sportgerät zu erblicken, sondern sich in sein Wesen hineinzudenken und auf seine Eigenarten einzugehen, dann wird ihn das Tier durch unbedingte Ergebenheit und freudige Mitarbeit belohnen. Ganz wie der Hund – oder auch das Kind –, mit dem man sich intensiv beschäftigt, wird das Pferd seine eigentlichen Werte erst richtig entwickeln, es wird sich – wenn der Ausdruck einmal für ein Tier erlaubt ist – zur Persönlichkeit entfalten.
Diese Erkenntnis gründet auf den Erfahrungen, die ich mit beiden Tieren, Pferd und Hund, als Begleiter langer Jahre machen konnte: den Pferden als Wegbegleitern meines reiterlichen Lebens und den Hunden, besonders meinen liebenswerten und gescheiten Dackeln, die mir als treue Freunde in Leid und Glück nur dann Kummer bereiteten, wenn sie mich für immer verließen.
Aber wie lernen wir unsere Gefährten wirklich kennen! Beim Reiten und beim Ausbilden von Pferden habe ich versucht, mich in die Lage des Tieres zu versetzen, schon um nicht mehr von ihm zu fordern, als es erfüllen konnte. Und wenn ich jetzt zurückdenke, sehe ich in dem ständigen Bemühen, die mir anvertrauten Lebewesen zu verstehen, den eigentlichen Grund, warum ich, der ich ihr Ausbilder gewesen bin, mich heute als ihr Schüler fühle. Warum ich meine, von der stillen Kreatur mehr gelernt zu haben als von vielen Menschen, und warum ich mich aufgefordert fühle, aufzuzeichnen, was ich mit meinen Pferden erlebt habe. Dies soll kommenden Generationen von Pferden und Reitern zum Nutzen gereichen.
Von frühester Kindheit an war Reiten meine größte Sehnsucht gewesen. So wie Rainer Maria Rilkes Komet war ich von diesem Gedanken Tag und Nacht erfüllt.
Reiten, um das so viel besungene höchste Glück dieser Erde auf dem Rücken der Pferde zu erleben, Reiten, um den vierbeinigen Partner zur Entfaltung der ganzen Schönheit seiner Bewegungen zu bringen und Reiten, um von dem stummen Lebewesen aus kleinsten Anzeichen zu erfühlen, nein zu erlernen, wie man sich mit ihm verständigen und es verstehen kann, um so eine Sprache zwischen Pferd und Reiter aufzubauen, die immer klar, gleich bleibend und eindeutig sein muß. Diese Einstellung soll auch zum Denken aus der Perspektive des Pferdes erziehen. Der Reiter muß wissen, was das Pferd innerlich bewegt, was ihm Freude macht, welche Schwierigkeiten es zu überwinden hat und wie sehr es sich durch Stimmungen beeinflussen läßt.
Aber es war ein langer Weg des Lernens. Zurückblickend kann ich nur feststellen, daß man niemals auslernt und die Lehrzeit bestenfalls in drei Stufen einteilen kann!
Zuerst muß der Reiter lernen, sich in allen Bewegungen am Rücken des Pferdes auszubalancieren und »oben zu bleiben«. Mancher ist damit schon zufrieden, und mancher glaubt auch dann schon, ein großer Reiter zu sein.
Bald muß man aber erkennen, daß das Reiten sich nicht in diesen einfachen Ergebnissen erschöpft, sondern daß es vor allem gilt, dem Pferd den Weg zu weisen, es zu gymnastizieren und zur Entfaltung seiner Anlagen zu bringen. Damit beginnt die zweite Stufe, die oft Phasen aufweist, in denen der Reiter daran zweifelt, jemals diese Kunst zu erlernen.
Ist es gelungen, in die Sphäre der höheren Reitkunst einzudringen und ein Pferd bis zur Hohen Schule zu fördern, dann ist wohl die zweite Stufe überwunden, der Weg des Lernens aber noch nicht zu Ende. Denn ein einziges bis zu diesem Grad ausgebildetes Pferd macht noch keinen perfekten Reiter. Es gibt aber viele, die sich mit diesem einen Erfolg begnügen. So mancher »Reiter« läuft gestiefelt und gespornt herum, der sich seine Pferde von anderen ausbilden läßt und sie nur zu Turnieren besteigt, der noch nie ein Pferd selbst ausgebildet hat und deshalb auch nie verstehen wird, daß er es ist, der von den Pferden lernen muß, wenn er die letzte Stufe der Reiterei erklimmen will.
Als Sohn eines K.-u.-k.-Offiziers wuchs ich im lebhaften Getriebe der Kasernen auf. Bevor ich noch richtig sprechen gelernt hatte, konnte ich die Regimenter beim Namen nennen, und vom Fenster meines Kinderzimmers aus beobachtete ich die Dragoner beim Dienst. »Schimmi«, das gescheckte Schaukelpferd, war mein liebstes Spielzeug, ich pflegte und wartete es, wie ich es den Pferdeburschen im Hof abschaute, und wenn ich ihn zu einem kühnen Ritt durchs Kinderzimmer bestieg, dann gehörte mir die Welt. »Schimmi« leitete die lange Reihe meiner Pferde ein – bis ihm die früh erwachte Leidenschaft meines jüngeren Bruders zur Medizin den Garaus machte.
In meiner Erinnerung nehmen viele Namen – einfache und wohlklingende – Gestalt an, und wenn ich die Augen schließe, dann stehen meine Pferde lebendig vor mir …
So tritt aus dem grauen Nebel der Vergangenheit die brave »Olga« hervor, jene gutmütige und etwas zur Fülle neigende Fuchsstute, die mein Vater in Neu-Zuzzka, einer Garnison an der östlichsten Peripherie der Donaumonarchie, als Dienstpferd verwendete. Schon Jahre vorher hatten mich die Burschen meines Vaters heimlich auf seine Pferde gehoben, bevor sie in den Stall zurückgeführt wurden; nun sollte ich mit »Olga« auch einige Runden um den Kasernenhof – natürlich nur im Schritt – reiten dürfen, was den siebenjährigen Knaben unendlich glücklich machte. Ja, mit diesem vor meinem Vater wohlgehüteten Geheimnis erhielt der Tag erst seinen Inhalt und Höhepunkt, dem ich aufgeregt entgegensah. Es gelang mir, diese Reitversuche zu wiederholen. So wurde »Olga« zu meinem ersten Lehrmeister. Durch ihre Gutmütigkeit und Geduld lernte ich, mich auf ihrem Rücken zurechtzufinden, Vertrauen zu bekommen und sogar die Möglichkeit des Herunterfallens zu vergessen. Sie gewöhnte mich daran, die Umgebung von einer »höheren Warte« aus zu betrachten, und lehrte mich – unbewußt, aber für alle Zukunft –, wie sehr das Vertrauen zum Pferd und zu der eigenen Geschicklichkeit von den ersten Eindrücken abhängt und wie wichtig es daher ist, daß der junge Reiter am Anfang seiner Ausbildung nach Möglichkeit nicht vom Pferd fällt.
Als »Olga« später als Wagenpferd verwendet wurde, trat das zweite Reitpferd meines Vaters, ein schnittiger Kohlfuchs voll Temperament, an ihre Stelle. »Salome« bemühte sich, ihrem Namen alle Ehre zu erweisen, und machte mir auch sofort klar, daß es keineswegs zu den Privilegien des Reiters gehört, sich nur nach seinem eigenen Willen von dem vierbeinigen Partner zu trennen. Sie beförderte mich gleich das erste Mal unsanft und im großen Bogen auf die Erde. Ein Vorgang, der sich mehrmals wiederholte und zu einer neuen Erkenntnis führte: Ich fand bald heraus, daß das Herunterfallen gar nicht so schrecklich ist und am harmlosesten verläuft, je unverhoffter es dazu kommt. Eine Erfahrung, die ich dann später dahingehend erweitern konnte, daß dem Reiter, der im Schritt herunterfällt, oft mehr passieren kann als im Galopp. Dabei findet er nämlich keine Zeit, sich in Abwehr zu versteifen, was leicht zu Zerrungen und Knochenbrüchen führt.
In diesen Lektionen bescheidenster Art lernte ich aber noch etwas anderes: aus gewissen Anzeichen rechtzeitig zu erkennen, wann die gute »Salome« vor einer Explosion ihres überschäumenden Temperaments stand, und Mittel zu finden, mich trotz heftiger Bewegungen auf ihrem Rücken zu halten. Spitzte sie die Ohren unbeweglich und bei leicht erhobenem Kopf nach vorne, so wurde ich darauf aufmerksam, daß irgend etwas ihr Mißtrauen erweckt hatte und leicht zu einem plötzlichen Seitensprung führen konnte, was mich veranlaßte, mich rechtzeitig stärker am Sattel festzuhalten. Plötzliches Stehenbleiben, dabei keiner Aufforderung des Stallburschen Folge leistend, erkannte ich bald als sicheres Anzeichen dafür, daß sie mir durch Steigen einen höheren Aussichtspunkt, aber auch einen sehr rutschigen Sitz anbieten würde, eine recht unbequeme Situation, der ich durch Vorbeugen des Oberkörpers und Umarmen des Pferdehalses gerecht zu werden versuchte, eine Abwehrbewegung, von deren falscher Wirkung mich ein späterer vierbeiniger Lehrmeister überzeugte. Ganz drohend wurde die Sache aber, wenn »Salome« sich in kurzen Tritten und mit schwingendem Rücken vom Boden abzustoßen begann und sich nur mühsam vom Pferdepfleger am Davoneilen hindern ließ, um sich dann zornig in die Höhe zu schnellen und mir zu demonstrieren, mit welch geballter Kraft sie mich zu Boden befördern konnte. Die ersten Male verging mir dabei Hören und Sehen, bis ich dann herausfand, daß ich mit Einziehen des Bauches und Einrollen des Oberkörpers ihr nur das Gelingen erleichterte und daß ich mit zurückgenommenem Oberkörper viel mehr Sitzfestigkeit hatte: eine Erkenntnis, die ich in meiner späteren reiterlichen Laufbahn noch oft bestätigt finden sollte.
Aber auch ein psychologisches Studium, dessen Sinn ich erst viel später erfassen sollte, vermittelte mir »Salome«. Sie besaß nicht nur Temperament, sondern auch eine virtuose Schlagfertigkeit der Hinterbeine, womit sie jede Annäherung eindeutig ablehnte und oft ihren Wärter zwang, beim Putzen und Satteln zur Seite zu springen. Eines Tages jedoch konnte ich beobachten, wie mein jüngster, etwa zweijähriger Bruder sich ihr in einem unbewachten Augenblick auf der Koppel näherte, die beiden Hinterbeine mit den Händchen erfaßte und zwischen ihnen hindurchkroch. Unter ihrem Bauch angelangt, drehte er sich um und turnte wieder munter nach hinten zwischen den Pferdebeinen durch, ein Spielchen, das er einige Male wiederholte. Meine Mutter, ebenfalls Zeuge dieser Gymnastik ihres jüngsten Sohnes, erstarrte vor Schreck und wagte nicht zu rufen, um »Salome« nicht aus ihrer Versunkenheit zu wecken. Schließlich stellte mein Bruder zu unser aller Erleichterung seine Turnübungen ein und kam wackelnd auf uns zu. »Salome« aber blickte verstehend dem jungen Erdenbürger nach, bevor sie sich wieder dem ungestörten Grasen widmete. Die Episode verhalf mir zu der noch unbewußten Erkenntnis, daß Pferde im Grunde ihres Wesens gutmütig sind und daß die Erscheinungen, die wir für Bösartigkeit halten, nur eine Abwehr darstellen, die aus Furcht geboren ist oder aus der Erinnerung schlechter Erlebnisse. Pferde sind im Grunde ihres Wesens ängstliche Geschöpfe, die immer die Tendenz haben, zu fliehen. Ist keine Fluchtmöglichkeit gegeben, dann setzen sie, je nach Intelligenz und Geschicklichkeit, Abwehrmaßnahmen ein, die sie fälschlich in den Ruf der Bösartigkeit bringen, was wiederum den Menschen dazu bewegt, sich ihnen zaghaft zu nähern, um damit jedoch erst recht ihr Mißtrauen zu wecken.
Jahre später fand ich diese Ansicht bei meinem Springpferd »Karwip« bestätigt, das mir im ersten Jahrgang am Militär-Reitlehrerinstitut zugeteilt wurde. Dieses Institut hatte die Aufgabe, den Offizieren der berittenen Truppen, ähnlich den Kavallerieschulen in anderen Ländern, eine höhere Reitausbildung angedeihen zu lassen. Im ersten Jahrgang wurden Reitlehrer für die Truppe, im zweiten und dritten Jahrgang solche für das Militär-Reitlehrerinstitut ausgebildet und eine Turnier-Equipe aufgestellt. Die erste Pferdezuteilung war immer eine sehr aufregende Prozedur, denn jedes Schulpferd hatte seinen Ruf, den uns die Pferdewärter beim Aufsitzen flüsternd ankündigten. Wir waren erwartungsvoll in Reih und Glied angetreten, der Reitlehrer, Oberst Päumen, schritt die Front der aufgestellten Pferde ab, sah von den Pferden zu uns herüber – wir fühlten uns wie Delinquenten kurz vor der Hinrichtung – und betrachtete wiederum die Pferde. Mir wurde »Karwip« zugeteilt, ich begann mir die Bügellänge zu richten, wobei mir der Pferdepfleger zuflüsterte: »Vorsicht, die Pferde sind heut voller Bummelwitz!« Kein Wunder, hatten sie doch während der zweimonatigen Ferien so gut wie nichts gearbeitet!
Diese erste Reitstunde hatte viel Ähnlichkeit mit einem amerikanischen Cowboy-Rodeo – das ich allerdings erst 25 Jahre später kennenlernen sollte – und endete nur allzuoft damit, daß der Reiter herunterfiel und das Pferd mühsam wieder eingefangen werden mußte. Auch »Karwip« nützte die Gelegenheit weidlich aus, doch hatte ich Glück und mußte nicht das Los der abgeworfenen Reiter teilen. Aus Freude darüber besuchte ich mein Pferd am Nachmittag im Stall, und als ich den Hals der Stute streichelte, stürzte der Pferdepfleger herbei und bedeutete mir aufgeregt, daß »Karwip« bisher immer mit den Hinterbeinen ausgeschlagen hatte, sobald jemand ihren Stand betreten wollte. Ich war aber so unbefangen und bestimmt zu ihr gekommen, daß sie gar nicht daran gedacht hatte, mich abzuwehren. Selbstverständlich hatte ich sie vorher angesprochen und war ihr über die Hinterhand gefahren, um sie nicht zu erschrecken. Je furchtsamer das Pferd ist, desto bestimmter muß der Reiter auftreten.
ALLER ANFANG IST SCHWER
Als ich 12 Jahre alt wurde, erlaubte mir mein Vater endlich geregelten Reitunterricht, mit dem er einen Dragonerwachtmeister beauftragte. Gabriel war mittelgroß und untersetzt, hatte einen Backenbart wie Kaiser Franz Joseph und eine gewaltige Stimme, mit der er eine Schwadron hätte einexerzieren können. Seine neue Aufgabe nahm er verteufelt ernst. Nach einer kurzen Begrüßung wurde ein gesatteltes Pferd ohne Bügel und Zügel auf den Reitplatz vor der Kaserne in Wels gebracht, ein recht friedlich aussehendes Tier, dessen Ausbindezügel von den Trensenringen zum Sattelgurt führten. Ich mußte aufspringen, durfte mich aber am Sattel anhalten, während das Pferd sich an einer langen Leine – Longe genannt, da sie im 17. Jahrhundert zuerst in Frankreich verwendet worden war – im Kreis um den im Mittelpunkt stehenden Gabriel bewegte. Durch seine gleichmäßigen Bewegungen sollte es mich nun lehren, wie ich mich am besten auf seinem Rücken zurechtfinden könne, was im Schritt leicht, im Galopp aber sehr schwierig war.
Natürlich muß das Reiten nicht unbedingt an der Longe beginnen, vor allem dann nicht, wenn es an geeigneten Pferden und Lehrern fehlt. In meiner langjährigen Tätigkeit als Lehrer wurde mir jedoch immer wieder bestätigt, daß der langwierig scheinende Ausbildungsweg über das Longieren den Reiter die Beherrschung seines Körpers in schöner Form und höchster Geschmeidigkeit lehrt, sodaß er das Gleichgewicht seines vierbeinigen Partners nicht stört und schließlich mit ihm zu einer Einheit verwachsen kann. Ein Ziel, das für mich in jenen Tagen noch in weiter Ferne lag, denn es galt doch zunächst nur, sich in den verschiedensten Bewegungen im Sattel zu halten.
Mein erstes Longepferd war also ein braves Dienstpferd, das so manchen Dragoner gelehrt hatte, auf seinem Rücken dem Vaterland zu dienen, und das mich nun in eine Welt einführte, von der ich von frühester Kindheit an geträumt hatte. »Sigi« war ein brauner Wallach ohne Abzeichen und mittelgroß – bei der heutigen Vorliebe für große Pferde würde man ihn als klein bezeichnen. Der schmale Kopf mit den ruhigen, etwas resignierenden Augen wandte sich vor dem Aufspringen neugierig nach mir um, und hätte »Sigi« sprechen können, würde er mir vermutlich zugeflüstert haben: »Es wird schon nicht so arg werden!« Ich hatte auch gleich Vertrauen zu ihm und war bemüht, mich seiner freundlichen Teilnahme würdig zu erweisen. Bügellos auf dem harten Kommiss-Sattel sitzend, leistete ich den Aufforderungen meines Lehrers gewissenhaft Folge und versuchte, wenn er es verlangte, mich weniger fest mit den Händen am Sattel anzuhalten. Ich sah, wie mein vierbeiniger Partner den leisesten Weisungen mit abgeklärter Ruhe folgte, und nahm ihn mir zum Vorbild, was den Gehorsam betraf. Seine willige Hingabe beeindruckte mich derart, daß ich auch keine Miene verzog, als es am Knie, Oberschenkel und Gesäß verdächtig zu brennen begann. Später stellte sich heraus, daß die zarte Haut den Härten des Reitens und besonders des Kommiss-Sattels noch nicht gewachsen war und sich ganze Flächen eines klassischen Aufrittes abzuzeichnen begannen. Natürlich behielt ich dieses Geheimnis für mich, um den Reitunterricht nicht zu unterbrechen, und brachte damit dem Reitsport ein erstes, aber noch lange nicht das letzte Opfer dar.
Vielmehr hatte ich in meiner Verbissenheit bereits nach wenigen Tagen wieder Gelegenheit, meiner Passion zum zweiten Mal zu opfern. In der Meinung, ich sei ein Wunderkind, und ermutigt durch mein Behaupten auf dem Pferderücken in Trab und Galopp – nur ein Verdienst von »Sigis« Gutmütigkeit und seinen weichen Bewegungen – stellte mir Wachtmeister Gabriel bereits am dritten Tag die Frage, ob ich Lust hätte, über eine auf der Reitbahn stehende Hürde zu springen. Ich betrachtete zweifelnd diese einsam auf weiter Flur stehende, ungefähr 90 Zentimeter hohe und sehr schmale Hürde und antwortete wahrheitsgetreu »Nein«, was mein gestrenger Lehrer nicht gelten lassen wollte. »Für einen richtigen Reiter gibt es kein Hindemis, er wirft sein Herz hinüber und springt dann mit dem Pferd hinterdrein!« Er führte mein Pferd mit der Longe an das Hindernis heran, knallte mit der Peitsche und »Sigi« setzte über die Hürde. Ob ich mein Herz vorausgeworfen hatte oder ob es mir in die Hosen fiel, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Tatsächlich landete ich in großem Bogen auf der Erde und brauchte einige Augenblicke, um mich von der Erschütterung zu erholen. Als ich den Kopf hob, begegnete ich den mitleidigen Augen meines »Sigi«, der mir zu sagen schien: »Ich kann nichts dafür, ich habe mein Bestes getan.« Es blieb mir aber nicht viel Zeit zur stummen Zwiesprache mit meinem mitfühlenden Partner, denn schon brüllte der Wachtmeister: »Also vorwärts, gleich aufspringen und den Sprung wiederholen!« Gesagt, getan, und wieder lag ich am Boden, über und über mit Staub bedeckt. Aber auch durch diesen zweiten mißlungenen Versuch ließ sich mein Erzengel nicht beirren und wiederholte das grausame Spiel in gleicher Weise mit dem gleichen Ergebnis, bis ich schließlich nach dem fünften oder sechsten Versuch krampfhaft irgendwie am Sattel angeklammert oben blieb. Gabriel war riesig stolz auf den Erfolg, ich spürte alle meine Glieder, und das Pferd war froh, daß die Hupferei mit dem blutigen Anfänger ein Ende hatte. Die Ansicht über den Erfolg teilte ich aber keinesfalls mit meinem Lehrer, und mein vierbeiniger Leidensgenosse hätte mir sicher zugestimmt; mein Vertrauen war nämlich erschüttert, und es dauerte Jahre, bis ich das flaue Gefühl in der Magengegend beim Springen überwunden hatte.
Über das Ziel der Ausbildung an der Longe sprach ich schon. Näher kommen konnte ich ihm aber erst allmählich, und erreicht habe ich es erst nach einer langen Reihe von Jahren mit Hilfe meiner vielen Longepferde. Ihre Namen – bei meiner ersten militärischen Ausbildung, bei meiner Fortbildung am Militär-Reitlehrerinstitut und dann an der Spanischen Hofreitschule – sind mir entfallen, aber das, was sie mich lehrten, versuchte ich zu behalten und durch dauernde Korrekturen an mir selbst noch zu verbessern. Jene Longepferde, die den Buben auf ihrem Rücken duldeten, sich mit dem jungen Soldaten plagten und die dann dem Schüler der Spanischen Hofreitschule die Wichtigkeit des richtigen Sitzes bewiesen, waren meine geduldigsten Lehrmeister.
Sie lehrten mich auch, die Welt der Pferde mit anderen Augen zu betrachten, zu versuchen, in den Gedankengang unserer treuen Weggenossen einzudringen und das Geheimnis ihres Verhaltens zu erschließen. Die Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich auf ihrem Rücken sammeln durfte, konnte ich gut verwerten, als ich später selbst die Longe für meine Schüler und zur Ausbildung der Pferde führte.
Als erstes lehrten sie mich die Wichtigkeit des gegenseitigen Vertrauens, das die Basis ist, auf der auch sie zu freudigen Mitarbeitern heranreifen können. Gerade das Longepferd, das dem jungen Reiter das Gefühl der Sicherheit geben soll, ist als brutal unterworfene Kreatur undenkbar.
Das Longieren, bei dem das Pferd an der Leine im Kreise um den im Mittelpunkt stehenden Ausbilder läuft, ist von großer Wichtigkeit für die Ausbildung. Das bügellose Reiten festigt den Sitz und lehrt die korrekte Haltung. Später lernte ich auch, welch ein wertvolles Mittel das Longieren bei der Ausbildung des Pferdes selbst ist. Die Arbeit an der Longe kräftigt das junge Pferd, macht es geschmeidig und gehorsam und bereitet es auf die Arbeit unter dem Reiter vor. Für Pferd, Reiter und Lehrer gilt ähnliches: Das Pferd muß in gleichmäßigem Gang den Reiter tragen, Selbstbeherrschung muß der Reiter üben, um seinen Körper in der Haltung des schönen und zweckmäßigen Sitzes zu gymnastizieren, und Selbstbeherrschung soll den Lehrer auszeichnen, auch wenn seine Anweisungen nicht immer gleich Erfolg haben. Geduld müssen Lehrer und Schüler aufbringen, um das Ziel zu erreichen, und Mäßigung in allen Anforderungen ist oberstes Gesetz. Der Reiter muß wissen, daß der Weg zum Erfolg lang ist, und darf nicht aus Eitelkeit oder Geltungstrieb sein Pferd überfordern. Der Lehrer muß sich im klaren sein, was Mensch und Tier zumutbar ist, um nicht beide zu ermüden oder verzagt zu machen.
Selbstbeherrschung als Reiter an der Longe lehrte mich besonders anschaulich ein Furiosohengst an der Spanischen Hofreitschule, der zur Entlastung der Lipizzaner zum Unterricht verwendet wurde und den ich während meiner Kommandierung in den Jahren 1933 und 1934 manchmal reiten mußte. Den kleinsten Sitzfehler, der sein Gleichgewicht störte, quittierte er mit einem mächtigen Bocker und setzte so manchen Reiter in den Sand des festlichsten Reitsaals der Welt, was nicht nur peinlich war, sondern auch eine Buße von fünf Kilogramm Zucker kostete. Wenn Zuckermangel für die Lipizzaner drohte, wurde einfach ein schwächerer Reiter auf diesen Hengst gesetzt, der den Beinamen »Zuckerlieferant« erhielt. Es gab aber auch Reiter, die es vorzogen, sich durch freiwillige Spenden von dem unbequemen Lehrmeister loszukaufen.
Beim Longieren junger Pferde – der besten Vorbereitung für jedes Reitpferd – kann man durch Beobachtung eine Menge von den uns anvertrauten Geschöpfen lernen. Bei meinem letzten Amerikaaufenthalt wurde ich gebeten, einer passionierten jungen Reiterin beim Longieren ihres jungen Hengstes zu helfen, der wegen einer ausgeheilten Verletzung nur sehr schonend gearbeitet werden durfte. Er war noch niemals longiert worden und nach sechs Wochen Krankenarrest dementsprechend bummelwitzig. Er stürmte an der Longe zunächst wild davon. Ich führte »Trumpeter« nun im Schritt und beschwichtigend auf ihn einsprechend auf dem Kreis herum, den er dann allein gehen sollte. Nach einer Weile entfernte ich mich langsam von ihm und hielt ihn durch vorsichtige Peitschenhilfe in Bewegung. Versuchte er wieder davonzustürmen, nahm ich ihn ruhig mit der Longe zu mir herein und wiederholte die gleiche Prozedur, mit dem Erfolg, daß er mich nach kürzester Zeit verstand und gelassen im Schritt und später auch im Trab auf dem Zirkel ging und gar nicht mehr daran dachte, wegzueilen. Mit Geduld konnte ich auch die Schwierigkeit, die sich später beim Handwechsel ergab, auf die gleiche Weise überwinden.
Ein Pferd ist im allgemeinen daran gewöhnt, von dem links neben ihm gehenden Menschen an dessen rechter Hand geführt zu werden, und bevorzugt daher meistens auch an der Longe die »linke Hand« – also die linke Seite dem Mittelpunkt des Kreises zugewandt. Soll es dann rechtsherum gehen, muß es sich erst daran gewöhnen, daß sich der Mensch jetzt auf der anderen Seite befindet. Daher ist es eine empfehlenswerte Vorbereitung, das junge Pferd vom Stall oder auf der Reitbahn manchmal mit der linken Hand – also rechts vom Pferd gehend – zu führen. Dieser Umstand war mir bei den Vollblütern in England besonders deutlich aufgefallen, denn dort muß auch auf der Rennbahn das Pferd immer einen Kurs mit Wendung nach links absolvieren und kann sich deshalb noch schwerer daran gewöhnen, auch rechtsherum zu gehen. Am Anfang versucht es bei jeder Gelegenheit, wieder auf die linke Hand zu kommen, was für den Reiter recht unangenehm sein kann. Davon kann meine arme Frau ein Lied singen, seit ich ihr einen langgehegten Wunsch erfüllte. Schon seit frühester Kindheit wollte sie reiten lernen, doch – so seltsam es klingt – es fand sich erst vor kurzem bei unserem Englandaufenthalt dazu Gelegenheit. Allerdings stand zum Longieren nur ein pensionierter Vollblüter zur Verfügung, der in echter Rennpferdmanier einfach nicht auf der rechten Hand bleiben wollte. Nach links ging es wunderbar, doch nach einer halben Runde auf der rechten Hand machte »Black Thunder« eine scharfe Wendung und schoß quer durch den Zirkel wieder auf die ihm vertraute linke Hand zurück. Aber auch bei diesem Pferd gelang uns durch Geduld und konsequente Wiederholung, es an die rechte Hand zu gewöhnen.
Von Longepferden kann man am besten lernen, wie wichtig das langsame Gewöhnen des vierbeinigen Partners an die richtigen Hilfen ist. Als ich infolge einer Herzerkrankung für zwei Jahre Reitverbot erhielt, wollte ich auch in der Verbotszeit mit meinen Pferden zusammensein und war glücklich, meine beiden bis dahin so erfolgreichen Dressurpferde »Nero« und »Teja« wenigstens noch an der Longe arbeiten zu können. Dabei schärften meine beiden Getreuen den Blick ihres Herren mehr, als es die bisherigen Longepferde getan hatten. Sie lehrten mich etwa die richtige Handhabung der Peitsche, weil sie bei ihrem hohen Ausbildungsgrad auf die geringsten Fehler reagierten. Gilt es doch gerade an der Longe, dem Pferd die Peitsche als »Hilfe« begreiflich zu machen. Es darf keine Abneigung gegen dieses Hilfsmittel aufkommen. Das Pferd muß die Peitsche respektieren, darf sie aber nicht fürchten. Einmal sah ich das Pferd eines bekannten Dressurreiters in den äußersten Winkel der Reitbahn flüchten, als sein Herr die Peitsche erhob. Ein schlechteres Zeugnis kann es für einen Reiter wohl nicht geben.
Eine wichtige Hilfe ist auch die Stimme. Sie kann je nach Tonfall beruhigend oder ermahnend wirken. Es muß aber genau beachtet werden, daß Worte und Klang für jede der Forderungen immer die gleichen bleiben. Denn Pferde haben ein außerordentlich gutes Gehör und merken sich die Worte für die bestimmten Übungen. So wichtig das für die Ausbildung des Pferdes an der Longe ist, so störend kann es beim Unterricht des Reiters sein. Wenn ich eine Abteilung meiner Schüler kommandierte, wechselten nach kurzer Zeit die Pferde bereits auf mein Kommando »Trab« oder »Galopp« die Gangart, ohne auf die Hilfen ihrer Reiter zu warten, was natürlich nicht dem Sinn des Unterrichts entspricht. Man muß dann andere Kommandos vereinbaren und sie nach einigen Tagen wiederum ändern, um den Pferden nicht die Aufmerksamkeit auf die Hilfen ihrer Reiter zu nehmen.
So wie die Peitsche beim Longieren gleichsam die Schenkelhilfe ersetzt, so soll die Longe auf die späteren Zügelhilfen des Reiters vorbereiten. Schon deshalb darf das Longieren niemals zu einem Tauziehen zwischen Ausbilder und Pferd ausarten, bei dem das Pferd schon rein gewichtsmäßig überlegen sein würde. Durch wiederholtes Anziehen und Nachgeben, wie bei den Zügelhilfen, wird die federnde Verbindung und Führung geschaffen, die das Pferd »am«, aber nicht mit dem Zügel hält. Dies lehrte mich besonders der Gestütshengst »Gidran«, den ich im Militär-Reitlehrerinstitut vier Wochen lang zu longieren hatte. Ihm paßte das Laufen im Kreise gar nicht, und er stürmte mir davon. Er war ja schließlich stärker als ich. Diese größere Kraft konnte nur durch Geschicklichkeit wettgemacht werden. Also gab ich zuerst mit der Longe nach, um ihm durch erneutes kurzes Anziehen meinen Willen kundzutun, und siehe da, sehr bald entschloß sich der »Bulle«, doch die Richtung einzuschlagen, die ich von ihm verlangte. Dieser Erfolg verwies mich auf die Wichtigkeit des nachgebenden Zügels, von dem schon Xenophon vor 2500 Jahren sprach.
Auch lernte ich, daß ein eigenwilliges Stehenbleiben des Longepferdes und ein Kopfschlagen etwas zu bedeuten hat. Dafür fand ich erst vor kurzem in Kanada eine greifbare Bestätigung. Freunde stellten mir den Vollblüter »Blue Bird« zum Reitunterricht an der Longe zur Verfügung. Es ging um die ersten Reitstunden für meine Frau; deshalb wollte ich den vierbeinigen Lehrer erst genau kennenlernen und nahm die Stute zunächst ohne Reiter an die Longe. Es zeigte sich sofort, wie richtig diese Taktik war, denn »Blue Bird« war sehr verhalten, das heißt, sie wollte nicht vorwärts gehen, und als ich sie mit der Peitsche ermahnte, schlug sie mit den Hinterbeinen aus. Diese Abwehr kann dem Ausbilder und seinem Schüler viel zu schaffen machen, wenn sie nicht rechtzeitig bekämpft wird. Denn der Sinn der Longearbeit ist nicht nur die Festigung des Sitzes, sondern mehr noch die Erhöhung des Vertrauens. In diesem Fall mahnte gleichzeitiges Kopfschlagen zu noch größerer Vorsicht. Nachdem ich die Zäumung kontrolliert und die Ausbindezügel verlängert hatte, führte ich »Blue Bird« wieder auf den Zirkel und gebrauchte bei neuerlichem Auftreten dieser Unart die Peitsche, worauf sie sich nun kerzengerade auf die Hinterbeine erhob, um mir damit noch deutlicher die Widersetzlichkeit vor Augen zu führen, die auf dem Nährboden der Verhaltenheit entstanden war. Ein Zuschauer, der das Pferd kannte, sagte achselzuckend zu mir: »Ja, sie steigt immer an der Longe, da kann man nichts machen.« Da es aber keine von Grund auf schlechten, sondern nur verdorbene Pferde gibt und dieses ganz offensichtlich auch Angst vor der Peitsche hatte, zeigte ich sie »Blue Bird« und klopfte sie dabei ab, um ihr zu beweisen, daß es nichts zu fürchten gab. Dann führte ich sie wieder auf den Zirkel und verlangte nun, daß sie ordentlich vorwärts ging – »vorwärts« ist beim Reiten bekanntlich das Allheilmittel –, wobei ich beschwichtigend auf sie einsprach. Nachdem sie ein paar Runden brav gegangen war, belohnte ich sie reichlich und wiederholte die ganze Prozedur. »Blue Bird« erkannte sehr bald, daß sie keine Angst zu haben brauchte, und verstand nun, was von ihr verlangt wurde. Sie versuchte nie wieder, zu steigen, und wurde ein ausgezeichnetes Longepferd. Durch die konsequente und in den Forderungen stets gleichbleibende Arbeit wurde ihr Gang ganz wesentlich verbessert, ihre anfangs sehr harten Bewegungen wurden weich und geschmeidig, sodaß meine Frau auch einen starken Trab bügellos aussitzen konnte.
Ich möchte das wichtige Kapitel des Longierens – so oft bagatellisiert, vernachlässigt oder unsachgemäß gehandhabt – mit dem Hinweis auf einen leider häufiger werdenden Mißbrauch abschließen. Statt die Longe in den Kappzaum einzuschnallen, wird sie am inneren Trensenring befestigt, was nicht nur falsch, sondern auch ausgesprochen schädlich ist. Das von Natur aus zarte Maul des Pferdes wird durch die dem Zügel gegenüber schärfere Einwirkung der Longe hart und unempfindlich. Damit geht der Sinn des Longierens, das Pferd auch zu einer leichten und gleichmäßigen Anlehnung zu erziehen, vollkommen verloren. Ein derartiges Longieren ist ebenso brutal wie sinnlos. Die Methode, die unsere Vorfahren gewissenhaft erforscht und mit Erfolg angewandt haben, ist auch hier die richtige, nicht die aus Bequemlichkeit und Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Tier geübte »Schnellausbildung«.
In der österreichisch-ungarischen Armee und auch beim österreichischen Bundesheer wurden alle jungen Pferde zu Beginn der Ausbildung longiert, bevor sie unter den Sattel kamen. Sie wurden dadurch schonender gearbeitet, als es unter dem Reiter möglich ist, und ihre Leistungsfähigkeit und Lebensdauer gesteigert. Außerdem verbesserten sich ihre Gänge und ihr Gleichgewicht, sodaß sie auch zu angenehmeren Reitpferden wurden.
Es wurden auch alle Soldaten der Kavallerie-Regimenter für ungefähr vier Wochen an der Longe unterrichtet, bevor man sie auf die Umwelt losließ. Sie lernten dadurch rascher, sich im Sattel zurechtzufinden und sich den Bewegungen des Pferdes anzupassen. Daß es dabei auch manchmal recht rauh zugehen konnte, war eben Soldatenmanier, und Wachtmeister Gabriel machte darin keine Ausnahme. Pferd und Reiter wurden nicht immer mit den feinsten Ausdrücken angetrieben, die Korrekturen beschränkten sich auf die primitivsten Details und wurden mir hauptsächlich in brüllender Lautstärke vermittelt. »Sigi«, mein Longepferd, war derlei gewöhnt und folgte den Kommandos mit stoischer Ruhe. So folgte ich seinem Beispiel und betrachtete den etwas rauhen Unterricht als einen Tribut, den ich meiner Reitleidenschaft zu zollen hatte.
Nach einigen Wochen Ausbildung an der Longe mit zahlreichen lösenden Gelenkübungen fühlte ich mich auf dem Pferderücken fast wie zu Hause, und Wachtmeister Gabriel hielt den Zeitpunkt für gekommen, mich allein reiten zu lassen. Ich bekam ein anderes Pferd, durfte die Bügel benützen und sollte die Zügel ergreifen, um meinem braunen Wallach den Weg auf der offenen Reitbahn zu weisen. Ich hatte nicht gedacht, daß diese Art des Reitens so viele Änderungen für mich bringen würde.
Aber scheinbar ging es meinem vierbeinigen Leidensgefährten nicht viel besser, denn anfangs regte ihn alles furchtbar auf. Während ihn ein Dragoner gesattelt auf die Reitbahn brachte, geriet er völlig aus der Fassung, wenn ein Spatz aufflog oder sonst irgendein ungewohntes Objekt seine Aufmerksamkeit erregte, und tänzelte nach allen Seiten. Es wurde noch komischer, als er mit beiden Hinterbeinen gleichzeitig ausschlug, als wollte er den zweiten Teil einer Kapriole demonstrieren. Der Mann konnte ihn nur mit Mühe halten und blickte ängstlich abwechselnd auf den Wachtmeister und auf das sich wie wild gebärdende Pferd. Scheinbar nicht zu Unrecht, denn im nächsten Augenblick folgte wieder ein Sprung, durch den der Dragoner den Boden unter den Füßen verlor und schließlich die Zügel ausließ. Der freigewordene Wallach begann auf der Reitbahn herumzurasen. Seine erste Richtung war natürlich das Eingangstor. Doch dort versperrte ihm eine Barriere den Weg zum Stall, und zum Springen fehlte ihm die Schneid oder aber er war zu klug, um auf den harten und glatten Boden der Straße zu springen, die zum Kasernenhof führte. Nachdem sich das Donnerwetter unseres gestrengen Reitlehrers auf das Haupt des zerknirschten Dragoners entladen hatte, begannen wir drei, den Ausbrecher in einer Ecke der mit dicken Balken eingezäunten Reitbahn einzukreisen, und fingen ihn schließlich ein. Alle vier waren wir außer Atem gekommen und konnten nun endlich mit der Arbeit beginnen. Der Wachtmeister brummte noch immer über den »dalkerten Kerl«, der Dragoner bemühte sich, die ziemlich verschobene Ausrüstung in Ordnung zu bringen, ich selbst versuchte, mich etwas kleinlaut für das zu wappnen, was mir aller Voraussicht nach noch bevorstand. Und »Maxl« schüttelte den Kopf, weil er anscheinend noch immer nicht begreifen konnte, warum ausgerechnet er am Nachmittag auf die Reitbahn kommen mußte und noch dazu ganz allein, ohne seine »Spezis«, mit denen er sich wenigstens in seiner Sprache hätte unterhalten können, um die langweilige Reitschularbeit zu würzen. Und noch dazu mußte dies alles zu einer Zeit vor sich gehen, da die anderen ungestört im Stall träumen konnten!
Als ich endlich aufsitzen konnte, mußte ich mich nun selber um die Führung kümmern, die bisher die Longe besorgt hatte. Außerdem mußte ich meinen »Maxl« dauernd zum Vorwärtsgehen auffordern, denn die Peitsche war weit weg, und jetzt, nachdem er sich einmal ausgetobt hatte, wollte er es sich so bequem wie möglich machen. Aber Peitschenknall und das Gebrüll unseres Lehrers schreckten uns beide auf. Diese Taktik führte nun wieder zu heftigeren Bewegungen meines Pferdes, ich verlor die noch ungewohnten Bügel, angelte nach ihnen und brachte dadurch meinen doch noch nicht so festen Sitz ziemlich in Unordnung. Aber das Schlimmste war, daß Gabriel die Peitsche in den Sand warf, wütend und unmißverständlich die Hände über dem Kopf zusammenschlug und damit den letzten Rest meines Selbstvertrauens auslöschte.
Wenn ich später selbst als Reitlehrer in der Bahn stand, hatte ich für diese Zusammenhänge Verständnis, ließ dem Schüler Zeit, sich in der neuen Lage zurechtzufinden, und machte ihn nicht durch meine Ungeduld noch nervöser. Ich wußte aus eigener Erfahrung zur Genüge, daß ein Pferdewechsel für den jungen Reiter viel schwerer wiegt als für den erfahrenen. Der Reiter muß sich erst an die anderen Bewegungen und Eigenheiten des neuen Gefährten gewöhnen, und beide müssen sich zuerst gleichsam beschnuppern. Auch wußte ich später von dem Unterschied, den es für ein Pferd bedeutet, im Kreis unter unmittelbarer Kontrolle oder aber unabhängig auf langen Linien außerhalb der Reichweite des Lehrers zu gehen.
Immerhin leuchtete es meinem Wachtmeister bald ein, daß es schwerer ist, ein Truppenpferd, das gewöhnlich in einer Gruppe gearbeitet wird, allein auf der großen Reitbahn mit all den dort möglichen Ablenkungen zu reiten, noch dazu nachmittags statt in der üblichen Morgenzeit des Reitunterrichts. So ließ er mich denn während meiner Schulferien an der Reitstunde seines Zuges teilnehmen, und ich wurde gemeinsam mit den Dragonern herumkommandiert. Diese Lösung war auch für ihn bequemer. Mir aber machte es ungemein Freude, in der militärischen Abteilung in vorgeschriebener Ordnung mitzureiten und die verschiedenen Übungen und Figuren auszuführen. Es erfüllte mich mit Stolz, daß ich den Dragonern im Können nicht nachstand und sogar das eine oder andere Mal besonders gelobt wurde. Damals war ich nahe daran, mich für einen perfekten Reiter zu halten. Doch mein hartgesottenes Kommißpferd belehrte mich sehr bald wieder eines Besseren.





























