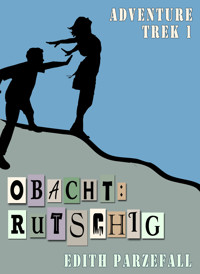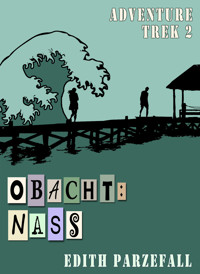5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Freie Reichsstadt Nürnberg 1590: Hilft Henkermedizin gegen Hexenwahn? Nach einem bitterkalten Winter gibt es endlich wieder einen heißen Sommer. Die lange Trockenheit lässt sogar Mühlräder stillstehen. So verwundert es kaum, wenn der Eichstätter Henkersknecht Hexen am Werk sieht. Als Sohn eines Nürnberger Bürgers hält Friedrich Stigler die Zeit für gekommen, auch in seiner Heimatstadt Druden und andere Unholdinnen zu verfolgen – und dabei ein gutes Geschäft zu machen. Jedoch hat er die Rechnung ohne den Nachrichter gemacht. Unter den Beschuldigten befinden sich zwei Frauen, für die Meister Frantz die Hand ins Feuer legen würde: die Mutter seines neuen Henkersknechts und Katharina Leinfelderin, heimliche Kundschafterin des Stadtrats. Der von Stigler geschürte Hexenwahn greift allerdings schneller um sich, als Meister Frantz die Rute oder das Richtschwert schwingen kann. Werden bald Scheiterhaufen vor dem Frauentor errichtet?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Meister Frantz
wider den Hexenjäger
Henker von Nürnberg, Band 10
von Edith Parzefall
Impressum
Copyright © 2020 Edith Parzefall
E-Mail: [email protected]
Ritter-von-Schuh-Platz 1,
90459 Nürnberg, Deutschland
Lektorat: Marion Voigt, www.folio-lektorat.de
Umschlag und Karten: Kathrin Brückmann
Die Originalabbildung der fliegenden Hexe entstammt einer Miniatur in einer Handschrift von Martin le Franc, Le champion des dames, 1451.
Alle Rechte vorbehalten.
Karte mit benachbarten Territorien
Handelnde Personen
Historische Figuren sind kursiv gesetzt. Sie werden in diesem Roman fiktional verwendet, obwohl ich mich weitgehend an die überlieferten Fakten halte. Wie damals üblich tragen alle Nachnamen von Frauen die Endung -in. Die Anrede Frau und Herr für gewöhnliche Leute war noch nicht geläufig.
Meister Frantz Schmidt: der Nachrichter, also Henker von Nürnberg.
Maria Schmidtin: Ehefrau von Frantz, auch als Henkerin bezeichnet.
Maria, Rosina und Jorgen Schmidt: Kinder von Frantz und Maria.
Augustin Ammon: der ehemalige Löwe, wie man den Henkersknecht in Nürnberg nannte.
Klaus Kohler: Nachwuchslöwe und Sohn von Agnes Kohler.
Maximilian (Max) Leinfelder: Stadtknecht und Ehewirt der heimlichen Kundschafterin Katharina (Kathi) Leinfelderin.
Friedrich Stigler: Henkersknecht zu Eichstätt und selbst ernannter Hexenjäger.
Floryk Loyal: Magister der Philosophie, Fuhrmann und Kundschafter.
Mosche Jud: Kundschafter der Reichsstadt Nürnberg.
Hieronymus Paumgartner: Vorderster Losunger und Hauptmann der Reichsstadt Nürnberg.
Andreas II. Imhoff: Ratsherr, Schöffe und zweiter Hauptmann sowie Losunger mit Suspens, das heißt, er muss vorläufig nur im Notfall dieser Aufgabe nachkommen und darf weiterhin seine Geschäfte führen.
Paul Harsdörffer und Paul Behaim: Stadträte und derzeit Lochschöffen.
Laurenz Dürrenhofer: Lochschreiber.
Eugen Schaller unterstützt von seiner Frau Anna Schallerin: Lochhüter, liebevoll auch Lochwirt genannt; oberster Aufseher im Lochgefängnis.
Benedikt: Lochknecht, also Wächter im Lochgefängnis.
In Altdorf:
Balthasar Paumgartner: Pfleger zu Altdorf.
Joachim Camerarius: Doktor der Medizin und Vater von Ludwig Camerarius, Student der Jurisprudenz.
Philipp Camerarius: Rechtskonsulent des Stadtrats und Prokanzler der Academia Altorfina.
Obertus Giphanius (Hubert van Giffen): angesehener, aber verschuldeter Professor der Jurisprudenz zu Altdorf.
Hugo Donellus (Hugues Doneau): hoch angesehener Rechtsgelehrter und Professor zu Altdorf.
Henry Wotton: prominenter Gaststudent an der Academia Altorfina, späterer Gesandter des englischen Königs Jakob I., Dichter und Kunstsammler.
Glossar
Atzung: Geld, das Gefangene für ihre Kost bezahlen mussten.
Dies academicus: jährlich am Peter-und-Paul-Tag (29. Juni) stattfindende akademische Feier.
Fraisch: Blutgericht, Hochgerichtsbarkeit.
Franzosenkrankheit: Bezeichnung für Syphilis oder andere Geschlechtskrankheiten wie Gonorrhö, die sich damals nicht eindeutig unterscheiden ließen.
Garaus: Torschluss.
Glimpf: gute Art, Anstand, Schonung, Mäßigung.
Keuche: Gefängniszelle.
Kustorin: Wirtschafterin in städtischen Diensten, zum Beispiel für das Pestlazarett.
Loch(gefängnis): Verlies unter dem Rathaus, das als Untersuchungsgefängnis diente. Hier wurden auch Delinquenten festgehalten, die auf ihre Hinrichtung warteten.
Lochwirt: Lochhüter, oberster Gefängniswärter im Loch.
Losunger: Der Vorderste Losunger war der mächtigste Mann der Stadt, zuständig für Finanzen und Verteidigung, da er gleichzeitig einer der drei obersten Hauptleute war. Unterstützt wurde er vom zweiten Losunger und von Mitarbeitern in der Losungsstube.
Löwe: Henkersknecht. Es gibt verschiedene Theorien dazu, wie der Henkersknecht zu seinem Spitznamen kam, den es so nur in Nürnberg gab, allerdings überzeugt keine so recht. In Bamberg hieß der Henkersknecht beispielsweise Peinlein.
Nachrichter: So wurde der Scharfrichter in Nürnberg und anderen Gebieten genannt, da er nach dem Richter seines Amtes waltete.
Pappenheimer: So wurden in Nürnberg die Straßenreiniger genannt, die auch in regelmäßigen Abständen die Abortgruben leeren mussten, vermutlich weil der Reichsmarschall über Jahrhunderte aus dem Geschlecht der Pappenheimer bestellt wurde. Dieser war unter anderem für die Sauberkeit bei Hofe zuständig.
Prisaun: Gefängnis, meist zur kurzfristigen Verwahrung von Delinquenten. Im Närrischen Prisaun wurden Geisteskranke verwahrt, die für sich oder ihre Umwelt eine Gefahr darstellten.
Reff: Rückentragekorb, Kraxe. Reffträger lieferten zumeist Waren in kleineren Mengen in die Stadt.
Scholarch: Stadtbeauftragter für Schul- oder Kirchenaufsicht.
Schurbauch: Skorbut.
Sterbenslauf: Seuche, Epidemie, die viele Menschen dahinraffte und dann ausklang.
Urgicht: Geständnis.
Unschlitt: Rindertalg
Prolog
Nürnberg am Mittwoch, den 25. März 1590
Im Morgengrauen begegnete Frantz kaum Menschen, als er sich durch die engen Gassen zur Peunt begab. Das Pflaster war noch feucht vom nächtlichen Regen, aber an diesem Morgen zogen nur wenige Wolken über den Himmel. Ein guter Tag für einen langen Ritt. Trunstadt lag hinter Bamberg. Das Tor des Bauhofs war noch geschlossen, aber nicht abgesperrt. Frantz öffnete es und trat hindurch. »Jemand da?«, rief er und ließ den Blick über die Gebäude schweifen. Stallungen, Lagerhallen und ein Wirtschaftsgebäude. Der Anschicker trat aus letzterem und verzog inzwischen nicht einmal mehr das Gesicht, wenn der Nachrichter von Nürnberg ein Pferd brauchte, doch lange hatte es gedauert, bis er sich nicht mehr vor Frantz scheute. Heute grüßte er sogar freundlich: »Guten Morgen, Meister Frantz.«
»Dir auch einen guten Morgen. Was hast du mir denn für ein Pferd ausgesucht?«
»Wieder die brave Trudi.«
Da führte der Knecht auch schon die etwas betagte Mähre aus dem Stall. Ihre Ausdauer beeindruckte trotz ihres Alters. Frantz streichelte ihr über die Nüstern. »Heute kommen wir zwei mal wieder aus der Stadt, Trudi.«
Als hätte das Ross ihn verstanden, hob es den Kopf und wieherte. Er befestigte seine Ledertasche mit Werkzeug, Salben und Kräutern sowie ein Bündel mit Proviant am Sattel und stieg auf. Die Strecke nach Trunstadt war für Trudi und seinen Hintern gerade so an einem Tag zu bewältigen.
»Gehab dich wohl«, verabschiedete sich Frantz und ritt los. Der Hufschlag hallte von den hohen Sandsteingemäuern wider, doch bald schon verließen sie die Stadt durch das Frauentor. Draußen warteten bereits einige Fuhrwerke mit Waren, die auf dem Markt verkauft werden sollten. Er ritt an ihnen vorbei in Richtung Fürth. Unwillkürlich wanderte sein Blick zum Hosengarnsticker aus Betzenstein, den Frantz gestern wegen Raubüberfalls auf die Bernthalmühle mit dem Strang vom Leben zum Tod gebracht hatte. Doch was war das? Bei der Hinrichtung hatte der Mann braune Kleidung getragen, jetzt leuchtete der Körper weiß im fahlen Morgenlicht.
Frantz lenkte das Ross zum Galgen. Irgendwelches Gelichter hatte dem Toten die Kleider vom Leib geraubt. Na, kein Wunder. Mindestens fünfhundert Gulden hatte Hans Walters allein bei der Mühle erbeutet – mithilfe von vierzehn Räubergesellen. Bei seiner Ergreifung befanden sich jedoch nur zehn Gulden unter den Habseligkeiten. In solchen Fällen lag der Verdacht nahe, er könnte Münzen in seine Kleidung eingenäht haben, allerdings war diese von der Frau des Lochhüters untersucht worden, ohne Ergebnis. Frantz blickte zurück zu den trutzigen Sandsteinmauern der Reichsstadt. Nein, dafür hatte er keine Zeit. Jemand anderes würde den Diebstahl bald bemerken und im Rathaus Bescheid geben, damit wenigstens die Scham des Leichnams bedeckt wurde, bevor seine Blöße zu viel neugieriges Weibsvolk anlockte.
Frantz ritt zurück zum Fahrweg nach Fürth und Erlangen. Anfangs musterte er aufmerksam die Fuhrwerke und mit einem gewissen Misstrauen berittene Reisende, die ihm begegneten, denn es gab genug Räuber, um auf der Hut zu sein. Doch bald grübelte er über seinen künftigen Patienten nach. Emmerich Ernst von Redwitz litt an so grausigen Schmerzen im Unterschenkel, dass er nicht mehr gehen konnte und mit Selbstmord gedroht hatte. In ihrer Verzweiflung hatte die Mutter des Freiherrn ausgerechnet ihn angefordert. Weshalb, das hatte ihm niemand erklären können, dennoch lächelte Frantz. Zum ersten Mal wurde er nicht als Henker, sondern als Heiler von der Freien Reichsstadt Nürnberg ausgeliehen. Das Lächeln verging ihm allerdings schnell wieder. Hoffentlich konnte er wirklich helfen. Amalia von Redwitz glaubte womöglich, dass einem Henker zauberische Kräfte innewohnten. Da wäre sie nicht die Einzige.
In seinem Bündel befand sich das Buch von Johann Weyer über bisher unbekannte Krankheiten, das ihm Doktor Camerarius geschenkt hatte. Falls er es auspackte, würde der Freiherr womöglich den Glauben an seine henkerischen Heilkünste verlieren. Frantz hatte tatsächlich bemerkt, dass sich manche Kranke schneller erholten, wenn er sie behandelte, obwohl er dieselbe Medizin anwendete wie jeder Wundarzt oder Medicus. Der Geist war sonderbar, die Macht der Einbildung groß. Doch solange er Leuten helfen konnte, sollte es ihm recht sein.
Kurz vor Erlangen legte er die erste Pause am Ufer der Rednitz ein und ließ das Ross saufen und grasen. Indes setzte er sich auf einen bemoosten Felsbrocken, verzehrte ein Gutteil seines Proviants bestehend aus Brot, Käse und Schinken und ließ sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Der Januar war so schrecklich kalt wie schon lange nicht mehr gewesen. Umso willkommener war ihm jetzt der Frühling. Vogelgezwitscher und austreibende Bäume kündeten von erwachendem Leben.
Während er aß, hielt er den Blick auf die Straße gerichtet. Die Arbeit eines Fuhrmanns hätte ihm auch gefallen können. Manche von ihnen kamen in halb Europa herum, reisten von Antwerpen bis zur kaiserlichen Residenz Prag oder von Hamburg bis Wien, Städte, deren Namen er nur aus Flugblättern kannte. Im letzten hatte er gelesen, der Goldmacher Mamugnano in Venedig sei doch ein Scharlatan gewesen, der aus Quecksilber nur eine sehr kleine Menge Gold herstellen konnte anstelle vieler Pfunde. Die Gauner wurden immer einfallsreicher.
Frantz saß auf und ritt weiter, pausierte noch einmal an einem Fischweiher in der Nähe von Buttenheim und spürte bereits jeden Muskel in seinem Körper. So weit war er schon lange nicht mehr geritten. Er streckte und reckte sich, führte das Ross ein Stück, bevor er wieder aufsaß.
Endlich kam Bamberg in Sicht. Dort war sein Vater Heinrich einst Henker gewesen und Frantz der Lehrbub. Mit gemischten Gefühlen ritt er an der Stadt vorbei. Schöne Erinnerungen an seinen Vater und die Stiefmutter vermischten sich mit ersten grausigen Eindrücken davon, was für ein Leben ihn erwartete.
Die Sonne stand schon tief, als er Trunstadt erreichte. Im Ortskern ragte das dreistöckige Schloss mit hohem Staffelgiebel auf. Eine Wehrmauer mit Graben umgab es. Er ritt zum Torwächter und stellte sich vor: »Frantz Schmidt aus Nürnberg. Die Freifrau Amalia von Redwitz wünscht meine Dienste.«
Der Mann musterte ihn eingehend. Ob der wusste, wer er war? Endlich trat der Wächter beiseite. »Ihr seid spät dran. Ich schließ gleich das Tor, also macht nicht zu lange.«
Was für ein Flegel! Frantz hoffte, hier Quartier für die Nacht zu bekommen. Der Wächter zog an einer Kette, die eine Glocke anschlagen ließ, und winkte ihn durch.
Im Innenhof des Guts sah Frantz sich um. Der Stall grenzte an die Zehntscheune an. Als er abgestiegen war und seine Taschen vom Sattel gelöst hatte, nahm ihm auch schon ein Stallknecht das Ross ab. »Die Herrin erwartet Euch.« Er wies zum Eingangsportal.
Tatsächlich stand eine edel gekleidete Frau im Eingang zum Herrschaftshaus. Das dunkle Haar war kunstvoll geflochten und nur von einem feinen Spitzentuch bedeckt, das Lächeln gequält. Frantz trat zu ihr. »Amalia von Redwitz?«
Sie nickte. »Und Ihr seid …«
Er deutete eine Verbeugung an. »Frantz Schmidt, Nachrichter zu Nürnberg und Heiler. Zu Euren Diensten.«
»Gut! Ihr habt … alles dabei?« Ihr Blick streifte sein Bündel und die Ledertasche.
»Das hoffe ich.«
»Folgt mir.« Sie eilte voraus eine Treppe hinauf. »Verzeiht, ich würde Euch gern eine Erfrischung anbieten«, rief sie über die Schulter. »Aber wenn es nicht zu viel verlangt ist, wäre es mir lieb, wenn Ihr Euch zuallererst meinem Sohn zeigt.« Sie blieb vor einer Tür stehen und sah ihn flehend aus dunklen tränenfeuchten Augen an. »Allein Euch zu sehen wird ihm Hoffnung geben, die braucht er dringend.«
Frantz unterdrückte ein Seufzen. Selbst eine Freifrau glaubte offenbar an die besonderen Kräfte, die einem Henker innewohnten. Fehlte nur noch, dass sie ihn bat, mit ihr zu einem Hexensabbat zu fliegen. Er verscheuchte den albernen Gedanken. »Natürlich seh ich ihn mir gern sofort an.« Er bemerkte, dass ihnen eine Magd und ein Diener gefolgt waren. »Würdet Ihr mir ein Glas Wasser bringen lassen? Der Weg war weit, die Straße staubig.«
Auf ein Nicken ihrer Herrin sprang die Magd sogleich davon. Die Freifrau klopfte an die Tür und betrat das Gemach ihres Sohnes. »Emmerich, Meister Frantz ist da!«
Ein Wimmern antwortete ihr. Frantz nahm das als Erlaubnis einzutreten. Muffig roch es, aber nicht wie ein Krankenzimmer. Er trat ans Bett aus Eichenholz mit kunstvoll geschnitztem Kopf- und Fußteil und betrachtete den Patienten. Das gerötete Gesicht war mit Schweiß überzogen, die blonden Haare klebten am Kopf. Er brachte beim Sprechen kaum die Zähne auseinander. »Macht, dass es aufhört.«
Frantz legte ihm eine Hand auf die Stirn. »Leichtes Fieber.«
»Das Bein«, keuchte Emmerich. Seine Mutter schlug die Decke zurück und entblößte die rechte Wade, deutete auf die geschwollene Stelle, ohne sie zu berühren.
Eine blutunterlaufene Ausbeulung zeigte sich eine Handbreit unter dem Knie auf der Innenseite des Schienbeins. »Ein Unfall?«, fragte er. »Ist der Knochen gebrochen?«
»Nein, das Bein … macht mir schon länger Schwierigkeiten, seit Monaten.« Der Kranke holte tief Atem. »Dann vor gut zwei Wochen ein stechender Schmerz, dass ich gar nicht mehr hab gehen können.«
Eine Knochenwucherung, die den Muskel so sehr reizte? Offenbar hatte noch niemand gewagt, das Bein aufzuschneiden und nachzuschauen. »Habt Ihr Schmerzmittel bekommen?«
»Ja, sonst hätte ich mich schon vom Turm gestürzt, aber nicht genug. Ihr könnt doch etwas tun? Die Ärzte wissen nicht weiter, aber Ihr als Henker …« Emmerich griff nach einem hölzernen Löffel und steckte ihn sich zwischen die Zähne, dann nickte er ihm zu.
Frantz betastete die Beule, während er mit der linken Hand das zuckende Bein festhielt. Der Patient stöhnte und holte stoßweise Luft, doch darauf durfte er jetzt keine Rücksicht nehmen. Was verursachte die Blutung? Da! Er meinte ein loses Stück Knorpel oder Knochen zu spüren. Der Freiherr schrie auf, als er es bewegte. Frantz ließ von ihm ab und überlegte. Es hatte sich tatsächlich wie ein bewegliches Knochenstück angefühlt. Konnte sich ein Überbein vom Schienbein gelöst haben? Davon hatte er noch nie gehört. Mit einer Hand packte er wieder den Knöchel, um nicht getreten zu werden, dann verschob er die geschwollene Beule noch einmal.
Emmerich von Redwitz schrie wie am Spieß. Frantz ließ los und trat zurück. Die Magd drückte ihm einen Becher in die Hand und er trank, verzog jedoch das Gesicht. Wein! Er stellte ihn weg. »Bring mir bitte Wasser. Ein Betrunkener sollte nicht am Bein des Freiherrn herumschneiden.«
»Schneiden?«, fragten Mutter und Sohn gleichzeitig und starrten ihn an.
Frantz sank auf den Stuhl neben dem Bett und bedachte andere Möglichkeiten. Doch solange er nicht wusste, womit er es zu tun hatte, half nur eines: nachschauen. »Ja, ich fürchte, es muss sein.«
»Der Wundarzt hat abgeraten«, wandte Amalia von Redwitz ein.
»Und er konnte Eurem Sohn nicht helfen, deshalb habt Ihr schließlich nach mir geschickt.«
»Sicher, aber könnt Ihr ihm nicht das Bein mit Menschenhaut verbinden, einen Segen sprechen …?«
Frantz rang sich ein Lächeln ab. »Das kann ich gern tun, doch es wird nichts helfen, solange ich nicht die Ursache für die Schmerzen behebe.«
Fragend sah die Freifrau ihren Sohn an, der antwortete: »Tut, was getan werden muss, damit ich die Schmerzen loswerde. Meinetwegen schneidet das Bein ab.«
»Das wird hoffentlich nicht notwendig sein.« Frantz sah sich im Raum um, entdeckte kein Waschzeug auf dem Tischchen, nur eine Schüssel mit Latwerge-Kügelchen oder Naschzeug sowie einen Schrank mit ähnlichen Schnitzereien verziert wie Kopf- und Fußteil der Bettstatt. Durch die Butzenscheiben drang nur noch wenig Licht.
»Was braucht Ihr?«, fragte die Mutter, die seinen Blick richtig gedeutet hatte.
»Erst einmal etwas zu essen, dann Wasser und Seife, ein Tuch. Außerdem mindestens zwei Talglampen oder Kerzen. Alles andere hab ich dabei.« Er wandte sich an den Patienten, der um die fünfundzwanzig sein mochte, doch bei seinem von Pein verzerrten Gesicht war das schwer einzuschätzen. »Was nehmt Ihr gegen die Schmerzen?«
»Bilsenkraut vermischt mit anderem Zeug.«
Frantz nickte. »Habt Ihr heute schon etwas davon genommen?«
»Natürlich, sonst …«
»Was genau und wie viel?«
Emmerich deutete zu der Schale mit Kügelchen. Frantz nahm eines und roch daran. Viele bekannte Düfte durchströmten ihn, allerdings auch welche, die ihm gar nicht in schmerzlindernde Latwerge zu gehören schienen. Vermutlich, um den Geschmack zu verbessern. Er fühlte den Herzschlag des Mannes, dann noch einmal die Stirn. »Gut, Ihr nehmt nichts mehr, bis ich mich gestärkt habe und anfangen kann. Bevor ich schneide, bekommt Ihr von mir reines Bilsenkraut und werdet gefesselt.«
Emmerich von Redwitz riss die Augen auf und starrte ihn an. Frantz nickte und nahm vorsichtshalber die Latwerge mit aus dem Gemach. Hastig tischte ihm das Gesinde kalten Braten und Brot auf. Amalia setzte sich zu ihm an den Tisch, wollte offenbar höflich sein, fragte ihn, ob der Ritt beschwerlich gewesen sei.
»Nicht sehr, doch verzeiht bitte, ich muss nachdenken«, antwortete er. »In Gedanken die Prozedur durchgehen. Um das Essen geht es mir gar nicht so sehr, tut aber gut.«
»Natürlich.« Etwas verlegen dreinschauend erhob sie sich.
Da fiel Frantz etwas anderes ein. »Darf ich fragen, weshalb Ihr ausgerechnet mich habt rufen lassen?«
Amalia von Redwitz lächelte. »Ihr seid mir empfohlen worden.«
Die Freifrau machte es spannend, deshalb hakte er nach. »Als Heiler oder Henker mit besonderen Kräften?«
Sie blinzelte mehrmals, schluckte. »Als wirkmächtiger Henker, der über die unverbrauchte Lebensenergie der Gerichteten verfügt.«
Ob ihr Kräuterweib zauberischen Schabernack trieb, um ihr Kraut teurer zu verkaufen? Nein, in der Bamberger Gegend wäre das zu gefährlich. Hexen wurde kurzer Prozess gemacht. »Hat mich etwa gar der Lebküchner aus Bamberg empfohlen?« Brunner hatte ihn erst letztes Jahr mit seinem Sohn aufgesucht, dessen gebrochenes Bein krumm zusammengewachsen war. Frantz hatte es erneut gebrochen, geschient und auf Wunsch des Vaters mit Menschenfett eingerieben, obwohl es auch so ordentlich zusammengewachsen wäre.
»Ganz recht. Er wurde ja schon von Eurem Vater behandelt und hat Euch als jungen Burschen gekannt.« Sie räusperte sich. »Der Bamberger Henker konnte nichts für Emmerich tun.« Sie verließ den Speiseraum des Gesindes, als wäre der Leibhaftige hinter ihr her.
Grübelnd aß Frantz weiter. Der Aberglaube, der sich um seine Arbeit rankte, behagte ihm wenig, auch wenn dieser ihm stattliche Nebeneinkünfte bescherte. Es ließ sich ja doch nicht ändern, also verscheuchte er derlei Gedanken und stellte sich vor, was er tun müsste, um dem Patienten tatsächlich zu helfen. Was er vorhatte, war nicht ungefährlich, doch jemand musste es wagen. Er schob sich einen letzten Bissen des sehr reifen Käses in den Mund und erhob sich. Der Diener stand bereit und führte ihn in einen Waschraum, wo schon ein Krug mit heißem Wasser, Seife und Schüssel bereitstanden. Frantz wusch sich erst das Gesicht, dann seifte er Hände und Arme ein und ließ den Diener etwas warmes Wasser darübergießen. Mit einem sauberen Tuch trocknete er sich ab. »Hol einen Becher Wein für deinen Herrn, in den ich das zerstoßene Bilsenkraut geben kann. Ich nehm Schüssel und Wasser mit. Mehr Tücher brauchen wir auch.« Frantz stieg die Treppe hinauf und betrat das Gemach, in dem er seine Tasche mit Handwerkszeug zurückgelassen hatte. Er wischte ein scharfes Messer, eine spitze Zange und eine Pinzette mit dem feuchten Tuch ab, bevor er die Werkzeuge bereitlegte.
Emmerich von Redwitz beobachtete ihn voller Misstrauen. »Warum wollt Ihr etwas tun, das sonst keiner wagt?«
Frantz lächelte. »Vielleicht, weil ich nicht hier lebe. Könnte es sein, dass die Ärzte, die Ihr bisher habt kommen lassen, zu viel Angst vor einem möglichen Versagen hatten, weil es sich herumsprechen und andere Patienten abschrecken könnte?«
»Mag sein. Ihr fürchtet Euch nicht zu scheitern?«
»Doch, aber gerade weil Ihr damit gedroht habt, Euch das Leben zu nehmen, muss ich es versuchen. Wenn es glückt, rette ich auch noch Euer Seelenheil.«
Der Leidende schnaubte. »So sei es.«
Der Diener brachte einige Tücher und hielt ihm den Becher Wein entgegen. Frantz rührte das berauschende und schmerzlindernde Kraut hinein, wartete etwas, rührte noch einmal um und reichte Emmerich das Getränk. »Trinkt alles.«
Die Mutter wollte offenbar zusehen. Sie brachte Stoffstreifen mit. »Wollt Ihr ihn damit binden?«
»Gern, dann scheuert er sich weniger auf, wenn er sich wehrt.«
»Herr im Himmel, hilf!«, flehte Emmerich übertrieben erbarmenswert. »Mutter, was holst du auch den Henker?«
Frantz musste unwillkürlich schmunzeln, was den Kranken zu beruhigen schien, oder das Kraut tat schon seine Wirkung. Aber vielleicht würden die Herrschaften es zu schätzen wissen, wenn er einen bereits gebrauchten Galgenstrick verwendete. Er fragte lieber nicht. »Rutscht etwas zu mir an die Seite.« Er winkelte das geschädigte Bein an und band den Knöchel am anderen Bein über dem Knie fest, sodass er ungehindert an der Verletzung arbeiten konnte und sein Patient nicht das ganze Bett voll blutete. Dann fesselte er das gesunde Bein an den massiven Bettpfosten. Der Diener und die Magd hatten dem Freiherrn inzwischen die Arme wesentlich lockerer an die Pfosten am Kopfende gebunden. In weiser Voraussicht stellte die Magd eine Schüssel unter das angewinkelte Knie.
Frantz erklärte: »Dass ich Euch festschnüre, mag Euch wunderlich erscheinen, doch je ungehinderter ich arbeiten kann, desto schneller habt Ihr es hinter Euch.«
»Schon recht, euer Kraut ist stärker als das Zeug von unserem Kräuterweibla. Mir ist ganz wohlig.«
»Die Frau kann Euch guten Gewissens nur so viel geben, dass Ihr nicht völlig von Sinnen werdet. Doch heute macht es nichts, wenn Ihr meint, allerlei zu sehen, das gar nicht im Raum ist, und mit Dämonen kämpfen wollt. Auch bei solchen Wahnvorstellungen, die das Kraut hervorrufen kann, erweisen sich die Fesseln als recht nützlich.« Frantz ließ weitere Lampen bringen, kniete neben dem Bein nieder, legte Tücher, Messer und Zange griffbereit auf den Boden, dann ertastete er den Muskel neben dem Schienbein und setzte direkt daneben den ersten Schnitt, so lang wie sein Daumen. Emmerich keuchte nur, doch der Diener nutzte die Gelegenheit, um ihm wieder den Holzlöffel zwischen die Zähne zu schieben.
Blut quoll aus der Wunde, aber nicht sehr viel. Frantz schob die Hautlappen auseinander, drückte mit einem Holzstäbchen gegen den Muskel. Das Bein zuckte, Emmerich röchelte.
»Locker lassen.« Als der Patient reagierte, schob Frantz den Muskel weiter vom Knochen weg. Mehr Blut quoll aus dem entzündeten Gewebe. Er ließ es ablaufen und staunte. Das Überbein war offensichtlich vom Muskel durch große Anstrengung vom Knochen gerissen worden. Bei jeder Bewegung rieb jetzt Knochen an Knochen! Die Schmerzen mussten ungeheuerlich sein. Wie konnte er die Bruchstelle schützen? »Wachs!«, rief er. »Habt Ihr Wachs und einen Löffel?«
»Natürlich.« Die Magd eilte los und kam mit einer Kerze zurück.
»Anzünden!«, befahl er.
Sie hielt den Docht an die Flamme einer Talglampe und stellte die brennende Kerze neben ihn. Während er wartete, bis genug Wachs geschmolzen war, überlegte er, wie arg der Muskel gereizt sein mochte.
»Reicht das?«, fragte die Magd. Um den Docht hatte sich nun einiges Wachs verflüssigt.
»Ich denke schon. Gieß es in einen Metalllöffel«, wies er sie in wesentlich freundlicherem Ton an. Frantz nahm die Pinzette. Als Erstes musste er das Knochenstück entfernen, ohne den Muskel zu verletzen. Er blickte zum Wachs. Noch war es nicht fest genug, dass er es einfach abziehen konnte. »Muss noch etwas abkühlen.«
Sie schwenkte den Löffel, blies auf das Wachs. Da fiel ihm auf, wie still der Patient hielt. »Seid Ihr noch bei Bewusstsein?«
»Natürlich, mir geht’s gut. Seid Ihr gar schon fertig?«
»Nein, etwas unangenehm wird es noch«, sagte Frantz, ließ die Pinzette in die Wunde gleiten und versuchte, das Knochenstück zu greifen, während er mit dem Holzstäbchen Haut und Muskel beiseitehielt. Doch das Überbein war zu glitschig, rutschte von den Greifbacken ab. Emmerich keuchte und wimmerte.
»Gut, erst das Wachs.« Frantz tauchte den Finger in den Löffel, nahm die warme, weiche Masse auf und tastete mit dem linken Zeigefinger nach der Bruchstelle am Knochen. Der Patient hechelte. Da fühlte er die raue Stelle. Frantz schob das Wachs darüber und drückte es fest. »Nun sollte es nicht mehr so schmerzhaft sein.« Frantz sah die Maid an. Sie wirkte sehr vernünftig und gern bereit zu helfen. »Kannst du das Stäbchen für mich halten, ohne in Ohnmacht zu fallen?«
Sie schluckte, dann nickte sie. »Glaub schon.«
»Komm auf meine andere Seite.« Frantz schob das Holzstück zwischen Schenkelknochen und Muskel. »So halten.«
Zittrige, klamme Finger legten sich über seine, dann packte sie das Hölzchen ganz fest und ruhig. Frantz schob ein zweites in die Wunde, um das Bruchstück von unten zu fixieren. Dann versuchte er wieder, diesmal mit der spitzen Zange das Knöchlein zu greifen. Erneut rutschte er ab. Kurzerhand schob er zwei Finger hinein und ertastete den glitschigen Knochen. Auch so konnte er das Stück kaum packen, doch endlich bekam er es zu fassen und zog es heraus.
Frantz atmete auf und wischte sich die blutige Hand an einem der feuchten Tücher ab. Emmerich wimmerte kaum hörbar. Mehr Blut strömte aus der Wunde. Hatte er mit seiner Grobheit den Muskel verletzt? Frantz ließ das Blut in die Schüssel ablaufen, dann tastete er nach dem Wachs. Erleichtert stellte er fest, dass er es nicht abgestreift hatte. »Das Schlimmste ist überstanden«, verkündete er und atmete noch einmal tief durch.
Die Magd sah ihn an. »Kann ich …?«
»Ja, zieh das Stäbchen langsam raus. Jetzt muss das Bein nur noch heilen.« Frantz überlegte, ob er eine betäubende Salbe in die Wunde streichen sollte, damit sich der gereizte Muskel schneller erholte, doch zu diesem Zeitpunkt wollte er lieber auf die Natur vertrauen. Der Strom von Blut ließ erfreulicherweise bald nach. Er sah sich nach der Mutter um. Blass hockte sie auf einem Stuhl in der Ecke und beobachtete ihn voller Sorge. Er lächelte ihr zu, da hellte sich ihre Miene auf.
»Danke, Meister Frantz!«
»Das hab ich gern getan. Zwei Wochen sollte er noch das Bett hüten, dann langsam wieder mit einem Stock herumgehen. Falls die Wunde nässt oder gar gelben Eiter absondert, holt unverzüglich einen Wundarzt. Der sollte wissen, wie damit umzugehen ist. Falls nicht, komme ich gern noch einmal her.« Ein Wundbrand konnte den Freiherrn doch noch das Bein kosten, aber so weit kam es hoffentlich nicht. Bevor er die Wunde nähte, hob er das Überbein auf, das tatsächlich mit Knochenhaut überzogen und deshalb so glitschig war. Daumennagelgroß ähnelte die Form einem Pilz mit Stiel so dick wie sein kleiner Finger. An dieser Verengung befand sich die Bruchstelle.
»Was ist es?«, fragte Amalia von Redwitz.
»Eine Knochenwucherung. Darf ich das Stück mit nach Nürnberg nehmen? Es könnte die dortigen Ärzte interessieren.«
»Was sagst du, Emmerich?« Sie schmunzelte. »Kannst du dieses Stück deines Körpers entbehren?«
Der Patient hustete. »Das Malefizding habt Ihr Euch verdient. Meinetwegen hängt es an den Galgen.« Er gab ein glucksendes Lachen von sich.
»Danke.« Frantz wusch das Blut von seinen Händen, vernähte mit einer Nadel und Schweinesehnen die Wunde und schloss aus der kaum vorhandenen Reaktion, wie sehr sein Patient berauscht war. »In den nächsten Tagen dürft Ihr gern noch Latwerge gegen die Schmerzen naschen, aber haltet Euch zurück, damit Ihr merkt, wie es dem Bein geht.«
»Von Euren Kräutern lasst Ihr mir nichts da?«, lallte der Freiherr schlaftrunken.
»Lieber nicht.«
»Verbindet Ihr ihm die Wunde mit Menschenhaut?«, fragte die Mutter.
Frantz schüttelte den Kopf. »Nicht bei einer offenen Wunde. Sauberer Stoff schützt die verletzte Stelle, lässt aber noch Luft durch. Das fördert die Heilung eher.« Sah er da Enttäuschung in ihrem Gesicht?
Kapitel 1
Altdorf am Sonntag, den 28. Juni 1590
Floryk fühlte sich schon den ganzen Tag ungemein fröhlich. Selbst jetzt noch, als der Pedell ihn zusammen mit den anderen fünf diesjährigen Absolventen in ihren Roben kritisch musterte, konnte er nur grinsen.
»Bald sind wir frei!«, verkündete Floryk. In seinen Jubel fielen die anderen Studenten ein, die am morgigen Dies academicus ebenfalls ihre Magisterurkunden erhalten sollten.
Der Pedell schüttelte missbilligend den Kopf. »Jetzt beginnt der Ernst des Lebens für euch.«
Ernst des Lebens? Lächerlich! Vier Jahre hatte Floryk hier ausgehalten und die letzten Monate waren ihm ziemlich verleidet worden, weil sich die Rechtsprofessoren Giphanius und Donellus immer wieder stritten, dabei hatte Giphanius den Leidener Kollegen sogar empfohlen. Alsbald hatte Floryk die Vorlesungen in Jurisprudenz öfter geschwänzt und lieber bei Praetorius Mathematik und Astronomie gehört.
»So, es wird Zeit«, verkündete der Pedell. »Begebt euch in den Hof der Akademie. Die Scholarchen treffen in Kürze ein.«
Lärmend verließen sie den Speisesaal und sprangen hinaus ins Freie. Was für ein herrlich warmer Sommer! Wenn nur das Meer nicht so fern wäre.
Als Nächstes scheuchte der Pedell auch schon Pauker und Trompeter heraus. Weit gemächlicher folgten die Professoren, die gerade das prächtig geschmückte Auditorium Welserianum inspiziert hatten. Dort fanden morgen die großen Feierlichkeiten statt.
Der Rektor Edo Hilderich von Varel trat zu Floryk und den anderen Studenten und lächelte zufrieden. »In diesem Jahr gleich sechs Absolventen. Die Academia Altorfina ist stolz auf jeden Einzelnen von euch.«
Richtig, letztes Jahr hatte es gar keine frischgebackenen Magister gegeben. Das war schon ein seltsamer akademischer Feiertag ohne Absolventen.
Jan, ein böhmischer Adelsspross, übte sich sogleich in höfischen Manieren und antwortete: »Das haben wir Euch zu verdanken, werter Varel. Dabei wolltet Ihr letztes Jahr die Wahl zum Rektor gar nicht annehmen.«
»Ach, ich hab mich nur geärgert, weil die Scholarchen eine Professur für Hebräisch abgelehnt haben, aber wenigstens darf ich Griechisch und Philosophie unterrichten und muss mich nicht auf Theologie beschränken. Und am 1. Juli übergebe ich das Amt an den werten Indenius.«
Ein steiler Aufstieg. Der war noch Student, als Floryk sich vor vier Jahren immatrikulierte.
Erst jetzt schlenderte auch Professor Giphanius aus dem Kollegiengebäude. Floryk stieß den böhmischen Studenten mit dem Ellbogen an. »Willst du nicht nach deinen Büchern fragen?«
Jan machte ein missmutiges Gesicht. »Ob ich die jemals wiedersehe? Es wird mir langsam wirklich leid.«
Varel atmete tief durch. »Deine Bücher hat Giphanius immer noch nicht herausgegeben?«
»Nein, aber bevor ich meine Bildungsreise antrete, will ich sie unbedingt zurückhaben. Die sind gar nicht so leicht zu ersetzen, waren auch teuer.«
»Natürlich«, antwortete Varel und eilte zu dem Bücher-Einheimser, redete auf ihn ein und warf dann einen Blick über die Schulter zu Jan.
Giphanius strich sich über den langen lockigen Bart, feixte dreist und nickte vor sich hin. Floryk hatte den Hugenotten aus Buren in seinem ersten Jahr sehr geschätzt, aber spätestens seit Donellus dem Kollegen bezüglich des Ansehens unter den Rechtsgelehrten und der Beliebtheit bei den Studenten den Rang abgelaufen hatte, benahm Giphanius sich missgünstig. Nun gesellte sich der künftige Rektor Indenius zu den Professoren. Der Emporkömmling versuchte oft zu vermitteln, doch mit wenig dauerhaftem Erfolg.
»Es wird Zeit, meine Herren!«, rief der Pedell. »Bald treffen die Scholarchen ein!« Er winkte die Professorenschaft in Richtung Pflegschloss. Rektor Varel sah sich schuldbewusst um, als hätte er ganz vergessen, was morgen für ein Tag war, und eilte voraus.
Floryk lachte mit seinen Freunden über die zerstreuten Gelehrten. Ludwig Camerarius und Henry Wotton kamen zu ihnen geschlendert. »Na, freut ihr euch, hier wegzukommen?«, fragte der Engländer.
Floryk nickte am eifrigsten und strahlte. »Wird Zeit.«
»Ich versteh dich nicht.« Henry schüttelte den Kopf. »Die letzten Monate hier waren vielleicht meine bisher schönste Zeit. Hab noch gar keine Lust, weiterzuziehen. Allerdings dürfte es im Herbst in Italien doch angenehmer sein als hier.«
Ludwig verdrehte die Augen. »Du bist wirklich zu beneiden, nicht einmal immatrikulieren musstest du dich, kannst gehen, wohin du willst, wann du willst.«
»Eine Bildungsreise durch Italien könnte mir auch gefallen«, gestand Floryk, obwohl er von Büchern erst einmal genug hatte. Falls sein Vater unbedingt wollte, dass er promovierte, würde er darauf bestehen, nach Padua oder Bologna zu gehen. Ob Vater schon aus Neumarkt angekommen war? Natürlich hatte Floryk ihm ein Zimmer im Goldenen Bären reserviert.
Da ertönte eine Trompete im Turm und kündigte die Ankunft der Scholarchen an.
»Grüß meinen Onkel Philipp«, sagte Ludwig.
»Willst du ihn nicht selbst begrüßen?«
Ludwig winkte ab. »Den seh ich bestimmt später.«
»Gut.« Mit den anderen Absolventen folgte Floryk den Trommlern und Trompetern auf die Straße und blickte der Kutsche entgegen. Zwei Schützen und zwei Stadtknechte ritten zum Geleit nebenher, darunter seine alten Bekannten Max Leinfelder und Michel Hasenbart. Als sie nahe genug herangekommen waren, winkte er ihnen zu und schritt mit den anderen feierlich voran zum Pflegschloss, wo die Herren aus Nürnberg speisen und nächtigen würden.
Die Professoren und der Landpfleger Balthasar Paumgartner erwarteten sie im Hof des Schlosses, das wie ein stattliches Gutshaus anmutete. Selbst die beiden Rechtsgelehrten wirkten nun sehr friedlich, Donellus stand sogar neben seinem Kollegen Giphanius.
Floryk nahm mit den anderen Absolventen neben den Lehrern Aufstellung. Die Kutsche hielt, ein hiesiger Diener öffnete auf einer Seite den Schlag, der Kutscher huldvoll lächelnd auf der anderen. Die Ordnungshüter waren am Tor zurückgeblieben.
Julius Geuder und sein Neffe Anton, beides frisch ernannte Scholarchen, stiegen leichtfüßig aus, während sich Hieronymus Paumgartner, der mächtigste Mann Nürnbergs, helfen lassen musste. »Die elende Gicht.« Er seufzte. »Jeden Sommer wieder.«
Sein Vetter, der Pfleger zu Altdorf, begrüßte ihn und fragte: »Brauchst du einen Tragstuhl?«
»Noch nicht, Balthasar, aber womöglich morgen für die Prozession.«
Der Vierte im Bunde war Philipp Camerarius, Prokanzler der Academia Altorfina und Rechtskonsulent der Freien Reichsstadt Nürnberg. Der Mann straffte die Schultern und sah sich lächelnd um. Die Professoren begrüßten die hohen Herren, erkundigten sich nach dem Befinden, schüttelten Hände. Dann endlich kriegten die Absolventen – die Helden des morgigen Spektakels – die volle Aufmerksamkeit der Gäste. Camerarius gratulierte Floryk zuerst. »Gut gemacht, Loyal, dabei wollte der werte Andreas Imhoff schon die Hoffnung aufgeben.«
»Danke, darauf hatte ich gezählt«, antwortete er mit einem Grinsen. Der Prokanzler zog die Augenbrauen zusammen, deshalb fügte Floryk schnell hinzu: »Ich soll Euch von Ludwig grüßen. Er freut sich, Euch heute Abend oder spätestens morgen bei den Feierlichkeiten zu sehen.«
»Dank dir.«
Der Rektor stellte nun die anderen Absolventen vor, und Camerarius gratulierte einem nach dem anderen. Die Scholarchen schüttelten ihnen ebenfalls die Hände und sagten ein paar anerkennende Worte.
Schließlich waren die Formalitäten vorbei und Pfleger Paumgartner wollte die Herren ins Schloss führen, doch da sagte Indenius: »Werte Scholarchen, es ist mir sehr unangenehm, nachdem ich der nächste Rektor werden soll …«
»Was denn?«, fragte der von Gicht geplagte Hieronymus Paumgartner etwas unwirsch und hängte sich bei seinem Vetter ein.
»Ich muss nach dem Dies academicus Altdorf für ein paar Wochen verlassen.«
»Wieso?«, fragte Geuder.
»Familiäre Probleme …«
»Hm, na gut, wenn es so wichtig ist«, antwortete Paumgartner. »Ich muss mich jetzt hinsetzen.« Die Herren gingen ins Schloss, nur Camerarius warf Professor Indenius noch einen fragenden Blick zu, erhielt aber keine ausführlichere Erklärung.