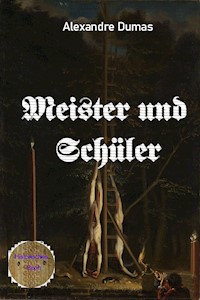
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BROKATBOOK
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Roman spielt 1672 in Den Haag. Die Vereinigten Niederlande und Frankreich befinden sich im Krieg. Die geschilderten Kriegsgreuel sind bestialisch. Dumas schildert die Geschehen mit ihren politischen Hintergründen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Alexandre Dumas
Impressum
Texte: © Copyright by Alexandre Dumas Umschlag:© Copyright by Gunter Pirntke
Übersetzer:© Copyrighby Walter Brendel
Verlag:
Das historische Buch, Dresden / Brokatbookverlag
Gunter Pirntke
Altenberger Straße 47
Inhalt
1. Ein dankbares Volk
2. Die beiden Brüder
3. Der Schüler von Johannes de Witt
4. Die Mörder
5. Der Tulpenzüchter und sein Nachbar
6. Der Hass eines Tulpen-Fanatikers
7. Der glückliche Mann macht Bekanntschaft mit dem Unglück
8. Eine Invasion
9. Die Familienzelle
10. Die Tochter des Gefängniswärters
11. Der Wille von Cornelius Van Baerle
12. Die Hinrichtung
13. Die Enttäuschung des Schurken Mynheer Isaac Boxtel
14. Die Tauben von Dort
15. Das kleine vergitterte Fenster
16. Meister und Schüler
17. Die erste Zwiebel
18. Rosas Liebhaber
19. Das Dienstmädchen und die Blume
20. Die Ereignisse, die sich in diesen acht Tagen abspielten
21. Die zweite Zwiebel
22. Die Öffnung der Blume
23. Der Rivale
24. Die Schwarze Tulpe wechselt den Besitzer
25. Der Präsident Van Systens
26. Ein Mitglied der Gesellschaft für Gartenbau
27. Die dritte Zwiebel
28. Die Hymne der Blumen
29. Vor der Abreise von Loewestein
30. Raten
31. Haarlem
32. Eine letzte Bitte
33. Schlussbemerkungen
1. Ein dankbares Volk
Am 20. August 1672, war die Stadt Den Haag, immer so lebendig, so ordentlich und so gepflegt, dass man jeden Tag glauben könnte, Sonntag zu haben, mit ihrem schattigen Park, mit ihren hohen Bäumen, die sich über ihre gotischen Häuser ausbreiten, mit ihren Kanälen wie große Spiegel, in denen sich ihre Kirchtürme und ihre fast östlichen Kuppeln spiegeln, -- schwoll die Stadt Den Haag, die Hauptstadt der sieben Vereinigten Provinzen, in allen ihren Adern mit einem schwarz-roten Strom der Eile an, keuchende und ruhelose Bürger, die mit Messern im Hüftgürtel, Musketen auf den Schultern oder Stöcken in den Händen auf den Buytenhof drängten, ein schreckliches Gefängnis, dessen vergitterte Fenster noch heute zu sehen sind, wo unter der Anklage wegen versuchten Mordes und der Anstifung zum Mord gegenüber des Chirurg Tyckelaer, Cornelius de Witt, der Bruder des Ratspensionär von Holland, eingesperrt wurde.
Wenn die Geschichte jener Zeit und insbesondere die des Jahres, in dessen Mitte unsere Erzählung beginnt, nicht untrennbar mit den beiden soeben genannten Namen verbunden wäre, könnten die wenigen erläuternden Seiten, die wir jetzt hinzufügen werden, ziemlich überflüssig erscheinen; aber wir werden dem Leser - unserem alten Freund, dem wir auf der ersten Seite gewohnt sind, Belustigung zu versprechen, und mit dem wir immer versuchen, unser Wort zu halten, so gut es in unserer Macht steht - von der ersten Seite an mitteilen, dass diese Erklärung für das richtige Verständnis unserer Geschichte ebenso unerlässlich ist wie für das des großen Ereignisses selbst, auf dem sie beruht.
Cornelius de Witt, Ruart de Pulten, d.h. Deichvorsteher, Ex-Bürgermeister von Dort, seiner Geburtsstadt, und Mitglied der Versammlung der Staaten von Holland, war neunundvierzig Jahre alt, als das niederländische Volk der Republik wie John de Witt überdrüssig wurde, der Ratspensionär von Holland, verstand es, konzipierte sofort eine höchst gewalttätige Zuneigung für das Stadtholderate, das in Holland durch das "Perpetual Edict", das John de Witt den Vereinigten Provinzen aufgezwungen hatte, für immer abgeschafft worden war.
Da es selten vorkommt, dass die öffentliche Meinung in ihren skurrilen Höhenflügen ein Prinzip nicht mit einem Mann identifiziert, sah das Volk die Personifizierung der Republik in den beiden strengen Gestalten der Brüder De Witt, jenen Römern Hollands, die den Phantasien des Pöbels nachgaben und sich mit unbeugsamer Treue zur Freiheit ohne Zügellosigkeit und Wohlstand ohne Verschwendung von Überfluss vermählten; andererseits erinnerte das Stadtholderate das Volk an das ernste und nachdenkliche Bild des jungen Prinzen Wilhelm von Oranien.
Die Brüder De Witt machten sich über Ludwig XIV. lustig, dessen moralischer Einfluss in ganz Europa zu spüren war und dessen materielle Macht Holland in jenem wunderbaren Feldzug am Rhein unter Druck gesetzt worden war, der innerhalb von drei Monaten die Macht der Vereinigten Provinzen in die Knie gezwungen hatte.
Ludwig XIV. war lange Zeit der Feind der Holländer gewesen, die ihn nach Herzenslust beleidigten oder verspotteten, obwohl man sagen muss, dass sie im Allgemeinen die französischen Flüchtlinge als Sprachrohr ihrer Bosheit benutzten. Ihr Nationalstolz hielt ihn als das Mithridat der Republik hoch. Die Brüder De Witt mussten also gegen eine doppelte Schwierigkeit ankämpfen, nämlich gegen die Kraft der nationalen Antipathie und außerdem gegen das Gefühl der Müdigkeit, das allen Besiegten eigen ist, wenn sie hoffen, dass ein neuer Anführer sie vor dem Ruin und der Schande retten kann.
Dieser neue Anführer, der durchaus bereit war, auf der politischen Bühne aufzutreten und sich mit Ludwig XIV. zu messen, so gigantisch das Schicksal des Großmonarchen auch in der Zukunft sein mochte, war Wilhelm, Prinz von Oranien, Sohn von Wilhelm II. und Enkel von seiner Mutter Henrietta Stuart, Ehefrau von Karl I. von England. Wir haben ihn bereits als die Person erwähnt, von der die Menschen erwarteten, dass das Amt des Stadthalters wiederhergestellt würde.
Dieser junge Mann war 1672 zweiundzwanzig Jahre alt. John de Witt, der sein Tutor war, hatte ihn mit dem Ziel erzogen, ihn zu einem guten Bürger zu machen. Der Meister, der sein Land mehr liebte als seinen Schüler, hatte durch das Ewige Edikt die Hoffnung des jungen Prinzen, eines Tages Stadthalter zu werden, ausgelöscht. Aber Gott lacht über die Anmaßung des Menschen, der die Mächte auf Erden aufrichten und niederwerfen will, ohne den König oben zu konsultieren; und über die Wankelmütigkeit und Willkür der Holländer, die sich mit dem von Ludwig XIV. inspirierten Schrecken verbanden, als er das Ewige Edikt aufhob und das Amt des Stadthalters zugunsten von Wilhelm von Oranien wieder einrichtete, für den die Hand der Vorsehung auf der verborgenen Karte der Zukunft andere Schicksale vorgezeichnet hatte.
Der Ratspensionär beugte sich vor dem Willen seiner Mitbürger; Cornelius de Witt war jedoch hartnäckiger, und trotz aller Todesdrohungen des orangischen Pöbels, das ihn in seinem Haus in Dort belagerte, weigerte er sich hartnäckig, den Akt zu unterzeichnen, mit dem das Amt des Stadthalters wiederhergestellt wurde. Von den Tränen und Bitten seiner Frau bewegt, gab er schließlich nach und fügte seiner Unterschrift nur noch die beiden Buchstaben V und C (Vi Coactus) hinzu und teilte damit mit, dass er nur der Gewalt nachgegeben habe.
Es war ein wahres Wunder, dass er an diesem Tag dem für ihn vorgesehenen Schicksal entronnen ist.
John de Witt zog keinen Vorteil daraus, dass er den Wünschen seiner Mitbürger bereitwillig nachkam. Nur wenige Tage später wurde ein Versuch unternommen, ihn zu erstechen, bei dem er schwer, wenn auch nicht tödlich verwundet wurde.
Dies entsprach keineswegs den Ansichten der orangenen Fraktion. Da das Leben der beiden Brüder ein ständiges Hindernis für ihre Pläne darstellte, änderten sie ihre Taktik und versuchten, durch Verleumdung das zu erreichen, was sie mit Hilfe des Poniards nicht hatten erreichen können.
Wie selten kommt es vor, dass im richtigen Augenblick ein großer Mann gefunden wird, der die Ausführung großer und edler Pläne anführt; und aus diesem Grund ist die Geschichte, wenn eine solche glückliche Übereinstimmung der Umstände eintritt, veranlasst, den Namen des Auserwählten festzuhalten und ihn der Bewunderung der Nachwelt entgegenzuhalten. Aber wenn Satan sich in menschliche Angelegenheiten einmischt, um einen Schatten auf eine glückliche Existenz zu werfen oder ein Königreich zu stürzen, kommt es selten vor, dass er nicht an seiner Seite ein elendes Werkzeug findet, in dessen Ohr er nur ein Wort flüstern muss, um ihn sofort auf seine Aufgabe aufmerksam zu machen.
Das jämmerliche Werkzeug, das ihm zur Seite stand, um diesen heimtückischen Plan auszuführen, war ein Tyckelaer, den wir bereits erwähnt haben, ein Barbier von Beruf.
Er erhob eine Anzeige gegen Cornelius de Witt, in der er darlegte, dass dieser - wie aus den seiner Unterschrift beigefügten Briefen hervorging, bei der Aufhebung des Ewigen Ediktes vor Wut schäumte - aus Hass gegen Wilhelm von Oranien einen Attentäter angeheuert hatte, um die neue Republik von ihrem neuen Stadthalter zu befreien; und er, Tyckelaer, war die Person, die so ausgewählt wurde; aber er hatte es aus Entsetzen über die bloße Vorstellung von der Tat, die man von ihm verlangte, vorgezogen, das Verbrechen zu enthüllen, anstatt es zu begehen.
Diese Enthüllung war in der Tat gut berechnet, um einen wütenden Ausbruch in der orangenen Fraktion auszulösen. Der Generalstaatsanwalt veranlasste am 16. August 1672 die Verhaftung von Cornelius de Witt; und der edle Bruder von Johannes de Witt musste sich wie der übelste Verbrecher in einer der Wohnungen des Stadtgefängnisses den vorbereitenden Graden der Folter unterziehen, mit denen seine Richter von ihm das Geständnis seines angeblichen Komplotts gegen Wilhelm von Oranien erzwingen wollten.
Doch Cornelius besaß nicht nur einen großen Verstand, sondern auch ein großes Herz. Er gehörte zu jener Rasse von Märtyrern, die, unlösbar mit ihren politischen Überzeugungen verbunden wie ihre Vorfahren mit ihrem Glauben, in der Lage sind, unter Schmerzen zu lächeln: Auf der Streckbank liegend, rezitierte er mit fester Stimme, tastete die Zeilen nach Maß ab, die erste Strophe des "Justum ac tenacem" des Horaz, und ermüdete, ohne ein Geständnis abzulegen, nicht nur die Kraft, sondern sogar den Fanatismus seiner Henker.
Dessen ungeachtet sprachen die Richter Tyckelaer von allen Anklagepunkten frei; gleichzeitig verurteilten sie Cornelius dazu, von all seinen Ämtern und Würden abgesetzt zu werden, alle Kosten des Prozesses zu tragen und für immer vom Boden der Republik verbannt zu werden.
Dieses Urteil nicht nur gegen einen Unschuldigen, sondern auch gegen einen großen Mann war in der Tat eine gewisse Genugtuung für die Leidenschaften des Volkes, dessen Interessen Cornelius de Witt sich immer verschrieben hatte: aber, wie wir bald sehen werden, war es nicht genug.
Die Athener, die in der Tat einen recht erträglichen Ruf der Undankbarkeit hinterlassen haben, müssen in dieser Hinsicht den Niederländern den Vorrang geben. Sie begnügten sich, zumindest im Fall von Aristides, damit, ihn zu verbannen.
John de Witt hatte auf die erste Andeutung der gegen seinen Bruder erhobenen Anklage hin sein Amt als Ratspensionär niedergelegt. Auch er erhielt eine edle Belohnung für seine Hingabe an die besten Interessen seines Landes, wobei er den Hass einer Vielzahl von Feinden und die frischen Narben von Wunden, die ihm von Attentätern zugefügt worden waren, mit in den Ruhestand nahm, die nur allzu oft die einzige Bürde war, die von ehrlichen Menschen erlangt wurde, die sich schuldig gemacht haben, für ihr Land gearbeitet und ihre eigenen privaten Interessen vergessen zu haben.
In der Zwischenzeit drängte Wilhelm von Oranien mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln auf den Lauf der Dinge und wartete sehnsüchtig auf den Zeitpunkt, an dem das Volk, von dem er vergöttert wurde, aus den Leichen der Brüder die zwei Stufen hätte machen sollen, über die er auf den Stuhl des Stadthalters steigen konnte.
So drängte sich also am 20. August 1672, wie wir bereits zu Beginn dieses Kapitels festgestellt haben, die ganze Stadt zum Buytenhof, um Zeuge der Abreise von Cornelius de Witt aus dem Gefängnis zu werden, da er ins Exil ging; und um zu sehen, welche Spuren die Folter der Folterbank auf dem edlen Gestell des Mannes hinterlassen hatte, der seinen Horaz so gut kannte.
Doch all diese Schar drängte sich nicht mit dem unschuldigen Blick auf den Buytenhof, nur um sich an dem Schauspiel zu ergötzen; es gab viele, die dorthin gingen, um aktiv daran teilzunehmen und ein Amt zu übernehmen, das sie für schlecht besetzt hielten, nämlich das des Henkers.
Es gab in der Tat auch andere mit weniger feindseligen Absichten. Alles, was ihnen wichtig war, war das Spektakel, das für den Pöbel, dessen instinktiver Stolz von ihm geschmeichelt wird, immer so anziehend war - der Anblick von Größe, die in den Staub geworfen wurde.
"Ist dieser Cornelius de Witt nicht", würden sie sagen, "eingesperrt und von der Folterbank zerbrochen worden? Sollen wir ihn nicht blass sehen, blutüberströmt, von Schande bedeckt?" Und war dies nicht ein süßer Triumph für die Bürger von Den Haag, deren Neid sogar den des gemeinen Pöbels übertraf; ein Triumph, an dem jeder ehrliche Bürger und Städter teilhaben sollte?
"Außerdem", so deuteten die orangefarbenen Agitatoren an, die sich in die Menge einmischten, die sie wie ein scharfkantiges und zugleich zermalmendes Instrument zu führen hofften, -- "bietet sich nicht im übrigen vom Buytenhof bis zum Stadttor eine nette kleine Gelegenheit, ein paar Handvoll Dreck oder ein paar Steine auf diesen Cornelius de Witt zu werfen, der dem Prinzen von Oranien nicht nur die Würde des Stadthalters lediglich vi coactus verlieh, sondern der ihn auch noch ermorden lassen wollte?
"Abgesehen davon", so die erbitterten Feinde Frankreichs, "würde Cornelius, wenn die Arbeit in Den Haag gut und mutig gemacht würde, sicherlich nicht ins Exil gehen dürfen, wo er seine Intrigen mit Frankreich erneuern und mit seinem großen Schurken von einem Bruder, Johannes, auf dem Gold des Marquis de Louvois leben würde".
Bei einem solchen Temperament rennen die Menschen im Allgemeinen eher, als dass sie gehen; das war der Grund, warum die Bewohner von Den Haag so schnell zum Buytenhof eilten.
Der Schurke Tyckelaer, mit einem Herzen voller Bosheit und Böswilligkeit und ohne einen bestimmten Plan im Kopf, war einer der ersten, der von der orangenen Partei wie ein Held der Redlichkeit, der nationalen Ehre und der christlichen Nächstenliebe vorgeführt wurde.
Dieser waghalsige Schurke ging mit all den Verzierungen und Ausschmückungen, die sein niederer Geist und seine rohe Phantasie vorschlugen, auf die Versuche ein, die er vorgab, Cornelius de Witt unternommen zu haben, um ihn zu korrumpieren; auf die versprochenen Geldsummen und all die teuflischen Strategeme, die im Voraus geplant waren, um ihm, Tyckelaer, alle Schwierigkeiten auf dem Weg des Mordes zu erleichtern.
Und jede Phase seiner Rede, die von der Bevölkerung eifrig verfolgt wurde, rief enthusiastischen Jubel für den Prinzen von Oranien und Stöhnen und Verwünschungen blinder Wut gegen die Brüder De Witt hervor.
Der Pöbel begann sogar, seine Wut an den sündigen Richtern auszulassen, die einen so verabscheuungswürdigen Verbrecher wie den Schurken Cornelius so billig davonkommen ließen.
Einige der Agitatoren flüsterten: "Er wird davonkommen, er wird uns entkommen!"
Andere antworteten: "In Schevening, wartet ein französisches Schiff auf ihn. Tyckelaer hat es gesehen."
"Ehrlicher Tyckelaer! Es lebe Tyckelaer!", rief der Pöbel im Chor.
"Und lasst uns nicht vergessen", rief eine Stimme aus der Menge, "dass zur gleichen Zeit mit Cornelius auch sein Bruder Johannes, der ein ebenso schurkischer Verräter wie er selbst ist, die Flucht ergreifen wird".
"Und die beiden Schurken werden sich in Frankreich mit unserem Geld vergnügen, mit dem Geld für unsere Schiffe, unsere Arsenale und unsere Werften, die sie an Ludwig XIV. verkauft haben".
"Nun gut, dann lassen Sie nicht zu, dass wir sie abreisen lassen", riet einer der Patrioten, die den Start der anderen errungen hatten.
"Vorwärts zum Gefängnis, zum Gefängnis!", hieß es in der Menge.
Inmitten dieser Schreie rannten die Bürger immer schneller dahin, spannten ihre Musketen, schwangen das Kriegsbeil und blickten dem Tod und dem Trotz in alle Richtungen entgegen.
Bisher war jedoch noch keine Gewalt verübt worden; und die Akte der Reiter, die die Zufahrten zum Buytenhof bewachten, blieb kühl, unbewegt, schweigsam, in ihrer Unbeweglichkeit viel bedrohlicher als all diese Menge von Bürgern, mit ihren Schreien, ihrer Aufregung und ihren Drohungen. Die Männer auf ihren Pferden waren in der Tat wie Statuen unter den Augen ihres Anführeres, des Grafen Tilly, des Hauptmanns der berittenen Haager Truppen, der sein Schwert ziehen ließ, es aber mit der Spitze nach unten, in einer Linie mit den Riemen seines Steigbügels hielt.
Diese Truppe, die einzige Verteidigung des Gefängnisses, überwältigte durch ihre entschlossene Haltung nicht nur die ungeordnete aufrührerische Masse der Bevölkerung, sondern auch die Abtrennung der Bürgergarde, die, da sie gegenüber dem Buytenhof aufgestellt war, um die Soldaten bei der Aufrechterhaltung der Ordnung zu unterstützen. Die Aufrührern wagten immer wieder aufrührerischer Schreie und Rufe: "Ein Hoch auf Orange! Nieder mit den Verrätern!"
Die Anwesenheit von Tilly und seinen Reitern übte in der Tat eine heilsame Kontrolle über diese Bürgerkrieger aus; aber nach und nach wurden sie durch ihre eigenen Rufe immer wütender, und da sie nicht verstehen konnten, wie jemand Mut haben konnte, ohne ihn durch Schreie zu zeigen, schrieben sie das Schweigen der Dragoner der Kleinmütigkeit zu und rückten einen Schritt auf das Gefängnis zu, mit all dem turbulenten Mob in ihrem Gefolge.
In diesem Moment ritt Graf Tilly einhändig auf sie zu, hob nur sein Schwert und zog die Stirn zusammen, während er sich an sie wandte: "Nun, meine Herren von der Bürgerwehr, was rücken Sie vor, und was wünschen Sie sich?
Die Bürger schüttelten ihre Musketen und wiederholten ihren Schrei:"Ein Hoch auf Orange! Tod den Verrätern!"
"'Hurra auf Orange!', antwortete Tilly, "obwohl ich glücklichen Gesichtern sicherlich mehr zugetan bin als düsteren. Tod den Verrätern!' soviel davon, wie Sie wollen, solange Sie Ihre Wünsche nur durch Schreie zum Ausdruck bringen. Aber was die ernsthafte Hinrichtung betrifft, so bin ich hier, um das zu verhindern, und ich werde es verhindern.
Als er sich seinen Männern zuwandte, gab er den Befehl: "Soldaten, bereit!"
Die Soldaten gehorchten den Befehlen mit einer Präzision, die die Bürgergarde und das Volk sofort zurückweichen ließ, in einer Verwirrung, die das Lächeln des Kavallerieoffiziers erregte.
"Holloa!", rief er mit jenem scherzhaften Tonfall, der den Männern seines Berufsstandes eigen ist, aus: "Seien Sie vorsichtig, meine Herren, meine Soldaten werden keinen Schuss abfeuern; aber andererseits werden Sie keinen Schritt auf das Gefängnis zugehen".
"Und wissen Sie, Sir, dass wir Musketen haben?", brüllte der Kommandant der Bürger.
"Ich muss es wissen, bei Jupiter, Sie haben sie vor meinen Augen genug glänzen lassen; aber ich bitte Sie, auch zu beachten, dass wir auf unserer Seite Pistolen haben, die die Pistole bewundernswert bis zu einer Entfernung von fünfzig Metern trägt, und dass Sie nur fünfundzwanzig Meter von uns entfernt sind.
"Tod den Verrätern!", riefen die verärgerten Bürger.
"Geht, verschwindet. Weg mit euch", knurrte der Offizier, "ihr weint immer wieder dasselbe. Das ist sehr ermüdend."
Damit übernahm er seinen Posten an der Spitze seiner Truppen, während der Tumult um den Buytenhof immer heftiger wurde.
Und doch wusste die rauchende Menge nicht, dass in dem Augenblick, als sie die Fährte eines ihrer Opfer verfolgte, der andere, als wolle er seinem Schicksal entgegentreten, in einer Entfernung von nicht mehr als hundert Metern hinter den Menschengruppen und den Dragonern vorbeiging, um sich zum Buytenhof zu begeben.
John de Witt war in der Tat mit seinem Diener aus seiner Kutsche ausgestiegen und ging ruhig über den Hof des Gefängnisses.
Er erwähnte seinen Namen gegenüber dem Gefängniswärter, der ihn jedoch kannte, sagte er:
"Guten Morgen, Gryphos; ich komme, um meinen Bruder, der, wie Sie wissen, zum Exil verurteilt ist, mitzunehmen und aus der Stadt zu schaffen".
Daraufhin hatte ihn der Kerkermeister, eine Art Bär, der darauf trainiert war, die Tore des Gefängnisses zu ver- und entriegeln, begrüßt und in das Gebäude eingelassen, dessen Türen sofort wieder geschlossen wurden.
Zehn Meter weiter traf John de Witt ein hübsches junges Mädchen, etwa siebzehn oder achtzehn Jahre alt, gekleidet in die Nationaltracht der friesischen Frauen, die ihm mit ziemlicher Zurückhaltung eine Kuriosität entgegenwarfen. Er faßte sie unter das Kinn und sagte zu ihr: "Guten Morgen, meine gute und schöne Rosa; wie geht es meinem Bruder?"
"Oh, Mynheer John!", antwortete das junge Mädchen, "Ich habe keine Angst vor dem Schaden, der ihm zugefügt wurde. Das ist jetzt alles vorbei."
"Aber wovor fürchten Sie sich denn?"
"Ich habe Angst vor dem Schaden, den sie ihm zufügen werden."
"Oh ja", sagte De Witt, "Sie meinen die Leute da unten, nicht wahr?"
"Hören Sie sie?"
"Sie sind in der Tat in einem Zustand großer Aufregung; aber wenn sie uns sehen, werden sie vielleicht ruhiger, denn wir haben ihnen nie etwas anderes als Gutes getan.
"Das ist leider kein Grund, außer dem Gegenteil", murmelte das Mädchen, als sie sich auf ein Gebot ihres Vaters hin zurückzog.
"In der Tat, Kind, was du sagst, ist nur zu wahr."
Dann, als er seinen Weg weiterging, sagte er sich: "Hier ist eine Jungfrau, die höchstwahrscheinlich nicht lesen kann, die folglich noch nie etwas gelesen hat, und doch hat sie gerade mit einem Wort die ganze Weltgeschichte erzählt".
Und mit der gleichen ruhigen Miene, aber melancholischer, als er beim Betreten des Gefängnisses gewesen war, begab sich der Ratspensionär in die Zelle seines Bruders.
2. Die beiden Brüder
Wie die schöne Rosa mit ahnenden Zweifeln vorausgesagt hatte, so geschah es auch. Während John de Witt die schmale Wendeltreppe hinaufstieg, die zum Gefängnis seines Bruders Cornelius führte, taten die Bürger ihr Bestes, um die Truppe von Tilly, die ihnen im Wege stand, zu beseitigen.
Als der Anführer, der die lobenswerten Absichten seiner eigenen geliebten Miliz voll und ganz zu würdigen wusste, diese Gesinnung sah, rief er sehr lustvoll: "Es lebe das Bürgertum!"
Graf Tilly, der ebenso besonnen wie standhaft war, begann im Schutz der gespannten Pistolen seiner Dragoner mit den Bürgern zu verhandeln und erklärte den tapferen Bürgern, dass sein Befehl aus den Staaten ihm befehle, das Gefängnis und seine Zufahrten mit drei Kompanien zu bewachen.
"Wozu eine solche Anordnung? Warum das Gefängnis bewachen?", riefen die Orangisten.
"Halt", antwortete der Graf, "da fragen Sie mich sofort mehr, als ich Ihnen sagen kann. Man sagte mir: "Bewachen Sie das Gefängnis", und ich bewache es. Sie, meine Herren, die Sie selbst fast schon Militärs sind, sind sich bewusst, dass ein Befehl niemals missachtet werden darf.
"Aber dieser Befehl wurde Ihnen erteilt, damit die Verräter die Stadt verlassen können."
"Sehr wahrscheinlich, denn die Verräter sind zum Exil verurteilt", antwortete Tilly.
"Aber wer hat diesen Befehl gegeben?"
"Die Staaten, um sicher zu sein!"
"Die Staaten sind Verräter."
"Davon weiß ich nichts!"
"Und Sie sind selbst ein Verräter!"
"Ich?"
"Ja, du."
"Nun, was das angeht, verstehen wir uns, meine Herren. Wen soll ich verraten? Die Staaten? Ich kann sie nicht verraten, solange ich in ihrem Sold stehe und ihren Befehlen gehorche."
Da der Graf so unbestreitbar im Recht war, dass es unmöglich war, gegen ihn zu argumentieren, antwortete der Pöbel nur mit verstärktem Geschrei und schrecklichen Drohungen, denen der Graf die vollkommenste Ruhe und Würd entgegensetzte.
"Meine Herren", sagte er, "entspannen Sie Ihre Musketen aus, eine von ihnen könnte aus Versehen losgehen; und wenn der Schuss einen meiner Männer treffen sollte, sollten wir ein paar hundert von Ihren umwerfen, was uns in der Tat sehr leid tun sollte, Ihnen aber noch mehr, zumal so etwas weder von Ihnen noch von mir in Erwägung gezogen wird.
"Wenn Sie das getan haben", riefen die Bürger, "dann sollten wir Sie auch umhauen".
"Natürlich würdest du das tun; aber angenommen, du hättest jeden von uns getötet, Jack, dann wären diejenigen, die wir hätten töten sollen, nicht weniger tot".
"Dann überlassen Sie uns den Ort, und Sie werden die Rolle eines guten Bürgers übernehmen."
"Erstens", sagte der Graf, "bin ich kein Bürger, sondern ein Offizier, was eine ganz andere Sache ist; und zweitens bin ich kein Holländer, sondern ein Franzose, was noch viel anders ist. Ich habe mit niemandem zu tun außer mit den Staaten, von denen ich bezahlt werde; lassen Sie mich einen Befehl von ihnen sehen, Ihnen den Platz zu überlassen, und ich werde nur allzu gerne sofort losfahren, da ich mich hier verdammt langweilig fühle".
"Ja, ja", riefen hundert Stimmen, deren Lärm sofort von fünfhundert anderen übertönt wurde, "lasst uns zum Rathaus marschieren, lasst uns zu den Abgeordneten gehen! Kommt mit! Kommt mit!"
"Das war's", murmelte Tilly zwischen den Zähnen, als er sah, wie sich die Gewalttätigsten unter der Menge abwandten; "Geht und bittet um eine Gemeinheit im Rathaus, und Ihr werdet sehen, ob sie sie gewährt; geht, meine feinen Leute, geht!
Der würdige Offizier verließ sich auf die Ehre der Richter, die sich auf ihrer Seite auf seine Ehre als Soldat verließen.
"Ich sage, Herr Hauptmann", flüsterte der Oberleutnant dem Grafen ins Ohr, "ich hoffe, dass die Abgeordneten diesen Verrückten eine glatte Absage erteilen; aber es würde ja nicht schaden, wenn sie uns Verstärkung schicken würden".
In der Zwischenzeit hatte John de Witt, den wir nach dem Gespräch mit dem Kerkermeister Gryphus und seiner Tochter Rosa die Treppe hinaufgegangen waren, die Tür der Zelle erreicht, wo auf einer Matratze sein Bruder Cornelius lag, nachdem er die vorbereitenden Grade der Folter durchlaufen hatte. Nachdem das Urteil der Verbannung ausgesprochen worden war, gab es keinen Anlass, die Folter außergewöhnlich durchzuführen.
Cornelius lag ausgestreckt auf seiner Couch, mit gebrochenen Handgelenken und zerquetschten Fingern. Er hatte ein Verbrechen, dessen er sich nicht schuldig gemacht hatte, nicht gestanden; und nun, nach drei Tagen der Qual, atmete er wieder frei, nachdem ihm mitgeteilt worden war, dass die Richter, von denen er den Tod erwartet hatte, ihn nur ins Exil verurteilten.
Ausgestattet mit einem eisernen Gestell und einem kräftigen Herzen, wie hätte er seine Feinde enttäuscht, wenn sie in der dunklen Zelle des Buytenhofes nur sein bleiches Gesicht gesehen hätten, das vom Lächeln des Märtyrers erhellt wurde, der die Schlacken dieser Erde vergisst, nachdem er einen Blick auf die helle Herrlichkeit des Himmels erhascht hat.
Der Gefängnisdirektor hatte in der Tat bereits seine volle Kraft wiedererlangt, viel mehr durch die Kraft seines eigenen starken Willens als durch tatsächliche Hilfe; und er rechnete aus, wie lange ihn die Formalitäten des Gesetzes noch im Gefängnis festhalten würden.
Dies war genau in dem Augenblick, als die vermischten Rufe der Bürgerwehr und des Pöbels gegen die beiden Brüder wüteten und Kommandant Tilly bedrohten, der ihnen als Schutzwall diente. Dieser Lärm, der außerhalb der Gefängnismauern dröhnte, als die Brandung gegen die Felsen prallte, erreichte nun die Ohren des Gefangenen.
Aber so bedrohlich es auch klang, Cornelius schien es nicht für lohnend zu halten, sich nach der Ursache zu erkundigen; er stand auch nicht auf, um aus dem schmalen, vergitterten Fenster zu schauen, das ihm Zugang zum Licht und zum Lärm der Welt draußen gab.
Er war so in seinen nicht enden wollenden Schmerz vertieft, dass es bei ihm fast zur Gewohnheit geworden war. Er spürte mit solcher Freude, wie sich die Bande, die sein unsterbliches Wesen mit seinem vergänglichen Rahmen verbanden, allmählich lösten, dass es ihm schien, als ob sein Geist, befreit von den Fesseln des Körpers, über ihm schwebte, wie die verlöschende Flamme, die aus der halb erloschenen Glut aufsteigt.
Er dachte auch an seinen Bruder; und während dieser ihm so lebhaft vor Augen stand, öffnete sich die Tür, und Johannes trat ein, eilte zum Bett des Gefangenen, der seine gebrochenen Glieder ausstreckte und seine Hände in Bandagen gefesselt jenem glorreichen Bruder entgegen, den er nun überragte, nicht in den Diensten für das Land, sondern in dem Haß, den die Holländer ihm entgegenbrachten.
John küsste seinen Bruder zärtlich auf die Stirn und legte seine wunden Hände sanft wieder auf die Matratze.
"Cornelius, mein armer Bruder, du leidest große Schmerzen, nicht wahr?"
"Ich leide nicht mehr, seit ich dich, meinen Bruder, sehe."
"Oh, mein armer, lieber Cornelius! Ich fühle mich zutiefst betrübt, dich in diesem Zustand zu sehen."
"Und in der Tat habe ich mehr an dich gedacht als an mich selbst; und während sie mich folterten, dachte ich nie daran, mich zu beschweren, außer einmal, um zu sagen: 'Armer Bruder! Aber nun, da Sie hier sind, lassen Sie uns alles vergessen. Du kommst, um mich mitzunehmen, nicht wahr?"
"Ich komme."
"Ich bin völlig geheilt; hilf mir aufzustehen, und du wirst sehen, wie ich gehen kann."
"Du wirst nicht weit gehen müssen, denn ich habe meine Kutsche in der Nähe des Teiches, hinter Tillys Dragonern."
"Tilly's Dragoner! Wozu sind sie in der Nähe des Teiches?"
"Nun", sagte der Großpensionär mit einem melancholischen Lächeln, das er gewohnt war, "die Herren im Rathaus erwarten, dass die Leute in Den Haag Sie gerne abreisen sehen möchten, und man befürchtet einen Tumult.
"Von einem Tumult?" antwortete Cornelius und richtete seinen Blick auf seinen verwirrten Bruder; "Ein Tumult?"
"Ja, Cornelius."
"Oh! Das habe ich gerade gehört", sagte der Gefangene, als spräche er zu sich selbst. Dann drehte er sich zu seinem Bruder und fuhr fort "Sind viele Personen vor dem Gefängnis?"
"Ja, mein Bruder, die gibt es."
"Aber dann, hierher zu mir zu kommen ..."
"Nun?"
"Wie kommt es, dass sie dich durchgelassen haben?"
"Sie wissen genau, dass wir nicht sehr beliebt sind, Cornelius", sagte der Ratspensionär mit düsterer Bitterkeit. "Ich habe mir meinen Weg durch alle möglichen Nebenstraßen und Gassen gebahnt."
"Sie haben sich versteckt, John?"
"Ich wollte Sie ohne Zeitverlust erreichen, und ich tat, was die Menschen in der Politik oder auf dem Meer tun werden, wenn der Wind gegen sie bläst, - ich habe getackert".
In diesem Moment hörte man den Lärm auf dem Platz unten mit zunehmender Wut brüllen. Tilly parlierte mit den Bürgern.
"Gut, gut", sagte Cornelius, "du bist ein sehr geschickter Taktierer, John; aber ich bezweifle, dass du deinen Bruder inmitten dieses Sturms so sicher aus dem Buytenhof heraus und durch die tobende Brandung des Volkshasses führen wirst, wie du es mit der Flotte von Van Tromp an den Untiefen der Schelde vorbei nach Antwerpen getan hast".
"Mit der Hilfe Gottes, Cornelius, werden wir es wenigstens versuchen", antwortete Johannes, "aber zuerst ein Wort mit Dir".
"Sprich!"
Die Rufe begannen von neuem.
"Horch, horch!", fuhr Cornelius fort, "wie wütend diese Leute sind! Ist es gegen dich oder gegen mich?"
"Ich würde sagen, es ist gegen uns beide, Cornelius. Ich habe dir gesagt, mein lieber Bruder, dass die Orangene Partei, während sie uns mit ihren absurden Verleumdungen angreift, es auch zu einem Vorwurf gegen uns gemacht haben, dass wir mit Frankreich verhandelt haben.
"Was sind das für Dummköpfe!"
"Aber sie werfen es uns in der Tat vor."
"Und doch, wenn diese Verhandlungen erfolgreich gewesen wären, hätten sie die Niederlagen von Rees, Orsay, Wesel und Rheinberg verhindert; der Rhein wäre nicht überquert worden, und Holland könnte sich inmitten seiner Sümpfe und Kanäle immer noch als unbesiegbar betrachten.
"All dies ist durchaus wahr, mein lieber Cornelius, aber noch sicherer ist, dass, wenn in diesem Augenblick unsere Korrespondenz mit dem Marquis de Louvois entdeckt würde, einem geschickten Diplomaten wie mir, ich nicht in der Lage wäre, die zerbrechliche Barke zu retten, die die Brüder De Witt und ihr Vermögen aus Holland heraustragen soll. Diese Korrespondenz, die den ehrlichen Menschen beweisen könnte, wie sehr ich mein Land liebe und welche Opfer ich für seine Freiheit und seinen Ruhm gebracht habe, wäre unser Ruin, wenn sie in die Hände der Oranier fallen würde. Ich hoffe, Sie haben die Briefe verbrannt, bevor Sie Dort verlassen haben, um zu mir nach Den Haag zu kommen".
"Mein lieber Bruder", antwortete Cornelius, "Ihre Korrespondenz mit M. de Louvois ist ein ausreichender Beweis dafür, dass Sie in letzter Zeit der größte, großzügigste und fähigste Bürger der Sieben Vereinigten Provinzen gewesen sind. Ich freue mich über die Herrlichkeit meines Landes; und ganz besonders freue ich mich über deine Herrlichkeit, Johannes. Ich habe gut darauf geachtet, diese Korrespondenz nicht zu verbrennen".
"Dann sind wir, was dieses Leben betrifft, verloren", sagte der Ratspensionär leise und näherte sich dem Fenster.
"Nein, im Gegenteil, John, wir werden gleichzeitig unser Leben retten und unsere Popularität zurückgewinnen.
"Aber was haben Sie mit diesen Briefen gemacht?"
"Ich habe sie Cornelius van Baerle anvertraut, meinem Patensohn, den Sie kennen und der in Dort lebt.
"Armer, ehrlicher van Baerle! Der so viel weiß und doch an nichts anderes denkt als an Blumen und an Gott, der sie gemacht hat. Du hast ihm dieses tödliche Geheimnis anvertraut; es wird sein Verderben sein. Arme Seele!"
"Sein Ruin?"
"Ja, denn er wird entweder stark oder schwach sein. Wenn er stark ist, wird er, wenn er von dem hört, was uns passiert ist, sich unserer Bekanntschaft rühmen; wenn er schwach ist, wird er sich wegen seiner Verbindung zu uns fürchten: wenn er stark ist, wird er durch seine Kühnheit das Geheimnis verraten; wenn er schwach ist, wird er zulassen, dass er uns verraten wird. In beiden Fällen ist er verloren, und wir sind es auch. Verschwinden wir also, fliehen wir, solange noch Zeit bleibt".
Cornelius de Witt erhob sich auf seiner Bank und ergriff die Hand seines Bruders, der bei der Berührung seiner Leinenbinden zitterte, und antwortete: "Kenne ich meinen Patensohn nicht? Wurde ich nicht befähigt, jeden Gedanken in van Baerles Kopf und jede Empfindung in seinem Herzen zu lesen? Sie fragen, ob er stark oder schwach ist. Er ist weder das eine noch das andere; aber das ist jetzt nicht die Frage. Das Wichtigste ist, dass er das Geheimnis sicher nicht preisgeben wird, aus dem sehr guten Grund, weil er es selbst nicht kennt".
John drehte sich überrascht um.
"Sie müssen wissen, mein lieber Bruder, dass ich in der Schule dieses bedeutenden Politikers John de Witt ausgebildet wurde; und ich wiederhole Ihnen gegenüber, dass van Baerle sich der Art und der Bedeutung des Depots, das ich ihm anvertraut habe, nicht bewusst ist.
"Dann schnell", rief John, "da noch Zeit bleibt, übermitteln wir ihm die Anweisung, das Paket zu verbrennen".
"Durch wen?"
"Durch meinen Diener Craeke, der uns auf dem Pferd begleiten sollte und der mit mir das Gefängnis betreten hat, um Ihnen unten zu helfen.
"Überleg es dir gut, bevor du diese wertvollen Dokumente verbrennen lässt, John!"
"Ich denke vor allem daran, dass die Brüder De Witt unbedingt ihr Leben retten müssen, um ihren Charakter retten zu können. Wenn wir tot sind, wer wird uns dann verteidigen? Wer wird unsere Absichten vollständig verstanden haben?"
"Sie erwarten also, dass sie uns töten würden, wenn diese Papiere gefunden würden?"
John zeigte, ohne zu antworten, mit der Hand auf den Platz, von wo aus sich in diesem Augenblick heftige Rufe und wilde Schreie erhob.
"Ja, ja", sagte Cornelius, "ich höre diese Rufe sehr deutlich, aber was bedeuten sie?"
Johannes öffnete das Fenster.
"Tod den Verrätern!", schrie die Bevölkerung.
"Hören Sie jetzt, Cornelius?"
"Zu den Verrätern, das heißt zu uns", sagte der Gefangene, hob die Augen zum Himmel und zuckte mit den Schultern.
"Ja, er meint uns", wiederholte Johannes.
"Wo ist Craeke?"
"An der Tür Ihrer Zelle, nehme ich an."
"Dann soll er eintreten."
Johannes öffnete die Tür; der treue Diener wartete auf der Schwelle.
"Kommen Sie herein, Craeke, und überlegen Sie gut, was mein Bruder Ihnen sagen wird."
"Nein, John; es wird nicht ausreichen, eine mündliche Botschaft zu senden; leider werde ich gezwungen sein, zu schreiben."
"Und warum das?"
"Weil Van Baerle das Paket weder aufgeben noch verbrennen wird, ohne einen besonderen Befehl dazu zu erteilen."
"Aber werden Sie schreiben können, der arme alte Kerl?" fragte John mit einem Blick auf die versengten und geprellten Hände des unglücklichen Leidenden.
"Wenn ich Feder und Tinte hätte, würdest du es bald sehen", sagte Cornelius.
"Hier ist auf jeden Fall ein Bleistift."
"Haben Sie Papier? Denn sie haben mir nichts gelassen."
"Hier, nimm diese Bibel und reiß das leere Blatt heraus."
"Sehr gut, das wird reichen."
"Aber Ihre Schrift wird unleserlich sein."
"Lass mich damit in Ruhe", sagte Cornelius. "Die Henker haben mich in der Tat schlimm genug gezwickt, aber meine Hand wird nicht ein einziges Mal zittern, wenn ich die wenigen erforderlichen Zeilen nachzeichne".
Und tatsächlich nahm Cornelius den Bleistift und begann zu schreiben, als durch die weißen Leinenbinden Blutstropfen austraten, die der Druck der Finger gegen den Bleistift aus dem rohen Fleisch drückte.
Ein kalter Schweiss stand auf der Stirn des Ratspensionärs.
Cornelius schrieb: "Mein lieber Patensohn,...
Verbrennen Sie das Paket, das ich Ihnen anvertraut habe. Verbrennen Sie es, ohne es anzuschauen und ohne es zu öffnen, damit sein Inhalt Ihnen für immer unbekannt bleibt. Geheimnisse dieser Beschreibung sind der Tod für diejenigen, bei denen sie deponiert sind. Verbrennen Sie es, und Sie werden Johannes und Cornelius de Witt gerettet haben.
Lebt wohl, und liebt mich.
Cornelius de Witt.
"20. August 1672."
Johannes wischte mit Tränen in den Augen einen Tropfen des edlen Blutes ab, das das Blatt beschmutzt hatte, und kehrte, nachdem er die Botschaft mit einer letzten Anweisung an Craeke übergeben hatte, zu Cornelius zurück, der von heftigen Schmerzen überwältigt und fast ohnmächtig zu werden schien.
"Nun", sagte er, "wenn der ehrliche Craeke das Pfeifen seines Steuermanns erklingen lässt, wird dies ein Signal dafür sein, dass er sich von der Menge entfernt und die andere Seite des Teiches erreicht hat. Und dann sind wir an der Reihe, aufzubrechen."
Fünf Minuten waren noch nicht verstrichen, als ein langer, schriller Pfiff durch das Getöse und den Lärm auf dem Platz des Buytenhofes ertönte.
Johannes erhob dankbar seine Augen zum Himmel.
"Und jetzt", sagte er, "lass uns gehen, Cornelius."
3. Der Schüler von Johannes de Witt
Während das Geschrei der Menge auf dem Platz des Buytenhofes, das immer bedrohlicher gegen die beiden Brüder wurde, John de Witt dazu veranlasste, die Abreise seines Bruders Cornelius zu beschleunigen, war eine Bürgerdelegation zum Rathaus gegangen, um den Abzug von Tillys Dragonern zu fordern.
Es war nicht weit vom Buytenhof bis zur Hoogstraet (High Street); und ein Fremder, der seit Beginn dieser Szene alle Vorfälle mit intensivem Interesse verfolgt hatte, wurde gesehen, wie er mit oder vielmehr im Gefolge der anderen zum Rathaus ging, um so bald wie möglich die aktuellen Nachrichten der Stunde zu hören.
Dieser Fremde war ein sehr junger Mann, kaum zweiundzwanzig oder drei Jahre alt, und er hatte nichts an sich, was eine große Energie an den Tag legte. Offensichtlich hatte er gute Gründe, sich nicht zu erkennen zu geben, denn er versteckte sein Gesicht in einem Taschentuch aus feinem friesischem Leinen, mit dem er sich unaufhörlich die Stirn oder die brennenden Lippen abwischte.
Mit einem scharfen Auge wie ein Raubvogel, mit einer langen, adlernen Nase, einem fein geschnittenen Mund, den er im allgemeinen offen hielt, oder besser gesagt, der wie die Ränder einer Wunde klaffte, - hätte dieser Mann Lavater, wenn Lavater zu dieser Zeit gelebt hätte, ein Thema für physiognomische Beobachtungen vorgelegt, das für die betreffende Person beim ersten Erröten nicht sehr günstig gewesen wäre.
"Welchen Unterschied gibt es zwischen der Figur des Eroberers und der des Piraten", sagten die Alten. Der Unterschied nur zwischen dem Adler und dem Geier, - Gelassenheit oder Unruhe.
Und in der Tat waren die fahle Physiognomie, der dünne und kränkliche Körper und das Herumstreunen des Fremden genau der Typus eines verdächtigen Herrn oder eines unruhigen Diebes; und ein Polizist hätte sich aufgrund der großen Sorgfalt, mit der sich die geheimnisvolle Person offensichtlich versteckte, sicherlich für die letztere Vermutung entschieden.
Er war schlicht gekleidet und offenbar unbewaffnet; sein Arm war schlank, aber drahtig, und seine Hände trocken, aber von aristokratischer Weiße und Zartheit, und er lehnte sich auf die Schulter eines Offiziers, der mit der Hand auf seinem Schwert die Szenen im Buytenhof mit einer für einen Militärangehörigen sehr natürlichen Neugierde beobachtet hatte, bis ihn sein Begleiter mit sich fortgezogen hatte.
Auf dem Platz der Hoogstraet angekommen, schob der Mann mit dem gelblichen Gesicht den anderen hinter einen offenen Fensterladen, aus dessen Ecke er selbst begann, den Balkon des Rathauses zu überblicken.
Unter dem wilden Geschrei des Pöbels öffnete sich das Fenster des Rathauses, und ein Mann trat hervor, um sich an die Leute zu wenden.
"Wer ist das da auf dem Balkon?", fragte der junge Mann und warf dem Redner einen Blick zu.
"Es ist der Stellvertreter Bowelt", antwortete der Offizier.
"Was ist das für ein Mann? Wissen Sie etwas über ihn?"
"Ein ehrlicher Mann, zumindest glaube ich das, Monseigneur."
Als der junge Mann diesen Charakter von Bowelt hörte, zeigte er Anzeichen einer so seltsamen Enttäuschung und offensichtlichen Unzufriedenheit, dass der Offizier nicht umhin konnte, dies zu bemerken, und fügte daher hinzu, "zumindest sagt man das, Monseigneur. Ich selbst kann dazu nichts sagen, da ich keine persönliche Bekanntschaft mit Mynheer Bowelt habe."
"Ein ehrlicher Mann", wiederholte derjenige, der mit Monseigneur angesprochen wurde; "wollen Sie damit sagen, dass er ein ehrlicher Mann (brave homme) oder ein tapferer Mann (homme brave) ist?
"Ah, Monseigneur muss mich entschuldigen; ich würde mir nicht anmaßen, eine solch feine Unterscheidung bei einem Mann zu treffen, den ich, das versichere ich Eurer Hoheit nochmals, nur vom Sehen her kenne".
"Wenn dieser Bowelt ein ehrlicher Mann ist", fuhr seine Hoheit fort, "wird er der Forderung dieser schreienden Bittsteller einen sehr eigenartigen Empfang bereiten.
Das nervöse Zittern seiner Hand, die sich auf der Schulter seines Gefährten bewegte wie die Finger eines Spielers auf den Tasten eines Cembalos, verriet seine brennende Ungeduld, die zu bestimmten Zeiten und besonders in diesem Moment unter dem eisigen und düsteren Ausdruck seines Gesichts so schlecht verborgen war.
Daraufhin hörte man den Chef der Bürgerdelegation, wie er eine Interpellation an Mynheer Bowelt richtete, den er bat, ihnen mitzuteilen, wo die anderen Abgeordneten, seine Kollegen, seien.
"Gentlemen", wiederholte Bowelt zum zweiten Mal, "ich versichere Ihnen, dass ich in diesem Augenblick hier allein mit Mynheer d'Asperen bin und keine Resolution auf meine eigene Verantwortung annehmen kann.
"Die Ordnung! Wir wollen die Ordnung!", riefen mehrere tausend Stimmen.
Mynheer Bowelt wünschte zu sprechen, aber seine Worte wurden nicht gehört, und man sah nur, wie er seine Arme in allen möglichen Gesten bewegte, was deutlich zeigte, dass er seine Lage als verzweifelt empfand. Als er schließlich sah, dass er sich nicht Gehör verschaffen konnte, drehte er sich zum offenen Fenster um und rief Mynheer d'Asperen.
Der letztgenannte Herr erschien nun auf dem Balkon, wo er mit noch energischeren Rufen begrüßt wurde als die Rufe, mit denen sein Kollege zehn Minuten zuvor empfangen worden war.
Dies hinderte ihn nicht daran, die schwierige Aufgabe der Belästigung des Pöbels zu übernehmen; aber der Pöbel zog es vor, die Garde der Staaten - die jedoch dem souveränen Volk keinen Widerstand leistete - dazu zu zwingen, der Rede von Mynheer d'Asperen zuzuhören.
"Nun denn", bemerkte der junge Mann kühl, während die Menge durch das Haupttor des Rathauses stürmte, "es scheint, dass die Frage drinnen diskutiert werden wird, Herr Hauptmann. Kommen Sie, und lassen Sie uns die Debatte hören."
"Oh, Monseigneur! Monseigneur! Passen Sie auf sich auf!"
"Vor was?
"Unter diesen Abgeordneten gibt es viele, die mit Ihnen zu tun hatten, und es würde genügen, dass einer von ihnen Eure Hoheit anerkennt."
"Ja, dass man mich beschuldigen könnte, der Anstifter all dieser Arbeit gewesen zu sein, in der Tat, Sie haben Recht", sagte der junge Mann und errötete einen Moment lang vor Bedauern, so viel Eifer verraten zu haben. "Von diesem Ort aus werden wir sie mit oder ohne den Befehl zum Rückzug der Dragoner zurückkehren sehen, dann können wir beurteilen, was größer ist, Mynheer Bowelts Ehrlichkeit oder seinen Mut".
"Aber", antwortete der Offizier und blickte mit Erstaunen auf die Persönlichkeit, die er als Monseigneur ansprach, "aber Eure Hoheit nimmt sicher nicht einen Moment lang an, dass die Abgeordneten Tillys Dragonern befehlen werden, ihren Posten aufzugeben?
"Warum nicht?", erwiderte der junge Mann leise.
"Weil das einfach nur die Unterzeichnung des Todesurteils von Cornelius und John de Witt wäre."
"Wir werden sehen", antwortete seine Hoheit mit der vollkommensten Gelassenheit; "Gott allein weiß, was in den Herzen der Menschen vorgeht.
Der Offizier blickte fragend auf die gefühllose Gestalt seines Gefährten und wurde blass: Er war sowohl ein ehrlicher als auch ein tapferer Mann.





























