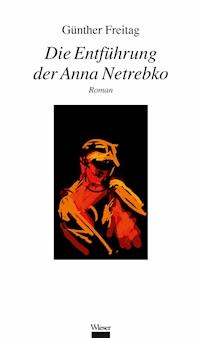Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wieser Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau zwischen zwei Männern, und doch keine Dreiecksgeschichte im herkömmlichen Sinn. Dora und Edwin, Billeteure im linken Parkett des Burgtheaters, in dem ihrer Meinung nach die wahren Kenner sitzen, sehen ihre Aufgabe nicht darin, die Besucher zu ihren Plätzen zu geleiten, sondern ihnen die Stücke zu erläutern. Während Edwin sich ausschließlich auf die Kunst konzentriert und nur durch seine Mutter mit ihrem neurotischen Papagei gestört wird, führt Dora mit dem Versicherungsagenten Viktor ein Leben neben dem Theater. Die beiden Männer ahnen nichts voneinander; was die Protagonisten verbindet, ist ihre problematische Jugend, geprägt durch Vaterfiguren, autoritär und lächerlich zugleich. Befreit die Kunst sie von ihren Erinnerungen, oder bleibt sie eine Illusion wie die Auftritte der gescheiterten Opernsängerin, der bei ihrem Debüt die Stimme versagte, und die Bemühungen des Bildhauers, dessen Skulptur "Weltdummheit" von der Realität überholt wird? Ist die Kunst vielleicht nur eine Täuschung, wie für den Juwelier, dem von seinem Vater verboten wurde, sich am Reinhardt-Seminar zu bewerben?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GÜNTHER FREITAG
Melancholische Billeteure
Roman
Die Herausgabe dieses Buches erfolgtemit freundlicher Unterstützung durch das Land Kärnten,das Land Vorarlberg, das Land Steiermark und die Stadt Graz.
A-9020 Klagenfurt/Celovec, 8.-Mai-Straße 12Tel. + 43(0)463 370 36, Fax + 43(0)463 376 [email protected]
Copyright © dieser Ausgabe 2017 bei Wieser Verlag GmbH,Klagenfurt/CelovecAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Gerhard MaierhoferISBN 978-3-99029-255-6eISBN 978-3-99047-089-3
Inhalt
EDWIN
DORA
VIKTOR
EDWIN
DORA
VIKTOR
EDWIN
DORA
VIKTOR
EDWIN
DORA
VIKTOR
EDWIN
DORA
VIKTOR
EDWIN
DORA
VIKTOR
EDWIN
DORA
VIKTOR
EDWIN
DORA
VIKTOR
EDWIN
DORA
VIKTOR
EDWIN
… auf dem Weg zu Sophie, die ich schon als Kind so nannte, weil mir von ihr verboten wurde, sie Mama zu rufen, überfällt mich jedes Mal, je näher ich ihrer Wohnung komme, ein Schüttelfrost. Wie bei einer schweren Grippe beutelt er meinen Körper durch. Das müssen alle Menschen bemerken, die mich zufällig ansehen, und werden Vermutungen über mich und meine Verfassung anstellen. Dabei kommt nichts Schmeichelhaftes für mich heraus, denn sie werden meinen, ich sei ein Verrückter, dem man besser aus dem Weg geht. Einer, bei dem man nicht sicher sein kann, dass er nicht im nächsten Augenblick eine Waffe aus seiner Jacke zieht und schießt, zusticht, vielleicht auf sie einschlägt mit einem Totschläger oder einem Schlagring. In Sekundenschnelle werden ihnen Nachrichtenbilder durch den Kopf schwirren von Terroristen, Selbstmordattentätern, Amokläufern, auch wenn es in unserer Stadt schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten keinen Terroranschlag gegeben hat und die meisten Tötungsdelikte Familientragödien oder Beziehungstaten sind. Aber an die Statistiken werden die Passanten nicht denken, wenn ich blass und durchgeschüttelt auf sie zukomme, sondern nur an den großen Bogen, den sie um mich machen müssen, damit ihr Leben nicht in Gefahr gerät. Die wenigen, die bei meinem Anblick eine Behinderung oder schwere Krankheit vermuten, Parkinson vielleicht, sehen zu Boden, an mir vorbei oder tun, als würden sie die Waren in den Auslagen betrachten, was noch verlogener ist als wegzuschauen. Manche fürchten wohl, ich könnte sie um Geld bitten, meine Krankheit sei nur gespielt und ich ein Betrüger, wie man ihn in jeder U-Bahn-Station trifft. Ein dilettantischer Armutsdarsteller auf der Innenstadtlaienbühne, einer, den seine slowakischen Ausbeuter frühmorgens losschicken, um ihm am Abend den Großteil des Erbettelten abzunehmen. Immer neue Tricks lassen die sich einfallen, habe ich in einer Gratiszeitung gelesen, manche von ihnen seien in der Lage, obwohl körperlich vollkommen unversehrt, den Einbeinigen, Blinden, Taubstummen oder Traumatisierten zu spielen, der in kaum verstehbaren Satzbrocken von Kriegen, Raketenangriffen und Folter berichtet. Es ist nicht notwendig, dass er verstanden wird, da die Menschen zwischen ihm und den Fernsehbildern aus den Krisengebieten eine Verbindung herstellen und Geld in seine Dose werfen. Sophie würde sie alle wegsperren, arbeitsscheues Gesindel nennt sie die Bettelschauspieler, manchmal auch Armutsschmierenkomödianten, und klingt dann wie die rechten Politiker, was ihr nicht auffällt, obwohl sie die verachtet. Sie verachtet alle Politiker, die linken, die liberalen und besonders die konservativen, die sich ihrer Meinung nach gemäßigt nennen, weil sie alle Grundsätze aufgegeben hätten und nur darauf hofften, von einer der anderen Parteien an der Regierungslaienbühne beteiligt zu werden …
… länger als eine Stunde dauert der Fußmarsch von meiner Wohnung in der Sechshauserstraße zu Sophies Loft in der Herrengasse, in dem sie seit Vaters Tod vor über dreißig Jahren allein lebt. Bei ihr einzuziehen hat sie mir nie angeboten, auch damals nicht, als ich mein Studium nach vierundzwanzig erfolglosen Semestern abgebrochen und mich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser gehalten habe. Kein Besuch vergeht, ohne dass Sophie über meine Kellerwohnung in der Sechshauserstraße lästert. Wie kann ein Mensch in so einem Loch leben?, fragt sie, obwohl sie nie bei mir gewesen ist und den ersten Bezirk nur selten verlässt. Außerhalb der Ringstraße, die den ersten Bezirk umgrenzt, lebten nur zwielichtige Figuren, behauptet sie, jenseits des Gürtels, wo auch die Sechshauserstraße beginnt, bloß Verbrecher. Im fünfzehnten Bezirk herrsche wegen des überdurchschnittlichen Ausländeranteils eine babylonische Sprachverwirrung; werde deutsch gesprochen, sei das Gestammle nicht mehr zu verstehen. Wie hältst du es in dieser Gegend aus?, fragt sie. Aber nicht aus Mitgefühl, sondern um mich zu demütigen. Dein Vater war Sektionschef im Verteidigungsministerium, und du Versager schleppst Gemüsekisten über den Naschmarkt. Begreifst du denn nicht, dass du dadurch seine Totenruhe störst? Sagt sie nicht dein Vater, spricht sie vom Sektionschef. Der war die rechte Hand des Ministers und erschoss sich aus Loyalität am Tag nach dem Politikerselbstmord. Mit einer Pistole desselben Fabrikats wie sein Vorgesetzter. Kein Wort über die dubiosen Waffengeschäfte, in die der Minister und der Vater verwickelt waren. Mit dem Gewinn kaufte er wahrscheinlich das Loft, auf das Sophie so stolz ist. Noch habe ich den Gürtel nicht erreicht und zittere, als wäre ich bereits im ersten Bezirk angekommen. Wohl deshalb, versuche ich mich zu beruhigen, weil ich an den Vater gedacht habe und an die Artikel in den Zeitungen, die Sophie als haltloses Gewäsch abtat. Alle Journalisten hält sie für ungebildetes Pack, das Papier mit Lügen vollschmiert, in welches am nächsten Morgen stinkende Fische und angefaulte Salatköpfe eingeschlagen werden …
… dass ich Rechtswissenschaften studieren würde, stand für den Vater schon vor meiner Einschulung fest. Das sei Familientradition, hörte ich bereits, als ich mit dem Wort noch nichts anzufangen wusste. Dass es etwas Bedeutendes bezeichnete, ahnte ich und war wohl auch ein wenig stolz in meiner Kinderblödheit, weil ich eine Tradition hatte, während die übrigen Kindergartenzwerge bloß Spielzeugautos oder Indianerkostüme besaßen und das Wort Rechtswissenschaften nicht einmal aussprechen konnten. Oft redete der Vater damals über seinen Vater, der in einer Trinkerheilstätte dahinvegetierte und keinen Menschen wiedererkannte. Nicht einmal seinen eigenen Sohn, obwohl der ihn regelmäßig besuchte und auch dann noch zu ihm aufsah, als er nur mehr lallen konnte und kein einziges Wort herausbrachte. Herr Bezirkshauptmann nannte er seinen Vater, was ich mir nicht erklären konnte. Heute vermute ich, dass er ihn deshalb so ansprach, weil er hoffte, der Kranke würde sich an das Leben vor dem Sanatorium erinnern und in die Wirklichkeit zurückkehren. Bezirkshauptmann – Sektionschef – Minister war wohl der Plan, den Vater verfolgte, um die Familientradition hochzuhalten. Hätte ich einen Sohn, müsste der Kanzler und sein Sohn Bundespräsident werden. Sonderbar war, dass die Familientradition nur für die Söhne galt; die Töchter durften ihre Berufe selbst wählen. Wie Tante Irene, Vaters jüngere Schwester, die sich zur Kunst berufen fühlte, was Sophie in einem ironischen Tonfall erzählte. Malerin wollte sie werden wie die von ihr bewunderte Maria Lassnig. Die male Menschen so, wie sie ihre Familie sehe, zerstört, verletzt und verletzbar, deformiert. Und das mit einem Lächeln, mit einem lächelnden Pinsel, soll sie gesagt haben, aber das ist wahrscheinlich eine von Sophies bösartigen Unterstellungen. Nachdem sie es nicht an die Akademie geschafft hatte, verging Irene das Lachen, und sie landete als Handarbeitslehrerin in einer Dorfschule. Tagsüber mühte sie sich mit Schülern ab, die noch weniger begabt waren als sie, berichtete Sophie, in der Nacht malte sie in einer ungeheizten Scheune, ihrem Atelier, an den deformierten Menschenbildern. Hunderte halbfertige Bilder fanden die Polizisten, nachdem sie sich ihr Scheitern eingestanden und die Pulsadern aufgeschnitten hatte. Wenigstens das hat sie richtig gemacht, erfuhr ich von Sophie, die ihren Bericht mit dem Rat beendete, wenn ich mir einmal die Pulsadern öffnen wolle, müsse ich das in vertikaler und nicht in horizontaler Richtung tun, um sicher zu sein, dass mein Vorhaben gelinge, also von oben nach unten und nicht quer, präzisierte sie, so, wie es Irene gemacht habe. Der Vater erwähnte Irene nie, für ihn war sie schon vor ihrem Selbstmord tot. Wenigstens Ärztin hätte sie werden können, meinte Sophie, als ich wieder einmal ihre Geschichte hören wollte. Ärztin wäre etwas gewesen, aber Handarbeitslehrerin in einem Kuhdorf an der slowenischen Grenze sei geschmacklos. Als Kind interessierte mich nicht, dass sie mit ihrer Malerei gescheitert war, ich wollte immer nur die Beschreibung der geöffneten Pulsadern hören und dass sie sich zum Sterben auf eine grundierte Leinwand gelegt hatte, auf der ihr Blut zerfloss, was Sophie bald herausfand und nicht mehr über Irene sprach, sondern bloß noch über meine blutrünstige Fantasie. Dann stellte sie Fragen, scheinbar für sie selbst bestimmt, aber natürlich hörte ich sie und wurde mir selbst unheimlich, wenn sie vermutete, in mir stecke, wenn ich mich so sehr für Blut und Sterben interessierte, vielleicht ein Mörder. In der Schule war ich einer der Schwächsten, nun traute mir Sophie einen Mord zu. Nachdem ich mich ein paar Tage lang wie ein Aussätziger gefühlt hatte, gefiel mir der Gedanke, ich würde über Leben und Tod entscheiden. So kam ich auf das Fliegenexperiment. Ich wollte herausfinden, ob ich tatsächlich fähig war zu töten. Mit einem Geschirrtuch schlug ich nach Stubenfliegen, die auf den Scheiben saßen. Lagen sie dann benommen auf dem Boden, unfähig zu fliehen, drückte ich sie mit dem Daumen platt. Bald schon langweilte mich das, weil ich dachte, das Fliegenexperiment lasse keine Rückschlüsse auf meine Fähigkeit zu. Die lästigen Tiere zu töten, sah ich nicht als Mordübung, sondern als Reinigungsarbeit, hatte ich doch im Unterricht gelernt, dass durch sie Krankheiten übertragen werden. Ich erweiterte mein Übungsfeld und suchte im Freien nach Käfern, mit denen ich auf ähnliche Weise wie mit den Fliegen verfuhr. Sie zu stellen war leichter, weshalb ich weitaus mehr von ihnen erledigte, und es wirkte echter, denn die Käfer starben mit einem deutlich hörbaren Knacken, während die Fliegen lautlos verendeten. Auch an ihnen verlor ich rasch das Interesse und spielte mit dem Gedanken, meine Fähigkeit an größeren Tieren auszuprobieren, an der Nachbarskatze oder dem Hund des Hausbesorgers. Die mit bloßen Händen zu töten, konnte ich mir nicht vorstellen, dazu fehlte mir die Kraft. Ich hätte eine Waffe benötigt, an die kam ich aber nicht heran, weil der Vater seine Jagdgewehre und die Dienstpistole in einem Tresor verschlossen hielt. Vielleicht steckt doch kein Mörder in mir, dachte ich, nachdem ich auch das Käferexperiment abgebrochen hatte, das nicht völlig erfolglos war, denn zum ersten Mal wehrte ich mich in der Schule gegen die Angriffe der Mitschüler, die sich rasch ein anderes Opfer suchten …
… bis heute leugnet Sophie den Selbstmord des Vaters, sie beharrt darauf, er habe sich nicht wie sein Minister erschossen, sondern sei das Opfer eines tragischen Unfalls. Beim Test einer neuen Waffe während eines Manövers, behauptet sie. Aus ungeklärten Gründen habe sich ein Schuss gelöst und den Vater tödlich in den Kopf getroffen. Lange habe ich ihr diese Lügengeschichte abgenommen, später jedoch herausgefunden, dass zu der Zeit gar kein Manöver stattfand und es sich bei der Pistole um ein altes Modell handelte. Selbstmord sei ein Zeichen von Schwäche und der Sektionschef alles andere als ein Schwächling gewesen. Wenn er in seiner Uniform auf das Ministerium zugegangen sei, hätten die Beine der Wachsoldaten zu zittern begonnen und sie gefürchtet, der Sektionschef würde etwas an ihrer Haltung auszusetzen haben, ihnen vielleicht für Wochen den Urlaub streichen. War er bei seiner Heimkehr gut gelaunt, erzählte der Vater manchmal vom Beinzittern der jungen Soldaten, auch dass er besonders langsam gegangen sei, um die Waschlappen länger zappeln zu lassen, lachte und ließ seine Faust auf die Tischplatte knallen, sodass Teller und Gläser Mazurken tanzten. Ich fürchtete diese Heiterkeitsausbrüche, weil sie immer damit endeten, dass er mich mit den zitternden Muttersöhnchen in Uniform verglich. Dann nörgelte er an meiner Haltung herum, kritisierte meine Leistungen in der Schule oder dass ich meine Hemdknöpfe nicht korrekt geschlossen hatte. Einen verweichlichten Hosenscheißer nannte er mich; fand er auf den ersten Blick keinen Grund zu Kritik, musste mein Gesichtsausdruck, mein verwaschenes Mienenspiel, herhalten, dem es an Entschlossenheit fehle, was für meine weitere Entwicklung das Schlimmste befürchten lasse. Dass Sophie nach solchen Szenen immer versprach, mein Auftreten in seinem Sinn zu verbessern, störte mich mehr als seine Beschimpfungen, die ich ja auswendig kannte, weil mich der Vater bei seinen Ausbrüchen in einer militärisch verknappten Sprache anherrschte, wie er überhaupt für alle Situationen einen Satz oder auch bloß ein Wort bereithielt, um sie einzuschätzen. Meist war darin schon eine Anweisung verpackt, wie Sophie oder ich uns zu verhalten hatten …
… zum Glück musste der Sektionschef dein Scheitern nicht mehr erleben, das hätte ihn umgebracht, das Malheur beim Manöver hat dich davor bewahrt, zum Mörder zu werden. Hätte er dich am Naschmarkt beim Kistenschleppen entdeckt, wäre er sofort zur nächsten U-Bahn-Station gelaufen und vor einen einfahrenden Zug gesprungen. Kartenabreißer ist zwar weniger vulgär, aber auch eine Peinlichkeit, die er nicht ertragen hätte. Billeteur, werfe ich ein, ich bin Billeteur im Burgtheater und nicht Kartenabreißer bei einer Geisterbahn im Prater. Was daran peinlich sei, frage ich, obwohl ich ihre Antwort kenne. Ließe ich sie zu Wort kommen, würde sie alles sagen, aber dazu gebe ich ihr keine Gelegenheit und rede über die Bedeutung des Burgtheaters, an das ich zur selben Zeit wie Peymann gekommen bin. Mit uns habe eine neue Ära begonnen, sage ich. Würdest du einmal ins Theater gehen und nicht Abend für Abend vor deinem Fernseher hocken, hättest du gesehen, dass ich für die teuersten Plätze im linken Parkett verantwortlich bin. Ich war vom Beginn an im Parkett und musste mich nicht wie meine Kollegin Dora vom zweiten Rang über den Balkon ins Parkett hochdienen. Da gab es am Anfang Eifersüchteleien, aber Peymann bestand gegen alle Widerstände darauf, dass ich im linken Parkett eingesetzt wurde, weil dort die Theater-kenner sitzen. Alle wirklichen Theaterfreunde haben ihre Plätze im linken Parkett, während rechts die Angeber und Ahnungslosen hocken, die nur ins Theater gehen, um gesehen zu werden, und, nachdem sich der Vorhang gehoben hat, auf die Pause und nach ihr auf den Schlussapplaus warten, in dem sie sich zur Garderobe davonstehlen, um dort nicht warten zu müssen. Im linken Parkett herrscht die größte Aufmerksamkeit, während rechts oft ganze Reihen einschlafen und die Aufführung durch ihr widerliches Schnarchen und Schnaufen stören. Selbstverständlich hätten die Schauspieler das längst herausgefunden und spielten für die von ihnen aus gesehen rechte Saalhälfte. Voss soll einmal auf einer Premierenfeier gesagt haben, dass er im Halbdunkel keine Menschen, sondern nur die roten Sitzpolsterungen sehe, wenn er in die linke Saalhälfte schaue. Das behauptet Dora, aber vielleicht hat sie diese Anekdote bloß erfunden, um ihre Verachtung für das rechte Parkett durch eine Berühmtheit zu untermauern. Tatsächlich?, fragte ich, als sie mir die Geschichte zum ersten Mal erzählte, und sah dabei wohl so ungläubig drein, dass sie nachlegte, nicht nur Voss denke so, auch Kirchner, Dene oder Meyerhoff dächten wie sie. Worauf ich Dora beruhigte, es sei nicht notwendig, mich von ihrer Meinung über die Besucher in der rechten Saalhälfte zu überzeugen, denn die seien mir ebenso zuwider wie ihr …
… über Dora würde Sophie gern mehr erfahren, bemerkte ich, als ich sie einmal nebenher erwähnte. Was ist diese Dora für ein Mensch?, fragte Sophie scheinheilig, und mir war sofort klar, dass sie herausfinden wollte, ob zwischen mir und meiner Kollegin etwas lief, was sie aber entrüstet zurückwies, als ich ihr das vorwarf. Ich dächte über sie immer schlecht, stellte sie beleidigt fest, es sei doch klar, dass sich eine Mutter für die Lebensumstände ihres Sohnes interessiere, weshalb ich sie verärgert unterbrach. Du kennst meine Lebensumstände in der Sechshauserstraße, sagte ich, das muss genügen. Ich frage dich ja auch nicht nach deinen Bridgepartnern. In einem weinerlichen Tonfall beklagte sie, dass sie seit Jahren nicht mehr zum Bridge gehe und ich das nicht einmal bemerkt hätte. Weil du nur an dich denkst und ich dich nicht interessiere. Wahrscheinlich wäre es mir am liebsten, sie würde tot umfallen und ich in ihr Loft ziehen, aber das könne ich mir abschminken, so weit werde sie es nicht kommen lassen. Keine ruhige Minute fände sie in ihrem Grab, wüsste sie, dass ich mich in ihrer Wohnung breitmachte, vielleicht sogar mit dieser Dora, über die sie nichts wisse. Ihr Loft werde sie dem Tierschutzverein vermachen, flüsterte sie und beschäftigte sich nur noch mit Albin, der auf einer Stange in seinem riesigen Messingkäfig hockte und mich herablassend fixierte. Sophie behauptet, der Graupapagei spreche den ganzen Tag mit ihr, was ich mir nicht vorstellen kann, denn komme ich in den Raum, krächzt er Unverständliches und verstummt. Er nennt dich Versager, behauptet Sophie, weil mich Albin schon bei meinem ersten Besuch durchschaut habe, was sie nicht überrasche, denn die Intelligenz der afrikanischen Graupapageien sei legendär. Das fehlte noch, sagte sie zu Albin gewandt, dass dieser Versager nach Frauchens Tod seine Dora anschleppt, das werden wir nicht zulassen, mein Liebling. Wegen dieses Platzanweisers musst du dir keine Sorgen machen, für dich wird gesorgt sein, selbst wenn du vierzig oder fünfzig Jahre lebst, dieser Kartenabreißer wird dein Erbe nicht mit seiner Dora verprassen. Die beiden gehören in die Sechshauserstraße, schon innerhalb des Gürtels würden sie wie Fremdkörper wirken, und den Ring überqueren sie ohnehin nur, um Programmhefte zu verkaufen und die Theaterbesucher zu ihren Plätzen zu führen, was nicht bloß eine lächerliche, sondern auch eine unnötige Tätigkeit ist, denn wer sich ein Theaterstück ansieht, wird doch wohl dazu fähig sein, die Zahlen auf der Karte zu lesen, und selbst seinen Platz finden.Warum hält sich Sophie nicht wie die meisten Menschen eine Katze? Ein Hund komme nicht infrage, nicht einmal eine dieser lächerlichen Karikaturen, die Frauen neuerdings auf dem Arm durch die Innenstadt tragen. Mit einem Hund müsste sie ihr Loft zweimal am Tag verlassen, was ihr zuwider ist. Wie ist sie bloß auf dieses krächzende Monster verfallen, überlege ich und komme zu dem Schluss, dass sie sich wahrscheinlich für den Graupapagei entschieden hat, weil keiner von ihren Verwandten oder Bekannten einen Vogel als Haustier hält. Dass der mich nicht ausstehen kann, ist offensichtlich, aber dass er mich verhöhnt, wie Sophie behauptet, glaube ich nicht. Was kann es den Schreihals schon kümmern, dass ich Billeteur statt Jurist geworden bin? Er reagiert wohl so abweisend auf mich, weil er meine Ablehnung spürt. Darin unterscheidet er sich nicht vom Hund des Hausmeisters in der Sechshauserstraße und von der Siamkatze des Inders aus dem Handyshop. Beide verschwinden, wenn sie mich nur von Weitem sehen, obwohl ich weder der Katze noch dem Pudel jemals etwas getan habe. Vielleicht mögen sie meinen Geruch nicht, oder die Art, wie ich mich bewege, lässt sie instinktiv zurückweichen. Aber da versagt die Menschenkenntnis der beiden, ihnen würde ich, ganz im Gegensatz zu Albin, niemals etwas antun. Mich stört es nicht einmal, wenn ich neben dem Haustor die Pissflecken des Pudels entdecke, die der Hausmeister noch nicht abgewaschen hat; die gehören zur Sechshauserstraße wie die nächtlichen Schlägereien oder die eingeworfenen Schaufensterscheiben des türkischen Gemüsehändlers. Bei einem meiner Besuche im Loft wurde Sophie von ihrer Cousine aus Amerika angerufen und blieb lange Zeit im Nebenraum. Ich war allein mit Albin, der so auf seiner Stange saß, dass er mir demonstrativ den Rücken zuwandte. Ich stellte mir vor, mich anzuschleichen, die Käfigtür zu öffnen und ihm mit einem schnellen Griff den Hals umzudrehen. Das heißt, ich dachte nicht wirklich daran, dem Vogel etwas anzutun, sondern spielte bloß mit dem Gedanken, um die Zeit zu überbrücken. Sophie kam lange nicht zurück, ich öffnete die Tür, worauf der Papagei ans andere Ende seines Gefängnisses abrückte. Dann öffnete ich das Fenster und hoffte, Albin würde in die Freiheit fliehen. Aber der dachte nicht daran, und so verschloss ich, noch bevor Sophie ihr Telefonat beendet hatte, enttäuscht den Käfig. Als sie in den Raum kam, schrie sie, was mir denn einfalle, die Kälte hereinzulassen, die könne Albins Tod bedeuten. Die ganze restliche Zeit verbrachte sie damit, mir alle möglichen Papageienkrankheiten aufzuzählen, und verbot mir, jemals wieder eigenmächtig in ihrem Loft ein Fenster zu öffnen …
… warum sperrst du dich in deiner Wohnung ein, frage ich, und warum lüftest du sie nur einmal pro Woche? Das verstehst du nicht, kannst es gar nicht verstehen, weil du in deinem Sechshauserstraßensubstandardloch nichts über Wohnungen weißt. Seit du hier ausgezogen bist, lebst du im Schmutz und siehst, wenn du aus deinem Fenster schaust, Menschenbeine vorüberlaufen. Hast du Glück, kannst du vielleicht einmal in der Woche einer Frau unter den Rock gucken, aber das lohnt sich wahrscheinlich ohnehin nicht bei den Leuten, die sich in die Sechshauserstraße verirren. Was wirst du schon entdecken außer wulstigen Krampfadern und unappetitlichen Bindegewebsschwächen, schiefgetretenen Absätzen oder rissigem Oberleder von Billigschuhen. Der Sektionschef trug ausschließlich Schuhe, die er jedes Frühjahr beim Schuster Birchhofer in Garmisch-Partenkirchen für sich anmessen ließ, handgenähte Einzelstücke, wie sie auch der Minister trug, der dem Sektionschef als Vertrauensbeweis die Adresse in Garmisch gegeben hatte. Warum weichst du mir aus, unterbreche ich Sophie, bevor sie den geschmacklosen Scherz des Vaters über die Birchhofer-Schuhe hätte anbringen können. Der polterte im angetrunkenen Zustand manchmal, hätten die deutschen Soldaten bei Stalingrad Birchhofer-Stiefel getragen, wäre die Sache anders ausgegangen. Da ich ihr diese widerwärtige Pointe verdorben habe, schweigt sie beleidigt, als ich meine Frage wiederhole: Warum gehst du nicht ins Freie, sondern sperrst dich wochenlang ein? Verlässt du die Wohnung überhaupt noch, wenn du nicht zu deinem Arzt läufst, um dir bestätigen zu lassen, dass dir nicht das Geringste fehlt? Das lässt sie nicht gelten und behauptet, sie sei nur deshalb einigermaßen gesund, weil sie sich mehrmals im Jahr von Kopf bis Fuß durchuntersuchen lasse. Was weiß der Kartenabreißer schon über Krankheiten, sagt sie zu Albin, der zustimmend nickt, mit diesem Dilettanten unterhalten wir uns nicht über medizinische Fragen …
DORA
… es war richtig, Viktor aus der Wohnung zu werfen. Sein überraschter Blick konnte nicht ernst gemeint sein, er durfte doch nicht erwarten, dass wir, nachdem er die Strafe abgesessen hatte, dort weitermachen, wo uns seine Verurteilung unterbrochen hatte. Stell dir einfach vor, wir wären im Theater und das Gefängnis die Pause, versuchte er das Jahr kleinzureden, in dem ich ihn nie besucht hatte. Darüber beklagte er sich nicht, sondern redete davon, dass man ihm ein halbes Jahr wegen guter Führung erlassen habe. Ich musste mich für den Dienst vorbereiten, hätte noch gern eine Stelle aus Richard III. nachgelesen, da läutete es, und in der Tür stand Viktor mit seinem Versicherungsagentengrinsen, als wäre er nur kurz weggegangen, um Zigaretten zu besorgen. Freust du dich nicht?, fragte er und erwartete keine Antwort, sondern stellte fest (noch immer das dümmliche Grinsen im Gesicht, mit dem er zahllosen einsamen Frauen unnötige Versicherungen aufgeschwatzt hatte): Natürlich freust du dich, kannst das aber, weil es für dich so überraschend kommt, nicht zeigen. Machen wir einen zweiten Versuch und vergessen, dass ich schon einmal geläutet habe! Ich war nicht fähig, mich gegen diese Treppenhauskomödie aufzulehnen, mit allen hatte ich nach dem Läuten gerechnet, mit dem Hausbesorger, einem Gaszählerableser, sogar mit den Zeugen Jehovas, aber nicht mit Viktor, wusste ich doch, dass er noch Monate abzusitzen hatte. Kurz überlegte ich, nicht mehr zu öffnen, aber Viktor wäre nicht gegangen, sondern laut geworden, hätte womöglich gegen die Wohnungstür getrommelt oder gar versucht sie einzutreten und die Nachbarn ins Treppenhaus gelockt. Aus Angst vor der Peinlichkeit öffnete ich ihm ein zweites Mal. Dass ich mich noch immer nicht über sein plötzliches Auftauchen freute, übersah Viktor und ließ sich auf die Couch fallen, streckte seine Beine selbstgefällig von sich und erwartete wohl, ich würde mich wie vor der Verurteilung über seinen geöffneten Hosenschlitz beugen. Was ich wahrscheinlich auch getan hätte, wäre er nicht unangekündigt und so knapp vor der Aufführung aufgetaucht. Viktor ist ein rücksichtsloser Genießer, ein Rohling, der in seinem ganzen Leben über keine einzige Metapher gestolpert ist, aber im Bett ist er das, was Voss auf der Bühne war. Zumindest vor dem Gefängnis. Wie sehr ihn das verändert hatte, konnte ich mir nicht vorstellen. Was macht einer wie Viktor mit seiner aufgestauten Geilheit, wenn er ein Jahr lang keine Frau sieht? Liegt er Abend für Abend mit einem steifen Glied in seiner Zelle und erinnert sich an die Frauen, mit denen er geschlafen hat, stellt er sich ihre schwitzenden Körper vor, hört er ihr Gestöhne, das ihn immer aufs Neue erregt hat, vergleicht er Brüste und Vaginas, oder vergisst er die schon nach wenigen Tagen, weil man den Häftlingen ein Mittel ins Essen mischt, das ihre Triebe einschläfert? Richard III. bewahrte mich davor, Viktor nachzugeben, ich dachte an das Stück und an Brandauer, an die Stuhlreihen im linken Parkett. Das gab mir den Mut, Viktor die zwei Koffer zu zeigen, in die ich am Tag der Verurteilung seine Sachen gepackt hatte. Zwei Koffer und ein Karton standen im Abstellraum. In den Koffern lagen gebügelt seine Kleider, sogar die Schuhe im Karton hatte ich eingecremt und poliert. Ich muss ins Theater, sagte ich, wenn ich nach der Vorstellung todmüde zurückkomme, Richard III. verlangt mir mehr ab als die meisten anderen Stücke, möchte ich dich und deine Koffer nicht mehr treffen. Mir war es sofort peinlich, was Viktor bestimmt als Schwäche oder Unentschlossenheit auslegte, dass ich ein unpassendes Verb verwendet hatte. Koffer kann man nicht treffen, was ihm nicht auffallen würde. Dass ich an ein falsch gewähltes Wort denken könnte, mich dafür auch schämte, wäre ihm niemals in den Sinn gekommen. Viktor ist ein Virtuose des knappen Ausdrucks, jede überflüssige Silbe sieht er als Zeitverschwendung, die ihn davon abhält, sein Wohlbefinden zu steigern. Redselig wurde er nur, wenn es darum ging, seinen Opfern, die er durch windige Schmeicheleien zu solchen degradiert hatte, Versicherungsverträge aufzuschwatzen. Dann knallten die Wörter wie Gewehrsalven aus seinem Mund, bis sein Gegenüber, zumeist waren das Frauen zwischen vierzig und sechzig, willenlos den entgegengestreckten Kugelschreiber nahm und unterschrieb. Viktor war mit seinen Verträgen ausschließlich am Vormittag unterwegs, weil zu dieser Zeit die meisten Ehemänner arbeiteten und nicht die Gefahr bestand, dass sie plötzlich auftauchten und ihn aus der Wohnung warfen. Schon nach wenigen Sätzen hatte er herausgefunden, wo die Männer arbeiteten und wann sie zurückerwartet wurden. Im wirklichen Leben gehe es zu wie in einem schlechten Pornofilm, in dem eine leicht bekleidete Hausfrau einen jungen Elektriker, Installateur oder Pizzaboten verführt. Ich nannte ihn einen Angeber, wogegen sich Viktor mit einer detaillierten Schilderung seiner Diensterlebnisse, er nannte sein Herumvögeln tatsächlich Diensterlebnisse, verwahrte. Obwohl sich Edwin mit mir im Burggarten treffen wollte, um die Ungereimtheiten einer Aufführung des Prinzen von Homburg zu bereden, sagte ich mit der dümmsten Ausrede (seit Stunden plagen mich entsetzliche Zahnschmerzen) ab und folgte Viktor. Wegen Edwin hatte ich ein schlechtes Gewissen, aber der würde nie annehmen, dass ich ihn belüge. Er versprach sogar, zur Vorstellung Schmerztabletten mitzubringen; er kenne einen Apotheker in der Sechshauserstraße, der ihm die stärksten Mittel auch ohne Rezept verkaufen würde. Edwin bot an, mich zum Arzt zu begleiten, er wäre an meiner Seite, könnte mich stützen, wenn mich eine plötzliche Kreislaufschwäche überfiele, ich dürfe die Gefahren nicht unterschätzen, in die mich ein vereiterter Zahn stürzen könne. Die meisten Menschen dächten ja in so einer Lage, es handle sich bloß um einen Zahn, der im Vergleich zum übrigen Körper winzig klein sei, und doch könne eine vereiterte Zahnwurzel einen Menschen lähmen. Darum werde es sich in meinem Fall wohl handeln, wenn er die Beschreibung meiner Schmerzen recht verstanden habe. So schlimm ist es zum Glück nicht, aber ich werde den Zahnarzt aufsuchen, um nicht am Abend meinen Dienst zu versäumen. Dann überredete ich ihn dazu, allein in den Burggarten zu gehen und über den Prinzen von Homburg nachzudenken, ich würde eine Viertelstunde eher als üblich ins Theater kommen, dann könnte er unsere Bedenken gegen die Inszenierung zerstreuen. Es gelang mir, Edwin von meinem vereiterten Zahn abzubringen. Bevor wir unser Gespräch beendeten, riet er mir allerdings noch, Eiswürfel in Plastikfolie einzuschlagen und gegen die Wange zu drücken, so würde ich eine Schwellung vermeiden. Viktor zu folgen war ein Kinderspiel, er schien sich ausschließlich für sich zu interessieren, konnte an keiner Auslage vorübergehen, ohne sich mit einem selbstgefälligen Grinsen in den Scheiben zu betrachten. Das einzige Problem tauchte bei einem Gründerzeithaus in Währing auf, wo ich kurz nach ihm am Eingangstor sein musste, bevor es zugefallen wäre. Aber die schnellen Schritte kenne ich aus dem Theater, spielend schaffte ich das einzige Hindernis und folgte ihm im Abstand eines Halbstocks. Eine Türklingel schrillte, wenig später legte Viktor mit einer verlogenen Gewandtheit los, die ich ihm niemals zugetraut hätte. Der Tonfall, in dem er den Namen seiner Gesellschaft aussprach und sich selbst als Versicherungsoberinspektor vorstellte, erinnerte mich daran, wie Politiker es verstehen, mit ein paar Sätzen die größte Banalität zu einer Angelegenheit von internationaler Bedeutung aufzublasen. Und bevor sein Opfer noch eine Frage hätte stellen können, redete Viktor schon über die unsichere Lage, auf dem großen Weltparkett wie auch im kleinen Währing, das er in einem Nebensatz, eine Spur leiser, zum schönsten Bezirk mit den intelligentesten Bewohnern der Stadt erklärte, wogegen seine potenzielle Kundin, die bis dahin kein einziges Wort gesprochen hatte, selbstverständlich nichts einwenden wollte. Was nun folgte, empfand ich im Gegensatz zu seiner Kundin, denn er hatte wohl längst erkannt, dass sie ihn nicht ohne unterschriebenen Vertrag wegschicken würde, auf eine vulgäre Art aufdringlich. Kein Wort mehr über die Welt oder Währing und seine Schönheit, auch keines über die Bedrohungen, denen gerade die Bewohner der wohlhabenderen Bezirke wehrlos ausgeliefert seien. Viktor holte zu seinem entscheidenden Schlag aus, indem er die Frau mit schmierigen Komplimenten überschüttete. Von seiner Verunsicherung redete er, eine Folge des Umstands, dass er nie und nimmer damit gerechnet habe, dass ihm eine derart herausragende Schönheit öffnen werde, dieser Tag sei allein deswegen schon ein glücklicher für ihn, selbst wenn er keinen einzigen Vertrag abschließen würde, müsste er den Tag auf der Habenseite verbuchen (Viktors Neigung zu lächerlichen Phrasen, die mich immer schon angewidert hatte), was auch noch geschehe, sein Tagessaldo sei schon am frühen Morgen im unumstößlichen Plus. Vorsichtig stieg ich ein paar Stufen höher, ich wollte die Frau sehen, die sich so leicht täuschen ließ. Viktor verdeckte sie, und so war ein geblümter Morgenmantel alles, was ich von ihr zu Gesicht bekam. Hatte Viktor Währing vor Kurzem noch einen eleganten Stadtteil genannt, widersprach das geschmacklose Blumenmuster dieser Einschätzung entschieden. Wer so ein Stück freiwillig anzieht, hat sich damit nie im Spiegel betrachtet oder mit dem Leben abgeschlossen. Dann wurde er von einer verlegenen Stimme, die eine akustische Fortsetzung des Blumenmusters zu sein schien, auf einen Kaffee eingeladen. Ich hörte noch, wie die Sicherheitskette eingehängt wurde, und presste ein Ohr an die Wohnungstür. Hinter der ich aber keine Stimmen belauschen konnte, obwohl ich mein rechtes Ohr fest gegen das Türholz drückte und das linke mit der Handfläche abdeckte. Ich wollte bereits gehen, da drang ein Kichern ins Treppenhaus. Das passt zu dem geblümten Morgenmantel, dachte ich schadenfroh, im nächsten Moment ein dumpfer Schlag gegen die Türfüllung, der sich bis in meinen Kopf hinein schmerzhaft ausbreitete. Das Kichern wich einem Stöhnen und Röcheln, Viktor wird doch nicht – nicht mit einer Frau in einem solchen Morgenmantel … Aber bald bestand kein Zweifel mehr, das Blumenmuster hatte nicht die von mir erwartete Wirkung gezeigt. Die Vorstellung, dass es Viktor, um einen Versicherungskontrakt abschließen zu können, hinter der Tür mit seiner Kundin trieb und uns nur ein paar Zentimeter Holz trennten, erregte mich. Ich wartete das Ende ab und lief dann ins Parterre. Es dauerte einige Zeit, bis Viktor pfeifend die Stiegen abwärts ging. Als ich ihm sagte, was ich auf der anderen Seite der Tür gehört hatte, lachte er bloß und meinte triumphierend, dass die Frau danach einen zweiten Vertrag unterschrieben habe … Du meinst doch nicht, was du sagst, behauptete Viktor und knöpfte nun auch noch seine Jacke auf. Selbstgefällig grinsend saß er mit gespreizten Beinen und offenem Hosenschlitz auf der Couch. Vielleicht dachte er ja an das Vergewaltigungsspiel, das wir zur Steigerung unserer Erregung hin und wieder versucht hatten. Ich fürchtete, er würde mich, zwei Stunden bevor sich der Vorhang für Richard III. hebt, ins Schlafzimmer zerren und aufs Bett stoßen. Zum Glück erinnerte er sich daran nicht, vielleicht stimmte die Geschichte mit den lusttötenden Essensbeigaben ja doch und deren Wirkung hielt noch an, er unternahm jedenfalls keinen weiteren Versuch, mich umzustimmen …
… mit Viktor habe ich mir die Miete geteilt; seit ich ihn hinausgeworfen habe, muss ich allein dafür aufkommen, was mit dem Billeteurgehalt nicht leicht ist. Sind Miete, Gas und Strom bezahlt, bleibt mir kaum etwas zum Leben. Natürlich könnte ich meine Mansardenwohnung am Rennweg aufgeben und in einen der Außenbezirke ziehen, ein paarmal war ich fast so weit, schreckte aber immer davor zurück, wenn ich mich an Edwins Berichte über seine Kellerwohnung und die Zustände in der Sechshauserstraße erinnerte. Edwin lebt nur für das Theater und verschwendet keinen Gedanken an Dinge außerhalb der Burg. Er denkt wohl, wenn er das Theater nach einer Aufführung verlässt und die Mariahilfer Straße stadtauswärts geht, schon an das Stück, das am nächsten Abend auf dem Spielplan steht. Das Loch, in dem er haust, hat keinen Platz in seinem Kopf. Der ist bis zum Rand angefüllt mit Texten, Regieanweisungen und Zitaten der bedeutendsten Dramentheorien. Obwohl wir nie darüber gesprochen haben und Edwin es wahrscheinlich leugnen würde, glaube ich, dass er in seinem Kellergefängnis irgendwo Hunderte Regiekonzepte versteckt. Was notierst du?, fragte ich, nachdem ich ihn während einer Vormittagsprobe durch einen Türspalt die Bühne beobachtend gesehen hatte. Sofort versteckte er ein Schulheft mit kariertem Umschlag in seiner Jacke. Er sei nur zufällig im Theater gewesen, habe eigentlich zu Sophie gewollt, aber dann vor ihrem Haus bemerkt, dass er sich im Tag geirrt habe. Um den weiten Weg von der Sechshauserstraße in die Innenstadt nicht vergeblich auf sich genommen zu haben, sei er zur Probe gegangen. Und was steht in dem Heft?, ließ ich nicht locker. Die Einkaufsliste, bloß die Einkaufsliste, log er und konnte mir an diesem Vormittag nicht mehr in die Augen sehen. Nachdem wir uns am Getreidemarkt getrennt hatten und jeder in eine andere Richtung ging, überlegte ich, dass eine Mischung aus Viktor und Edwin einen idealen Mann abgäbe. Zumindest für mich, denn sosehr ich auch am Theater hänge, ausschließlich dafür zu leben wie Edwin, würde ich nicht schaffen. Manchmal glaube ich, Edwin schreibe selbst an einem Theaterstück. Dass er es könnte, wusste ich, nachdem er mir einen kurzen Text gezeigt hatte, den er aus Erschütterung über den Tod des von ihm verehrten Dichters Jonke hingekritzelt hatte. Die Trauer hat seine Verlegenheit besiegt, nicht um ihn gehe es, betonte er mehrmals, sondern um den toten Weltpoeten, nicht um sein Gekritzel, sondern ausschließlich darum, dass von dem kein neues Stück mehr auf die Bühne gelangen werde. Bevor er mich die zwei Seiten lesen ließ, musste ich ihm versprechen, nicht an ihn (nicht den kleinsten Gedanken an deinen Kollegen!), sondern nur an den toten Dichter zu denken …
… ein japanischer Pianist, eine Berühmtheit, was seine Fingerkuppenfertigkeit betrifft, setzte sich an den Steinway, nachdem er den bis auf den letzten Platz besetzten Konzertsaal betreten hatte, nicht ohne sich zuvor ein paarmal in alle Richtungen tief verbeugt zu haben. Eingetaucht in den ihm längst zur Gewohnheit gewordenen Auftrittsapplausdonner, hatte er schon nach wenigen Momenten den Handflächenklangüberschuss vergessen und sich nur noch auf das Chopinmazurkengewitter konzentriert, mit dem er seinen Abend eröffnen wollte. Auf der Klavierbank sitzend, waren dann mit einem Schlag alle Noten aus seinem Kopf entwichen. Sah er in seinen Kopf hinein, fand er keine einzige Notenzeile, nicht einmal die Ahnung von Klängen entdeckte er, gähnende Leere herrschte in seinem Kopf, eine völlige Ton- und Klangabwesenheit. Die er dadurch zu überwinden versuchte, dass er sich ein zweites Mal an die Rampe stellte, in der Hoffnung, der sofort sich auftürmende Applaus würde die irgendwo im Saal herumschwirrenden Klänge in seinen Kopf zurückscheuchen. Wieder am Flügel, wusste er nach wenigen Sekunden, er würde an diesem Abend keinen einzigen Ton spielen, und floh unter dem Gemurre des Publikums in sein Künstlerzimmer.
Sein Agent verbarg alle Zeitungen vor ihm, aber auch ohne eine einzige Zeile gelesen zu haben, kannte er den Inhalt der Künstlervernichtungsberichte. Schloss er seine Augen, sah er immer das hämisch grinsende Gesicht eines Unbekannten, das ihn bis in seine entsetzlichen Traumlandschaften hinein verfolgte; vor denen floh er an Bord einer Nachtmaschine nach Europa, wo er hoffte, den Chopinklängen näher zu sein, sie womöglich in der hochalpinen Einsamkeit wiederzufinden.
Unser Stolz nannten sie die Dorfbewohner, wenn die Rede auf sie kam. In der Höhe war die Bergrettung ihr Stolz, in der Ebene die freiwillige Feuerwehr. Selbstlos und trinkfest. Die Feuerwehr, sagten sie, sei auf der Bierseite daheim, die Bergretter eher auf der Schnapsseite. Weil, vermuteten die Alpendorfbewohner, Bier beim Hochklettern hinderlich sei, die Rettungskletterer nach unten ziehe, wo es aber kein Betätigungsfeld für sie gebe, da dort schon die Feuerwehr auf ihren Einsatz warte. Ballast müsse abgeworfen werden bei der Bergrettung, was für ihre Mitglieder bedeute, sie müssten sich an den Schnaps halten und auf das Bier verzichten. Ein Alarm erreicht sie immer zu spät, sodass die Alpinisten niemals überlegen, sondern ihre Entscheidungen intuitiv treffen. Wer zu viel denkt, gehört zur Feuerwehr, sagten die Bergretter und waren schon in einen Überhang eingestiegen. Bald sahen sie den Verletzten hilflos in seinem Sicherungsseil baumeln, ohne nachzudenken war ihr Schlachtplan entworfen und ein Freiwilliger auf dem Weg zu ihm. Der, wenige Meter trennten ihn noch von dem Opfer, bemerkte, dass es sich bei diesem um keinen Verletzten, sondern um einen Japaner handelte, der im Seil hängend meditierte und sich nun, da er den bergrettenden Störenfried entdeckt hatte, jede Einmischung verbat. Durch laute Rufe verständigte sich der Freiwillige mit dem Einsatzleiter, der anordnete, den Japaner zu retten, schließlich sei ein Notfall gemeldet worden und der Japaner möglicherweise so verwirrt, dass er seine Notlage nicht erkenne. Augenblicklich machte sich der Freiwillige auf den Weg. Der zierliche Japaner wehrte sich gegen den bergrettenden Furor des Naturburschen, solange seine Kraft reichte, dann resignierte er und ließ sich zu jenem Plateau zerren, auf dem die übrigen Bergretter seine Ankunft erwarteten. Die letzten Meter zogen sie ihn mit einem Seil hoch, das ihm mehrere Rippen zerdrückte. Während sich die Bergretter um den liegenden Japaner kümmerten, ihm Schnaps anboten und aufmunternd gegen die gebrochenen Rippen klopften, stürzte der Freiwillige in eine dreihundert Meter tiefe Schlucht. Bei dem kurzen Kampf mit dem Japaner musste sich, ohne dass er es bemerkt hatte, der Karabiner des Sicherungsseils geöffnet haben. Unter Einsatz ihres Lebens, berichteten die Bergretter, sei es ihnen gelungen, den toten Kameraden zu bergen …
VIKTOR
… von Doras Mansardenwohnung mit Blick auf Schloss Belvedere, in dessen Fenstern sich die Morgensonne spiegelt, über eine Zweimannzelle in mein altes Kinderzimmer, was für ein Abstieg. Ich muss froh sein, dass mich die Mutter bei sich wohnen lässt. Lebte der Vater noch, hätte er dem Zuchthäusler nicht einmal geöffnet, und wenn er mich doch eingelassen hätte, dann nur, um mir an den Kopf zu werfen, dass seine Prophezeiung wahr geworden ist. Wer sich zu gut dafür ist, mit seinen Händen zu arbeiten, aber zu dumm fürs Gymnasium, mit dem nimmt es ein böses Ende. Das hat es mit ihm genommen, lange bevor ich mich am Geld meiner Klienten vergriffen habe. Wie stolz war er darauf, dass er es als uneheliches Kind einer Küchenhilfe zum Straßenbahnlenker geschafft hatte. Die Straßenbahnergewerkschaft und die Sozialistische Partei waren seine Heimat, sie gaben ihm einen Lebenssinn, den er mir immer absprach, schufen Gemeinschaft. Über die Straßenbahn und die Partei redete er wie über einen geheimen Orden, der nur Auserwählte aufnimmt. Dabei wusste doch jedes Kind in der Stadt, dass die Sozialisten allen dankbar waren, denen sie ein Parteibuch unterjubeln konnten. Mit diesem standen dem Besitzer zu der Zeit, als der Vater in die Partei eintrat, alle Türen der städtischen Betriebe offen. Wahrscheinlich war er deshalb so stolz darauf, den D-Wagen über den Ring zu fahren, weil er, hätte es der Zufall schlechter mit ihm gemeint, bei der Müllabfuhr oder der Kanalräumbrigade gelandet wäre. Als Straßenbahnlenker ist man eine Respektsperson, höre ich seine Stimme noch heute, dann hielt er seine dunkelblaue Schildkappe in die Höhe wie der Pfarrer den Kelch während der Wandlung. Obwohl der Vergleich unpassend ist, denn die Tabernakelwanzen gehörten einer anderen Klasse an und waren deshalb die natürlichen Feinde der Partei. Er sagte, redete er über die Sozialisten, nur die Partei, denn neben dieser gab es für ihn keine weitere. Die zweite große Partei war für ihn abwechselnd bloß ein Pfaffen-, Bauern- oder Greißlerverein, ähnlich bedeutungslos wie der Arbeiterfischereiverein, den außer seinen fischmordenden Mitgliedern auch niemand ernst nahm. Dass gerade sie viele Jahre lang den Kanzler gestellt hatte, während für die Partei nur der Vizekanzlerposten übrig geblieben war, zählte nicht, weil erstens die Stadt schon immer fest in sozialistischer Hand gewesen sei und zweitens der Klassenkampf mit dem von ihm bewunderten Kanzler Kreisky ein siegreiches Ende gefunden habe. Ohne den, behauptete er, würde die Welt in der kürzesten Zeit vor die Hunde gehen. Alle Krisen brächen ja nur aus, weil die Verursacher sich darauf verließen, dass sie der Bruno wieder lösen werde. Nie nannte er ihn beim Familiennamen, immer nur beim Vornamen und stellte dadurch für sich wohl so etwas wie Nähe her. Dem Kanzler sei kein Problem zu gering, heute löse er die Ölkrise und morgen verteile er Gratisschulbücher, was mir jedoch nichts nütze, denn ich sei entweder zu faul oder zu dumm zum Lernen. Oder beides. Festlegen wollte er sich nicht, bloß meine Unfähigkeit stand nie zur Diskussion. Was jenseits der Stadtgrenze geschah, interessierte ihn nicht; die Bewohner der übrigen Bundesländer waren für ihn seltsame Wesen, die noch nicht alle Stufen der Evolutionsleiter hochgestiegen waren. Nach dem letzten Gefecht, zitierte er die Internationale, welche die Straßenbahner am Tag der Arbeit beim Maiaufmarsch vor dem Rathaus sangen, könnten sich die Schwarzen