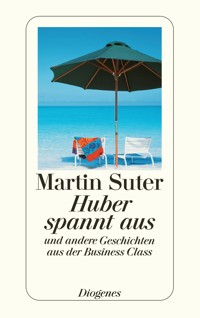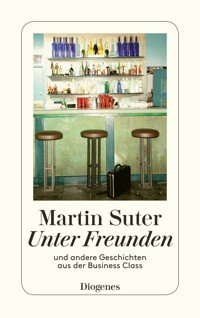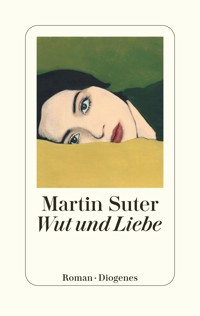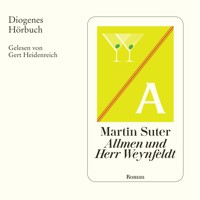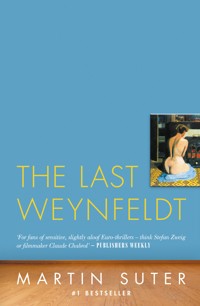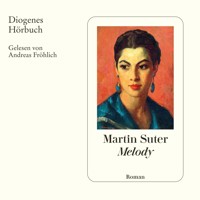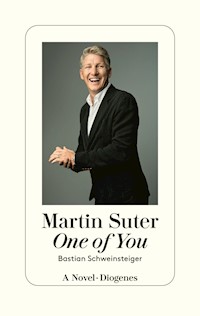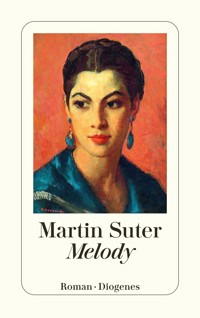
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einer Villa am Zürichberg wohnt Alt-Nationalrat Dr. Stotz, umgeben von Porträts einer jungen Frau. Melody war einst seine Verlobte, doch kurz vor der Hochzeit – vor über 40 Jahren – ist sie verschwunden. Bis heute kommt Stotz nicht darüber hinweg. Davon erzählt er dem jungen Tom Elmer, der seinen Nachlass ordnen soll. Nach und nach stellt sich Tom die Frage, ob sein Chef wirklich ist, wer er vorgibt zu sein. Zusammen mit Stotz’ Großnichte Laura beginnt er, Nachforschungen zu betreiben, die an ferne Orte führen – und in eine Vergangenheit, wo Wahrheit und Fiktion gefährlich nahe beieinanderliegen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Martin Suter
Melody
Roman
Diogenes
Für Margrith und Ana
ERSTER TEIL
1
Was er alles tat für nichts und wieder nichts.
Tom stand vor dem Spiegel und band sich die Krawatte. Inzwischen hatte er ein wenig Übung darin, nach so vielen Vorstellungsgesprächen. Am Anfang trug er keine, er suchte ja keinen Krawattenjob. Seine Abschlussnoten waren Krawatte genug, fand er. Doch inzwischen hatte er die Milch heruntergegeben, wie sein Vater sich auszudrücken pflegte. Tom hatte nie herausgefunden, woher die Redensart kam. Aber was sie bedeutete, war ihm schon klar: vom hohen Ross herunterkommen.
Jetzt war er unten. Mit Krawatte.
Tom besaß ein Double Degree. Zwei Master of Law, einen der hiesigen Uni und einen des King’s College London. Für Letzteren hatte er zwei Studienjahre angehängt, weil er seinen Abschluss hatte hinauszögern wollen. Sein Vater bezahlte ihm das Studium, und Tom hatte keinen Grund und keine große Lust, berufstätig zu werden.
Ursprünglich hatte er geplant, nach New York zu gehen und dort auch noch das Bar Exam abzuschließen. Doch kurz vor der Abreise nahm sich sein wohlhabender Vater das Leben. Es stellte sich heraus, dass der Grund dafür eine ausweglose Verschuldung war.
Auf seine Mutter, die seit ihrer Scheidung mit einem Forstingenieur in Kanada lebte, konnte er nicht zurückgreifen, und so war Tom gezwungen, seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Etwas, das sich nicht als so einfach herausstellte, wie er gedacht hatte. Seit nun schon sechs Wochen war er auf Jobsuche. Inzwischen auch nach einem, der nichts mit seiner Ausbildung zu tun hatte.
Die Stelle, für die er sich an diesem Morgen bewarb, hatte er, ganz altmodisch, in einer Anzeige in der Tageszeitung gefunden. Sie lautete:
Gesucht: Vertrauenswürdiger, gebildeter jüngerer Mann für Nachlassordnung. Juristische Vorkenntnisse erwünscht. Vollzeit. Faire Bezahlung.
Die Anzeige war – auch das ziemlich altmodisch – chiffriert. Tom hatte sein Standardbewerbungsschreiben und sein Curriculum an die Chiffre gesandt und die Sache als Bewerbung abgehakt.
Es stimmte nicht ganz, dass er es für nichts und wieder nichts tat. Er tat es als Beweis dafür, dass er sich bewarb und nichts als Absagen bekam. Er brauchte das für sein Arbeitslosengeld.
So weit war es mit ihm gekommen: arbeitslos. Bald würde er über seinen Schatten springen müssen und sich auf dem Arbeitsamt melden. Er, Tom Elmer, 30, LL.M. Die Milch war wirklich ganz unten.
Dann war der Brief gekommen. Absender: Dr. Peter Stotz, Weilstammweg 12, Zürich. In einer sorgfältigen Altherrenschrift bezog er sich in knappen Sätzen auf Toms Bewerbung und bat ihn für den kommenden Freitag um 09:30 Uhr zu einem Vorstellungsgespräch zu sich. Mit der Bitte um eine kurze »postalische Bestätigung«.
Tom sagte zu.
Es war Viertel vor sieben. Er erinnerte sich nicht, wann er das letzte Mal um diese Zeit auf den Beinen gewesen war. Schon oder noch.
Er zog den Krawattenknoten fest und begutachtete sich noch einmal im Spiegel. Seinen Bart hatte er eigens zu diesem Anlass frisch getrimmt. Ja, so weit war es mit ihm gekommen.
2
Der Weilstammweg lag in einem verschachtelten Villenviertel. Das Haus neben der Nummer 12 war von einem Baugespann umgeben. Profile zeigten die Dimensionen des Neubaus an, der dort geplant war.
Die Villa, vor deren Gartentor Tom jetzt stand, war ein klassizistisches Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, wohlproportioniert und groß.
Es sah aus, als wären in den Zwanziger- und Dreißigerjahren des letzten Jahrhunderts Teile des ursprünglichen Grundstücks verkauft und mit Ein- und Mehrfamilienhäusern bebaut worden. Der Garten war nun für die Villa viel zu eng. Zwei wohl zwanzig Meter hohe Rottannen bedrängten zusätzlich das gelbe Gebäude. Die Eingangstür war von zwei Säulen flankiert, die einen Balkon trugen. Auf dem Giebel darüber prangte in vergoldeten Lettern die Inschrift: Tempus fugit, amor manet. Sie sah aus wie frisch restauriert und bildete einen seltsamen Gegensatz zu der verwitterten Fassade.
Auf dem schwarz angelaufenen Messingschild über der Klingel stand Dr. P.S. Tom klingelte.
Es dauerte eine ganze Weile, bis der Türöffner surrte und das schmiedeeiserne Gartentor freigab. Tom stieg die drei Granitstufen zum Plattenweg hinauf.
Die Fugen waren moosig, die Beete auf beiden Seiten mit Farn überwachsen.
Nach ein paar Schritten hatte er die Hausecke erreicht. Dort teilte sich der Weg. Rechts ging es zum Haupteingang, geradeaus an der efeuüberwachsenen Fassade entlang zu einer Tür zwischen zwei vergitterten schmalen Fenstern. Sie stand offen, und eine ältere Frau in einer Schürze, das schneeweiße Haar straff nach hinten zu einem Zopf gebunden, erwartete ihn.
»Herr Elmer«, stellte sie mit Akzent fest, spanisch oder italienisch.
Neben der Tür war ebenfalls ein Messingschild angebracht, aber dieses war poliert. Lieferungen war darauf eingraviert.
Sie führte ihn durch einen Korridor, vorbei an einem Office und einer Küche, aus der es nach Kaffee duftete, in ein Vestibül. Dort bat sie ihn zu warten.
Zwei geschwungene Treppen führten von beiden Seiten des Raumes zu einer Balustrade. In der Mitte des Raumes hing ein Messingkronleuchter mit Kerzenimitaten. Eine kleine Sitzgruppe stand zwischen zwei der Türen, die in die verschiedenen Räume des Erdgeschosses führten. An der gegenüberliegenden Wand hing, üppig in Gold gerahmt, ein großer ovaler Spiegel.
Es roch nach Tabakpfeife, Kaffee und Vergangenem.
Die Frau kam zurück. »Bitte«, sagte sie und deutete auf die Tür, aus der sie gerade gekommen war.
Der Raum, in den sie ihn führte, war ein Salon. Bücherregale, wohin das Auge reichte. Tief in einem Ledersessel versunken saß ein alter Mann vor einem Kaminfeuer und rauchte Pfeife. Buschige, tiefschwarze Augenbrauen hoben sich von der bleichen, etwas durchsichtig wirkenden Haut seines eingefallenen Gesichts ab. Sein zurückgekämmtes Haar war silbern und dicht, sein Haaransatz lag tief auf der seltsam glatten Stirn. Der dünne Hals ragte aus einem zu weit gewordenen Kragen über einer sorgfältig gebundenen Krawatte. Der Anzug, den er trug, war aus zu viel Stoff für seinen mageren Körper.
»Setzen Sie sich, ich stehe nicht mehr gerne auf«, sagte er zur Begrüßung. Er machte auch keine Anstalten, Tom die Hand zu reichen.
»Fragen Sie Herrn Elmer, wie er den Kaffee nimmt, Mariella«, bat er die Haushälterin auf Italienisch.
Tom bestellte ihn schwarz mit Zucker.
Während sie darauf warteten, musterte der alte Herr ihn schweigend. Erst als Mariella den Kaffee gebracht hatte, ergriff er das Wort.
»Sie sind natürlich überqualifiziert.«
Tom nickte. »Ist das ein Problem?«
»Überqualifizierte Leute bleiben nicht lange.«
Tom überlegte, wie er darauf antworten sollte, und entschied sich für die Wahrheit. »Da haben Sie recht.«
Stotz sog dreimal heftig an seiner Pfeife, die auszugehen drohte. Als wieder Rauch austrat, sprach er ruhig weiter. »Ich brauche aber jemanden für eine ganze Weile.«
»Für wie lange?«
»Nicht für ewig.« Der alte Mann lachte etwas bitter.
»Haben Sie eine ungefähre Vorstellung?«
»Die Ärzte geben mir ein Jahr.«
Tom erschrak etwas über die Antwort. »Ach so.«
Eine nachdenkliche Stille breitete sich aus im Raum.
Aus der Tabakpfeife drang regelmäßig ein feines Gurgeln. Der alte Mann nahm sie aus dem Mund und legte sie mit der Öffnung nach unten in den Aschenbecher. Noch immer sagte er nichts. Sah Tom nur an, als wollte er seine Gedanken lesen. Und könnte es auch.
Tom hatte Stotz gegoogelt. Er war einst eine wichtige Persönlichkeit gewesen. Nationalrat. Mitglied der liberalen Wirtschaftspartei, Königsmacher und Geldgeber. In der Wirtschaft spielte er eine große Rolle als Banken-, Versicherungen- und Maschinenindustrie-Verwaltungsrat. Daneben war er Kunstmäzen und langjähriges Mitglied des Verwaltungsrats der Oper und dessen Präsident während elf Jahren.
Alles vor Toms Zeit, aber seinem Vater wäre der Name Stotz bestimmt ein Begriff gewesen.
3
Stotz hatte Tom einen Jahresvertrag angeboten, gegenseitig unkündbar. Tom hatte erst gezögert, bis das Salär zur Sprache kam: zwölftausend Franken im Monat. Plus Kost und Logis.
»Logis?«, hatte Tom gefragt.
»Sie wohnen im Haus«, hatte Dr. Stotz geantwortet.
Nun tastete er mit dem Fuß auf dem Teppich nach einer bestimmten Stelle und trat mit etwas Nachdruck darauf. Als er den Fuß wegzog, sah Tom eine kleine Erhebung unter dem Teppich. Eine Fußklingel, und wie zur Bestätigung trat Mariella ein.
»Zeigen Sie Herrn Elmer die Gästewohnung.«
Sie ging ihm voraus die Treppe hinauf. Tom bemerkte, dass sie das Geländer fest mit der Linken packte und die Beine durch kräftiges Ziehen entlastete. Der weinrote Treppenteppich war mit Messingstangen fixiert und etwas abgewetzt, an zwei Stellen fehlten die gedrechselten Geländerstäbe. An den Wänden hingen konstruktivistische Aquarelle von jemandem, der sich sehr intensiv mit Mondrian befasst haben musste.
Bei der obersten Stufe führte das Geländer um die Ecke und ging in die Balustrade über, von der man vom oberen ins untere Vestibül sehen konnte. Die Türen hier im ersten Stock führten wohl in die Schlafräume und Ankleidezimmer. Weiter hinten befand sich der Treppenaufgang zum Dachgeschoss.
Dort oben geleitete ihn die Haushälterin durch einen weiteren großen Raum mit vielen Türen zu einem kurzen Korridor. Ins Nussbaumholz einer Tür war aus einem helleren Holz das Wort Gäste eingelassen.
Sie betraten einen großen Raum ohne Möbel. »Das Wohnzimmer«, erklärte Mariella.
Es roch wie in einem Neubau nach frischer Farbe und Reinigungsmitteln. Tom öffnete das Fenster. Es bot einen nicht sehr attraktiven Blick auf ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus von zweifelhafter Architektur.
Vom Wohnzimmer führte eine Tür zu einer winzigen Küche und eine zweite zu einem fast gleich großen leeren Raum, dem Schlafzimmer. Von dort betrat man das neugestaltete Bad. Viel grauer Marmor, eine große Dusche, eine Badewanne und hinter einer Tür ein Dusch-WC. Das Fenster war mit opakem Glas versehen. Er öffnete es. Auch auf dieser Seite der Villa stand ein Mehrfamilienhaus.
»Gefällt es Ihnen?«, fragte Mariella.
»Nicht schlecht«, antwortete Tom.
Mariella sah ihn an, als warte sie auf eine Frage. Als keine kam, komplimentierte sie ihn aus den Räumen wieder hinunter zum Vestibül. Erst jetzt fiel Tom dort ein Ölbild auf. Das Porträt einer jungen Frau. Sie saß in einem Polstersessel vor einer Bücherwand, hatte ein aufgeschlagenes Buch auf dem Schoß und sah fragend auf, als wäre sie vom Betrachter gestört worden. Ihr schwarzes offenes Haar fiel ihr auf der rechten Seite über die Schulter und verdeckte eine Hälfte des Ausschnitts ihrer gelben Bluse. Ihre vollen Lippen hoben sich im gleichen Rot von ihrer hellen Haut ab wie das ihrer Halskette. Die anderen Kontraste auf ihrer Haut waren das Blau der Augen und das Schwarz der Haare und Wimpern.
Die Buchrücken der Bücherwand nahmen die Farben der Porträtierten auf.
Das Bild war groß und hochformatig und mit einer liebenswürdigen Unbeholfenheit naturalistisch gemalt.
Tom war davor stehen geblieben. »Bellissima, vero?«, sagte Mariella, mehr zu sich als zu ihm.
Als sie zurück zum Kamin kamen, legte der alte Herr sein Buch auf das niedrige Beistelltischchen neben dem Sessel und die große Lupe darauf, mit deren Hilfe er gelesen hatte.
»Es ist nicht möbliert. Ich dachte, Sie wollen es lieber mit Ihren Sachen einrichten.«
»Sie wissen doch gar nicht, ob ich zusage.« Tom klang überrascht.
»Ach so. Sie sagen nicht zu?«
Tom zögerte nur kurz. »Doch.«
»Eben.«
Tom lächelte. »Aber das konnten Sie nicht wissen.«
»Bei Hundertvierundvierzigtausend im Jahr plus Kost und Logis war die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ablehnen, nicht sehr groß.« Stotz’ knochige Hand griff nach einem grünen Kartonmäppchen. Er schlug es auf und entnahm ihm zwei Verträge, die auf Toms Namen lauteten. Sie enthielten zwei Punkte, die sie noch nicht besprochen hatten. Erstens: Der Arbeitgeber übernahm auch die Umzugskosten und die Miete von Toms Wohnung bis zum Ablauf von dessen Mietvertrag. Zweitens: Die Ferien betrugen sechs Wochen und waren mit der Bitte verbunden, diese nicht zu beziehen, sondern sich ausbezahlen zu lassen.
Der Vertrag war erstmals kündbar auf das heutige Datum in einem Jahr.
Tom unterschrieb.
4
Es war das erste Mal, dass Tom die Dienste einer Umzugsfirma in Anspruch nahm. Er – beziehungsweise sein Vater – hätte es sich früher zwar leisten können, aber es war ein studentischer Brauch, einander dabei zu helfen.
Jetzt stand er in seiner neuen Wohnung und dirigierte die Möbelträger. Es war nicht viel, was sie anschleppten, er hatte für die zwei Zimmer in Stotz’ Villa nur die besten Stücke aus seiner Vierzimmerwohnung ausgewählt: die Sitzgruppe aus den Dreißigerjahren und den Art-déco-Schreibtisch, beides in seiner Londoner Zeit erstanden. Den Rest hatte er verschenkt oder entsorgt.
In London hatte er seine Freude an Art déco entdeckt. Eine Studienkollegin – und ein bisschen mehr als das – aus sehr begütertem Haus hatte ihn auf den Geschmack gebracht. Es war allerdings, trotz der Großzügigkeit seines Vaters, eine Leidenschaft, die seine Mittel überstieg, wenn sich auch im Nachhinein die paar Stücke, die er sich geleistet hatte, als gute Investition herausstellten. Sie hatten sich auch in schwierigen Zeiten zwar mit etwas Verlust, aber doch zu einem annehmbaren Preis verkaufen lassen.
Die Sitzgruppe und der Schreibtisch waren alles, was an diese Episode erinnerte. Der Rest des Mobiliars, das er mitgebracht hatte, war praktischer Natur: das Doppelbett aus Stahlrohr und die luftige Bücherwand aus Birkenholz. Dazu die Elektronik: Laptop, Drucker, Beamer für TV und Streaming, High-End-Lautsprecher und Plattenspieler für seine Vinylsammlung.
Punkt zehn Uhr brachte Mariella Brot, Fleischkäse am Stück und Bier.
»Haben Sie auch etwas Alkoholfreies?«, erkundigte sich der Teamchef, der nicht aussah, als würde er oft ein Bierchen verschmähen.
»Scusi«, sagte Mariella, »früher war das der Möbelmänner-Imbiss. Mein letzter Umzug war allerdings vor über vierzig Jahren.«
»Heute arbeiten wir alkoholfrei«, erklärte der Mann mit bedauerndem Lächeln.
Tom begleitete Mariella in die Küche und brachte die Softdrinks hinauf. Um ihr das mühsame Treppensteigen zu ersparen. Und auch, um bei ihr ein paar Punkte zu schinden. Er würde ein Jahr lang mit ihr auskommen müssen.
Der Service des Umzugsunternehmens ging so weit, dass die Männer ihm halfen, die Bilder zu hängen. Tom hatte in seiner wohlhabenden Zeit Kunst gekauft, ausschließlich von Künstlern aus seinem Bekanntenkreis. Es fiel ihm leichter, eine Beziehung zu den Werken herzustellen, wenn er schon eine zu denen hatte, die sie erschufen.
Mit den Bildern ging es ihm anders als mit den Möbeln: Er konnte sich von keinem trennen. Als die Männer sich verabschiedeten, hingen in der Wohnung wohl etwas zu viele davon. Aber jedes half Tom, sich am neuen Ort etwas zu Hause zu fühlen.
5
Die Blüten der beiden Obstbäume – Äpfel oder vielleicht Kirschen? – waren die letzten hellen Flecken im Dämmerlicht des Gartens.
In einigen Fenstern des nahen Hauses brannte schon Licht. Tom hatte eine der von den Möbelmännern verschmähten Bierflaschen aus dem Kühlschrank geholt und trank daraus in kleinen Schlucken. Früher hätte er dazu eine seiner vier Tageszigaretten geraucht, eine nach dem Frühstück, eine nach dem Lunch, eine nach dem Feierabend, eine nach dem Abendessen. Plus eine nach der Liebe.
Das Rauchen hatte er vor einem Jahr aufgegeben, die Liebe vor sechs Wochen. Das eine war seit Langem geplant. Rauchen hielt er für eine Jugendsünde, und mit dreißig ist die Jugend bekanntlich vorbei.
Das mit der Liebe hingegen war unvorhergesehen gewesen, wie der Tod seines Vaters. Und es hing auch damit zusammen. Ariane, seine seit über einem Jahr feste Freundin, hatte sich »emotional von ihm entfernt«, wie sie sich ausdrückte.
Tom vermutete, dass sie sich emotional eher von seiner neuen finanziellen Situation entfernt hatte.
Es klopfte, und Mariella, etwas außer Atem, trat ein. Sie gab ihm einen Briefumschlag und blieb unschlüssig stehen.
Tom sah sie fragend an.
»Ich soll auf Ihre Antwort warten«, erklärte sie.
Er öffnete den Umschlag und las:
Dr. P.S.
Sehr geehrter Herr Elmer,
willkommen in der Villa Aurora.
Falls Sie keine anderen Pläne haben, würde es mich freuen, Sie zu einem Willkommensdinner empfangen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Peter Stotz
20 Uhr, Formal Business
Tom sah von der Einladung auf und begegnete Mariellas erwartungsvollem Blick. »Kommen Sie?«, fragte sie.
»Gerne«, antwortete er.
Sie verließ den Raum, und Tom setzte sich an den Schreibtisch, klappte seinen Laptop auf und googelte »Formal Business«.
Es handelte sich um einen Dresscode. Dunkler Anzug, schwarz oder mitternachtsblau, weißes Hemd, Krawatte und schwarze Schuhe aus glattem Leder.
Einen dunklen Anzug besaß er, ein weißes Hemd auch, aber seine einzigen schwarzen Schuhe waren mit perforiertem Leder verzierte Halbschuhe im Golflook. Nun, sein Gastgeber würde darüber hinwegsehen müssen.
Die Dusche besaß eine Regenbrause, eine Handbrause und an den Wänden Massagebrausen. Tom stand mit geschlossenen Augen da und genoss, wie das warme Wasser von allen Seiten auf ihn einprasselte.
Hoffentlich, dachte er, lebt der Alte noch etwas länger als nur ein Jahr.
Mit dem Krawattenbinden hatte er nach wie vor ein wenig Mühe. Er lächelte sich im Spiegel an und murmelte: »Nun hast du also doch einen Krawattenjob.«
6
Um fünf vor acht verließ Tom seine Wohnung und trat auf die Diele. Nur ein schmaler Lichtstreifen fiel aufs ansonsten dunkle Parkett. Er kam von einer Tür, die ein wenig offen stand. Er ging langsam an ihr vorbei und warf einen Blick hinein. Soviel er durch den schmalen Spalt erkannte, war es eine Nähstube. An dem Stück Wand, das er sehen konnte, hingen Stickereien, und vor einem Polstersessel fiel sein Blick auf einen Ständer mit einem Stickrahmen.
Tom war ein neugieriges Kind gewesen, das hatte seine Mutter immer gesagt. Und als sein Vater sehr viel später erfuhr, dass Tom Jura studieren wolle, meinte er: »Die Neugier gehört zum Beruf des Anwalts. Aber auch die Diskretion. Und die verträgt sich nicht so gut mit der Neugier.«
Diskret war er geworden und neugierig geblieben. Er stieß die Tür vorsichtig ein kleines Stück weiter auf.
Neben dem Stickrahmen stand ein kleiner dreibeiniger runder Tisch. In dessen Mitte ein Bilderrahmen mit dem Schwarz-Weiß-Foto einer jungen Frau. Sie saß vor einer Bücherwand und sah vom Buch auf, das sie auf den Knien hielt.
Es war die Vorlage des Ölgemäldes in der Diele.
Tom ging die Treppe hinunter. Aus der weit offenen Salontür klang Opernmusik.
Dr. Stotz erwartete ihn vor dem Kamin. Auf einem Beistelltischchen standen zwei Champagnergläser. Er ließ den rechten Griff des Rollators los, bückte sich unsicher, nahm eines der Gläser und reichte es Tom. Dann hob er das zweite, stieß mit seinem Gast an und sagte: »Herzlich willkommen. Auf gute Zusammenarbeit.«
Sie setzten sich, und Dr. Stotz bemerkte im Konversationston: »Ein Blanc de Noir. Weißer macht mich nervös.«
Sie tranken beide einen Schluck. Es schien Tom, als nähme die Haut des alten Herrn sofort ein wenig Farbe an.
»Das erste Geheimnis, das ich Ihnen verraten muss: Ich bin kein sehr ordentlicher Mensch. Es ist Ihre Aufgabe, mich posthum als ordnungsliebend erscheinen zu lassen. Das zweite Geheimnis über mich: Ich bin kein uneitler Mensch. Ich habe mein ganzes Leben versucht, der Welt ein bestimmtes Bild von mir zu vermitteln. Ihre Aufgabe besteht darin, dieses auch für die Nachwelt zu bewahren.«
Dr. Stotz trank wieder einen Schluck, Tom tat es ihm nach.
»Das dritte Geheimnis ist für Sie bereits keines mehr: Ich bin ein geschwätziger alter Mann.« Er leerte das Glas und suchte mit dem Fuß die Klingel unter dem Teppich.
»Und jetzt Sie.«
Doch bevor Tom ansetzen konnte, betrat ein großer älterer Herr den Raum. Er trug einen schwarzen Abendanzug und eine Fliege. Wortlos ging er zum Eiskübel, entnahm ihm die Champagnerflasche und schenkte nach.
»Das ist Roberto«, erklärte Dr. Stotz. »Er kümmert sich seit über vierzig Jahren um mich. Und heute Abend auch um Sie.«
Roberto bestätigte dies mit einem formellen Nicken. Als er den Raum verlassen hatte, erklärte Dr. Stotz: »Er war als junger Mann der Maître d’hôtel im Excellence. Ich habe ihn abgeworben. Etwas vom Gescheitesten, was ich je getan habe.« Er lächelte. »Also. Nun Sie.«
»Ich habe keine Geheimnisse«, antwortete Tom, »dafür hatte mein Vater unzählige.«
»Zum Beispiel?«
»Das größte: Er war pleite.«
»Das zweitgrößte?«
»Die tausend Geheimnisse, die dazu geführt haben.«
Dr. Stotz musste wieder die Fußklingel betätigt haben, denn Roberto kam herein. Stotz machte ihm ein Zeichen, und der – durfte er ihn als Butler bezeichnen? – trat heran, half ihm aus dem Sessel und begleitete ihn hinaus.
»Entschuldigen Sie mich einen Moment.«
Die Oper war zu Ende, die Stille wurde nur noch durch das Knistern des Kaminfeuers gestört, aus der Glut war eine Flamme hochgeschossen.
Tom nippte an seinem Glas und ließ den Blick durch den Raum schweifen. Er glich mehr einer Bibliothek als einem Salon. Es schien, als hätten die Bücher mit den Jahren von ihm Besitz ergriffen, wie die Natur manchmal von der Zivilisation. Einfache Bücherregale unterschiedlicher Machart waren den im Stil der niedrigen Wandtäfelung fest eingebauten Nussbaumregalen hinzugefügt worden. Sie hatten wohl das ursprüngliche Mobiliar verdrängt und bedrängten nun die Bilder an der Wand. Schweizer Kunst aus den Achtzigerjahren. Tom glaubte, einen Martin Disler, einen Dieter Roth, einen Fischli/Weiss und wahrscheinlich einen Meret Oppenheim zu erkennen.
Zwischen zwei Regalen war eine einzelne, schmale Konsole angebracht. Einige Gegenstände lagen darauf, und ein kleiner Spot beleuchtete ein gerahmtes Foto, das darüber an der Wand hing. Tom stand auf und ging hin, um zu sehen, ob er richtig vermutete.
Ja, es war wieder die junge Frau. Daneben lagen eine einfache Haarspange aus Schildpattimitat, ein silbernes Dupont-Feuerzeug, ein Paar Perlen-Ohrstecker, ein Bleistiftabsatz.
Die Tür ging auf, und Roberto begleitete Dr. Stotz zurück.
»Vielleicht ist das mein Geheimnis«, erklärte Tom etwas verlegen, »ich bin neugierig.«
»Das gehört zu einem Anwalt«, antwortete Dr. Stotz, »aber hoffentlich gepaart mit Diskretion.«
Tom war überrascht. »Das hat mir, außer meinem Vater, noch nie jemand gesagt.«
Sie setzten sich wieder.
»Verzeihen Sie die Unterbrechung. Sie werden sich daran gewöhnen müssen. Ich habe keinen Magen mehr.«
»Oh«, antwortete Tom, mehr fiel ihm dazu nicht ein.
»Aber keine Angst, Sie müssen mich nicht begleiten, ich kann auch allein gehen. Nun zurück zur Neugier.« Dr. Stotz hob das Glas vor den Mund. »Sie wollen wissen, wer die junge Frau ist.«
»Ja. Die Neugier.«
Dr. Stotz nahm einen Schluck und stellte das Glas zurück. »Das ist eine lange Geschichte. Ich werde sie Ihnen nicht ersparen können. Aber nicht gleich jetzt.«
7
Roberto kam herein und verkündete: »Dinner is served.«
Sie erhoben sich, und Dr. Stotz raunte Tom zu: »Manchmal sagt er sogar: ›Es ist angerichtet.‹«
Tom schob ihm den Rollator zu, aber sein Gastgeber sagte: »Wenn Sie erlauben«, und hängte sich bei ihm ein. »In gewissen Situationen versuche ich die Würde zu wahren, und die verträgt sich schlecht mit diesem Ding.«
Sie folgten Roberto ins Speisezimmer.
Tom war nicht besonders groß, etwa eins achtundsiebzig. Aber der alte Mann reichte ihm nur bis zur Schulter, obwohl er sich noch erstaunlich gerade hielt. Seine Hand umklammerte Toms Unterarm hart wie eine Zange. In dieser Nähe drang durch den Tabakgeruch ein diskreter Duft, den Tom zu erkennen glaubte, und der ihn deshalb etwas irritierte: Knize Ten, ein altmodisches Eau de Toilette, das sein Vater benutzt hatte.
Auch im Esszimmer standen Bücherregale, denen man ansah, dass sie nicht immer hier gestanden hatten. Und auch hier fiel Tom sofort ein Bild der jungen Frau auf. Diesmal war es ein großes fotorealistisches Porträt. Es zeigte sie lächelnd, die schwarzen Haare über die linke Schulter fließend, eine große Hibiskusblüte hinter das rechte Ohr gesteckt.
Dr. Stotz blickte zu Tom herauf. »Ja, wieder sie.«
Sie setzten sich an den Tisch. Roberto schenkte aus einem Dekanter einen Fingerbreit fast schwarzen Rotwein in das Glas von Dr. Stotz. Dieser kostete konzentriert und mit geschlossenen Augen. Dann nickte er. »Im Unterschied zum Magen funktioniert der Gaumen noch. Wenn Sie zur Vorspeise lieber Weißen wünschen, sagen Sie es einfach. Ich trinke nur noch Roten. Zu Mariellas Küche passt der ohnehin besser.«
Tom blieb auch beim Rotwein.
Während des Essens ließ Tom den Blick immer wieder zu den Bücherregalen schweifen.
»Sie fragen sich, ob ich die alle gelesen habe, nicht wahr?«
»Haben Sie?«
»Die allermeisten. Ich habe mein ganzes Leben immer gelesen. Fachliteratur ungern, aber Romane habe ich verschlungen. Das bitte ich Sie jedoch der Nachwelt umgekehrt zu überliefern. Ich liebe die Fiktion entschieden mehr als die Realität. Und Sie? Lieben Sie Geschichten?«
Tom musste kurz überlegen. Dr. Stotz ließ ihm keine Zeit zu antworten.
»Ein guter Anwalt sollte der Dichtung mehr verpflichtet sein als der Wahrheit.«
Tom hatte die Antwort: »Ja. Ich mag Geschichten.«
»Seien Sie froh. Ich werde Ihnen nämlich viele erzählen, fürchte ich.«
Nach dem Essen – Pennette alla Norma und Orata al forno con patate – gingen sie zurück zu den Sesseln vor dem Kamin. Jemand hatte Holz aufgelegt, das jetzt in hohen Flammen loderte.
»Mit Feuer kann ich besser denken. Es ist wie etwas Lebendiges, das mir Gesellschaft leistet. Man muss es zwar füttern wie einen Hund, aber Gassi gehen muss man nicht.« Dr. Stotz lachte kurz auf. »Ich weiß, dass Feuer nur eine Redoxreaktion ist, dennoch kommt es vor, dass ich mit ihm rede. Mariella denkt dann, ich führe Selbstgespräche, dabei rede ich mit dem Feuer. Es antwortet zwar nur mit einem gelegentlichen Knacken oder Fauchen, aber mir sind wortkarge Zuhörer ohnehin lieber als gesprächige.«
Nach einer Pause fügte er hinzu: »Verstehen Sie mich nicht falsch, Zwischenfragen sind Ihnen selbstverständlich gestattet. Sonst hätte ich nicht einen Anwalt gesucht.«
»Also, eine Zwischenfrage zum Feuer: Wie halten Sie es damit im Hochsommer?«
Stotz deutete nach oben. »Aircondition. Und jetzt habe ich ja ein richtiges Lebewesen, das mir Gesellschaft leistet und zuhört.«
Tom spürte wohl die Wirkung des Weins, sonst hätte er nicht gesagt: »Einen bezahlten Zuhörer.«
Dr. Stotz zögerte nur kurz. »Das Feuer ist auch bezahlt. Günstiger, allerdings.«
Dr. Stotz hatte nebenbei eine Pfeife gestopft und zündete sie jetzt an.
»Auch das ist ein kleines Feuer, mit dem ich mich manchmal unterhalte. Stört es Sie eigentlich, wenn ich rauche?«
»Nein. Ich habe auch geraucht, als ich jünger war.«
Dr. Stotz fand das so lustig, dass es ihm die Zähne entblößte. Sie waren sehr weiß für einen alten Pfeifenraucher.
Roberto erschien, wohl durch die Fußklingel herbeigerufen. »Den Achtunddreißiger, bitte«, bat der Gastgeber.
Roberto stellte je einen Cognacschwenker auf die Beistelltischchen neben den Sesseln, entfernte sich und kam mit einer Flasche zurück.
»Armagnac«, erklärte Stotz, »mein Jahrgang. Kosten Sie.«
Tom führte den Schwenker an die Nase, roch, ließ die dunkelbraune Flüssigkeit etwas im bauchigen Kristallglas kreisen, wie es sein Vater immer mit Cognac getan hatte, und nahm einen kleinen Schluck. Sein Mund füllte sich mit etwas Mildem, Rundem, Weichem. Erst als er es schluckte, hinterließ es ein gutmütiges Brennen.
»Nicht der beste Jahrgang«, kommentierte Dr. Stotz, »aber für mich hat er ganz gut gereicht.«
Er stellte das Glas ab und gab Tom das Dokument, das daneben gelegen hatte. »Das ist mein offizieller Auftrag an Sie als Anwalt. Bitte unterschreiben Sie. Damit sind Sie dann an das Anwaltsgeheimnis gebunden.«
8
Es war weit nach Mitternacht, als Tom zum ersten Mal am neuen Ort zu Bett ging. Er war nicht angeheitert, er war betrunken.
Dr. Stotz hatte darauf bestanden, ihn bessere Jahrgänge kosten zu lassen. Und zum Schluss musste er unbedingt noch den Direktvergleich der letzten beiden Jahrhundertwenden vornehmen. Zur Überraschung von keinem der beiden war der Neunzehnhundertnullnuller einiges besser als der Zweitausender.
Seinem Gastgeber war nichts anzumerken gewesen. Die Farbe seiner Wangen war zwar etwas lebhafter geworden, aber seine Aussprache hatte sich nicht verändert, nur der Inhalt seiner Erzählungen wurde blumiger.
Ab und zu hatte er seinen Redefluss für einen Toilettengang unterbrochen. Auch dabei war ihm nichts anzumerken gewesen, im Gegenteil: Er brauchte dazu nun nicht mehr Robertos Hilfe, und Tom hatte das Gefühl, auch seine Schritte seien jetzt sicherer.
Nach dem letzten Toilettenbesuch ertappte Dr. Stotz seinen Gast bei einem kaum unterdrückten Gähnen.
»Es gibt verschiedene Gründe zu gähnen«, erklärte er lächelnd. »Angesteckt habe ich Sie wohl kaum, ich habe nicht gegähnt. Vielleicht hat mein treues Feuerchen zu viel Sauerstoff verzehrt? Oder war es aus Langeweile? Ich hoffe doch nicht. Ich will es der Müdigkeit zuschreiben. Ein langer Tag, ein Umzug und viele neue Eindrücke, das kann einen jungen Menschen schon ermüden. Füttern Sie noch mal meinen netten Gesellschafter mit zwei Scheiten, dann verrate ich Ihnen ein weiteres Geheimnis und lasse Sie danach zu Bett gehen.«
Tom legte zwei neue Scheite auf die Glut und setzte sich wieder.
Dr. Stotz nippte an der Jahrtausendwende und begann: »Das Thema ist die Vernunft, diese spröde Jungfer. Sie hat mir ein Leben lang vor der Sonne gestanden. Sie hat mich herumkommandiert wie eine Gouvernante. Und ich Trottel habe ihr immer gehorcht. Sie hat mich zu einem anderen Menschen gemacht als der, der ich sein wollte.«
Stotz machte eine Kunstpause. »Wissen Sie, was ich wirklich sein wollte?«
Noch eine Kunstpause.
»Künstler.«
Erwartungsvolles Schweigen.
Tom quittierte das mit einem überraschten »Wirklich?«
»Ich war ein ganz guter Zeichner in meiner Jugend, spielte recht ordentlich Klavier, vor allem Jazz, und hätte, wenn es mir von Tante Vernunft vergönnt gewesen wäre, meinen Lebensunterhalt als Barpianist bestreiten können. Ich besaß Fantasie und konnte träumen, Geschichten erzählen und sie auch schreiben. Aber nichts davon habe ich ausleben dürfen.«
Seine Pfeife war ausgegangen. Er legte sie auf den Aschenbecher und fuhr fort.
»Es waren nicht meine Eltern, die es verhinderten, keineswegs. Meine Eltern waren einfache Leute, der Vater kleiner Beamter, die Mutter Hausfrau, die mit etwas Heimarbeit – sie war eine gute und schnelle Näherin – ein wenig dazuverdiente. Nein, meine Eltern hatten sich nie eingemischt in die Frage, was ich werde. Nur wie, das interessierte sie. Anständig, ehrlich, höflich, das musste ich sein und bleiben.«
Dr. Stotz hatte nach diesem Geständnis eine Pause gemacht und dann leicht verwundert hinzugefügt: »Warum erzähle ich Ihnen das bereits bei unserem ersten Kamingespräch? Sie denken wohl, weil ich zu viel getrunken habe. Mag sein. Aber nicht nur deshalb. Vor allem, weil der, der meinen Nachlass ordnen und« – lächelnd fügte er ein – »etwas beschönigen soll, von Anfang an wissen muss, mit wem er es in Wahrheit zu tun hat.«
Dr. Stotz erhob seine bisher immer leise Stimme: »Herr Elmer, Sie haben einen Künstler vor sich.«
»Alles klar«, sagte Tom.
Der Fuß von Dr. Stotz tastete nach der Klingel. »Sie sind Jahrgang zweiundneunzig, wollen wir ihn degustieren? Als Schlummertrunk?«
»Wann ist Arbeitsbeginn am Morgen?«
»Neun Uhr. English. Frühstück um acht.«
»Dann gehe ich besser hinauf.« Tom stand auf und merkte, dass er nicht mehr so sicher auf den Beinen war.
Dr. Stotz merkte es auch. »Ja. Sie gehen besser schlafen.«
»Und Sie?«
»Ich werde noch Ihren Jahrgang kosten und dazu mit meinem geduldigen Colonel Fire sprechen. Bitte gönnen Sie ihm noch ein Scheitlein oder zwei. In meinem Alter braucht man nicht mehr viel Schlaf.«
In der Nähstube auf der Diele oben brannte noch immer Licht. Tom stieß die Tür ganz auf und trat ein.
Es war keine Nähstube, in der er sich befand. Es war eine Stickstube. Auf einem Regal lagen Stickrahmen verschiedener Formen und Größen, einige davon bespannt, zwei davon mit angefangenen Arbeiten. Überall an den Wänden hingen Stickereien. Es war ihnen anzusehen, dass sie nicht von Vorlagen kopiert waren, sie waren kreiert. Kleine Kunstwerke, abstrakt oder figürlich. Alle ausdrucksvoll und eigenständig.
Er ging zum Bild der jungen Frau und fragte mit etwas klobiger Zunge: »Und dein Geheimnis?«
Er schlief nicht gut zum ersten Mal am fremden Ort. Wie in den Zimmern seiner Kindheit wurde es ihm im Dunkeln unheimlich.
Tom war ein ängstliches Kind gewesen. In den ersten Lebensjahren hatte er wohl fast jede Nacht geweint und den Eltern von Gespenstern an der Wand und Teufeln neben dem Bett erzählt. Und auch mit sieben oder acht hörte er nachts noch Schritte und Stimmen, Bewegungen hinter Vorhängen, Gelächter in der Stille.
Wenn seine Eltern ausgingen, mussten sie immer Babysitter organisieren. Und als sie sich trennten, war sein Vater gezwungen, Nannys anzustellen. Sie kamen über verschiedene Londoner Nanny-Agenturen und blieben nie lange. Tom wusste nicht, weshalb, aber später hatte er den Verdacht, dass sein Vater der Grund gewesen sein könnte.
9
Der modernste Raum hier unten war der Weinkeller. Er wurde von einem leise brummenden, schläfrig blinkenden Gerät konstant befeuchtet und von einer Klimaanlage auf zwölf bis vierzehn Grad gekühlt. Der Boden bestand aus Kork. Die gut bestückten Regale waren die gleichen wie die, die ihm ein wohlhabender Bekannter seines Vaters einmal stolz präsentiert hatte. Sie waren mit Sensoren ausgerüstet, die den Code auf den Flaschen lesen konnten. Sie übertrugen deren Daten auf den Computer, der genau Buch führte über Abgänge, Zugänge, Lagerzeiten und ideale Reife und was der Önologe sonst noch über seinen Wein wissen musste.
Der zweitmodernste Raum war die Waschküche. Wasserabweisend weiß, Waschmaschine und Tumbler Hightech-Profi-Geräte, etwa doppelt so groß wie die der Gemeinschaftswaschküche von Toms früherer Wohnung.
Der altmodischste Raum war das Archiv. Es sah nicht aus, als hätte man es in den letzten Jahrzehnten renoviert, und war mit geschraubten Blechregalen verstellt, alle voller farbiger Ordner mit mal handschriftlichen, mal getippten Etiketten.
Der Raum war ungeheizt bis auf einen neuen Elektroofen, der wahrscheinlich im Hinblick darauf angeschafft worden war, dass das Archiv, zumindest zum Teil, Toms Arbeitsplatz werden würde.
Neben dem Ofen stand ein Schredder, der ebenfalls ungebraucht aussah.
Mariella entschuldigte sich mit einem bedauernden Gesichtsausdruck für den Arbeitsplatz und führte Tom wieder hinauf. »Der Dottore erwartet Sie in seinem Büro.«
Dr. Stotz saß hinter einem mächtigen Mahagonischreibtisch, auf dem sich Akten stapelten, bewacht von Ebenholzschnitzereien aus aller Welt.
Sein Chef sah von seinem Buch auf und legte die Lupe zur Seite. »Das ist Ihr Platz.« Er deutete auf den Schreibtisch mit Glasplatte, dessen Stirnseite an die des Mahagonischreibtisches anschloss. Ein Computer stand darauf.
»Apple für Sie, nicht?«, fragte Dr. Stotz.
»Genau. Woher wissen Sie das?«
»Apple oder Windows, Frisch oder Dürrenmatt, Beatles oder Stones – ich habe es meistens erraten. Setzen Sie sich, bitte.«
Tom nahm auf dem Bürostuhl Platz und sah sich um. Auch dieser Raum glich mehr einer Bibliothek als einem Arbeitszimmer. Nur in einem der Regale standen Ordner, in einem anderen waren es Lexika und Fachliteratur. Der Rest war Belletristik.
Lose Akten stapelten sich auch auf dem Boden und auf jeder Abstellfläche. Und auch hier hatte die Literatur der bildenden Kunst nicht viel Raum gelassen. Und auch hier gab es eine Konsole, die aussah wie ein Altar mit einem Heiligenbild. Die Heilige war wieder die junge Frau, flankiert von Blumen und umstellt von Fundstücken eines Lebens. Darunter eine richtige Heilige: eine kleine schwarze Madonna mit einem Mantel aus purpurfarbenem Kunststoff. Sie und das Jesuskind in ihrem linken Arm trugen goldene Kronen. Um den Hals hatte sie eine Kette mit einem Kreuz, und in der Rechten hielt sie noch eines. Beide waren golden bemalt wie auch die Borten der Talare von Mutter und Kind.
Dr. Stotz bemerkte Toms Blick auf den Altar und sagte: »Später.« Und nahtlos fuhr er fort: »Wie Sie sehen, befindet sich an jedem Ihrer Arbeitsplätze ein Aktenvernichter. Ich bitte Sie, beide eifrig zu benutzen. Das meiste von dem, was sich angesammelt hat, können Sie schreddern. Ich möchte einfach, dass jedes Blatt, das der Reißwolf zu fressen bekommt, noch einmal in die Hand genommen und beurteilt wird. Sie entscheiden, ob es etwas für die Archive der Unternehmen sein könnte, die ich geführt und verwaltet habe. Oder etwas, das geschreddert wird. Oder etwas, das hilfreich sein könnte für jemanden, der sich mir einst biografisch widmen möchte. Ich glaube zwar nicht, dass das jemals der Fall sein wird, aber mir sind in meinem Leben schon so viele uninteressante Biografien in die Hände gekommen, dass ich es nicht ganz ausschließen kann.«
Mariella brachte Kaffee und ein paar Amaretti. Dr. Stotz wartete, bis sie gegangen war. Dann sagte er: »In diesem Mäppchen neben Ihrem Computer befindet sich eine Liste.«
Tom nahm sie heraus. Sie war in Stotz’ Handschrift.
Kindheit
Frühe Jugend
Ausbildung
Studium
Militär
Doktorat
Unternehmensberatung
Zunft
Partner
Mandate
Verwaltungsratssitze
Politik
Kultur
Gesellschaftliches
»Zu jedem dieser Stichworte habe ich notiert, was Sie erwähnen und dokumentieren sollen. Alles andere …« Er deutete auf den Reißwolf.
Tom nickte nur.
Sein Gesichtsausdruck ließ Dr. Stotz sagen: »Das ist keine Geschichtsfälschung. Es ist Geschichtsgewichtung. Geschichte wurde seit jeher gewichtet, das wissen Sie doch.«
Tom nickte. »›Nicht die ganze Wahrheit sagen ist nicht gelogen.‹ Auch von meinem Vater.«
»Scheint ein kluger Mann gewesen zu sein.«
»Nicht in jeder Beziehung.«
Dr. Stotz lächelte. »Wie wir alle.«
Und dann zurück zum Thema: »Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen: Einige Ordner, die blauen, sind maschinenbeschriftet. Das sind die, die von meiner persönlichen Assistentin Chantal Favre angelegt wurden. Sie hat mir nach ihrer Pensionierung eine ganze Wagenladung nach Hause geliefert. Ich gehe davon aus, dass sie sehr ordentlich geführt und vollständig sind. Bestimmt zu vollständig. Da geht es mir weniger um die geschichtlichen Auslassungen, sondern eher um die Vermeidung – nein, das wäre zu viel verlangt –, um die Verringerung der Langeweile.
Frau Favre war über dreißig Jahre bei mir, die treue Seele. Unglaublich tüchtig und präzise. Wenn Sie Fragen haben, die ich nicht beantworten kann – und das werden viele sein –, dann ist sie die richtige Adresse. Sie ist ein wandelndes Lexikon. Und eine gefährliche Geheimnisträgerin. Ich stelle Sie einander vor, sie kommt morgen zum Mittagessen. Das ist doch in Ordnung so? Ich dachte sowieso, dass wir jeweils miteinander lunchen könnten. Mariella kocht hervorragend, das haben Sie ja gestern feststellen können.«
Als Tom kurz zögerte, fügte Dr. Stotz hinzu: »Wann immer Sie etwas anderes vorhaben, lassen Sie es uns einfach am Vortag wissen.«
»Das wird selten vorkommen«, versicherte Tom, »bei dieser Küche. Obwohl – ich bin am Abnehmen.«
»Ich auch«, grinste Dr. Stotz, »nur nicht ganz freiwillig.«
»Bei mir ist es eher präventiv.«
»Sie hätten mich sehen sollen in Ihrem Alter.«
Das hatte Tom, als er Dr. Stotz gegoogelt hatte. Er war ein untersetzter, schwerer Mann gewesen. Verglichen damit war Tom schlank. Aber nicht ganz so, wie er es gerne gewesen wäre. Seit er zwanzig war, machte er immer wieder Diäten. Zum Beispiel jetzt, theoretisch. Er war ein Jo-Jo-Mann.
Dr. Stotz stemmte sich aus seinem Bürostuhl und angelte sich den Rollator. »Bitte entschuldigen Sie mich. Ich schlage vor, Sie beginnen im Archiv unten. Ich erwarte Sie um zwölf Uhr fünfzehn zum Mittagessen. Dann werde ich Ihnen Ihre drängendste Frage beantworten.«
Er deutete auf das Bild der jungen Frau und steuerte auf die Tür zu, hinter der, wie ihm Mariella verraten hatte, sich Dr. Stotz’ private Räume befanden.
Tom verbrachte den Rest des Vormittags im Archiv und begann mit seiner langweiligen Arbeit.
10
Tom betrat den Salon gleichzeitig mit Dr. Stotz. Der hellblaue Anzug, den dieser jetzt trug, saß ihm etwas schlabberig, und die Weite des Hemdkragens kaschierte er mit einem bunten Foulard.
»Ich pflege mir vor dem Lunch einen kleinen Sherry zu genehmigen. Machen Sie mit?«
»Ich trinke zum Mittagessen nur Alkohol, wenn ich am Nachmittag nicht arbeite«, erwiderte Tom.
»Das habe ich früher auch so gehalten. Aber mit Ausnahmen. Heute machen wir eine.«
Tom zögerte, aber Roberto nahm ihm die Entscheidung ab. Er betrat den Raum mit einem Silbertablett, darauf zwei kleine Gläser mit Sherry.
Dr. Stotz nahm eines und Tom das andere.
»Sherry ist ein Stehgetränk, fand ich immer. Und halte mich bis heute daran, auch wenn ich nicht mehr so gut stehe. Es ist kein Plauderdrink, man kippt ihn en passant. Ein beiläufiger Magenöffner, wie ich ihn früher nannte.« Und lächelnd fügte er hinzu: »Als ich noch einen hatte. Cheers.«
Der Sherry war kalt und mild. Sie stellten die leeren Gläser zurück auf das Tablett, mit dem Roberto gewartet hatte, er kannte das Prozedere.
Dr. Stotz spannte die Bremsen des Rollators und bat um Toms Arm. Sie gingen ins Esszimmer und setzten sich an den Tisch.
»Darf ich Sie bitten, den Wein einzuschenken?«
Tom stand auf und schenkte aus der Karaffe ein. Sich nur wenig.