
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Als Emma von Dijk in einem Kaffee von einem böswilligen Daimon angegriffen wird und dabei fast in den Tod stürzt, stellt sich ihre Welt auf den Kopf. Ihre Retter bringen Sie in die Kirche der Nacht, ein Institut für Hexen und Pugnator, sogenannten Daimonjägern. Doch immer mehr Geheimnisse kommen ans Licht, die ihr bisheriges Leben in Frage stellen. Als Emma auch noch Entführt wird, um Informationen über ihren besten Freund preiszugeben, will Sie ihr leben selbst in die Hand nehmen. Emma will das machen wofür Sie geboren wurde -Kämpfen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophie Marie Gose lebt in einer gemütlichen Wohnung in Auenwald. Ihre große Leidenschaft sind Bücher und das Fechten. Nach ihrem Lyrikband „Tintenklecks -Gedichte meiner Seele“ ist dies Sophie Marie Goses erster Roman.
Für meine Eltern, die immer für mich da sind.
Für meinen Bruder, der mein bester Freund ist.
Für Alex, der immer an mich glaubt.
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHSZEHN
SIEBZEHN
ACHZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
WORTVERZEICHNIS
MADAME BLAIRS MAGISCHER KAFFEE
PROLOG
Staub rieselte von dem Wandteppich auf mich nieder und kitzelte mich gefährlich in der Nase. Ich atmete durch den Mund und versuchte ein Niesen zu unterdrücken, ich muss die Wächter nicht noch extra auf mich aufmerksam machen. Die ganze Wand war mit aufwendiger Malerei verziert. Sie erzählte Geschichten von längst geschlagenen Schlachten, von Liebe und Tod. Und mittig, direkt auf meiner Augenhöhe, befand sich das kleine Schloss. Auf dem ersten Blick wirkte es wie gemalt, gemalt aus Öl auf Holz, doch wenn man es berührte, verriet das kalte Metall die Illusion. Schnell steckte ich den Schlüssel in das Schloss und drehte ihn um.
Langsam schob sich die Wand zur Seite. Panisch drehte ich mich um. Warum dauerte das so lange? Die Schritte wurden lauter und lauter.
Endlich war der Spalt groß genug, sodass ich mich durch ihn hindurch quetschen konnte. Sofort wurde ich von der schützenden Dunkelheit umschlossen, geschützt vor den Blicken der nahenden Soldaten.
Ich rannte los. Ich würde gar nicht erst darauf warten dass sich die Wand schloss. Ich hatte kein Licht. Meine Hände tasteten sich an der kalten Wand entlang-So würde ich zumindest merken wenn eine Abzweigung kam. Theoretisch kannte ich den Weg: bei der ersten Abzweigung nach rechts, dann die Treppe runter, nach zwei Abzweigung nach links, zwei Stufen hoch. Danach 100 Meter geradeaus, mit den Händen die Decke abtasten, die Falltür finden, öffnen, nach oben ziehen. Das war der Weg in die Freiheit … oder in den sicheren Tod.
Ich kam ins Straucheln und kickte einen kleinen Stein, welcher auf den Boden lag, ein Stück tiefer in den Tunnel. Ich konnte mich noch rechtzeitig abfangen, bevor ich auf den kalten Boden fiel, doch der Stein halte laut in dem Tunnel wieder. Am liebsten hätte ich mich selbst für meine Dummheit geohrfeigt. Ich war so in meine Gedanken vertieft gewesen, dass ich vergessen hatte auf meinen Weg zu achten. Wenn ich mich jetzt nicht konzentrierte, würden mich die Wächter schnappen, noch eher ich auch nur „Freiheit“ sagen konnte, oder ich würde über irgendetwas stolpern, mir das Genick brechen und von Ratten gefressen werden. Ich schüttelte den Kopf, um die düsteren Gedanken zu verjagen. Ich musste mich konzentrieren und da half es nicht gerade über den Tod nachzudenken. Ich kannte den Weg, jetzt muss ich ihn nur noch bewältigen und schauen, dass ich über den Zaun kam. Das war doch gar nicht so schwer? Der Zaun war ja auch nur drei Meter hoch und stand unter Hochspannung. Eine kleine Strähne hatte sich aus meinem Zopf gelöst und kitzelte mich an der Nase, schnell blies ich mir sie aus dem Gesicht.
„Ein Tunnel!“
Laut hallte die Stimme eines Wächters im Tunnel wieder und ich zuckte erschrocken zusammen. Sie hatten den Tunnel entdeckt! Ab jetzt durfte mir kein Fehler unterlaufen, ich durfte weder eine falsche Abzweigung nehmen, noch zu langsam laufen.
Es durfte nicht mehr lange bis zur ersten Abzweigung dauern. Laut hallten meine patschenden Schritte von den Wänden wieder und vermischten sich mit meinem keuchenden Atem. Diese Geräusche schienen den gesamten Tunnel zu erfüllen. In diesem Moment griff meine rechte Hand ins Leere. Ich reagierte rechtzeitig und bremste schlitternd ab, um die Kurve zu bekommen. Nun hatte ich einen Vorteil! Sie hatten zwar Licht, doch ich kannte den Weg – zumindest theoretisch. Aber das war besser als nichts. Neu gefundene Hoffnung keimte in mir auf, glühend heiß, wie die Sonne und verdrängte für einen Moment meine Angst. Ich konnte es wirklich schaffen! Allein dieser Gedanke trieb mich voran und ließ mein Herz noch wilder pochen. Das Adrenalin war berauschend und löste ein plötzliches Glücksgefühl in mir aus. Ich verlangsamte meine Schritte etwas, um nicht plötzlich von der Treppe überrascht zu werden.
Plötzlich erklang im Tunnel ein neues Geräusch und passte sich mit meinen Schritten an. Die Schritte der Wächter wurden lauter und hallten bedrohlich von den Wänden wieder. Mein Herz raste wie verrückt und pochte hart gegen meine Brust. Bei jedem Atemzug zog sich meine Lunge schmerzhaft zusammen und schien gegen die eisige Luft im Tunnel zu rebellieren. Ich konnte jeden Muskel in meinem Körper spüren, jede einzelne Faser, spürte, wie sie sich dehnte und wieder zusammenzog, spürte das Pulsieren in meinen Adern. Hundert Messer schienen auf meinen Körper einzustechen, doch ich konnte nicht langsamer werden. Mein Fuß trat ins Leere. Mein Herz setzte für einen Moment aus und nur mit Mühe konnte ich einen Aufschrei unterdrücken, als ich auf einem Stein aufkam. Die Treppe! Vorsichtig tastete ich mich die Wendeltreppe hinab. Die Stufen waren feucht und mehrmals drohte ich auszurutschen.
„... teilen uns auf!“
Schwach drang das Echo der Wächter zu mir hinab. Sie hatten also die Abzweigung erreicht. Aber warum teilten sie sich auf und orteten mich nicht einfach? Vielleicht war mir das Glück doch hold und das Funksignal war hier unten gestört. Noch hatte ich einen guten Vorsprung, die Wächter hatten in den engen Gängen sichtlich Schwierigkeiten mit ihrer dicken Uniform. Keuchend erreichte ich die nächste Abzweigung. Ich schlitterte elegant um die Kurve, stieß mich mit meiner linken Hand ab und rannte den nächsten Gang entlang. Ich hatte es bald geschafft. Verdammt, ich konnte es wirklich schaffen!
Ich beschleunigte meine Schritte. Meine Lunge drohte zu zerbersten, doch das war mir egal. Ich konnte es wirklich schaffen. Ich konnte vor diesem kranken System fliehen! Wie musste es wohl sein, einen ganzen Tag nichts zu tun? Ich konnte schlafen, den ganzen Tag! Die Gedanken an meine Zukunft berauschten mich und fast hätte ich glücklich aufgelacht.
Im Tunnel wurde es immer kälter. Tausend Eiskristalle schienen beim Einatmen meine Lunge zu zerschlitzen und mit jedem Atemzug, fiel es ihr schwerer, sich mit der Luft vollzusaugen.
Ich wusste nicht, wie lange ich schon rannte, als meine Hände endlich auf Holz stießen. Das Holz der Tür fühlte sich kalt und nass an. Mit einem kräftigen Stoß, stieß ich sie auf. Ich sprintete durch die Öffnung hindurch, bevor diese wieder schallend ins Schloss fiel. Ich war mir durchaus bewusst, dass das Geräusch im ganzen Tunnel widerhallen würde, doch die Wächter waren mir sowieso schon auf den Fersen. Warum also Rücksicht nehmen?
Die Decke war in diesem Teil des Tunnels deutlich niedriger gebaut worden als im restlichen Teil. Der Boden war von einem feuchten Film überzogen und immer wieder trat ich in eine kleine Pfütze. Das eisige Wasser fraß sich durch meine Schuhe und langsam verlor ich das Gefühl in meinen Zehen.
Ich hatte die grobe Ahnung, dass es noch klappt 200 Meter bis zum Treppenaufgang sein mussten. Das patschende Geräusch meiner Schritte schien immer lauter zu werden und der Geruch im Tunnel immer intensiver. Umso näher ich der Treppe kam, desto verwester roch es. Der Geruch war so intensiv, dass ich mich zusammenreißen musste nicht auf zustoßen. Mich würde es nicht wundern, wenn ich über einen toten Körper stolpern würde, oder mehrere, dem Geruch nach zu schließen. Was roch hier so bestialisch? Wie viele Lebewesen hatten hier unten schon ihr Leben gelassen. Das Glücksgefühl, welches bis eben meine Seele beherrscht hatte, wich zusehends der Angst. Was war hier unten gestorben? Und noch wichtiger, warum?
Ich schüttelte den Kopf, um die Gedanken aus meinem Kopf zu vertreiben. Ich wurde verfolgt! Obendrein nicht von irgendwem, sondern von den Gildesoldaten! Und da machte ich mir Sorgen, ob ich über einen toten Körper stolpere? Wenn sie mich schnappten, würde ich der nächste tote Körper auf dem Boden sein, welcher in dem Tunnel langsam vor sich hin verweste!
Wie weit war es noch bis zu den Stufen? Nicht mehr wie fünfzig Schritte. Ich begann jeden Schritt zu zählen um mich abzulenken. Es war ein schreckliches Gefühl, blind durch die Dunkelheit zu rennen und dabei noch verfolgt zu werden. Ich hatte Angst, schreckliche Angst. Außerdem wollte ich nicht über die Stufen stolpern, was sich dennoch nicht vermeiden lassen würde. Der eigentliche Grund, warum ich meine Schritte zählte, war wohl, dass ich zumindest ein bisschen Kontrolle über das haben wollte, was soeben passierte. Der Gedanke, dass ich abschätzen konnte, wann die Stufen kamen, beruhigte mich ungemein.
Klack!
Mit einem Rumsen stieß mein linker Fuß gegen etwas Hartes. Eine Welle des Schmerzes Überfluttete meinen Fuß und zum zweiten Mal an diesem Abend unterdrückte ich einen Aufschrei. Doch die Welle des Schmerzes wurde zugleich von Erleichterung verdrängt. Ich hatte die Treppe erreicht! Diesmal vorsichtiger als zuvor, tastete ich mich die zehn Stufen hinauf. Die letzte Stufe lag höher wie ihre Vorgänger, etwa kniehoch. Mit den Händen tastete ich vorsichtig danach und hievte mich hinauf. Erleichtert atmete ich ein. Doch schon im nächsten Moment bereute ich mein Handeln und drückte meine Nase in meine Armbeuge. Der ganze Gang war von so einem intensiven Verwesungsgeruch erfüllt, dass ich würgen musste. Der Geruch stieg von meiner Nase hinauf in meinen Kopf und verursachte ein schmerzhaftes Pochen.
Laut hallten die Schritte der Wächter hinter mir wider. Sie kamen immer näher und holten eschreckend schnell auf. Ich musste weiter.
Es war nicht mehr weit bis zur Luke, bis zur Tür in die Freiheit. Hundert Schritte musste ich noch schaffen. Hundert Schritte trennten mich noch vom Ausgang. Ich hielt mir die Nase zu und zwang mich durch den Mund diese widerliche Luft einzuatmen und weiterzugehen. Bedacht setzte ich jeden Schritt, achtete darauf keine Fehler zu machen, mich nicht zu verzählen. Ich lief langsam, zu langsam. Jeder einzelne Schritt schien doppelt so laut in dem Tunnel widerzuhallen. Jedes Platschen, jeder Tropfen, der von der Decke fiel, ließ mich zusammenzucken. Jetzt auf den letzten Metern, jetzt, wo ich mein Ziel näher als in meinen Träumen war, hatte ich mehr Angst als je zuvor geschnappt zu werden. Zu absurd war der bloße Gedanke, dass ich es geschafft haben könnte zu fliehen. Das war einfach so unreal. Doch was sollte ich eigentlich tun, wenn ich es geschafft hatte? Was, wenn ich entkam? Wo sollte ich hin? I Wie sollte es weitergehen?
Ein Geräusch ließ mich zusammen zucken. Unwillkürlich blieb ich stehen. Ich hielt für einen Moment die Luft an. Lauschte. Mein Herz klopfte viel zu laut, so laut, dass die Wächter es sicher schlagen hören konnten. Es müssten zehn oder zwanzig Sekunden vergangen sein, ehe ich es wagte mich zu regen. Ich hatte nichts mehr gehört. Keine Schritte, die sich näherten, keine Atemgeräusche - nichts. Was ich gehört hatte, war sicher nur das Echo meiner eigenen Schritte gewesen. 37 Schritte trennten mich noch vom Ausgang.
Mit einem natürlich lauten Planschen landete ein kleiner Wassertropfen auf meiner Nase. Erschrocken zuckte ich zusammen. Da war es wieder! Das leise Pochen, welches immer näher zu kommen schien. Auf mich zu! Ein weiteres Pochen gesellte sich zu dem ersten. Es dauerte nicht lange, dann schienen diese beiden unisono. Ein leises, bedrohliches Klopfen in der Ferne. Sie hatten mich gefunden! Diese Erkenntnis traf mich so plötzlich, dass ich einen Moment keine Luft bekam. Das Gefühl, das Verlangen mich hinzusetzen und zu weinen, überkam mich einen kurzen Moment, drohte mich zu bewältigen. Wie konnte ich nur jemals glauben ich könnte es schaffen? Mein ganzer Körper begann zu zittern. Ich rannte los und achtete darauf, dass meine Schritte weder zu kurz noch zu klein waren. 64, 65, 66 …
Ich war zu langsam. Diese Erkenntnis hing über meinem Kopf, wie eine Regenwolke an einem regnerischen Tag. Wie eine stumme Bedrohung, jederzeit bereit ihre Auswirkung zu zeigen.
Meine Atmung ging nur noch stoßweiße, die Angst schnürte mir meine Kehle zu. Das Pochen wurde lauter, es schien den gesamten Tunnel zu erfüllen, von den Wänden widerzuhallen. Ich konnte schon förmlich spüren, wie die Gildesoldaten ihre Hände nach mir ausstreckten, mich schnappten und in eines der Labore des Staatenbundes verfrachteten. Ich würde sterben! Keinen würde es interessieren, keiner würde mich vermissen. Unbekannt. Alleine.
91. Ich hatte es fast geschafft.
92, 93, ich verlangsamte mein Tempo und versuchte dabei meine Schrittlänge nicht zu verändern. Ich konnte sie hören, regelrecht spüren, wie sie immer näher kamen.
98, 99, 100. Ich hatte die Stelle erreicht! Ich blieb stehen, holte tief Luft und streckte mich. Meine Fingerkuppen waren gefroren von der Kälte, welche der Tunnel beherbergte. Ich spürte kaum noch den kalten Stein der Decke. Vorsichtig glitten meine Fingerspitzen darüber. Ich musste mich ein wenig strecken, um besser an die Decke zu gelangen. Die Steine waren kalt und feucht. Es schien, als ob sich kleine Wassertropfen durch die Decke gefressen hatten und diese nun mit ihrer Feuchtigkeit tränkten. Jede Unebenheit, jede Kerbe nahm ich war, doch ich spürte keinen Griff. Die Decke schien keine größere Unebenheit vorzuweisen. Was, wenn ich mich verzählt hatte? Selbst wenn nicht, jeder definiert einen Schritt anders, ich konnte genauso gut zu kleine oder zu große gemacht haben. Frustriert biss ich mir auf die Lippen. Vielleicht hatte ich ja doch etwas übersehen. Konzentriert suchte ich noch einmal die Wand über mir ab. Doch auch diesmal fand ich nichts. Nervös knete ich meine Finger. Ich musste etwas tun, die Zeit lief mir davon.
Ich machte einen Schritt nach vorn, tastete die Decke ab - wieder nichts. Mein Herz schlug immer schneller, mein Puls raste. Meine Hoffnung schwand bei jedem weiteren Schritt, doch ich wollte einfach nicht aufgeben. Wieder glitten meine Hände über die Decke, über die Steine, welche so akkurat aneinander gereiht waren. Plötzlich glitten sie ins Leere. Eine schmale Lücke! Vorsichtig tastete ich mit meinen Händen die Öffnung ab, sie schien groß genug zu sein, um mich durch sie hindurch zu hieven. War das die Falltür? Hoffnung keimte in mir auf. Zwar nur eine zarte, schüchterne Flamme, welche sich noch nicht traute zu leuchten. Ich bewegte mich noch ein Stück nach vorne, sodass ich direkt unter der Lücke stand. Geschickt tasteten meine Hände den Stein ab. Stein. Nichts als Stein. Das konnte doch nicht sein? Hier musste doch der Griff sein! Ein plötzlicher Schmerz durchzog meine Finger, als ich gegen etwas Hartes stieß. Der Griff! Ich ignorierte meine pochenden Finger und griff nach dem alten modrigen Holz.
Das Pochen, die Schritte der Wächter, war schon gespenstig nah und ich rechnete jeden Moment damit von einem Lichtstrahl ihrer Taschenlampe geblendet zu werden. Mit einem kräftigen Ruck zog ich an dem alten Griff. Ächzend löste sich die Tür ein Stück aus ihrer Verankerung. Ich keuchte, die Falltür war schwerer als gedacht! Mit meinem ganzen Gewicht hängte ich mich an die Falltür. Meine Hände schmerzten. Ich nahm noch einmal meine ganze Kraft zusammen und zog. Knarrend löste sich die Tür. Ich sprang ein Stück nach hinten, um die schwankende Tür nicht abzubekommen, und kniff geblendet die Augen zusammen.
Warmes Sonnenlicht fiel durch die Öffnung auf dem Tunnelboden. Das Licht liebkoste meine Haut und legte sich wie ein warmer Schleier über meine Haut, um die Kälte abzuhalten. Es dauerte einen Augenblick, bis sich meine Augen an das Licht gewöhnt hatten, zu lange war ich durch die Dunkelheit gerannt. Die Falltür bestand auf der Innenseite aus Holz, in welche in gleichmäßigen Abständen Kerben eingeschlagen waren. Eine Treppe! Ich stellte mich vor die Falltür, streckte mich und ertastete den Boden des Gebäudes über mir. Ich stützte mich ab und stieg auf die erste Stufe. Die Falltür war relativ stabil und schwankte nur ganz leicht, während ich nach oben kletterte, wie eine Blume, die sanft im Wind wiegt.
EINS
„Es ist schon so eine Sache mit dem Träumen. Jede Nacht schlafen wir und gleiten ohne unsere Kontrolle in die tiefen Ebenen unserer selbst. Keine Kontrolle. Keine Regeln. Fremdgesteuert von unserem Körper.“
Ich sahs vor meinem Laptop und starrte den Bildschirm an. Vor Wochen hatte ich mir vorgenommen endlich an meiner Bachelorarbeit zuschreiben, doch bisher hatte ich mich nie dazu aufrappeln können. Während meiner Schulzeit hatte ich es genossen zu schreiben. Ich hatte einen Blog, auf welchem ich immer wieder Rezepte hochgeladen hatte, oder Restaurantbesitzer Interviewte. Doch seitdem ich mit meinem Studium angefangen hatte, fiel mir das Schreiben zusehends schwer. Nicht gerade Vorteilhaft wenn man Literaturwissenschaften studierte. Lustlos spielte ich mit der Maus herum, als plötzlich mein Handy vibrierte. Eine Textnachricht von Henrik, meinem besten Freund. „Heute 16 Uhr im Kupferstecher?“ Ich musste lächeln. Unser Stammkaffee seit Jahren. Schon während der Schulzeit hatten wir hier gemeinsam gelernt, wenn wir beide es nicht mehr zu Hause ausgehalten hatten. Und immer Samstag, verwandelte sich das heimelige Kaffee in einen kleinen Kellerclub, in welchem auch stets unsere Abipartys gefeiert wurden. Henrik und ich wohnten zwar nicht weit voneinander entfernt, doch hier bei uns auf dem Dorf, gab es keine Kaffees, deshalb zogen wir uns immer in die Kleinstadt zurück.
Bis 16 Uhr hatte ich noch ein bisschen Zeit um irgendetwas brauchbares auf meinem Laptop zu tippen. Ich stand auf und ging zu meiner kleinen Tchibo Kaffeemaschine um mir ein einen starken Kaffee herauszulassen. Währenddessen tippte ich Henrik schnell das ich 16 Uhr da sein würde und schaltete mein Handy dann in den Flugmodus. Ich musste mich jetzt wirklich auf meine Arbeit konzentrieren.
Um 16 Uhr betrat ich das kleine Kaffee und sofort wurde ich in die Luftblase aus Kaffeeduft und Stimmen gesogen. An den Steinwänden hingen die verschiedensten Bilder regionaler Künstler. Obwohl es ein normaler Wochentag war, schien das Kaffee proppenvoll zu sein und an jedem Tisch stapelten sich Menschen.
Ich entdeckte meinen rothaarigen Freund an einem der hintersten Tische. Er war tief in die Speisekarte versunken. Ich musste lächeln. Obwohl wir schon seit Jahren in den Kupferstecher gingen und sich die Speisekarte des kleinen Bistros nie geändert hatte, studierte er sie jedes Mal erneut, nur um sich schlussendlich doch das gleiche zu Bestellen. Ich schlängelte mich durch die engen Tischreihen und grüßte hier und da ein bekanntes Gesicht. Alte Klassenkameraden, Freunde meiner Eltern, oder bekannte aus dem Fitnessstudio in der Stadt. Ebersberg war nicht besonders groß und so kannte man die meisten Gesichter. „Heeeey...“ ich durchwuselte Henrik die rooten Haare und setzte mich auf den leeren Platz gegenüber von Ihm. Seine goldbraunen Augen strahlten mich freudig an. „Du bist zu spät...mal wieder.“ Ich holte mein Handy raus und blickte auf den Display. „Zehn Minuten.“ ich lachte. „Hab keinen Parkplatz gefunden.“ Nuschelte ich in meinen Schaal, während ich meine Jacke auszog. Wir hatten Mai, dennoch waren die letzten Tage überraschend kalt gewesen und es wehte ein beißender Wind draußen. Eine Kellnerin trat an unseren Tisch und wir bestellten, wie immer Cappuccino und Kürbissuppe. Henrik blickte mich forschend an. „Na, hast du geschrieben, oder deine ganze Zeit wieder mit Netflix verplempert?“ Ich zuckte mit den Schultern. „Ein bisschen, aber irgendwie fehlen mir die Ideen und alles klingt so langweilig.“ Ich nestelte an meiner Fliederfarbenden Serviette herum. Es ärgerte mich, dass ich mit meinem Projekt nicht voran kam. Ich wollte das es gut wurde, ich war darauf angewiesen das ich eine gute Bewertung bekam. Doch bei all meinem Ehrgeiz blockierte ich mich selbst. „Du hast ja noch ein bisschen Zeit, dass wird schon.“ Henrik der ewige Optimist strahlte so viel Zuversicht aus, dass ich Ihm einfach glauben wollte. Doch ich kannte mich gut genug, wenn ich nicht bald was zu Papier brachte, würde ich den Abgabeschluss verpassen.
Die Kellnerin kam zurück an unseren Tisch und stellte zwei dampfende Teller Kürbissuppe vor uns ab, gefolgt von zwei großen Cappuccino. Die Suppe roch verführerisch nach Kokkus und dem Orangen Gemüse. Automatisch begann mein Magen sich sehnsüchtig zusammen zuziehen.
Während wir aßen erzählte Henrik begeistert von seiner neuen Bastle Idee. Er wollte aus seiner Abstellkammer in seiner, kleinen drei Zimmerwohnung, ein kleines Studio einbauen. Henrik war nicht der typische BWL Student. Er arbeitete nebenher in einer Zimmerei im Dorf und spielte Gitarre. Insgeheim wollte er ein eigenes Album heraus bringen. Doch egal wie sehr ich Ihn dazu ermutigte zumindest kleine Gigs zu spielen, er glaubte immer seine Musik sei nicht gut genug. Doch ich liebte sie. Und ich konnte Ihm und seiner Gitarre stundenlang zuhören.
„Wir können uns ja nächste Woche den Transporter von meinem Chef aus leihen und dann zum...“ Plötzlich veränderte sich etwas in dem kleinen Kaffee. Die Lampen flackerten kurz auf. Überrascht schaute ich an die Decke, doch niemand der Gäste schein dies zu bemerken. Auf einmal zog eine kälte an meinen Füßen auf und stieg langsam nach oben. Es fühlte sich an, als würde sie an meinen Beinen meinen Körper nach oben kriechen. Ich schaute Henrik an ob er etwas bemerkte, doch er sprach munter weiter. „...zurzeit gute Angebote. Du hast ja glaub noch frei, dann könnten...“
Wie in Trance stand auf. Der Schaum auf meinen Cappuccino schien sich zu einer bösen Fratze zu verszerren. Ich wusste nicht was mit meinem Körper geschah. Warum war ich aufgestanden? Ich konnte es nicht sagen. Henrik schaute mich erstaunt an. „Ehm Emma, alles okay bei dir? Du siehst so blass aus.“ Ich spürte wie mein Kopf sich hob und Henrik direkt in seine goldenen Augen blickte, doch ich hatte nicht das Gefühl als würde ich Ihn ansehen. Ohne mein Zutun, kam leben in meine Beine. Ungeschickt drehte sich mein Körper um und bewegte sich von dem kleinen Tisch weg. „Nein, nein, nein.“, dachte ich. „Ich will nicht gehen, ich will zurück zu Henrik und meinen Kaffee trinken.“ Doch mein Körper schien mich nicht zu beachten. Ich steuerte meine Bewegungen nicht, mein Körper schien gegen mich zu arbeiten, mich nicht wahrzunehmen. Mein Herz begann wie wild gegen meinen Brustkorb zu trommeln. Langsam spürte ich Panik in mir hochkriechen. War das so eine Art schlafwandeln? Vieleicht war ich ja kurz eingeschlafen ohne es zu merken? Oder ich Träumte noch!
Mein Körper hatte jetzt die Tür des kleinen Cafés erreicht. Ich sah entsetzt dabei zu wie meine Hand sich langsam nach dem hölzernen Türknauf ausstreckte und Ihn runterdrückte. Ein kalter Wind schlug mir entgegen und zerrte beißend an meinem dünnen Kleid. Meine Jacke hing noch immer über den Stuhl bei Henrik. Doch mein Körper schien die Kälte nicht zu interessieren. Ungeschickt bahnte er sich seinen Weg durch die vollgestopfte Gassen und patschte durch Pfützen. Der kalte Regen lief mir in Rinnsalen mein Gesicht hinab. Doch ich konnte weder blinzeln, noch meine Hand heben um mir meine nassen Haare aus dem Gesicht zu streichen. Was geschah mit mir? Wo wollte ich hin?
Ich bog in eine dunkle Gasse ab, die ich nicht kannte.
Trotz der Straßenlaternen war es dunkel hier. Das Licht schien über mir zu Drohnen, zu fern um mich zu erreichen. Dunkle Tropfen spiegelten sich in dem schwachen Licht. Tosend pfiff der Wind durch den schmalen Gang, leises flüstern in der Nacht. Ich schien eine schmale Straße entlangzugehen, die nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben war. Sie führte zwischen alten Backsteinbauten entlang, deren Wände die Straße begrenzten. Die Fenster u Straße waren mit schweren Brätern zugenagelt und verbargen jeden Blick auf mich. Alles in mir sträubte sich weiterzugehen. Doch ich schien jede Kontrolle über meinen Körper verloren zu haben. Nie im Leben würde ich Freiwillig in so eine Gasse gehen. So sahen Orte aus, an denen die Polizei verweste Leichen fand.
Je weiter ich durch die Gasse ging, desto stärke roch es nach abgestandenen Wasser und weniger nach Abgasen. Ich entfernte mich immer weiter vom belebten Leben der kleinen Stadt und schon bald wehte der Wind nicht mal mehr Stimmfetzen zu mir her. Wie schwarze Schatten zogen die Wände der Fabrikgebäude an mir vorbei, mein Blick war starr auf eine aschgraue Tür gerichtet, die am Ende der finsteren Gasse lag. Die Welt schien still zu stehen, alles war aus meinem Fokus verschwunden. Alles außer diese Tür. Ich hörte nichts, ich roch nichts. Ich spürte lediglich diese fremde Kraft die meinen Körper immer weiter vorwärts trieb. Und Angst. Sie wuchs immer weiter in mir, kroch meine Beine empor und schien sich um mein Herz zu schlingen, doch selbst se konnte mich nicht lähmen. Ich sah wie meine Hand nach dem Türgriff fasste und geräuschlos schwang diese auf. Vor mir lag nichts außer Dunkelheit. Doch mein Körper schien zu wissen wo er hin musste. Sicher drehte ich mich und ehe ich mich versah ging ich sicheren Schrittes die metallenen Stufen einer Treppe empor.
Ich stand am Rand der Brüstung. Unter mir erstreckte sich der kalte Asphalt. Die Laternen warfen gespenstige Schatten auf den Boden. Es war vollkommen still um mich herum, in dem kleinen Industriegebiet knarzten nur die Gräne im beizendem Wind. Im spürte die kalte Brüstung, die ich mit meinen Händen umklammert hielt. Durch meinen Körper ging ein Ruck und ich spürte wie mein Bein sich langsam auf die Brüstung legte. Meine Hände drückten sich ab und mein Körper schob sich nach oben. Ich wollte über die Brüstung klettern, oder viel mehr mein Körper. Ich versuchte gegen den Drang anzukämpfen, jede Faser meines Körper kämpfte. Doch das schien meinen Körper nicht zu interessieren. Ziel sicher kletterte ich über die Brüstung, jeder tritt saß und ich rutschte nicht einmal von dem nassen Metall ab. Dann stand ich hinter ihr. Locker hielten sich meine Hände fest, ich wollte klammern, doch meine Finger rührten sich keinen Zentimeter. Ich spürte wie mein Kopf sich auf die Brust legte und in die tiefe Blickte. Von hier sah es schrecklich weit bis zum Boden aus. Und Plötzlich wusste ich, warum ich hier stand, warum meine Hände sich nicht an das Geländer klammerte, sondern sich nur locker festhielt. Ich würde springen! Panik schwappte in mir auf und da war wieder dieses Gefühl. Kälte kroch meine Füße hinauf und ich hatte das Gefühl von ihr eingeschlossen zu werden. Ein eiskaltes lachen erfüllte meinen Kopf. Ich schrie, doch kein Ton kam heraus. Wie konnte ich ein Lachen hören, ein Lachen welches nicht zu mir gehörte und nur in meinem Kopf erklang. Dann spürte ich, wie meine Finger sich quälend langsam von der Brüstung lösten. Ich sah nach unten. Ich konnte nichts machen, ich konnte nicht gegen meinen Körper ankämpfen. Ich war wie ein willenloses Opfer, das keinen Einfluss auf ihren Peiniger nehmen konnte. Ich wusste das ich springen würde. Vielleicht hatte ich Glück und würde mir nur meine Beine brechen. Doch das konnte ich mir selbst nicht glauben. Wir waren im fünften Stock, dass konnte ich nicht überleben. Und wenn, würde ich wohl in einem Krankenbett enden. Meine Hände hatten sich komplett gelöst und ich stand frei auf dem kleinen Sims. Dann machte ich einen kleinen Schritt nach vorne. Staub rieselte auf die Straße hinab. Niemand war da. Niemand der mich hätte aufhalten können. Ich war alleine. Morgen würde irgendjemand auf dem Weg zur Arbeit meine Leiche finden. Alle würden denken ich wäre einer dieser junky Teenager gewesen, die im Rausch sich in die Tiefe gestürzt hatte. Niemand würde je erfahren, dass irgendetwas die Beherrschung über meinen Körper übernommen hate. Das ich keine Wahl hatte!
Noch ein Schritt und ich würde in den Tod stürzen. Ich konnte nicht klar denken. Ob es wohl wie in den Filmen war? Das dass Leben an einem Vorbeizieht, bis man auf dem harten Asphalt aufkam? Dann hob sich mein linkes Bein und schob sich nach vorne, Ich versuchte mein Gleichgewicht nach hinten zu verlagern, doch mein Körper hörte nicht auf mich. Ich spürte das nichts unter mir. Mein Oberkörper lehnte sich nach vorne. Ich konnte nicht einmal die Augenschließen. Und dann viel ich.
Plötzlich packte mich etwas am rechten Oberarm. Ein knacksen ertönte, gefolgt von einem brennendem schmerz. Tränen schossen mir in die Augen. Erschrocken wollte ich nach oben Blicken, doch mein Körper hing steif an meinem Oberarm hinab. Ein stechender Schmerz durchfuhr meinen Arm wie tausende von Nadelstichen und ich wünschte mir nichts sehnlicher, als das endlich aufhörte. Starr blickte ich gerade aus in die Dunkelheit, fast als wäre mein Körper erbost, das er noch immer lebte und nicht schon Tod auf dem kalten Asphalt lag. „Bitte...“flüsterte ich immer wieder in meinem Kopf. „Rette mich.“
Mit einem Ruck wurde ich nach oben gezogen, als hätte mein Retter meine Gebete erhört. Schlaf hing mein Körper über der Brüstung, als mich sanfte Hände auf den kalten Boden legten. Kaum berührte mein Körper den kalten Boden, durchfuhr mich ein zucken. Ich keuchte auf und setzte mich ruckartig auf. Panisch schnappte ich immer wieder nach Luft und presste meine Hände gegen die Brust. Ich konnte mich wieder bewegen! Ich hatte die Kontrolle über meinen Körper wieder gewonnen. Dicke Tränen kullerten über meine Wangen und ich bebte vor Schluchzern. „Hey, jetzt ist alles gut!“ Ich spürte einen Arm um meine Schulter und eine freundliche weibliche Stimme sprach auf mich ein. Ich schaute auf, und blickte in die Augen meines Retters. Ein Stück von mir entfernt stand ein junger Mann. Er war groß und ganz in dunkel gekleidet, eisblondes Haar wehte ihm leicht ins Gesicht und umspielte seine hohen Wangenknochen. Seine blauen Augen musterten mich interessiert. „Das war ganzschön knapp, Leiko.!“ sagte er, dann strich er sanft über die schneide eines Messer und steckte es in seine Jackentasche. „Wer seit ihr?2 fragte ich immer noch nach Luft schnappend. „Was ist mit mir passiert?“ Ich wand meinen Kopf zu der Frau, welche noch immer einen Arm beruhigend um mich gelegt hatte. Sie hatte dunkle Haare und feine Gesichtszüge. Auch sie erinnerte mich auf bizarre Weiße an einen Engel. Was wahrscheinlich daran lag, dass die Beiden mich gerettet hatten. Sie war, ebenso wie der Blonde, trug sie dunkle Ledersachen. „Nicht hier...“ setzte Sie an, doch wurde von dem Blonden unterbrochen. „Ein Daimon hat dich besessen und wollte deinen Tod.“ sagte er belanglos und blickte an mir vorbei. „Was...?“ Ich starten den Blonden ungläubig an. „Dray!“ zischte die Frau böse und funkelte Ihn an. Plötzlich ertönten Schritte hinter uns und die Tür zum Turm wurde aufgestoßen. „Emma! Oh Gott zum Glück geht’s dir gut!“ Ich drehte mich um. Henrik kam auf mich zu gerannt und schloss mich in seine Arme. Selten war ich so froh gewesen meinen Freund zu sehen. Ich klammerte mich an seinem Hemd fest und musste schluchzen: „Hen… Henrik ich weiß nicht…“ ersuchte ich zwischen Schluchzern hervor zu bringen, doch Henrik strich mir beruhigend über den Kopf. „Jetzt ist alles gut, du bist in Sicherheit!“ Erneut ertönten Schritte auf der Treppe und mit einem Schlag ging die Tür auf. „Sorry Leute, er ließ sich nicht aufhalten.“ Über Henriks Schulter erkannte ich einen kleineren Mann, der wie die anderen Beiden um die Zwanzig war. Er hatte dunkle Locken und erinnerte mich an Jet aus High School Musical. Erschrocken stellte ich fest, dass er in seiner Hand ein langes Schwert schwang. „Wer sind diese Leute?“ flüsterte ich ängstlich in Henriks Ohr. Sie hatten mich zwar gerettet, aber ihr bizarrer Eindruck verunsicherte mich. Die junge Frau war mittlerweile aufgestanden und hatte sich zwischen die beiden Männer gestellt. Sie waren alle dunkel Gekleidet und trugen schwere Boots. Ihre Gesichter waren von Kapuzen teilweiße bedeckt, so das man Ihre Züge nicht genau deuten konnte. Doch was mich am meisten verunsichert war, das sie mit mittelalterlichen Waffen bewaffnet waren. Sie alle trugen Schwerter, oder Schusswaffen bei sich, die ich nur aus Serien kannte.
„Keine Ahnung.“ antwortete Henrik, doch er schien sich auch nicht sonderlich für Ihr aussehen zu Interessieren.
„Warum zur Hölle wolltest du springen Emma!“ fuhr mein Freund mich plötzlich an. Ich fuhr unwillkürlich zusammen und löste mich aus seiner Umarmung. „Ich… ich wollte nicht springen! Irgendwie hat mein Körper das alles von...“ „Sie gehört erstmal untersucht!“ fuhr der Blonde, die Frau hatte Ihn Dray genannt, dazwischen. „Ich habe Ihre Schulter nicht gerade sanft angepackt, wir lassen unseren Arzt drüber schauen.“ Henrik drehte sich um und musterte die drei mit zusammengekniffenen Augen. „Euren Arzt? Warum sollte sie mit euch mitkommen!“ fuhr Henrik die Drei böse an. „Weil wir ihr helfen können.“ erwiderte Dray trocken und strich sich eine blonde Strähne aus dem Gesicht. „Sie geht nirgendswo hin! Das Ihr sie gerettet hat war echt mega nett, danke! Aber jetzt bin ich da.“ er wand sich an mich. „ich bring dich ins Krankenhaus. Vielleicht arbeitet ja deine Tante Sam?“ Doch ich schaute unverwandt die Drei an. Irgendetwas an Ihnen war anders, ich wusste nicht was, doch sie strahlten etwas aus, das mich anzog. Sie erinnerten mich an etwas. Etwas das ich weder deuten, noch einordnen konnte. Doch ich wusste das sie mir helfen würden. Außerdem war ich neugierig auf die Drei fremden, die wie aus dem nichts aufgetaucht waren und mich vor dem sicheren Tod gerettet hatten.
„Was sind Daimons?“ fragte ich, „So etwas wie Dämonen?“
Der Typ mit den langen schwarzen Haaren entblößte weiße Zähne und grinste. „Doch kein dummes Blondchen.“ stellte er fest.
„Das klären wir nachdem du untersucht wurdest!“ sagte die Frau mit fester Stimme und schaute den dunklen Treppenaufgang hinunter.
„Wir sollten langsam verschwinden.“
Leises murmeln ertönte von unten. Ich rappelte mich vorsichtig auf. Mein Arm hing schlaff herab und brannte. Ich fühlte mich unglaublich schwach. Jede Faser meines Körpers schien ausgetrocknet, regelrecht verbrannt. Doch meine Gedanken kreisten unentwegt. Was zur Hölle ist mit mir passiert? Und was waren das für Leute? Und da war noch diese Angst, dieser kleine Keim der zu wachsen drohte, was wenn ich verrückt war? Wenn ich irgendeine Psychose hatte, oder ich mich bald nicht mehr kontrollieren konnte? Und ohne eine vernünftige Erklärung dafür zu haben, hatte ich das Gefühl das diese komischen Leute mir Antworten geben könnten. Und hoffentlich auch helfen. Automatisch suchten meinen Augen die von Henrik und hielten seinen Blick fest. Ich konnte sehen das in ihm die Emotionen lodern, seine Sorge um mich. Er würde nicht begeistert sein von meinem Vorschlag, so viel war sicher. „Henrik, ich…“ Ich schluckte, um den Großen Kloß in meinem Hals los zu werden, was mir jedoch nicht gelang. Also straffte ich lediglich die Schultern und schaute ihm fest in die Augen. „Ich werde mit ihnen mitgehen. Das ist gut, glaube ich. Schließlich sind sie extra gekommen um mir zu helfen.“ „Em,“ Henrik schaute mich liebevoll an und griff nach meiner Hand. Die Wärme seiner Haut jagte einen wohligen Schauer durch meinen Körper.
„Ich hab keine Ahnung was heute Nascht passiert ist und ich verstehe das du Angst hast und unglaublich verwirrt bist. Ich meine ich weiß selbst nicht mal was heute Abend los war. Aber es ist keine Lösung mit irgendwelchen Fremden mitzugehen. Wir gehen in die Notaufnahme und lassen dich durchchecken und danach holen wir uns eine Pizza, okay?“
Ich musste lächeln, trotzdem schüttelte ich den Kopf.
„Nein, ich muss das machen. Ich denke…“
Weiter kam ich nicht, den der große Blonde mit den unglaublich blauen Augen trat zwischen uns. „Wir haben für euer Kindergarten keine Zeit. Du bewegst deinen Arsch jetzt da runter und kommst mit uns mit. Was du Rotschopf machst ist mir eigentlich vollkommen egal, aber steh mir nicht im Weg rum verstanden?“ Und ohne ein weiteres Wort zu sagen packte er mich am Arm und schob mich vor sich her die Treppe runter. Ich konnte noch hören wie die Frau etwas zu Henrik sagte, doch dann waren der Fremde und ich schon im Treppenhaus verschwunden.
ZWEI
Nur am Rande nahm ich war wie wir das Treppenhaus hinunterstiegen und den dunklen Weg auf die belebte Hauptstraße. Verschwommen zogen die Menschen an mir vorbei, gedämpft drangen ihre Stimmen an mein Ohr, doch ich konnte ihre Worte nicht verstehen. Ich spürte nichts, außer den starken Griff des Blonden um meinen rechten Oberarm, die kalten Finger die sich in meine Haut bohrten. Ich hatte noch immer nicht das Gefühl her meines Körpers zu sein, doch es war anders wie zuvor. Es fühlte sich nicht so ein als wäre etwas in mir drin, würde mich beherrschen.
Doch die Hände von Dray gaben mir auf eine befremdliche Art und Weiße Sicherheit. Henrik lief dicht hinter mir, fast so als hätte er Angst ich könnte einfach verschwinden. Im Gegensatz zu mir schien er nicht wie betäubt zu sein, ganz im Gegenteil. Seine Stimme überschlug sich mein Reden, was sonst nicht seine Art war und dabei war diese noch einige Oktaven höher. „Ich finde das alles höchst kurios! Das Beste wäre einfach die Polizei zu rufen und euch verrückten nicht zu folgen…“ Zeterte er den dunkeläugigen Mann voll. Dieser lief Stummen neben ihm her und schaute stur gerade aus. „ Nimm es nicht persönlich, aber das heute Abend war verrückt und ihr…ich meine wer seit ihr überhaupt? Und warum lauft ihr so rum als sei gerade jemand gestorben? Ist das so eine Emo-Punkband in der ihr spielt? Und was Emma an geht, sie kann nicht klar denken! Würdet ihr sie kennen dann wüstet ihr das sie viel zu schüchtern ist um einfach mit irgendwelchen fremden mitzugehen. Sie ist verwirrt! Und sollte dringend ins Krankenhaus! Wir kreuzten immer wieder Straßen und gingen an beleuchteten Lokalen vorbei. Doch in der Dunkelheit hatte ich schon bald die Orientierung verloren. Wir befanden uns immer noch auf einer relativ belebten Straße an der sich kleine Lokale reihten. Lichterketten erhellten die dunkle Nacht und fröhliches Stimmengewirr lag in der Luft. Ein lauer Wind wehte und wirbelte Bunte Blätter vom Boden auf, dabei trug er den herrlichen Duft von frischer Suppe zu uns herüber. Doch Dray bog scharf nach rechts ab und wechselte die Straßenseite, dabei zog er mich grob mit sich. Ich war so von den kleinen Lokalen abgelegt gewesen, dass ich ihm ungeschickt hinterher stolperte. Darauf bedacht ja nicht das Gleichgewicht zu verlieren und hinzufallen.
Auf der Gegenüberliegenden Straßenseite erstreckte sich ein breiter Weg aus Pflastersteinen gesäumt von dunklen Pfählen der Laternen. Diese erhellten mit schwachen Schein die Nacht und ließen dunkle Schatten auf unseren Gesichtern tanzen.
Wir überquerten die Straße und gingen einige Meter an den hohen Friedhofsmauern entlang. Außerhalb der Menschenmaßen und der Geschützen Gassen, zog en eisiger Wind auf. Unbarmherzig peitschte er in unsere Gesichter und fand jeden Schlitz in unserer Kleidung. Fröstelnd rieb ich die Hände aneinander und vergas für einen Moment wo wir waren. Doch schon im nächsten Augenblick wurde ich wieder grob über die Straße gezogen. Überrascht schaute ich auf und stellte fest das wir auf die große Kirche von Ebersberg zuliefen. Sie war eine der ältesten Kirchen im Land und erstreckte ihre hohen Zinnen in den Nachthimmel. Das Tor zu ihr stand wie immer einladend offen. Wir passierten es und liefen über den steinernen Weg in Richtung Kirche. Steine knirschten bei jeden Schritt und durchschnitten die Dunkelheit.
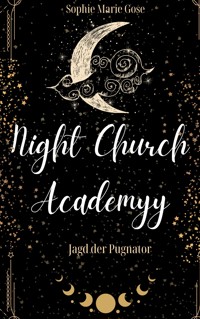















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












