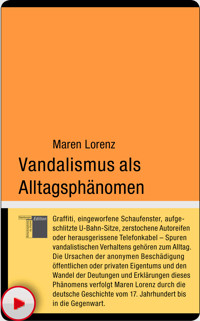Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Mensch nach Maß - Bevölkerungspolitik und Proto-Eugenik in der Frühen Neuzeit. Nicht erst seit der Moderne wünscht man sich den optimal leistungsfähigen Menschen. Utopien der Menschenzucht sind vielleicht so alt wie die menschliche Zivilisation selbst. Bereits in der Renaissance und ausgerechnet während der Aufklärung gewannen Fragen der Bevölkerungspolitik in Europa und den jungen USA an Relevanz. Nicht nur Ökonomen, Politiker und Mediziner entwarfen Szenarien und suchten nach Wegen zur Produktion perfekter »Untertanen«. Auch Literaten, Journalisten, Philosophen, Sexualaufklärer, Theologen, religiöse Utopisten und erste Frauenrechtlerinnen forderten staatliche Regulation und Kontrolle über die menschliche Reproduktion. Dieses vorher religiös bestimmte Thema sollte sich nun allein am Staatswohl und nicht am Recht des Individuums orientieren. Maren Lorenz untersucht Utopien und Konzepte der Menschenzucht im Alten Reich, Großbritannien, Frankreich und den USA. Sie betrachtet wissenschaftliche, religiöse und politische Diskurse ebenso wie Literatur, Zeitschriften und Sexual- und Eheratgeber. Die Vielzahl der Beispiele zeigt, wie sich die Grenzen des öffentlich Sagbaren und sozial Machbaren immer weiter verschoben, bis sich Ende des 19. Jahrhunderts die Eugenik als eigene Wissenschaft etablierte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 695
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maren Lorenz
Menschenzucht
Frühe Ideen und Strategien 1500-1870
WALLSTEIN VERLAG
Gedruckt mit Unterstützung der Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf
Die vorliegende Studie war nur möglich durch großzügige Unterstützung: ein einjähriges GHI/NEH-Fellowhip des Deutschen Historischen Instituts in Washington D.C. sowie ein zweijähriges Senior Fellowship der Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2018
www.wallstein-verlag.de
Umschlaggestaltung: Marion Wiebel
Umschlagbild: Siehe Abbildung
ISBN (Print) 978-3-8353-3349-9
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-4301-6
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-4302-3
Inhalt
Statt eines Vorwortes. Die Optimierung des Menschen – Historischer Traum und Alptraum
1 Menschenbild und Bevölkerungspolitik in der Frühen Neuzeit
Der Mensch als Träumer – Züchtungsutopien vor 1700
Von Menschen und»›Missgeburten«
Von weiblicher Imagination und männlicher Prävention
Physiognomik und die Furcht vor den ›Anderen‹
2 Der Staatskörper als Volkskörper – Das Alte Reich und die Sattelzeit
Zeugungsgebot und Zeugungsverbot als landesväterliche Fürsorge
Zuchterfolg vor Sittlichkeit?
Samenökonomie und Zeugungsgeschäft in Kameralismus und Eherecht
Die Medizinalpolizei – »Glückseligkeit« durch gesunde Zucht
Zwischen Heiratsverbot und Heiratszwang
Gesunde Wilde und kranke Zivilisation
Bevölkerungspolitik von unten – vom »Himmeln-Lassen« und der Pockenimpfung
Von »göttlicher Zulassung« und menschlichem Versagen
3 Die Medikalisierung der Gesellschaft – La grande nation malade
Demographie und Ökonomie – Angst vor dem Untergang
Menschenversuche
Rasse und Menschenzucht – Von der kolonialen »Métissage«
Vererbung und Erbkrankheiten – Die europäische Perspektive
4 Provokanter Pragmatismus in Großbritannien
Literatur darf alles – Menschen als Schlacht- und Zuchtvieh
The Malthusian Elephant in the Room
Bürgerliche Todesphantasien und christliche Humanität
5 Neue Menschen für die Neue Welt (USA)
Eliten für die junge Republik
Zwei Brüderpaare als Väter der Phrenologie
Intermarriage of the Races – Miscegnation
Phrenologie und Intermarriage of Relatives
Proto-eugenische Eheberatung als Antwort auf die Marriage Crises
Der Import der europäischen Angst vor (geistiger) Degeneration
Selective Breeding als göttlicher Auftrag
Der Hype um Barnums Baby Shows
6 Die Pflicht zur Selbstverpflichtung. Fortpflanzungsoptimierung in Ehe- und Sexualratgebern
Perfekte Ehen – Perfekte Kinder – Neue Eliten für Alteuropa
Perfekte Ehen – Perfekte Kinder – Neue Eliten für die USA
Menschenzucht ist Frauensache
Menschenzucht in ›Metropolis‹ – Ein sozialmedizinisches Projekt
7 Schlussbemerkung – Die Perfektionierung des Menschen. Von der Utopie zum Projekt
Anmerkungen
Abbildungen
Bibliographie
Personenindex
»[…] du werdest einmal der Kinderzeugung gedenken, wie sie es damit halten, und wie sie die Neugeborenen erziehen werden, und diese ganze Gemeinschaft der Weiber und Kinder, von der du sprichst; denn wir glauben, daß es viel, ja alles ausmacht für die Verfassung, ob es richtig geschieht oder nicht. […] Daß diese Weiber alle diesen Männern allen gemeinschaftlich seien und keine mit keinem besonders zusammenwohne, und daß ebenso die Kinder gemeinschaftlich seien und kein Vater sein Kind kenne noch ein Kind seinen Vater. […] So ist also klar, daß wir weiterhin nach Kräften möglichst heilige Hochzeiten einführen werden; heilig aber wären die nützlichsten […] Es müssen ja nach dem Zugegebenen die besten Männer den besten Weibern möglichst oft beiwohnen, und die schlechtesten Männer den schlechtesten Weibern möglichst selten, und die Kinder der einen muß man aufziehen, die der andern aber nicht, wenn die Herde möglichst vorzüglich sein soll; und alles dies muß geschehen, ohne daß es jemand außer den Regierenden selbst bemerkt […] Die Zahl der Vermählungen aber werden wir die Regierenden bestimmen lassen, damit sie möglichst die gleiche Zahl von Männern erhalten, indem sie auf Kriege und Krankheiten und alles Derartige Rücksicht nehmen, so daß uns der Staat womöglich weder zu groß noch zu klein werde. […] Und denjenigen unter den jungen Männern, die im Kriege oder sonstwo sich tüchtig erweisen, muß man unter andern Auszeichnungen und Preisen wohl auch die häufigere Erlaubnis, bei Weibern zu schlafen, erteilen, damit zugleich auch unter diesem Vorwand möglichst viele Kinder von solchen gezeugt werden. […] Die von den Tüchtigen dann werden sie, denke ich, nehmen und sie in eine bestimmte Anstalt bringen zu Wärterinnen, die in einem gewissen Teile der Stadt abgesondert wohnen; die von den Schlechteren aber, und wenn etwa von den andern eines gebrechlich zur Welt kommt, werden sie an einem geheimen und unbekannten Orte verbergen, wie sich’s geziemt. […] Wenn dann aber, denke ich, die Weiber und Männer über das Alter des Zeugens hinaus sind, so werden wir ihnen Freiheit lassen beizuwohnen, wem sie wollen, außer einer Tochter und Mutter und ihren Enkelinnen und den Töchtern ihrer Großmutter, und andererseits den Weibern jedem, außer einem Sohne und Vater und aufwärts und abwärts von diesen.«
Platon, Politeia / Der Staat, Fünftes Buch
Für Wally, in Dankbarkeit – immer noch und immer wieder
Statt eines Vorwortes
Die Optimierung des Menschen – Historischer Traum und Alptraum
Menschenzucht: Gedankenexperiment oder politisch-ökonomisches Projekt?
Das Bedürfnis des Menschen nach ›Verbesserung‹ seiner selbst und seiner Artgenossen ist uralt. Weltweit zeugen religiöse Normen davon, Bildungssysteme, aber auch das Gesundheitswesen und die ebenso uralte Schönheits- und Wellnessindustrie. Die Überzeugungen dessen, was die angestrebte Perfektion denn ausmache und ausmachen solle, wer darüber zu bestimmen habe und welche und wessen Ziele damit eigentlich verfolgt werden sollen, klaffen allerdings weit auseinander. Bislang existiert kein Überblick über das breite Spektrum vormoderner Überlegungen zur menschlichen Optimierung, die von literarischen Utopien über ökonomische Planspiele bis zu proto-eugenischen Medizinphantasien reichen. Entscheidend in diesem Zusammenhang ist die Frage nach Normalisierungsprozessen, die hier aber nicht als disziplinarische oder rechtliche Normsetzungen durch Kontrollinstanzen verstanden werden, sondern als die Verschiebung von Diskursgrenzen. Wer überschreitet wann aus welchen Motiven Tabugrenzen? Wie verschaffen sich die Akteure und Akteurinnen Gehör? Welche Argumente werden vorgebracht, um zeitgenössisch profitieren zu können? Wie wird von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen darauf reagiert?
Dieses Buch will einen Beitrag zur Beantwortung solcher Fragen leisten und so – einmal mehr – auch auf die Zweischneidigkeit des Verhältnisses von Ethik und Wissenschaft aufmerksam machen, dabei aber auch die mehr oder weniger implizite Bedeutung partikulärer wirtschaftlicher und spezifischer Machtinteressen nicht aus dem Blick verlieren. Denn Wissenschaft und Medizin, auch und gerade deren theoretische Reflexion, finden ebenso wie das Rechtswesen immer in einem politisch-sozialen Raum statt, der ihre Diskurse steuert und ihre Ergebnisse medial gefiltert wieder in die Gesellschaft zurückgibt.[1]
Eine nur auf den ersten Blick banal erscheinende, diesem Buch zugrunde liegende These lautet, dass zu ihrer Zeit noch nicht mehrheitsfähige Diskurse doch langfristig und grenzüberschreitend durchaus ihre gesellschaftlichen Spuren hinterlassen. Abhängig davon, wer welche Behauptungen mit welchen Argumenten in den gesellschaftlichen Diskurs einbringt, werden gedankliche Grenzen und kollektive Wertvorstellungen verschoben. Das vorher nicht Denkbare wird sagbar; irgendwann fehlen vielleicht nur die passenden Rahmenbedingungen zur Umsetzung. Diese Prozesse der Normalisierung möchte ich in Bezug auf die menschliche Optimierung genauer betrachten.
Weniger fruchtbar erscheint mir hingegen die eigentlich naheliegende Frage, warum vor Ende des 19. Jahrhunderts nirgendwo ernsthaft versucht wurde, proto-eugenische Maßnahmen in großem Stil zu institutionalisieren. Hier bilden fraglos Prozesse der Nationalstaatsbildung in Europa, wie auch global, sowie die Intensivierung von bürokratischem Bevölkerungsmanagement zentrale Voraussetzungen. Entscheidend war hingegen sicher schlicht das Fehlen bestimmter technischer Entwicklungen im Bereich der medizinischen Diagnostik und Intervention.
Dabei steht die Fortpflanzung seit der Antike bis heute im Zentrum aller Optimierungsdiskurse. Denn Anzahl und Fähigkeiten der die jeweiligen Länder und Herrschaftsräume bevölkernden Menschen bilden Grundlage und Bedingungen für alle weiteren Gesellschaftskonstruktionen und vor allem für Krisendiskurse aller Art. Bevölkerungspolitik war und ist zu allen Zeiten und in allen Systemen mehr oder weniger explizit Teil akademischer Reflexion, aber eben auch von politischen Konzepten und Regierungshandeln. Was von den jeweiligen Gesellschaften dabei als adäquate Bevölkerungsgröße und insbesondere deren Qualität betrachtet wurde, lässt sich allerdings nicht an scheinbar unbestechlich harten Zahlen und Daten ablesen, sondern wurde und wird stets von jenen Interessengruppen definiert, die die jeweiligen Diskurse beherrschen. Je nach technischer Machbarkeit und normativen, d. h. religiösen und rechtlichen Rahmenbedingungen wird dabei in der Regel eine Kombination aus Zwang durch Drohung mit Sanktionen und Lenkung durch ein entsprechendes Umfeld und Anreize zum erwünschten Zeugungsverhalten angewendet.[2] Im Idealfall werden die erwünschten Normen von den Menschen so internalisiert, dass kein Zwang mehr ausgeübt werden muss.
Der französische Psychologe, Soziologe und Philosoph Michel Foucault bezeichnete dies schon vor vierzig Jahren als »gouvernementale Biopolitik« im Interesse der Staatsräson.[3] Darunter verstand er externe Techniken zur Formung eines »Gattungskörpers«, die Transformation von politischer Macht in ein Bündel von Techniken und Regeln, beherrscht von Fachleuten. »Biomacht« erreicht die Optimierung der Bevölkerung durch bürokratische Akte, durch Kategorisierung, hierarchische Klassifizierung, Gebote und Verbote, schließlich auch durch Selektion.[4] Möglich wird dieser Prozess nach Foucault nur durch die Verschleierung normativer Axiome, d. h. unüberprüfbarer Vorannahmen, und durch die Formierung einer sich rational gebenden Sprache der »Degeneration«.[5]
Das für den deutschen Sprachraum lange maßgebliche Zedlersche Lexikon nennt 1734 diesen Begriff als erstes und bezeichnet damit kurz und knapp ein »übel gerathen, aus dem Geschlecht oder Geschirr schlagen.«[6] Bereits hier fallen die beiden zentralen Aspekte der Vererbung und der Disziplinierung bzw. Zurichtung zusammen. Auch im Englischen findet sich der Begriff um die Mitte des 18. Jahrhunderts in verschiedenen Versionen und wird bereits umfassend mit Beispielen garniert. So werden in Johnson’s Dictionary of the English Language von 1755 »Degeneration« und »Degeneracy« synomym gebraucht, im moralischen Sinne als »fall« bzw. »deviation from the virtue of one’s ancestors« und als Verb »degenerate« sowie als Substantiv »Degeneratedness« auch im pflanzen-physiologischen Sinn, »to fall from its kind, to grow wild or base«. Für beide Bedeutungsfelder ist aber klar, dass das so Bezeichnete »unworthy« sei.[7] Im Französischen heißt es hingegen noch 1787, das Wort »dégéneration« im Sinne von geminderten »talents« werde selten benutzt.[8] Nur zehn Jahre später benennt es das Lexikon der Académie Française dann doch als einen minderwertigen Zustand für etwas, dessen »gute Zucht« außer Kontrolle geraten sei: »(État) de ce qui dégénère. La dégénération des plantes, des animaux, des races, des espèces.«[9]
Eng verwoben ist das Bedeutungsfeld der Degeneration mit den noch zu entschlüsselnden Gesetzen der Vererbung und dem daran orientierten, auch im Deutschen doppeldeutigen Begriff der Zucht. Er kann ebenso generative Züchtung wie Formung durch äußere Eingriffe (Versorgung, Erziehung) bedeuten. Beide Sinngehalte existierten für das englische »breeding« lange parallel. Noch 1836 hieß es dazu im amerikanischen Johnson’s Dictionary nur knapp: »education, manners, nurture«.[10] Dabei fanden sich schon Mitte des 18. Jahrhunderts im damals maßgeblichen Dictionary of the English Language für »breed« als Verb und Substantiv gleich sieben verschiedene, mit berühmten Literaturzitaten aus früheren Jahrhunderten belegte, Definitionen. Gleich die erste bezog sich auf die hier gemeinte: »To procreate, to generate, to produce more of the species«. Der im frühen England vorherrschende Gebrauch als Erziehung und Aufzucht wurde dort erst an sechster Stelle genannt (und mit Shakespeare, Pope, Swift, Milton, Dryden und Locke untermauert): »To educate, to qualify by education.«[11] – »The breed« bedeutete auch 1755 hingegen bereits eindeutig »a cast, a kind, a subdivision of species«. In England gewann dieser Gebrauch dann bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts auf allen Gebieten immer mehr an Bedeutung. In der Anthropologie, der aufblühenden Garten- und Landschaftskunde (horticulture) und in der Tierzucht (husbandry) wurde der gezielt zu kontrollierende Faktor der Vererbung (im Gegensatz zu Umwelteinflüssen) immer stärker gewichtet.[12] So kann auch nicht überraschen, dass beide Bedeutungsfelder des englischen »breeding« einen nachhaltigen Einfluss auf den Export des englischen Denkens für die gezielte Besiedlungspolitik in den amerikanischen und australischen Kolonien ausübten.[13]
Durch diesen kleinen Ausflug in die Etymologie einiger im Folgenden ständig zitierten Begriffe wird klar, dass das Verhältnis von Staatsräson zu Moral und Rechtsordnung immer eines der Hierarchisierung von Prioritäten und Qualitäten ist. Priorisierungen, die nicht nur im Falle einer tyrannischen Herrschaft über die Wertigkeit von Leben, auch menschlichem entscheiden konnten. Der Sprachgebrauch schafft die unabdingbaren Voraussetzungen für das Handeln, indem er es zwangläufig vorab oder auch gelegentlich ex post, legitimieren muss. Wie Sean Quinlan richtig anmerkte, konstruiert das o. g. Foucaultsche Konzept der Biomacht jedoch eine monolithische Wirkmächtigkeit von Lobbygruppen, die in dieser Einheitlichkeit nirgendwo existierte. Es sind und waren stets unterschiedliche Interessen und Diskurse und schon gar nicht immer die politischen Eliten, die Definitionsmacht verkörperten und/oder ausübten.[14] Umso wichtiger erscheint es mir, die Genese und Synthese der unterschiedlichen Diskurse der jeweils Handelnden vor ihren historischen Kontexten einzuordnen und zu entschlüsseln.Jürgen Habermas wies für unsere modernen demokratischen Gesellschaften darauf hin, dass die Stabilität bestimmter Normen und Menschenbilder konkreten Forschungen und damit wissenschaftlichen Lernprozessen im Wege stünde. Der Vorwurf des Denkverbots, der Kritikern der heutigen embryonalen Genforschung gemacht wird, kehre somit die Beweislast um. Wer gegen bestimmten Normenwandel (hier in Bezug auf gentechnische Grundlagenforschung) sei, stehe dem Fortschritt, d. h. der individuellen wie der kollektiven Verbesserung, hemmend im Wege und müsse sich dafür rechtfertigen.[15] Ähnliche Phänomene gibt es auch in früheren Gesellschaften zu beobachten, in denen mit solchen Normverschiebungen etwa die »Glückseligkeit des Staates«, das »Überleben der Nation« oder auch die »nationale Gesundheit« garantiert werden sollten. Dazu gehörte zunächst einmal eine bewusste, zentral gesteuerte Form der Bevölkerungspolitik.
Voraussetzung für das ›Management‹ ihrer Bevölkerung, zur Verhinderung von Degeneration und im Interesse der Staatsräson ist und war für jede Regierung, zunächst einen möglichst detaillierten Kenntnisstand über die Zusammensetzung der eigenen Gesellschaft zu erhalten. Alter, Gesundheit, Geschlecht, Erwerbsfähigkeit, Berufstätigkeit, Verteilung im geographischen Raum waren und sind dabei notwendige Grundinformationen, nicht nur für die konkrete Planung von Infrastruktur und Versorgung, sondern auch für den Umgang mit zukünftigen demographischen und technischen Entwicklungen. Im Hintergrund all dieser Aspekte schwangen jedoch schon in der Antike immer ökonomische und v. a. militärisch-territoriale Fragen mit – wobei die Nutznießerschaft und die Verteilung des angestrebten Wohlstands von den diskursmächtigen Gruppen kaum jemals spezifiziert wurden und werden. Unübersehbar wird die Gewinnorientierung, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass es gerade die frühneuzeitlichen britischen und französischen Kolonialsysteme in Nordamerika und Indien waren, die als erste moderne Bevölkerungsstatistiken entwickelten und tatsächlich gezielte ›Zuchtmaßnahmen‹ ergriffen.[16] Auch wenn 1753 die Einführung eines Zensus im Londoner Parlament noch heftig diskutiert wurde, weil die bloße Bevölkerungsgröße an sich noch als Erfolgsmaßstab galt, setzte sich die Anerkennung der Notwendigkeit einer Kontrolle der Quantität und zunehmend lauter gefordert, auch der Qualität der Landeskinder, bereits kurz nach Erscheinen des Essay on the Principle of Population (zunächst 1798 anonym) des englischen Nationalökonomen und Theologen Thomas Malthus (1766-1834) schnell europaweit durch.[17] Malthus war allerdings nicht der erste, der solche Gedanken formulierte, aber er war der mit der zeitgenössisch und langfristig größten Durchschlagskraft. Sein Untergangszenario von der unkontrollierten Bevölkerungsexplosion bei nicht schritthaltender Nahrungsversorgung erschien zu einem Zeitpunkt, an dem ein Zusammenhang von stetigem Bevölkerungswachstum und steigender Verelendung in den meisten Ländern Europas unter Ausblendung etwaiger Verteilungsungerechtigkeiten unübersehbar wurde. Die britische Insel mit ihren explodierenden Städten London und Dublin und das revolutionsgeschüttelte Frankreich mit seiner weiterhin darbenden Landbevölkerung gingen dabei um 1800 voran.
Die Französische Revolution hatte zudem deutlich gemacht, welches politische Risiko Aufstände depravierter Massen sogar für ein lang etabliertes politisches System haben konnten. Fein registriert wurde in Großbritannien, dass Malthus sein Augenmerk beim Problem des »overbreeding« primär auf die verelendeten Unterschichten richtete. Zwar forderte er in der erstmals unter seinem Namen erschienenen zweiten, umfassend überarbeiteten Fassung von 1803 grundlegende Sozialreformen im Erziehungs- und Gesundheitswesen der armen Massen, sogenannte nachwirkende »positive checks«. Ebenso deutlich sprach er aber davon, dass es auch »preventive checks« geben müsse. Explizit benannte er jedoch nur möglichst späte Heiraten. Verhütung und Abtreibung kamen für den frommen Christen explizit nicht infrage, Emigration stelle ebenfalls keine dauerhafte Lösung dar. Malthus’ ethisches Dilemma wird auch an den ständig überarbeiteten Neuauflagen (1806, 1807, 1817, 1826) und der intensiven, oft widersprüchlichen Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Willen Gottes deutlich. Denn obwohl er Sozialreformen forderte, hielt er diese angesichts eines exponentiellen (»geometric«) Bevölkerungswachstums letztlich gar nicht für ausreichend.[18] Ohne Bedauern konstatierte er im Gegenteil, dass gerade in den prekären Unterschichten, Hunger und Epidemien am effizientesten, weil dezimierend wirken, gerade hier ethisch motivierte bessere Hygiene und Versorgung sogar kontraproduktive Effekte zeitigten. Malthus löste dieses Problem für sich, indem er solches Elend und Leid als Teil eines größeren göttlichen Heilsplans bezeichnete. Er war bis zu seinem Tod dezidierter Gegner des gerade neu reformierten Armenrechts und beurteilte Kinder explizit nur nach deren »value for society«. Denn durch die gemeindliche Versorgung würden nur Faulheit (»unproductive idleness«) und Abhängigkeit gefördert und die Menschen pflanzten sich ungehemmt weiter fort, so »clogging the great machine of society«.[19] Keine Marginalie ist es, an dieser Stelle zu betonen, dass der anglikanische Pfarrer Malthus 1805 gerade aufgrund seines Bestsellers als erster professioneller »Economist« an dem kleinen brandneuen englischen East India College engagiert wurde, um hier exklusiv leitende Kolonialbeamte für Indien auszubilden. Er blieb dort bis zu seinem Tod 1834, und seine Theorien bildeten die selbstverständliche Leitlinie der heimischen, aber auch der kolonialen demografischen britischen Politik der folgenden Jahrzehnte. Insbesondere die in Indien tätigen britischen Mediziner versuchten das Malthussche Modell konkret auf die indigenen Völker anzuwenden. Ein zentrales Thema war dabei neben der schwächenden Masturbation v. a. der Umgang mit »early marriage[s]«, den verbreiteten Kinderehen unter den Hindus.[20]
Doch auch in deutschen Landen bemühten sich insbesondere christlich-sozial motivierte Theologen und Philanthropen nach den Napoleonischen Kriegen (1797-1815) um den Ausbau des Sozialwesens und um »positive checks« mittels Sozialreformen. Theodor Fliedner (1800-1864), evangelischer Pfarrer und Begründer der Kaiserswerther Diakonie z. B., nannte als Motivation zur Gründung seiner ersten »Kleinkinderschule« 1835 die »Verwahrlosung, Verkrüppelung und Verwilderung eines großen Teils der Kinderwelt« durch die unvermeidliche Vernachlässigung der Kinder der Armen durch berufstätige Eltern und elende Lebensbedingungen.[21] Ausführlich beschrieb er aus eigener Anschauung, in welch desolatem Zustand (»welk und verkümmert«) viele Kinder existieren müssten, dass diese bei ausreichender Fürsorge aber häufig vollständig, seelisch, körperlich und moralisch gesunden und zu leistungsfähigen Arbeitern heranwachsen könnten. Auch Philanthropen wie Fliedner argumentierten selbstverständlich utilitaristisch, um sowohl potentielle Wohltäter als auch Regierende zur Mitwirkung an drängenden Sozialreformen zu bewegen. Sie erwogen allerdings keine selektiven Eingriffe oder gar Tötungen von schwachen und kranken Kindern – und wissenschaftslogisch von entscheidender Bedeutung – sie sahen noch nachträgliche Optimierungschancen. Angeborene Mängel ließen sich kompensieren. ›Natur‹ war hier kein zwangsläufiges Schicksal, ›Kultur‹ der entscheidende Schlüssel zur Bevölkerungsverbesserung.
Das Dogma des Nutzens einer großen, gesunden und damit optimal arbeitsfähigen Bevölkerung scheint gerade in Flächen- und Kolonialstaaten im Verlauf der Geschichte dominiert zu haben, doch beschäftigten sich bereits räumlich begrenzt agierende Stadtstaaten wie das antike Athen oder Sparta intensiv mit Bevölkerungsmanagement im Sinne einer zahlenmäßigen Begrenzung bei gleichzeitiger Optimierung.[22]
Dabei ist der Begriff der Bevölkerung bzw. sein lateinisches Pendant der population selbst ein Konstrukt und etablierte sich zeitversetzt erst im 17. Jahrhundert. Vorher wurde er nur als Gegenbegriff zur Entvölkerung bzw. depopulation verstanden und signalisierte damit ein politisches Handeln, nämlich das Ansiedeln im und Besiedeln von Raum, und fungierte nicht als abstrakter analytischer Begriff einer Zustandsbeschreibung.[23] Allen Nuancen der Verwendung gemein ist jedoch die Tendenz zur Normalisierung, d. h. Homogenisierung, zur Vereinheitlichung der Standards eines ›Volkskörpers‹ als Kollektiv.[24]
Davon unberührt bleibt, dass vor der Mitte des 20. Jahrhunderts in keinem Land der Welt wirkliche Gleichheit aller Einwohner vor dem Gesetz existierte. Seit der Antike waren im Gegenteil verschiedene Formen von Ständegesellschaften die Norm. Sklaven, Freigelassene, Fremde mit Wohnrecht, illegale Heimatlose, Leibeigene, Frauen, Kinder, bestimmte Berufsgruppen, Herrschaftseliten, ›fremde Völker‹ wurden rechtlich unterschieden. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts kam die Hautfarbe als ein neues Kriterium für unterschiedliche Grade von Freiheit hinzu. Überall gab es ausdifferenzierte Hierarchien, die es schwer machten, pauschal von der Bevölkerung zu sprechen, außer, man betrachtete diese als kollektive ökonomische Ressource. Auch Malthus dachte selbstverständlich weiter in diesen ständischen Kategorien. Doch genau dieses Denken setzt zunächst das Primat einer – wie auch immer definierten – Ökonomisierung des Menschen voraus.
Die indische Anthropologin und Entwicklungssoziologin Shalini Randeria brachte aus dezidiert anti-eurozentristischer Perspektive diese Korrelation und den Konstruktivismus solcher Diskurse so auf den Punkt:[25]
»Die Kolonialmächte betrieben damals [im 19.Jh.] eine pronatalistische Politik, weil die Kolonien eine Quelle billiger Arbeitskräfte waren. Sie versuchten, die Fruchtbarkeit der Bevölkerung zu erhöhen, zum Beispiel mit der Einführung neuer Heiratsregeln in Indien. Stufte also der Westen die Kolonien zuerst als unterbevölkert ein, betrachtete er sie nach deren Unabhängigkeit als überbevölkert.«
Und in Bezug auf heute stellte sie scharfsinnig fest:
»Es kommt darauf an, wie und wozu man Zahlen interpretiert. Die Niederlande, eines der am dichtesten besiedelten Länder der Welt, gilt nicht als überbevölkert, genauso wenig die Schweiz, die auf Nahrungsmittelimporte angewiesen ist. Demgegenüber werden dünn besiedelte afrikanische Länder als überbevölkert angesehen, ebenso wie Indien, das seine Bevölkerung selbst ernähren kann.[26]Ich habe oft das Gefühl, in einer schizophrenen Welt zu leben: Während der indische Staat mit kostenlosen Sterilisationen Bevölkerungskontrolle betreibt, finanzieren in Europa die Krankenkassen künstliche Befruchtungen, und versuchen viele Länder, die Gebärfreude der einheimischen Bevölkerung zu stimulieren. Und die Migrationspolitik wird immer restriktiver.«
Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts erfuhr weltweit der gesamte Bereich der pränatalen Diagnostik eine dramatische Veränderung, nicht nur in der Dimension der Debatten über erwünschte und unerwünschte Fortpflanzungsergebnisse, sondern auch über Zahl und Art der tatsächlichen Geburten. Neue technische Entwicklungen, zunächst der bildgebenden Verfahren wie des Ultraschalls, fanden – weil vielversprechende Geschäftsmodelle – sehr schnell Verbreitung und wurden zu selbstverständlichen diagnostischen Mitteln in verschiedenen Bereichen. Gerade im Bereich der Schwangerschaft hat dieses nichtinvasive, schmerzlose Sehen in den Körper wie das Röntgen Jahrzehnte zuvor, zu extrem schneller Akzeptanz in der Bevölkerung der Industriestaaten geführt, aber auch und gerade in rasant wachsenden Schwellenländern wie Indien und China.
Seit den Neunzigerjahren des 20. Jahrhunderts wird außerdem die Präimplantationsdiagnostik (PID) angewendet, bei der das Erbgut eines im Labor erzeugten Embryos unter anderem auf Trisomie 21, Cystische Fibrose (Mukoviszidose), Chorea Huntington, die Bluterkrankheiten Hämophilie A und B sowie Sichelzellanämie überprüft wird. Auch nach Geschlecht oder nach potentiellen Spendereigenschaften für engste Blutsverwandte (Stammzellen) kann so bereits im frühesten Zellstadium selektiert werden. Der Embryo wird dann je nach Ergebnis entweder in die Gebärmutter eingepflanzt oder vernichtet. Überschüssige gesunde Zellhaufen, auf Vorrat produziert, werden eingefroren, später entweder noch einmal für eine eigene Schwangerschaft verwendet, der Wissenschaft für weitere Forschungen zur Verfügung gestellt, anderen Paaren gespendet oder ebenfalls vernichtet.
In neuester Zeit wird mit der »Genschere« experimentiert. Das Verfahren CRISPR/Cas9 soll DNA-Sequenzen aus dem Erbgut trennen, die als defekt identifiziert werden. Im August 2017 wurde dies in den USA erstmals bereits im Moment der Zeugung getestet. Die dabei produzierten Embryonen, die zu nur bzw. immerhin Dreivierteln die defekte Sequenz nicht mehr aufwiesen, wurden danach vernichtet. Auch diese Form der Biomanipulation wird künftig von den ›Besitzern‹ Entscheidungen über die Zukunft einer potentiell menschlichen Entwicklung fordern, gerade weil damit möglicherweise ein erhöhtes Krebsrisiko verbunden sein wird.[27] Damit werden auch in diesem zentralen Bereich durch technischen Wandel, den wir als Gesellschaften schließlich bewusst und gezielt betreiben und fördern, Dimensionen von Gewissensentscheidungen erreicht, die von unseren Jahrtausende alten philosophischen und religiösen Modellen ebenso wenig erfasst werden, wie von den ohnehin löchrigen rechtlichen Normen. Doch zwangsläufig gleichzeitig werden diese Reproduktionstechniken von Auswahlprozessen begleitet, für die keine adäquat eindeutigen oder auch nur gesellschaftlich verhandelten Kriterien existieren. Nicht die Frage der Machbarkeit an sich wird noch hinterfragt, sondern allein die Grenzen der Zulässigkeit werden global sehr unterschiedlich gesetzlich geregelt und immer wieder umgeschrieben. Längst machen z. B. belgische oder US-Kliniken mit der möglichen Selektion des Geschlechts und dem genetischen Screening bei der In-vitro-Fertilisation offen Werbung und ziehen damit schon seit einigen Jahren immer mehr solvente internationale Kundschaft an.[28]
Weltweit werden selbst Leben und Tod, auch nur scheinbar faktisch klare Zustände, dabei aber letztlich ethische, juristisch auszubuchstabierende Dimensionen und eben keine biologisch klar begrenzbaren Definitionen, rechtlich unterschiedlich definiert. Die Verhandelbarkeit auch solch grundlegender Verfasstheiten wird besonders eindringlich an der Debatte um Hirntod versus Herztod deutlich.
Im Alltag werden, auch mangels genügend Hintergrundwissens, diese Komplexitäten von den meisten Menschen gerne ausgeblendet. Die heute übliche Schwangerschaftsvorsorge wurde und wird zwar ausschließlich als Prävention zum Schutz der Gesundheit von Mutter und ungeborenem Kind öffentlich angepriesen, ist aber nolens volens Teil einer staatlichen Bevölkerungspolitik, mithin ein kollektiv beschwiegener Nebeneffekt angesichts steigender Gesundheitskosten. Denn nicht oder nur sehr bedingt arbeitsfähige Menschen, hier ressourcen- und betreuungsintensive Kinder, später Erwachsene, belasten ebenso die Kassen wie die stetig kostspieligere Behandlung und Versorgung der wachsenden Zahl an multimorbiden alten Patienten.[29]
Die Historikerin und Soziologin Barbara Duden hat für den Fortpflanzungsbereich schon vor 25 Jahren auf dieses moralische und ethische Dilemma aller Beteiligten hingewiesen, das sich heute auf den gesamten Bereich der Früherkennung, v. a. auch von Erbkrankheiten, erstreckt und mit dem Begriff der »Technologiefolgenabschätzung« zwar korrekt, aber in seinen emotionalen und sozialen Dimensionen nur unzureichend beschrieben wird.[30] Denn es sind im Falle der Fortpflanzung die potentiellen Eltern und im Falle der körperlichen Konsequenzen in der Regel letztlich die Frauen, denen eine Entscheidung über Leben und Tod mit all den daran hängenden Schuldzuweisungen und Schuldgefühlen, ganz unabhängig von der Richtung der Entscheidung, aufgezwungen wird. Erschwerend kommt im Falle des standardisierten Erst-Trimester-Screenings noch hinzu, dass gar keine klaren Diagnosen erstellt, sondern nur statistische Wahrscheinlichkeiten benannt werden, die eine Kette weiterer, ebenso unsicher basierter (mögliche erbliche Vorerkrankungen, Alter der Erzeuger, gewählte Testverfahren) Folgeentscheidungen nach sich ziehen. Diese Situation, die so vor einigen Jahrzehnten gar nicht möglich gewesen wäre, wird in ihrer Tendenz massiv von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, den technischen wie ökonomischen Effizienzprinzipen bestimmt, letztlich aber doch in ihrer Verantwortung wieder individualisiert und ›re-privatisiert‹.
Die Pränataldiagnostik hat sich nach wie vor dem alten ethischen Problem um die Lebensdebatte und dessen (ob nun religiöser oder profaner) ›Heiligung‹ zu stellen: ob und wenn ja, inwieweit bereits der Embryo ein schützenswertes Wesen sei, dem Menschenwürde zukomme.[31] Dabei gibt es eben einerseits eine lange Tradition des Bemühens um menschliche Optimierung ›von oben‹ mit der Frage, wie mit den als suboptimal definierten Individuen umzugehen sei – wovon in diesem Buch hauptsächlich die Rede sein soll. Andererseits wächst mit zunehmender gesellschaftlicher Selbstverständlichkeit des Machbaren, der vorhin angesprochenen Normalisierung durch Grenzverschiebungen in Diskurs und Praxis, auch ein Markt bzw. die Nachfrage ›von unten‹. Beide Entwicklungen hängen eng zusammen, wie noch zu zeigen sein wird. Die Diskussionen um das gesellschaftlich Erwünschte und Zulässige dauern an und werden, je nach Priorisierung bestimmter Normen und Werte, aber v. a. auch bestimmter Axiome, nie endgültig zu beantworten sein. Schon das Thema Abtreibung fordert die jeweiligen Gesellschaftsnormen stets neu heraus. Seit der Antike und auch in Mittelalter und Früher Neuzeit wurde die Frage nach dem Beginn des Lebens immer wieder unterschiedlich beantwortet. Bis heute schwelt in der philosophisch-theologischen Debatte der grundsätzliche Streit zwischen den Verfechtern der »Sukzessivbeseelung« (nach Aristoteles lebt ein männlicher Embryo nach 40 Tagen, ein weiblicher erst nach 90, ein Verständnis, das sich auch im 3. Buch Mose 12, 1-5 findet) und jenen der »Simultanbeseelung« (gilt in den christlich-orthodoxen Kirchen bereits seit dem 7. Jahrhundert). Begann das Leben also mit der Zeugung oder erst mit der ersten Bewegung im Mutterleib, mithin dem Moment, in dem Gott offenbar der Leibesfrucht erst ihre Seele und somit Menschenwürde verlieh?[32] In der heutigen Diskussion gerne vergessen wird dabei, dass das römisch-katholische Kirchenrecht noch im 19. Jahrhundert zwischen beseeltem (animatus) und unbeseeltem (inanimatus) Fötus unterschied. Papst Innozenz XI. dekretierte unter Berufung auf neueste medizinische Erkenntnisse 1679 gar explizit:
»Es ist erlaubt, vor der Beseelung eines Fötus eine Abtreibung vorzunehmen, damit das Mädchen nicht, wenn es schwanger ertappt wird, getötet werde oder in schlechten Ruf komme. Es scheint wahrscheinlich, dass jeder Fötus (solange er in der Gebärmutter ist) einer vernunftbegabten Seele entbehrt und erst dann anfängt, eine solche zu haben, wenn er geboren wird; und folglich wird man sagen müssen, dass bei keiner Abtreibung ein Mord begangen wird.«[33]
Hier ging es allerdings nicht um menschliche Optimierungsstrategien, sondern um das andere große Thema einer normativ aufgeladenen Fortpflanzungsdebatte: um die Sittlichkeit von insbesondere weiblichem Sexualverhalten, das interkulturell weltweit vor dem Hintergrund patriarchaler Vorstellungen von Ehre, Ökonomie und Erbe sowie dadurch motivierten – in diesem Fall christlichen – ›Ehrenmorden‹ verhandelt wird.
Noch bis vor wenigen Jahrzehnten waren dem Menschen in seinem Bestreben nach Perfektionierung des Körpers und des Geistes enge technische Grenzen gesetzt, weshalb die meisten nicht invasiven utopischen Entwürfe schlicht nicht realisiert werden konnten. Die mittlerweile immerhin in Ansätzen erforschte Geschichte staatlich-eugenischer Experimente und Programme vieler Industrieländer im 20. Jahrhundert, z. B. Skandinaviens, der Schweiz, Nordamerikas aber auch der Sowjetunion und Japans, zeichnet allerdings bis heute ein viel drastischeres Bild als den meisten Menschen bewusst sein dürfte. So ist immerhin bekannt geworden – und hat in verschiedenen Ländern seit den 1990er Jahren emotionale öffentliche Debatten und gesetzliche Änderungen bewirkt – dass es eben nicht die Nationalsozialisten waren, die als erste und einzige eugenische Programme entwickelt und auch umgesetzt hatten. Vielmehr haben im Zuge einer globalisierten eugenischen Bewegung seit Ende des 19. Jahrhunderts kaum zeitversetzte Wellen staatlicher Programme die Bevölkerungsprofile und das Normalitätsverständnis gerade auch demokratisch regierter Länder schleichend verändert.
Seit ihrer technisch vergleichsweise gefahrlosen Machbarkeit stellt insbesondere die Zwangssterilisation von körperlich und geistig Behinderten, sowie von sozial unerwünschten Personengruppen wie »Asozialen«, »Debilen«, ledigen, nach patriarchaler Logik also »unsittlichen« jungen Müttern sowie auch Alkoholkranken oder Verhaltensauffälligen aller Art und last but not least, ethnisch als minderwertig definierten Gruppen, bis teilweise weit in die 1980er Jahre hinein eine Selbstverständlichkeit dar.[34] Zu nennen wären hier wieder neben den USA v. a. Skandinavien und die Schweiz.[35] In der Alpenrepublik sterilisierte der Psychiater Auguste-Henri Forel (1848-1931) 1886 die erste Frau wegen einer »sexuellen Neurose« und dann aus dezidiert eugenischen Gründen in den nächsten 20 Jahren weitere Männer und Frauen.[36] Dort traf es auch viele der als »asozial« stigmatisierten »Verdingkinder« aus tatsächlich oder scheinbar problematischen sozialen Verhältnissen und die vagierende Gruppe der »Jenischen«. Aber auch in Australien[37], Kanada und den USA, mit ihren bald inferiorisierten indigenen Völkern, existierten bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts quasi autonom agierende staatliche und/oder kirchliche Institutionen, meist im Zusammenhang mit einem organisierten Fürsorge- und Zwangsinternatssystem. Aus dessen Fängen konnte sich kaum jemand befreien, der einmal als deviant stigmatisiert worden war.[38]
Obwohl der Eingriff bei Frauen physisch erheblich aufwendiger und kostspieliger war, trafen die Zwangsterilisationen aus religiös-normativen Gründen fast überall überwiegend Frauen und Mädchen. Berichte über das Fortdauern solcher Praktiken, mindestens mit staatlicher Tolerierung, wenn nicht gar im staatlichen Auftrag, zeigen noch heute in der Slowakei[39], Indien, China und anderen Ländern, dass dieses Thema keineswegs der Vergangenheit angehört – zumal in den mit Abstand bevölkerungsreichsten Ländern China und Indien, die Abtreibung weiblicher Föten weiterhin an der Tagesordnung ist.[40]
Gerade im von den Entwicklungen in Großbritannien stark beeinflussten Australien und den USA spielten schon Ende des 18. Jahrhunderts Fragen der Rasse und eine mehr oder weniger biologisierte Überlegenheit von »whiteness« eine zentrale Rolle für Identitäts- und »nation building«.[41] Für die französischen karibischen Kolonien entwarfen Verwaltungsmitglieder sogar bereits Ende des 18. Jahrhunderts konkrete Zuchtmodelle, allerdings weniger aus geschäftlichen, denn aus gesellschaftspolitischen Motiven.[42] In den USA wurde von den Plantagenbesitzern, angelehnt an die Nutztierzucht um die Mitte des 19. Jahrhunderts, vergeblich versucht, das »slave breeding« zu optimieren. So sollte nach dem Verbot des Sklavenimports von 1807 das Nachschubproblem gelöst und durch den Verkauf auch noch Gewinne erwirtschaftet werden. Sexualisierte Gewalt gegenüber Mädchen und Frauen war logischerweise Teil und Grundbedingung eines solchen Systems.[43] Ganz selbstverständlich praktizierten und forcierten auch liberale Aufklärer und Vordenker wie etwa Thomas Jefferson (1743-1826) als Politiker und Plantagenbesitzer diesen Versuch der Gewinnoptimierung.[44] Eine neue Studie führte gerade am Beispiel der jungen USA dramatisch vor, wie sehr durch den Sklavenstatus der größten Bevölkerungsgruppe, der Aufstieg und die ökonomische Macht der USA erst möglich wurden. Denn erst der explodierende Binnen-Sklavenhandel nach 1810 ermöglichte die US-Expansionen nach Mexico und Kuba sowie in weitere südamerikanische Staaten.[45] Indem gezielt gezeugte Menschen schon bei der Geburt als »human assets«, als kapitale Wette auf die Zukunft betrachtet wurden, zeigt sich, wie sehr nicht nur die allgemeine Bevölkerungspolitik, sondern gerade die konkrete Menschenzucht v. a. ein ökonomisch relevantes Thema darstellte. Dies lässt sich auch am Machtkampf zwischen den beiden Staaten Virginia (als Zentrum der Sklavenzucht) und South Carolina (als größter Sklavenimporteur, der als Verlierer des Machtkampfs um die Sklaverei als Ressource dann die Sezession betrieb) ablesen, bei dem Schwarze als billigste Arbeitskraft ausgebeutet, v. a. aber auch als Kreditsicherheiten eingesetzt wurden.[46] Die andere Seite der Medaille stellte der Versuch des »breeding out the colour« aufgrund der britischen weißen Überlegenheitsideologie dar. Dies galt sowohl für die Schwarzen in den jungen USA als auch für die Aborigines in den australischen Kolonien. Teil dieser Logik waren die seit Mitte des 18. Jahrhunderts von Deutschland und Frankreich ausgehenden, heiß diskutierten anthropologischen Theorien rund um die begrifflich noch nicht klar geschiedene Trias von »Rasse«, »Spezies« und »Art« im Zusammenhang mit ersten evolutionären Konzepten zur Vererbung. Dazu gehörte auch die Vorstellung, dass wie bei bestimmten Tieren, jene »mixed-bloods« mit den ungünstigsten Mischungsverhältnissen (»corrupt«, »degraded« und »ill-bred«) spätestens nach einigen Generationen selbst unfruchtbar würden.[47] Interessanterweise war die akademische Meinung über indigene »half-breeds« in den USA vielfach eine bessere, da diese durch missionarische Erziehung oft zu lokalen wirtschaftlichen Eliten aufstiegen, selbst Sklaven erwarben, stolz auf ihr teilweise »weißes Blut« waren und stammestraditionell motiviert, ihrerseits ebenfalls Wert auf strenge Heiratsregeln legten.[48]
Dieses »selective breeding«, wie bereits von Malthus angeregt, wird heute in erster Linie mit dem Begriff der Eugenik und dessen expliziter Ausformulierung durch Charles Darwins (1809-1882) Cousin Francis Galton (1822-1911) verbunden. Dessen Schrift Hereditary Talent and Character (1865) basierte explizit auf der Ableitung menschlicher Zucht von der Tierzucht, primär englischer Rennpferde und Jagdhunde (Bassets). In Abgrenzung zu Malthus und in Anlehnung an Darwins Vererbungstheorie bezeichnete er die verelendeten englischen und irischen Unterschichten als unrettbar degeneriert in ihrer »physical structure« und forderte außerdem das konsequente staatlich kontrollierte Auszüchten unerwünschter, kollektiv unterstellter Charaktereigenschaften (»mental qualities«) über mehrere Generationen hinweg, etwa die Neigung zu Trunksucht, Faulheit und hemmungsloser Sexualität. Zwangsheiraten der Besten und Heiratsverbote für die Schlechtesten »in stock« waren nur eine logische Konsequenz zur Bevölkerungsoptimierung und Elitenzucht und beileibe keine neue Idee (Hereditary Genius 1869). Die Ablehnung der Lamarckschen, aber auch teilweise noch Darwinschen Theorie von der Vererbung erworbener Eigenschaften durch »use« und »disuse« innerhalb einer Generation war ein anderer Teil der Galtonschen Philosophie und Logik.[49]
Darwin und Galtons Werkte stellen damit viel mehr als Malthus’ Essay eine bis heute öffentlich weitgehend noch immer nicht als solche wahrgenommene ethisch-moralische Wende dar. Insbesondere der durch Galton ausgelöste Dammbruch, in dem was nicht mehr nur denkbar, sondern nun öffentlich sagbar und bald auch politisch umsetzbar war, die von den englischen »Eugenic Societies« ab der Jahrhundertwende in alle Welt exportieren Modelle und (Zwangs-)Maßnahmen, lassen eugenisches Denken als eine Erfindung der Moderne, als logische Folge des industriellen und säkularisierten Kapitalismus erscheinen.[50] Auch und gerade am Beispiel der Modelle zu Bevölkerungspolitik durch selektive Menschenzucht lässt sich die Theorie des Mediziners und Wissenschaftsphilosophen Ludwik Fleck (1896-1961) zur Genese wissenschaftlicher Tatsachen wunderbar durchexerzieren:[51]
Voraussetzung für die Akzeptanz einer Tatsache als solche sind die »Denkkollektive« von Experten. Sie sind vor dem Hintergrund ihrer Zeitgenossenschaft an bestimmte »Denkstile« gebunden und entscheiden so über die Zulassung neuer Erkenntnisse zum Kanon. Nur innerhalb der Grenzen des eigenen Denkkollektivs und zwischen parallelen Kollektiven werden laut Fleck adaptive Varianten des Denkens zur Diskussion zugelassen. Wandel geschieht darum nur schrittweise, über »Denkstilergänzung, Denkstilerweiterung und Denkstilumwandlung«.
Befürworter solch spezifischer Formen der ›Familienpolitik‹ als Staatsprogramm fanden sich nämlich zu verschiedenen Zeiten auf durchaus unterschiedlichen Seiten des politischen und ideologischen Spektrums. So forderten Teile der internationalen Frauen- und auch der Arbeiterbewegung seit Ende des 19. Jahrhunderts staatliche Maßnahmen und den rechtlich legitimierten Eingriff in die Entscheidungsfreiheit und körperliche Integrität des Individuums.[52] Gemeinsames Motiv solch unterschiedlicher Interessengruppen war das Streben nach einer »besseren« und damit glücklicheren Gesellschaft. Unausgesprochener Teil dieses Glücks war selbstverständlich auch ökonomischer Wohlstand. Diesem höheren kollektiven Interesse hatte sich der/die Einzelne schlicht zu unterwerfen. Wie eine solche Gesellschaft genau aussehen und wer über ihre Ausgestaltung befinden sollte, darüber wurde meistens weniger offen diskutiert.
Dieser unhinterfragte Vorrang der Gemeinschaft vor dem Individuum – deren Interessen zuerst einmal als einheitlich und homogen konstruiert und behauptet werden müssen – stand schon im Zentrum des ersten uns bekannten und bereits damals sehr elaborierten Konzepts staatlich organisierter Menschenzucht mit eugenischen Aspekten. Der eingangs zitierte Platon beschrieb die Prioritäten seines Idealstaates zunächst explizit als militärische und herrschaftspolitische Belange. Er entwickelte seine Überlegungen bereits im 4. Jahrhundert vor Christus in seiner Politeia als eine Form der Staatsräson.[53] In diesem als Gesprächsammlung ausgearbeiteten politischen Konzept ließ Platon Sokrates im fiktiven Dialog mit seinem, Platons älterem Bruder, Glaukon das Modell eines ständisch geordneten, aber autokratisch geführten idealen Staates diskutieren. Die Bevölkerung dieser Politeia wäre, so wird unermüdlich postuliert, zum Besten, d. h. zur Glückseligkeit aller Staatsbewohner (Eudaimonie), indogermanischen Traditionen folgend in drei Stände mit unterschiedlichen Rechten und Pflichten gegliedert: den der Handwerker, Kaufleute und Bauern (Demiurgoi), den Stand der Soldaten bzw. »Wächter« (Phylakes) und den einer kleinen, aus dem Wächterstand rekrutierten vernunftbegabten Herrscherelite (Archontes). Zwei elementare Grundregeln sollten nur für die Wächter und die Herrscherkasten gelten: die Aufhebung des Privateigentums und die Auflösung der elementaren Einheit der Kernfamilie als Ehe zwischen Mann und Frau und von diesen gemeinsam gezeugten Kindern. Es sollten dennoch in religiös legitimierten Hochzeitsritualen gezielt und möglichst häufig die »Besten mit den Besten« vermählt werden. Nur die tapfersten Krieger sollten mit möglichst vielen Frauen viele edle Kinder zeugen. Zur Vermeidung emotionaler und möglicherweise dadurch ausgelöster, den gesellschaftlichen Frieden gefährdender, Gewalthandlungen unter den Mitgliedern der Elite, müsse die Regierung die Entindividualisierung des Beischlafs und damit die Entkopplung von Emotionen wie Lust (Begehren) und Liebe (individueller Verbundenheit) besonders überzeugend legitimieren. Religion und ihre Rituale werden hier ausschließlich als normative Überzeugungshilfe begriffen, denn die Teilhabe an Kulten aller Art dient hier nicht dem Gottes-Dienst im monotheistischen Sinne, sondern ist einzig Ausdruck der Loyalität zum Staat.
Auch die Versorgung der Säuglinge und Erziehung der Kinder des Wächterstandes würde in diesem Idealstaat kollektiv organisiert. Keine Mutter dürfe ihr leibliches Kind stillen. Die Kinder der Wächter und Herrscher dürften auch nie erfahren, wer ihre leiblichen Eltern seien, wiederum um Zwist in der Gemeinschaft zu vermeiden. Erbschäden durch versehentlich zu enge Inzucht sollten in direkter, absteigender Linie durch Beischlafverbote zwischen denjenigen verhindert werden, deren Geburt zwischen sieben und zehn Monaten nach dem Beischlafritual des älteren Teils – Platon ging selbstverständlich von den Männern aus – schriftlich aufgezeichnet würde. Ab einem gewissen Alter allerdings, wenn die Beteiligten »des Laufes schärfste Höhe hinter sich« hätten – Platon setzte 40 Jahre für Frauen und 55 für Männer an – solle man den Beteiligten den freien heterosexuellen Verkehr wieder gestatten, um Druck aus dem System zu nehmen. Sexualität als natürlicher Trieb aller Menschen, sowie homosexuelle Beziehungen unter Männern waren anerkannt und standen nicht im Widerspruch zur Fortpflanzungspolitik, im Gegenteil. Denn den am Gespräch beteiligten Philosophen war klar, dass ein Großteil der Männer an Frauen sexuell gar nicht übermäßig interessiert wäre. So schließt denn das fünfte Buch der Politeia auf die Frage, ob denn besonders tapfere Männer nicht nur mit sozialem Aufstieg, sondern auch mit »Küssen« belohnt werden dürften, die jedoch sexuelle Reize auslösen könnten, mit dem Satz:
»…daß keinem, den er küssen will, gestattet sein soll, es zu verweigern, damit auch, falls einer etwa einen Geliebten hat oder eine Geliebte, er um so eifriger sei, nach dem Preise der Tapferkeit zu trachten.«
Die Sorge um die »Samenökonomie« der monotheistischen Spätantike und späteren Jahrhunderte (seit Onan, der in Genesis 38, 8-10 masturbierte, um nicht die Frau seines verstorbenen Bruders schwängern zu müssen) spielte bei den alten Griechen gar keine Rolle. Dabei waren Vorstellungen von Vererbung und Befruchtung bereits damals selbstverständlicher Teil des medizinischen Weltbildes, ebenso Erfahrungswissen über zu enge Inzucht.
Auch wenn moderne Vererbungstheorien und Begriffe wie ›natürliche Selektion‹ erst nach 1865 durch die massive Rezeption von Darwins Origin of the Species und den Schriften Galtons weltweit zum ›Allgemeinwissen‹ geronnen,[54] so hatten sich bereits Hippokrates, Empedokles und Aristoteles intensiv mit der Rolle von väterlichem und mütterlichem Samen bei der Zeugung und mit den von den elterlichen individuellen Säfteverhältnissen abgeleiteten Temperamenten (Phlegmatiker, Choleriker, Melancholiker und Sanguiniker) befasst. Selektive Tierzucht wurde ebenfalls längst praktiziert, worauf Platon Sokrates in der Politeia auch explizit Bezug nehmen lässt. Denn Menschen seien in Analogie zu Nutztieren zu züchten wie Jagdhunde, Pferde und Geflügel.
Auch die körperliche Fitness spielte bei Platon wie bei den Spartanern eine entscheidende Rolle zur Ausbildung von Führungspersonen. Mindestens gleichwertig zu körperlicher Perfektion war jedoch die charakterliche Veredelung, denn die Tugendhaftigkeit (Arete) aller Mitglieder der Polis sollte maximiert werden. Tüchtigkeit und Tapferkeit z. B. konnten die Befreiung und den sozialen Aufstieg eines Sklaven ebenso zur Folge haben, wie die Feigheit eines Wächters im Krieg seine Degradierung zum Bauern.
Die Frage der Zucht von Sklaven oder auch der Bauernschicht, den unteren Ständen der Polis, d. h. der Umgang mit den »Metöken« (Mothakes, den ansässigen Fremden) und möglicherweise sogar versklavten Mothones, wird in diesem elitären Konzept nicht gesondert thematisiert. Dies steht im Gegensatz zu den vorab erwähnten Spartanischen Entwicklungen, die trotz großen Unbehagens gegenüber einer befürchteten Degeneration des Spartanischen »Genos« in späterer Zeit ausgewählte Xenoi oder Perioikoi (Einwohner unterworfener Nachbargemeinden) einheiraten ließen.[55] Es hieß nur, dass andere »Griechen«, also Nicht-Athener, keinesfalls versklavt werden dürften, um den ethnischen ›Pool‹ der zivilisierten Völker nicht unnötig gegenüber den nicht griechisch sprechenden »Barbaren« der Restwelt zu schwächen. Diese Fixierung auf die Zucht oligarcher Eliten unterscheidet antike Utopien und auch die Utopien der Renaissance von den Ideen zu Menschenzucht der Aufklärung – doch dazu später mehr.
Zur körperlichen Erziehung gehörte bei Platon das bekannte sportlich-militärische Training der jüngeren Männer bis 30 Jahren im »Gymnasion« v. a. deshalb, weil nur ein durch gute Lebensführung und physisches Training erzeugter starker gesunder Körper, eine ebensolche Seele beherbergen könne. Geistige und körperliche Ausbildung gingen wie in Sparta Hand in Hand. Darum sollten auch die Ärzte keine Zeit und Ressourcen an jene verschwenden, die sich durch ungesunde ausschweifende Lebensführung unter Ignorierung medizinischen Rates selbst in einen chronisch siechen Zustand hineinmanövriert hätten. Eine umstrittene vielzitierte Stelle bei Platon geht sogar noch weiter: »Wer siech am Körper ist, den sollen sie sterben lassen, wer an der Seele missraten und unheilbar ist, den sollen sie sogar töten.« Der Medizinhistoriker Udo Benzenhöfer weist allerdings den eugenischen Gehalt der letzten Aussage als aus dem Zusammenhang gerissene Fehlinterpretation zurück. Hier ginge es nicht um die Tötung Geisteskranker, sondern um die Hinrichtung von notorischen Kriminellen durch das zuvor im Text angesprochene Rechtssystem.[56]
Auch hieran zeigt sich jedoch, dass schon in der Antike staatliche Bevölkerungspolitik als Voraussetzung für alle weitere Gesellschaftsformierung und -stabilisierung betrachtet wurde, wofür auch damals bereits eine elaborierte bürokratische Steuerungsmaschinerie und eine an den Interessen des Staates ausgerichtete Staatsmedizin zur Verfügung stehen sollten. Offen gab Platon zu, dass die Regeln, die dabei anzuwenden seien, nur der Herrscherelite bekannt sein dürften, da sonst Neid, Unruhe und Konkurrenz selbst in der gebildeten Führungsschicht entstehen könnten. Wichtiger Teil des Konzeptes waren eben nicht nur Eheverbote für bestimmte als minderwertig identifizierte Individuen, sondern die langfristig stetige Verringerung des Anteils an körperlich und geistig schwächeren Menschen in jenen Teilen der Bevölkerung, denen noch ein gewisser Anteil an der politischen Teilhabe zugesprochen wurde.
Wie im antiken Griechenland üblich, sollten auch im perfekten Staat zusätzlich zur Beischlafsregelung »gebrechliche« und behinderte Säuglinge, wie es wörtlich heißt, »verborgen« werden. Ob damit euphemistisch das übliche Aussetzen Neugeborener nach der Geburt gemeint war oder nur der Ausschluss aus dem elitären Wächterstand, ist in der Forschung bis heute umstritten. Denn im Gegensatz zur sonstigen Deutlichkeit wird hier eben nicht gesagt, wie genau mit den »Verborgenen« anschließend weiter verfahren werden sollte und welche gesellschaftlichen Aufgaben ihnen als Erwachsene zukommen könnten. Auch sollten Kinder, die von zu alten Männern, also jenen über 55, gezeugt worden waren, »abgetrieben« werden. Zum Thema der Kindstötung und Kindesaussetzung »wie es sich gehört«, gibt es verschiedene Stellen in der Politeia und später auch bei Aristoteles, der sich auch in Bezug auf die Altersgrenzen bei der Eheschließung Platon anschloss, sowie möglichst frühzeitige Abtreibungen bei zu stark wachsender Bevölkerung forderte.[57]
An anderer Stelle werden vage Zuchtziele wie soldatische Stärke und körperliche Fitness für die Landwirtschaft thematisiert. Allerdings bleibt zwischen Platon und Aristoteles umstritten, ob und welche Heiratsbeschränkungen für die beiden unteren Stände gelten sollten. Während Platon keine Überbevölkerung befürchtete, prognostizierte Aristoteles die Gefahr dadurch hervorgerufener sozialer Unruhen. Abtreibungen und die Tötung behinderter Kinder waren auch für ihn selbstverständlich.[58]
Fakt ist aber wohl, dass in allen mediterranen antiken Kulturen das bewusste Sterbenlassen durch Verbringung an abgelegene Orte (»Verbergen«) durchaus üblich war, und v. a. in den Stadtstaaten Athen und Sparta zur Blütezeit eine gewisse Bevölkerungsgröße weder über- noch unterschritten werden sollte. In Sparta entschied nach Plutarch nicht das Familienoberhaupt über die Lebensberechtigung eines Säuglings, sondern ein Rat aus Stammesältesten befand nach Begutachtung des Körpers des Neugeborenen über Aussetzung oder nicht.[59] Das Ertränken oder Aussetzen behinderter, weil »unnützer« Kinder galt auch in Rom noch als Gebot der »Vernunft«, wenn auch vermutlich ein Großteil der Säuglinge noch lebend von Dritten aufgefunden und angenommen oder als Sklaven wieder verkauft wurde.[60] Aussagen über die tatsächliche Häufigkeit solcher Verhaltensweisen lassen sich allerdings für keine Kultur und Epoche treffen. Auch mittelalterliche und frühneuzeitliche christliche Gesellschaften kennen entgegen aller religiöser Normen heimliche Praktiken wie das unversorgte bzw. unbehandelte Liegenlassen von unerwünschten oder kranken Neugeborenen und Kleinkindern. In Süddeutschland und Österreich wurde das im 19. Jahrhundert noch ganz öffentlich »Himmeln Lassen« genannt.[61]
An den Diskursen über und an der Heimlichkeit dieser Praktiken lässt sich allerdings das grundlegende Dilemma erkennen. Während es in den normativen Zeugnissen der paganen Kulturen um säkulare, letztlich ökonomische und militärische Staatsinteressen ging, die über Zahl und geistige Fitness der Bevölkerung definiert wurden, waren die Texte der frühen jüdisch-christlichen Zeit durch theo-normatives Denken geprägt und begründeten ihre zunehmende Ablehnung der Kindesaussetzung damit, dass das Leben immer eine geheiligte Gabe Gottes sei.[62]
Mit diesem kursorischen Einblick in das Spektrum von antiker Bevölkerungspolitik und moderner Eugenik ist die bis heute gültige Konfliktlinie eines die Menschheit begleitenden Themas bereits in ihren Umrissen und Eckpunkten vorgezeichnet. Die Thematik ist also nicht neu, und Generationen von Wissenschafts- und Medizinhistorikern und -historikerinnen auf der einen, die Geistes- und Philosophiegeschichte auf der anderen Seite und eine stark spezialisierte und eher marginalisierte Demographiegeschichte haben sich immer wieder mit Teilaspekten der Genese und Rezeption europäischer Texte zu Staatsphilosophie und Bevölkerungspolitik beschäftigt.[63] Auch wurde und wird gelegentlich mehr oder weniger sinnvoll zwischen ›positiver‹ (unterstützender) und ›negativer‹ (prohibierender) Eugenik unterschieden. Doch sind die Grenzen, gerade in der Vormoderne, mangels technisch großer Spielräume, aber auch abhängig von der sprachlichen Definitionsmacht hier noch sehr fließend.[64] In den letzten Jahren ist das Thema v. a. auf die englisch- und französischsprachigen Schriften des 18. und 19. Jahrhunderts bezogen, auch in den Fokus der Literaturwissenschaften gerückt. Doch deren Erkenntnisse wurden von den Nachbardisziplinen oft kaum rezipiert. So irritiert, dass auch die aktuellste und umfassendste Studie zum Thema aus gesamteuropäischer Perspektive explizit wieder nur die quantitativen Aspekte betrachtet und »Äußerungen zur Qualität der Bevölkerung oder eine qualitative Bevölkerungspolitik […] nicht untersucht« hat.[65]
Eine Integration der Erkenntnisse mit Fokus auf die vielschichtige Umbruchphase der Aufklärung scheint darum sinnvoll. Das Ende der Frühen Neuzeit im Übergang von Mittelalter zum Industriezeitalter hatte mit einer Vielzahl an Neuerungen, aber auch der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen in allen Bereichen umzugehen; liefen doch seit der Mitte des 18. Jahrhunderts besonders viele technische, wissenschaftliche, philosophische und andere Strömungen in einer neuen Form des akademischen Bevölkerungsdiskurses zusammen. Deren Essenz bildet noch heute die Grundlage uns selbstverständlich erscheinender Gewissheiten, Wahrheiten und Werte, deren axiomatische Vorannahmen wir kaum noch infrage stellen.
Damit geht es aber nicht etwa um ›Aufklärungs-Bashing‹. Es geht nicht darum zu demonstrieren, dass auch die Helden der westlichen Wertegemeinschaft in Wahrheit keine ›Guten‹ gewesen seien. Es geht nicht darum, die Errungenschaften der Aufklärung, wie die normative Festlegung der Menschenrechte, den mühsamen Weg zur empirischen Erkenntnis, losgelöst von religiösen Dogmen, die graduelle Auflösung der Ständegesellschaft hin zu einer tendenziellen Gleichberechtigung aller abzuwerten, wie neo-reaktionäre Stimmen unter dem Etikett eines »Dark Enlightenment« die Erkenntnisse gerade von den Füßen auf den Kopf zu stellen versuchen. Federführend wäre hier der englische Philosoph und Autor Nick Land zu nennen, auf dessen gleichnamiges Traktat sich das sog. Alt-Right Movement in den USA um den ehemaligen Präsidentenberater Stephen Bannon gern bezieht und der wie die antiken Autoren Menschenzucht mit der Ausgestaltung der politischen Führung und Charakter des Systems eines Staates verknüpft. Land bezeichnet
»the dynamics of democratization as fundamentally degenerative: systematically consolidating and exacerbating private vices, resentments, and deficiencies until they reach the level of collective criminality and comprehensive social corruption. […] This analysis introduces the central paradox of ›white identity‹, since the specifically European ethnic traits that have structured the moral order of modernity, slanting it away from tribalism and towards reciprocal altruism, are inseparable from a unique heritage of outbreeding that is intrinsically corrosive of ethnocentric solidarity. In other words: it is almost exactly weak ethnic groupishness that makes a group ethnically modernistic, competent at ›corporate‹ (non-familial) institution building, and thus objectively privileged / advantaged within the dynamic of modernity.«[66]
Im Unterschied zur rassisch motivierten Eugenik geht es Land also nicht um die Schaffung einer ethnisch reinen »Herrenrasse«: »Because inbreeding systematically contra-indicates for modern power, racial Übermenschen make no real sense.« Nur die Zucht einer intellektuellen Elite, welche die Logik ihres Handels auf moralfreie, computerbasierte Intelligenz stütze, könne das kapitalistische System noch retten.Es gibt begründete Hinweise darauf, dass sich viele CEOs der hochtechnisierten Konzerne des Silicon Valley als genau die avisierte Führungselite einer solchen optimierten Gesellschaft betrachten.[67]
Die Gefahr so interpretiert zu werden, in dichotomische Kategorien von Schwarz und Weiß, von Optimierung und Degeneration zu verfallen, zeigte bereits Michel Foucault in seinem durch Kants gleichnamigen Vortrag angeregten Essay Was ist die Aufklärung? Er nannte dieses Missverständnis »die Erpressung der Aufklärung«. Sie sei »als eine Gesamtheit politischer, ökonomischer, sozialer, institutioneller und kultureller Ereignisse, von denen wir noch zu einem großen Teil abhängen, ein besonderes Feld der Analyse.« Und Foucault fährt fort:
»Aber das heißt nicht, daß man für oder gegen die Aufklärung sein muß. Es heißt sogar, daß wir alles zurückweisen müssen, was sich in Form einer vereinfachten und autoritären Alternative darstellt: entweder man akzeptiert die Aufklärung und bleibt in der Tradition ihres Rationalismus (was von einigen als positiv betrachtet und von anderen als Vorwurf benutzt wird); oder man kritisiert die Aufklärung und versucht, diesen Prinzipien der Rationalität zu entkommen (auch dies kann wiederum als gut oder schlecht angesehen werden). Und wir brechen aus dieser Erpressung nicht aus, indem wir dialektische Nuancen einführen, während wir zu bestimmen suchen, was an der Aufklärung gut oder schlecht gewesen sein mag.«[68]
In diesem Licht betrachtet geht es bei der Auseinandersetzung mit Konzepten der Bevölkerungsoptimierung, die gerade zur Zeit der Aufklärung eine Renaissance und Weiterentwicklung erlebten, eben nicht um Rück- oder Fortschritte, um eine abstrakte Humanität oder im Gegenteil um Unmenschlichkeit der im Folgenden vorgestellten Autoren (und sehr wenigen Autorinnen). Vielmehr geht es um die Kehrseite, die Fallstricke eindeutig gut gemeinter, der Verbesserung des kollektiven Lebens dienender Ideen, aber unter Berücksichtigung dessen, was je als Verbesserung definiert wurde. Ja, ein Großteil der Aufklärer und ihrer Nachfolger suchte und fand neue Legitimationen für die Zementierung der Nicht-Gleichberechtigung von Frauen und als minderwertig klassifizierter »Rassen«. Dafür müssen die Genese der Konzepte, die Wege ihrer Verbreitung, aber auch der Kontext, in dem diese Überlegungen formuliert und rezipiert, ggf. zurückgewiesen wurden, genauer betrachtet werden. Deutlich werden soll dabei auf jeden Fall das Ringen der Beteiligten um Erkenntnis, um Differenzierung, aber gerade auch um den Wertekanon einer Gesellschaft vor dessen Hintergrund die Autoren jeweils dachten. Nur in Ansätzen kann in einem solchen Parforceritt durch die frühe Gedankenwelt der europäischen und US-amerikanischen Bevölkerungsoptimierung deutlich werden, in welchem Umfang die Schriften gesellschaftspolitisch in konkreten politischen Konstellationen relevant wurden und welchen Machtinteressen sie dienen konnten oder sollten. Gerade die selbstverständliche Interdisziplinarität der Aufklärung und der unmittelbar darauffolgenden Jahrzehnte, die selbstverständliche Verflechtung von Medizin, Anthropologie, Ökonomie, Recht, Literatur, Theologie und Philosophie schaffte es damals auch standes-, grenz- und disziplinüberschreitend verstanden zu werden.
1 Menschenbild und Bevölkerungspolitik in der Frühen Neuzeit
Der Mensch als Träumer – Züchtungsutopien vor 1700
Auch und gerade für die späteren (Gedanken-)Experimente gilt: die Renaissance leitete in Europa einen Umbruch in allen Denk- und Lebensbereichen ein, der nie wieder unumkehrbar sein wird und in seiner langfristigen Wirkmacht und Durchschlagskraft gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Die dramatischen Entwicklungen und revolutionären Forderungen der Aufklärung waren gar nicht vorstellbar, ohne die gewagten und angesichts der kirchlichen Sanktionen bis hin zur Todesstrafe durchaus für den Einzelnen extrem mutigen und riskanten Experimente in Kunst und Wissenschaft. Indem sich in ganz Europa immer mehr Menschen von religiösen Denkverboten lösten, nach technischen Neuerungen in Kunst, Architektur, Musik und Ästhetik suchten, antike Vorbilder wiederentdeckten und neu zu betrachten und lesen lernten, überschritten sie jene Grenzen, die ein theozentrisches Weltbild seit der Spätantike zementiert und durch blutige Ketzerverfolgungen jahrhundertelang martialisch zu bewachen versucht hatte.
Künstler und Wissenschaftler der Renaissance erweiterten ihr Blickfeld, rückten die Bedingungen der menschlichen Existenz im Diesseits in den Mittelpunkt. Auch wenn für die meisten von ihnen tatsächlich der christliche Glaube an das Jenseits und die Wiederauferstehung weiterhin die normative Richtschnur gebildet haben dürften, weil die Natur selbst ja den klarsten Beweis für Gottes Existenz darstellte, akzeptierten sie nicht länger das Verbot der Beschäftigung mit der Gegenwart und den allzu irdischen Problemen menschlicher Gemeinschaften.
Doch diese als Humanismus bezeichnete neue Geisteshaltung sollte nicht einseitig als harmonisches Fest der Ästhetik, als Aufbruch des schönen, guten und lebensbejahenden Menschen gefeiert werden. Die Künstler und Denker der Renaissance beobachteten Vorgänge in der Natur zunehmend ohne religiöse Scheuklappen, zählten, klassifizierten und berechneten, fertigten mittels wiederentdeckter und neu entwickelter mathematischer, geometrischer, chemischer und physikalischer Gesetze detailgetreue Studien an, zogen und begründeten logische Schlüsse. Wie in der Antike wurden wieder Leichen seziert, nun aber das unter der Haut Gesehene in Bild und Text akribisch dokumentiert. (Menschliche) Nacktheit wurde ebenso zunächst als Naturtatsache akzeptiert wie menschliche Leidenschaften, die man verstehen wollte, ohne das Menschliche vorab als sündig zu dämonisieren.
Sämtliche Tabus in Bezug auf Leben und Tod wurden hinterfragt. Die Machbarkeit wurde zum Primat des Denkens und Tuns. Es galt nicht mehr der begrenzte Spielraum der Passfähigkeit in die Welt der katholischen Normen und Denkverbote. So wurde z. B. auch die rasante Weiterentwicklung der Waffentechnik und Militärstrategien nie infrage gestellt, sondern – nicht zuletzt durch gezielte Förderung machtpolitisch ambitionierter Herrscher – mit Leidenschaft und Akribie vorangetrieben. Doch selbst die akademische Beschäftigung mit der Optimierung der Kriegsführung nährte sich durchaus aus dem Bedürfnis nach friedlicheren Verhältnissen und dementsprechend prosperierenden Staaten.
So verfasste der ehemalige, weil von den Medici aus der Stadt verbannte, Florentiner Verwaltungschef Niccolò Machiavelli (1469-1527) seine berühmte und Maßstäbe setzende Kunst des Krieges (um 1520) aus seiner Erfahrung als Florentiner Beamter heraus. Er hatte angesichts der als unzuverlässig, undiszipliniert und grausam verschrienen Söldnermilizen eine aus der Bewohnerschaft der Republik Florenz selbst zu rekrutierende Landmiliz geschaffen. Sie wurde nach bestimmten Kriterien strukturiert und zusammengesetzt, zuverlässig finanziert, Soldaten und Offiziere mit gewissen Privilegien ausgestattet, um so einerseits die Disziplin innerhalb der Truppe zu verbessern und dadurch hohe Akzeptanz in der Bevölkerung zu generieren und gleichzeitig zur Kriegsvermeidung Abschreckung nach außen zu erzielen. Machiavelli vergaß schon aus eigener Erfahrung dabei nicht die Gefahr, die von starker Waffengewalt ausgehen kann, wenn die Befehlsgewalt im eigenen Herrschaftsbereich in die ›falschen‹ Hände gerät. Insgesamt befassten sich alle seine im Exil verfassten politisch-philosophischen Werke mit dem systemimmanent fragilen Verhältnis von Macht, Krieg, Herrschaft, Gerechtigkeit und der Verfasstheit von Gesellschaften.[1] Seine Definition von »Staatsräson«, dem Primat der Interessen eines als Einheit axiomatisch definierten Staates, wird für die folgenden Ausführungen noch eine zentrale Rolle spielen, denn die Frage der Bevölkerungsgröße sowie deren ›Qualität‹ wurden von ihm mit berücksichtigt.[2] Der Untertan wurde ganz offiziell, was er ja de facto in der Ständegesellschaft immer war, zum Machtmittel des Herrschers, v. a., wenn auch nicht nur, in militärischer Hinsicht. Die Ursprünge der neuen »Kriegskunst«, zu der auch die Erneuerung höfisch-militärischer Tugenden der Körper- und emotionalen Beherrschung gehörte, wie Ritterlichkeit, Fechtkunst und der Tanz, waren also ebenso Teil der humanistischen Denkrevolution, wie die globalen und lokalen Entdeckungen und die Experimente im Bereich der Heilkunst.
Zu dieser Suche nach der besten Gesellschaftsform gehörten insbesondere die europaweit sprießenden Entwürfe utilitaristischer Staatsutopien, für die nicht zuletzt auch Machiavelli stand, der oft als menschenverachtender Zyniker missverstanden wird. Die theologisch und juristisch umfassend akademisch gebildeten Autoren in Renaissance und Barock fanden durchaus widersprüchliche Legitimationen für ihre gewagten Ideen zu ganz verschiedenen Lebensbereichen, doch alle bezogen sich noch immer auf die Schriften Platons und anderer griechischer Philosophen sowie auf das kriegs- und staatspolitische Erbe des so lange mächtigen und erfolgreichen Römischen Reiches.[3]
Auch der ehemalige Jesuit Giovanni Botero (1544-1617), der den Begriff der Staatsräson mit seiner Schrift Delle Ragion die Stato (1589) erst prägte, war sowohl von diesen Traditionen, aber auch den Schriften Machiavellis geprägt. Er war der Erste, der die Malthusianische These (1798) von der Begrenztheit der Ressourcen bei zu starkem Bevölkerungswachstum vorwegnahm und dafür Venezianische Gesandtenberichte zu seiner statistischen Grundlage machte. Er stellte dabei aber keine proto-eugenischen, sondern wirtschaftliche Überlegungen an, um eine genau zu berechnende maximale Kinderzahl gut ernähren und aufziehen, d. h. entsprechend bilden, zu können.[4]
Auch wenn das biblische Paradies, der vom Kirchenvater Augustinus (354-430) um 420 herum entworfene Gottesstaat, oder mittelalterliche Varianten eines himmlischen idealen Jerusalems oder auch die vernunftgeleitete Herrschaft der Frauen, wie von Christine de Pisan – als wohl erstes feministisches Manifest um 1405 beschrieben – als frühe Utopien einer perfekten Welt gelten können, beschritt Thomas Morus (1478-1535) mit seinem Roman Utopia (1516) ganz neue Wege. Wie schon den anderen vor ihm und noch vielen nach ihm, ging es ihm um Gerechtigkeit und das Beste für eine kollektive »Allgemeinheit«.[5] Das Allgemeinwohl schloss allerdings eben nicht immer wirklich alle ein. Denn auch bei Morus blieben Sklaverei z. B. zum Schlachten der Tiere und zur Verhinderung der Verrohung der Bürger ebenso zulässig und unvermeidlich, wie die selbstverständliche Unterordnung der Frauen unter männliche Vormundschaft. Mit seinem Wortspiel des »Nicht-Orts« und gleichzeitig »Schönen Ortes« als Namen für seinen perfekten Staat und dessen detailliert beschriebene Regeln und Strukturen, wollte der zeitlebens gläubige Katholik bewusst einen konkreten Gegenentwurf zu einer extrem kritisch betrachteten Gegenwart vorstellen und öffentlich bewerben. Morus’ Stimme ragte mit seinen Überlegungen zur Abschaffung des Privateigentums und der Ständegesellschaft und damit deren Mechanismen der sozialen Diskriminierung für Jahrhunderte selbst aus dem vielstimmigen Chor der utopischen Entwürfe heraus. Keiner der frühneuzeitlichen Gesellschaftsentwürfe, auch nicht jener der französischen Revolutionäre, dachte ernsthaft an eine Abschaffung, sondern maximal an eine Restrukturierung der ständischen Gliederung. Ein jedes florierendes Staatswesen setzte eine auch rechtlich differenzierte Bevölkerungsstruktur voraus.[6] Doch Morus’ Forderungen nach gerechter Herrschaft und gerechter Verteilung der Ressourcen, der Reformation des Rechtsystems, seine Entlarvung der vorgeschobenen und der wahren Gründe für (Expansions-)Kriege etc. lösten nicht nur eine Welle utopischer Literatur aus, sondern auch eine Debatte darüber, wer denn mit dem Interesse des »Gemeinwohls« wohl gemeint sei und wessen Interessen und Bedürfnisse hier zurückzutreten hätten.
Das bei so viel Idylle und Wohlstand drohende Problem der Überbevölkerung wurde in den verschiedenen Utopien ganz unterschiedlich gelöst. Während Platon gezielt die Fortpflanzung begrenzen wollte, nutzte Morus, neben der obrigkeitlich gesteuerten Gattenwahl, den Trick der Verlagerung nach Außen, in eine als Black Box unbeschriebene Welt des Jenseits, hier jenseits des Meeres. Auf dem nächstgelegenen Festland sollten Utopianer in selbstverständlich unbesiedelten, aber fruchtbaren Bereichen Kolonien anlegen. Auch diese Idee war bereits in der Antike bekannt. Doch genau beim Aspekt der Bevölkerungspolitik wurde auch seine Utopie widersprüchlich und geriet an ihre normativen Grenzen; denn es hieß zu den dort durchaus vermuteten Ureinwohnern:[7]
»Diejenigen aber, die sich weigern, nach ihren Gesetzen zu leben, vertreiben sie [die Utopianer] aus diesen Gebieten, die sie sich selbst aneignen. Gegen Widerstrebende wenden sie Waffengewalt an. Denn sie halten es für einen gerechtfertigten Kriegsgrund, wenn irgendein Volk Boden selbst nicht nutzt, sondern gleichsam ohne Sinn und Zweck leer lässt, dennoch anderen, die nach dem Naturrecht daraus ihre Nahrung holen müssten, die Nutzung und den Besitz untersagt.«[8]
Die Kolonien fungierten auch als menschlicher Vorratsspeicher, falls »Unfälle« oder Seuchen im Mutterland die Bevölkerung zu stark dezimierten. Umgekehrt sollte Bevölkerungsmangel durch patriarchale Umverteilung der Fortpflanzungsfähigen und genau berechnete Stadtgrößen von 6000 Einwohnern vermieden werden. Morus konzipierte Familiengrößen mit mindestens zehn und maximal sechzehn Erwachsenen. Grundlage des Staates waren im Stile einer klassischen patriarchalen Stammesstruktur durch gezielte Ausheiraten aller Frauen miteinander verwobene Familienverbände unter Führung eines männlichen Oberhauptes. Weder für Frauen noch für Männer gab es individuelle Rechte, nur Pflichten gegenüber dem Verband und dem Staat. Überschuss und Mangel an unterschiedlichen Orten würden schlicht durch Selektion und Umsiedelung behördlicherseits gesteuert.
Auch im Umgang mit Schwerstkranken tauchten utilitaristische Aspekte auf, die den katholischen Glaubensnormen der Caritas des Autors massiv widersprachen: So sollten unheilbar Kranke und schwer Leidende, die