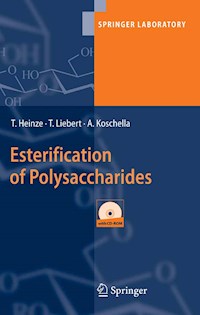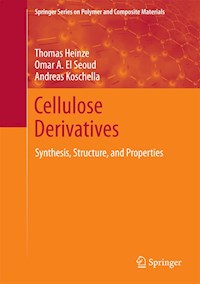8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebesschmerz, Eifersucht, Sex wie hormonbehandelte Bonobos, romantische Verirrungen, Korruption und kleinhirnige Mafiosi, knallköpfige Politgangster, Freundschaft zwischen Vater und Sohn - ein wilder Ritt durch den Dschungel menschlicher Existenz. Das Buch bietet Romantik ohne Sentimentalität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
VORWORT
Metaphysische Schlampen ist die Geschichte von Mitzi Märzenbecher und Thomas O`Malley, zwei Großstadtkindern aus Wien.
Dutzende Lesungen in Wien und in Deutschland von 2003 bis 2006 haben gezeigt: Nach dem ersten Schock ging das Publikum mit und lag am Schluss des Programms vor Lachen unter dem Tisch. Die Zuhörer steuerten als eine Art Zufallsgenerator den Ablauf der Lesungen selbst. Die Performances, teilweise mit Piano-Begleitung, begannen meist mit meinem Lieblingskapitel 'Heimatlos' und dann konnte das Publikum aus den weiteren Kapiteln beliebig auswählen. Wer am lautesten schrie, der kam dran, genau wie im richtigen Leben.
Das Werk hat keinen Plot und ist nicht chronologisch geordnet, die Metaebene vieler Kapitel ist das metaphysische Schlampentum der handelnden Personen, aber auch die Freundschaft und die Liebe. Eine metaphysische Schlampe [Metaslut] kann sowohl weiblich als auch männlich sein. Sämtliche handelnden Personen und die Orte der Handlung sind anonymisiert, alle Begebenheiten und Dialoge sind frei erfunden und jede Ähnlichkeit mit realen Personen und Orten ist zufällig und völlig unbeabsichtigt. Spekulationen, wer und wo das jeweils gewesen sein könnte sind daher müßig und führen zu nichts. Das Werk ist kein Schlüsselroman und auch keine Autobiographie. Mit metaphysischem Schlampentum ist nicht etwa wahlloser Sex gemeint, sondern der Verrat an Werten, der mit dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg parallel geht bzw. dessen Voraussetzung ist und in letzter Konsequenz zur persönlichen und sozialen Zerrüttung führt.
Genug erklärt jetzt. Dieses Buch muss nicht unbedingt linear von Kapitel eins bis zum Schluss gelesen werden. Man kann irgendwo in der Mitte anfangen, hin und herspringen, Kapitel auslassen, von hinten nach vorne lesen; ganz nach Lust und Laune der Lesenden. Man kann es - nach dem Kauf bitte - aber auch gar nicht lesen. Das wäre allerdings schade und man/frau versäumt etwas.
Das Werk wurde im Jahr 2001 geschrieben und 2020 lektoriert bzw. Korrektur gelesen. Ein paar Kapitel habe ich weggelassen, um die Seitenanzahl zu verringern. Die Kapitel „Lara die Erste“ und „Geburt und Werden“ wurden ergänzt, sonst habe ich nichts Grundlegendes geändert.
Ein freundlicher Hinweis für die Anwälte des Disney-Konzerns: Die Romanfigur Thomas O’Malley ist benannt nach dem amerikanischen Politiker Thomas O’Malley (1868-1936) und nicht nach der Zeichentrickfigur aus dem Disney-Film Aristocats.
Wien, Januar 2001 und Januar 2021
Thomas Heinze
INHALT
DISKRETION
WERK EINS
SZOMBATELY
GEBURT UND WERDEN
WHY DON’T WE DO IT IN THE ROAD?
WERK ZWEI
FLUGS AUFGESPIELT
BAROCKÄRSCHLEIN
GEBURTSTAGSGESCHENK
DAS MEER
GIOVANNIiiiiii
WESTENTASCHEN-MAFIOSI
DER HAUPTMANN
RICHTER AZDAK
DER DIREKTOR
MUSIK
GÖTTERZORN
DELIRIOUS TOKYO
SEHNSUCHT
FICKURLAUB MIT DREIERSCHMÄH
MALEN
EIN BRIEF
UNSENT LETTER
DAS SPIEL IST AUS
PENSO A TE
LARA DIE ERSTE
AUFRISS
BETONSOFA
KLIMAX
EIFERSUCHT
VERRAT
THE UNIVERSAL FUCK
KLUNKER UND NUTTEN
DICKE FRAUEN
HEIMATLOS
LOB DEN POLNISCHEN PRINZESSINNEN
DIVA SANDWICH
DAS SCHLAUE FÜCHSLEIN
HOTLINE TO OUR HEARTS
KUNST
KEIN VERLANGEN MEHR
TOD
FREUNDSCHAFT
SEDATIVUM
SCHLUSS
ABSPANN
1.
DISKRETION
„Hallo, hier ist Mitzi.“
„Oh äh ach ja ha... hallo wie ge. . . - wo bist du?“
„Ich bin in Monaco und fliege gerade zurück nach Bhopal. Ich wollte nur mal fragen, wie es dir geht?
“ Wie geht es dir?“
„Mir geht es gut.“
Na wenigstens jemand, dem es gut geht . . . Ich muss mir jetzt mein Leben neu organisieren, neu systematisieren, ich stehe vor den Trümmern meines Privatlebens, das muss ich neu ordnen. Deshalb bitte mehr Diskretion, wenn du anrufst. Wir haben ausgemacht, dass wir einen Anruf mit SMS ankündigen, dass man nicht überrascht ist in Gesellschaft. Ich bin nicht ganz so exhibitionistisch wie du.
„Glaubst du nicht, wenn deine SMS bei mir ankommen, dass man das nicht hört? Es klingelt so laut, den Luschinsky reißt`s jedes Mal, der weiß, dass du mir die schickst.“
Bei mir ist es so, dass mein handy vibriert, wenn was von dir kommt. Ich trag es in der linken Brusttasche am Herzen. Es ist wie ein Herzschrittmacher, oft glaube ich, es vibriert, aber es ist nur Einbildung.
Ich spüre über tausend Kilometer Entfernung, wenn du an mich denkst.
Früher hat mir das gefallen. Ich merke es, wenn du mit deinem Geheimagenten vögelst. Wenn ich daran denke, schüttelt es mich. Dass du mich dabei im Kopf hast, wie du mir heute sagtest, finde ich total pervers.
Bei dem schlechten Sex, den du mit diesem Schleimer machst, hast du diese Phantasie offenbar notwendig.
Und ich spüre dann, wie er dir seinen Schwanz reinschiebt. Zum Kotzen, der Gedanke daran.
Missbrauche mich nicht, um dir dieses fragwürdige Vergnügen zu versüßen. Dass du beim Ficken mit diesem Schleimbatzen an mich denkst, finde ich die Höhe und extrem Scheiße.
Lass das bleiben, hör auf damit, mach deine Spielchen mit deinem Geheimagenten, aber genieß es wenigstens, lass mich draußen vor.
Heute bin ich neben einem Mädchen aufgewacht und habe an dich gedacht. Ich dachte nach dem Sex an dich, und nicht während. Im Übrigen, Frau Ex-Gefährtin, liegen noch deine Kontaktlinsenutensilien bei mir im Küchenschrank.
2.
WERK EINS
Ich saß mit zwei Freunden aus unserer Kapelle, „Hausmaster im Jenseits“ haben wir sie später genannt, damals hatte sie noch keinen Namen, in einem Jazzlokal namens Werk Eins im Zentrum von W.
Unser Schlagzeuger Hermann kündigte mit leuchtenden Augen an, dass in wenigen Minuten eine Opernsängerin auftauchen werde.
„Eine Opernsängerin?“ fragte ich neugierig, „so eine richtige?“
Wir waren begeistert und gespannt, ich zumindest hatte noch nie eine Opernsängerin an einem Tisch neben mir sitzen gehabt, so mit ungefähr vierzig bis fünfzig Zentimetern Abstand.
Von Hermann waren wir beeindruckt.
Er machte uns in eindeutigen Andeutungen klar, dass er früher ein intensives Verhältnis mit dieser Opernsängerin gehabt habe und jetzt war sie so etwas wie seine Geliebte, oder er ihr Geliebter, das kam nicht klar heraus. Er hatte jedenfalls eine Art Affaire mit ihr oder ein Verhältnis.
Später stellte sich heraus, dass sie ein oder zwei Mal mit ihm ins Bett gegangen war, sagte sie zumindest.
Der Kerl war also verheiratet und hatte eine Affaire mit einer richtigen Opernsängerin. Das bedeutete, er konnte mit ihr ficken und sie sang dabei.
Das war meine Fantasie, es schien interessant zu sein.
Die Opernsängerin kam etwas später als angekündigt, sie übte offenbar, sich wichtig zu machen; sie probte den Effekt des zu spät Kommens, gerade nicht zu viel, damit die Wartenden sich nicht aufregen konnten, aber gerade genug, damit man auf sie gespannt war. Das beherrschte sie bereits zu dieser Zeit.
Sie war ein hübsches, etwas dickes Mädchen mit ein bisschen zu viel Make-up.
Klasse rote Haare, und wohlgeformte Titten, Brüste, besser gesagt und politisch korrekter.
Etwa wie zu groß geratene Pfirsiche.
Ich meine, tatsächlich hatte sie ziemliche Dinger, aber sie wirkten nicht groß, sondern eben so, wie ich sagte.
Wie zwei größere Grapefruits, das kam besser hin, von der Größe und Form her, meine ich.
Diese junge Frau, Mitzi Märzenbecher, setzte sich zu uns an den Tisch und wir bewunderten sie gebührend. Waren wir doch mit unserer Musik nie über zwielichtige, nach Pisse und Bier stinkende Kellerlokale und Proberäume hinausgekommen und Mitzi Märzenbecher war tatsächlich auf richtigen Bühnen mit Publikum tätig.
Opernbühnen sind meist sehr staubig und dreckig und die Bühnenteppiche sind zerrissen, weil es Direktoren, Impressarii und Kunstbürokraten gleichgültig ist, ob ihre Schauspieler oder Sänger bei der Arbeit aufs Maul fallen.
Das wusste ich damals allerdings noch nicht.
Mitzi Märzenbecher sang also nicht irgendwelchen Schmafu wie shoobeedooba oder yeah yeah yeah.
Sie sang tatsächlich richtige Opern und Operetten und konnte offenbar die langen Texte auswendig und das in verschiedenen Sprachen.
Von Operetten und von Opern war ich mein ganzes Leben lang nicht die Spur begeistert. Das interessierte mich genau Null Komma Josef. Vor allem über Leute, die sich Operetten anschauten, machte ich mich lustig.
„Ob blond ob braun, ich liebe alle Fraun,“ „Ach ich hab sie ja nur auf die Schulter geküsst“ und so weiter. Das war nicht mal zum Lachen und hatte mit der wirklichen Welt nichts zu tun und außerdem waren wir von der Blues- und Jazz-Abteilung und hatten mit so einem seichten Mumpitz nichts am Hut.
Ein einziges Mal in zwanzig Jahren war ich bisher in W. in der Oper gewesen. Norma hieß das Stück, von einem Herrn namens Bellini, Bellozzi oder Vantuzzi, jedenfalls ein Italiener, glaub ich. Das war ein mir völlig unverständliches, langweiliges Zeug, in dem irgendwelche Leute ziemlich laut herumbrüllten und reihenweise wahnsinnig wurden oder starben oder beides gleichzeitig.
Ich bin jedenfalls in dieser italienischen Oper eingeschlafen. Meine damalige Angetraute und charmante Begleiterin Aphrodite machte mir Vorwürfe, dass die Karten so teuer gewesen seien und ich hätte geschlafen.
Eine Art Banausenvorwurf von Bildungsbürgertochter an Proletarier.
Jedenfalls eine solche Oper anzuschauen und eine junge schöne Opernsängerin neben mir am Tisch sitzen zu haben und mit ihr zu reden, das war schon ein gewaltiger Unterschied, ich brauchte nicht lange, um das zu begreifen. Diese Dame, Mitzi Märzenbecher, fing nämlich überraschend nach kurzer Zeit heftig mit mir zu flirten an, obwohl sie doch angeblich mit dem Hermann eine Affaire oder ein Verhältnis hatte. Sie zwinkerte mir zu und blitzte mich an und lachte und redete mit mir, jeweils mit deutlicher Unterstützung ihrer diversen sehr attraktiven Körperteile.
Ich war irritiert, weil ich den Eindruck hatte, ich sei hier in eine Oper oder Operette geraten.
Es war mir zu viel und wirkte auf mich extrem unecht und zu dick aufgetragen.
Es war allerdings nicht unecht, wie ich später begriff.
Ich merkte nur nichts, weil ich zu verstrickt war in meine damalige Situation, sodass ich nichts merken konnte oder wahrscheinlich auch nichts merken wollte.
Frauen gingen mir zu jener Zeit ziemlich auf den Wecker.
Trotzdem war meine Begeisterung, dass ich hier offensichtlich von einer richtigen Opernsängerin angestiegen wurde, nicht gering. Ich flirtete mit ihr, so gut ich es mit meinem Misstrauen konnte, ziemlich zurückhaltend also.
Irgendwann musste ich gehen. Ich lebte mit Lara der Ersten, war fast wie verheiratet mit ihr. Das bedeutete, wir stritten uns ständig über unwichtige Kleinigkeiten, weil wir nicht so gut zusammenpassten, wie wir am Anfang gedacht hatten. Unser entzückender Sohn Ilua war damals zirka drei Jahre alt.
Die Sängerin Mitzi Märzenbecher behauptete ungefähr ein Jahr später, in jenem Moment, als ich die Treppe hinaufging, habe sie gedacht: „Hier geht mein Mann.“
Mitzi und ich betrachteten uns später zumindest eine Zeit lang als Mann und Frau, wenn auch ohne Trauschein. Dieses Gefühl war schön für mich. Die Kollegen aus der Hausmaster im Jenseits Band hatten ihr vermutlich gesagt, dass ich mit meiner Frau Lara der Ersten gerade ein Kind hatte und daher ließ Mitzi mich in Ruhe. Ich sah ebenfalls keine Veranlassung, mich um sie zu bemühen, da ich in Affairen meiner Freunde nicht einzugreifen pflegte.
Unser Schlagzeuger Hermann hatte behauptet, er habe eine Affaire mit ihr. Zumindest verstand ich das so.
Ich habe diese Mitzi Märzenbecher schnell vergessen, etwa so, wie man eine mittelmäßige Theatervorstellung vergisst.
Frappierend war, dass ich beim ersten Treffen das Gefühl hatte, diese Frau spielt mir etwas vor, also in diesem Fall einen heftigen Flirt, der mir nicht schlecht gefiel.
Allerdings war ich mir nicht sicher, ob ich jetzt drauf einsteigen sollte und sie vielleicht fragen, ob wir zum Vögeln auf die Damentoilette gehen könnten. Das ist jetzt so ein Spruch, der mir beim Schreiben einfiel. Auf einer Damentoilette hab ich überhaupt noch nie gevögelt. Zwar habe ich es später mit dieser Sängerin probiert, aber es hat nicht geklappt.
Wir hatten beide zu viele Gespritzte in der Mütze, besonders ich.
Von diesem Ausrutscher abgesehen haben wir fast überall hoochie coochie gemacht, wo uns das halbwegs sinnvoll erschien.
Ich kann heute nicht mehr unbehelligt durch W. gehen, weil ich mir an ziemlich vielen Ecken oder Plätzen sagen muss: da hab ich mit meiner Sängerin gefickt, in der M.Straße hinterm Bauzaun, auf der Straße, in der sie wohnte hinter einer Mülltonne oder anschließend an einen Lokalbesuch gleich auf dem Gehsteig.
Weil es nicht schnell genug gehen konnte.
“Why don`t we do it in the road, noone will be watching us,” es ist tatsächlich so.
Noone is watching you, John Lennon hatte recht. Man muss es nur machen.
Mitzi und ich machten es überall und es war tatsächlich ein Hyperthrill.
Kann ich nur jedem Ehepaar mit Sexualstörungen empfehlen. Versuchen Sie es mal hinter einem Bauzaun. Da kommt die Baustellen-Erotik voll durch. Das Leben ist eine Baustelle, warum also nicht auf Baustellen ein bisschen herumtun und herummachen.
Probieren Sie es einfach auf der Straße und sagen, nachdem sie die Polizei gerufen haben, Ihre Frau habe versucht, Sie zu vergewaltigen.
So etwas wirkt und bringt verlässlich Pfeffer ins eheliche Sexualleben.
Mitzi und mir war es wurscht, dass manche Leute ein wenig komisch schauten - also ich glaube im Gegenteil, diese Frau hat das ziemlich angeturnt - und dann natürlich nach dem Heurigen in den Weinbergen, in ihrem Campingbus, in meiner Dusche, im Schwimmbad, am Strand, in einer Höhle in Kolumbien, auf einer Aussichtswarte, im Park, in einem Hauseingang et cetera. Hauseingänge zum Beispiel haben, finde ich, etwas ungeheuer Erotisches und Romantisches.
3.
SZOMBATHELY
Als die Gulaschkommunisten in Ungarn noch an der Macht waren, gerieten drei Kollegen und ich in der Stadt Szombathely in die Fänge der dortigen Justiz. Da begab es sich auch, dass ich eine sehr nette russische Jungfrau kennenlernte. Ich stand mit ihr in einem feuchten Hauseingang und sie sagte nicht „Schysn plocho“, sondern „Ja liubliu tebja“ und ich sprach zu ihr: „Sluschaite dewuschka . . .“
Das hieß soviel wie: „Hören Sie mal zu, Mädchen девушка. “
Das gefiel ihr anscheinend. Diesen Satz musste ich nicht einmal beenden, der Anfang genügte. „слушайте, девушка!“
Ich versprach, für sie eine Birke zu pflanzen - eine береза - und ich machte es später tatsächlich.
Eine solche Szene in Szombathely konnte man nur erleben, wenn man zu viele ungarische oder sonstige Währungseinheiten in den Taschen hatte und dann leichtfertig die Grenze überschritt.
Die Gulaschkommunisten hatten damals eine Obergrenze der Einfuhrmenge an Kohle oder wie man da sagt, Devisenbeschränkung ist der richtige Ausdruck, von genau vierhundert ungarischen Währungseinheiten pro Person festgelegt und wir waren zu viert und jeder hatte circa zehntausend solcher Währungseinheiten in der Tasche.
Tatsächlich hatten nicht alle die Scheinchen in der Hosentasche.
Mein Partner N. hatte sie in der Hose, ganz locker, und sie schauten auch noch aus seiner Gesäßtasche heraus, weil ihm seine Beinkleider am Arsch zu eng waren.
Ich jedenfalls hatte meine zehn Tausender in einem Paar Socken versteckt, völlig unerfahren wie ich beim Schmuggeln war.
Der ungarische Zollmann sagte grinsend zu mir: „Sie gutää Inschänäär, ich gutää Forint Findäär.“
Er schien eine Art Ehrgeiz entwickelt zu haben, mir eins auszuwischen. Wahrscheinlich hatte ich ein ziemlich fatzkehaftes Wesen damals und kam mir ziemlich gut vor, weil ich dachte: „Bis zu meinen Socken kommt der nie.“
Meine Socken hatte ich schlauerweise ganz unten in meiner Reisetasche versteckt, ein lächerlich laienhaftes Vorgehen.
Die ungarischen Zollfritzen nahmen aber nicht nur unsere Koffer und Taschen auseinander, sondern auch unsere Autos und stellten die ganzen Innereien von den Fahrzeugen auf die Straße und wir mussten das nachher alles wieder hineintun und zusammenschrauben, um weiterfahren zu können.
Schöne Bescherung das.
Festgenommen hatten sie uns, weil wir viel zu viel Geld einstecken hatten. N. und Paul, die damals noch Freunde waren, wollten sich einen Kahn am Balaton kaufen, ein richtiges Segelboot mit Kajüte und so, daher das Geld.
Diese ungarischen Boote waren speziell für Flachwasserseen designt und schöne runde Nussschalen, wo man sich die DDR-Mädchen draufholen konnte und mit denen ein bisschen plaudern.
Die DDR-Mädchen plauderten gern mit West-Onkels, weil die meist ein paar Deutschmarks oder Schilling dabei hatten. Die DDR-Bräute waren mit ihren Bezugsscheinen, für die sie sich, glaub ich, pro Tag ein Bier und einen Broiler kaufen konnten, schnell am Ende. Es lebe der Sozialismus und die Würde der Arbeiterklasse.
Am Abend tigerten diese Damen meist hungrig, durstig und geil durch die Gegend.
Broiler waren leicht grünlich aussehende gekochte Hühner, anscheinend das Nationalgericht der damaligen DDR, die dunkelweiß bis ockerfarben in den improvisierten Imbisshütten am Balatonstrand herumhingen und vor sich hin moderten. Das Zeug sah dermaßen grausig aus, dass sich sofort heftige Übelkeit einstellte, wenn man nur hinschaute, von Essen möchte ich nicht reden.
Also schauten wir von diesen modrigen Hühnern weg und richteten unser Augenmerk auf die knackigen Werktätigen-Weibchen, die an diesem See Balaton zu Hunderten herumliefen.
Meistens machten wir es so: wenn der Käpt’n pinkeln musste, sagte er kurz vor dem Pissgang zu mir:
„Wenn ich zurückkomme, sitzen die drei da drüben am Tisch.“
Er meinte unseren Tisch.
Er war total gut im Taxieren, die Frage mit wenigen Blicken und Überlegungen zu klären, ob wir es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schaffen konnten, unsere Auserkorenen für ein gemeinsames Plauderstündchen in unserem Zelt oder auf unserem gemieteten Schiff zu begeistern.
Nicht alle für einen und einer für alle; jeder hatte seine Kabine und jeder kriegte sein Weibchen.
Die DDR-Mädchen wohnten meist in Gewerkschaftsheimen, da musste man an bissigen Consiergen vorbeikommen und das war nahezu unmöglich, also mussten wir die Damen in unsere Facilities lotsen.
In Leningrad neunzehnhundertsiebenundachtzig war das auch so. Consiergen saßen in den Hotels auf jedem Stockwerk und kontrollierten die Gäste, ob sie sich Frauen mitnahmen oder ob die Frauen anschaffen gingen.
Die Consiergen wurden dann mit einem kleinen Obulus in Dollar beglückt und die Sache war geklärt und geregelt, in Leningrad funktionierte das.
In Szombathely dachten sich die Ungarn eine ziemlich schlimme Strafe für uns aus: Sie quartierten uns für eine Woche im teuersten Hotel der Stadt ein.
Die Unterbringung ging nicht auf Staatskosten, sondern wir bekamen hinterher die Rechnung. So konnten sie uns besser abzocken und verrechneten uns einen doppelten Deppenaufschlag.
Auffällig war, dass in diesem Hotel viele sehr abgewetzte Kunstleder-Sporttaschen herumstanden. Auf der Straße vor dem Hotel waren verdächtig viele Fiat Ladas geparkt, alle mit dicken Antennen auf dem Dach.
Die Herren in den Fiat Ladas versuchten, die Späße zu verstehen, die wir damals machten, und das war sicher nicht einfach.
Paul, der oft im damaligen Ostblock unterwegs war, und dort Computer verkaufte, erklärte mir, dass sie uns in den Fiat Ladas abhören würden; ich hielt ihn für leicht paranoide. Was die Ungarn über uns Würstchen herausfinden wollten, konnte ich mir nicht vorstellen. Paul hatte wahrscheinlich recht. Das Spitzel- und Abhörunwesen war in den damaligen COMECON-Ländern extrem ausgeprägt.
Mein Partner N., der schon wesentlich mehr Reisen unternommen hatte in diese Gegend um den schönen See Balaton als ich, erzählte mir oft von Leuten, die ihm glaubwürdig schilderten, wie sie und von wem sie gerade bespitzelt wurden, und das live:
„Schau mal, der Typ da drüben mit dem karierten Hemd und der Halbglatze, das ist unser Stasi-Fritze.“
Die DDRler durften keine Westkontakte haben, das konnte ihnen in Chemnitz oder Dresden als Kooperation mit dem Klassenfeind vorgehalten werden und dann durften, wenn sie zu eng mit dem Klassenfeind kooperiert hatten, vielleicht die Kinder nicht mehr studieren oder Abitur machen; so ungefähr war das damals bei denen.
Die Piefke haben immer die wahnsinnigsten Politsysteme, weil sie anale Charaktere sind, küchenpsychologisch betrachtet.
Die DDR-Fräulein, die sich uns aussuchten oder die wir uns aussuchten, hatten allerdings meist gegen intensivere Kooperationen mit dem Klassenfeind nicht so viel einzuwenden. Sie machten sich auch nichts aus den Spitzeln, weil sie sich dachten, mit dem Klassenfeind zu vögeln falle nicht unter die Rubrik intensive Westkontakte; so war zumindest zu vermuten.
Einmal gelang uns ein Meisterstück. Wir schnappten einer Gruppe von Motorradfuzzis zwei ihrer schönsten Bräute weg, setzten die Girls auf die Gepäckträger unserer Fahrräder und düsten zu unserem Zelt.
Dort unterhielten wir uns dann ausgiebigst über Fragen des gegenseitigen Respekts zwischen männlichen und weiblichen Systemen und wie man die Pipelines legen könnte, dass das eine System zum anderen kommt und die Säfte sich ein wenig vermischten zum Wohle des Weltfriedens.
Schön und zärtlich und zutraulich waren diese Mädchen, mit einer Lebenslust ausgestattet, die nur durch das ganzjährige Eingesperrtsein und das langweilige Fernsehprogramm in der DDR zu erklären war.
Sie hatten einfach Lust am Leben und durch die Sachen, die wir mit ihnen machten, fühlten sie sich wie kleine Prinzessinnen. Wir waren immer höflich und benahmen uns sehr anständig und großzügig ihnen gegenüber.
Sie wiederum halfen uns, die zur Verfügung stehende Zeit mit allen Freuden des Herzens zu genießen.
„Freuden des Herzens, ist das jetzt Courths-Mahler oder was?“
Die Zollfritzen und die Justiz in Szombathely bemühten sich nach Kräften, uns ordentlich was anzuhängen und mein Partner N. und ich sahen uns schon in einem Steinbruch beim großen Bruder in Sibirien mit sehr einfachen Werkzeugen dieses Granit-Kleinstein-Pflaster herstellen, das damals im Lande A. für teurere Fußgängerzonen Verwendung fand.
In der Kärntnerstraße in W. war so ein Granit-Kleinstein-Pflaster verlegt und wenn der Stein, aus dem das hergestellt wurde, eine besonderes harte Konsistenz hatte, würde unser Los extrem bitter werden. Das wurde uns schmerzlich klar.
Diese Verzweiflung im Wissen um die möglicherweise letzten Tage in Freiheit setzte in uns auch eine Lebenslust frei, die unter normalen Versuchsbedingungen nicht zu beobachten war. Wir waren dadurch in der Lage, die Atmosphäre einer lonesome Cowboy Crew aufzubauen.
Bei so etwas wurden fast alle Mädchen schwach, außer sie waren russische Aufseherinnen mit Nirostagebiss und einem Leibesumfang wie ein Sumo-Ringer.
Ich musste eine solche Aufseherin eines ganzen Busses voll schönster russischer Jungfrauen irgendwie becircen, damit die anderen Jungs besser an die Mädchen herankamen; eine solche undankbare Arbeit hatte man mir als Smutje zugeteilt.
Auf meinen Kumpel Walter stand die Ehefrau des örtlichen russischen Militärkommandanten von Szombathely, deswegen mussten wir höllisch aufpassen, eine äußerst heikle Angelegenheit.
Man stelle sich vor, auch noch ein durchgeknallter russischer General, der mit einer Kalasch herumfuchtelt und Satisfaktion will, na danke.
Ich glaube, Walter und diese Russin hatten eine kurze, aber intensive Begegnung. Als Walter und Paul weg waren, weil sie ihren Job machen mussten und mein Partner N. und ich die gesamte Chose in unsere Verantwortung übernommen hatten, kam Ludmilla oder wie sie hieß, über den Hauptplatz von Szombathely gestakst. Wir hörten sie von der anderen Seite des Platzes schon:
„I hear the click clack of your feet on the stones, on the Granit-Kleinstein–Pflaster and I know you’re no scare-eyed honey.“1
Wir hörten sie von Weitem mit ihren Sohlen und Absätzen auf diesem Granit-Kleinsteinpflaster herumklicken und ich sagte zu N.: „Das ist doch die Shiksah vom Walter!“
Ich winkte ihr zu und sprach: „Kak dela?“ oder „Dobroe Utro!“
N. und ich tranken gerade abwechselnd einen Kaffee und einen Barack, sprachen über unsere Großmütter und dass wir sie leider schon lang verloren hatten, als wir noch Kinder waren und wir unsere Familien jetzt auch lange Zeit nicht mehr sehen würden. Die Tränen liefen uns über die Wangen.
Ludmilla oder wie sie hieß wollte mit uns angesoffenen weinerlichen Wapplern nichts zu tun haben und fragte nur: „Wo ist Walter?“
Wir sagten: „Der ist schon weg.“
Da drehte sie sich auf einem ihrer Absätze um und klickklackte davon. Fort war sie, wir hatten keine Chance bei ihr.
Ich versagte zudem völlig bei der Ablenkung der russischen Aufseherin mit dem Nirostagebiss. Diese Aufpasserin wollte sich von einem Greenhorn wie mir nicht einkochen lassen, außerdem war mein Russisch ziemlich schlecht, Feinheiten waren ihr damit nicht vermittelbar.
Meine süße russische Freundin konnte ich wegen dieser widrigen Umstände nicht auf ihrem Zimmer besuchen oder sie mich auf meinem, obwohl wir doch im besten Hotel der Stadt waren. Das war leider nicht möglich, no hoochie coochie.
Ich stand mit ihr am Gang herum, traf sie in der Lobby, schenkte ihr ein rotes Liebesband, verliebte Blicke und eben die Birke, die ich allerdings nicht dabei hatte, sondern später irgendwo ausgrub und im Westerwald einsetzte.
Das ist ein sehr schöner großer gesunder Baum geworden, unser Liebesbaum.
Dadurch, dass wir nicht in die Tiefen der fleischlichen Lust vordrangen, war unsere flüchtige Begegnung rein und unbefleckt geblieben.
„Was soll das jetzt? Katholischer Sexualkundeunterricht, oder was?“
Jedenfalls war es irgend etwas in der Richtung: flüchtig und tief zugleich. Eine Metapher für die Liebe und das Leben.
„Huh, Huh!“
Warm und weich zugleich. Weil diese russischen Prinzessinnen ständig bewacht wurden und auch nach zwei Tagen wieder abzischten in ihre Heimat, mussten wir uns anderen Schönen zuwenden, die auch vollstes Verständnis für unsere missliche Lage hatten und Hand, Zunge, Pussy und Bett anboten, um uns kurz vor unserer Verurteilung und sicheren Zwangsarbeit ein wenig die Zeit zu verschönern.
Walter und ich, angesoffen wie zwei Häuseltschik und mit dem richterlichen Verbot belegt, die Stadtgrenzen von Szombathely zu überschreiten, luden uns zwei steirische Schwestern an Bord. Anschließend düsten wir zu ihrer Ferienanlage, die blöderweise außerhalb der Stadtgrenze lag, um dort die Betten ein wenig auszuprobieren.
War alles stabile ungarische Wertarbeit, wie sich herausstellte.
Unser Richter war ein äußerst gepflegter Mann um die vierzig und hatte zwei wunderhübsche sympathische Assistentinnen, die ihm beim Übersetzen von meinen Geschichten zur Hand gingen.
Falls man das so sagen kann, zur Hand gehen.
Den ganzen Mumpitz, den ich dem Richter beim Verhör erzählte, versuchten sie zu übersetzen. Ich stilisierte mich als Latin Lover mit Hang zur Vielweiberei und sie waren total neugierig, wie ich das anstellte und ich schilderte ihnen ein paar harmlosere Details. Das fanden sie lustig, lachten und kullerten.
Dann fragte ich den Richter, ob er uns ein Domizil etwas weiter draußen im Grünen organisieren könne, das ein bisschen billiger sei als unser derzeitiges Hotel. Wir hätten nicht so viel Kohle, weil zuhause Frau und Kinder hungrig warteten und so weiter. Der Richter sagte, er wisse da etwas von einem Verwandten, der ein nettes Appartmenthäuschen habe und er würde sich darum kümmern.
Ich ging hinaus aus dem Zimmer, in dem er sein Verhör mit mir gemacht hatte und die anderen Jungs von der Crew hingen missmutig auf der Treppe herum mit ziemlich verzweifelten Gesichtern.
Sie dachten, das dauert so lang, weil sie den O’Malley auseinandernehmen; der wird wahrscheinlich gefoltert und gibt dann Sachen zu, die wir nie gemacht haben und nie machen würden.
Aber ich kam heraus von dem Verhör und sprach zu ihnen: „Hey Jungs, der Herr ist nett, der besorgt uns ein Zimmer.“
Dieser Satz machte sie noch melancholischer, weil sie zuerst dachten, das Zimmer sei ein Einzelzimmer mit Innenklo in irgendeiner Haftanstalt der Provinz im Lande Ungarn oder eben gleich beim großen Bruder in Sibirien. Aber ich meinte ein anderes Zimmer, das Fremdenzimmer im Grünen und da waren sie froh und dachten sich, dass sie mich etwas überschätzt hätten in meinem Sarkasmus.
1Jagger/Richards, Stray Cat Blues
4.
GEBURT UND WERDEN
Als mein Sohn Ilua auf die Welt kam, das heißt genauer: als er geboren wurde, er war vorher schon auf der Welt und als er sich und seine Mutter ihn nach fünf Stunden Wehen aus ihrer Geburtsöffnung schob, da pisste dieser kleine Mensch als allererstes in einem hohem Bogen auf ihren Bauch.
Das war eine sehr pragmatische und vernünftige Tat.
Er dachte sich wahrscheinlich: „Auf die Geschichte hier ist gepisst, ekelhaft kalt hier.“
Dadurch hatte er von Anfang an eine richtige und gesunde Einstellung zu dem, was außerhalb des Bauches seiner Mutter so los war.
Anschließend wurde er mir, Thomas O’Malley, in die Arme gegeben. Wir gingen hinaus aus diesem Gebärzimmer, diesem Kreißsaal, wie es so abschreckend heißt, „kreißen“, und Ilua erzählte mir die Geschichte, wie er aus seiner Mutter Lara der Ersten herausgekommen war, haarklein und im Detail.
Ilua hatte zum damaligen Zeitpunkt noch keine Sprache, die der deutschen Hochsprache ähnelte, aber er hatte etwas zu erzählen und ich verstand ihn sehr gut. Er redete in einer Sprache, die keineswegs eine Babysprache war, so lall lall, lu lu, dutzi dutzi und ähnlich. Wie diese Teletubbies reden oder wie die Erwachsenen glauben, dass Kinder zu reden hatten.
Er artikulierte sich sehr präzise und mit einer klaren Sprachmelodie, fand ich.
Ilua wollte einfach diesen Kampf schildern, wie er aus Laras Uterus herausgekommen war.
Eng und dunkel, keine Luft, kein Licht.
Schieben, Drücken.
Wahrscheinlich konnte er selbst nicht sehr viel tun, außer vielleicht darauf zu achten, dass sich die Nabelschnur nicht um seinen Hals wickelte.
Er wurde geschoben, gedrückt, es wurde immer ärger.
Fünf Stunden, man muss sich das vorstellen, und keine Ahnung gehabt, was draußen ist, nicht den blassesten Schimmer, wo er drin war, warum er drin war und wieso er jetzt hinaus musste.
Keine Ahnung, wo es langgeht, aber trotzdem durchhalten.
Durchhalten, ohne zu wissen, wozu und warum.
Das war es, was den Menschen auszeichnete.
Ich hörte Ilua sehr aufmerksam zu, und ich verstand, dass die aus dem Bauch seiner Mutter Herauskriecherei keine einfache Sache gewesen sein konnte, denn sie hatte eine ziemlich enge Muschi.
Eine Tatsache, die ich meistens zu schätzen wusste, wenn Lara die Erste und ich buderten wie die Brotkäfer oder uns aufführten wie hormonbehandelte Bonobos auf Ecstasy.
Ilua hatte einen ziemlichen Schädel, mit dem voran er da hinaus musste. Insgesamt gesehen also eine große kulturelle Leistung. Iluas Wille zum Leben war sehr ausgeprägt, von Anfang an.
Er war ein selbstbewusster Jüngling, und zwar schon in dem Moment, als er herauskam aus seiner Mutter und ihr als erste Handlung auf den Bauch pisste.
Die Ärzte, Ärztinnen und Hebammen, die da zugange waren in diesem sogenannten Kreißsaal, amüsierten sich dementsprechend köstlich über ihn.
Aber offenbar auch über mich und seine Mutter, Lara die Erste, mit der ich vorher die ganze Atmerei und Schwangerengymnastik geprobt hatte. Dementsprechend gut waren wir in dem Moment, als es darauf ankam.
Wir atmeten gemeinsam circa fünf Stunden lang, und ich musste immer bis fünf zählen oder bis fünfzig, weiß nicht mehr.
Ich konnte die Geburtsschmerzen, die Lara hatte, nicht nachvollziehen, natürlich nicht.
Falls das überhaupt Schmerzen sind, wie die Frauen immer behaupten, und nicht morphin- und dopamingetriggerte Glücksgefühle.
Ich konnte mir ungefähr ausmalen, wie es ist, wenn sich eine Muschi von drei bis fünf Zentimeter Durchmesser, die sie so für einen durchschnittlichen mitteleurpäischen Penis braucht, auf fünfzehn oder mehr Zentimeter Durchmesser ausdehnen muss.
Ziemlich starke Sache musste das sein.
Dieser kleine Kerl kam aus Lara heraus, ich liebte ihn im ersten Moment, als ich ihn sah und er schilderte mir seine erste Reise, die er gerade hinter sich hatte.
Angefangen hatte die Sache wahrscheinlich so, dass es ihm zu eng wurde, er irgendwie verkrampfter als sonst an der Nabelschnur herumhing und außerdem eine biologische Uhr, die die Frauen hatten, begann Alarm zu schlagen.
Das war der sogenannte Blasensprung. Es sprang die Fruchtblase, in der er herumschwamm und alles hatte, was er brauchte. Und als die Blase sprang, sagte Lara zu mir: „Ich habe einen Blasensprung!“
Da sprang ich in irgendeine Hose, die gerade so herumlag, zerriss sie dabei, sodass mir der halbe Arsch rausschaute, orderte eine Droschke und los ging es.
Mann ist bei einer Geburt total nervös. So steht es zumindest in der Literatur. Er geht in die nächstbeste Kneipe, betrinkt sich sinnlos mit billigem Branntwein und der die das Neugeborene wird ihm anschließend vorgestellt oder er kann es sich durch eine Glasscheibe hindurch anschauen und sein edles Produkt taxieren.
In modernen Beziehungen ist das anders, da macht der Vater die Schwangerengymnastik mit, verknallt sich in die Schwangerengymnastiklehrerin und brennt mit ihr durch.
In meinem Fall war das nicht ganz so extrem. Ich verknallte mich zwar in die Schwangerengymnastiklehrerin, aber ich brannte nicht mit ihr durch, sondern ich schmachtete aus der Ferne und schenkte ihr Blumen, wie meistens, wenn ich die Aussichtslosigkeit einer Mann-Frau-Kombination rechtzeitig erkannte.
Jedenfalls brachte ich die Schwangerengymnastiklehrerin, die, oh Wunder, gleichzeitig auch noch Hebamme war, nicht dazu, sich näher mit mir zu beschäftigen.
Das wäre auch zu pervers gewesen, fand ich damals.
In meinem weiteren Bekanntenkreis gab es Typen, die das tatsächlich machten, und sich hinterher noch in die Kindergartentante ihres Sprösslings verliebten und diese fatalerweise auch noch ehelichten. Was es alles gibt.
Ich bewunderte die Schwangerengymnastiklehrerin, die gleichzeitig Hebamme war, aus der Ferne für ihren sinnvollen Job, nämlich kleine Jungs und Mädchen auf die Welt zu heben oder besser: auf die Welt heben zu helfen, weil den härtesten Job hatten bei einer Geburt schon die Kinder, dann die Mütter, dann die Hebammen. Trotzdem großes Kompliment an diese Ammen.
Männer waren mehr oder minder Zuschauer, das muss offen gesagt werden, aber wahrscheinlich war es halb so wild für die Mütter, wie sie immer behaupteten, und das Ganze fühlte sich für sie an wie ein Geschlechtsverkehr mit einem ziemlich dicken Teil. Und das dann nicht von außen, sondern von innen.
So könnte es ungefähr sein.
Wie sie stöhnte, Lara, wie sie sich wand und die Augen verdrehte, Sackzement.
Ilua kam nach zirka fünf Stunden
Pressen und Pumpen, Wehen auch genannt,
weil es doch mit Schmerz verbunden
für Frau und Kind,
gesund und munter auf die Welt.
Er wurde mir dann in meinen Arm gegeben,
und erzählte mir sofort von seinem Leben unter Wasser
und wie es dort so war
als ein komplett und völlig Nasser;
ob ihr es nun glaubt oder auch nicht,
seine Erzählung war für mich
durchaus verständlich,
denn ich sagte mir,
dass er erzählte sicherlich
von seiner Reise heraus aus
seiner Mutter schützendem Uterus,
die für ihn nicht unbeschwerlich war.
Die erste Rede, die Ilua hielt,
um mir zu erklären
wie seine Reise gewesen war,
fand ich einfach wunderbar.
Sie wurde gefolgt von zahlreichen weiteren
klaren Ansagen zu verschiedenen Themen,
die ihn und uns beschäftigten.
Zum Beispiel, wenn er etwas nicht fand,
seinen Schnuller oder seine Nuschi,
da plärrte er nicht herum oder nölte stundenlang,
sondern fragte klar und deutlich:
„Wo ist mein Zeug?“
Es wurde ihm dann gebracht sogleich,
von seiner Mutter oder mir.
Auch beim gemeinsamen Malen,
das wir machten mehr als ein halbes Dutzend Jahr,
bis er dann ins Gymnasium ging
und keine Lust mehr hatt’ auf solche Ding,
machte Ilua seine Ansagen stets eindeutig.
War er fertig mit einer Zeichnung,
sagte er „fertig“ oder hörte einfach auf
und schaute mich mit großen Augen an.
Ich bracht ihm dann ein neues Blatt,
damit er was zu Malen hatt.
Damit errang er meine Bewunderung,
denn ich hatte immer Schwierigkeiten,
zu wissen, wann ein Werk fertig ist,
Verschlimmbesserung war dann oft die Folge.
Auch Musik machten wir damals schon,
Das Lied vom Eisenkuchenritter zum Beispiel,
den Waschmaschinsky-Blues oder andere Liedlein,
auch Spottlieder manchmal über dicke Polizisten,
die in unserem Hof jemanden zu fangen versuchten,
aber sich aus Angst versteckten
hinter den Müllkübel-Kisten.
Oder die berühmte Afrika-Geschichte:
Wir spielten grad, Ilua am Schlagzeug
und ich am Klavier
unser Lied „Pferde im Prater“, denk ich mir,
Da klopfte es wie wild an unsere Tür.
Der Nachbar von oben
wollte mal wieder
ein bisschen
seinen Frust austoben?
Wie Fred Feuerstein stand er vor unserer Tür,
er brüllte allerdings nicht „Wilmaaaaa!“
sondern: „Sammer do in Afrika?“
Ich machte die Tür auf und ließ in herein geschwind,
da schrie er noch einmal „Sammer do in Afrika?“
Ilua, cirka vier oder fünf Jahre alt,
schaute ihn herausfordernd an
und sagte klar und deutlich zu ihm „ja”.
Damit war der Knallkopf vollkommen erledigt,
schlich sich und hielt die Schnauze, wie es sich geziemt,
wenn Musiker mit Musiker spielt.
Diese Szene zeigt sehr deutlich,
dass eine klare Ansage einem solche Säcke
leicht und elegant vom Leibe hält.
Eine Sache möchte ich nicht übergehen,
nämlich die Erfindung des Eisenkuchenritters.
Das war der Beginn unserer Mal- und Zeichenphase,
die dauerte sicher ein halbes Dutzend Jahr.
In der neuen Küche in Laras Wohnung,
schnappte Ilua sich eines Tages
eine runde Kuchen-Springform aus dem Küchenschrank,
stieg mit beiden Beinen hinein
und hob das Teil hinauf bis zu seinem Bauch.
Dann schaute er mich an und sagte:
„Eisenkuchenritter.“
Sonst nichts, er laberte nicht herum,
es war völlig klar, was er damit meinte,
nämlich dass er jetzt der Eisenkuchenritter sei.
Ich fand das so gut,
dass ich mit ihm schnurstracks ins Atelier ging
und anfing,
mit ihm den Eisenkuchenritter aufzumalen.
Er steht heute noch hier bei mir und ist eines unserer besten Werke. Der Eisenkuchenritter hatte so eine Art selbst gebasteltes Raumschiff mit. Es war zusammengesetzt aus Teilen, die andere Raumschiffe verloren hatten und die im Weltraum unkontrolliert herum torkelten. Die fing der Eisenkuchenritter sich ein, mit einem Magnet wahrscheinlich, und er machte auf einer Art Weltraumschrottplatz sein Gefährt. Mit Nieten und ziemlich schlampigen Schweißnähten. Das Gefährt sah ein bisschen aus wie ein bunter Eierbecher , aber zum Aufklappen.
Der Eisenkuchenritter war ein tapferer Mann, dem allerdings schon das Herz ein bisschen heraushing von der ständigen Kämpferei und Rauferei. Sie hatten ihn das eine oder andere Mal ziemlich heftig erwischt.
Zudem fehlte ihm eines: Er hatte kein Fräulein. Keine Geliebte. Keine Herzensdame. Deshalb machten wir auch einen Reim, damit der Eisenkuchenritter nicht so einsam war und der Reim ging so:
Der Eisenkuchenritter trinkt gerne Magenbitter,
der Eisenkuchenritter spielt abends gerne Zither,
und quietscht mal seine Rüstung,
nimmt der Eisenkuchenritter klarerweise
Erdnussöl mit Eierspeise.
Das war die Geschichte vom Eisenkuchenritter. Eine Musik machen wir auch dazu, der Refrain ging:
Ro – bo – ter. Ro – bo - ter.
Für Ilua war der Eisenkuchenritter eine Art Roboter, den wir geschaffen hatten, ihm Leben eingehaucht. Roboter lagen immer schon in seinem Interessensgebiet.
Der Zeitpunkt, an dem Ilua und ich anfingen zu malen, ist sehr genau bestimmbar.
Unsere Malerei fing an, als die Fenster in meinem Atelier vergrößert wurden und ich eine Art Balkonfenster einbauen ließ.
Ich leistete mir damals für den Umbau einen amerikanischen Architekten namens Bernie. Der kostete mich rund Dreißigtausend damaliger Währungseinheiten oder noch ein bisschen mehr und das meiste, das er aufzeichnete, war unbrauchbar. Er wollte mir die Bude zustellen wie einen Messestand. Er baute damals gerade Messestände für eine Ausstellung in Spanien, deshalb machte er das so.
Eine sehr gute Idee allerdings hatte Bernie, die machte meinen Arbeitsplatz nachher einfach hundertmal besser. Bernie sagte zu mir: „Nimm doch Balkonfenster, das ist besser. Dann hast du mehr Licht und bei uns in Amerika ist das überall so.“
Das war der Beginn der Malerei von Ilua und mir. Für die Balkonfenster musste man die Ziegel einer sechzig Zentimeter starken Wand herausbrechen und während der Umbauphase wurden die so entstandenen großen Öffnungen mit passenden Spanplatten versperrt. Ich wollte nicht, dass die finsteren Typen, die damals in der Gegend herumliefen, in der ich mein Atelier hatte, mir sämtliche Instrumente, Werkzeuge, Computer und Drucker klauten.
Damals konnte man in dieser Gegend nicht einmal eine gebrauchte Matratze in der Hofeinfahrt stehen lassen und kurz pinkeln gehen. Wenn man zurückkam, war das Teil verschwunden, darauf konnte man jede Wette eingehen. Einfach wieder in den ökonomischen Kreislauf integriert, Recycling ohne Bürokratie und Müllabfuhr. Das ging blitzschnell in dieser Gegend damals.
Als die neuen Balkonfenster dann eingebaut waren, hatten wir einige riesige zwei Komma zwei Zentimeter starke Spanplatten übrig. Die standen herum, taten nichts, nahmen Platz weg und waren zudem noch irre schwer.
Ich kaufte ein paar Dosen Acrylfarbe, Wachsstifte und Ölstifte sowie große und kleine Pinsel, hatte so eine Art Kaufrausch im Künstlerbedarfsgeschäft, wie es öfter nachher wieder vorkam und Ilua und ich fingen an, zwei von diesen Spanplatten zu bemalen.
Schicht auf Schicht. Zwei Jahre lang ungefähr.
Wir lernten verschiedene Dinge voneinander, wie zum Beispiel, wann etwas fertig ist, wie man den Pinsel hält, wie man einfache Icons malt, wie sich verschiedene Pinselbewegungen und Farb- und Materialmischungen auf das Ergebnis auf dem Malgrund auswirkten und so weiter.
Das alles schauten wir voneinander ab.
Einer vom anderen.
Einmal hatte der eine die gute Idee, einmal der andere, einmal Ilua, einmal ich. Ich bemühte mich, keine Hierarchie aufkommen zu lassen, außer beim Aufräumen manchmal. Ich wollte nicht in die Rolle dessen geraten, der genau wusste, wie man malt.
„Ich zeig dem Kleinen jetzt, wie das geht.“
Das wäre ein großer Blödsinn gewesen. Ilua war gescheit genug, dass er sich die wichtigsten Sachen abschaute und ansonsten seine eigenen Zeichen hinmalte.
Mit verschiedensten Werkzeugen, Spachtel, Pinsel, Holzstab, japanischen Essstäbchen; oder Ilua verwendete getrocknetem Ton als Kreide; Schicht um Schicht auftragen und dann die jeweils untere Schicht durch Kratzen oder Schaben wieder zum Vorschein bringen.
Solche Sachen machten wir und die zwei Bilder, die dabei entstanden hießen: „Der Eisenkuchenritter“ und „Man is leaving a City because it/she is too beautiful.“
Das erste Bild war eine Idee von Ilua.
Das zweite war die Manifestation des Unbehagens des Menschen an den sogenannten Designer-Städten und sollte meine professionelle Deformation ein wenig thematisieren.
Aus zwei Steckdosen oder Schaltern machten wir, als Ilua ungefähr drei Erdenjahre alt war, zwei roboterartige Wesen, Ilua und Igua. Auch aus Lego machen wir immer diese zwei Figuren, wobei das für ihn und für mich Zwischenwesen waren zwischen Robotern und Sauriern.
Einen Lieblingssaurier von Ilua, einen mit einer Halskrause, Triceratops mit wissenschaftlichem Namen, der ein bisschen aussah wie ein überdimensionales Nashorn, nannte Ilua Ritzeratzkopf.
Ritzeratzkopf.
Ich fand das gut.
Ritzeratzkopf.
Das Malen mit Ilua und eben so Sachen entwerfen wie Ilua und Igua war für mich auch das Design einer Gegenwelt, wo man sich seiner Phantasie hingeben konnte und herumträumen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
Darum ging es.
Ein Bild von Ilua und mir, das „Zirpenhaus“, ist besonders unter diesem Aspekt zu sehen.
Als uns die Zirpen, wie ich die Mädchen damals nannte, weil ich mit so einer Sopran-Zirpe verbandelt war, wieder ordentlich auf den Keks gingen mit ihrer Wichtigmacherei, da entwarfen wir das Zirpenhaus, wo man die verschiedenen Arten von Zirpen unterbringen konnte.
„Mein wunderschönes Zirpenhaus, es ist nicht weit von hier, die Zirpen gehen ein und aus und haben’s gut bei mir.“2
In diesem Zirpenhaus waren dann nicht nur Sopran-Zirpen und Mutter-Zirpen sondern auch Pferdezirpen, Ziegenzirpen, Katzenzirpen und Klebezirpen gut untergebracht.
Die Klebezirpen konnten sich wie ein Gecko an den Fensterscheiben des Zirpenhauses festhalten.
Außerdem designten wir auch eine Vogelzirpe, die zu faul zum Fliegen war und sich aus diesem Grund eine Art Heißluftballon zugelegt hatte.
Den Hausmeister von der Hütte, in der sich mein Atelier befand, und der Ilua und mir immer unheimlich auf die Nerven ging, weil er in unserem Hof ständig seinen Lungenschleim ausspuckte und immer angesoffen war mit Sliwowitz und zudem nicht grüßte - der Typ musste mehrere Magengeschwüre gehabt haben, schätze ich mal - den Hausmeister von dieser Hütte also malten wir auf dem Zirpenhausbild als Geköpften mit seinem Stinkeschädel auf einem Besenstiel aufgespießt und auf dem Dach zur Schau gestellt.
Als Warnung an alle Hausmeister, dass sie, wenn sie nicht spurten, ins Jenseits kamen.
Hausmeister ins Jenseits.
Weiter war auf dem Zirpenhausbild noch eine Zirpenkatze abgebildet und ein Zirpenpferd, das ein wenig stupide in die Gegend schaute und sich wahrscheinlich ziemlich fehl am Platz vorkam, außerdem ein Zirpenfisch und ein Zirpenkäfer.
Eine Art Zirpen-Arche Noah, das Ganze.
Darüber hinaus machten Ilua und ich Dutzende Bilder auf Pappelsperrholz mit Plaka- und Acrylfarben und viel Wasser, unter anderem:
„Der dicke König schaut zufrieden auf seine Kinder.“
Der dicke König, der Titel war von mir. Damit meinte ich ein wenig auch mich, der ich glücklich war, der dicke kleine König war glücklich.
Ich hatte alles, was man auf Erden wollen konnte zu jener Zeit:
Einen Sohn, mit dem ich Zeit hatte zu malen, ihn von Kindergarten abzuholen, mit ihm im Park spazieren zu gehen, mit ihm Fußball zu spielen und die Nase ordentlich hoch zu tragen.
Ich war privilegiert.
Andere Männer in meinem Alter mussten ihre Statussymbole anschaffen gehen, Mercedes G oder Landrover Defender kaufen, Eigentumswohnung abbezahlen, ihren Ehefrauen und Nutten teure Klunker und Klamotten schenken, damit sie wieder nett zu ihnen waren und solche Sachen.
Ich konnte mit Ilua im Park abhängen und mit den Müttern, die auf den Parkbänken saßen, mehr oder minder gepflegte Konversationen führen.
Oft beklagten sich diese Mütter bitterlich über ihr Schicksal, dass sie hier ständig im Park sitzen durften und auf ihre Kinder aufpassen konnten. Ich hatte keine Veranlassung, in dieses allgemeine Frustgejammer einzustimmen.
I was the little fat King of Pötzleinsdorf, sozusagen. Der dicke nette Onkel aus dem Park.
Ich hatte eine gute Frau, Lara die Erste, die Mutter von Ilua, die sich ausgezeichnet um unser Kind kümmerte, und mir, da sie mich brauchte und sicher auch schätzte, auch keine streng limitierten Kinder-Besuchszeiten mit Psychiater-Begleitung aufzwingen wollte.
Das war eine intellektuelle, psychische und soziale Leistung sondergleichen von Lara der Ersten.
Wahrscheinlich schickte sie sich aber einfach in die Umstände. Da sie viele Nachtdienste als angehende Ärztin hatte, brauchte sie mich einfach zur Brutpflege.
Und dann hatte ich eine Gefährtin, Mitzi Märzenbecher, mit der ich hätte Pferde stehlen können - wir taten es tatsächlich nicht, das nicht – und mit der ich in irgendwelchen Provinzopern und später auch größeren Häusern herumhing und hoochie coochie machte und die ich auf meine Art äußerst liebte.
Was will Mann mehr.
Kohle war in dieser Zeit immer da. Ich fing gerade an, ein wenig Geld zu verdienen nach sechs oder sieben Jahren Putz von den Wänden fressen.
Alles in allem: Cool, die Götter schienen mich zu lieben: Ich war Don Pomodoro, der landlose italienische Edelmann. Das sagte mein Freund Gernot einmal zu mir.
Alles in allem:„Oh, what a lucky man I was.“ 3
I was a lucky man, aber neben dem Gemause mit Mitzi Märzenbecher und dass ich mich mit Iluas Mutter Lara halbwegs verstand und meiner Arbeit war mir mein Sohn Ilua das Wichtigste im Leben.
Das habe ich richtig gefunden und mich daran gehalten.
Mitzi Märzenbecher war zeitweise eifersüchtig auf Ilua. Sie wollte immer die Erste sein, war es aber nicht immer.
Sie fühlte sich ausgeschlossen, wenn Ilua und ich malten, und das machten wir ständig.
Dazu brauchten wir sie nicht; sie hätte allerdings nicht gestört, hätte auch mit uns malen können, ohne Weiteres.
Ich hielt es für richtig und unumstößlich, meinen Sohn Ilua an die erste Stelle zu setzen.
Unter anderem schlichtweg aufgrund meiner Überzeugung, dass man die Erziehung von Männern nicht vollständig den Frauen überlassen kann. Das wird dann nichts.
Die Frauen erziehen die Knaben unbewusst so, wie sie später als Männer am besten verabscheut werden können. Sie kümmern sich ungefragt um alles, sie halten ihre Schwänzchen beim Pissen möglichst bis sie vierzig sind.
Sie fragen mit zwanzig noch, ob der Bub nicht vergessen hat, kacki zu machen. Totale Kontrolle der Körperfunktionen, des Essens und der diesbezüglichen Ausscheidungen. Der Mann war körperlich und geistig ihr Geschöpf, fanden sie zumindest.
Sie halten die Knaben als libiniöses verfügbares wehrloses Objekt in Unmündigkeit; möglichst lang und ausdauernd. Sie bezeichnen das als Liebe.
„Ich liebe mein Kind mehr als irgendetwas anderes auf der Welt. Ich bin die Beste aller Mütter, es soll ihm an nichts mangeln.“
Und wer das nicht glaubt, der kriegt was auf die Mütze, aber schärfstens.
Ilua und ich malten also diese Zirpen hin, um sie in unserem Zirpenhausbild zu bannen. Wir konnten in einer Art magischem Realismus die ganzen Zirpen einfach hineintun.
Zirp Zirp.
Wir hatten unsere Ruhe.
Die Sprache, das wurde später klar,
ist Iluas Metier, er studierte das sogar.
Heute ist er ein Magister der Künste,
Absolvent der Universität Salzburg, Schauspiel.
Und arbeitet seit mehr als einem Jahr
am Theater in der Josefstadt;
spielte dort ganz verschiedene Rollen,
inklusive der Hauptrolle des Joe in „Magic Afternoon”.
während seines Studiums,
das möcht ich noch erwähnen hier,
spielte er von Palmetshofer über Shakespeare
so ziemlich alles, was man heute können muss,
er machte es mit Erfolg und lockerem Impetus.
Mit fünfundzwanzig Jahren Shylock spielen
ist eine große Herausforderung,
da gibt es nichts zu diskutieren.
Er sagte einfach:
„Ich, Ilua, bin jetzt Shylock,
der grausame Kerl aus „Der Kaufmann von Venedig.“