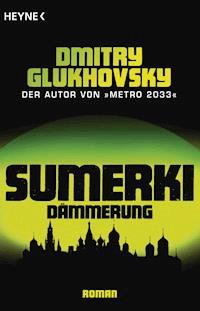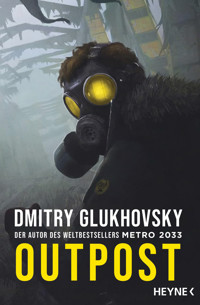9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Metro-Romane
- Sprache: Deutsch
Der Held einer ganzen Generation ist zurück – in METRO 2035 macht sich Artjom erneut auf die gefährliche Reise durch das Dunkel der Moskauer Metro
Seit ein verheerender Atomkrieg zwanzig Jahre zuvor die Erde verwüstet hat, haben die Menschen in den Tiefen der Metro-Netze eine neue Zivilisation errichtet. Doch die vermeintliche Sicherheit der U-Bahn-Schächte trügt: Zwei Jahre, nachdem Artjom die Bewohner der Moskauer Metro gerettet hat, gefährden Seuchen die Nahrungsmittelversorgung, und ideologische Konflikte drohen zu eskalieren. Die einzige Rettung scheint in einer Rückkehr an die Oberfläche zu liegen. Aber ist das überhaupt noch möglich? Wider alle Vernunft begibt sich Artjom auf eine lebensbedrohliche Reise durch eine Welt, deren mysteriöses Schweigen ein furchtbares Geheimnis birgt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 872
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Von Dmitry Glukhovsky sind im Wilhelm Heyne Verlag erschienen:
Metro 2033
Metro 2034
Metro 2035
Sumerki – Dämmerung
Futu.re
Mehr zu Dmitry Glukhovsky und seinen Romanen finden Sie auf:
diezukunft.de
DMITRYGLUKHOVSKY
METRO2035
Roman
Aus dem Russischen von David Drevs
Deutsche Erstausgabe
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der russischen Originalausgabe:
METPO 2035
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Deutsche Erstausgabe 5/2016
Redaktion: Maria Peeck
Copyright © 2015 by Dmitry Glukhovsky
Copyright © 2016 der deutschen Ausgabe und der Übersetzungby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: Animagic, Bielefeld
Karten: Herbert Ahnen
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN: 978-3-641-16509-3V001
INHALT
1 Hier Moskau
2 Die Metro
3 Die Röhre
4 Bezahlung
5 Feinde
6 Acht Meter
7 Zwetnoi bulwar
8 Heil
9 Theater
10 Rot
11 Niederschlag
12 Orden
13 Lebensraum
14 Fremde
15 Straße der Enthusiasten
16 Letzte Sendung
17 Alles richtig
18 Dienst
19 Was schreiben
20 Wunder
21 Kameraden
22 Wahrheit
23 Daheim
Nachwort
Anmerkungen
1
HIER MOSKAU
Es geht nicht, Artjom.«
»Mach auf! Mach auf, sag ich.«
»Anweisung vom Stationschef. Ich darf niemanden rauslassen.«
»Was soll das heißen, niemanden? Willst du mich verarschen?«
»Das ist mein Befehl! Zum Schutz der Station … vor der Strahlung … das Tor geschlossen halten. So lautet mein Befehl, kapiert?«
»Kommt das von Suchoj? Hat dir mein Stiefvater den Befehl gegeben? Mach schon auf.«
»Wegen dir krieg ich noch eins auf die Mütze, Artjom …«
»Na gut, wenn du nicht willst, mach ich’s eben selbst.«
»Hallo … San-sejitsch … Ja, vom Posten … Artjom ist hier … Ihr Artjom. Was soll ich mit ihm machen? Ja. Wir warten.«
»Bravo, Nikizka, jetzt hast du mich verpfiffen. Dafür ziehst du jetzt aber Leine! Ich mache auf. Egal was, ich gehe da raus!«
Doch in diesem Augenblick sprangen noch zwei aus der Wächterkabine heraus, zwängten sich zwischen Artjom und die Tür und schoben ihn mitleidig zurück. Auch wenn keiner der Wachleute ernsthaft handgreiflich wurde, war Artjom – ohnehin schon müde, die Augen schwarz umrandet, den Aufstieg vom Vortag noch in den Knochen – ihnen nicht gewachsen. Neugierige hatten sich dazugestohlen: dreckverschmierte Knirpse mit Haaren, durchsichtig wie Glas, aufgedunsene Hausfrauen, die Hände blau und stählern vom endlosen Waschen im eiskalten Wasser, müde Viehzüchter aus dem rechten Tunnel, die einfach nur dumpf gaffen wollten. Sie flüsterten untereinander, sahen Artjom an und zugleich durch ihn hindurch. Auf ihren Gesichtern lag – weiß der Teufel was.
»Er hört einfach nicht auf damit. Wozu will er da rauf?«
»Genau. Und jedes Mal geht dabei die Tür auf. Und dann kommt das alles hier rein, von da oben! Sturkopf, verdammter …«
»Hör mal, lass das … So kannst du nicht über ihn sprechen. Immerhin hat er uns … gerettet. Uns alle. Auch deine Kinder da.«
»Ja, stimmt schon. Aber was jetzt? Wofür hat er sie denn gerettet? Fängt sich da draußen jede Menge Röntgen ein … und wir kriegen auch gleich noch was ab.«
»Und vor allem: Was zum Henker will er dort? Wenn es wenigstens einen Grund gäbe!«
In diesem Augenblick tauchte unter all diesen Gesichtern das wichtigste auf: ein ungepflegter Schnauzer, die spärlichen grauen Haare quer über die Glatze gelegt. Das Gesicht nur mit geraden Linien gezeichnet, nirgends eine einzige Rundung. Und auch alles andere an ihm: steif und zäh wie Hartgummi, als hätte man diesen Mann bei lebendigem Leib gedörrt. Genauso war seine Stimme.
»Geht nach Hause, alle. Habt ihr gehört?«
»Das ist Suchoj. Suchoj ist gekommen. Soll er seinen Jungen mitnehmen.«
»Onkel Sascha …«
»Schon wieder du, Artjom? Wir hatten doch darüber gesprochen …«
»Mach auf, Onkel Sascha.«
»Geht nach Hause, ich sag’s nicht noch mal! Hier gibt es nichts zu gaffen! Und du – komm mit.«
Aber Artjom setzte sich auf den Boden, den glattpolierten, kalten Granit. Lehnte sich gegen die Wand.
»Es reicht jetzt«, sagte Suchoj lautlos, nur mit den Lippen. »Die Leute tuscheln sowieso schon.«
»Es muss sein. Ich muss hoch.«
»Da ist nichts! Nichts! Nichts gibt es da zu suchen!«
»Onkel Sascha, ich hab dir doch gesagt …«
»Nikita! Was stehst du da rum? Los, schaff die Bürger hier weg!«
»Jawohl, San-sejitsch!« Nikita fuhr hoch und begann hastig die Menge wegzuschaufeln. »Also, wer braucht noch eine Extraeinladung? Los, Marsch, Marsch …«
»Das ist doch alles dummes Zeug. Hör zu …« Suchoj stieß die in ihm angestaute Luft aus, wurde auf einmal weich und faltig – und ließ sich neben Artjom auf dem Boden nieder. »Du bringst dich noch um damit. Glaubst du, der Anzug schützt dich vor der Strahlung? Der ist doch wie ein Sieb! Da könntest du genauso gut ein Baumwollhemd tragen!«
»Na und?«
»Nicht mal die Stalker gehen so oft nach oben wie du … Hast du überhaupt mal deine Dosis gemessen? Was willst du eigentlich: leben oder krepieren?«
»Ich weiß, dass ich es gehört habe.«
»Und ich weiß, dass du es dir eingebildet hast. Es gibt niemanden, der Signale schicken könnte. Niemanden, Artjom! Wie oft soll ich es dir noch sagen? Niemand ist mehr da. Außer Moskau. Außer uns hier.«
»Das glaube ich nicht.«
»Denkst du vielleicht, mich kümmert, was du glaubst? Wenn dir die Haare ausfallen, das kümmert mich! Wenn du Blut pisst! Willst du, dass dir der Schwanz eintrocknet?!«
Artjom zuckte mit den Schultern. Schwieg, wog ab.
Suchoj wartete.
»Ich habe es gehört. Damals, auf dem Turm. In Ulmans Funkgerät.«
»Aber außer dir hat niemand etwas gehört. Die ganze Zeit über, egal wie oft sie danach gehorcht haben. Der Äther ist leer. Also was jetzt?«
»Jetzt gehe ich nach oben. Weiter nichts.«
Artjom stand auf, streckte den Rücken.
»Ich will Enkel haben«, sagte Suchoj von unten zu ihm.
»Damit sie hier leben? Im Untergrund?«
»In der Metro«, korrigierte Suchoj.
»In der Metro«, lenkte Artjom ein.
»Und sie sollen ganz normal leben. Erst mal überhaupt auf die Welt kommen, natürlich. Aber so …«
»Sag ihnen, sie sollen aufmachen, Onkel Sascha.«
Suchoj blickte zu Boden. Auf den schwarz glänzenden Granit. Offenbar war da irgendwas zu sehen.
»Hast du gehört, was die Leute sagen? Dass du übergeschnappt bist. Damals, auf dem Turm.«
Artjom verzog den Mund zu einem schiefen Lächeln.
Er holte tief Luft.
»Weißt du, was nötig gewesen wäre, damit du Enkel bekommst, Onkel Sascha? Du hättest eigene Kinder kriegen sollen. Die könntest du dann herumkommandieren. Und deine Enkel wären dann wenigstens dir ähnlich – und nicht weiß der Teufel wem.«
Suchojs Brauen zogen sich zusammen. Eine Sekunde tickte vorüber.
»Nikita, lass ihn raus. Soll er doch krepieren. Scheiß drauf.«
Nikita gehorchte schweigend. Artjom nickte zufrieden.
»Ich bin bald zurück«, sagte er zu Suchoj aus der Schleuse.
Dieser stemmte sich an der Wand hoch, drehte Artjom den gebeugten Rücken zu und schlurfte, den Granit polierend, fort.
Die Schleusentür knallte zu, die Riegel fielen ins Schloss. Eine grellweiße Lampe an der Decke flammte auf – fünfundzwanzig Jahre Garantie – und spiegelte sich wie die schwache Wintersonne in den verschmierten Fliesen. Die gesamte Schleusenzone war, bis auf eine stählerne Wand, damit getäfelt. Ein verschlissener Plastikstuhl, um sich auszuruhen oder die Stiefel zu binden, an einem Haken ein deprimiert wirkender Strahlenschutzanzug, im Boden ein Abfluss, daneben ein Gummischlauch zur Dekontamination. In der Ecke stand noch ein Armeerucksack. Ein blauer Hörer hing an der Wand, wie bei einer Telefonzelle.
Artjom stieg in den Anzug – dieser war geräumig, wie der eines Fremden. Er holte die Atemschutzmaske aus der Tasche. Zog den Gummi lang, stülpte sie sich über, blinzelte, während er sich an die Sicht durch die runden, nebligen Sichtfenster gewöhnte. Nahm den Hörer ab.
»Bereit.«
Ein schweres Knarren ertönte, und die stählerne Wand – keine Wand, sondern ein hermetisches Tor – begann nach oben zu kriechen. Von außen wehte ein kalter, feuchter Atem herein. Fröstelnd schulterte Artjom den Rucksack, der sich schwer anfühlte, als hätte sich ein Mensch rittlings obendrauf gesetzt.
Die abgenutzten, rutschigen Stufen der Rolltreppe führten steil hinauf. Die Metrostation WDNCh lag sechzig Meter unter der Erde. Gerade tief genug, dass die Wirkung von Fliegerbomben nicht mehr zu spüren war. Natürlich, hätte ein Atomsprengkopf Moskau getroffen, gäbe es hier nichts als eine riesige Grube, gefüllt mit Glas. Doch die Sprengköpfe waren alle von der Raketenabwehr hoch über der Stadt abgefangen worden. Nur ihre Splitter waren auf die Erde herabgeregnet – strahlend, aber nicht mehr explosionsfähig. Nur aus diesem Grund stand Moskau noch immer fast unbeschädigt da, ähnelte seinem früheren Selbst wie eine Mumie dem lebenden Pharao. Arme und Beine befanden sich noch immer, wo sie hingehörten, ein Lächeln lag auf seinen Lippen …
Andere Städte hingegen hatten kein Raketenabwehrsystem besessen.
Ächzend rückte Artjom den Rucksack zurecht, bekreuzigte sich verstohlen, schob die Daumen unter die lockeren Riemen, um sie zu spannen, und begann mit dem Aufstieg.
Regen prasselt auf den stählernen Helm. Artjom spürt das hohle Klopfen direkt auf seinem Schädel. Seine Sumpfstiefel sinken tief in den Schlamm ein, rostige Bäche laufen von irgendwo oben nach irgendwo unten, am Himmel türmen sich Wolken, nirgends auch nur eine einzige Lücke. An den leeren Häusern ringsum nagt der Zahn der Zeit. Die Stadt ist menschenleer. Seit über zwanzig Jahren nicht eine Seele.
Am Ende einer Allee aus feuchten, kahlen Baumleichen ist der riesige Torbogen zum Ausstellungsgelände der WDNCh zu erkennen. Was für ein Kuriositätenkabinett: Imitationen antiker Tempel, in denen einst die Hoffnung auf künftige Größe spross. Damals glaubten sie noch, diese Größe werde in nächster Zukunft anbrechen – vielleicht schon morgen. Aber dann gab es auf einmal kein Morgen mehr.
Die WDNCh ist jetzt ein lebensfeindlicher Ort.
Vor ein paar Jahren lebten hier noch alle möglichen Kreaturen, aber inzwischen sind nicht einmal die mehr da. So mancher hat gehofft, dass die Hintergrundstrahlung abnehmen würde und die Menschen wieder nach oben zurückkehren könnten. Laufen ja sowieso überall Mutanten herum, und die sind doch auch nur Tiere, wenn auch ziemlich abgefahrene …
Aber dann kam es genau umgekehrt: Die Eiskruste der Erde verschwand, die Erde begann zu atmen und zu schwitzen, und die Strahlung ging sprunghaft in die Höhe. Die Mutanten mit ihren Krallen klammerten sich verzweifelt an ihr Leben, ergriffen entweder die Flucht oder krepierten früher oder später. Der Mensch dagegen hockt unter der Erde, lebt in den Metrostationen und hat gar nicht vor zu sterben. Der Mensch braucht ja nicht viel. Der Mensch ist zäher als jede Ratte.
Schnarrend beginnt der Geigerzähler Artjoms Dosis zu berechnen. Den nehm ich nicht mehr mit, denkt Artjom, der nervt nur. Was ändert es denn, wie viel er da zusammentickt? Solang ich hier noch nicht fertig bin, kann er herumschnarren, so viel er will.
»Sollen sie doch reden, Schenja. Sollen sie glauben, dass ich übergeschnappt bin. Sie waren damals nicht dabei … auf dem Turm. Sie kommen ja sowieso nie aus ihrer Metro raus. Woher sollen sie es wissen? … Übergeschnappt … Ich hab sie alle zugebombt … Ich sag doch: Genau in dem Augenblick, als Ulman die Antenne da oben montierte … Während er sie einstellte … Da war was. Ich hab’s genau gehört! Und – nein, du Arschloch, ich hab’s mir nicht eingebildet. Sie wollen mir nicht glauben!«
Ein Autobahnkreuz bäumt sich über ihm auf. Asphaltbänder, in einer Wellenbewegung erstarrt, haben sich Autos wie Ungeziefer vom Rücken gewischt: Wahllos liegen diese am Boden verstreut, mal auf allen vieren, mal auf dem Rücken, und sind in dieser Haltung verreckt.
Artjom sieht sich kurz um und steigt dann die ihm entgegengestreckte raue Zunge einer Auffahrt hinauf. Es ist nicht mehr weit – vielleicht noch eineinhalb Kilometer. Bei der nächsten Zunge ragen die Tricolor-Wolkenkratzer auf. Früher waren sie in triumphalem Weiß-Blau-Rot gestrichen; mittlerweile hat die Zeit sie, wie alles andere, grau übertüncht.
»Warum glauben sie mir nicht? Aus Prinzip, weiter nichts. Na gut, bisher hat noch keiner Rufzeichen gehört. Aber von wo horchen sie? Von unter der Erde. Keiner von ihnen würde für so was an die Oberfläche gehen, stimmt’s? … Denk doch mal nach: Außer uns soll wirklich niemand überlebt haben? Auf der ganzen Welt – niemand? Das ist doch völlig hirnrissig! Oder?«
So sehr er den Ostankino-Turm aus seinem Sichtfeld zu verdrängen versucht, es ist unmöglich, ihn zu übersehen: Wie sich Artjom auch dreht, der Turm wabert immer irgendwo am Rand herum – wie ein Kratzer auf dem Sichtglas seiner Maske. Schwarz, feucht, abgebrochen bis zum Knauf der Aussichtsplattform, als hätte jemand mit geballter Faust seinen Arm aus dem Untergrund gestoßen, ein Riese, der sich an die Oberfläche durchkämpfen wollte, aber im roten Moskauer Lehm stecken geblieben ist, eingeklemmt von starrer, feuchter Erde, eingeklemmt und erdrückt.
»Als ich damals auf dem Turm war …« – Artjom nickt steif in dessen Richtung – »… als wir auf Melniks Signal warteten … Da, in dem Rauschen … Das kann ich beschwören, bei allem, was du willst … Da war etwas! Etwas war da!«
Über dem nackten Wald schweben zwei Kolosse: der Arbeiter und die Kolchosbäuerin, in seltsamer Pose miteinander verschränkt. Sie scheinen gemeinsam über eine Eisfläche zu gleiten oder einen Tango aufs Parkett zu legen, jedoch ohne einander anzusehen. Irgendwie wirken sie geschlechtslos. Wohin blicken sie? Ob sie von ihrer Höhe aus sehen können, was hinter dem Horizont liegt? Wen interessiert das überhaupt?
Links bleibt das Teufelsrad der WDNCh zurück, riesig, wie ein Schräubchen jenes Mechanismus, der die Erde um ihre Achse dreht. Zusammen mit ihm ist auch das Rad vor mehr als zwanzig Jahren stehen geblieben und rostet jetzt leise vor sich hin.
Ende Gelände.
Auf dem Rad steht »850« geschrieben: So alt war Moskau, als es aufgestellt wurde. Sinnlos, die Zahl zu aktualisieren. Wenn niemand da ist, die Zeit abzulesen, bleibt sie stehen.
Die hässlichen, tristen Wolkenkratzer, einst weiß-blau-rot, sind bereits auf die Größe der halben Welt angewachsen: Es ist nicht mehr weit. Sie sind die größten Gebäude im Umkreis, von dem geknickten Turm abgesehen. Genau das Richtige. Artjom legt den Kopf zurück und nimmt den Gipfel in den Blick. Sofort beginnen seine Knie zu schmerzen.
»Vielleicht heute …«, fragt Artjom ohne Fragezeichen, auch wenn ihm klar ist, dass die Ohren des Himmels mit Wolkenwatte verstopft sind.
Natürlich hat ihn dort niemand gehört.
Der Eingang.
Ein Eingang wie jeder andere.
Die Gegensprechanlage verwaist, die Stahltür ohne Strom, im Aquarium des Concierge ein toter Hund. Die Postkästen klappern blechern im Luftzug, es sind weder Briefe darin noch Reklamemüll. Alles längst eingesammelt und verbrannt, um wenigstens die Hände daran zu wärmen.
Es gibt drei glänzende deutsche Aufzüge. Ihre Türen stehen weit offen, das rostfreie Innere funkelt, als könne man jeden von ihnen einfach so betreten und damit bis in die Spitze des Hochhauses hinauffahren. Artjom hasst sie dafür. Daneben die Tür zum Notausgang. Artjom weiß, was sich dahinter befindet. Er zählt bereits: sechsundvierzig Stockwerke zu Fuß. Der Weg nach Golgatha ist jedes Mal ein Fußmarsch.
»Jedes Mal … zu Fuß …«
Der Rucksack wiegt jetzt eine ganze Tonne. Und diese Tonne presst Artjom in den Beton, hindert ihn am Gehen, bringt ihn aus dem Tritt. Aber Artjom geht trotzdem immer weiter, wie in Trance, und wie in Trance redet er.
»Na und, was soll’s, dass die keine Raketen … abwehr … Egal … Es müssen … müssen doch irgendwo noch … Menschen … Unmöglich, dass nur hier … dass nur in Moskau … nur in der Metro … Hier ist doch die Erde … noch heil … nicht zerborsten … Der Himmel … reinigt sich … Das kann doch nicht … dass das ganze Land … Amerika … Frankreich … China … oder wenigstens Thailand … Was haben die denn getan … Die waren doch gar nicht …«
Natürlich ist Artjom mit seinen sechsundzwanzig Jahren weder in Frankreich noch in Thailand gewesen. Um ein Haar hätte er die alte Welt gar nicht mehr angetroffen: zu spät geboren. Die Geografie der neuen Welt ist etwas ärmer: die Metrostation WDNCh, die Metrostation Lubjanka, die Metrostation Arbatskaja … die Ringlinie. Aber immer wenn er in einem dieser seltenen alten Reisemagazine mit Schimmel überzogene Aufnahmen von Paris und New York betrachtet, spürt Artjom, dass es diese Städte irgendwo gibt, dass sie noch stehen, nicht zugrunde gegangen sind. Dass sie warten – vielleicht auf ihn.
»Warum … Warum soll allein Moskau überlebt haben? Das ist doch unlogisch, Schenja! Verstehst du nicht? Unlogisch! … Das bedeutet doch, dass wir ihre … ihre Signale … nicht empfangen … noch nicht. Ich muss einfach immer weitermachen. Aufgeben ist verboten … Verboten.«
Der Wolkenkratzer ist leer, aber dennoch tönt und lebt er: Über die Balkone weht der Wind herein, klappert mit Türflügeln, atmet pfeifend durch die Aufzugschächte, raschelt in fremden Küchen und Schlafzimmern, macht Geräusche, als wären die Eigentümer zurückgekehrt. Doch Artjom glaubt ihm nicht, dreht sich nicht einmal um, schaut nicht mal für einen Moment auf Besuch vorbei.
Sowieso klar, was sich hinter den unruhig klopfenden Türen befindet: ausgeraubte Wohnungen. Nur Fotos liegen vielleicht noch auf dem Boden herum, von toten Fremden, die sich selbst geknipst haben, Fotos, die niemandem mehr als Erinnerung dienen. Oder es steht irgendwo noch ein sperriges Möbelstück, das man weder in die Metro noch ins Jenseits mitschleppen konnte. In anderen Häusern hat die Druckwelle die meisten Fenster eingedrückt, die hier montierten Verbundscheiben dagegen haben standgehalten. Nur sind sie nach zwei Jahrzehnten vollständig mit Staub überwachsen, als ob sie am grauen Star erblindet wären.
Früher traf man in dem einen oder anderen Apartment noch auf ehemalige Bewohner, die den Rüssel ihrer Schutzmaske gegen irgendein Spielzeug drückten und näselnd vor sich hin weinten, ohne zu merken, dass man sich ihnen von hinten näherte. Jetzt aber ist ihm schon lange niemand mehr begegnet. Der Rüsselmensch liegt längst reglos, ein Loch im Rücken, neben seinem idiotischen Spielzeug, und sein Anblick macht deutlich: Hier oben gibt es kein Zuhause. Es gibt hier nichts außer Beton, Ziegel, Matsch, rissigem Asphalt, vergilbten Knochen, Mulm und natürlich der Strahlung. So ist es in Moskau – und auf der ganzen Welt. Leben gibt es nur in der Metro. Das ist eine Tatsache. Das weiß doch jeder.
Außer Artjom.
Was, wenn es auf dieser unermesslichen Erde doch noch einen Ort gibt, der für den Menschen geeignet ist? Für Artjom und Anja? Für alle von der Station? Einen Ort, wo man nicht ständig eine Eisendecke über dem Kopf hat, sondern wo man bis in den Himmel wachsen kann? Wo man ein Haus für sich selbst bauen, ein eigenes Leben führen und von dort aus allmählich diese verbrannte Erde neu besiedeln kann?
»All unsere Leute … könnten dort leben … unter freiem Himmel …«
Sechsundvierzig Stockwerke.
Er könnte auch im vierzigsten, ja wahrscheinlich sogar im dreißigsten haltmachen. Schließlich hat niemand Artjom gesagt, dass er unbedingt aufs Dach steigen muss. Aber er hat es sich in den Kopf gesetzt, dass es, wenn überhaupt, nur dort, auf dem Dach, funktioniert.
»Natürlich … ist es … nicht so … hoch … wie auf dem Turm … damals … Aber … aber …«
Die Sichtfenster der Schutzmaske sind angelaufen, das Herz hämmert gegen den Brustkorb. Es ist, als ob jemand mit einem selbstgemachten Messer ausprobiert, wie man am besten unter Artjoms Rippen kommt. Spärlich zwängt sich die Atemluft durch den Filter der Maske, es mangelt an Leben. Als Artjom auf der fünfundvierzigsten Ebene ankommt, hält er es – wie damals, auf dem Turm – nicht mehr aus, reißt sich die enganliegende Gummihaut vom Gesicht und schöpft die süße, bittere Luft. Eine ganz andere Luft als die in der Metro. Frisch.
»Die Höhe … vielleicht … Das sind ja … vielleicht dreihundert Meter … Die Höhe … Vielleicht deshalb … Ja, wahrscheinlich … lässt sich in der Höhe … was einfangen …«
Er wirft den Rucksack ab: geschafft. Mit steifem Rücken stemmt er sich gegen den Lukendeckel, drückt ihn auf und klettert auf die Plattform. Erst dort fällt er zu Boden. Bleibt flach auf dem Rücken liegen, blickt in die Wolken, die von hier aus zum Greifen nah sind; redet seinem Herzen gut zu, lässt den Atem zur Ruhe kommen. Und setzt sich auf.
Die Aussicht von hier …
Als wäre er gestorben und schon dabei, ins Paradies zu fliegen, aber währenddessen plötzlich gegen eine Glasdecke gestoßen und dort hängen geblieben, und jetzt kann er weder vor noch zurück. Nur eines ist klar: Von dieser Höhe kann er nie mehr hinabsteigen. Wenn du einmal von hier oben gesehen hast, wie spielzeughaft das Leben auf der Erde in Wahrheit ist, wie kannst du es jemals wieder ernst nehmen?
Nebenan türmen sich zwei weitere, ganz ähnliche Wolkenkratzer auf, einst bunt, jetzt grau. Aber Artjom besteigt jedes Mal diesen einen. Hier fühlt er sich fast wie zu Hause.
Für eine Sekunde öffnet sich zwischen den Wolken eine Scharte, und die Sonne schießt hervor. In diesem Augenblick scheint etwas auf dem Nachbargebäude aufzublitzen, vielleicht vom Dach oder aus einem der verstaubten Fenster in den oberen Etagen. Als hätte jemand mit einem Spiegel einen Strahl eingefangen. Doch als er sich danach umdreht, hat sich die Sonne schon wieder verbarrikadiert, und der Glanz ist verschwunden. Und kommt nicht wieder.
Wie von selbst wandern die Augen, auch wenn Artjom dies zu vermeiden versucht, immer wieder zu dem völlig verwandelten Wald hinüber, der jetzt anstelle des ehemaligen botanischen Gartens wuchert. Und zu der schwarzen, kahlen Wüstenei in dessen innerstem Kern. Ein toter Ort ist dies, als hätte der Herr dort einen letzten Rest brennenden Schwefels ausgeschüttet. Aber nicht der Herr ist es gewesen …
Der botanische Garten.
Artjom hat ihn anders in Erinnerung. Es ist der einzige Ort aus der ganzen verschwundenen Vorkriegswelt, an den er sich noch erinnert.
Seltsam: Da besteht dein ganzes Leben nur aus Fliesen, Tunnelsegmenten, tropfenden Decken und Rinnsalen neben Gleisen, aus Granit und Marmor, aus Schwüle und elektrischem Licht. Aber dann taucht darin auf einmal ein winziges Stück von etwas anderem auf: ein kühler Maimorgen, kindlich zartes, frisches Grün auf schlanken Bäumen, mit bunter Kreide bemalte Parkwege, eine quälend lange Schlange vor dem Sahneeis, und dann das Eis selbst, im Waffelbecher, nicht nur einfach süß, sondern schlicht überirdisch. Und die Stimme der Mutter – schwach und von der Zeit entstellt wie von einem kupfernen Telefondraht. Und die Wärme ihrer Hand, die du nicht loslassen darfst, damit du nicht verloren gehst, weshalb du dich mit aller Kraft festhältst. Obwohl: Kann man sich an so etwas überhaupt erinnern? Wahrscheinlich nicht.
Und all das andere – das so unpassend und unmöglich ist, dass du gar nicht mehr weißt, ob es tatsächlich geschehen ist oder ob du es nur geträumt hast. Aber wie solltest du so etwas träumen, wenn du es nie zuvor gesehen und gekannt hast?
Deutlich sieht Artjom die Kreidezeichnungen auf den Wegen vor sich, die goldenen Nadeln der Sonne im löchrigen Laub, die Eiswaffel in seiner Hand, die komischen orangen Enten auf dem glänzend braunen Spiegel des Teichs, die schwankenden Stege darüber. Wie sehr er sich fürchtete, ins Wasser zu fallen, und noch mehr – den Waffelbecher dort hineinfallen zu lassen!
An ihr Gesicht, das Gesicht seiner Mutter, kann sich Artjom nicht erinnern. Er hat versucht, es heraufzubeschwören, sich selbst vor dem Einschlafen gebeten, wenigstens im Traum einen Blick auf sie zu erhaschen, selbst wenn er diesen am Morgen wieder vergessen haben sollte – zwecklos. Gibt es in seinem Kopf wirklich keine noch so winzige Ecke, wo sich seine Mutter versteckt, wo sie Tod und Schwärze überdauert haben könnte? Offenbar nicht. Aber wie kann ein Mensch existieren – und dann so vollkommen verschwinden?
Und jener Tag, jene Welt – wohin sind sie verschwunden? Hier sind sie doch, gleich nebenan, er muss nur die Augen schließen. Sicher kann man zu ihnen zurückkehren. Irgendwo auf der Erde müssen sie sich doch gerettet haben, sind übriggeblieben – und rufen nun all den Verirrten zu: Wir sind hier, wo seid ihr? Man muss sie nur hören. Man muss nur zuhören können.
Artjom blinzelt und wischt sich über die Lider, damit seine Augen wieder das Heute sehen, nicht die Vergangenheit von vor über zwanzig Jahren. Er hockt sich hin und öffnet den Rucksack.
Darin befindet sich ein Funkgerät, eine sperrige Armeevariante in zerkratztem Grün. Dann kommt ein weiteres Ungetüm zum Vorschein: ein Eisenkasten mit einer Kurbel, ein Dynamo Marke Eigenbau. Und schließlich, ganz unten, vierzig Meter Kabel – die Antenne.
Artjom verbindet alle Leitungen, legt das Kabel im Kreis auf dem Dach aus, wischt sich die Feuchtigkeit vom Gesicht und schlüpft widerwillig zurück in die Schutzmaske. Klemmt sich den Kopfhörer auf den Schädel. Streicht mit den Fingern über die Tasten. Dreht die Kurbel des Dynamos. Eine Diode blinzelt auf, ein Summen setzt ein, und es beginnt in seiner Hand zu vibrieren wie ein Lebewesen.
Er drückt auf den Kippschalter.
Schließt die Augen, aus Angst, sie könnten ihn daran hindern, im Rauschen der Funkbrandung jene Flaschenpost zu entdecken, die ein Überlebender von irgendeinem fernen Kontinent geschickt hat. Er schaukelt auf den Wellen. Und dreht immer weiter an der Kurbel, als ob er auf einer Luftmatratze säße und mit einer Hand paddelte.
Der Kopfhörer zischt, sendet ein dünn jaulendes »Iiiiii…« durch das Rauschen, hüstelt schwindsüchtig, schweigt – und zischt wieder los. Es ist, als wanderte Artjom durch eine Tuberkulosestation auf der Suche nach einem Gesprächspartner, doch keiner der Patienten ist bei Bewusstsein; nur die Pflegerinnen legen streng den Finger auf den Mund und machen »schschsch…«. Niemand hier will Artjom Antwort geben, niemand hat vor zu leben.
Niemand aus Piter. Niemand aus Jekaterinburg.
London schweigt. Paris schweigt. Bangkok und New York schweigen.
Es spielt längst keine Rolle mehr, wer jenen Krieg begonnen hat und wie er begann. Wozu? Für die Geschichte? Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben, aber in diesem Fall ist niemand da, der sie schreiben könnte – und bald wird sie auch niemand mehr lesen.
»Schschschsch…«
Leere im Äther. Endlose Leere.
»Iiiiiuuu…«
Gespenstischen Wiedergängern gleich hängen die Nachrichtensatelliten in ihrer Umlaufbahn: Niemand funkt sie an, und so stürzen sie sich irgendwann, wahnsinnig vor Einsamkeit, auf die Erde herab – lieber verglühen sie in der Atmosphäre, als weiter so zu existieren.
Kein Wort aus Peking. Tokio schweigt wie ein Grab.
Artjom aber dreht diese verfluchte Kurbel immer weiter, dreht, rudert, rudert, dreht.
Wie still es ist! Unmöglich still. Unerträglich.
»Hier Moskau. Hier Moskau, kommen.«
Es ist seine, Artjoms, Stimme. Wie immer hält er es nicht aus, kann nicht warten.
»Hier Moskau, bitte kommen! Antwortet!«
»Iiiiiiu…«
Nicht aufhören. Nicht aufgeben.
»Petersburg, kommen! Wladiwostok, kommen! Hier Moskau! Rostow, kommen!«
Was ist los mit dir, Piter? Hast du dich wirklich so leicht erschüttern lassen, warst du noch weniger standfest als Moskau? Was ist da jetzt an deiner Stelle? Ein See aus Glas? Oder hat dich der Schimmel aufgefressen? Warum antwortest du nicht?
Wo steckst du, Wladiwostok, stolze Stadt am anderen Ende der Welt? Du standst so weit von uns entfernt, und jetzt sollst auch du komplett verseucht sein? Hat man dich nicht verschont?
»Kchch. Kchch.«
»Wladiwostok, hier Moskau, bitte kommen!«
Die ganze Welt liegt am Boden, das Gesicht im Dreck, und spürt nicht, wie dieser ewige Regen auf ihren Rücken tropft, wie sich Mund und Nase mit rostigem Wasser füllen.
Aber Moskau … ist da. Steht. Auf den Beinen. Wie lebendig.
»Was ist jetzt, seid ihr etwa alle krepiert, oder was?!«
»Schschsch…«
Vielleicht sind das ihre Seelen, die ihm aus dem Äther antworten? Oder klingt so die Hintergrundstrahlung? Auch der Tod muss doch eine Stimme haben. Wahrscheinlich ist die hier ganz passend: ein Flüstern. Pssst … ist ja gut. Mach keinen Lärm. Ganz ruhig. Ganz ruhig.
»Hier Moskau! Kommen!«
Vielleicht hören sie ihn jetzt?
Vielleicht hustet im nächsten Augenblick jemand aus dem Kopfhörer, durchbricht aufgeregt das Zischen und ruft aus weiter, weiter Ferne:
»Wir sind hier! Moskau! Ich kann euch hören, bitte kommen! Moskau! Schaltet jetzt bloß nicht ab! Ich höre euch! Mein Gott! Moskau! Moskau ist am Ende der Leitung! Wie viele von euch sind noch am Leben?! Wir haben hier eine Kolonie mit fünfundzwanzigtausend Menschen! Unser Boden ist sauber, die Strahlung gleich null! Das Wasser nicht kontaminiert! Lebensmittel? Natürlich! Auch Medikamente haben wir. Wir schicken eine Rettungsexpedition los. Haltet aus! Hört ihr, Moskau?! Haltet aus!«
»Iiiiiiiiiiu…«
Leere.
Das hier ist kein Kontaktversuch per Funk, sondern eine spiritistische Sitzung. Die einfach nicht klappen will. Die Geister, die er ruft, gehorchen ihm nicht. Sie fühlen sich wohl im Jenseits. Sie blicken von oben durch die spärlichen Wolkenlücken auf Artjoms gekrümmte Gestalt herab und grinsen sich eins: Wohin? Hinunter zu euch? Pustekuchen!
»Kchchchch…«
Er lässt die Scheißkurbel los. Reißt sich den Kopfhörer vom Schädel. Steht auf, rollt das Antennenkabel sorgfältig wieder zusammen, langsam, sich zur Sorgfalt zwingend, denn am liebsten würde er es in Stücke reißen und vom sechsundvierzigsten Stock in den Abgrund werfen.
Er packt alles wieder in den Rucksack. Hievt ihn sich auf die Schultern, diesen Satan, diesen Verführer. Und beginnt den Abstieg. In die Metro. Bis morgen.
»Dekontamination durchgeführt?«, näselte der blaue Hörer.
»Durchgeführt.«
»Deutlicher!«
»Durchgeführt!«
»Soso …« Der Hörer schnalzte ungläubig. Artjom knallte ihn hasserfüllt an die Wand.
Von innen begann das Türschloss kratzend seine Zunge einzuziehen. Dann öffnete sich die Tür mit gedehntem Ächzen, und die Metro wehte ihn mit ihrem schweren, verbrauchten Atem an.
An der Schwelle wartete Suchoj. Entweder hatte er gespürt, wann Artjom zurückkommen würde, oder er war die ganze Zeit hiergeblieben. Wahrscheinlich hatte er es gespürt.
»Wie geht es dir?«, fragte er müde, ohne Bosheit.
Artjom zuckte mit den Achseln. Suchoj tastete ihn mit den Augen ab. Sanft, wie ein Kinderarzt.
»Jemand hat dich gesucht. Jemand von einer anderen Station.«
Artjom nahm unwillkürlich eine gerade Haltung an.
»Von Melnik?«
Etwas in seiner Stimme klirrte, als hätte jemand eine Patronenhülse fallen lassen. Hoffnung? Kleinmut? Oder etwas anderes?
»Nein. Irgendein alter Mann.«
»Was für ein alter Mann?«
Das letzte bisschen Kraft, das Artjom für den Fall gesammelt hatte, dass der Stiefvater »Ja« sagen würde, floss sogleich aus ihm heraus und verschwand im nächsten Abfluss. Er wollte sich nur noch hinlegen.
»Homer. Er sagt, er heißt Homer. Kennst du ihn?«
»Nein. Ich geh schlafen, Onkel Sascha.«
Sie bewegte sich nicht. Schlief sie wirklich schon? Rein mechanisch kam Artjom dieser Gedanke, denn eigentlich war es ihm im Moment völlig egal, ob sie schlief oder nur so tat. Er warf seine Kleidung am Eingang auf einen Haufen, rieb sich fröstelnd die Schultern, legte sich verstohlen wie ein Waisenknabe neben Anja, drehte sich auf die Seite und zog die Decke zu sich. Wäre da eine zweite gewesen, hätte er das gar nicht erst gewagt.
Auf der Stationsuhr war es etwa sieben Uhr abends gewesen. Anja musste um zehn aufstehen, um zu den Pilzen zu gehen. Artjom dagegen war vom Pilzdienst befreit. Als Held. Oder als Invalide? Alles, was er tat, machte er aus eigenem Antrieb. Wenn sie von ihrer Schicht zurückkehrte, stand er auf – und ging nach oben. Und fiel ins Bett, während sie so tat, als schliefe sie noch. So lebten sie ein phasenverschobenes Leben. In einer Koje, aber in zwei verschiedenen Dimensionen.
Vorsichtig begann Artjom die rote Steppdecke über sich zu ziehen. Als Anja das bemerkte, riss sie, ohne ein Wort zu sagen, wütend am anderen Ende. Eine Minute dauerte dieser idiotische Kampf, dann gab Artjom auf – und blieb nackt am Bettrand liegen.
»Super«, sagte er.
Sie schwieg.
Wie kommt es, dass eine Lampe erst brennt und dann durchbrennt?
Er vergrub das Gesicht im Kissen – zum Glück gab es davon zwei –, wärmte es mit seinem Atem und schlief so ein. In einem fiesen Traum erschien ihm eine andere Anja: die ihn fröhlich ärgerte, lachend, schlagfertig, irgendwie noch ganz jung. Obwohl, wie viel Zeit war eigentlich vergangen? Zwei Jahre? Zwei Tage? Weiß der Teufel. Damals hatten sie geglaubt, sie hätten die ganze Ewigkeit vor sich. Beide hatten sie das geglaubt. Also musste das alles eine Ewigkeit her sein.
Auch im Traum sorgte Anja dafür, dass ihm kalt war – sie jagte ihn nackt durch die Station, aber nicht aus Hass, sondern zum Spaß. Und als Artjom erwachte, glaubte er in schläfriger Trägheit noch eine ganze Minute lang, die Ewigkeit sei noch nicht vorüber, sondern Anja und er befänden sich erst irgendwo auf halbem Weg. Er wollte sie rufen, ihr verzeihen, alles in einen Scherz ummünzen. Aber dann fiel es ihm wieder ein.
2
DIE METRO
Und du, willst dumir vielleicht mal zuhören?«, fragte er Anja.
Aber da war sie schon nicht mehr im Zelt.
Der Kleiderhaufen lag noch genau an derselben Stelle: direkt im Durchgang. Anja hatte seine Sachen nicht weggeräumt oder beiseitegeschleudert. Sie war einfach darüber hinweggestiegen, als hätte sie Angst, sie zu berühren. Sich zu infizieren. Vielleicht hatte sie ja wirklich Angst davor.
Wahrscheinlich hatte sie die Decke schon immer nötiger gehabt. Er würde sich schon irgendwie aufwärmen.
Gut, dass sie gegangen ist. Danke, Anja. Danke, dass du nicht mit mir geredet hast. Danke, dass du mir nicht geantwortet hast.
»Danke, verdammt«, sagte er laut.
»Darf ich?«, ertönte eine Stimme durch die Zeltbahn, direkt neben seinem Ohr. »Artjom? Sind Sie schon wach?«
Artjom kroch zu seiner Hose.
Draußen saß auf einem Feldhocker ein älterer Herr, dessen Gesichtszüge für sein Alter zu weich erschienen. Er saß bequem, im Gleichgewicht, und es war klar, dass er sich hier schon vor einiger Zeit niedergelassen hatte und nicht vorhatte, wieder zu gehen. Der Alte war fremd, nicht von hier: Er rümpfte die Nase, durch die er unvorsichtigerweise einatmete. Daran erkannte man Zugereiste sofort.
Artjom schirmte seine Augen mit der Hand gegen das rote Licht ab, das die WDNCh durchflutete, und betrachtete den Gast.
»Was willst du, alter Mann?«
»Sie sind Artjom?«
»Könnte sein.« Artjom atmete hörbar ein. »Kommt drauf an.«
»Homer«, erklärte der Alte, ohne sich zu erheben. »So nennt man mich.«
»Tatsächlich?«
»Ich schreibe Bücher. Ein Buch.«
»Interessant«, sagte Artjom mit der Stimme eines uninteressierten Menschen.
»Ein Geschichtsbuch. Sozusagen. Aber über unsere Zeit.«
»Ein Geschichtsbuch«, wiederholte Artjom vorsichtig und sah sich um. »Wozu? Es heißt doch, die Geschichte sei zu Ende. Aus und vorbei!«
»Und wir? Einer muss doch über das alles, was mit uns hier … was mit uns hier passiert, das muss doch jemand den Nachfahren berichten.«
Wenn er nicht von Melnik kam, wer war er dann? Wer hatte ihn geschickt? Wozu?
»Den Nachfahren. Klar, unbedingt.«
»Natürlich, einerseits … muss man vor allem davon berichten, wie wir hier leben. Die Meilensteine der Geschichte, das Auf und Ab sozusagen, all das muss darin vorkommen. Aber wie, in welcher Form? Trockene Fakten geraten schnell in Vergessenheit. Damit sich die Menschen erinnern, muss die Geschichte lebendig sein. Dazu bedarf es eines Helden. Daher habe ich mich auf die Suche nach geeignetem Material gemacht. Dies und jenes ausprobiert. Einmal dachte ich schon, ich hätte das Passende gefunden. Aber als ich dann anfing … funktionierte es nicht. Ein Fehlgriff. Und dann habe ich von der WDNCh gehört und …«
Der Alte tat sich erkennbar schwer, sein Anliegen auszudrücken, aber Artjom dachte gar nicht daran, ihm zu helfen. Er begriff einfach nicht, worauf das alles hinauslief. Böses schien von dem Alten nicht auszugehen, auch wenn sein Verhalten etwas unangemessen war. Und doch braute sich da etwas zusammen, etwas braute sich zusammen zwischen ihm und Artjom, etwas, das jeden Augenblick in die Luft gehen konnte, sengend und splitternd.
»Man hat mir von der WDNCh erzählt … Von den Schwarzen – und von Ihnen. Und da wurde mir klar, dass ich Sie finden muss, um diese …«
Artjom nickte. Endlich war der Groschen gefallen.
»Tolle Geschichte.«
Und dann ging er los, ohne sich zu verabschieden, die ewig kalten Hände in den Hosentaschen. Der Alte blieb auf seinem bequemen Hocker sitzen und fuhr fort, Artjoms Rücken irgendwas zu erklären. Artjom aber hatte beschlossen zu ertauben.
Er blinzelte – seine Augen hatten sich an das Licht gewöhnt, er musste die Lider nicht mehr zusammenkneifen.
Für das Licht im Freien hatten sie länger gebraucht: ein ganzes Jahr. Und das war schnell! Die meisten Metro-Bewohner wären selbst an diesem von Wolken gedämpften Sonnenlicht für immer erblindet. Kein Wunder, nach einem Leben im Finstern. Artjom hingegen hatte sich gezwungen, dort oben sehen zu lernen. Die Welt zu sehen, in die er geboren worden war. Denn wenn du die Sonne nicht aushältst, wie willst du dann nach oben zurückkehren, wenn die Zeit kommt?
Alle, die in der Metro geboren waren, wuchsen ohne Sonne auf – wie Pilze. Daran war nichts Besonderes. Wie sich herausstellte, braucht der Mensch nicht Sonne, sondern Vitamin D. Man konnte Sonnenlicht also durchaus auch als Dragee schlucken. Und auch mit dem Tastsinn war ein Leben möglich.
Ein gemeinsames Beleuchtungssystem gab es in der Metro nicht. Auch keine gemeinsame Stromversorgung. Es gab überhaupt nichts Gemeinsames: Jeder war für sich selbst verantwortlich. An einigen Stationen hatte man es hingekriegt, fast so viel Strom zu erzeugen wie früher. Anderswo reichte es gerade mal für eine einzige Lampe in der Mitte des Bahnsteigs. Wieder andere waren, wie die Tunnel, in tiefste Schwärze getaucht. Brachte jemand ein tragbares Licht dorthin, so vermochte er, aus dem Nichts einzelne Stückchen herauszufischen: den Boden, die Decke, eine Marmorsäule. Aus der Dunkelheit krochen dann die Bewohner der Station heran, angelockt vom Strahl der Taschenlampe und dem Wunsch, etwas zu sehen. Doch war es besser, wenn sie sich nicht zeigten: Ohne Augen hatten sie zu leben gelernt, aber ihr Mund war nicht zugewachsen.
An der WDNCh lief das Leben dagegen in geregelten Bahnen, das Volk war geradezu verwöhnt: Bei einigen Bewohnern brannten in den Zelten kleine, von der Oberfläche herangeschaffte Leuchtdioden, während für die öffentlichen Plätze noch die alte Notbeleuchtung verwendet wurde: Lampen mit roten Glashauben. Diese gaben dasselbe Licht, bei dem man früher Fotonegative entwickelt hatte. Und so war auch Artjoms Seele in diesem roten Licht allmählich zum Vorschein gekommen, hatte sich im Entwickler abgezeichnet, und es stellte sich heraus, dass diese Seele dort oben, an jenem hellen Maitag, aufgenommen worden war.
Doch an einem anderen – einem trüben Oktobertag – hatte jemand den Film aus der Kamera gerissen und gelöscht.
»Tolle Geschichte, Schenja, nicht wahr? Weißt du noch, die Schwarzen?«, flüsterte Artjom. Aber ihm antworteten immer andere. Immer die Falschen.
»Artjom, wie geht’s?«
»Oh, Artjom!«
Alle grüßten ihn. Manche lächelten dabei, manche runzelten die Stirn, aber alle grüßten. Denn alle, nicht nur Artjom und Schenja, erinnerten sich noch an die Schwarzen. Alle erinnerten sich an die Geschichte, obwohl keiner sie kannte.
Die WDNCh war die Endstation dieser Linie. Seine Heimat. Zweihundert Meter lang, zweihundert Bewohner. Sie bot gerade genug Platz: nur etwas weniger, und das Atmen würde ihnen schwerfallen, nur etwas mehr, und es würde nie richtig warm werden.
Gebaut worden war die Station vor knapp hundert Jahren, zur Zeit des Imperiums, aus den damals typischen Materialien: Marmor und Granit. Sie war großartig geplant, wie ein Palast, wenn auch eingegraben in die Erde, letztlich ein Mittelding zwischen Museum und Gruft. Ihr altertümlicher Geist war, wie bei den anderen Stationen, selbst den neueren, gänzlich unausrottbar. Auch wenn ihre Bewohner mittlerweile erwachsen geworden waren, so saßen sie doch noch immer auf den bronzenen Schößen irgendwelcher alten Greise – und kamen einfach nicht von ihnen los.
In den Bögen zwischen den ausladenden, verrußten Säulen waren alte, abgewetzte Armeezelte aufgeschlagen, in denen jeweils eine, manchmal sogar zwei Familien lebten. Hätte man die Insassen von Zeit zu Zeit neu gemischt, so wäre dies wahrscheinlich niemandem aufgefallen. So ist es eben, wenn man über zwanzig Jahre gemeinsam an einer Station lebt und sich zwischen deinen Geheimnissen und denen deiner Nachbarn, zwischen all dem Stöhnen und dem Geschrei nichts als eine Lage Segeltuch befindet.
Woanders hätten sich die Menschen wohl längst gegenseitig aufgefressen. Natürlich war man auch hier eifersüchtig aufeinander, zürnte Gott, dass er die Kinder anderer mehr liebte, hatte Schwierigkeiten, den eigenen Mann, die eigene Frau oder auch nur den eigenen Wohnraum mit anderen zu teilen. Woanders war all das Grund genug, einander an die Gurgel zu gehen, aber nicht hier, nicht an der WDNCh. Hier versuchte man, die Dinge einfach zu halten – man war eben unter sich.
Es war wie in einem Dorf oder in einer Kommune: Fremde Kinder gab es nicht. Kam beim Nachbarn ein gesundes zur Welt, so war dies ein gemeinsames Fest. Bekam ein anderer ein krankes, trug jeder dessen Los mit, half, womit er konnte. Fand jemand keinen Platz, um sich niederzulassen, rückten die anderen zusammen. Hatte sich einer mit seinem Freund geprügelt, versöhnte die Enge die beiden bald wieder. Hatte einen die Frau verlassen, vergab er ihr früher oder später. Eigentlich war sie ja gar nicht weg, sondern befand sich noch immer in demselben Marmorsaal, unter einer Million Tonnen von Erdreich, nur schlief sie jetzt eben hinter einer anderen Zeltplane. Schließlich begegnete man sich jeden Tag nicht nur ein, sondern hundert Mal. Also blieb nichts anderes übrig, als sich irgendwann auszusprechen. Es war ja unmöglich, sich einzubilden, sie sei nicht da und es habe sie nie gegeben. Hauptsache, es waren alle am Leben, alles Weitere ergab sich schon … Eben wie in einer Kommune – oder wie bei den Höhlenmenschen.
Es gab einen Weg, der von hier fortführte: durch den südlichen Tunnel zur Alexejewskaja und dann weiter in das große Netz der Metro. Und doch … Vielleicht lag es ja daran, dass die WDNCh die letzte Station der Linie war. Und dass hier all jene lebten, die nirgends mehr hingehen wollten oder konnten. Die ein Zuhause brauchten.
Artjom blieb bei einem der Zelte stehen und verharrte still. So stand er da, ließ seine Silhouette durch die abgewetzte Plane scheinen, bis schließlich ein Frauchen mit aufgedunsenem Gesicht heraustrat.
»Grüß dich, Artjom.«
»Guten Tag, Jekaterina Sergejewna.«
»Schenja ist nicht da, Artjom.«
Er nickte ihr zu. Am liebsten hätte er ihr die Haare gestreichelt, ihre Hand genommen. Ihr gesagt: Ich weiß doch, ich weiß. Ich weiß wirklich alles, Jekaterina Sergejewna. Oder sprechen Sie gerade mit sich selbst?
»Geh, Artjom. Geh. Bleib nicht hier stehen. Hol dir lieber einen Becher Tee.«
»Mach ich.«
An beiden Enden war die Stationshalle noch vor den Rolltreppen gekappt worden. Man hatte sich selbst eingemauert und abgedichtet, damit die vergiftete Luft von der Oberfläche nicht hereindrang … Na ja, und natürlich alle möglichen unerwünschten Gäste. Auf der einen Seite, wo sich der neuere Ausgang befunden hatte, war tatsächlich alles dicht. Auf der anderen, beim älteren Ausgang, hatte man eine Schleuse für den Aufstieg in die Stadt gelassen.
Am verschlossenen Ende befanden sich Küche und »Club«. Hier standen mehrere Herdplatten, an denen Hausfrauen mit Schürzen ihren Kindern und Männern Essen machten. Wasser gurgelte durch Kohlefilter-Röhren und sammelte sich beinahe klar in Auffangbecken. Mitunter begann ein Teekessel zu pfeifen, und jemand von der Landwirtschaftsschicht kam, um heißes Wasser zu holen, rieb sich die Hände an der Hose, suchte unter den Köchinnen nach seiner Frau, um sie an irgendeiner weichen Stelle zu drücken, an seine Liebe zu erinnern und gleichzeitig noch etwas aus dem Kochtopf zu schnabulieren.
Herdplatten, Teekocher, Geschirr, Stühle und Tische waren Gemeinschaftseigentum, aber die Menschen gingen dennoch achtsam damit um und bemühten sich, nichts kaputtzumachen.
Bis auf die Nahrungsmittel selbst stammte das gesamte Inventar von oben, denn in der Metro gab es kaum Möglichkeiten, etwas Sinnvolles zu konstruieren. Glücklicherweise hatten sich die Toten in der Zeit, als sie noch Leben vor sich hatten, alle möglichen Güter auf Vorrat zugelegt: Lampen, Dieselgeneratoren, Kabel, Waffen, Patronen, Geschirr und Möbel. Auch jede Menge Kleidung hatten sie sich geschneidert, die man nun auftragen konnte, als hätte man sie von älteren Geschwistern geerbt. All das hielt sicher noch lange vor: In der ganzen Metro lebten nicht mehr als vierzigtausend Menschen; in Moskau waren es seinerzeit fünfzehn Millionen gewesen. Nach Adam Riese hatte also jeder Einwohner der Metro gut dreihundert »Geschwister«. Schweigend drängelten sich diese um die Überlebenden und hielten ihnen ihre abgetragenen Sachen hin: Da, das hier ist noch so gut wie neu, nimm es ruhig, ich bin ja schon rausgewachsen.
Einmal mit dem Geigerzähler drübergehen, mehr war nicht nötig. Wenn er nicht zu sehr tickte, bedankte man sich artig und konnte die Sachen verwenden.
Artjom erreichte die Teeschlange und stellte sich hinten an.
»He, Artjom, tu doch nich so, als wärste fremd hier! Stellt sich einfach hinten an! Setz dich, Stehen macht auch nich klüger … Wie wär’s mit nem Schluck Heißem?«
Die Leitung der Küche hatte Mantel-Dascha übernommen, eine resolute Dame von gut fünfzig Jahren, die ihr Alter jedoch entschlossen ignorierte. Drei Tage vor dem großen Knall war sie aus irgendeinem Loch bei Jaroslawl nach Moskau gekommen, um sich einen Pelz zu kaufen. Das hatte sie auch getan und ihn seither nicht mehr abgelegt, weder tags noch nachts, nicht mal, wenn sie auf die Toilette ging. Artjom hatte sich nie über sie lustig gemacht. Was hätte er wohl getan, wenn ihm so ein Stück aus seinem früheren Leben geblieben wäre? Ein Stück Mai, etwas Sahneeis, ein wenig Pappelschatten oder ein Rest vom Lächeln seiner Mutter?
»Gern. Danke, Tante Dascha.«
»Nenn mich nich immer Tante!«, entgegnete sie, zugleich vorwurfsvoll und kokett. »Was gibt’s Neues da oben? Wie ist das Wetter?«
»Leichter Regen.«
»Also steht bei uns bald wieder’s Wasser? Hörste, Aygül? S’regnet, sagt er.«
»Das ist Allah, der uns straft. Für unsere Sünden. Aber schau, brennt da dein Schweinefleisch nicht an?«
»Du mit deinem Allah! Immer musst du den gleich rauskehren! Aber wo du recht hast, hast du recht: Das brennt gleich an … Wie geht’s denn deinem Mehmet, ist der schon von der Hanse zurück?«
»Seit zwei Tagen ist er schon weg. Seit zwei Tagen!«
»Na, reg dich doch nich gleich auf …«
»Ich schwör dir bei meiner Seele, Dascha, der hat sich dort eine Neue angelacht! Eine von euch! Und jetzt lebt er in Sünde …«
»Von euch, von uns … Was soll das denn? … Wir sind doch alle hier, Aygül, Liebes … Wir halten doch zueinander.«
»Irgendein Flittchen hat er sich zugelegt, ich sag’s dir bei Allah …«
»Hättst ihn halt auch öfter mal ranlassen sollen … Die Kerle sind doch wie die Kätzchen … Stoßen überall rum, bis sie was finden …«
»Was schwätzt ihr denn da für Zeug? Der Mehmet ist geschäftlich unterwegs, Handel treiben!«, mischte sich ein Mann ein, nicht viel größer als ein Kind. Auch seine Gesichtszüge waren kindlich, wenn auch abgehärmt. Aus irgendeinem Grund war er nicht so gewachsen, wie er eigentlich sollte.
»Is ja gut, Kolja, brauchst deinen Kumpel nich in Schutz zu nehmen. Und du Artjom, hör nich auf uns Weiber. So, bitte schön. Vorsicht, is noch heiß.«
»Danke.«
Ein Mann näherte sich, kahlköpfig, das Gesicht durchzogen von alten, ausgeblichenen Narben, doch sein Blick hinter den buschigen Augenbrauen war nicht wild und seine Redeweise gewandt.
»Ich grüße alle Anwesenden, insbesondere die Damen! Wer steht hier für den Tee an? Dann komme ich nach dir, Kolja. Habt ihr schon das Neueste von der Hanse gehört?«
»Was ist mit der Hanse?«
»Die Grenze ist dicht. Wie der Klassiker sagt: Leuchtet auf das rote Licht, Kind, dann quer die Straße nicht. Fünf von uns hängen da jetzt fest.«
»Na siehste, Aygül. Rühr mal deine Pilze um, Schätzchen.«
»Und meiner ist noch dort! Was mach ich jetzt?! Um Allahs willen … Aber wie können sie denn die Grenze so einfach dichtmachen? Sag, Konstantin!«
ENDE DER LESEPROBE