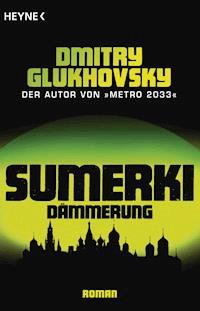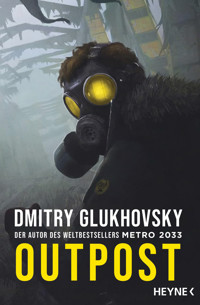Inhaltsverzeichnis
CAPÍTULO II
LA TAREA
Copyright
CAPÍTULO II
Achtung Fangfrage: Wo in Moskau befindet sich die Itzamná-Straße?
Vernünftig betrachtet haben nach Maya-Göttern benannte Straßen, Boulevards und Plätze in dieser Stadt nichts zu suchen. Doch ich hielt in meiner Hand eine Notiz mit der Adresse: ul. Izamny, 23. Man erwartete mich dort. Und davon, wie schnell ich diese Straße ausfindig machte, hing weit mehr ab als nur mein persönliches Schicksal.
Es wäre töricht anzunehmen, dass auf den Karten und Automobilatlanten Moskaus sämtliche Gassen und Gebäude der Stadt eingezeichnet sind. Geheime Orte gibt es hier mehr als genug. Trotzdem hoffte ich noch immer, die Straße zu entdecken, die den Namen des ältesten Maya-Gottes trug, und so kroch ich weiter mit meiner Lupe über die riesige topografische Karte der Stadt hinweg.
Ich hätte den Auftrag nicht annehmen sollen. Hätte weiter in Ruhe meine Unternehmensstatuten, Bedienungsanleitungen und Lieferverträge übersetzen sollen, mit denen ich mir schon immer meinen Lebensunterhalt verdient hatte. Außerdem war das Spanische nie meine stärkste Sprache gewesen. Doch an jenem Tag blieb mir nichts anderes übrig. Gerade hatte ich dem Mitarbeiter des Büros eine dünne, mit Gummiband zusammengehaltene Mappe mit übersetzten Verträgen über den dunkelbraunen, polierten Tisch zugeschoben. Nachdem er mir mein Honorar ausgezahlt hatte, breitete er die Arme aus.
»Das war’s soweit. Bisher ist noch nichts Neues reingekommen. Schauen Sie nächste Woche wieder vorbei«, sagte er und wandte sich seinem Computer zu, wo eine Patience geduldig auf ihn wartete, das Lieblingsspiel aller Däumchendreher dieser Erde.
Seit gut drei Jahren kannte ich ihn schon. Seit der Zeit, als er in diesem Übersetzungsbüro angefangen hatte. Bislang hatte ich noch nie nachgehakt, wenn er wieder einmal gleichgültig ankündigte, dass keine neuen Aufträge anstünden und ich mindestens eine Woche lang kein Geld sehen würde. Doch diesmal gab ich mir einen Ruck und sagte: »Haben Sie wirklich gar nichts? Schauen Sie doch bitte noch mal nach. Ich hab gerade eine Rechnung reinbekommen und keine Ahnung, wie ich die bezahlen soll.«
Erstaunt über meine Beharrlichkeit riss er sich vom Bildschirm los, rieb sich die niedrige Stirn und fragte zweifelnd: »Na ja, Spanisch machen Sie doch nicht, oder?«
Die Rechnung lag tatsächlich auf meinem Tisch, und ihr vierstelliger Betrag veranlasste mich, es darauf ankommen zu lassen. Drei Jahre Spanisch an der Uni, vor anderthalb Jahrzehnten … Riesige Hörsäle mit beschlagenen Fenstern, stickiger Kreidestaub von zerkratzten Tafeln, dazu nutzlose, vorsintflutliche Lehrbücher, die einem Cervantes’ Sprache anhand von offiziellen Kontakten zwischen den beiden Sowjetbürgern Iwanow und Petrow und den Señores Sanchez und Rodriguez beibrachten. Me gustas tú. Ziemlich magere Grundlagen. Egal, ein Wörterbuch hatte ich noch zu Hause.
»Doch«, log ich also verlegen. »Hab vor kurzem damit angefangen.«
Wieder musterte er mich voller Zweifel, aber dann erhob er sich, schlurfte ins Nebenzimmer, wo die Dokumente aufbewahrt wurden, und kehrte mit einer schweren Ledermappe zurück, auf der in einer Ecke ein abgewetztes goldenes Monogramm prangte. So etwas hatte ich hier noch nie gesehen.
»Bitte.« Respektvoll legte er die Mappe vor mir auf den Tisch. »Unser ›Spanier‹ ist mit dem ersten Teil noch nicht fertig, und der zweite ist schon eingetroffen. Ich fürchte, wenn wir in Verzug geraten, verlieren wir den Kunden. Also machen Sie sich bald an die Arbeit.«
»Was ist es denn?« Ich nahm die Mappe vorsichtig und wog sie in den Händen.
»Irgendwelche Papiere. Archivmaterial, glaub ich. Hab nicht so genau hingesehen, schließlich gibt’s hier auch so genug zu tun.« Er blickte kurz auf den Bildschirm, wo noch immer ein aufgedecktes Blatt auf ihn wartete und der Zähler gnadenlos weitertickte.
Das Honorar für den Auftrag war dreimal so hoch wie üblich, also machte ich mich aus dem Staub, bevor der Bürofritze es sich anders überlegte. Die Mappe sah kostbar aus, irgendwie aristokratisch, so dass ich mich nicht traute, sie in meine schmuddelige Aktentasche zu stecken. Ich musste an die Geschichte des ewig hungrigen Timm Thaler denken, dem schlecht geworden war, als er zum ersten Mal in seinem Leben eine teure Cremetorte probiert hatte.
Das Übersetzungsbüro lag verborgen in den Gassen des Arbat. Es befand sich in einem alten Holzgebäude, das früher eine Kinderbibliothek beherbergt hatte. Schon als kleiner Junge war ich regelmäßig mit meiner Großmutter hergekommen, um Bücher über Weltreisen und heldenhafte Pioniere in der Gewalt der Faschisten auszuleihen. Daher hatten meine wöchentlichen Besuche im Übersetzungsbüro etwas Nostalgisches - als beträte ich einen verlassenen, verrosteten Vergnügungspark, über den ich dreißig Jahre zuvor an der Hand meiner Eltern geschlendert war. Das Aroma alter Bücher saß noch in den Tapeten und Holzwänden und überdeckte sowohl den scharfen Geruch der Geschäftspapiere als auch den süßlich warmen Plastikdunst der PCs. Für mich war dieses Büro immer eine Kinderbibliothek geblieben. Vielleicht war dies der Grund, warum ich mich im ersten Moment gar nicht besonders wunderte, als ich die Papiere aus der Ledermappe zog.
Ein Blick genügte, um zu begreifen, dass sie aus einem Buch stammten. Sie waren nicht herausgerissen, sondern sorgfältig mit chirurgisch genauen Schnitten abgetrennt worden. Ich stellte mir vor, wie eine Hand in einem Gummihandschuh mit einem Skalpell einen alten Folianten entlangfuhr, der aufgeschlagen auf einem OP-Tisch lag. Derartige Maßnahmen erschienen mir keineswegs übertrieben - sicher war das aus unbekanntem Grund zerlegte Buch äußerst wertvoll gewesen. Dem äußeren Anschein nach waren die Seiten mindestens zweihundert Jahre alt. Das feste Papier, das im Laufe der Zeit an einigen Stellen sandfarben geworden war, jedoch noch keine Anzeichen von Verfall zeigte, bedeckten etwas unregelmäßige Zeilen aus gotischen Buchstaben. Offenbar handelte es sich um gedruckte Schrift, obwohl die Lettern sich nicht immer vollständig glichen.
Die Seiten waren nicht nummeriert, doch auf dem obersten Blatt hieß es: Capítulo II. Das erste Kapitel befand sich vermutlich bei dem anderen Übersetzer, der vor mir begonnen hatte und nun mit der Rückgabe in Verzug geraten war. Der Grund für diese Verzögerung wurde mir klar, nachdem ich den Text überflogen hatte. Auch mir kamen jetzt Zweifel, ob ich meine Übersetzung termingerecht würde einreichen können. Ich brauchte einige Stunden, um mich an die seltsame Schrift zu gewöhnen und mich durch den ersten Absatz dieses widerspenstigen, vom Alter zäh gewordenen Textes zu beißen.
Inzwischen war es draußen dunkel geworden. Ich hatte mich daran gewöhnt, häufig nachts zu arbeiten. Erst im Morgengrauen ging ich zu Bett und stand am Nachmittag auf. Sobald sich die Wohnung in Dunkelheit hüllte, machte ich nur zwei Lampen an - auf meinem Schreibtisch sowie in der Küche - und verbrachte die ganze Nacht zwischen diesen beiden Feuern hin und her wandernd. Beim warmen, gelben Schein der Vierzig-Watt-Birne ließ es sich viel besser denken - das Tageslicht hingegen stach mir in die Augen und höhlte meinen Schädel aus. Nicht einen einzigen Gedanken bekam ich dann zu fassen; sie schienen sich irgendwohin verzogen zu haben, wo sie bis zum Anbruch des Abends ausharrten.
Hatte ich die Nacht über durchgearbeitet, so legte ich mich meist um fünf Uhr morgens schlafen. Mit meinen dichten Vorhängen sperrte ich die ersten Sonnenstrahlen aus, schlüpfte unter die Daunendecke und schlief augenblicklich ein.
In letzter Zeit hatte ich mehrmals seltsam geträumt: Aus irgendeinem Grund war mir immer wieder mein geliebter Hund erschienen, der vor gut zehn Jahren gestorben war. Im Traum gab es natürlich keine Anzeichen für sein Ableben, und er verhielt sich wie ein völlig normales, lebendiges Tier. Was bedeutete, dass ich mit ihm Gassi gehen musste. Während dieser Spaziergänge lief er mir bisweilen weg (schon zu Lebzeiten hatte ich ihn nur sehr selten an die Leine genommen, höchstens um ihn über die Straße zu führen), so dass ich einen Gutteil des Traums damit verbrachte, nach ihm zu suchen und aus Leibeskräften seinen Namen zu rufen. Hoffentlich bekamen die Nachbarn nichts davon mit! Nicht immer gelang es mir, ihn wiederzufinden, bevor ich aufwachte. Aber das war nicht weiter schlimm: Bis zum nächsten Morgen fand er stets von selbst nach Hause, wartete bereits ungeduldig an der Schwelle zwischen Schlaf und Wachen auf mich und kaute verspielt auf seiner Leine herum. Ich hatte mich inzwischen so an seine selbstständige Rückkehr gewöhnt, dass ich mir, wenn er einmal nicht da war, sogleich Sorgen machte, ob ihm etwas passiert war.
Es fiel mir nicht leicht, den Sinn der ersten zehn Zeilen zu erfassen. Mindestens ein Fünftel der Wörter fehlten in meinem Wörterbuch - ohne dessen Hilfe hätte ich kaum mehr als ein Drittel eines Satzes verstanden. Außerdem begann jeder neue Absatz aus unerfindlichem Grund mit dem Wort »Dass«. Immer wieder abgelenkt von den gelblichen Flecken auf dem uralten Papier, begann ich akribisch jedes nachgeschlagene Wort auf ein Blatt Papier zu notieren. Einige musste ich später korrigieren, da sich der erste Übersetzungsversuch als falsch herausstellte. Die gesuchte Bedeutung war im Wörterbuch meistens mit dem Hinweis »veraltet« versehen.
Schon aus dem ersten Absatz wurde klar - und diese Hypothese bestätigte sich später, als ich mich bereits in der wunderlichen Erzählung dieses unbekannten Autors zu verstricken begann -, dass es sich hier um die Chronik einer Expedition in die bewaldeten Täler von Yucatán handelte, die von einem kleinen spanischen Trupp unternommen worden war. Auf den nächsten Seiten fanden sich Datumsangaben: Die beschriebenen Ereignisse hatten sich offenbar vor fast 450 Jahren abgespielt, also Mitte des 16. Jahrhunderts, zur Zeit der Eroberung Mittel- und Südamerikas durch die Konquistadoren.
Der Text in der Form, wie ich ihn hier und im Folgenden anführe, ist natürlich das Ergebnis sorgfältiger Korrektur und mehrfacher Überarbeitung. Meine ersten Versionen waren viel zu roh und unverständlich, als dass ich sie anderen hätte zeigen können, ohne mich zum Gespött der Leute zu machen.
»Dass wir uns auf Geheiß Fray Diego de Landas, des Guardians von Yzamal und Provinzials der Franziskaner von Yucatán, in eine der von Maní weiter entfernten Provinzen aufmachten, um aus den dort befindlichen Tempeln alle Handschriften und Bücher einzusammeln und nach Maní zurückzubringen.
Dass mit mir die edlen Señores Vasco de Aguilar und Gerónimo Núñez de Balboa aus Córdoba aufbrachen sowie gut vierzig fußläufige und ein Dutzend berittene Soldaten unter unserem Befehl, des Weiteren zwei mit Pferden bespannte Fuhrwerke, auf denen wir alle Handschriften und Bücher nach Maní bringen sollten, einige getaufte Indianer, die uns den Ort zeigen sollten, an dem sich jene Tempel befanden, sowie Fray Joaquín, den uns Fray de Landa zur Seite gestellt hatte.
Dass unser Weg nach Südwesten führte, in ein wenig erkundetes Gebiet, und dass wir über keine zuverlässigen Karten verfügten, weshalb Fray Diego de Landa uns auch so viele Soldaten mitgegeben hatte, wodurch er sogar die Verteidigung Manís aufs Spiel setzte. Dass er von den Führern nur die zuverlässigsten entsandte, drei seiner eigenen Dolmetscher, die Fray Diego de Landa selbst getauft hatte: Der erste von ihnen hieß Gaspar Xiu, der zweite Juan Nachi Cocom, und der dritte Hernán González, die beiden ersten aus dem Volk der Maya, das in Yucatán lebt, wohingegen der dritte - Hernán González - ein Halbblut war, sein Vater ein Spanier, seine Mutter aber eine Maya.
Dass mich Fray de Landa vor dem Aufbruch unserer Abteilung zu sich bat und mir die Aufgabe sowie ihre Bedeutung erläuterte und mir mitteilte, dass unsere Expedition nur eine von vielen sei, die er, Fray de Landa, von Maní aus in alle Himmelsrichtungen ausgesandt habe mit dem Befehl, alle indianischen Bücher und Handschriften, die an verschiedenen Stellen aufbewahrt wurden, zu finden und einzusammeln. Dass solche Expeditionen nach Osten gen Chichenizá und nach Westen gen Uxmal und nach Ekab und zu anderen Orten unternommen würden. Dass Fray de Landa nachsah, ob jemand hinter der Tür stünde und unser Gespräch belauschte, und sodann leise zu mir sagte, dass unsere Gesandtschaft die größte Verantwortung trage; treu gesinnte Menschen hätten ihm Gerüchte zugetragen, es gebe in entfernten Gegenden sogar getaufte Indianer, die noch immer ihren alten Göttern huldigten, und ihre Bücher verleiteten sie dazu, sich von Christus abzuwenden. Und deshalb habe er, Fray de Landa, beschlossen, den Indianern all ihre Handschriften wegzunehmen und ebenso ihre Götzenbilder, denn durch sie verführe der Teufel ihre Seelen. Wenn man jetzt nicht handle, so könnten sich die versprengten Maya erneut zusammenschließen und sich, unseren Herrn Jesus Christus verleugnend, wieder ihren satanischen Göttern zuwenden; und dann stünde den Spaniern ein neuer Krieg bevor, welcher die wenigen Kämpfe bei der Eroberung Yucatáns in den Schatten stellen werde. Dass es große Aufbewahrungsorte ihrer Handschriften im Nordwesten und Nordosten gebe, in den verlassenen Städten der Maya, doch die wichtigsten befänden sich, den Mitteilungen seiner treuen Gefolgsleute zufolge, einige Wochenreisen südwestlich von Maní.
Dass Fray de Landa mich dorthin sandte, und die Señores Vasco de Aguilar und Gerónimo Núñez de Balboa mit mir, und mit uns Fray Joaquín. Dass er, da die Gegend dort noch nicht erkundet war, uns jene treuen Gefolgsleute zur Seite stellte, die ihm von den Tempeln im Südwesten berichtet hatten.
Dass unsere Abteilung Maní am vereinbarten Tage verließ, dem 3. April im Jahre 1562 nach Christi Geburt, ohne zu wissen, welches Schicksal sie erwartete, und ohne zu ahnen, wie wenige dieser fünfzig Mann lebend wieder zurückkehren würden.«
Ich riss mich von den Blättern los und legte den Bleistift in mein Wörterbuch. Im schwarzen Spiegel des Fensters erblickte ich mein Gesicht: die zerzausten Haare (auf der Suche nach den richtigen Worten war ich ständig mit den Fingern hindurchgefahren), die weiche und wenig markante Nase, die runden Backen, das gut sichtbare Doppelkinn. Seit meinem dreißigsten Geburtstag hatte ich mir immer wieder heilige Eide geschworen, mein Äußeres nicht zu vernachlässigen. Doch ab diesem Alter wird es deutlich schwerer, das Gewicht zu halten. Der Körper folgt einem eingebauten Programm, dessen Ziele keineswegs mit deinen übereinstimmen, und jeder Krümel, den du verzehrst, droht sich in deinen rasant zunehmenden Fettpolstern abzulagern, wohl als Vorrat für künftige schwarze Tage. Überhaupt, seit der Scheidung ließ ich mich viel zu sehr gehen.
Meine Gesichtszüge hätte ich am liebsten mit jemand anderem getauscht, so sehr waren sie mir zuwider. Nach fünfunddreißig Jahren gibt dir dein Gesicht bereits erste Hinweise, wie es im Alter aussehen wird: Geheimratsecken deuten die künftige Glatze an; Falten glätten sich nicht mehr, wenn deine finstere Miene einem friedlichen Ausdruck oder Lächeln weicht; die Haut wird rau und lässt immer weniger Röte hindurch. Ab fünfunddreißig beginnt sich dein eigenes Gesicht in ein Memento mori zu verwandeln, eine Erinnerung an den Tod, die dich stets begleitet.
Was mich angeht, so habe ich mein Gesicht ständig vor Augen: Mein Schreibtisch steht direkt am Fenster, hinter dem es, wenn ich mich an die Arbeit mache, meist schon dunkel ist. Frisch geputzt, reflektiert das Glas wie die Oberfläche eines dunklen Waldteichs, der sämtliche Konturen wiedergibt, dafür aber die Farben schluckt. Dann scheint es mir, dass sich meine Gesichtszüge, von der nahen Tischlampe gut ausgeleuchtet, ebenso wie die verschwommeneren Linien der Möbelstücke, der Stuckdecke und des schweren Bronzelüsters geradewegs in der dichten Nachtluft spiegeln. Wer weiß, vielleicht existieren sie ja wirklich dort, vor dem Fenster - umso heller und deutlicher, je mehr Licht in meinem Zimmer brennt.
Außer der Tischlampe brennt noch das Licht in der Küche, und auch diese Lichtquelle lösche ich erst, wenn die fahle Morgensonne hereinkommt. Mein Vorgehen dient jedoch nur vordergründig der Gemütlichkeit - ich könnte in dieser Wohnung gar nicht anders leben.
Meine Wohnung ist weitläufig und alt, mit hohen Decken (zum Auswechseln durchgebrannter Glühbirnen brauche ich eine Leiter), eingerichtet mit antiken, rissigen Möbeln aus karelischer Birke, die sich für kein Geld der Welt reparieren lassen. Ich bringe es aber nicht übers Herz, sie zu verkaufen, denn die Wohnung habe ich von meiner Großmutter geerbt. Als ich noch klein war, war ich sehr oft bei ihr zu Besuch, und als sie starb und mir ihre Wohnung hinterließ, kehrte ich gleichsam in meine eigene Kindheit zurück.
Wenn ich früher bei meiner Großmutter übernachtete - damals war sie noch gesund -, ließ mich das Gefühl nicht los, dass ihr Haus atmete. Und selbst wenn sie ausgegangen war, glaubte ich zu hören, wie ihre Gedanken in irgendwelchen Ecken vor sich hin flüsterten und das Echo ihrer Schritte durch den Flur raschelte. Heute kommt es mir eher so vor, dass die Wohnung ihr eigenes Leben führt. Die Fenster sind auf verschiedenen Seiten, weshalb es im Flur oft zieht und offen stehende Türen nachts plötzlich zufallen. Manchmal fängt auch das über hundert Jahre alte Parkett auf einmal an zu knarzen, als ob jemand darüberginge. Natürlich könnte ich das Parkett mit einem Spezialmittel bearbeiten und endlich neue Fenster mit Isolierverglasung einsetzen. Sicherlich würden dann all die Gespenster augenblicklich verschwinden. Aber mir gefällt die Wohnung gerade so, wie sie ist … voller Leben.
Bevor ich mich wieder in die Übersetzung vertiefte, blickte ich noch einmal durchs Fenster. Etwas machte mich stutzig. Eine Zeit lang betrachtete ich erstaunt die Umrisse meines Gesichts, das dort in der stillen Nachtluft schwebte. Der Mann hinter dem Spiegel unterschied sich kaum merklich von dem, der mich gestern noch so missmutig von der anderen Seite aus angeblickt hatte.
Der Unterschied lag in den Augen. Gewöhnlich waren sie trüb oder glasig, wie bei den ausgestopften Ebern und Bären in dem berühmten Jagdgeschäft auf dem Arbat. Heute schien es jedoch, als ob sie von innen heraus strahlten. Kein Wunder: Zum ersten Mal seit vielen Jahren saß ich an einer Arbeit, die mich interessierte.
»Dass unser Weg zunächst über grüne und wunderschöne Wiesen führte, an deren Stelle alsbald undurchdringlicher Tropenwald trat. Dass wir allein dank unserer drei Führer durch das Dickicht auf unserem Weg vorankamen. Dass zwei der Indios stets vorausgingen und, wo immer nötig, mit ihren langen Messern Zweige abschlugen, um den Weg frei zu machen, gefolgt von ein paar Soldaten, die sie vor wilden Tieren und Feinden beschützten, während der dritte Führer gewöhnlich mich sowie die Señores Vasco de Aguilar und Gerónimo Núñez de Balboa begleitete.
Dass unser Marsch auf das Ende der Trockenzeit fiel, worauf in Yucatán und in den anderen Teilen dieses Landes Monate des Regens folgen. Dass selbst weit entfernt von den Siedlungen der Indios ein Brandgeruch in der Luft stand und die Sonne trüb war vom Rauch, denn im April und Mai, bevor die Regenzeit beginnt, verbrennen die Indios große Teile der Selva und des Gebüschs, um sie für den Ackerbau im nächsten Jahr vorzubereiten. Dass alle ebenen Länder der Maya in diesen Wochen von Rauch überzogen sind und danach ganze sechs Monate starker Regen fällt, und dass gegen Dezember die Indios in diese von der Asche fruchtbar gemachten und vom Regen getränkten Erde den Mais pflanzen, der dort ungewöhnlich gut wächst, so dass ein einzelner Ackersmann zwanzig Menschen ernähren kann.
Dass wir auf Anordnung Fray Diego de Landas die bekannten Straßen mieden und aus diesem Grunde nur langsam vorankamen. Dass wir anfangs die Fuhrwerke zurücklassen und einigen Soldaten befehlen wollten, sie wieder zurückzubringen; doch dann brachten uns die Führer zu einem alten Weg, den verwachsene Baumkronen vor fremden Blicken verbargen und der gesäumt war von Steingebilden, welche jenen grotesken Gnomen glichen, die ich schon in Maní bei den alten Tempeln der Maya gesehen hatte. Dass wir zudem an aufrechten Steinplatten vorüberkamen, die mit winzigen Symbolen bedeckt waren, von denen mir Fray de Landa bei einer unserer Unterredungen berichtet hatte; es seien die Buchstaben der yukatekischen Sprache, und er habe sie begriffen.
Dass unsere Reise in den ersten Tagen ohne Hindernisse und Schwierigkeiten verlief. Dass wir auf unserem Weg immer seltener Dörfer der Indios antrafen und nun, da wir in die Selva eingetaucht waren, keinen einzigen Menschen mehr zu Gesicht bekamen. Dass uns aber auch keine wilden Tiere behelligten und nur ein Mal nachts ein Wächter unweit im Dickicht einen Jaguar brüllen hörte; doch obwohl wir Pferde dabeihatten, folgte uns das Tier nicht, worauf unsere indianischen Begleiter meinten, dies sei ein gutes Zeichen.
Dass es sowohl für uns als auch für die Soldaten und unsere Führer genug zu essen gab, denn wir führten Dörrfleisch und trockene Maisfladen mit, und mitunter sammelten die Führer für uns essbare Früchte im Wald, und einige Male gingen sie auf die Jagd und brachten getötete Brüllaffen wieder, und am vierten Tage erlegten sie mit ihren Pfeilen einen Hirschen, dessen Fleisch wir gerecht unter den Soldaten verteilten, und die Jäger bekamen das Doppelte.
Dass am fünften Tage unseres Weges, während unsere Abteilung ruhte, einer der Führer, Gaspar Xiu, sich zu mir setzte und mich flüsternd fragte, ob ich wisse, weshalb Fray Diego de Landa uns auf diese Fahrt geschickt habe. Dass ich mich der gebotenen Vorsicht erinnerte und antwortete, man habe uns befohlen, gewisse Bücher zu suchen und sie nach Maní mitzunehmen, alles Weitere sei mir nicht bekannt. Dass Gaspar Xiu mich daraufhin lange anblickte und alsdann fortging, und er den Eindruck erweckte, als glaube er mir nicht.
Dass am nächsten Tage, da ich in der Nachhut der Abteilung ritt, um unsere Fuhrwerke zu bewachen, mich der andere Führer, das Halbblut Hernán González, bat, etwas zurückzubleiben, damit unsere Gefährten uns nicht hörten, und mir mitteilte, dass in einigen Gebieten der Maya, insbesondere in Mayapán, Yaxuna und Tulum, spanische Soldaten Bücher und Götzen der Indios verbrannt hätten. Dass dieser Hernán González mich fragte, warum sie so handelten und ob ich einen ähnlichen Befehl habe. Dass ich, obwohl ich bereits ahnte, warum uns Fray Diego de Landa zu diesem Marsch abgeordnet hatte, dem zweiten Führer dennoch ebenso antwortete wie dem ersten, nämlich, dass Fray de Landa nicht von mir gefordert habe, Manuskripte und Statuen zu verbrennen, sondern sie heil und unversehrt nach Maní zu bringen, und ich wisse nicht, zu welchem Zweck.
Dass ich am folgenden Tage mit meinen Kompagnons, den Señores de Aguilar und Núñez de Balboa sprach und erfuhr, dass unsere indianischen Führer sie das Gleiche gefragt hatten, doch weder der eine noch der andere mehr über die Ziele unserer Expedition wusste als ich; und dass ich, dem Befehl Fray de Landas sowie der Stimme meines Schutzengels folgend, ihnen nichts von meinen Vermutungen berichtete. Dass sich später herausstellte, dass diese Vermutungen nur zu einem Teil der Wahrheit entsprachen, und diese viel unfassbarer und düsterer war, als ich zu glauben gewagt hatte …«
Ich legte die Blätter und das Wörterbuch beiseite und blickte auf die Uhr: Die Zeiger standen auf halb zwei. Mein Hals war trocken. Gewöhnlich trinke ich, wenn ich abends arbeite, bereits gegen elf Uhr meinen Tee. Ich stand also auf und schwamm durch das Halbdunkel meiner Wohnung zur Küche hinüber.
Dieser nächtliche Tee ist für mich eine Art Ritual, das mir für gewöhnlich die Gelegenheit gibt, für zwanzig Minuten die Geheimnisse des Innenlebens einer Waschmaschine oder die möglichen Vertragsstrafen bei Nichtlieferung von Hühnerbeinen zu vergessen.
Das Teewasser koche ich stets auf dem Gasherd. Mein Kessel passt genau zu dieser Wohnung: Auch er ist alt und unglaublich anheimelnd - rot mit weißen Tupfern emailliert, mit breiter Tülle, auf die man vor dem Erhitzen eine glänzende Pfeife setzt. Wenn ich ihn von der Platte nehme oder den Deckel öffne, verwende ich dazu immer einen gesteppten, wiederum roten Küchenhandschuh. Die Teeblätter hole ich stets mit einem kleinen Löffel, dessen Griff spiralförmig gewunden ist, aus der Packung und gebe sie zum Aufbrühen in die kleine, dunkelblaue, handgearbeitete Porzellankanne, die mir schon vor langer Zeit jemand aus Taschkent mitgebracht hat.
Zwei Löffel fein gebrochene Teeblätter in die gespülte und trockengewischte Kanne, mit heißem Wasser übergießen, den Deckel schließen und fünf Minuten geduldig warten. Unter dem Deckel und aus der Tülle steigt verlockender, aromatischer Dampf, doch keine Hast: Der Tee muss noch ziehen.
Normalerweise vertreibe ich mir die Zeit, indem ich in den Zeitungen blättere, die ich tagsüber erworben habe. In dieser Nacht jedoch kam es anders. Wie gewohnt schlug ich die Iswestija auf und begann mechanisch einen der Artikel zu lesen, aber die winzigen Zeitungsbuchstaben entglitten meinem Blick, und er verlor sich zwischen den Zeilen. Vergeblich versuchte ich mich zu konzentrieren, doch blieb mir der Sinn der Nachricht verborgen hinter den geisterhaft verschlungenen Zweigen und Lianen jener »Selva«, durch die sich die Herren de Aguilar und de Balboa sowie jener namenlose Erzähler schlugen. Nach einigen Augenblicken ertappte ich mich dabei, dass ich wie versteinert auf ein Foto starrte, das einen Artikel über einen riesigen Tsunami in Südostasien illustrierte. Ohne besonderes Interesse überflog ich den Text und legte die Zeitung wieder zusammen.
Viel mehr beschäftigte mich die Frage, warum der Besitzer dieses seltsamen Fragments sich an eine ganz normale Übersetzungsagentur gewandt hatte. In all den Jahren, die ich für dieses Büro arbeitete, war mir noch nie ein derartiger Auftrag untergekommen. Soweit ich wusste, befassten sich mit solchen Büchern ganz andere Leute: Universitätsdozenten zum Beispiel, die irgendwelche Geschichten aus Cortés’ Eroberungszügen bis ins kleinste Detail analysierten und daraus ihre Doktorarbeiten bastelten. Für gewöhnlich verlassen Schriftstücke dieser Art kaum jemals die Magazine wissenschaftlicher Bibliotheken, wo sie hinter Glas in einem besonderen Mikroklima aufbewahrt werden. Natürlich ist anzunehmen, dass einige davon in den Lagern privater Antiquariate untergehen, bis sie irgendwann einmal einem glücklichen Sammler in die Hände fallen. Doch wenn jemand tatsächlich über genügend Mittel verfügte, ein derartiges Buch zu erwerben, warum gab er es dann in die Hände eines namenlosen Übersetzers, der diesen unschätzbaren Band beschädigen oder gar verlieren konnte? Warum bestellte er nicht einen Universitätsdozenten zu sich nach Hause? Der würde die brüchigen alten Seiten sicher mit der gebotenen Ehrfurcht behandeln und wäre zudem in der Lage, nicht nur eine korrekte Übersetzung, sondern auch noch die nötigen Kommentare zu liefern. Wozu diese Arbeit einem Laien anvertrauen?
Vollends unklar war schließlich, wie jener vermeintliche Sammler dieses Buch so gnadenlos hatte zerschneiden können. Überschätzte ich seinen Wert vielleicht? Oder hatte der Besitzer es bereits in diesem Zustand erworben? Oder wollte er nicht, dass ein allzu neugieriger Leser gleich den ganzen Band auf einmal in der Hand hielt?
Endlich war der Tee fertig. Ich goss ihn durch ein kleines Sieb in meine Lieblingstasse, die wie ein Krug mit schmalem Hals geformt war (so blieb der Tee länger warm) und kehrte eilig in mein Zimmer zurück, wo im heißen Licht der Schreibtischlampe jener edle, mir noch immer unbekannte Entdecker auf seinem knarzenden Ledersattel dahinschaukelte und würdevoll darauf wartete, dass ich meine Angelegenheiten beendete und mich erneut zu ihm begab, um seiner Erzählung zu lauschen.
»Dass unsere Abteilung, je weiter wir nach Südwesten vordrangen, zusehends in Schwierigkeit geriet, und die Soldaten, obwohl wir noch genug Lebensmittel für alle hatten, bereits zu murren begannen. Dass ich einen von ihnen befragte und erfuhr, sie hätten bereits von dem Zweck unseres Unternehmens erfahren, was einige sehr verdrossen gemacht habe. Dass sowohl ich als auch die Señores Vasco de Aguilar und Gerónimo Núñez de Balboa sich darob sehr wunderten, denn all die Soldaten, die man uns mitgegeben hatte, waren an weitaus schwierigere Aufgaben gewöhnt; so waren unter ihnen auch einige, mit denen ich selbst mehrere Dörfer aufständischer Ureinwohner niedergebrannt hatte.
Dass der von uns befragte Soldat unverhohlen gestand, dieses Unbehagen sei auf Gerüchte zurückzuführen, die indianischen Götter würden uns alle verfluchen, sollten wir Hand an ihre heiligen Bücher legen. Dass ich wohl ahnte, wer diese Gerüchte verbreitet hatte, doch beschloss, diese Menschen zunächst nicht zu bestrafen, und auch die murrenden Soldaten nicht zur Rechenschaft zu ziehen. Dass Fray Joaquín ihm nur sagte, er solle nicht die Götzenbilder fürchten, seien sie nun aus Holz oder Stein, sondern den Zorn des Herrn, der all jene mit furchtbarer Macht trifft, die vergessen, wer für alle Zeit der einzig wahre Gott ist; und er fügte hinzu, wenn es Satan aber wagen sollte, durch indianische Götter einen Anschlag auf die Christenmenschen zu verüben, so werde die Heilige Jungfrau Maria uns vor aller teuflischer Arglist bewahren.
Dass Fray Joaquín, nachdem der Soldat beschämt von uns gegangen war, darauf beharrte, ihn auspeitschen zu lassen sowie diejenigen, die jenes gotteslästerliche Geschwätz ersonnen hatten, ausfindig zu machen und aufknüpfen zu lassen. Dass jedoch ich sowie die Señores de Aguilar und Núñez de Balboa dem nicht zustimmten, da wir einen Aufstand fürchteten und die Führer nicht zu verlieren wünschten, denn wir waren bereits tief in den Wald eingedrungen. Dass ich stattdessen gegen Abend das Halbblut Hernán González kommen ließ und ihn anwies, er und die anderen Führer sollten nicht mehr dergleichen Reden führen, als ob wir von den indianischen Göttern eine Arglist zu erwarten hätten; es stehe weder ihm noch Gaspar Xiu oder Juan Nachi Cocom als getauften Christenmenschen an, solches zu glauben, und ich drohte ihm mit dem Scheiterhaufen. Dass er mir versicherte, er habe niemals an die Götter der Maya geglaubt noch sie gefürchtet, sondern sei immer unserem Herrn Jesus Christus sowie der Heiligen Jungfrau Maria treu gewesen; doch als er von mir ging, wandte er sich noch einmal um und flüsterte mir zu, ich wisse nicht, was ich tue.
Dass bereits am nächsten Tage das Gerede aufhörte, doch alsbald ein neues Unglück über uns hereinbrach. Dass der breite Weg, dem unsere Abteilung folgte, sich zu verengen begann, bis nur noch ein gewöhnlicher Pfad übrig blieb, auf dem zwar ein Pferd mit Reiter, jedoch kein Fuhrwerk passieren konnte. Dass wir nach einiger Beratung zunächst beschlossen, das Buschwerk und die Bäume am Rande des Pfades zu schlagen, um für die Fuhrwerke den Weg zu bereiten, dies jedoch so viel Zeit kostete, dass wir, selbst als die Soldaten gemeinsam mit den Indios den Weg frei machten, bis Sonnenuntergang nicht mehr als eine halbe Legua vorangekommen waren.
Dass wir aus diesem Grunde am nächsten Tage beschlossen, die Fuhrwerke mit einer Wache und einem Führer an Ort und Stelle zurückzulassen, nachdem wir zuvor um sie herum einen genügend großen Platz frei gemacht hatten zur Verteidigung im Falle eines unerwarteten Angriffs, woraufhin wir mit fünfundzwanzig Mann sowie zwei der Indios unseren Weg fortsetzten, um die Umgebung zu erkunden und herauszufinden, ob das Dickicht bald aufhören würde. Dass wir als Aufenthaltsort für die Fuhrwerke und Wachen einen Platz ausgewählt hatten, an dem einige steinerne Götzen standen, denn dort wuchsen weniger Bäume, was uns weniger Arbeit bescherte. Dass auf dieser Lichtung unter dem Befehl des Señor Gerónimo Núñez de Balboa zehn Armbrustschützen, drei Soldaten mit Arkebusen, zwei Berittene sowie der Indio Gaspar Xiu bei den Fuhrwerken zurückblieben, während die Übrigen mit mir und dem Señor Vasco de Aguilar aufbrachen.
Dass wir vereinbarten, nach drei Tagen oder früher zurückzukehren, sie jedoch insgesamt mindestens eine Woche auf uns warten und sich erst dann nach Maní zurückziehen sollten. Dass Fray Joaquín beschloss, mit uns zu gehen, und die Zurückgebliebenen segnete. Dass wir uns nach Errichtung des Lagers von unseren Kameraden verabschiedeten und am Morgen des nächsten Tages aufbrachen.
Dass ich seither weder den edlen und mutigen Señor Gerónimo Núñez de Balboa noch einen der mit ihm zurückgebliebenen Soldaten jemals wiedergesehen habe, weder tot noch lebendig.«
Ich blickte erneut auf die Uhr: bereits kurz nach vier. Obwohl ich gewöhnlich um diese Zeit in die Küche gehe, um mir ein Abendessen zu machen, verspürte ich diesmal keinen Hunger; alles, was mich interessierte, war die Fortsetzung der Erzählung.
Erst viel später sollte ich die Absicht des Verfassers dieser Seiten begreifen: Seine Geschichte glich einem Sumpf. War man einmal hineingeraten - wozu man das Buch gar nicht unbedingt von Anfang an zu lesen brauchte -, war es schier unmöglich aufzuhören. Der Autor schien zwischen den Zeilen Fangschlingen ausgelegt zu haben, in die er den unvorsichtigen Leser mit geheimnisvollen Verheißungen hineinlockte. Immer wieder deutete er an, welch sagenhafte Dinge ihm widerfahren waren und ließ nicht eine Sekunde lang Zweifel daran aufkommen, dass sich die beschriebenen Ereignisse tatsächlich zugetragen hatten.
Mehr und mehr juckte es mich, die Erzählung nicht weiter Absatz für Absatz zu übersetzen, sondern sie gleich bis zum Ende durchzulesen. Eigentlich tue ich das immer, um zuerst den Gesamtsinn eines Textes zu erfassen. Diesmal aber war die Sprache einfach zu kompliziert, und ich fürchtete, wenn ich über all die unbekannten Wörter hinwegsprang, die mehr als die Hälfte des Textes ausmachten, entging mir womöglich ein wichtiges Detail, das den Schlüssel zum Verständnis aller künftigen Geheimnisse enthielt.
Je weiter ich las, desto klarer wurde mir, dass ich auf ein höchst außergewöhnliches Schriftstück gestoßen war. Aus irgendeinem Grund war ich absolut davon überzeugt, dass es sich hier nicht um irgendeinen Abenteuerroman des 18. oder gar 19. Jahrhunderts handelte, den mir womöglich einer meiner Bekannten zum Spaß untergeschoben hatte. Nein, an diesen Blättern, diesen Buchstaben, diesen Sätzen war alles echt: das ungleichmäßig beschnittene Papier, die unter der Lupe deutlich erkennbaren Unterschiede zwischen den Lettern, die spröde, exakte, militärische Art des Berichts.
Während ich also darüber nachdachte, ob ich in die Küche gehen sollte, um Wasser für die Spaghetti aufzusetzen, kehrten meine Augen, wie von einem Magneten angezogen, an die Stelle zurück, wo ich mit der Übersetzung aufgehört hatte. Die Frage war entschieden.
»Dass wir noch vor Anbruch der Dunkelheit jenen Ort erreichten, wo die Selva aufhörte. Dass wir aus dem Wald hinaus auf das Hochufer eines unbekannten Flusses traten, der nicht sehr breit, doch schnell dahinfloss, mit durchsichtigem Wasser von grüner Farbe. Dass sich an das schräg ansteigende Ufer der anderen Seite offenes Land anschloss, wo nur kurzes Gras wuchs, und in der Ferne Berge mit steilen Felshängen zu sehen waren.
Dass ich und Señor Vasco de Aguilar uns berieten und beschlossen, noch am selben Abend umzukehren und erst dann Halt zu machen, wenn uns die Nacht ereilen würde. Dass während unseres Gesprächs von Nordosten, woher wir gekommen waren, ein fernes Donnern ertönte, welches wir für den Schuss einer Arkebuse hielten, ein Alarmzeichen unserer Kameraden, die bei den Fuhrwerken zurückgeblieben waren. Dass jedoch einer der Führer auf einen Baum stieg, um Ausschau zu halten, und meldete, dass aus jener Richtung, aus der das Geräusch gekommen war, ein Gewitter heranziehe.
Dass die beiden Indios und jene Soldaten, die in Yucatán bereits länger als ein Jahr dienten, sich darüber sehr wunderten, da bis zur Regenzeit noch einige Wochen vor uns lagen und schlechtes Wetter selten war.
Dass nach einiger Zeit von Nordosten dasselbe Geräusch zu hören war, doch diesmal klang es eher wie Donner, da sich seine Quelle in größerer Nähe befand. Dass nach weniger als einer halben Stunde schwarze Wolken den Himmel einhüllten und über dem Ort, an dem wir uns befanden, starker Regen und sodann ein Gewitter einsetzte.
Dass wir aufgrund des Sturms an jenem Tage den Rückweg nicht antreten konnten und beschlossen, dort, wo wir standen, die Nacht zu verbringen. Dass wir aus dem Wald hinaustraten, um ein Lager aufzuschlagen. Dass das Gewitter die ganze Nacht hindurch tobte und direkt über unseren Köpfen Blitze zuckten. Dass einer der Soldaten sich unserem Befehl widersetzte und unter einen Baum flüchtete, wo er vom Blitz getroffen wurde und starb, was den Indios und auch den übrigen Soldaten nicht geringen Schrecken einjagte.
Dass am nächsten Tage der Himmel wieder klar war und die Sonne heiß herabbrannte. Dass wir den toten Soldaten nach christlichem Brauch bestatteten und Fray Joaquín ihm die Totenmesse las und um Vergebung für seine Sünden bat. Dass während unserer Rückkehr an den Ort, wo wir die Fuhrwerke mit der Bewachung zurückgelassen hatten, die Soldaten erneut über die Götzen der Indios sprachen und über den Blitz, der ihren Kameraden getroffen hatte. Dass ich die beiden Führer immer bei mir behielt, um sie davon abzuhalten, derlei Geschwätz zu befördern, die Soldaten aber trotz allem immer weiter davon sprachen.
Dass wir den Weg zum Lager ohne Mühe fanden, obwohl der Boden von dem Regen aufgeweicht war; dass aber bei unserer Ankunft auf jener Lichtung keine Menschenseele zu finden war. Dass ich den Soldaten befahl, an Ort und Stelle zu warten, und sodann gemeinsam mit Señor de Aguilar und den beiden Indios die Lichtung untersuchte sowie den Weg, der von dort in die andere Richtung führte. Dass wir keine Spuren eines Kampfes entdeckten, weder zurückgelassene Dinge noch andere Zeichen noch Abdrücke von Wagenrädern und Hufeisen. Dass ich den Weg weiter entlangritt in der Hoffnung, jemanden aus unserer Abteilung oder wenigstens irgendwelche Spuren zu entdecken, doch selbst nach einer halben Stunde niemanden antraf und zurückkehrte.
Dass die Führer während meiner Abwesenheit etwas entdeckt hatten, das uns anfangs entgangen war, nämlich eine der steinernen Götzenstatuen, die zwischen den Bäumen stand und von dichtem Laub bedeckt sowie ganz mit vertrocknetem Blut beschmiert war. Dass ich sogleich an Gaspar Xiu dachte und ihn des Verrats verdächtigte und gerade den Befehl geben wollte, die beiden anderen zu ergreifen, als mich jedoch, bevor ich dies tun konnte, Señor de Aguilar zu sich rief, der eine kleine Lichtung betrachtete, die etwas weiter von der großen entfernt war.
Dass sich auf dieser Lichtung ein großer quadratischer Stein befand mit einer Vertiefung in der Mitte und Furchen, die von dort aus bis zu den Rändern hin verliefen. Dass auf diesem Stein unser Führer Gaspar Xiu lag, ganz und gar entkleidet, sein Brustkorb aufgeschlitzt und offen, und dass sein Herz herausgerissen worden war und wir es nirgends finden konnten.
Dass wir übereinkamen, den Soldaten nichts davon zu erzählen und den Führern unter Androhung des Galgens verboten, selbiges zu tun, und daraufhin eilends diesen Ort verließen und uns erneut nach Südwesten aufmachten, ohne uns umzusehen.«
Draußen vor dem Fenster rauschte der Regen, doch im Unterschied zur Trockenzeit in Yucatán war dies für Moskau im Oktober nichts Ungewöhnliches. Eilig drehte ich das letzte Blatt um, in der Erwartung, den Beginn des nächsten Kapitels zu erblicken. Stattdessen starrte ein überaus seltsames Wesen mir entgegen, das ziemlich dilettantisch von Hand gezeichnet war. Es war eine hässliche Figur mit langer Nase, die mit ausgestreckten Beinen dasaß und sich mit einer Hand aufstützte. Die andere war nach vorne gestreckt und zeigte mit der Fläche nach oben. Am Hals der Figur hing eine Kette mit einem daran befestigten Talisman. Unter dem Bild war die Aufschrift Chaac zu lesen. Dieses Wort konnte ich in keinem der Wörterbücher finden, weder in jener Nacht noch am nächsten Tag, als ich den Text in der Bibliothek redigierte und Korrektur las.
Als alles fertig war, ergänzte ich meine Übersetzung mit einer wenig überzeugenden Kopie der Zeichnung, versah diese sozusagen zur Rechtfertigung mit der Bezeichnung »Abb. 1« und ließ den Titel unübersetzt. Dann legte ich die Blätter des Originals ordentlich in die Mappe zurück und warf noch einmal einen Blick auf die Zeichnung, bevor ich sie schloss. Der Gnom auf dem Bild grinste triumphierend. Eilig ließ ich das Messingschloss zuschnappen und begann mich anzuziehen.
Auf meinem Tisch lagen zwei identische Papierstapel: die getippte Endfassung meiner Übersetzung des zweiten Kapitels aus einem Buch, dessen Titel ich noch nicht kannte, und daneben ein Durchschlag. Einer der Stapel verschwand zusammen mit der Ledermappe in einer Tüte. In meinem Vertrag stand nirgends etwas davon, dass ich keine Kopie behalten durfte.
LA TAREA
Sowohl an diesem als auch am nächsten Tag trommelte der Regen gegen die Fensterscheiben und peitschte gegen meinen Regenmantel, als ich ins Übersetzungsbüro zurückging, in der Hoffnung, man würde mir dort ein neues Kapitel des Buches aushändigen. Sobald ich die Mappe mit meiner Übersetzung eingereicht hatte, erhielt ich unverzüglich mein Honorar - die komplette Summe. Als ich mich jedoch nach dem nächsten Teil des Auftrags erkundigte, schüttelte der Büroangestellte den Kopf.
»Bislang nichts. Aber ich hätte hier ein paar Verträge über Pralinen- und Zigarrenlieferungen.«
Er zog mehrere Klarsichthüllen mit weißen, bedruckten DIN-A4-Seiten aus einer Schublade und blickte mich schräg an. Offenbar erwartete er, dass ich wie gewohnt vor Dankbarkeit zerfloss.
»Verträge? Ach so …« Ich riss mich zusammen, murmelte ein »Danke« und nahm die Unterlagen an mich. Offenbar war die Enttäuschung meiner Stimme deutlich anzumerken, denn mein Gegenüber wies mich kühl zurecht:
»Aufträge zum dreifachen Honorar gibt’s nun mal nicht am Fließband.«
»Natürlich. Entschuldigen Sie bitte, ich war nur in Gedanken.« Ich war bemüht, meine Erwiderung schuldbewusst klingen zu lassen. In Wahrheit aber überlegte ich bereits, dass diese Verträge eine gute Rechtfertigung wären, nach ein paar Tagen erneut vorbeizukommen und mich zu erkundigen, ob das dritte Kapitel vielleicht schon eingetroffen sei.
»Apropos«, fuhr der Mann fort, und seine Stimme kam mir etwas menschlicher vor. »Was war denn nun in der Mappe? Nachdem Sie weg waren, bin ich doch neugierig geworden.«
»In der Mappe?« Endlich hatte ich mich wieder in der Gewalt und rang mich zu einem Lächeln durch. »Sie hatten Recht: nichts als Archivdokumente.«
»Ja, ja, natürlich«, nickte der Bürohengst. Ich war bereits auf dem Weg nach draußen, da rief er mir unschlüssig hinterher: »Wissen Sie was? Unser ›Spanier‹ hat immer noch nicht abgeliefert. Und ans Telefon geht er auch nicht.«
Ich murmelte etwas Unverfängliches, rannte die Treppe hinunter und flog hinaus auf die Straße. In mir sah es aus wie in einem kleinen Jungen, dem man zu Neujahr ein Feuerwehrauto mit Blaulicht und Sirene versprochen hat - und der nun vor einer mickrigen Packung Knete sitzt.
Ich wusste nicht einmal, ob eine Fortsetzung der Geschichte überhaupt existierte, und wenn ja, ob ihr Besitzer sie derselben Agentur anvertrauen würde, zumal diese offenbar ein Kapitel des Schatzes einem unachtsamen und unzuverlässigen Übersetzer übergeben hatte. Wäre ich an seiner Stelle, ich würde keinen Fuß mehr in dieses Büro setzen. Es galt also, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass die Arbeit an dem Buch zwar ungewöhnlich interessant gewesen war, doch das Leben auch ohne sie weitergehen würde. Und wenn mich die Welt der Indianer, die Maya und die Expeditionsberichte der Konquistadoren so faszinierten, warum kaufte ich mir dann nicht einfach ein paar historische Abhandlungen über Cortés oder eine Chronik der Ureinwohner Südamerikas?
Zu meiner Verwunderung musste ich feststellen, dass in keinem einzigen Buchladen ein seriöses Werk über die Eroberung der Halbinsel Yucatán zur Zeit der Conquista zu erstehen war. Was es gab, waren ziemlich lausige Publikationen wie etwa Die Geheimnisse der Maya-Kultur eines gewissen Reinhard Kümmerling, in dem kein Wort über die Kultur verloren wurde; der Autor begnügte sich mit miserablen Fotos von Schädeln, halb verfallenen Pyramiden und vom Dschungel überwucherten Ballspielplätzen sowie einer genauen Auflistung darüber, in welcher der verlassenen Städte diese Aufnahmen und die archäologischen Funde gemacht worden waren.
Eine zufällige Entdeckung brachte mich schließlich aber doch dazu, das Buch zu kaufen. In seiner Einleitung erwähnte Kümmerling beiläufig den Franziskanerbischof Diego de Landa, der, wie sich herausstellte, eine historisch verbürgte Person war und seinerzeit tatsächlich Vorsteher des Ordens in der Stadt Izamal in Yucatán gewesen war. Daneben ging er kurz auf ein gewisses Autodafé in Maní ein, infolgedessen Landa nach Spanien abberufen wurde, wo die höchsten geistlichen Instanzen seinen Fall verhandelten. Später jedoch wurde sein Vorgehen als begründet anerkannt, und Landa kehrte nach Yucatán zurück, das ihm inzwischen zur zweiten Heimat geworden war, um auf seine alten Tage das verdiente Amt des Bischofs anzutreten.
Leider ging der Text nicht genauer auf die Ereignisse rund um den Guardian des Franziskanerklosters ein, obwohl der Name Diego de Landa noch an einigen weiteren Stellen auftauchte, zumeist wenn es um die Entzifferung der Schriftzeichen ging, derer sich die Indianer der Maya-Kultur bedienten. Er schien als erster Europäer gelernt zu haben, sie zu lesen.
Landas Dekodierungssystem erwies sich später jedoch als fehlerhaft. Die Macht des Alphabets hatte den alten Mann zu der Annahme verleitet, die ganze Welt müsse eine vergleichbare Zeichensprache verwenden, auch die Bewohner Yucatáns. Dem von ihm entwickelten, ausgefeilten System zufolge gab es für die »Buchstaben« der yukatekischen Sprache phonetische Entsprechungen, die dem spanischen Ohr geläufig waren. In Die Geheimnisse der Maya-Kultur führte Kümmerling eine vollständige Auflistung dieser Zeichen auf einer Doppelseite an - wohl hauptsächlich um Platz zu schinden, denn schon auf der nächsten Seite verwarf er Landas System, indem er die Kommentare moderner Sprachforscher zitierte: Die Zeichen der yukatekischen Sprache repräsentierten nicht bestimmte Laute, sondern erwiesen sich als Hieroglyphen mit jeweils eigener Bedeutung.
Ich musste an die von seltsamen Zeichen übersäten Stelen denken, von denen der Autor des Berichts gesprochen hatte. Angeblich hatte er Landa persönlich gekannt, und dieser hatte behauptet, er könne das Yukatekische entziffern. Kümmerlings Büchlein war natürlich nur einer der vielen Versuche, einem Publikum, das sich in erster Linie für UFOs und Loch-Ness-Monster interessierte, die Ergebnisse langwieriger archäologischer Forschung in einer möglichst aufregenden Verpackung zu verkaufen. Doch die scheinbar wertlose Schale barg einen unschätzbaren Kern, ein
Titel der russischen Originalausgabe СУМЕРКИ
Deutsche Erstausgabe 10/2010
Redaktion: Maria Peek
Lektorat: Sascha Mamczak
Copyright © 2007 by Dmitry Glukhovsky unter Vermittlung der Nibbe & Wiedling Literary Agency
Copyright © 2010 des Nachworts by David DrevsCopyright © 2010 der deutschen Ausgabe und der Übersetzungby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbHwww.heyne.de
Satz: C. Schaber Datentechnik, Wels
eISBN: 978-3-641-06021-3
Leseprobe
www.randomhouse.de