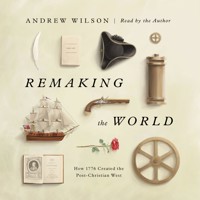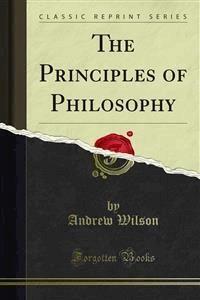6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mehr Leben passt in kein Buch Darf man für die Liebe zu Gott die Liebe zu den Menschen opfern? Peter Prange erzählt die schicksalhafte Lebensreise der Gracia Mendes, einer der außergewöhnlichsten Frauen der europäischen Renaissance. Obwohl eine gläubige Jüdin muss sie aus Angst vor der Inquisition wie eine Christin leben. Damit nicht genug, wird sie mit einem Mann verheiratet, der skrupellos Profit aus der Not seiner jüdischen Glaubensbrüder schlägt. Doch schon in der Hochzeitsnacht wird der vermeintliche Verräter zur großen Liebe ihres Lebens. Unter der grausamen Gewaltherrschaft der Inquisition aber wird Gracia gezwungen, quer durch den brodelnden Kontinent zu fliehen. Die Reise der Gottessucherin beginnt, die Reise einer Kämpferin, die Königen und Päpsten die Stirn bieten wird. Die Gottessucherin von Peter Prange: als eBook erhältlich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Andrew Wilson
Mit gespaltener Zunge
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Judith Schwab
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Dies ist nicht das Buch, das ich schreiben wollte.
So war es überhaupt nicht geplant.
I
Wohin ich auch ging, sah ich ein Fragezeichen im Herzen der Stadt. Das erste Mal passierte es am Flughafen, als ich am Gepäckband stand und wartete. Ich holte meinen Reiseführer aus der Tasche, schlug die hintere Klappe auf, wo sich der Stadtplan befand, und der Umriss sprang mir buchstäblich ins Auge: der Canal Grande, der sich wie eine symbolgewordene Frage durch die dicht besiedelte Stadt schlängelte.
Ich sah mich um und fragte mich, was all diese Leute nach Venedig führte. Ein junger Chinese schaute konzentriert auf sein Handy, während er eine neue SIM-Karte einlegte. Eine hübsche dunkelhäutige Frau nahm ihre Brille ab, zog einen kleinen Spiegel aus ihrer Jackentasche und setzte sich fischschuppendünne Kontaktlinsen ein. Ein glatzköpfiger Mann, auf dessen rasiertem Schädel sich die grellgelben Lampen der Flughafenbeleuchtung spiegelten, wartete ungeduldig auf sein Gepäck. Seine Augen sprangen nervös umher.
Ich wusste, warum ich hier war. Als ich meine Lage mit der meiner Freunde in London verglich, die gerade mit irgendwelchen langweiligen Postgraduiertenstudiengängen begannen oder für einen Hungerlohn in einem sogenannten kreativen Beruf arbeiteten, musste ich lächeln. Mein bester Kumpel Jake hatte kürzlich einen Anfängerjob bei den Klatschseiten einer Zeitung angenommen und war so abgebrannt, dass er sich von Billigwein und kostenlosen Häppchen auf Partys ernähren musste. Ich hatte Besseres vor.
Während meines letzten Semesters an der Uni hatte ich den Leuten – was vielleicht keine gute Idee war – erzählt, dass ich einen Roman schreiben wollte. Doch in London gab es zu viele Dinge, die mich ablenkten. Alles, was ich brauchte, war Zeit zu schreiben. Und die würde ich jetzt finden.
Vor einigen Monaten hatte Jake erwähnt, ein Freund seines Vaters, ein italienischer Investor, suche jemanden, der in Venedig das Englisch seines sechzehnjährigen Sohnes aufbessern könne. Das war eine perfekte Gelegenheit. Morgens würde ich Antonio unterrichten und hatte dann für den Rest des Tages ausreichend Zeit, um an meinem Buch zu arbeiten, das, wie ich beschlossen hatte, in Venedig spielen sollte. Nach einem etwa halbstündigen Gespräch am Telefon und einer Salve von E-Mails hatte man mir den Job angeboten. Toll bezahlt war er nicht, etwa dreihundert Euro im Monat, aber die Unterkunft war kostenlos. In ein paar Tagen würde ich anfangen. Ich konnte mein Glück kaum fassen.
Nachdem ich mein Gepäck abgeholt und es auf einem Wagen verstaut hatte, trat ich in die warme Abendluft hinaus. Ein rosa schimmernder Mond stand am Himmel. Ich folgte den anderen Reisenden zu der Anlegestelle der Vaporetti. Der Weg führte durch eine Reihe von wackeligen Plastiktunnels, in denen sich die warme Luft dermaßen staute, dass ich das Gefühl hatte, sie verbrenne mir beim Atmen die Kehle. Während ich mich der Haltestelle Alilaguna näherte, hörte ich das Klatschen der Wellen, die auf die Mole trafen. Vor meinem inneren Auge tauchte klares, erfrischendes Wasser auf, doch was ich sah, schockierte mich – eine Brühe, die mehr an Teer erinnerte als an Wasser, dick und zäh und mit einem schmierigen Film bedeckt, in dem allerlei Unrat dümpelte. Eine tote Taube trieb auf der Wasseroberfläche, der Kadaver schaukelte sanft im Auf und Ab der Wellen. Mit der Strömung schwappte sie auf die Mole zu. Sie hatte keine Augen mehr.
Auf die nächste Barkasse musste ich nicht lange warten. Ich kaufte mir eine Fahrkarte an Bord und begann meine etwa einstündige Fahrt durch die dunkle Lagune. An der Haltestelle bei San Marco hievte ich mein Gepäck an Land und studierte den Stadtplan. Da war es wieder, das Fragezeichen. Rasch hatte ich die winzige Gasse direkt hinter der Piazza gefunden, versuchte mir ihre Lage einzuprägen und marschierte quer über den Platz. Um mich herum war nur das unablässige Flattern der Tauben zu hören – ein Geräusch, das irgendwie spöttisch klang.
Das Hotel war klein und schäbig. Es roch nach abgestandenem Rauch und undichten Rohren. Der Besitzer, ein winziges Männchen mit teigigem Gesicht, durchscheinender Haut, schwarzem, strähnigem Haar und einem deutlichen Überbiss, fixierte mich mit fiesen Knopfaugen. Er streckte mir die rechte Hand entgegen, die in einem schwarzen Lederhandschuh steckte, und reichte mir meinen Zimmerschlüssel, Nummer dreiundzwanzig im obersten Stockwerk. Ich lächelte ihm zu, stieg die Treppe hinauf und öffnete die Tür. Alte Holzbalken zogen sich quer über die Zimmerdecke. Auf der pfirsichfarbenen Tapete prangten große feuchte Flecken, und das Bettzeug sah so aus, als wäre es nicht frisch gewaschen. In dem winzigen Waschbecken hockte eine Kakerlake. Aber schließlich war es nur für eine Nacht. Morgen würde ich in die Wohnung der Gondolinis umziehen, die in der Nähe des Arsenale lag. Und am Tag darauf würde ich mit meinem Roman anfangen.
Da ich erst um vier Uhr mit Signor und Signora Gondolini verabredet war, hatte ich mehr oder weniger den ganzen Tag zur Verfügung, um mir die Stadt anzuschauen. Nach dem Frühstück bezahlte ich meine Hotelrechnung und vereinbarte, dass ich mein Gepäck später abholen würde. Obwohl ich noch nie in Venedig gewesen war, verfügte ich über eine ziemlich klare Vorstellung von der Stadt – ein ausgeklügeltes Bühnenbild, das auf dem Wasser trieb, eine architektonische Traumlandschaft. Doch an diesem Tag war die unleugbare Schönheit Venedigs – der Stadt, die ich aus Reiseführern und Filmen kannte – von grellweißem Sonnenlicht ausgeblichen und überdeckt von einer unglaublichen Masse an Touristen. Reiseleiter hoben bunte Regenschirme in die Höhe und versuchten verzweifelt, mit ihren Stimmen das vielsprachige Geplapper ringsum zu übertönen. Übergewichtigen rann der Schweiß aus allen Poren. Frauen in ihrem besten Modeschmuck drückten schicke Goldtäschchen an sich und versuchten die Fassung zu bewahren, wenn sie sich geklonten Versionen ihrer selbst gegenübersahen. Viele der Ehemänner starrten blicklos vor sich hin, ihre Augen wirkten wie tot.
Ich bahnte mir einen Weg in Richtung Riva und kämpfte mich am Ufer entlang. Mit dem Stadtplan in der Hand überquerte ich den Rio del Vin, wandte mich nach links und ließ endlich die Menschenmassen hinter mir. Mein Ziel war der Campo San Zaccaria, wo der Legende nach am Michaelitag der Teufel erschienen war und gerade im Begriff stand, mit seinem Höllenwagen eine junge Braut zu entführen, als ihr Bräutigam wie der Löwe von San Marco brüllte und ihn damit verscheuchte. Ich wusste nicht, ob es stimmte, hatte aber gelesen, dass sich alljährlich junge Männer auf dem Platz versammelten, um das Ritual neu aufleben zu lassen und sich der Treue ihrer zukünftigen Ehefrauen zu versichern. Ich dachte an Eliza in London, stellte mir vor, wie sie mit Kirkby ins Bett ging. Er hatte einen gebrochenen Arm, und ich sah ihn vor mir, wie er sie vögelte, den Arm in der Schlinge an die Brust gedrückt, als stillte er einen Säugling.
Ich stieß die hölzerne Tür der Kirche auf und trat in das abgedunkelte, kühle Innere des Gotteshauses. Eine ältere Frau kniete mit gesenktem Kopf und geschlossenen Augen neben einer Kirchenbank und betete lautlos. Ihre papierdünnen Lider flatterten und zuckten, als hätte sie sich gerade erst aus dem Bett aufgerappelt und träumte noch. Ich umrundete sie und blieb vor Bellinis Sacra Conversazione stehen, das manchmal auch Madonna mit vier Heiligen genannt wird. Während meines Studiums der Kunstgeschichte hatte ich mir dieses Altarbild oft in meinen Lehrbüchern angeschaut. Jetzt nahm ich eine Münze und warf sie in den Schlitz. Künstliches Licht überflutete das Gemälde, beleuchtete den Engel, der zu Füßen der thronenden Muttergottes mit ihrem Kind saß und auf einem Saiteninstrument spielte, während das Jesuskind den vier Heiligen unter ihm die kleine Hand entgegenstreckte, um sie zu segnen. Da waren Petrus mit seinen Schlüsseln und dem Buch, die heilige Katharina mit dem Symbol ihres Martyriums, dem zerbrochenen Rad, der Kirchenvater Hieronymus, der ganz in Rot gekleidet war und ein weiteres dickes Buch in Händen hielt, und die heilige Lucia mit dem kleinen Glas, in dem sich der Legende nach ihre Augen befanden, die ihr von Diokletian herausgerissen worden waren. Ich stellte mir die kleinen Kugeln vor, die im Salzwasser schwammen, die Pupillen geweitet vor Entsetzen und Angst.
Als sich das Licht wieder ausschaltete, ging ich an dem Altar vorbei, der angeblich die sterblichen Überreste des heiligen Zacharias, des Vaters von Johannes dem Täufer, enthielt, und den rechten Gang entlang zur Kapelle des heiligen Athanasius. Ein Mann mit einer großen, dunklen Brille, die ihm das Aussehen einer Stubenfliege verlieh, saß hinter einem Tisch. Ich fragte ihn auf Italienisch, wie viel der Eintritt kostete, aber er gab mir keine Antwort, sondern wies nur stumm auf ein Schild, auf dem stand, die Gebühr betrage einen Euro. Ich reichte ihm eine Münze, und er winkte mich durch. Ringsum an den Wänden, über dem Chorgestühl aus dem fünfzehnten Jahrhundert, hing eine Reihe von Gemälden, darunter eine Darstellung der Geburt von Johannes dem Täufer, ein Frühwerk Tintorettos; eine Szene mit David und Goliath von Jacopo Palma dem Jüngeren; und, über der Tür, das Bild eines Märtyrers, dem von einem Schergen mit einer Art Schüreisen die Augen ausgestochen wurden.
Ich wanderte zur nächsten Kapelle und bewunderte die goldenen Altarbilder von Vivarini und d’Alemagna sowie die Fresken des Florentiner Künstlers Andrea del Castagno. Durch eine gläserne Fliese im Boden sah ich auf einige Mosaiken in der unteren Ebene, die noch aus dem neunten Jahrhundert stammten, und gelangte über ein paar Treppenstufen hinab in die Krypta, in der gerade mehrere Zentimeter hoch das Wasser stand. Nur ein kurzer Augenblick in dem modrig riechenden Raum mit seinen Säulenreihen und Bögen, die sich im Wasser spiegelten, und ich fühlte mich so bedrängt und eingeschlossen, dass ich rasch wieder hinaus musste. Auch mein Rückweg führte durch die Kapellen zur Hauptkirche und schließlich den Mittelgang entlang zur Tür.
Bei einem Espresso studierte ich meinen Reiseführer. Ich wollte mir noch San Marco und den Dogenpalast ansehen, doch da ich keine Lust auf die Menschenmassen hatte, die sich rund um den Platz drängten, beschloss ich, mich stattdessen auf den Weg zur Accademia zu machen. Um die Hauptwege zu meiden, wählte ich eine Reihe von kleinen Nebengassen, von denen manche so schmal waren, dass niemals die Sonne hineinschien, und kam schließlich in der Nähe des Campo Santo Stefano aus dem Gassengewirr heraus. Ich überquerte die Accademia-Brücke und blieb kurz stehen, um auf den Canal Grande zu schauen. Doch als ich die Treppe herunterkam, sah ich die Menschenschlange vor dem Eingang des Museums. Auf eine lange Wartezeit hatte ich keine Lust, weil ich den Gedanken unerträglich fand, so dicht gedrängt mit all den anderen Menschen zu stehen, und so beschloss ich, mich stattdessen auf den Weg zu Santa Maria Gloriosa dei Frari zu machen, einer weiteren Kirche, mit der ich mich in meinem Seminar beschäftigt hatte und die nördlich von hier in San Polo lag. Als ich über den Campo Santa Margherita schlenderte, stieg mir ein köstlicher Duft nach gebratenem Knoblauch, frischen Tomaten und gehacktem Basilikum in die Nase, und ich schaute auf die Uhr. Es war fast eins, Zeit zum Mittagessen, und so nahm ich in einem der Cafés an der Piazza Platz. Nach einem Teller billiger spaghetti al pomodoro schaute ich mich in aller Ruhe um und genoss jede Einzelheit des Geschehens auf dem Platz. Zwei kleine Jungen spielten Fußball und quietschten dabei vor Freude. Das Geräusch des Balles, wenn er auf den Boden traf, war wie ein Echo meines Herzschlags. Hausfrauen hielten ein Schwätzchen mit Männern in langen Schürzen, die in einer Reihe von überdachten Ständen Oktopus, Krabben, Seespinnen und Fische feilboten. Junge Paare gingen händchenhaltend spazieren, fütterten sich gegenseitig mit Eiscreme in den abenteuerlichsten Farben und vermischten beim Küssen die Aromen auf ihren Lippen. Alles um mich herum war so lebendig, so neu. Und ich würde bald ein Teil davon sein.
Ich trank noch einen Kaffee, beglich meine Rechnung und machte mich auf den Weg zur Frari-Kirche. Im Inneren des riesigen, T-förmigen Gotteshauses war nur das leise Schlurfen von Füßen auf dem Marmorboden und das gedämpfte Murmeln eines Stadtführers weiter hinten zu hören. Ich ging an einem neoklassizistischen Mausoleum für Canova vorbei, einer Art Pyramide, in der das Herz des großen Bildhauers aufbewahrt wurde, und stand schließlich vor Tizians Madonna des Hauses Pesaro, einem Porträt Jacopo Pesaros, der der Jungfrau Maria mit dem Kinde seine Aufwartung macht. An der Uni hatte man uns erklärt, das Bild habe die venezianische Altarmalerei auf revolutionäre Weise erneuert, weil der Künstler beschlossen hatte, die Muttergottes aus der traditionellen Position im Zentrum des Bildes auf die Seite zu verschieben, doch zugleich auch wegen der großen Menschlichkeit des Bildes, der rührenden und realistischen Weise, mit der Tizian seine Figuren dargestellt hatte.
Während ich das Gemälde betrachtete und immer wieder ein paar Schritte vor und zurück trat, um das tiefe Blau des Gewandes von Petrus und die innere Harmonie der Komposition des Gemäldes zu bewundern, machte mich die Abbildung eines kleinen Jungen in weißem Satin am rechten unteren Bildrand zunehmend unruhig. Wohin auch immer ich mich bewegte, schienen mich die seltsam vorwurfsvollen Augen des Kleinen zu verfolgen, als wollte er mich daran erinnern, dass auch ich eines Tages sterben würde, so wie er. Obwohl ich mir Mühe gab, auch Tizians zweites Meisterwerk, die Assunta – eine Darstellung der Himmelfahrt Mariä – zu würdigen, das über dem Hochaltar prangte, ebenso wie die übrigen Kunstschätze der Kirche, ihre Grabmäler und Gedenksteine, war es um meine Konzentration geschehen. Das Gesicht jenes Jungen ließ mich nicht mehr los.
Kurz nach drei machte ich mich auf den Weg zu den Gondolinis. Ich marschierte zu der Vaporetto-Haltestelle San Toma am Canal Grande und drängelte mich mit vielen anderen Fahrgästen an Bord des Wasserbusses. Mühsam arbeitete ich mich zum hinteren Teil des Bootes vor und konnte direkt nach der Accademia sogar einen Sitzplatz im Heck ergattern. Das Wasser schimmerte wie Quecksilber im Sonnenlicht, und auf den Häuser lag ein traumähnlicher Glanz. Während das Boot sich von der Haltestelle San Zaccaria entfernte, spiegelten sich in den Glaswänden, die den inneren Fahrgastbereich des Bootes vom äußeren trennten, der Campanile und die Kuppel von Santa Maria della Salute. Langsam wurde mir von dem ständigen Schaukeln des Bootes ein wenig schwindelig, ein Gefühl, das sich auch nicht legte, als ich schließlich beim Arsenale wieder festen Boden unter den Füßen hatte.
Man hatte mir gesagt, die Familie lebe in den ausgedehnten Räumlichkeiten eines renovierten Lagerhauses, nicht weit entfernt von der Corderia, der früheren Seilfabrik. Während ich mich der Gegend näherte, die in Zukunft mein Zuhause sein würde, bemerkte ich, dass Touristen hier deutlich seltener anzutreffen waren. Nach einem kurzen Blick auf meinen Stadtplan fand ich schließlich die angegebene Straße und stand kurz darauf vor dem Haus der Gondolinis, einem riesigen Backsteingebäude, das direkt an einem kleinen Kanal lag. Ich drückte auf den Klingelknopf und wartete. Niemand antwortete. Ich klingelte noch einmal. Immer noch nichts. In meiner Tasche kramte ich nach der E-Mail von den Gondolinis. Es war die richtige Adresse. Vielleicht war die Familie ja ausgegangen. Erst als ich den Finger noch einmal auf den Klingelknopf legte und ihn mehrere Male kurz hintereinander betätigte, klickte es, und die Tür ging auf.
Im Treppenhaus war es dunkel, und ich tastete mich vorsichtig vorwärts, um einen Lichtschalter zu suchen. Gerade hatte ich ihn gefunden, als von oben eine Männerstimme ertönte.
»Adam Woods? Sind Sie das, Adam? Wir sind hier oben.«
Das war offenbar Niccolò Gondolini. Vielleicht war er im Bad oder am Telefon gewesen. Ich stieg die hölzerne Treppe hinauf und musste immer wieder anhalten, um mich an der Wand entlangzutasten, bis sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Als ich im zweiten Stock ankam, sah ich eine offene Tür. Ich blieb einen Moment stehen, bevor ich eintrat. Ein Mann stand mit dem Rücken zu mir an einem Fenster auf der anderen Seite des Zimmers, scharf umrissen von dem blendend hellen Licht. Ich schirmte meine Augen ab.
Bevor ich etwas sagen konnte, hörte ich hinter mir das Klacken von hochhackigen Schuhen auf dem Marmorboden. Als ich mich umdrehte, stand mir eine Frau gegenüber. Zierlich und wohlgeformt wie sie war, erinnerte alles an ihr an eine Puppe. Sie musste bereits mittleren Alters sein, doch ihr Alabastergesicht war auf sonderbare Weise frei von Falten.
»Adam – ich frrreue mich, dass Sie kommen konnten«, begrüßte sie mich. Sie sprach Englisch mit starkem Akzent und schien sich beim Sprechen an den Worten entlangzutasten, wie jemand, der sich in einem Flussbett seinen Weg über eine Reihe glitschiger Steine sucht. »Auch Niccolò ist frrroh, dass Sie hierr sind.«
Während wir uns die Hand schüttelten, wies sie auf ihren Mann, der immer noch am Fenster stand. Er drehte sich um und kam auf mich zu.
Wie seine Frau hatte auch Niccolò Gondolini ein makelloses Äußeres; er war tief gebräunt und trug sein öligschwarzes Haar aus der Stirn gekämmt. An seinem Handgelenk prangte eine wuchtige Armbanduhr mit Diamanten rund um das Zifferblatt.
»Bitte – hier entlang«, sagte er und wies in Richtung eines Zimmers, das vom Flur abging. Er runzelte die Stirn, vielleicht weil es ihm nicht leichtfiel, Englisch zu sprechen. Ich erklärte ihnen, ich verstünde etwas Italienisch und könne, wenn sie langsam sprachen, durchaus einem Gespräch folgen, weshalb wir uns von da an in ihrer Sprache unterhielten.
Wir betraten einen Raum, der an einen weißen Kubus erinnerte und nur mit einem flachen, grauen Sofa und einem Stuhl mit hoher Lehne möbliert war. Die Wände waren nackt, ohne auch nur ein einziges Gemälde oder Bücherregal.
»Sie können hier sitzen«, schlug Signor Gondolini vor und zeigte auf das Sofa. Seine Frau lächelte mir aufmunternd zu, aber ich spürte deutlich, dass da etwas nicht stimmte. Niccolò senkte den Blick zu Boden.
»Ich fürchte, wir haben da … äh …«, begann Signor Gondolini, »ein kleines Problem.«
»Ja«, bestätigte seine Frau. »Nun, am besten kommen wir gleich zur Sache. Anscheinend können wir Ihnen nämlich doch keinen Job anbieten, Mr.Woods.«
»Wie bitte?«, fragte ich.
Signora Gondolini wandte sich ihrem Mann zu. Offenbar erwartete sie, dass er dies näher erklärte. Er vermied jeglichen Blickkontakt mit mir.
»Wo liegt das Problem?«, fragte ich.
Der Mann blieb stumm.
»Nun, es ist so«, sagte seine Frau. »Das Ganze ist … nun, wie soll ich sagen … eher peinlich. Alles war für Sie bereit, und Antonio hatte sich wirklich darauf gefreut, dass Sie hierherkommen würden. Aber dann haben wir etwas erfahren; es ist – nun, ein wenig – delikat.«
Wieder trat eine Pause ein, während das Paar Blicke tauschte. Niccolò nickte kurz in ihre Richtung, als gebe er seiner Frau die Erlaubnis, fortzufahren.
»Allem Anschein nach hat unser Sohn eine ziemliche Dummheit gemacht«, berichtete sie. »Gestern am späten Abend erhielten wir einen Anruf vom Ehemann unseres Hausmädchens. Kaum hatten wir den Hörer abgenommen, fing er an zu schreien und zu schimpfen. Ich sagte, er solle sich beruhigen und alles der Reihe nach erzählen. Aber er beschimpfte Antonio aufgebracht mit schrecklichen, schmutzigen Wörtern, die ich Ihnen nicht zu wiederholen brauche. Er sagte … dass sich Antonio offenbar mit seiner Tochter Isola getroffen hat. Gestern Morgen war sie nicht aufgestanden. Als ihre Mutter nachschaute, was denn los sei, da weinte sie. Zuerst weigerte sie sich, es ihr mitzuteilen, aber dann platzte sie damit heraus – dass sie schwanger ist. Und sie behauptet, das Kind sei von Antonio.«
Sie hatte die Stimme zu einem Flüstern gesenkt und war so leise geworden, dass ich mich ein wenig zu ihr beugen musste, um sie zu verstehen. Sie roch schwach nach Geißblatt.
»Adam – sie ist erst vierzehn Jahre alt und …«
»Sie können sich also vorstellen, was wir getan haben«, unterbrach Niccolò sie. »Wir haben ihn befragt, wollten wissen, ob das stimmt. Und tatsächlich, er war mit Isola zusammen gewesen, und sie hatten … nun, sie hatten eine Art Beziehung. Schließlich meinte er noch, er würde zu ihr stehen – eine lächerliche Idee. Dieser dumme Junge! Sechzehn ist er gerade erst geworden. Sein ganzes Leben liegt noch vor ihm. So ein Blödsinn!«
»Es war wirklich ein ziemlicher Aufruhr – das können Sie sich doch vorstellen, Adam, oder?«, fragte die Frau. »Aber wir können einfach nicht zulassen, dass er sein Leben wegwirft. Deshalb haben wir heute Morgen alles in die Wege geleitet, dass er nach New York fliegt und eine Weile bei meiner Schwester lebt. Natürlich ist das mit Isolas Eltern alles noch ziemlich chaotisch – es wird weiß Gott unmöglich sein, Maria noch länger hier zu beschäftigen –, aber wir müssen irgendwie eine Lösung finden. Doch ich befürchte, für Sie sind das keine guten Nachrichten, nicht wahr?«
Für mich war gerade meine neue Welt zusammengebrochen, und ich spürte, wie ich langsam wütend wurde, nickte aber dennoch mitfühlend.
»Natürlich kann man da nichts machen«, meinte ich. »Ich suche mir etwas anderes. Wie Sie bereits sagten, mussten Sie ja das tun, was für Antonio am besten ist. Und vermutlich kann er sein Englisch in New York ebenso gut verbessern, als wenn er hier bei mir Unterricht gehabt hätte.«
»Ich bin so froh, dass Sie das verstehen, Adam«, versicherte sie. »Das ist sehr freundlich von Ihnen. Niccolò und ich haben uns schreckliche Sorgen gemacht, was Sie wohl sagen würden. Wir haben uns einfach verantwortlich gefühlt.«
Niccolò griff mit seiner großen Hand in eine seiner Taschen und zog ein Portemonnaie hervor.
»Wir bezahlen Ihnen den ersten Monat – das ist das Mindeste, was wir tun können«, erklärte er. »Und wenn es noch etwas anderes gibt, das Sie brauchen, lassen Sie es uns einfach wissen.«
Ich nahm die dreihundert Euro. Damit würde ich nicht weit kommen, das wusste ich, aber ich lächelte dennoch und dankte ihm.
»Was werden Sie tun?«, erkundigte sich Signora Gondolini. »Fahren Sie zurück nach London? Wir könnten Ihnen auch den Flug bezahlen, meinst du nicht, Niccolò?«
»Sí, sí, natürlich«, erwiderte er. »Machen Sie ein paar Tage Ferien hier und sagen Sie uns einfach, wann Sie bereit sind. Wir besorgen Ihnen dann ein Ticket.«
Doch was hatte mir Großbritannien schon zu bieten? Eine gescheiterte Beziehung und die Aussicht auf einen Sommer, den ich bei meinen Eltern in Hertfordshire verbringen würde. Und ich musste meinen Roman schreiben. Als ich meinem Vater von meinen Absichten erzählt hatte, hatte er nur verächtlich gegrinst. Nein, ich musste hier bleiben.
»Ich glaube, ich werde mich erst einmal eine Weile hier in Venedig aufhalten«, erwiderte ich. »Wahrscheinlich versuche ich einfach, einen anderen Job zu bekommen. Mir ist noch nicht danach, schon wieder nach Hause zu fahren und …«
Signora Gondolini sprang von ihrem Stuhl auf, was die Spitzen ihres perfekt geschnittenen Bobs in Schwingungen versetzte. Ihre winzigen Hände flatterten wie Schmetterlinge, als sie sprach.
»Niccolò – Niccolò«, rief sie begeistert. »Ich hab’s!«
»Cosa?« Ihr Ehemann musterte sie irritiert.
»Den perfekten Job – für Adam«, antwortete sie und wandte sich mir zu. »Ich kann gar nicht glauben, dass mir das nicht schon vorher eingefallen ist.«
Sie holte ein paar Mal tief Luft und hob erneut an.
»Du erinnerst dich doch an den englischen Gentleman, für den Maria manchmal Besorgungen macht?«
Ihr Ehemann schaute sie ratlos an.
»Du weißt doch – der, der nie aus dem Haus geht. Der Schriftsteller – wie heißt er noch? – Gordon, Gordon – Crace. So heißt er. Der vor Jahren dieses Buch geschrieben hat und dann nichts mehr.«
Es war deutlich zu sehen, dass Niccolò immer noch keine Ahnung hatte, wovon seine Frau so aufgeregt schnatterte. Offenbar war er der Ansicht, er habe seine Verpflichtungen erfüllt, und damit sei von seiner Seite aus die Sache erledigt. Er war ein wohlhabender Mann, der sein Gewissen damit erleichtert hatte, dass er mir einen Monat Lohn bezahlt und die Übernahme der Flugkosten angeboten hatte. Jetzt wollte er mich einfach nur loswerden. Zweifellos fing mein schäbiges Äußeres an, ihn in seiner eleganten Umgebung zu stören.
»Sind wir ihm denn je begegnet?«
»Nein – ich sagte dir doch, dass er seit Jahren nicht mehr ausgeht«, erwiderte sie. »Aber Maria hat erzählt, er wird langsam ein wenig … klapperig und braucht Gesellschaft. Jemanden, der die Einkäufe für ihn erledigt. Ab und zu Besorgungen für ihn macht. Das Haus sauber hält. Könnte das denn etwas für Sie sein, Adam?«
Um ehrlich zu sein, klang für mich alles verlockend, das es mir ermöglichte, in Venedig zu bleiben, und ich war sehr interessiert.
»Ja, natürlich, das klingt großartig«, antwortete ich.
Plötzlich fiel ein Schatten über ihr Gesicht.
»Gibt es ein Problem?«, fragte ich.
»Nun, es könnte eins geben«, überlegte sie. »Am besten wäre es, über Maria Kontakt zu ihm aufzunehmen. Aber unsere Beziehung ist momentan natürlich etwas … angespannt. Wie Sie sich vorstellen können, ist sie uns nicht sehr freundlich gesinnt, und ich habe meine Zweifel, ob sie überhaupt zurückkommt.«
»Ja, verstehe.«
»Aber ich gebe Ihnen seine Adresse. Maria hat sie mir einmal aufgeschrieben, damit wir uns wegen einer Empfehlung an ihn wenden konnten, aber erinnerst du dich, ob wir überhaupt jemals eine Antwort von ihm bekommen haben?« Niccolò schüttelte den Kopf. »Vielleicht sollten Sie ihm trotzdem einfach mal schreiben. Ich glaube nicht, dass er Telefon hat.«
Sie ging durch das Zimmer auf den Flur hinaus und kam mit einem Stück Papier und einem Füllfederhalter zurück. Die Tinte, die aus der Spitze floss, malte große, geschwungene Kringel auf das leere Blatt. Sie reichte mir den Zettel, und ich las die Adresse: Palazzo Pellico, Calle delle Celle. Ich muss etwas verwirrt dreingeschaut haben, denn ehe ich mich versah, holte Signora Gondolini einen Stadtplan herbei.
»Schauen wir mal, ob wir das für Sie finden können«, sagte sie.
Vielleicht war es ja nur Einbildung, aber ich war felsenfest davon überzeugt, dass ihr Finger ein unsichtbares Fragezeichen auf die Karte malte, als er sich langsam über den Plan bewegte.
Da ich den Gedanken nicht ertragen konnte, in jenes Rattenloch von Hotel zurückzukehren, folgte ich einer Empfehlung der Gondolinis und begab mich zu einer billigen, aber sauberen Pension in Castello. Tatsächlich hatte man dort ein Zimmer für mich – nichts Besonderes, aber wenigstens sträubten sich mir hier vor Ekel nicht bei jeder Berührung die Nackenhaare. Nachdem ich ausgepackt hatte, bat ich um ein Blatt Papier und ein Kuvert, setzte mich in eine kleine Bar und schrieb einen Brief, in dem ich den menschenscheuen Gordon Crace um einen Job bat.
Bevor ich die Gondolinis verließ, hatte mich die Signora über die zwar nur kurze, aber dennoch recht spektakuläre literarische Karriere von Gordon Crace in Kenntnis gesetzt. Sein erster und einziger Roman, Der Debattierclub, war in den Sechzigern veröffentlicht worden und eine Sensation gewesen. Die Kritiker hatten ihn mit großem Lob bedacht, und er war in alle wichtigen Sprachen übersetzt worden. Sowohl der Verlag als auch Leser in der ganzen Welt hatten auf ein zweites Buch gewartet – Crace sei nichts anderes gewesen als ein Star, una stella, berichtete sie –, aber er habe nie wieder einen Roman zustande gebracht, zumindest keinen veröffentlicht. Offensichtlich reichte Crace das Geld aus der Vermarktung der Filmrechte, um nie wieder etwas schreiben zu müssen, aber bei jemandem von solcher Leidenschaft, solcher Energie war es seltsam genug, dass es ihn nicht mehr danach verlangte, seinen Namen auf einem Buch stehen zu sehen. Vielleicht war er ja ausgebrannt. Oder hatte sein literarisches Verstummen möglicherweise mit einer Liebesbeziehung zu tun? Signora Gondolinis schwarze Augen funkelten, als sie darüber spekulierte, während ihr Mann den Blick abwandte und so tat, als habe er es nicht mitbekommen.
Ich dagegen hatte genug gehört, um interessiert zu sein. In meinem Brief schrieb ich Mr.Crace, ich hätte von dem Job gehört, und schilderte ihm in knappen Zügen meinen Hintergrund – meinen Abschluss in Kunstgeschichte an der Londoner Universität (die Ergebnisse stünden noch aus), Grundkenntnisse in Italienisch und den dringenden Wunsch, mindestens drei bis sechs Monate bleiben zu können, damit mir genügend Zeit dafür blieb, mit meinem Roman beginnen zu können. Zwar erwähnte ich, dass ich mich durchaus für einen guten Gesellschafter hielte, doch Signora Gondolinis Bemerkung über den zurückgezogenen Lebensstil von Crace veranlasste mich hinzuzufügen, dass ich Stille und das Bedürfnis nach Privatsphäre durchaus zu schätzen wüsste. Der ganze Brief wurde wahrlich kein Meisterstück, doch er war kurz und bündig und klang, wie ich hoffte, nicht anmaßend. Ich faltete ihn sorgfältig zusammen, schob ihn in das Kuvert und klebte es zu. Nachdem ich die Adresse meines Hotels auf die Rückseite geschrieben hatte, warf ich einen Blick auf meinen Stadtplan. Craces Palazzo lag nur einen zehn- bis fünfzehnminütigen Fußweg von mir entfernt, weshalb ich beschloss, den Brief nicht auf die Post zu bringen, sondern persönlich abzugeben. Dann nahm ich meine Sachen und ging in die Nacht hinaus.
Obwohl es bei Tag in der Stadt nur so wimmelte von Touristen, verwandelte sich Venedig, kaum dass die Sonne untergegangen war, in einen völlig anderen Ort. Während ich durch unbeschilderte Straßen ging und nur ab und zu das Spiegelbild des Mondes im Wasser aufblitzen sah, spürte ich, wie ich langsam begann, mich zu entspannen. Wie weggeblasen war meine Sorge um einen Job, mein Kummer um Eliza oder um die Situation zu Hause. Hier kannte mich niemand, und ich war ledig und frei.
Ich überquerte den Campo Santa Maria Formosa, wo der Legende nach die Jungfrau Maria in wohlgeformter Gestalt dem heiligen Magnus erschienen war, ging an der gleichnamigen Kirche vorbei, die nach ihr benannt war, und bog in eine Calle, die vom Platz abzweigte. Eine Weile wanderte ich in dem Gassengewirr umher, das immer wieder an demselben dunklen Kanal zu enden schien, aber die Adresse konnte ich nicht finden. Dann endlich, in der Nähe der Calle degli Orbi, gelang es mir, durch einen schmalen Durchgang zu schlüpfen, der nicht einmal einen Namen zu haben schien.
Ganz am Ende des finsteren Gässchens stieß ich auf eine weitere, etwas breitere Calle – die Calle delle Celle, die »Gasse der Zellen«, an deren Ende Craces Palazzo aufragte. Den einzigen Zugang bildete eine winzige Brücke, die sich von der Straße aus über das Wasser spannte und zu einem imposanten Tor führte, das durch eine Lampe von außen beleuchtet war. Hinter dem Eingang lag offenbar eine Art Innenhof. Über die ganze Längsseite des großen, dreistöckigen, vollkommen symmetrisch angelegten Gebäudes verlief – wie das Rückgrat eines längst verendeten Ungeheuers – eine Reihe von Bogenfenstern, vier auf jedem Stockwerk, abgesetzt mit weißem Marmor. Kerzen flackerten in einem der Räume im ersten Stock, beleuchteten Teile des abgedunkelten Raumes und warfen sonderbare Schatten an die Decke. Außer dem sanften Lecken des Wassers an der Kanalmauer war kein Geräusch zu hören.
Ich holte den Umschlag aus meiner Tasche und überquerte so leise wie möglich die Brücke. Der Briefkasten befand sich linkerhand der Tür und war geformt wie ein Drachenkopf, den man in den Marmor gemeißelt hatte. Während ich den Brief durch das Maul des Tieres gleiten ließ, streifte meine Hand die abgewetzten Zähne seines Fangs, und ich trat einen Schritt zurück in einen Lichtkreis. Als ich mich auf den Rückweg über die Brücke machte und noch einmal aufschaute, sah ich einen Schatten, der durchs Zimmer wanderte und schließlich wieder mit der Dunkelheit verschmolz.
Am folgenden Tag kehrte ich am Nachmittag von einer Besichtigungstour in meine Pension zurück und fand einen Brief für mich vor. Der Mann an der Rezeption teilte mir mit, er sei kurz nach Mittag von einem Boten abgeliefert worden. Ich lief in mein Zimmer und riss den Umschlag auf.
Palazzo Pellico
Calle delle Celle
30 122 Venezia
Lieber Mr.Woods,
haben Sie recht herzlichen Dank für Ihren Brief. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich darüber gefreut habe, denn er hätte zu keinem günstigeren Zeitpunkt eintreffen können. Mein voriger Assistent, den ich gerade erst angestellt hatte, ist vor nur wenigen Tagen gegangen, und ich war mir unschlüssig, was ich tun sollte.
Vor diesem Hintergrund frage ich mich, ob Sie Interesse hätten, einmal vorbeizukommen und die Sache weiter zu bereden. Natürlich kann ich Ihnen derzeit noch keine Anstellung versprechen. Zuerst müssen gewisse Aspekte meines Lebens zur Sprache kommen, auch Ihre Eignung für die Stellung müsste einer Prüfung unterzogen werden. Dennoch erscheint mir Ihre Qualifikation, zumindest oberflächlich betrachtet, durchaus beeindruckend.
Sollten Sie weiterhin interessiert sein, möchte ich Sie bitten, mir zu schreiben, damit wir gemeinsam einen passenden Tag und eine Uhrzeit vereinbaren. Ein Telefon habe ich nicht, und auch ein Verlassen meines Hauses kommt für mich nicht in Frage.
Mit freundlichen Grüßen
Gordon Crace
Ich schrieb Crace zurück, machte ihm einen Terminvorschlag und brachte meine Antwort erneut persönlich vorbei, um das Ganze zu beschleunigen. Crace antwortete mir mit einem erneuten Brief per Boten, in dem er mir mitteilte, der Termin sei ihm recht, und er freue sich auf unser Treffen. Langsam nahm meine Zukunft wirklich Gestalt an.
Ich stand vor Craces Palazzo. Es war der Morgen meines Bewerbungsgesprächs, und meine Handflächen waren feucht von Schweiß. Ich trug die einzigen schicken Sachen, die ich dabeihatte – einen cremefarbenen Leinenanzug und ein weißes Hemd. Bevor ich das Hotel verlassen hatte, war ich kurz vor dem Spiegel stehen geblieben, um mich zu betrachten. Sonnenlicht strömte durch das Fenster herein, legte einen bleichen Schimmer auf mein blondes Haar und ließ die Umrisse meines Gesichts so stark verschwimmen, dass ich die Jalousie herunterziehen musste, um mich richtig betrachten zu können.
Zu meiner Verabredung mit Crace war ich ein paar Minuten zu früh dran, aber mir war auch nicht danach, mir noch länger in der Hitze die Füße zu vertreten. Ich holte einmal tief Luft und ging über die Brücke. Als ich auf den Klingelknopf drückte, der neben der Tür angebracht war, schaute ich in die blicklosen Augen des Marmordrachens, der den Briefkasten bewachte, und lächelte vor mich hin. Es war offenkundig, dass Crace Humor hatte, auch wenn es sich wahrscheinlich um die schwarze Spielart handelte. Das wusste ich aus seinem Buch, das ich erst in den frühen Morgenstunden dieses Tages zu Ende gelesen hatte.
Der Debattierclub handelt von einer Gruppe älterer Schüler eines unbedeutenden englischen Internats, die sich jede Woche trifft, um über ein dringliches Thema oder Problem zu debattieren. Nachdem die Jungen sich den üblichen Inhalten gewidmet haben – Todesstrafe, Abtreibung, Tierschutz, den Vor- und Nachteilen des Sozialismus, einer Gegenüberstellung von Oligarchie und Demokratie –, macht der Vorsitzende des Clubs, Charles Jennings, eines Tages den Vorschlag, im Geheimen über die Vorzüge der Ermordung ihres respektablen Latein- und Griechischlehrers, Mr.Dudley Reeve, zu beraten. Die Jungen geben dem Antrag statt, halten das Ganze jedoch für einen Witz – bis Jennings eines Tages den Lehrer in einen Wald lockt und ihn erschlägt. Einen Grund für den Mord gibt es nicht – der Mann war weder ein Kinderschänder noch ein Sadist, sondern ein im Grunde sanfter und liebenswerter Zeitgenosse –, und das einzige Motiv für die Tat scheint darin zu liegen, dass Jennings’ Antrag im Debattierclub angenommen worden ist. Bis zum Ende des Buches bleibt Jennings auf freiem Fuß und geht zusammen mit den übrigen Mitgliedern des Debattierclubs vom Internat ab, um die Universität zu besuchen und später einem ehrenhaften Beruf nachzugehen. Ihr Geheimnis bleibt für immer im Verborgenen. Auf der Rückseite meiner Taschenbuchausgabe, die ich in einem modernen Antiquariat in Dorsoduro aufgetrieben hatte, war eine Reihe von Zitaten aus Rezensionen aufgeführt, die den bitteren Humor des Werkes ebenso lobten wie den geschickten Einsatz einer Krimihandlung als Rahmen, durch die ein besonders eindrücklicher Blick tief in das finstere Herz der britischen Gesellschaft ermöglicht werde. Offenbar konnte ich von Crace eine Menge lernen.
Ich betätigte noch einmal die Glocke. Wie Signora Gondolini angedeutet hatte, war Crace Anfang siebzig und brauchte möglicherweise eine Weile, um die Treppe hinabzusteigen und an die Tür zu kommen. Doch kaum hob ich meinen Finger vom Klingelknopf, öffnete sich die Tür einen Spaltbreit.
Vor mir stand ein Mann, der viel, viel älter schien, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Er war tief gebeugt, fast wie am Rumpf abgeknickt, und als er ganz langsam den Kopf hob, um mich anzuschauen, sah ich, dass das Fleisch seines Halses nur noch eine undefinierbare Masse war. Er kniff die winzigen, graugrünen Äuglein zusammen, während er in die Sonne blinzelte, und machte, statt zur Begrüßung auf mich zuzutreten, einen Schritt zurück in den Schatten.
»Adam Woods?«, fragte er. Seine Stimme war munter und scharf, hatte einen deutlichen Oberklasseakzent und klang sehr bestimmt.
»Ja – tut mir leid, ich bin ein bisschen früh dran«, erwiderte ich.
»Macht gar nichts«, meinte er und hob langsam die linke Hand, um die meine zu schütteln. Sie fühlte sich an wie der leblose Körper eines winzigen Vogels.
»Kommen Sie doch rein, hier entlang«, bat er und ging mir in einen säulenumrandeten Innenhof voraus.
Die Wände des Hofes waren mit Weinlaub bewachsen, das auch die Säulen und die Treppe hochkletterte, die zum Eingang im ersten Stock führte. Eine Reihe großer Töpfe mit wild wuchernden Lorbeerbäumen und rosa Hortensien stand ringsum auf der freien Fläche verteilt. Mitten im Hof lag der Kopf einer korinthischen Säule, deren Kapitell mit Akanthusblättern geschmückt war. Darauf erhob sich ein nackter Cherubim, ganz dunkel vom grünlich schwarzen Moos, mit dem er bewachsen war.
»Wie Sie sehen, habe ich die Dinge hier ein wenig schleifen lassen«, sagte Crace. »Das ist einer der Gründe, warum ich gehalten bin, jemanden wie Sie, Mr.Woods, anzustellen. Und nun lassen Sie uns nach oben gehen und etwas trinken.«
Um die Steinstufen langsam zu erklimmen, musste er sich mit der rechten Hand an dem Metallgeländer festhalten, ab und zu streifte eine Ranke des wilden Weines seine Finger. Seine gelbliche Haut war mit Altersflecken übersät und sah aus wie abgewetztes, uraltes Pergament. Der Leinenanzug, der lose an seinem ausgemergelten Körper herabhing, erinnerte an das weiche, verwesende Fleisch eines Toten.
Als wir die Treppe bewältigt hatten, trat Crace direkt in den Portego, einen großen Saal, der wie in vielen venezianischen Palästen die ganze Länge des Gebäudes einnahm. Die zweiflügeligen Fenster an den entgegengesetzten Enden des riesigen Raumes waren so schmutzig, dass nicht nur kein Licht durchdrang, sondern ich mich unweigerlich fragte, ob ich tatsächlich vor ein paar Tagen, als ich abends meinen Brief vorbeigebracht hatte, einen Umriss gesehen haben konnte, der durch das Zimmer gewandert war. Die Stiche und Drucke, die die Wände schmückten, waren dick mit Spinnweben überzogen; auch der fein gearbeitete Stuck und die üppigen Schmuckelemente an der Decke und den Simsen hatten längst ihre einstige Pracht eingebüßt, und der wolkig strukturierte Marmorboden war mit zahllosen Wollmäusen bedeckt. Hinter mir befand sich eine weitere Treppe; sie führte zu einer Tür, die mit einem Schloss gesichert war.
»Oh, da hoch gehe ich nie«, teilte mir Crace mit, als er meinen Blick bemerkte. »Schon seit Jahren nicht mehr. Es ist völlig leer. Auch um das Stockwerk unter uns kümmere ich mich nicht, weil es feucht ist und ständig überflutet wird. Folgen Sie mir.«
Er geleitete mich durch den Mittelsaal, der mit einer ganzen Reihe herrlichster Zeichnungen, Stiche und Drucke geschmückt war, und wir gelangten durch eine Flügeltür in den Salon. Dessen gesamte Wände waren mit einem üppigen roten Stoff bespannt, auf dem Renaissancegemälde in kostbaren vergoldeten Rahmen prangten. Die Fenster zur Straße hin waren hinter schweren, roten Samtvorhängen verborgen; das einzige Licht spendeten zwei Lampen, die rechts und links von dem marmornen Kaminsims standen, darüber hing ein großer, antiker Spiegel. Von der Decke baumelte ein gewaltiger Kandelaber, dessen Glasstücke leise klirrten.
Crace schlurfte über einen großen Perserteppich, ließ sich auf einem der beiden roten Samtsessel am Kamin nieder und bedeutete mir, auf dem anderen Platz zu nehmen.
»Ach, was bin ich für ein Dummkopf«, meinte er, als er es sich bereits in seinem Sessel bequem gemacht hatte. »Ich habe vergessen, Ihnen etwas zu trinken zu holen.«
»Kein Problem«, erwiderte ich. »Bitte – darf ich das machen?«
»Das ist wirklich sehr nett von Ihnen, Mr. Woods. Was möchten Sie denn? Gin? Whisky? Einen trockenen Sherry?«
Obwohl es erst elf Uhr morgens war, schienen Kaffee, Wasser oder andere nichtalkoholische Getränke nicht auf dem Plan zu stehen.
»Ein Sherry wäre schön – aber den hole ich«, erklärte ich. »Und für Sie?«
»Ja, ich schließe mich Ihnen an – Sie finden alles da drüben in dem Schränkchen.« Er hob einen seiner knochigen Finger und zeigte auf einen Bereich des Zimmers, der im Dunkeln lag. »Sehr nett von Ihnen, vielen Dank.«
Mein Blick fiel auf eine weitere Lampe in der Nähe des Barschranks, doch als ich Anstalten machte, sie anzuknipsen, bellte Crace: »Nein – kein Licht mehr. Ich denke, wir haben genug.«
Ich nahm meine Hand vom Schalter und beugte mich hinab, um mich um die Drinks zu kümmern. Crace hatte zwei Gläser bereitgestellt, beides kostbare Stücke – ein trichterförmiges Kristallglas mit dockenartigem Fuß und ein Kelch mit einer schönen Filigranverzierung in Fadenglastechnik –, doch sie fühlten sich klebrig an und waren mit einer dicken Schicht Staub und zahllosen Fingerabdrücken bedeckt, vielleicht sogar mit Haaren. Ich goss die klare, süßlich riechende Flüssigkeit in die beiden Gläser, reichte eins davon Crace, stellte das andere auf ein kleines Beistelltischchen neben meinem Sessel und setzte mich.
»Nun denn, Mr.Woods, aus Ihrem Brief weiß ich ja schon einiges über Sie, aber können Sie mir etwas mehr von sich erzählen?«
Starr wie ein Reptil nahm mich Crace ins Visier. Seine Augen waren klein und schienen immer wieder im Raum herumzuflitzen, mich dabei aber nie aus dem Blickfeld zu lassen. Ich räusperte mich.
»Ja, natürlich«, erklärte ich. »Ich bin jetzt seit etwas mehr als einer Woche in Venedig und möchte es, wie bereits erwähnt, mit dem Schreiben versuchen.«
Crace nickte, blieb aber stumm.
»Kürzlich habe ich an der Londoner Universität mein Studium der Kunstgeschichte abgeschlossen, und bevor ich mich irgendwie ablenken lasse, dachte ich, es sei ein gute Idee, es wenigstens einmal zu probieren.«
»Haben Sie denn schon etwas geschrieben?«
»Nun, geschrieben kann man es wahrscheinlich nicht nennen – ein paar Fragmente von Kurzgeschichten. Nichts, was ich jemandem zeigen könnte, wenn Sie das meinen.«
»Wollten Sie denn immer schon Schriftsteller werden?«
»Durchaus, seit ich mich erinnern kann«, antwortete ich. »Aber von meiner Familie bin ich dazu nicht allzu sehr ermuntert worden. Mein Vater ist Bankangestellter – ich bin in Hertfordshire aufgewachsen – und wollte, dass ich etwas Sinnvolles mit meinem Leben anfange. Ich glaube, einen Abschluss in Kunstgeschichte zu machen, hielt er für eine ziemlich dekadente Entscheidung. Aber ich möchte ihm – und mir selbst – beweisen, dass ich wirklich schreiben kann. Der Roman soll in Venedig spielen, weshalb es mir auch so wichtig ist, hier zu bleiben.«
»Ja, verstehe«, erwiderte Crace.
Noch eine Pause.
»Und aus diesen Gründen glaube ich auch, dass dieser Job, die Arbeit bei Ihnen, wirklich perfekt für mich wäre«, fuhr ich fort. »Ich kann mich im Haus nützlich machen, für Sie einkaufen, ab und zu kochen, putzen. Ich kann die Post für Sie durchschauen, Rechnungen begleichen und solche Sachen. Es sieht auch so aus, als müsste Ihr Innenhof ein wenig auf Vordermann gebracht werden – das könnte ich auch tun, wenn Sie wollen. Einfach alles, was Ihnen das Leben etwas angenehmer macht, damit Sie mehr Zeit zum Schreiben haben.«
Er zog eine Grimasse, als müsste er sich gegen einen plötzlich aufgetretenen Schmerz im Inneren wappnen.
»Ich schreibe nicht, Mr.Woods, und wünschte auch, ich hätte es nie getan«, erklärte er. »Und wenn Sie diese Stelle hier tatsächlich annehmen, dann würde ich erwarten, dass Sie es niemals wieder erwähnen. Das meine ich ganz ehrlich. Es ist ein Teil meiner Geschichte, den ich lieber nicht durchlebt hätte. Natürlich möchten Sie gerne über Ihr Schreiben sprechen, und es wäre grausam, Ihnen das zu verweigern, aber ich kann es wirklich nicht dulden, wenn Sie meine Arbeit als Schriftsteller zum Thema machen. Haben Sie mich verstanden, Mr.Woods?«
Ich hatte kein Wort von dem verstanden, was er gesagt hatte, stimmte ihm aber dennoch zu.
»Es gibt da auch noch etwas anderes, das Sie über mich wissen sollten«, fuhr er fort. »Ich setze niemals einen Fuß vor diesen Palazzo und habe das auch nie mehr vor. Vielleicht finden Sie das wunderlich – die Leute haben mich freilich schon mit schlimmeren Schimpfworten belegt –, aber obwohl ich mittlerweile schon seit über dreißig Jahren hier in Venedig lebe, hatte ich nie das Verlangen, es mir anzuschauen.«
»Sie meinen, Sie sind nie draußen gewesen?«
»Dazu besteht nicht die geringste Notwendigkeit, überhaupt nicht. Wie wir alle wissen, ist das die Stadt, die man am leichtesten besuchen kann, ohne sie jemals zu betreten. Jedenfalls ist das Venedig hier drinnen«, sagte er und tippte sich an den Kopf, »so viel interessanter und seltsamer als alles, was ich erleben könnte – da draußen. Die sogenannte reale Welt wird allgemein deutlich überschätzt, finden Sie nicht?«
Ich antwortete mit einer weiteren Frage. »Wie haben Sie das denn geschafft – ich meine, in der Vergangenheit?«
»Früher, als ich mich noch wesentlich besserer Gesundheit erfreute, habe ich mich auf einige Frauen aus der Nachbarschaft gestützt, die für mich einkauften und Botengänge erledigten«, berichtete er. »Die letzte, Maria, war eigentlich ganz in Ordnung, neigte aber ein wenig zur Hysterie. Hat mich immer ein bisschen nervös gemacht, was für meine Gesundheit nicht gut ist, überhaupt nicht gut. Und das Mädchen, das Ihnen in meinem Auftrag jene Briefe brachte, ist nicht besonders zuverlässig. Mittlerweile ist mir bewusst geworden, dass es für mich besser ist, jemanden wie Sie einzustellen, wenn ich weiter zurechtkommen will. Wie ich bereits in meinem Brief erwähnte, hat es mit dem jungen Mann, den ich kürzlich eingestellt hatte, nicht geklappt, und deshalb sind Sie heute hier.«
Ich nickte und wartete. Crace nahm einen Schluck Sherry und schien sich wieder ein wenig zu beruhigen.
»Mr.Woods, ich bin ein Mensch, der ausgesprochen großen Wert auf Verschwiegenheit legt. Bestimmt haben Sie schon begriffen, dass das, was innerhalb dieser Mauern geschieht, unter uns bleiben muss. Nicht dass ich etwas zu verbergen hätte, aber Sie müssen mir absolute Vertraulichkeit zusichern. Sollte ich herausfinden, dass Sie selbst etwas so Triviales ausgeplaudert haben wie, nehmen wir mal an, das, was ich zum Frühstück gegessen habe oder wie viel Milch ich in meinen Kaffee tue, müssten Sie mich verlassen. Und zwar auf der Stelle. Ich könnte es einfach nicht dulden.« Er hielt inne. »Haben Sie noch irgendwelche Fragen, Mr.Woods?«
»Dürfte ich Sie nach den Bedingungen fragen? Ich meine Arbeitszeit und …«
»Natürlich, tut mir leid, dass ich das nicht schon früher angeschnitten habe«, sagte er. »Zu Ihren Aufgaben würde es gehören, mir Frühstück zu machen, einzukaufen, sowohl Essen als auch Wein; zwar habe ich einige gute Flaschen im Keller, aber die möchte ich für besondere Gelegenheiten aufsparen. Sie wären auch dafür zuständig, ein leichtes Mittag- und Abendessen zuzubereiten – keine Sorge, ich esse nicht sehr viel, das dürfte also nicht schwierig sein – sowie noch einige andere Aufgaben, die sich möglicherweise ergeben. Sie hätten Ihr eigenes Zimmer – was ich Ihnen gleich zeigen kann – und so viel freie Zeit, wie es einzurichten ist, die Sie nach Gutdünken verbringen können. Allerdings nur hier – nur innerhalb des Palazzos. Das ist wichtig. Ich kann es nicht dulden, dass man mich allein lässt. Natürlich müssen Sie ausgehen, wenn Sie Einkäufe machen, aber wenn das jeden Tag erledigt wird, dürfte es nicht allzu lange dauern. Und ich kann mir ja auch vorstellen, dass Sie mit Ihrem Buch vorankommen wollen.«
»Ja, das stimmt.«
»Natürlich würden viele junge Männer auch nur den Gedanken an eine solche Vereinbarung rundweg ablehnen. Ich bin mir sicher, Sie werden mir gleich mitteilen, Sie können sich nicht vorstellen, unter einem solch drakonischen Regiment zu leben. Aber keine Sorge, das kränkt mich nicht. Ich würde es sogar völlig verstehen, wenn …«
»Nein.«
»Wie bitte?«
»Ich meine – das würde mich überhaupt nicht stören. Ich bin mir sicher, es würde mir sogar helfen, mich besser zu konzentrieren. Bei meinem Buch am Ball zu bleiben. Also ist das kein Problem.«
»Wirklich nicht?«
»Ja, ein bisschen Selbstdisziplin ist genau das, was ich brauche.«
»Oh, gut. Und was das Geld angeht – über das Thema muss man ja auch reden, auch wenn es schrecklich vulgär ist –, könnte ich Ihnen etwa … Schauen wir mal – wie klingen denn fünfhundert Euro pro Monat? Das wäre natürlich nur für Sie, Sie könnten hier kostenlos wohnen, und ich bezahle auch das Essen und so weiter. Ist das die Summe, mit der Sie gerechnet hätten?«
Um ehrlich zu sein, war das wesentlich mehr, als ich erwartet hatte, und ich sagte, das sei in der Tat eine sehr großzügige Summe.
»Und wenn Sie die Stelle annehmen würden, wann könnten Sie dann anfangen?«
»Mehr oder weniger sofort«, erwiderte ich, eingedenk meiner immer höher werdenden Hotelrechnung. »Eigentlich je eher, desto besser.«
Crace lächelte kurz. Seine dünnen Lippen gaben den Blick auf eine Reihe überraschend weißer Zähne frei.
»Möchten Sie denn das Zimmer sehen, in dem Sie schlafen würden?«
Crace stemmte sich mit Schwung aus dem Sessel in die Höhe, kämpfte ein paar Augenblicke um sein Gleichgewicht und ging dann nicht auf die Flügeltür zu, die das Zimmer vom Portego trennte, sondern zu einer weiteren Tür, die in einen dunklen Gang mündete.
»Da ist die Küche«, erklärte er und zeigte auf einen Raum gegenüber. Ich bemerkte, dass sich das Geschirr in der Spüle türmte und ein fauliger Geruch in der Luft hing. »Nichts Besonderes, aber gewiss völlig ausreichend.« Am Ende des Korridors blieb er stehen. »Und das wäre dann Ihr Zimmer«, verkündete er.
Er öffnete die Tür zu einem kargen, schlicht eingerichteten Raum mit weiß getünchtem Holzboden, einem Einzelbett mit schmiedeeisernem Rahmen, einem Einbauschrank und einem Schreibtisch direkt vor einem Fenster, das mit einem Laden verschlossen war und auf den Kanal hinausging. Die strenge Anmutung des Raumes kam mir durchaus entgegen, zumal das Zimmer im Gegensatz zum restlichen Palazzo relativ sauber wirkte, als hätte sein letzter Bewohner alles darangesetzt, die Spuren seiner Existenz zu verwischen. Ich fragte mich, was das wohl für ein Junge gewesen war, der vor mir hier geschlafen hatte, und warum er gezwungen gewesen war, zu gehen.
»Das ist in Ordnung … alles, was ich brauche – oder brauchen würde«, versicherte ich, weil mir einfiel, dass man mir den Job ja noch gar nicht angeboten hatte.
Crace schien Gedanken lesen zu können, denn als er mir ein Stück vorausgegangen war und sich über den Flur auf den Rückweg zum Portego machte, hielt er kurz inne und wandte sich mir zu.
»Also dann, Mr.Woods, wenn die Situation Ihnen zusagt, dann sehe ich eigentlich keinen Grund, warum Sie nicht sofort anfangen sollten.«
»Sie meinen, Sie bieten mir den Job an?« Ein Glücksgefühl durchströmte mich.
»Ja, wenn Sie das möchten«, sagte er.
»Danke schön, das ist wundervoll«, freute ich mich. »Ich werde Sie sicher nicht enttäuschen.«
Während wir den Portego durchquerten, bemerkte ich, dass von der Haupthalle ein weiterer Flur abging, der vermutlich zu Craces Gemächern führte. Als er mein Interesse spürte, nickte er in die Richtung und teilte mir mit, sein Schlaf- und sein Arbeitszimmer lägen tatsächlich in jenem Flur.
»Ebenso wie das Badezimmer – das wir uns teilen müssen«, erklärte er. »Ich hoffe, das ist in Ordnung für Sie.«
»Ja, ja, das ist völlig okay«, beteuerte ich.
»Ich würde Ihnen jetzt ja den Rest des Palazzos zeigen, aber …«
»Nein, keine Sorge, ist schon in Ordnung. Das hat wirklich keine Eile«, erwiderte ich.
Als wir an den vielen Radierungen, Drucken und Zeichnungen vorüberkamen, die die Wände des Portegos schmückten, sagte ich das Erste, was mir in den Sinn kam: »Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich das erwähne, aber Sie haben da eine herrliche Kunstsammlung, Mr.Crace.«
Er lächelte, offenbar erfreut über dieses Kompliment für seinen guten Geschmack.
»Ach, finden Sie? Diese Stücke habe ich schon seit Jahren. Eine Mischung aus Originalen und Kopien, aber ich hänge in der Tat sehr an ihnen.«
Wir blieben bei einem Paar reich verzierter, aber staubiger Truhen stehen, die rechts und links neben der großen Flügeltür standen, die in den Salon führte. An der Wand gegenüber von uns, in einem schlichten Ebenholzrahmen, hing etwas, das wie das Frontispiz eines alten Buches aussah. Es war ein Holzschnitt, der auf dickes, ockerfarbenes Papier gedruckt war und einen älteren Mann namens »Il Griti« zeigte. Er trug ein fließendes Gewand und einen sonderbar geformten Hut, saß auf einem eindrucksvollen Thron und nahm mit der linken Hand ein Buch von einem jüngeren Mann entgegen, der vor ihm kniete. Oberhalb des Jüngeren, der einen Bart trug und »Il Lodovici« genannt wurde, hing eine Art Sonnensymbol mit dem Gesicht einer Frau in der Mitte. Sie ließ ihre Strahlen direkt auf ihn herabscheinen.
»Ja, ein recht ansprechendes Stück«, meinte Crace, dem mein Interesse aufgefallen war. »Aus den Triomphi di Carlo von Francesco de’ Lodovici. Es zeigt den Schriftsteller, wie er dem Dogen Andrea Gritti, seinem Herrn, eine Ausgabe seines Buches, eines Ritterromans über Karl den Großen, überreicht. Man geht davon aus, da das Porträt von Il Griti tatsächlich den Dogen zeigt, müsste der Knabe mit Bart Lodovici sein, und die Dame in der Sonne da, die ihn inspiriert – was für ein hässliches kleines Ding sie doch ist –, wäre dann Lodovicis Muse. Ich bin mir nicht sicher, woher ich das Bild eigentlich habe, aber auf seine Weise ist es recht charmant.«
Gleich daneben hing die kleine Skizze eines Knaben mit lockigem Haar, der eine Tunika trug und seine Hände vor Schreck in die Höhe geworfen hatte, in den weit aufgerissenen Augen einen Ausdruck des Entsetzens. Bei der Zeichnung, die mit schwarzer Kreide auf recht ausgeblichenem Papier angefertigt war, handelte es sich um eine überaus feine Arbeit, offenbar das Fragment einer Studie zu einem umfangreicheren Werk.
»Wissen Sie, wozu dies die Vorlage ist?«, fragte ich.
»Ja, das weiß ich in der Tat«, antwortete er. »Das hat Battista Franco für sein Martyrium des heiligen Laurentius angefertigt. Kennen Sie das Bild?«
»Nein, ich fürchte nein.«
»Ach, es ist wunderbar, ganz wunderbar. Schauen Sie hier«, sagte er und führte mich zur gegenüberliegenden Wand. »Ich habe noch eine viel drastischere Abbildung von Cornelis Cort.«
Er wies auf einen Stich, der die ganze schreckliche Szenerie zeigte: den heiligen Laurentius, der bei lebendigem Leibe auf einem Eisengitter geröstet wurde. Einer seiner Peiniger stieß gerade eine spitze Gabel in seine Haut, während ein anderer das Feuer unter dem Märtyrer schürte, der wiederum die Hand zwei Engeln im Himmel entgegenstreckte. Das ganze Firmament war voller Feuer und Rauch.
»Wie Sie aus der Inschrift auf dem Gitterrost schließen können, hat dies ursprünglich ›Tizian, der kaiserliche Ritter erschaffen‹«, erläuterte er und zeigte auf die Inschrift neben dem Leib des Märtyrers. »Und natürlich möchte gewiss jeder eines der beiden Gemälde besitzen, die diese Szene zeigen. Doch da eines hier in Venedig in der Jesuitenkirche hängt und das andere im Escorial in Madrid, ist das wohl unmöglich.«
Schon meine ersten Eindrücke hatten mir vor Augen geführt, dass Crace eine schöne Sammlung von Kunstwerken sein eigen nennen konnte, doch bis zu diesem Moment hatte ich nicht geahnt, welche Bedeutung sie wirklich hatte. Er besaß offenbar einige wichtige – und sehr kostbare – Kunstwerke. Während ich mich in dem Portego umschaute, dessen Wände voll behängt mit Drucken und Radierungen waren, mich an die Gemälde erinnerte, die ich zuvor im Salon bewundert hatte, und mir dazu noch die zweifelsohne überaus kostbaren Stücke vorstellte, die in Räumen hingen, die ich noch gar nicht betreten hatte, versuchte ich zu schätzen, wie viel das alles wohl wert sein mochte.
»Ja, wirklich, eine herrliche Sammlung«, bewunderte ich sie mit einem letzten Blick in die Runde.
»Ach, auch nichts anderes als die eitle Sammlung eines törichten alten Narren«, erwiderte Crace mit einem abfälligen Winken.
Wir machten uns durch den Saal auf den Weg zur Treppe, wo ich stehen blieb und mich zu ihm umdrehte.
»Führen Sie denn Buch über Ihre Kunstwerke? Ich meine, eine Inventarliste?«
»Nein, so etwas habe ich, glaube ich, nicht. Wieso?«
»Ich habe mich nur eben gefragt, ob Sie mir erlauben würden – natürlich nachdem ich mit dem Putzen und Aufräumen und anderen notwendigen Arbeiten fertig bin –, ein Bestandsverzeichnis all Ihrer Besitztümer anzulegen. Ihre Sammlung ist wirklich eine der besten in privater Hand, die ich jemals gesehen habe. Natürlich bin ich kein Experte, aber ich denke, schon allein was die Versicherung angeht, könnte das durchaus hilfreich für Sie sein.«
»Würden Sie das denn nicht schrecklich langweilig finden?«
»Nein, überhaupt nicht. Eher im Gegenteil – es würde mir große Freude bereiten.«
»Nun gut, wenn Sie das möchten.«
»Vielen Dank«, sagte ich.
Er begleitete mich wieder die Treppe hinunter und in den schattigen Innenhof.
»Dann sehen wir uns also morgen«, meinte er und hob die Hand.
»Ja, und nochmals schönen Dank«, erwiderte ich. »Soll ich gleich etwas mitbringen? Brauchen Sie etwas?«
»Vielleicht ein paar Lebensmittel – Brot, Milch, etwas Obst und …« Er schaute sich um. »Und wie wäre es mit einer Gartenschere? Langsam bekomme ich nämlich Angst, dass mich diese schrecklichen Reben hier noch ersticken werden.«
Ich wachte früh auf, weil ich darauf brannte, endlich mein neues Leben beginnen zu können. Über die Vergangenheit brauchte ich nicht mehr nachzudenken. Jetzt würde alles anders werden. Ich packte meinen Rucksack, bezahlte die Hotelrechnung und gönnte mir einen Espresso und ein Cornetto in einem kleinen Café an einem Seitenkanal. Anschließend tätigte ich ein paar Einkäufe für Crace und kam kurz nach zehn an seinem Palazzo an. Als er mir die Tür öffnete, bemerkte ich ein amüsiertes Glitzern in seinen blutunterlaufenen Augen, und die dünne Haut spannte sich über seinen spitzen Wangenknochen, während er anfing zu lachen. Bis er wieder sprechen konnte, vergingen ein paar Augenblicke.
»Tut mir leid, Mr.Woods«, entschuldigte er sich. »Ich habe bloß gerade etwas fürchterlich Lustiges gelesen. Kommen Sie doch rein.«
Wir nahmen dieselbe Route wie am Tag zuvor, vorbei an den wuchernden Weinreben, die Treppe hoch und den Portego entlang bis in den Salon, den er »das rote Zimmer« nannte. Während der ganzen Zeit lachte er beständig in sich hinein.
»Da hat Sie aber etwas wirklich amüsiert«, stellte ich fest.
»O ja, ja, das hat es – in der Tat«, bestätigte er und nahm in seinem Sessel Platz.
Er holte ein paar Mal tief Luft und gewann seine Fassung zurück. Neben ihm auf dem Tisch lagen ein paar Bücher. Ich kniff die Augen zusammen, um die Titel erkennen zu können. Es waren zwei ziemlich vermodert aussehende Schinken mit rotem Ledereinband und goldener Inschrift auf dem Rücken.
»Wie Sie sehen«, sagte er und hob einen der beiden Bände hoch, »lese ich gerade Thomas Coryat.«
Ich schaute ihn verständnislos an.
»Kennen Sie Coryat? Wissen Sie, er hat dieses absolut köstliche Buch namens Coryat’s Crudities geschrieben. Geboren wurde er in Somerset, doch Anfang des siebzehnten Jahrhunderts reiste er hierher nach Venedig und galt in jeder Hinsicht als Sonderling. Es heißt sogar, er habe die Gabel nach England gebracht. Jedenfalls schildert er in diesem Buch die wundervoll schauerlichen Vorgänge in der Sala del Tormento, der Folterkammer des Dogenpalasts.«
»Oh, ich verstehe«, meinte ich, neugierig darauf, mehr zu erfahren.
»Ja, das ist richtig starker Tobak. Hören Sie sich das mal an.« Er ließ das Buch noch etwas tiefer in seinen Schoß rutschen, doch bevor er anfing zu lesen, sagte er: »Lassen Sie mich zuerst den Kontext umreißen. Ein Gefangener wird in die Folterkammer gebracht, wo er zunächst nur diese recht schlichte Apparatur sieht – ein einfaches Seil und einen Flaschenzug, der an der Decke befestigt ist. Doch dann bindet man ihm die Arme auf den Rücken, hakt sie am Ende des Seils ein und zieht ihn mittels des Flaschenzugs so weit in die Höhe, bis er unter der Decke hängt, wo er – und jetzt hören Sie – ›höchste Pein erlitt, weil es ihm die Gelenke zugleich löste und sie zerbersten ließ‹. Das liebe ich so an Venedig – äußerlich ist es eine Schönheit, aber sein Appetit auf Grausamkeit ist unersättlich, finden Sie nicht auch?«
Crace ließ mir gar keine Zeit zu antworten.
»Natürlich war das damals einfach so«, fuhr er fort. »Ich meine, früher war das Morden immer eine spektakuläre Angelegenheit. All dieses Blutvergießen. Und was, denken Sie, haben wir dagegen heute? Höchstens erstochen wird gelegentlich jemand – meistens, wenn sich zwei Männer um eine Frau streiten. Immer das alte Klischee. Oder einem Hitzkopf platzt eines Tages der Kragen, und er schlägt bei seiner Frau ein bisschen zu fest zu. Und wo liegt da der Unterhaltungswert?«
Ich lachte über Craces leidenschaftliche kleine Ansprache. So also hieß er mich in seinem Haus willkommen.