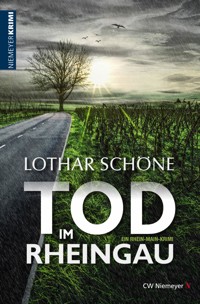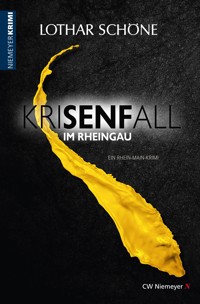7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
DER VIERTE FALL FÜR FRAU WUNDER UND HERRN SPYRIDAKIS Die Kunsthistorikerin Köckel-Simons erleidet einen grotesken Tod – man findet sie aufgeknüpft an einer elektrischen Tafel im Hörsaal. Die Ermordete wurde von ihren Kollegen spöttisch Mona Lisa genannt. Weil sie rätselhaft und undurchschaubar war wie die von Leonardo? Oder gibt es noch andere Gründe? Kommissar Vlassi Spyridakis verwandelt sich in einen Studenten, ermittelt undercover, agiert wahrlich komisch – was ihn leider an den Rand des Todes führt. Doch gemeinsam mit seiner Chefin Julia Wunder und seinem Mainzer Kollegen, der als Hausmeister tätig wird, finden sie einiges über die Tote heraus. Eine heiße Spur führt nach Frankfurt zu einem hochverdächtigen Kunstauktionator …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
„Malen ist nicht eine Angelegenheit von Träumerei oder Inspiration, es ist ein Handwerk und braucht kein millionenschweres Publikum, sondern wahre Liebhaber.“Auguste Renoir
Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Handlungen und Charaktere sind frei erfunden. Tatsächlich existierende Personen haben ihre Zustimmung erteilt.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de© 2019 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.comEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8363-7
Lothar Schöne
Mona Lisa stirbt im RheingauEin Rhein-Main-Krimi
Lothar Schöne, geb. in Herrnhut, arbeitete als Journalist, Hochschullehrer, Drehbuchautor und veröffentlichte Romane, Erzählungen und Sachbücher. Er erhielt eine Reihe von Preisen und Auszeichnungen, unter anderem das Villa-Massimo-Stipendium in Rom, den Stadtschreiber-Preis von Klagenfurt/Österreich und den von Erfurt, den Literaturpreis der Stadt Offenbach a.M., zuletzt 2015 den Kulturpreis des Rheingau-Taunus-Kreises. Sein Roman „Der blaue Geschmack der Welt“ wurde von den Lesern der Tageszeitung „Die Welt“ zum „Buch des Jahres“ gekürt, der Roman „Das jüdische Begräbnis“ in sechs Sprachen übersetzt. Derzeit wird die Verfilmung vorbereitet.
Den Kunstfreunden, den echten, wahren, guten, hier und heute, in nah und fern
1 Ein schauderhaftes Bild
Jörg Wöbbeking schlurfte durch die leeren Gänge. Er war ein Mann von vierundsechzig Jahren, der Probleme mit dem Sehen hatte. Auf dem rechten Auge schielte er, auf dem linken lag seine Sehkraft bei nur noch zwanzig Prozent. Daran hatte er sich gewöhnt, es störte ihn kaum noch. Weshalb auch? Seine Tätigkeit war von der Art, dass es auf genaues Sehen nicht so sehr ankam. Bei ihm ging es um anderes. Er musste wach sein. Denn seine Arbeit begann, wenn sich niemand mehr in der Hochschule herumtrieb. Als Nachtwächter saß er meist an der Pforte, strich ab und zu seinen grauweißen Haarschopf nach hinten und musste nachschauen, ob auch überall in den Räumen das Licht ausgelöscht war. Einige Professoren vergaßen es zu gern, auch wenn sie nur wegen einer Kleinigkeit am Abend noch einmal aufkreuzten. Wach sein, Licht überprüfen – eine simple, leider aber nicht gerade hochbezahlte Tätigkeit. Wenn er seinen Geldbeutel in die Hand nahm, um sich einen Kaffee aus dem Automaten zu ziehen, kam ihm manchmal der Gedanke, dass er doch besser Direktor oder Präsident hätte werden sollen, wenigstens Hochschulpräsident – das klingt doch nach was. Aber längst hatte er sich mit seinem Los abgefunden.
Wöbbeking kam am Kaffeeautomaten vorbei, warf ein Eurostück ein und zog sich einen schwarzen Kaffee in einem Pappbecher. Er nahm einen Schluck und betrat den Gang, der zum kleinen Hörsaal 3 führte, dort war er noch nicht gewesen. Natürlich wusste er, dass manche Professoren auch Vorlesungen am frühen Abend hielten, was er scheußlich fand. Konnten die nicht wie normale Menschen tagsüber ihr Werk verrichten? Der Abend und die Nacht waren schließlich ihm vorbehalten, da gehörte diese Hochschule ganz und gar ihm, er war gewissermaßen der Nachtpräsident, und niemand hatte hier was verloren, aber auch gar niemand. Doch um diese Zeit, beruhigte er sich gleich, würde er keinen Menschen mehr finden, da war er sich ganz sicher. Er schaute auf seine Uhr, kurz nach Mitternacht zeigte sie an, da war Ruhe im Karton. Als er aufschaute, musste er blinzeln. Dort vorne – fiel da nicht ein schwacher Lichtschein unter der Tür hervor? Hatte mal wieder irgendein siecher Professor das Licht brennen lassen? Oder arbeitete um diese Zeit noch einer? Verwehrte man ihm die Hoheit über die Nacht? Oder spielten ihm seine trüben Augen den Lichtschein nur vor? Litt er schon an Lichterscheinungen, handelte es sich eventuell um die Vorstufe zum Tod?
Der Nachtpräsident zögerte keinen Augenblick und schritt aus. Als er vor der Tür des Hörsaals 3 stand, hielt er inne. Seine Ohren waren im Gegensatz zu seinen Augen vollkommen intakt, und er hörte ein leises Summen. Ein Summen? Fand hinter dieser Tür ein exklusives Experiment mit Bienen oder anderen Insekten statt? War er einer geheimen Verschwörung von Greenpeace-Aktivisten auf die Spur gekommen? Studierende aller Art waren für so einen Hokuspokus meist zu begeistern. Jörg Wöbbeking dachte keinen Moment daran anzuklopfen, er griff zur Klinke und öffnete vorsichtig die Tür.
Im ersten Moment kniff er die Augen zu. Spielten sie ihm einen Streich? Konnte er sich überhaupt nicht mehr auf sie verlassen? Doch als er sie wieder öffnete, sah er dasselbe Bild – das ihn erschaudern ließ. Was seine Augen sahen, war … grauenhaft. Der fast noch volle Kaffeebecher löste sich aus seiner Hand und fiel zu Boden, die schwarze Flüssigkeit breitete sich als Lache zu seinen Füßen aus. Und Nachtpräsident Wöbbeking musste sich am Türrahmen festhalten.
*
Kommissar Vlassopolous Spyridakis weilte zur gleichen Zeit im Bett seiner Freundin Carola. Sie hatten zuvor in einem italienischen Ristorante gegessen, Vlassi hatte in einem Anfall von Großzügigkeit eingeladen, und jetzt dachte er mit etwas Wehmut an den letzten Fall: die Senfgeschichte. Da war er nach einem Mahl bei Carola zu ganz anderen Leistungen im Bett fähig gewesen. Aber heute fühlte er sich irgendwie schlapp, schlapp, schlapp. Sie hatten zwar ein bisschen herumgeschmust, doch alle Reizungen von ihrer Seite zeigten keine Wirkung bei ihm, und schließlich war sie eingeschlafen, während er dösend über sein Versagen nachgrübelte. War das auswärtige Essen daran schuld, hatte er vielleicht Verdorbenes zu sich genommen, sah er schon einem Vergiftungssiechtum entgegen? Oder litt er nach seiner Sexsucht beim letzten Fall jetzt eventuell an Impotenz? So etwas sollte ja vorkommen, sogar schon in jungen Jahren. Müsste er sich daraufhin untersuchen lassen? Aber nicht die Suchttherapeutin Heidi Teubler-Berg, wie schon geschehen, sollte er aufsuchen, sondern einen Facharzt für die unteren Regionen. Herr Doktor, schauen Sie mal nach bei mir, ich glaub’, ich bin untenrum malad. – Wieso glauben Sie das? – Da will nichts mehr nach oben streben, und vor Kurzem fühlte ich mich noch wie ein Stier.
Vlassi wälzte sich auf die andere Seite, und weitere üble Krankheitsfantasien stiegen in ihm auf. Konnte es eventuell sein, dass Impotenz die Vorstufe für Schrecklicheres war? Vielleicht hatte sich längst ein Tumor in den unteren Regionen bei ihm eingenistet, ein unbemerkter Tumor, der nun ausstrahlte nach allen Richtungen. Vielleicht konnte er bald nicht mehr pinkeln, vielleicht kam er zur Gänze nicht mehr hoch, aus dem Bett nämlich am nächsten Morgen, vielleicht konnte er bald keinen Schritt mehr vor den anderen setzen? Vlassi spürte plötzlich Schweiß auf seiner Stirn – es handelte sich um puren Angstschweiß. Er strich ihn mit zitternder Hand fort und sagte sich im selben Moment innerlich: Den Schweiß kannst du wegwischen, die Angst aber nicht. Kam er überhaupt noch aus dem Bett heraus? Er musste es versuchen, er konnte nicht den frühen Morgen abwarten und seiner Carola als Invalide aus den Federn heraus zuwinken: Ich schaffe es nicht mehr – bin bettlägerig geworden.
Vlassi richtete sich im Bett vorsichtig auf. Er konnte es kaum glauben, denn es gelang ihm. Ich muss sehen, ob ich auch die Beine herausbekomme und darauf stehen kann. Wider Erwarten schaffte er auch das. Kommissar Spyridakis stand hoch aufgerichtet im dunklen Schlafzimmer seiner Freundin. Jetzt ein paar Schritte machen und hoffentlich nicht umfallen, ging es ihm durch den Kopf. Gesagt, getan, er machte einige Schritte – die ein schmerzhaftes Ende fanden. Er stieß nämlich an die Kommode an der Wand, und ein Schmerz zuckte durch sein Knie. Vlassi ächzte laut auf, doch Carolas Schlaf war von der Art, dass sie nur einen sanften Brummton von sich gab. Wahrscheinlich träumte sie von einer stürmischen Eroberung ihres stierhaften Freundes, die allerdings in der Vergangenheit lag, leider einer nicht allzu fernen Vergangenheit.
Vlassi tastete sich zur Tür. Wozu sich wieder ins Bett legen? Er konnte doch nicht einschlafen, jetzt tat ihm noch das Knie weh, und seine Schlappheit verhinderte sowieso den Schlaf. Eigentlich widersinnig, dachte er, wer schlapp ist, sollte doch den Schlaf herbeisehnen. Aber seine Schlappheit hatte vermutlich tiefere Gründe – Krankheitsgründe. Wo war seine Hose geblieben, wo sein Hemd? In Carolas Wohnzimmer hatte er beides abgeworfen, und so öffnete er leise die Schlafzimmertür, um nach nebenan zu gelangen.
Nachdenklich zog sich Vlassi im Nachbarzimmer an. Den Schlaf kann man nicht herbeizwingen, es hatte keinen Sinn, sich hellwach und schweißüberströmt im Bett hin und her zu wälzen. Er musste ein paar Schritte gehen, als Nachtwandler auf dunklen Gassen würde er vielleicht Ruhe finden. Aber hoffentlich nicht zuletzt an einer Straßenecke einschlafen. Doch vielleicht fielen ihm unterwegs noch andere Gründe für sein Versagen im Bett ein. Wenn es kein Krankheitssymptom seines maladen Körpers war – was konnte es noch sein, das ihn erotisch so übel zur Strecke gebracht hatte?
Kurze Zeit darauf sah man Vlassi auf der nachtdunklen Steubenstraße entlangwandeln. Er spürte immer noch sein Knie, aber das Gehen machte es besser. Vielleicht sollte ich, dachte er, in Zukunft eine Runde ums Viertel spazieren, bevor ich zu Carola ins Bett steige. Vielleicht war das die Lösung. Wer kann denn auch schon nach einem reichhaltigen Mahl Höchstleistungen im Bett vollbringen? Das wäre übermenschlich. Carola, ich gehe jetzt erst mal eine Weile durch die frische Luft, mach es dir im Bett schon mal gemütlich, wenn ich wiederkomme, habe ich stierhafte Kräfte gesammelt.
Vlassopolous Spyridakis war in der Nähe des Kurparks angelangt, als plötzlich eine Sambamusik ertönte. Doch nicht aus einem offenen Fenster erklang sie, hinter dem Feiersüchtige eine kesse Sohle aufs Parkett legten – die Sambarhythmen kamen aus der Innentasche seiner Jacke. Sie stammten von seinem Handy, es war sein Klingelton. Wer ruft mich zu dieser Zeit an?, fragte sich Vlassi empört. Ein Kommissar kann nicht Tag und Nacht im Dienst sein, wahrscheinlich bin ich deshalb auch erotisch überfordert – ich arbeite zu viel. Und er beschloss nicht nur, den Klingelton zu überhören, sondern ihn auch zum Anlass zu nehmen, auf der Straße einige Tanzschritte zu vollführen, Tanzschritte, die sich zu einem flotten südamerikanischen Solotänzchen entwickelten – die Gesundheit erforderte es. Und so sah man Herrn Spyridakis zu nächtlicher Stunde in den Wiesbadener Kurpark hineintanzen, und nur ein paar müde Enten vom nahe gelegenen Teich öffneten schläfrig die Augen und wunderten sich über das seltsame Geschehen.
2 Das klingenlippige Ungeheuer
Als Kommissar Spyridakis am nächsten Morgen im Polizeipräsidium eintraf, näherte sich ihm der diensthabende Beamte mit dem Namen Schuster und teilte mit gefurchter Stirn mit: „Ich habe Sie vergangene Nacht angerufen …“
Vlassi unterbrach ihn: „Warum mich? In der Nacht bin ich sakrosankt!“
„Frau Wunder habe ich auch angerufen, aber die konnte ich ebenfalls nicht erreichen“, erwiderte der Kollege und wirkte jetzt missgelaunt.
„Daraus können Sie etwas lernen, Herr Schuster, die Nacht gehört zum Feierabend, sie ist die Verlängerung desselben und gewissermaßen heilig für uns Kripoleute.“
Der Kollege Schuster erkannte, dass es keinen Sinn hatte, mit Kommissar Spyridakis weiter über sein vergebliches Telefonat zu diskutieren, deshalb teilte er jetzt mit: „Wie Sie meinen. Ihre Chefin wird Ihnen erzählen, worum es geht.“
Als Vlassi ins Dienstzimmer trat, schien ihn Hauptkommissarin Julia Wunder schon zu erwarten.
„Sie kommen spät, Herr Wunder. Wir müssen gleich los. In der Rhein-Main-Hochschule gibt es offenbar einen Toten.“
„Der Kollege Schuster sagte mir gerade an der Pforte, dass er Sie schon gestern Abend angerufen, aber leider nicht erreicht hat“, erwiderte Vlassi.
„Ich war im Theater, hab’ mein Smartphone abgestellt und vergessen, es wieder anzustellen. Aber Sie hätte er doch erreichen müssen.“
„Diensteifrig, wie ich bin, wäre ich natürlich drangegangen“, log Vlassi, „aber um diese Zeit liege ich im Bett bei Carola.“ Und er fügte bedauernd hinzu: „In tiefem Schlaf. In so tiefem Schlaf, dass mich nicht einmal ein Sambarhythmus daraus hervorlocken kann.“
Julia sah ihn skeptisch an, streifte ihren Regenmantel über und setzte ihren blauen Afidora-Hut auf. Sie eilte wortlos aus dem Zimmer, und Vlassi beeilte sich, ihr hinterherzuhechten.
Die Hochschule im Kurt-Schumacher-Ring hatten sie mit dem Auto schnell erreicht. Julia fuhr in die Tiefgarage, und sie nahmen den Aufgang nach oben. In der Lobby standen einige Leute, die sie offenbar schon erwarteten. Julia Wunder wandte sich an den Nächststehenden, stellte sich kurz vor, worauf dieser sie an einen anderen Herrn in der Nähe verwies: „Sie sprechen am besten mit dem Präsidenten unserer Hochschule.“
Der Angesprochene kam auch gleich näher: „Sie sind von der Kripo, ja?“
Kommissarin Wunder bejahte, nannte nochmals ihren Namen und stellte den hinter ihr stehenden Kommissar Spyridakis vor.
„Mein Name ist Schüttler, Professor Schüttler, ich bin der Präsident dieser Hochschule“, teilte der Nähergekommene mit ernster Stimme mit.
Schüttler war ein mittelgroßer Mann von Ende vierzig. Eine Halbglatze zierte seinen Kopf, er trug einen Dreitagebart, und seine Nase war viel zu kurz für sein flächiges Gesicht. Julia musterte ihn und dachte bei sich, dass Schüttler wahrscheinlich durch seinen angedeuteten Bart seine Jungenhaftigkeit verstecken wollte. Laut aber sagte sie: „Was ist passiert, Herr Professor Schüttler?“
„Kommen Sie bitte mit, wir haben alles so gelassen, wie es Herr Wöbbeking vorgefunden hat.“
Schüttler ging voraus, Julia und Vlassi folgten ihm, und Vlassi fragte von hinten: „Wer ist Herr Wöbbeking?“
„Unser Nachtbediensteter.“
Wie fein der sich ausdrückt, dachte Vlassi, er könnte doch auch Nachtwächter sagen, schloss zu ihm auf und fragte: „Einen Tagesbediensteten haben Sie nicht?“
„Sie wissen vermutlich nicht, wie schwer es ist, Personal zu finden“, erklärte Schüttler im Gehen, „ja, wir suchen auch einen Tageshausmeister, finden aber keinen. Und Herr Wöbbeking, dem ich die Stelle angeboten habe, will nicht. Das übersteige seine Kräfte, außerdem sei er ein Nachtmensch.“
Sie kamen zum Hörsaal 3, dessen Eingang geschlossen war. Professor Schüttler öffnete die Tür, und sie traten ein. Was Frau Wunder und Herr Spyridakis sahen, war gruselig. An der großen elektrischen Tafel vorn hing eine Frau. Vlassi ging näher und teilte mit: „Sie ist tot.“
„Ja“, sagte Präsident Schüttler von hinten, „deshalb haben wir Sie geholt. Unser Herr Wöbbeking hat das in der Nacht auch schon festgestellt.“
„Vielleicht war die Frau da aber noch lebendig“, mutmaßte Vlassi, „ist Herr Wöbbeking denn ein Forensiker?“
„Sie können mit ihm selbst sprechen, ich hab’ ihn gebeten hierzubleiben“, erwiderte Schüttler.
„Wer ist die Tote denn?“, fragte Julia.
„Es handelt sich um Frau Professor Köckel-Simons“, antwortete der Präsident.
Julia nickte: „Aha. Also, dann holen Sie bitte Herrn Wöbbeking.“
Schüttler verließ den kleinen Hörsaal, und Julia Wunder deutete auf einen Diaprojektor, der vor sich hin summte: „Hier sind offenbar Bilder gezeigt worden, was uns einen ersten Hinweis gibt, Herr Spyridakis. Welchen?“
„Welchen?“, überlegte Vlassi laut. „Es kann nur etwas zu tun haben mit der Tätigkeit, die die aufgehängte Dame hier ausübte.“
„Sehr richtig, aber warum sehen wir nichts auf der Leinwand?“
„So ein Diaprojektor macht auch mal Feierabend“, antwortete Vlassi, „und dann summt er eben nur so im Halbschlaf vor sich hin.“
Die Tür öffnete sich, und Schüttler kam mit dem Nachtportier herein.
„Herr Wöbbeking“, stellte er ihn vor, „er hat Frau Professor Köckel-Simons gefunden.“
Wöbbeking fing sofort zu sprechen an: „Ich hab’ nichts angerührt, weder die Professorin noch den Projektor oder sonst was. Ich weiß, was sich gehört. Sehe alle Tatorte im Fernsehen.“
„Natürlich, natürlich“, beschwichtigte Hauptkommissarin Wunder, „Sie haben alles so gelassen, wie wir es jetzt sehen?“
Wöbbeking nickte, und Präsident Schüttler fügte an: „Er hat bei mir angerufen und auf Band gesprochen.“
„Waren Sie denn nicht daheim?“, fragte Julia.
„Doch, doch, aber auch Hochschulpräsidenten müssen mal eine Mütze Schlaf nehmen.“
„Eine Mütze?“, fragte Vlassi vorlaut. „Unsereins ist dagegen immer im Dienst, wir können uns keine Mützen leisten.“
Julia warf ihm einen strafenden Blick zu und wandte sich an Wöbbeking, der sein üppiges grauweißes Haupthaar nach hinten strich: „Herr Wöbbeking, haben Sie denn noch jemanden angerufen außer Herrn Schüttler?“
„Ja, natürlich, ich hab’ die Polizei angerufen, ich hab’ mir gleich gedacht, dass hier eine Gewalttat vorliegt. Die Frau Professorin wird sich ja nicht selbst aufgehängt haben.“
Julia nickte und wandte sich an Schüttler: „Es handelt sich hier, wie Sie sagten, um Frau Köckel-Simons. Welches Fach hat sie denn vertreten?“
Julia ahnte die Antwort schon, wollte sie aber bestätigt wissen durch den Präsidenten.
„Frau Köckel-Simons war Kunsthistorikerin.“
„Dann hat sie hier vermutlich Kunstobjekte gezeigt …?“
„An die Wand geworfen“, ergänzte Vlassi.
„Vermutlich“, stimmte Schüttler zu.
„Wir wollen doch mal sehen, was der Diaprojektor uns zeigt“, sagte Julia.
„Spielt das denn eine Rolle?“, fragte Präsident Schüttler.
„Alles spielt eine Rolle“, antwortete Julia, „bitte bringen Sie den Diaprojektor zum Laufen.“
Schüttler warf Wöbbeking einen auffordernden Blick zu, worauf der zum Projektor ging. Es bedurfte lediglich eines Handgriffs, und ein Bild leuchtete auf der weißen Wand neben der elektrischen Tafel auf, das allerdings durch die Helligkeit im Raum nicht deutlich zu erkennen war.
„Bitte abdunkeln“, forderte Julia.
Wöbbeking ging zum großen Fenster an der Seite, und zwei Rollladen surrten herunter und verdunkelten den Hörsaal.
„Ah, was sehen wir denn hier?“, fragte Hauptkommissarin Wunder.
Schüttler fühlte sich angesprochen und antwortete wie ein Prüfungskandidat: „Das ist … soviel ich weiß … also … ein van Gogh.“
Julia Wunder musterte ihn, sie wollte herausfinden, ob der Präsident log, das wäre ein erster Hinweis auf die Sachlage gewesen.
„Sie täuschen sich, Herr Professor“, erwiderte sie schließlich und genoss ein wenig die Situation. Schüttler hatte offenbar tatsächlich keine Ahnung von bildender Kunst.
Julia wandte sich an Vlassi: „Herr Spyridakis, was ist das für ein Gemälde, und wer ist der Urheber?“
Ihr Assistent antwortete unverzüglich: „Rubens. Magd am See.“
Julia Wunder stöhnte leise auf und sah Vlassi mitleidig an: „Mit den Kenntnissen in der bildenden Kunst ist es offenbar bei gewissen Polizeibeamten nicht weither.“
Dann warf sie dem Präsidenten der Rhein-Main-Hochschule einen enttäuschten Blick zu: „Sie sind offenbar auch kein Kunsthistoriker.“
„Da haben Sie nicht ganz unrecht“, gestand der, „mein Fach ist die Betriebswirtschaftslehre.“
„Das erklärt viel“, erwiderte Julia, „vom Fachgebiet Ihrer Frau Köckel-Simons haben Sie also keine Ahnung?“
„Meine Kenntnisse in der Kunst, will ich mal sagen, halten sich in Grenzen – leider, leider.“
„Wie heißt Frau Köckel-Simons übrigens mit Vornamen?“, fragte Julia.
„Margaretella“, antwortete Schüttler.
„Margaretella?“, ließ sich Vlassi fragend hören.
Präsident Schüttler nickte bestätigend. Von hinten schob sich jetzt Herr Wöbbeking vor, der offenbar auf Julias Frage nach der Herkunft des Bildes eingehen wollte: „Frau Kommissarin, ich glaube, das ist ein Pissarro. Ich sehe das, obwohl ich eine Augenschwäche habe.“
Julia schaute ihn verwundert an: „Sehr gut, Herr Wöbbeking. Sie haben recht, das ist ein Bild von Camille Pissarro, das wir hier sehen.“
Wöbbeking schnitt ein zufriedenes Gesicht, er war zwar nur Nachtpräsident, aber er wusste doch, dass er das Zeug auch zum Tagespräsidenten hatte. Pissarro, das hatte außer ihm niemand gewusst!
Hauptkommissarin Wunder zog ihr Moleskine-Notizbuch heraus und machte sich ein paar rasche Notizen. Dann wies sie Vlassi an, die Spurensicherung herbeizutelefonieren.
„Wir müssen die Tote mitnehmen“, informierte sie Professor Schüttler, „lassen Sie hier alles so, wie es ist, bis unsere Leute kommen.“
Sie machte Anstalten zu gehen, der Präsident folgte ihr, und als sie die Tür erreichten, sagte Julia: „Ich möchte mich gern mit Ihnen unterhalten, aber nicht in der Lobby.“
„Natürlich“, erwiderte Schüttler, „gehen wir doch in mein Büro.“
In der Lobby, die sie durchquerten, standen inzwischen noch mehr Personen, die ihnen neugierige und fragende Blicke zuwarfen. Julia, Vlassi und Schüttler mussten ein Stockwerk höhersteigen, dort befand sich das Büro des Präsidenten. Es war weitläufig und machte den Eindruck, als residiere hier der Vorstandsvorsitzende eines Dax-Konzerns und nicht ein Wissenschaftler. Julia nahm das beiläufig zur Kenntnis, während Schüttler sie zu einer Sitzecke führte, wo sie alle drei in pompösen Sesseln Platz nahmen.
„Ich bin entsetzt über diese Tat“, teilte Schüttler mit gewichtiger Miene mit.
„Verstehe ich“, erwiderte Julia, der allerdings sein Entsetzen ein wenig gespielt vorkam.
„Ich bin entsetzt“, wiederholte Schüttler, „dass so etwas an unserer Hochschule vorkommen kann.“
Vlassi fragte: „Warum soll so etwas nicht auch an einer Hochschule vorkommen?“
„Herr Spyridakis“, erwiderte Schüttler gravitätisch, „an einer Hochschule, noch dazu unserer, ist Mord nicht an der Tagesordnung.“
Hauptkommissarin Wunder räusperte sich: „Herr Professor Schüttler, hatte Frau Köckel-Simons am gestrigen Abend eine Vorlesung?“
„Nein, nein, das wüsste ich …“
„Dann hat sie eine Vorlesung vorbereitet?“
„Bestimmt, sie wollte offenbar die Bilder, die sie zeigen wollte, noch einmal durchgehen.“
Vlassi teilte ungeniert mit: „Vielleicht wollte sie sich noch mal selbst prüfen, ob sie all die Maler kennt, die sie vorführt.“
„Aber ich bitte Sie“, erwiderte Schüttler ernst, „sie ist eine absolute Koryphäe auf ihrem Gebiet, natürlich kennt sie die Maler aller Epochen.“
„Kommissar Spyridakis neigt zum Scherzen“, flocht Julia ein, der die Humorlosigkeit von Schüttler auffiel, „Frau Köckel-Simons wäre ja wohl nicht Professorin an dieser Hochschule, wenn sie nicht eine Expertin wäre.“
Der Präsident nickte zustimmend: „Das ist vollkommen richtig.“
„Herr Professor Schüttler“, fuhr Julia fort, „wer käme denn infrage für eine so grausige Tat?“
„Aber Frau Wunder“, empörte sich der Präsident, „woher soll ich das wissen?“
„Ich dachte, sie könnten uns vielleicht einen Verdächtigen nennen.“ Julia hielt inne und erklärte dem humorfreien Mann an der Spitze der Hochschule, was sie meinte: „Ich will herausfinden, ob Margaretella Köckel-Simons Feinde hier an der Hochschule hatte.“
„Aber keineswegs“, widersprach Schüttler, „Frau Köckel-Simons war sogar äußerst beliebt …“
„Bei den Kollegen?“
„Bei den Kollegen und auch bei den Studierenden“, versicherte Schüttler.
Vlassi schaltete sich ein: „Dann gibt es eigentlich kein Tatmotiv für irgendwelche Kollegen von Ihnen?“
„Das würde ich vollkommen ausschließen!“, erklärte Professor Schüttler.
„War Frau Köckel-Simons verheiratet?“, wollte Julia wissen.
„Ja, das war sie“, antwortete der Präsident.
„Ist der Ehemann schon informiert über das Ableben seiner Frau?“
„Nein, ich bin noch nicht dazu gekommen.“
„Sie rufen ihn aber noch an?“, wollte Vlassi wissen. Er hegte die Befürchtung, dass diese undankbare Aufgabe sonst mal wieder auf ihn zukam.
„Das werde ich tun. Ich mache es, wenn unser Gespräch beendet ist.“
Vlassi nickte zufrieden, während Julia Wunder den Hochschulpräsidenten genau beobachtete. Er reagierte bisher ziemlich normal, abgesehen von seinem übertrieben theatralischen Entsetzen über den Mord. Er wirkt, überlegte Julia, eigentlich nicht wie ein Wissenschaftler, sondern wie ein Beamter, der eine Gewalttat möglichst rasch und bürokratisch aus der Welt geschafft haben will. Aber auch das schien ihr nicht unnormal – wer will einen Mord schon zu seinem ständigen Begleiter machen?
„Ich muss Sie um die Adresse von Frau Köckel-Simons bitten“, sagte sie in Richtung Schüttler.
„Ja, natürlich.“
Der Hochschulpräsident erhob sich, ging zu seinem Schreibtisch, drückte auf die Enter-Taste seines Computers und teilte nach wenigen Sekunden mit: „Die Adresse ist in Mainz, es ist die Carlo-Mierendorff-Straße 32.“
„Sie hat in Mainz gewohnt?“, fragte Vlassi, der schon ahnte, dass er auf die andere Seite des Rheins müsste. Wenigstens konnte er da Ernst Lustig einspannen, der mit seiner derben Art vielleicht den Ehemann aus der Reserve locken würde.
„Ja, in Mainz“, bestätigte Schüttler und fügte hinzu: „Eine Reihe unserer Professoren wohnen nicht in Wiesbaden. Manche in Mainz, manche in Frankfurt, manche sogar noch weiter weg.“
„Mainz ist ja schon sehr weit weg“, erklärte Vlassi mit Ironie in der Stimme.
Schüttler sah ihn verständnislos an, er kapierte nicht, was Kommissar Spyridakis damit sagen wollte.
Julia hatte die Adresse mitgeschrieben und fragte jetzt: „Hatte Frau Köckel-Simons denn hier an der Hochschule nähere Kontakte zu Kollegen?“
Professor Schüttler kam zur Sitzecke zurück und machte ein angestrengt nachdenkliches Gesicht: „Nicht dass ich wüsste.“
„Ich dachte, sie war äußerst beliebt?“, fragte Julia.
„Ja, ja, aber ich kann mich ja nicht um alle persönlichen Belange kümmern“, erwiderte der Präsident.
„Also Frau Köckel-Simons hatte jedenfalls keine Feinde hier an der Schule?“, wollte Julia nochmals wissen.
„Feinde?“, murmelte der Präsident jetzt, als wäre ihm diese Vokabel unbekannt, um dann rasch zu antworten: „Nein, nein, ich sagte es doch schon.“
Seine Worte klangen nach der nachdenklichen Einleitung jetzt bestimmt und direkt. Dennoch schob Julia nach: „Es können auch Gegner, Konkurrenten, Widersacher sein oder einfach Leute eben, die sie nicht ausstehen konnten.“
Schüttler überlegte einen Moment, dann antwortete er: „Wer hat denn keine Gegner, aber bei der Kollegin Köckel-Simons wüsste ich wirklich nicht …“
Er weiß es nicht, dachte Julia, wahrscheinlich weiß er überhaupt sehr wenig – oder tut er nur so und will sich aus allem heraushalten? Jedenfalls hat er von bildender Kunst keine Ahnung. Und ob er sich in seinem Fach, der Betriebswirtschaftslehre, wirklich auskennt, bezweifle ich auch. Aber solche Leute werden eben Präsidenten. Er ist vermutlich der kleinste Nenner gewesen, auf den man sich einigen konnte.
„Einen Racheakt schließen Sie also aus?“, fragte sie.
Schüttler presste seinen dünnen Lippen aufeinander, dass sie noch dünner und schmaler wurden, sodass man den Eindruck hatte, sich daran schneiden zu können. Vlassi sah es mit Unbehagen und dachte bei sich: Dieser Präsident darf auf keinen Fall eine Frau küssen, er mutiert ja gerade zu einem klingenlippigen Ungeheuer und würde ihr Gesicht zerschneiden.
Doch da antwortete der Präsident: „Einen Racheakt …? Ja, also einen Racheakt schließe ich aus.“
„War Frau Köckel-Simons denn auch bei den Studenten beliebt?“, fragte Julia.
Schüttler richtete sich auf: „Kann man so sagen, sie war sowohl bei den Kollegen als auch bei den Studierenden beliebt und geschätzt.“
„Aha“, sagte Julia und erhob sich: „Das wars fürs Erste, Herr Professor Schüttler. Wir melden uns wieder.“
Der Präsident stand ebenfalls auf: „Ja, natürlich, melden Sie sich bitte bei mir, wenn Sie weitergekommen sind. Ich kann diese Untat immer noch nicht fassen.“
Die drei Personen schritten zur Tür, und Vlassi ging der Gedanke durch den Kopf, dass es vermutlich keinen Sinn hatte, den Präsidenten nochmals zu befragen, dieser Mann schien aus Pappmaschee, und man brauchte nicht zu hoffen, dass er je eigene Ansichten entwickeln würde. An diesen Fall müsste man ganz anders herangehen. Und Vlassi wusste auch schon, wie. Und vor allem, wo.
3 Man nannte sie Mona Lisa
Julia Wunder und Vlassi erreichten gerade die Tiefgarage, die Hauptkommissarin ging auf ihren Dienstwagen zu, einen VW Passat, und eben wollte Vlassi mit seinem Einfall herausrücken, wie man bei diesem Mordfall am besten weiterkam, als hinter einem Mercedes ein nicht sehr großer Mann hervortrat. Er trug eine rote Hose, ein leuchtend hellblaues Sakko und ein gelbes Hemd ohne Krawatte. Das Auffallendste allerdings waren sein aufgezwirbelter Oberlippenbart, der an Salvador Dalí erinnerte, und sein schütterer hellbrauner Kopfschmuck – lange spiralförmige Haare, die gen Himmel und nach der Seite strebten.
Ohne sich vorzustellen, fragte er mit sonorer Stimme: „Es ist Frau Köckel-Simons, die tot im Hörsaal gefunden wurde?“
Julia sah die seltsame Erscheinung erstaunt an, und Kommissar Spyridakis war nahe daran zu fragen, ob es sich bei dem Unbekannten um das elfte Weltwunder handele.
„Sie sind doch die Kommissarin, die diesen Fall untersucht?“, wollte der Mann wissen.
„Ja, das bin ich“, bestätigte Julia, „Hauptkommissarin Wunder. Vielleicht haben Sie auch einen Namen?“
„Oh, natürlich, ich vergaß, mich vorzustellen. Ich bin Ulysses Sauerinsky, ich arbeite hier an der Hochschule, bin Professor für Design.“
„Warum überfallen Sie uns in der Tiefgarage, Herr Professor Sauerinsky?“
„Bitte verstehen Sie mich, ich wollte nicht oben in Sie dringen.“
Wie redet der denn?, dachte Vlassi. In uns dringen, das wird ihm nicht gelingen, höchstens mit einem Dolch, den er uns ins Fleisch stößt.
Julia allerdings erwiderte: „Haben Sie denn etwas zu verbergen, Herr Professor Sauerinsky?“
„Überhaupt nicht, ich wollte nur Gewissheit erlangen, ob es sich tatsächlich um Margaretella Köckel-Simons handelt.“
Julia fiel auf, dass der Design-Professor den Vornamen der Toten nannte. Kannte er sie etwa genauer? Laut sagte sie jedoch: „Ja, es handelt sich um Frau Köckel-Simons.“ Sie machte eine kleine Pause: „Aber das hätte Ihnen Präsident Schüttler auch sagen können.“
Sauerinsky ließ den Kopf ein wenig sinken: „Ich weiß nicht, er ist nicht sehr kommunikativ.“
Julia wurde sofort neugierig: „Spricht er nicht mit dem Personal, den Kollegen, meinen Sie das?
„Nun ja … ich will ihn nicht in ein schlechtes Licht rücken … er verschanzt sich gern in seinem Büro.“
Vlassi fragte vorwitzig: „Verschanzt er sich, und gräbt er sich auch ein?“
Julia warf ihm einen missbilligenden Blick zu und sagte in Richtung Professor Sauerinsky: „Mein Kollege Spyridakis – er will es immer ganz genau wissen.“
Zu ihrer Überraschung antwortete der Designer: „Ausgezeichnete Berufsauffassung, ich will es auch immer ganz genau wissen.“
Vlassi war von der Antwort angetan, dieser Paradiesvogel war nach seinem Geschmack. Er nickte ihm zu: „Der Präsident gräbt sich ein, stimmt das?“
„Nun ja, da Sie es ganz genau wissen wollen, sage ich ein Ja.“
„Danke für Ihr offenes Wort, Herr Professor Sauerinsky“, erklärte Julia, kam aber nicht weiter, da ihr der Design-Professor ins Wort fiel: „Lassen Sie den Professor weg, es genügt, wenn Sie mich mit meinem Namen ansprechen.“
„Wie Sie wollen, Herr Sauerinsky …“
Der Designer fiel ihr wieder ins Wort: „Stimmt es denn, dass sie erhängt wurde?“
„Woher wissen Sie das?“, fragte Julia zurück.
„Nun ja … dieser Herr Wöbbeking hat es mir gesagt.“
„Es stimmt“, erwiderte Julia, „können Sie uns vielleicht sagen, ob die Ermordete bei den Kollegen beliebt war?“
Der Angesprochene schaute sich in der Tiefgarage um, aber da war niemand zu sehen, dann antwortete er: „Wissen Sie, wie man sie hinter ihrem Rücken genannt hat?“ Er wartete keine Antwort auf seine rhetorische Frage ab, sondern gab sie selbst: „Man nannte sie Mona Lisa.“
Vlassi, dem die farbenfrohe Gestalt immer sympathischer wurde, teilte jetzt im Brustton der Überzeugung mit: „Mona Lisa kennt man natürlich. Ein Gemälde von Raffael.“
Der Professor schaute ihn mit einer gewissen Verwunderung an, während Julia Wunder schnell korrigierte: „Herr Spyridakis meint natürlich Leonardo.“
„Den meinte ich“, nahm Vlassi sofort das Angebot an, „Leonardo da Vinci.“
Professor Ulysses Sauerinsky nickte begütigend: „Ja, ja, die Mona Lisa von Leonardo ist ein Ölgemälde aus der italienischen Renaissance …“
Julia befürchtete eine Vorlesung in der Tiefgarage und ließ den Designer nicht ausreden: „Wieso nannte man Frau Köckel-Simons denn Mona Lisa?“
„Ich wollte es gerade erklären“, sagte Sauerinsky.
„Bitte fahren Sie fort“, erklärte Vlassi förmlich, der auf einmal von Wissbegier geplagt schien.
„Ich glaube“, teilte der Designer mit, „man nannte sie deshalb so, weil sie wie die Mona Lisa von Leonardo zugleich verführerisch und abweisend war.“ Er hielt einen Moment inne, um dann nachzuschieben: „Nicht wenigen galt sie als überheblich und frostig.“
Jetzt fühlte sich Vlassi gefordert: „Aber die Mona Lisa lächelt doch. Für mich wirkt das ziemlich gewinnend.“
„Sie müssen genauer schauen, Herr Spyridokoleios …“
„Spyridakis genügt mir“, sprach Vlassi in seine Antwort.
„Herr Spyridakis“, korrigierte sich der Professor, „Sie lächelt, die Mona Lisa, ja, ja, aber das ist es gerade. Sie lächelt zurückweisend.“
„Herr Sauerinsky“, griff jetzt Julia ein, „wollen Sie damit sagen, dass die Ermordete einige Leute abgewiesen hat und deshalb unbeliebt war?“
„Nun ja, manche haben sie sogar mit Furcht betrachtet.“
Vlassi begann laut zu denken: „Wenn man jemanden fürchtet – ist der dann unbeliebt?“
„Eine kluge Frage“, bemerkte Sauerinsky.
„Haben Sie sich auch vor Frau Köckel-Simons gefürchtet?“, fragte Julia den Designer.
„Nein, ich habe mich nicht gefürchtet, aber der Spottname für sie hat schon eine gewisse Berechtigung. Denn wie bei der Mona Lisa von Leonardo hatten manche wohl das Gefühl, dass bei der Kollegin irgendetwas nicht zusammenpasst.“ Er machte eine kleine Pause, um dann fortzufahren: „Sie kennen doch das Bild von Leonardo?“
Vlassi hob die Hände nach oben, eine Geste, die andeuten sollte, dass das für einen Mann von Welt wie ihn doch keine Frage war, Julia sah den Professor auffordernd an.
„Der große Leonardo hat mit einem Trick gearbeitet“, fuhr Sauerinsky fort, „er hat das Bild in zwei verschiedenen Perspektiven gemalt, eine für den Hintergrund und eine für die Figur. Der Betrachter kann sich das nicht erklären, bekommt aber den Eindruck, dass hier etwas nicht stimmt …“
Julia wurden die Ausführungen zu lang: „Und etwas stimmte auch bei Frau Köckel-Simons nicht?“
Ulysses Sauerinsky nickte.
„Sagen Sie mal“, wollte Vlassi plötzlich wissen, „besaß die Tote auch einen Silberblick wie die echte Mona Lisa? Das macht doch den geheimnisvollen Charakter des Porträts aus.“
„Einen Silberblick hatte Frau Köckel-Simons nicht“, erwiderte der Designer bestimmt.
„Aber etwas stimmte mit ihr nicht“, kam Julia auf Sauerinskys Ausführungen zurück, „aber was?“
„Ich wollte Ihnen lediglich den Spottnamen für sie erklären“, antwortete der Designer.
„Was für ein Verhältnis hatten Sie denn zu ihr?“, wollte Julia wissen.
„Frau Köckel-Simons war eine Kollegin, ich darf sagen, eine geschätzte Kollegin.“
„Und was schätzten Sie so an ihr?“, wollte Vlassi wissen.
„Sie wollen es ganz genau wissen“, lächelte Sauerinsky, und die Enden seines Oberlippenbarts zeigten mit einem Mal straff nach oben, „ja, ja, das ist gut. Also – ich schätzte ihr enormes Fachwissen, sie war eine absolute Expertin auf ihrem Gebiet.“
Vlassi kam in Fahrt: „Sie haben nicht vielleicht eine Idee, wer sie umgebracht haben könnte? Vielleicht hat jemand sie nicht so geschätzt?“
Julia musste grinsen, allerdings nach innen, Vlassi lernte schnell, die direkte Fragemethode, die er gerade benutzte, hatte sie ja vor Kurzem beim Präsidenten Schüttler angewandt.
Doch der Designer reagierte auf Vlassis Frage gar nicht abweisend oder empört, er hob stattdessen leicht die Schultern, und sein Dalí-Bärtchen schien sich zu entspannen: „Treffende Frage! Ich würde Ihnen am liebsten einen Namen nennen.“ Seine Stimme senkte sich, und er beugte sich etwas vor: „Den Namen des Mörders natürlich. Leider fällt mir keiner ein.“
„Denken Sie auch angestrengt nach?“, wollte Vlassi wissen, und Sauerinsky antwortete: „Unentwegt, unentwegt.“
Julia machte der kleinen Komödie ein Ende. „Sagen Sie, Herr Sauerinsky, war das Verhältnis von Frau Köckel-Simons zu den Studenten auch abweisend und überheblich?“
„Wie soll ich sagen?“, antwortete Sauerinsky ausweichend, „eher nicht, in Einzelfällen aber schon.“
„An den Einzelfällen sind wir besonders interessiert“, ließ sich Vlassi hören, „können Sie da mit einem Namen dienen?“
„Einen Namen, einen Namen …“, sinnierte Ulysses Sauerinsky, um dann wie für sich zu sprechen: „Sie hat kürzlich einen Bachelor-Kandidaten durchfallen lassen, der ist natürlich nicht gut zu sprechen auf sie …“ Er machte eine nachdenkliche Miene: „Wie heißt er noch mal …?“
„Woher wissen Sie das denn, dass sie jemanden hat durchfallen lassen?“, fragte Julia.
„Das erfährt man schnell, wir sind ja keine Massen-Hochschule, bei uns geht es überschaubar zu …“
„Fällt nur alle Schaltjahre bei Ihnen jemand durch?“, fiel Vlassi dem Design-Professor ins Wort.
Sauerinsky grinste anzüglich: „Kann man so sagen, bei uns fällt selten jemand durch … ah, und jetzt steigt auch der Name in mir auf.“
Der Mann ist nicht nur äußerlich verstiegen, dachte Vlassi, während er seinen Blick vom gelben Hemd zum Dalí-Bärtchen des Designers schweifen ließ, in dem steigen sogar die Namen auf. Wer weiß, vielleicht steigt er selbst manchmal wohin, vielleicht ist er auch auf die elektrische Tafel gestiegen und hat die Kunsthistorikerin oben aufgeknüpft.
„Wenn ich mich recht erinnere, trägt er den Namen Wiehn“, fuhr Sauerinsky fort, „wie die Stadt, nur mit h.“
Julia zog ihr Moleskine-Notizbuch hervor: „Wissen Sie auch den Vornamen?“
„Steigt er auch in Ihnen auf?“, schob Vlassi fragend nach.
„Er steigt, er steigt“, erwiderte Sauerinsky unverzüglich, „sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, er heißt mit Vornamen Florian.“
„Also Florian Wiehn“, fasste Julia zusammen.
„Wahrscheinlich.“
Julia störte sich nicht am Wahrscheinlich, notierte sich den Namen, um dann zu sagen: „Danke für Ihre Hilfe, Herr Sauerinsky. Vielleicht können Sie mir Ihr Kärtchen geben, falls ich Sie noch einmal benötige.“
„Kärtchen?“, fragte der zurück, „ich habe keine Kärtchen, ich kann Ihnen aber eine selbst entworfene Visitenkarte geben. Sie ist, unter uns gesagt, ein Vermögen wert – behandeln Sie sie sorgfältig.“
„Ein Vermögen?“, fragte Vlassi gierig.
Der Designer nickte: „Kennen Sie denn nicht die Servietten-Geschichte von Picasso?“ Er wartete keine Antwort ab, sondern sprach weiter: „Als Picasso in Paris lebte und nicht viel verdiente, öffnete er hin und wieder sein Atelier für Besucher. Das waren häufig Frauen, die vom Mittagessen kamen. Sie wollten ein Andenken haben, holten ihre Servietten vom Essen heraus und baten Picasso um seine Signatur. Der zeichnete eine Kleinigkeit dazu, einen Hund oder eine Katze – die Damen gingen hochbefriedigt von dannen …“
„Ja und?“, unterbrach ihn Vlassi ungeduldig – er wollte schließlich wissen, was es mit dem Vermögen auf sich hatte.
Sauerinsky streckte sich, und sein Dalí-Bärtchen streckte sich mit ihm und wurde plötzlich ganz spitz: „Heute gibt es sogenannte Servietten-Ausstellungen von Pablo Picasso, die kleinen Andenken aus seiner Pariser Zeit sind inzwischen ein Vermögen wert.“
Vlassi ächzte auf, während Julia den Design-Professor nachdenklich anschaute: „Ist ja hochinteressant, was man von Ihnen alles erfahren kann. Wenn ich eine Visitenkarte von Ihnen bekomme, dann sollte ich sie unbedingt für die Nachwelt aufbewahren, ja?“
Sauerinsky und sein Bärtchen entspannten sich: „Ich rate dringend dazu. Denken Sie immer an Picasso. Zu seiner Pariser Zeit waren seine Servietten nichts wert.“ Er machte eine kleine Pause, und sein Gesicht nahm eine schwelgerische Note an: „Aber heute!“
Vlassi fand seine Sprache wieder: „Wie viel ist denn so eine Picasso-Serviette heute wert?“
Der Design-Professor warf einen müden Blick auf ihn: „Wozu wollen Sie das wissen? Es würde Ihnen die Sprache verschlagen, und außerdem sind Sie doch überhaupt nicht im Besitz einer solchen Serviette.“
Vlassi hätte gern geantwortet: Was glauben Sie, welche Servietten ich besitze. Eine von Picasso ist bestimmt dabei, ich muss sie nur finden – doch seine Chefin Julia räusperte sich vernehmlich und teilte mit: „Danke für Ihre kleine Vorlesung, Herr Sauerinsky. Ihre Visitenkarte bitte.“
Der Designer griff in die Seitentasche seines hellblauen Sakkos und zog – nein, keine anständige Visitenkarte, sondern einen winzigen speckigen Karton hervor und hielt ihn hoch. Das Kärtchen sah nicht nur unscheinbar aus, sondern abgenutzt und verdreckt, als hätte es einige Jahrhunderte in der farbenfrohen Kleidung des Designers ausgeharrt, sodass Vlassi fragte: „Müssen wir Ihnen das zurückgeben?“
„Nein, nein“, erwiderte Professor Sauerinsky, „Sie können meine Visitenkarte behalten. Sie ist ein Geschenk von mir.“
„Und wann, meinen Sie, wird sie wertvoll?“, konnte sich Vlassi nicht verkneifen zu fragen.
Sauerinsky richtete sich auf, doch die Enden seines Dalí-Bärtchens schienen auf einmal etwas kraftlos und krümmten sich nach unten: „Warten Sie auf meinen Tod. Wenn ich unter der Erde liege und die Würmer an mir nagen, wird dieses kleine Kunstwerk hier explodieren.“
Ist denn da auch Sprengstoff drin?, wollte Vlassi fragen, unterdrückte diese Regung aber, denn Sauerinskys Miene wirkte zu feierlich.
Doch Hauptkommissarin Wunder wollte wissen: „Sie sprechen von Ihrem Tod, Herr Sauerinsky, glauben Sie denn, dass auch Sie in Gefahr sind?“
„Wer weiß, wer weiß. Wer hätte denn gedacht, dass Frau Köckel-Simons so schnell sterben würde. Auf unwürdige Weise hat sie ihr Leben hergeben müssen.“
Vlassi wollte im ersten Moment auch hier eine Frage einschieben, nämlich die, wie man auf würdige Art sein Leben hergeben kann. Er unterließ es aber, denn ihm fiel ein, dass er schließlich im letzten Fall diese bedeutsame Thematik schon für sich geklärt hatte, und er konnte sich zugutehalten, dass Julia Wunder vollkommen auf seiner Seite gewesen war.
Jetzt endlich streckte Sauerinsky seine Hand mit der Visitenkarte vor und überreichte sie mit feierlichem Gesicht der Hauptkommissarin. Sodann verabschiedete er sich, senkte dabei seinen Kopf und teilte mit: „Mein Wagen steht ebenfalls hier in der Tiefgarage.“
Er drehte sich um und ging auf ein Auto zu, das vor vielen Jahrzehnten vielleicht einmal jung und hip war. Es handelte sich um eine Art Methusalem in der Autobranche, einen Citroën 2CV, im Volksmund auch als hässliches Entlein bekannt. Obendrein war das Entlein noch von einem blassen Rot. Der Designer stieg ein und ließ das Vehikel an. Nach mehreren krächzenden Versuchen des Motors, Luft und Benzin zu bekommen, nahm er endlich einen unrunden Lauf an, Sauerinsky rollte nach hinten, klappte das Seitenfenster nach oben und hob die Hand zum Gruß, dann machte er mit dem Gefährt einen hopsenden Sprung nach vorn und verließ die Tiefgarage.
Unsere beiden Wiesbadener Kommissare schauten dem hässlichen Entlein staunend nach, und Vlassi sagte nachdenklich: „Einem Fahrer von einem solchen Auto traue ich Dinge zu, von denen ein Rolls-Royce-Chauffeur vornehm zu schweigen wüsste.“
4 Sind Leichen zu bewundern?
Julia schwieg, als sie zu ihrem Passat ging. Sie schwieg auch noch, als Vlassi neben ihr Platz nahm, und sie schwieg, als sie aus der Tiefgarage den Weg nach oben suchten. Vlassi überlegte bereits, was es war, das ihr die Sprache verschlagen hatte, denn er wusste: Wenn seine Chefin schwieg, dann sann sie nach, dann hatte sie eine Fährte aufgenommen. Ich sollte auch nachdenken, dachte er, vielleicht komme ich auf die gleiche Spur wie sie, und er setzte seine grüblerischste Miene auf.
Doch da begann Julia Wunder zu reden: „Diese Servietten-Geschichte von Picasso, die uns Sauerinsky erzählt hat, wie fanden Sie die?“
„Sehr informativ, geradezu rührend“, stellte Vlassi fest, „ein absolut menschlicher Künstler.“
„So könnte man denken. Leider bietet sie nur die halbe Information über den Maler“, erwiderte Julia stirnrunzelnd.
„Wieso?“
„Unter Fachleuten ist bekannt“, erzählte Julia, „dass Picasso in den Pariser Restaurants sein Essen bezahlte, indem er eine Zeichnung auf das Tischtuch malte. Aber wenn er vom Restaurant-Chef gebeten wurde, doch auch seine Unterschrift dazuzusetzen, lehnte Picasso ab. Wissen Sie, warum?“
„Keine Ahnung.“
„Dann kläre ich Sie jetzt mal auf, damit Sie mehr von Künstlern verstehen“, erwiderte Julia. „Picasso, um seine Signatur gebeten, sagte dem Chef des Etablissements: Glauben Sie, ich wollte das ganze Lokal kaufen!“
„Tatsächlich?“, staunte Vlassi. „Das kommt mir gar nicht mehr rührend vor. Woher wissen Sie das denn?“
„Mein kunstsinniger Freund Markus Clauer hat mir das erzählt, er ist Kulturredakteur bei der Tageszeitung Rheinpfalz und kennt sich sehr gut aus.“