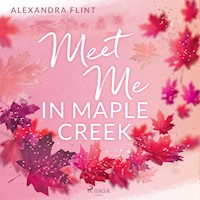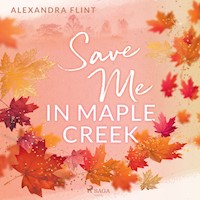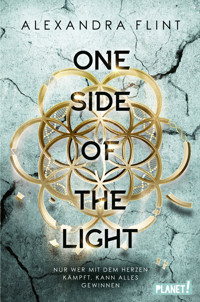14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wer Bücher liebt, wird diese Geschichte verschlingen! Tief unter den Gassen von Paris schlummert ein uraltes Mysterium, das das fragile Gleichgewicht der Welt bewahrt: die Weltenbibliothek Mondia, ein verborgener Ort voller Bücher, die über das Schicksal der Menschheit wachen. Davon ahnt die 19-jährige Remy jedoch nichts, die ein normales Leben führt und ihre Zeit am liebsten in der Werkstatt im Blumenladen ihrer Schwester verbringt. – Bis eines Tages Kasimir in den Laden stolpert und ein magisches Kästchen verlangt, das in Remys Besitz sein soll. Denn sie ist die letzte Erbin der Ripari, einer Familie, deren Blutlinie seit Jahrhunderten die Bibliothek beschützt. Und nun liegt es in ihren Händen, die Mondia vor den Schatten der Zerstörung zu bewahren. Doch während Remy und Kasimir sich den drohenden Gefahren stellen, lauern ihre Feinde bereits im Verborgenen, entschlossen, die Welt, wie wir sie kennen, für immer zu vernichten … Silent Secrets ist der emotionale und starke Auftakt der Mondia-Dilogie – die Geschichte besticht mit einer actiongeladenen Handlung voller Twists, einer starken Heldin, einem atemberaubenden Setting über- und unterhalb von Paris und einer magischen Liebesgeschichte, die Herzen brechen wird. Die Romantasy-Dilogie der Bestsellerautorin kommt im wunderschönen Gewand daher: Als Hardcover mit Schutzumschlag, haptisch hochwertigem Naturpapier, edler Goldprägung und exklusiv in der 1. Auflage eingelegtem Page Overlay, wird es zu einem Schmuckstück in jedem Bücherregal. Die Mondia-Dilogie: // Band 1: Silent Secrets Band 2: erscheint im Frühjahr 2025 // »Eine Geschichte voller Spannung, fesselnder Wendungen und tiefer Emotionen. Alexandra weiß einfach, was Romantasy-Herzen höher schlagen lässt.« Julia Dippel, SPIEGEL-Bestseller-Autorin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Buch
Tief unter den Gassen von Paris schlummert ein uraltes Mysterium, das das fragile Gleichgewicht der Welt bewahrt: die Weltenbibliothek Mondia, die über das Schicksal der Menschheit wacht. Davon ahnt die 19-jährige Remy jedoch nichts. Sie verbringt ihre Zeit am liebsten in ihrer kleinen Werkstatt – bis eines Tages Kasimir in ihr Leben stolpert und ein magisches Kästchen verlangt, das in Remys Besitz sein soll. Denn sie ist die letzte Erbin der Ripari, einer Familie, deren Blutlinie seit Jahrhunderten die Bibliothek beschützt. Und nun liegt es in ihren Händen, die Mondia vor den Schatten der Zerstörung zu bewahren. Doch während Remy und Kasimir sich den drohenden Gefahren stellen, lauern ihre Feinde bereits im Verborgenen, entschlossen, die Welt für immer zu vernichten …
Die Autorin
© Maximilian J. Dreher
Alexandra Flint veröffentlichte unter dem Namen Alexandra Stückler-Wede bereits mehrere Romane und wurde 1996 in der Nähe von Hannover geboren. Die Autorin lebt mit ihrem Mann im Herzen von München, wo sie Elektro- und Informationstechnik studierte und sich seit 2021 ganz der Literatur widmet. Ihre ersten Geschichten verfasste Alexandra bereits mit sieben Jahren. Neben dem Schreiben bloggt sie als @alexandra_nordwest auf Instagram über Bücher und das Autorenleben oder reist mit Rucksack und Zelt um die Welt.
Zu ihren liebsten Genres gehört alles, was mit fantastischen Welten, tiefen Gefühlen, Spannung und Magie zu tun hat. Genauso wie ihr Herz an dunklen Geheimnissen, verworrenen Schicksalen und Charakteren hängt, die immer wieder über sich hinauswachsen.
www.alexandraflint.de
Instagram: @alexandra_nordwest
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Planet! auch!Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor:innen und Übersetzer:innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator:innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher und Autor:innen auf:www.thienemann.de
Planet! auf Instagram:https://www.instagram.com/thienemann_booklove
Planet! auf TikTok:https://www.tiktok.com/@thienemannverlage
Viel Spaß beim Lesen!
Alexandra Flint
Silent Secrets
Planet!
»Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat,
ist die der Bücher die Gewaltigste.«
Heinrich Heine
Playlist
Dernière danse – Indila
Chasing Cars – Snow Patrol
Nothing Is As It Seems – Hidden Citizens, Ruelle
Je te pardonne (fest. Sia) – GIMS, Sia
Pompei MMXXIII – Bastille, Hans Zimmer
In My Blood – Tommee Profitt, Fleurie
Hungry Hearts – Declan J Donovan
Luminary – Joel Sunny
RUNNING – NF
Way Beyond – Bastille
Up In Flames – Ruelle
Got It In You – BANNERS
Supermassive Black Hole – Muse
Rolling in the Deep – Adele
Fighter – The Score
Hit Sale – Therapie TAXI, Roméo Elvis
Hurts Like Hell – Tommee Profitt, Fleurie
Für M.
Ich kann es nicht erwarten,
deine Geschichte zu lesen.
Prolog
Pyrenäen, vor 19 Jahren
Der Schnee fällt dicht und flockig aus den tiefhängenden Wolken. Wie undurchdringbare Spinnweben bedecken sie beinahe jeden Winkel des Himmels, sodass die dunkle Nacht darüber kaum erkennbar ist. Kein einziger Stern ist zu sehen, nicht einmal der sonst so helle Vollmond, und die Welt wirkt beinahe so, als würde sie den Atem anhalten, während der Schneesturm über die schroffen Hänge der Pyrenäen peitscht. Das alles scheint in meinen Augen wie eine stumme Warnung der Natur, weiterzufahren. Diesem Weg zu folgen, der uns unweigerlich zu einem Punkt führt, an dem es keine Umkehr mehr gibt. Nur diesen einen Moment, diese eine gefällte Entscheidung, die alles verändert und nichts zurücklässt.
Ich schaue auf meine kalten Hände herab. Sie zittern ein wenig, genauso wie unser viel zu kleines Auto, das immer wieder von heftigen Böen erfasst und durchgeschüttelt wird. Es ist Wahnsinn, was wir hier machen. Leichtsinn in seiner gefährlichsten Form. Unser fast fünfzehn Jahre alter Renault ist kaum für normale Langstrecken geeignet, ganz zu schweigen von der schmalen, steilen Passstraße, über die wir ihn jetzt gnadenlos treiben. Aber wir haben nur den Clio und das hier ist unsere einzige Chance.
Nervös knete ich meine Finger und blicke wieder raus in die Dunkelheit. Das gelbliche Licht der altersschwachen Scheinwerfer dringt nur spärlich durch den Schnee und die Finsternis dahinter – und nicht zum ersten Mal frage ich mich, ob das nicht alles ein riesengroßer Fehler gewesen ist. Ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Für unsere Kinder. Für uns. Für sie.
»Jeanne.«
Mein Name aus seinem Mund, so warm und zärtlich ausgesprochen, reicht aus, um mich aus meinen verworrenen Gedanken zu holen.
Andrés braune Augen sind unverwandt auf die kurvige Straße gerichtet und doch weiß ich, dass er mich ansieht. Bei ihm fühle ich mich immer gesehen. Mit meinen Gedanken, meinen Ängsten. Es ist seine ganz besondere Fähigkeit fernab von all den unerklärlichen Dingen dieser Welt. Meiner alten Welt. Mein Mann sieht mehr, als ich vielleicht jemals begreifen werde. Deswegen hat er auch keine Fragen gestellt, als ich ihn aus dem Schlaf gerissen und zum Aufbruch gedrängt habe. Als ich hektisch ein paar Dinge in zwei große Taschen gepackt und unsere Kinder aus ihren Bettchen geholt habe. André hat keine einzige Frage gestellt, keine Erklärung gefordert, mir nur in die Augen geschaut und genickt. Weil er es gesehen hat. Die Angst in meinem Blick. Die Dringlichkeit, Paris zu verlassen. Die Antworten, die ich ihm nicht geben kann.
Mon Dieu, ich habe mich noch nie in meinem Leben so gefürchtet.
Ich denke an den Brief mit dem Zahnrad und zucke zusammen.
Ich denke an die Worte und bekomme eine Gänsehaut.
Ich denke daran, was es für mein kleines Mädchen bedeutet und spüre, wie alles in mir ganz kalt wird.
Angst.
Todesangst.
Wie von selbst gleiten meine Augen zu der alten Ledertasche, in der sich diese verbotenen Worte und das kleine, goldene Zahnrad befinden. Eine stetige Erinnerung an das, was ich getan habe. An den wohl größten Fehler, den ich jemals begangen habe. Ich würde alles dafür geben, diese eine Nacht ungeschehen zu machen und gleichzeitig möchte ich nichts daran ändern. Weil es bedeuten würde, mein kleines Mädchen aufzugeben, und das würde ich niemals tun. Nur über meine Leiche. Ich wünschte einfach, es wären andere Umstände. Eine andere Welt, in der diese Regeln, die ihren Tod bedeuten, nicht existieren.
»Jeanne«, sagt André wieder und ich schlucke.
»Es tut mir leid.«
Kopfschüttelnd umfasst er das Lenkrad fester, als die nächste Kurve kommt. »Wir müssen umdrehen. Es ist zu gefährlich bei diesem Schneesturm noch höher in die Berge zu fahren.«
Ich wandte mich nach hinten um. Zu unserem zweijährigen Sohn Clément und seiner kleinen Schwester Genevieve, die kaum ein halbes Jahr alt ist. Beide schlafen in ihren Kindersitzen, bekommen nicht mit, wie die Erde um sie herum bebt. Wie knapp unsere Flucht aus dieser verdammten Stadt gewesen ist.
Wir können nicht zurück. Nicht bei dem, was uns dort erwartet. Sie wissen von ihr und sie werden sie töten. Sie werden uns alle töten. Oder Schlimmeres.
»Wir können nicht zurück«, spreche ich meine Gedanken im nächsten Moment laut aus. Meine Stimme ist ganz rau von den ungeweinten Tränen, die mir seit Stunden die Luft zum Atmen nehmen.
André wird langsamer und mein Herz beginnt zu rasen. Dann bleibt er mitten auf der Straße mit laufendem Motor stehen, schaltet in den Leerlauf und flucht leise. Ich glaube, ich habe ihn noch nie zuvor fluchen gehört. Das passt nicht zu ihm, aber es passt zu dieser Situation. Zu dieser ganzen vermaledeiten Situation, in die ich uns gebracht habe.
»Ich liebe dich, Jeanne, das weißt du. Ich liebe dich mehr, als ich es jemals in Worte fassen könnte, und genau deswegen werde ich nicht weiterfahren. Diese Straße wird uns umbringen.«
Meine Augen beginnen zu brennen.
»Mir ist bewusst, dass ich vieles über dich und deine Vergangenheit nicht weiß. Du hast unzählige Geheimnisse vor mir und ich habe dich nie um eine Erklärung gebeten, aber hier und jetzt flehe ich dich an, Jeanne. Rede mit mir. Sag mir irgendetwas. Und wenn nicht für uns, dann für unsere Kinder.«
Ich bebe innerlich. Schneidende Furcht gräbt ihre Krallen in meine Eingeweide. »Ich kann nicht. Ich kann es dir nicht erzählen. Du … du musst mir einfach vertrauen.« Wieder wird meine Zunge zu einem harten Knoten, sobald die Sprache auf dieses Thema fällt, auf diesen Teil meines Lebens, den ich vor etwas mehr als einem Jahr hinter mir gelassen habe und der nach all der Zeit doch wieder Jagd auf mich macht. Auf meine Familie und mich. Dabei habe ich geglaubt, ihr entkommen zu können. Wie naiv ich doch gewesen bin.
»Bitte glaube mir, André, ich wünschte, ich könnte es dir sagen, aber ich …«
»Du kannst nicht.« Seine Stimme ist nicht länger warm. Kühle Resignation schwingt darin mit und lässt mich erschaudern. Plötzlich bekomme ich noch aus einem ganz anderen Grund Angst. Ich kann das nicht ohne ihn tun. Ich bin zu schwach. Bin es vielleicht schon immer gewesen.
Sei tapfer. Sei mutig. Sei unerschrocken.
»Lass uns weiterfahren. Bitte. Wir können im nächsten Dorf anhalten und dort die Nacht verbringen, nur … nicht zurück.«
Er sieht mich lange an, während das Stottern des alten Motors und das Rauschen des Windes außerhalb des Wagens die Stille füllen. Dann seufzt er leise. »Wir sind vor knapp einer Stunde an der letzten Siedlung vorbeigekommen. Lass uns dahin fahren und den Sturm abwarten. Danach können wir immer noch in Ruhe weitersehen.«
Allein bei dem Gedanken daran, uns Paris wieder zu nähern, zieht sich alles in mir zusammen, aber der kleine logische Teil in mir, der noch nicht vollends von meiner Panik verschlungen worden ist, weiß, dass André recht hat. Weiterzufahren wäre Selbstmord. Allein, dass wir es bis hierher geschafft haben, ohne von der Straße abzukommen, grenzt schon an ein Wunder und ich habe unser Glück schon genug herausgefordert.
Ich nicke kaum merklich und greife nach der Hand, die mir André hinhält. Unsere Finger verflechten sich wie von selbst und sofort beruhigt sich mein viel zu schnell schlagendes Herz.
»Es wird alles gut, Jeanne. Es wird alles gut, solange wir einander niemals loslassen. Erinnerst du dich?«
Seine Worte sorgen dafür, dass sich einer meiner Mundwinkel wie von selbst hebt. Er kann gar nicht anders. Ich nicke wieder. »Niemals.«
»Niemals«, wiederholt er, haucht einen Kuss auf meine kalten Fingerknöchel und greift dann nach dem Schalthebel, um uns in Sicherheit zu bringen.
Und einen Augenblick lang glaube ich wieder daran. An diese süße Illusion, dass wir gemeinsam in Sicherheit sein können. Dass es dieses gut irgendwo da draußen wirklich gibt. Dass André, Clément, Genevieve und ich neu anfangen können. Weit weg von Furcht und Angst, von diesen verfluchten Worten und Büchern und Geheimnissen.
Weit weg von ihm.
Es ist ein schöner Augenblick, ein leichter Augenblick.
Der Augenblick, den André braucht, um den Wagen zu wenden.
Der Augenblick, in dem sich mein halbes Lächeln, das André mit einem ganzen erwidert, echt anfühlt. Wärme breitet sich in meiner Brust aus. Der Druck lässt ein wenig nach.
»Ich liebe dich«, sage ich und lege ihm eine Hand auf den Oberschenkel.
André streicht federleicht über meine Haut und öffnet den Mund, doch die Silben kommen ihm nie über die Lippen. Weil dieser leichte Augenblick im nächsten Moment abrupt bricht, wie eine Schallplatte, die ihr Ende erreicht hat, und die Illusion in unzählige scharfkantige Splitter zerreißt.
Das Davor von dem Danach trennt.
Irgendetwas kracht ungebremst in unseren Wagen, ein ohrenbetäubendes, kreischendes Knallen, das meinen Kopf explodieren lässt, während sich die Welt aus Schnee und Dunkelheit und gelbem Schein um uns herum dreht. Immer und immer weiter, bis ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Bis es nur noch Rot und Schmerz und Lärm gibt. Glas knirscht, Metall kreischt. Es scheint eine Ewigkeit zu dauern. Und vielleicht auch noch eine zweite. Ich kneife die Augen zusammen und schreie. Schreie, weil ich Clément und Genevieve weinen höre. Schreie, weil André keinen einzigen Laut von sich gibt. Schreie, bis meine Stimme versagt und es endlich aufhört. Es still wird. So verflucht und endgültig still.
Ich wage kaum zu atmen, weil jeder einzelne Atemzug wie Feuer brennt und klingt, als wäre es mein letzter. Und dennoch hole ich vorsichtig Luft und öffne die Augen. Für meine Familie.
Das Erste, was ich bemerke, ist, dass es nicht mehr schneit. Es stürmt auch nicht mehr und die Nacht ist nicht länger finster, sondern in das sanfte Licht des Vollmonds gehüllt. Für einen Moment glaube ich, dass ich mir alles nur eingebildet habe. Die Gefahr, die vielen Überschläge, doch dann schaue ich nach links, wo André starr mit weit aufgerissenen Augen in seinem Sicherheitsgurt hängt. Ich schaue nach hinten, wo Clément reglos in seinem Kindersitz kauert. Wo Genevieve im Fußraum liegt und sich nicht mehr rührt. Ich schaue sie an, sehe das Blut, die Glassplitter, und das Leben, das längst aus ihren kleinen Körpern gewichen ist. Panisch versuche ich mich aus meinem Sitz zu stemmen, ignoriere jeden Schmerz, weil ich nur daran denken kann, zu ihnen zu gelangen, sie an mich zu drücken, doch etwas hält mich zurück. Meine Beine sind eingequetscht, ich spüre sie nicht mehr und das scharfkantige Teil, das aus meinem Oberkörper ragt … Ich schreie wieder. Lautlos dieses Mal, weil ich keine Kraft mehr habe, weil ich zu meinen Kleinen möchte und es nicht kann.
Weil ich nicht mit ihnen gestorben bin.
Kalter Wind zieht durch die gesprungenen Fenster, er riecht nach Benzin und Blut und Tod.
Meine Familie ist tot.
Ich sacke in mich zusammen, weil ich mich nicht länger aufrecht halten kann und weil ich hilflos und machtlos bin. Da ist zu viel. Viel zu viel von allem. Irgendwie hole ich ein weiteres Mal keuchend Luft und hoffe gleichzeitig, dass es das letzte Mal ist. Dass mich der Tod genauso zu sich zerrt, wie er es mit meiner Familie getan hat. Dass es schnell geht.
Alles wird gut. Ich lasse dich nicht los.
Die Gedanken klingen wie André in meinem Kopf. Als würde er direkt neben mir sitzen, als würde er noch leben. Ich schaffe es nicht, noch einmal zu ihm oder unseren Kindern zu schauen, ich schaffe es einfach nicht. Stattdessen lasse ich den Kopf auf die andere Seite fallen und erschrecke, als ich dort durch das gesplitterte Seitenfenster hindurch einen weißen Panther erblicke. Und anders als zuvor weiß ich sofort, dass ich nicht träume. Ich erkenne den Panther und ich kenne seine Bedeutung.
Ich bin immer für dich da.
Ein paar stotternde Schläge meines schwachen Herzens lang sehen wir einander an. Seine goldenen Augen sind hell und klar und beinahe schmerzhaft intelligent. Ich meine Trauer und Bedauern darin lesen zu können. Kaum merklich neigt er den Kopf, dann setzt er sich lautlos in Bewegung, schleicht um das zerbeulte Auto herum, bis er aus meinem Blickfeld verschwindet. Nur einen Sekundenbruchteil später, so kommt es mir vor, taucht er wieder an meiner Seite auf. In seiner Schnauze hängt ein lebloses Bündel. Hellbrauner Babyflaum lugt aus dem Tuch, das mit Blut befleckt ist, als hätte man grausame, rote Blumen daraufgestickt.
Genevieve.
»Nicht«, möchte ich sagen, schreien, kreischen, doch alles, was ich über die Lippen bringe, ist ein feuchtes Röcheln, in dem ich den verräterischen Geschmack von Blut erkenne. Lass mein kleines Mädchen bei mir. Lass uns zusammen gehen. Lass –
Der Gedanke bricht abrupt ab, als ich eine winzige Bewegung ausmache. Ein kaum merkliches Zucken zwischen den Stofflagen, eine winzige Babyhand, die sich rührt, die … Sie lebt. Genevieve, sie … Mein Herzschlag setzt aus, nur um im beinahe gleichen Moment wieder loszurasen.
Mein kleines Mädchen hat überlebt.
Ich schaue wieder zu dem Panther und zucke zurück, als mir der funkelnde Gegenstand auffällt, der neben dem Bündel in seinem Maul baumelt. Eine goldene Kette mit einem kleinen Zahnrad daran. Ein so winziges, scheinbar belangloses Detail, das in diesem Moment jedoch alles bedeutet. All das, vor dem ich Genevieve zu beschützen versucht habe. All das, was uns hierhergeführt hat. All das, was ich falsch gemacht habe.
Ich sehe dem Panther in die Augen und bringe ein schwaches Kopfschütteln zustande. Nein. Bitte. Bitte … bring sie nicht zurück. Lass nicht zu, dass ein unschuldiges Kind in diesen Kampf gezogen wird. Bitte. Ich weiß, dass er mich nicht hören kann, ich bin nicht wie sie, ich bin nicht er, aber ich hoffe es. Ich hoffe es mit jedem Funken Leben, den ich noch in mir trage. Bitte, ich flehe dich an. Beschütze sie vor dieser Welt. Du weißt, dass sie darin keinen Platz finden wird.
Noch einen Augenblick länger erwidert er meinen Blick. Der Moment dehnt sich aus, in dem ich meine Gedanken wieder und wieder in seine Richtung schreie, weil mir für laute Worte schlichtweg die Kraft fehlt.
Der Panther wird ganz ruhig, starr, beinahe wie eine Erscheinung, die nur in meiner Fantasie existiert. Und dieses eine Mal wünschte ich, ich wäre wirklich ein Teil ihrer Welt, würde dazugehören und könnte verstehen, was in seinen Gedanken vor sich geht. Doch ich gehöre nicht dazu. Habe ich nie. Und als der Panther seine klugen bernsteinfarbenen Augen abwendet, weiß ich, dass ich jetzt den Preis dafür zahlen muss. Ich folge seinem Blick, sehe den Rauch, der aus der zerbeulten Motorhaube aufsteigt. Sehe die Flammen, die bereits am Metall lecken und den alten Lack Blasen schlagen lassen.
Zu spät. Zu spät für so vieles.
Ich spüre, wie mir nutzlose Tränen über die Wangen laufen, wie die Welt vor mir verschwimmt. In Rauch und Flammen und Taubheit. Sehe, wie sich der Panther umdreht, wie seine schlanke, schneeweiße Gestalt von den Schatten verschluckt wird, bis ich ihn und meine Tochter aus den müden Augen verliere.
Bis ich allein zurückbleibe.
Alles wird gut, Jeanne, solange wir einander niemals loslassen.
Ich lächele und weine und greife nach Andrés kalter, blutverschmierter Hand, als seine Worte meine Gedanken fluten. Die einzigen Worte, die ich jemals wirklich geliebt habe.
Es wird alles gut.
Die Flammen werden gieriger, mein Herzschlag langsamer. Ich denke an Genevieve, an Clément, an André. Ich denke an sie alle, während ich immer weniger denke. Immer weniger werde. Bis es endlich aufhört und gleichzeitig neu beginnt.
Es wird alles gut.
Es wird alles gut.
Erster Teil »Geheimnisse, die uns rufen«
Kapitel 1
7. Arrondissement, Paris
Remy
»Es wird alles gut.« Beschwichtigend hob ich die Hände und rutschte näher an meine beste Freundin heran, die in diesem Moment wirkte, als würde sie entweder gleich in Tränen ausbrechen oder explodieren. Das konnte man bei Ninette nie so genau sagen. »Es wird alles gut, Ninnie. Du wirst schon sehen.«
Zweifelnd zog sie ihre schmalen Augenbrauen hoch und schüttelte so nachdrücklich den Kopf, dass ihre schulterlangen, schwarzen Haare, deren Spitzen aktuell türkis schimmerten, in alle Richtungen flogen. »Wie soll ich das wieder geradebiegen? Mein Professor hasst mich jetzt schon und ich habe noch nicht einmal angefangen.«
»Dann ist doch nach wie vor alles offen«, hielt ich dagegen, obwohl ich wusste, dass ich längst auf verlorenem Posten kämpfte. Meine Freundin schnaubte nur, was mich unweigerlich breit grinsen ließ. Wenn Ninette sich einmal in Rage geredet hatte, dann brachte sie so schnell nichts von ihrem Standpunkt ab – einer der Gründe, warum ich sie so liebte. Ninnie machte niemals irgendwelche halben Sachen. In keiner Hinsicht. Seufzend streckte ich meine Beine auf der gepunkteten Picknickdecke, auf der wir es uns auf der weiten Grünfläche vor dem Eiffelturm gemütlich gemacht hatten, aus und wechselte die Taktik. »Du musst das ja nicht allein machen. Ich helfe dir, schon vergessen?«
Die steile Falte auf ihrer Stirn wurde etwas weicher. »Und dafür könnte ich dich küssen, aber ich kann mir nicht jedes Mal dein inneres Genie ausborgen. Das ist Schummeln.«
»Nein, das ist klug.«
»Remy.«
Ich zuckte mit den Achseln und fasste meine langen, hellbraunen Wellen zu einem unordentlichen Knoten zusammen. »Du hast mir auch schon oft genug den Hintern gerettet. Ist doch nichts dabei.«
»Nur, dass es dieses Mal nicht um irgendein Hausarbeitsprojekt geht, sondern um einen praktischen Lernnachweis. Vor Ort. Ich darf nichts von den Werkstücken aus dem Raum mit nach Hause nehmen und nur im Labor daran arbeiten.«
Zugegeben, das schränkte meine Rolle als geheime Unterstützerin schon gewaltig ein. »Okay, dann von vorn. Worum geht es genau?«
Ninette murmelte einen leisen Fluch und ließ sich nach hinten auf die Decke fallen, die Hände verschränkte sie vor ihrer Brust, während ihr Blick nach oben schweifte. »Irgendein intelligenter Schaltkreis. Soll am Ende ein Miniaturgewächshaus überwachen und automatisch Temperatur und Wasser regeln … was weiß ich?«
Ich schmunzelte, legte mich neben sie und starrte in den wolkenlosen babyblauen Himmel über Paris. Kondensstreifen zeichneten ein wirres Muster auf die scheinbar unendliche Leinwand. »Ich habe bei mir in der Werkstatt etwas Ähnliches rumfliegen.«
»Warum wundert mich das jetzt nicht?«
Ich stupste sie im Liegen mit dem Ellenbogen an. »Das ist auf Essies Mist gewachsen. Sie wollte ihr Blumenlager effizienter gestalten und die Bewässerung anpassen, aber letztlich war es ihr dann doch zu abgefahren.«
Meine ältere Schwester Esther war, was ihren Blumenladen Bouquet de la Rose und ihre Leidenschaft für alles Grüne betraf, schlichtweg unverbesserlich. Wahrscheinlich lief ihr Laden gerade deswegen so gut. Ihre Gestecke und Arrangements waren mittlerweile in ganz Paris gefragt und Essie konnte sich kaum vor Aufträgen retten. Auch ohne intelligente Bewässerungsanlage.
»Wir könnten es am Wochenende unter die Lupe nehmen und zerlegen, bis du die einzelnen Komponenten auswendig kannst«, bot ich an.
Ninnies Blick kribbelte auf meiner Haut. »Warum machst du das, Remy?«
»Ich mache was?«
»Das weißt du ganz genau.« Dieses Mal war sie es, die mich anstieß. »Du sabotierst dich selbst.«
»Du fängst jetzt nicht wirklich diese Diskussion an, oder?«
»Und du klingst nur so genervt dabei, weil du genau weißt, dass ich recht habe.«
Merde. Ninnie und ihre verdammte Schlagfertigkeit, die immer, wirklich ausnahmslos immer, ins Schwarze traf. »Ich dachte, wir reden über dein Projekt.«
»Was dich unweigerlich mit einschließt, ma cocotte. Du solltest neben mir in diesen Kursen sitzen. Du solltest sie alle mit deinem beinahe unheimlichen Talent vom Hocker reißen.«
Ich drehte den Kopf zu meiner besten Freundin seit Kindergartentagen und sah sie lange an. Ninette war ebenso wie ich in Paris geboren und aufgewachsen. Ihr Vater war ein berühmter, französischer Modedesigner, dem Ninnies Liebe für alles, was eine Platine besaß, immer etwas schwer im Magen lag. Allerdings änderte das nichts daran, dass Maurice Beauford der coolste Papa war, den ich kannte – meinen Vater einmal ausgenommen. Ninette hatte von klein auf bei Maurice gelebt, nachdem ihre Mutter Akane kurz nach ihrem zweiten Geburtstag als Stewardess zurück nach Japan gegangen war. Vor ein paar Jahren waren wir sogar nach Fukuoka geflogen, damit Ninnie Akane kennenlernen konnte, aber es hatte sich relativ schnell herausgestellt, dass sie außer ein paar äußerlichen Merkmalen – die schmalen, dunklen Augen, die helle Porzellanhaut und die feinen japanischen Züge – und ihrer Vorliebe für Sushi nichts verband. Eine coole Reise war es trotzdem gewesen und Ninnie ziemlich erleichtert, dass sie sich künftig nicht zwischen zwei völlig unterschiedlichen Kulturen zerreißen musste.
Ich atmete hörbar aus und verschränkte die Arme unter dem Kopf. »Du kennst meine Meinung dazu, Ninnie. Ich … ich passe da irgendwie nicht rein.«
»Inwiefern? Die Sorbonne ist großartig! Allein die Labore mit ihrer Ausstattung dort sind ein Paradies. Dagegen verblasst selbst deine kleine Werkstatt und du weißt, ich liebe deine Höhle heiß und innig.«
Ich verzog das Gesicht. »Das klingt ziemlich falsch.«
»Na und? Du bist genial, Remy, und du hast ein Talent, von dem andere nur träumen können. Keine Ahnung, wie du es machst, aber du knackst jede noch so komplizierte Schaltung, jedes Gerät, du … du verstehst die Technik einfach. Und du gehörst an die Sorbonne, verflucht.«
»Es muss dir ja mächtig wichtig sein, wenn du schon mit dem Fluchen anfängst.«
»Einer von uns muss es ja wichtig sein, was du mit deinem Leben machst, Aramena.«
Autsch. Irgendetwas an ihrem Satz hinterließ einen bitteren Nachgeschmack auf meiner Zunge. Vielleicht weil Ninette wie meine Maman klang. Du solltest etwas aus dir machen, chérie. Du könntest Großes vollbringen, wenn du dir nur einen Ruck gibst.
»Mir gefällt mein Leben so, wie es ist«, gab ich ein wenig schnippisch zurück und klang dabei defensiver als gewollt. »Mit Esther in ihrer Blumenboutique zu arbeiten, macht Spaß und ich habe mit den großen und kleinen Problemen der Nachbarschaft genug zu tun.« Und das war die Wahrheit. Ich liebte meine Werkstatt im Hinterzimmer von Esthers Laden, wo ich die Haushaltsgeräte aus der Gegend reparierte, wenn ich nicht gerade meiner älteren Schwester unter die Arme griff. Es war die Wahrheit und dennoch sorgten die Worte für ein kleines, unangenehmes Ziehen in meiner Mitte. Es macht dir Spaß, aber da müsste noch mehr sein, oder? Mehr als nur dieses Gefühl, das Richtige zu tun. Eine Perspektive, für die du brennst. Ein Ziel.
Formidable, jetzt klang meine innere Stimme auch schon wie meine Mutter.
»Du weißt, wie ich das gemeint habe. Mal ernsthaft, du kannst doch nicht wirklich zufrieden damit sein, Toaster und Wasserkocher zu reparieren.«
Ruckartig setzte ich mich auf und sah auf sie herab. »Haben dich meine Eltern auf mich angesetzt?« Ihre Wangen röteten sich merklich. Da hatte ich meine Antwort. Mit einem leisen Knurren presste ich die Lippen aufeinander. »Haben sie dich bestochen?«
Meine beste Freundin richtete sich ebenfalls auf und strich sich die dunklen Haare zurück. »Sie machen sich doch nur Sorgen und beim letzten Ratatouille-Abend …«
»Geht es hierbei um die Einladung der Uni, die ich abgelehnt habe?«
Wieder dieser schuldbewusste Blick. »Deine Maman hat mich nur darum gebeten, noch einmal mit dir zu sprechen, weil … na ja, sie verstehen es nicht, Remy, und ich ehrlich gesagt auch nicht. Und dabei würde ich behaupten, dass ich dich besser kenne als jeder andere Mensch auf diesem Planeten.«
Mein Magen zog sich zu einem unangenehm harten Ball zusammen. Unwillkürlich griff ich nach dem kleinen goldenen Zahnrad, das an einer filigranen Kette um meinen Hals baumelte. Seine Kanten gruben sich seltsam tröstlich in meine Haut. Wie waren wir bitte von Ninettes anstehendem Projekt zu meiner aktuellen Lebenssituation gekommen?
»Also: Warum hast du abgesagt? Das war quasi ein Freifahrtschein direkt in eines der besten Stipendiatenprogramme für angewandte Wissenschaften in ganz Frankreich. Du liebst Technik. Du liebst es, zu tüfteln und an elektronischem Kram herumzubasteln. Das machen wir schon, seit ich denken kann und –«
»Ich gehöre da nicht hin, Ninnie, okay?!«
Perplex schaute sie mich an. »Wie kommst du denn auf diese beknackte Idee? Du gehörst da hin wie ein … ein Seitenschneider in jeden guten Werkzeugkasten.«
»Seitenschneider?«
»Tais-toi! – Sei still. Du weißt, dass Worte nicht unbedingt meine Stärke sind. Und darum geht es hier auch gar nicht. Was gibt dir dieses absolut deplatzierte Gefühl, die Sorbonne wäre nicht der passende Ort für dich, Remy? Was geht in deinem hübschen Kopf vor sich?« Ihre Stimme war sanfter geworden und ihr Blick beinahe besorgt, eindringlich, fast so, als würde sie mir direkt ins Herz schauen. Ein Blick, der mir sofort unter die Haut ging, weil er mich an all die Momente erinnerte, die ich mit schlechten Gefühlen verband. Momente, in denen ich zu Ninette gelaufen war, weil sie zwischen all den Veränderungen der letzten Jahre, zwischen Familienstreitereien, der nervigen Schulzeit und dem Erwachsenwerden schon immer mein liebstes Zuhause gewesen war. Weil sie genau dann stark war, wenn ich es nicht sein konnte. Als mich die anderen Schüler auf unserer schicken Privatschule gehänselt hatten, weil meine Familie nicht meine richtige Familie und Esther nicht meine richtige Schwester war. Als sie mir hinterhergerufen hatten, dass mich meine leiblichen Eltern anscheinend nicht genug geliebt hatten, um mich zu behalten und stattdessen als Baby zur Adoption freigegeben hatten. Und als ich wochenlang, monatelang jeden Tag und beinahe jede Nacht damit zugebracht hatte, nach meiner echten Familie zu suchen, um doch niemals etwas herauszufinden. Ninette war immer da gewesen. Immer an meiner Seite und immer mit diesem Blick.
Es dauerte eine ganze Weile, bis ich meine Stimme wiederfand und schließlich erwiderte: »Es fühlt sich nicht richtig an. Es fühlt sich nicht so an, als wäre das der Weg, den ich gehen sollte. Das ist … schwer zu beschreiben.«
»Komm schon, niemand ist so gut darin, komplizierte Sachen verständlich zusammenzufassen, wie du. Stell dir vor, dieses Gefühl wäre ein technisches Gerät, ein Schaltkreis. Erklär es mir, Remy.«
Meine Mundwinkel hoben sich entgegen meiner inneren Anspannung. Diese Wirkung hatte Ninette mit ihrer scheinbar grenzenlosen Empathie und ihren bunten, ein wenig abgedrehten Klamotten einfach auf mich. Sie lockte Worte aus mir heraus, von denen ich nicht einmal gewusst hatte, dass sie irgendwo tief in mir drin darauf warteten, ausgesprochen zu werden. Ich ließ das Zahnrad an meiner Kette los und zog die Beine in den Schneidersitz, ehe ich meine Wasserflasche aus dem Rucksack holte und einen Schluck nahm. Um diese Uhrzeit war der Champ de Mars gut besucht. Bei dem schönen Wetter war fast jeder freie Platz der großen Grasfläche von Touristen und Einheimischen gleichermaßen bevölkert, während die Junisonne den Eiffelturm wie eine Wunderkerze funkeln ließ. Viele Pariser konnten wenig mit den Orten anfangen, die Menschen aus aller Welt förmlich anzogen, aber ich liebte genau das daran. Das Gewusel, das Gefühl in der Menge irgendwie ein kleines bisschen weniger allein zu sein. Dazuzugehören.
Ich sah wieder zu Ninnie, die mich abwartend betrachtete und dabei die unzähligen goldenen Ringe an ihren schlanken, langen Fingern drehte. »Du hättest vielleicht doch Psychologie studieren sollen. Es ist beinahe unheimlich, wie du es jedes Mal schaffst, genau das zu sagen, was ich hören muss.« Sie lächelte leicht, doch die Runzeln auf ihrer Stirn blieben, also fuhr ich fort. Horchte in mich hinein, um etwas in Worte zu fassen, das ich selbst nicht gänzlich verstand. »Das Angebot der Universität fühlt sich nicht so an wie das Reparieren und Schrauben, Ninnie.«
»Okay.« Dieses Okay klang aus ihrem Mund eher wie eine Frage, der eine ganze Horde von Fragezeichen folgte.
Ich schnitt eine Grimasse. »Technischer Schnickschnack zieht mich irgendwie an, das weißt du. Als würden Geräte und ihre Fehler mit mir sprechen und mich zu sich locken. Es ist einfach … dieselbe Frequenz. Es fühlt sich richtig an, wie ein warmes Summen in meinem Körper.« Instinktiv legte ich mir eine Hand auf das Dekolleté, dort, wo mein Herz gerade ein wenig schneller schlug. »Wenn ich in meiner Werkstatt bin und vor mich hinarbeite, dann ist da genau dieses Summen. Und als ich diesen Brief aufgemacht habe, der mich aus meiner Werkstatt an die Sorbonne bringen würde, da … ist es verstummt.«
Ninette rümpfte ein wenig skeptisch ihre schmale Nase. »Das Summen?«
Stöhnend warf ich die Hände in die Luft. »Ich weiß, wie das klingt. Maman und Papa haben mich genauso angeschaut, als ich es ihnen zu erklären versucht habe. Keine Ahnung, was das genau ist, vielleicht habe ich einfach zu viele Dämpfe beim Löten abbekommen und längst den Verstand verloren.«
Behutsam legte mir Ninnie eine Hand auf den Unterarm und suchte meinen Blick. »Ich glaube dir ja. Das geht uns doch allen so, oder? Manches fühlt sich eben richtig an und anderes falsch, so treffen wir die meisten Entscheidungen.«
»Aber?«
»Ich habe nichts von einem Aber gesagt.«
»Und doch war da eins. Ein dickes, fettes Ninette-Aber.«
»Das deiner Einbildung entsprungen ist. Vielleicht bist du doch ein bisschen durchgeknallt.«
Ich streckte ihr die Zunge raus und dabei war es mir völlig gleich, dass ich mit meinen neunzehn Jahren vermutlich schon etwas zu alt für diese Geste war.
»Meinetwegen, hier kommt dein Aber, wenn du es denn unbedingt haben möchtest: Ich verstehe dieses Gefühl – was viele wahrscheinlich Intuition nennen würden – und deine Bedenken, Remy, wirklich, aber es gibt manchmal eben auch Momente, in denen dieses Bauchgefühl eher die Verlängerung einer Angst ist und man nicht darauf hören sollte. Man über seinen Schatten springen sollte.«
Ich dachte über ihre Worte nach und kam zu dem Schluss, dass ich es nicht wusste. Vielleicht fürchtete ich mich vor einer Veränderung oder davor, dass ich wieder mit Ablehnung konfrontiert werden könnte. Vielleicht zerdachte ich diese ganze Sache auch einfach.
Missmutig rupfte ich etwas Gras heraus und spielte an den einzelnen Halmen herum. »Schon möglich. Oder wir liegen beide komplett daneben.« Ich pustete mir eine lose Strähne aus der Stirn und warf das Gras zur Seite. »Ist jetzt ohnehin zu spät. Ich habe abgesagt und bleibe bei Esther. Sie braucht meine Hilfe, und unsere Nachbarschaft auch.«
»Besonders Madame Bouttoir und ihr feuerrotes Radio. Was würde sie nur ohne ihren wöchentlichen Besuch, bei dem du ihr heiß geliebtes Radio durchcheckst, machen?«
»Sie wäre vollkommen aufgeschmissen.«
»Sie und ihr Katzen-Schrägstrich-Hunde-Ersatz-Radio. Wundert mich, dass es noch keinen Namen hat.« Ninnie lachte leise.
»Kommt bestimmt noch. Ich könnte ihr einen vorschlagen, wenn sie das nächste Mal reinschneit, obwohl das Radio noch genauso einwandfrei läuft wie in der Woche zuvor.«
Immer noch grinsend zupfte meine beste Freundin an ihrem bunten Patchworkkleid herum und wurde dann wieder ernst. »Du weißt, dass deine Absage nicht endgültig sein muss.«
»Ninette …«
Nun war sie es, die abwehrend die Hände hob. »Ich meine ja nur. Lass es dir wenigstens noch einmal durch den Kopf gehen, ja?«
»Damit du Maman sagen kannst, du hättest es versucht? Hat sie dich mit ihren Macarons bestochen?«
»Mit ihren Macarons und den Bedenken, die wir teilen. Aber hauptsächlich ihre Macarons, ja. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der dem Gebäck von Felicienne widerstehen kann.«
»Wusste ich es doch.«
Eine ihrer Augenbrauen wanderte in die Höhe. »Also?«
Ich seufzte und zog mein Smartphone hervor. »Das ist –« Ich unterbrach mich selbst, als mir die Uhrzeit auf dem Display ins Auge fiel, dicht gefolgt von den unzähligen Nachrichten und verpassten Anrufen von Esther. »Putain! Ich hätte vor zehn Minuten im Laden sein sollen.«
»Ich dachte, donnerstags ist dein freier Nachmittag.«
Fahrig stopfte ich meine Strickjacke in den Rucksack und griff nach meinen Sandalen, während ich gleichzeitig eine Nachricht zu tippen versuchte. Unnötig zu erwähnen, dass ich hoffnungslos versagte. »Normalerweise schon, aber Essie hat heute einen Termin in Versailles wegen einer großen Hochzeit und … argh, das ist wirklich wichtig für sie. Sie wird mir den Kopf abreißen.« Fluchend stand ich auf und kramte meinen Fahrradschlüssel hervor.
Ninette kam ebenfalls auf die Beine. »Es sind nur zehn Minuten, Remy. Den Puffer hat sie vermutlich ohnehin eingeplant.«
»Trotzdem.«
»Was ist mit der Uni-Einladung?«
»Wir reden wann anders weiter, ja? Ich muss jetzt echt los. Sehen wir uns am Wochenende wegen deinem Projekt?«
Sichtlich unzufrieden mit dem abrupten Ende ihrer Mission schürzte sie die Lippen. »Sicher. Aber, Remy –«
»Ich schreibe dir«, fiel ich ihr ins Wort, drückte sie kurz an mich, wobei ich ihr jeweils ein Küsschen rechts und links auf die Wange hauchte. »Tut mir leid, Ninnie. Ich kann Essie nicht hängen lassen. Nicht heute.«
Mit einem ergebenen Seufzen ließ mich meine beste Freundin schließlich gehen. »Wir reden noch darüber, Aramena Benoit.«
»Tun wir das nicht immer?«, rief ich ihr über die Schulter zu, schon halb auf dem Weg zu meinem hellgelben Stadtfahrrad. »Und mach dir keine Gedanken, wir kriegen deinen Lernnachweis schon geschaukelt.«
Ich wartete erst gar nicht auf ihre Erwiderung, sondern lief direkt los. Mittlerweile war es deutlich voller als heute Mittag und einen Weg durch die vielen Menschen mit Kameras, Sommerhüten und Rucksäcken zu finden, wurde zu einer wahren Tortur. Immer wieder murmelte ich Entschuldigungen und schlängelte mich durch Gruppen und Pärchen, bis endlich der Fahrradständer in Sicht kam und –
Autsch.
Meine heldenhafte Sprinteinlage kam zu einem jähen Ende, als ich gegen eine warme, breite Brust prallte und im nächsten Moment rückwärtstaumelte. »Excusez-moi, ich …«, setzte ich an und verstummte, als mir klar wurde, dass sich die Brust, beziehungsweise der Kerl, dem besagte Brust gehörte, bereits umgedreht hatte, als hätte es den Zusammenstoß nicht gegeben. Verdutzt schaute ich ihm nach, während ich mir gedankenverloren die Schulter rieb. Dunkelbraune Haare, groß, muskulös und … was ist das für ein weißer Hund? Unbewusst machte ich einen Schritt in seine Richtung, um – ja was? Ihm zu folgen? –, als mir wieder in den Sinn kam, warum ich überhaupt so in Eile war, und den Blick zurück auf mein Fahrrad richtete. Mein eigentliches Ziel.
Komm schon, Remy. Essie verlässt sich auf dich.
Kaum merklich schüttelte ich den Kopf und sah ein letztes Mal zu der Stelle, an der der Kerl und sein seltsamer Hund gerade noch gestanden hatten. Die Stelle war verwaist und der junge Mann verschwunden.
Natürlich ist er das.
Meine Lippen verzogen sich zu einem leichten Lächeln, dann wandte ich mich ab und schloss endlich mein Fahrrad auf.
Kapitel 2
Fitzrovia, London
Sim
Leichter Nieselregen legte sich beinahe wie Nebel auf meine Kleidung, als ich in Fitzrovia aus der U-Bahn an die Oberfläche trat. Sofort bereute ich es, keinen Schirm mitgenommen zu haben und das nicht nur, weil sich in meinem Jutebeutel Bücher im Wert von fast dreitausend Pfund Sterling befanden, sondern auch, weil ich wusste, dass sich besagter Nieselregen innerhalb der nächsten paar Minuten in eine wahre Sintflut verwandeln würde. Und ich hasste es, nass zu werden. Jeder hasste das.
Mit einem undeutlichen Murmeln wich ich einer Touristengruppe aus und zog die Schultern hoch. Vielleicht schaffte ich es ja doch noch vor dem Wolkenbruch ins Museum. Sosehr ich London auch für seine altehrwürdigen Ecken, die architektonische Zeitlosigkeit und die Hektik liebte, der ständige Regen ging mir trotzdem auf den Wecker. Aber jeder Ort hatte seine Macken, war es nicht so?
Die einen mehr, die anderen weniger und von manchen sollte man sich lieber ganz fernhalten, nicht wahr, Kasimir?
Zähneknirschend drängte ich die Gedanken zurück, die den vertrauten Bariton meines Vaters angenommen hatten, und schüttelte kaum merklich den Kopf. Als über mir das erste Donnern über die dunkelgrauen Wolken rollte, beschleunige ich automatisch meine Schritte, bis ich fast rannte und achtete dabei weder auf mögliche Ampeln noch auf hupende Taxis oder rote Doppeldeckerbusse. So machte man das eben als Londoner. Nur, dass ich gar kein echter Londoner war, aber das spielte keine Rolle. In meinem dünnen, dunkelblauen Mantel, den Lederschuhen, der hellen Hose und dem weißen T-Shirt fühlte ich mich jedenfalls ziemlich britisch und diese Stadt war meine Heimat, ganz gleich, was mein Ausweis sagte. London war und blieb meine Wahlheimat, bis mich irgendein neuer Auftrag, mit dem ich eigentlich nichts zu tun haben wollte, wieder an einen anderen Ort verschlug und der ganze Kram von vorne begann.
Komm schon, nur ein Tag ohne die alte Leier.
Ich zeigte meiner inneren Stimme den imaginären Mittelfinger und überquerte die letzte Querstraße, die mich noch von dem imposanten British Museum trennte. Ein bisschen wie aus der Zeit gefallen ragte der gewaltige Bau mit seinen ionischen Säulen samt geschwungenen Kapitellen aus hellem Sandstein vor mir auf, als ich den Vorplatz betrat. Vor dem Einlass hatte sich bereits eine beachtliche Schlange gebildet und ich war einmal mehr froh, dass ich mit meinem Universitätsausweis die Abkürzung nehmen konnte. Sonst würde ich vermutlich letzten Endes doch noch in den Geschmack des Sommerregens kommen, der sich bereits so fulminant angekündigt hatte. Eine Hand an meinem Beutel mit den kostbaren Büchern lief ich an den Wartenden vorbei und tauchte wenig später in den Säulengang ein, wo sich einer der Seiteneingänge für Mitarbeitende und – seit Neuestem – Studierende der Kulturwissenschaften befand.
»Kasimir! Du bist spät dran für deine Verhältnisse«, begrüßte mich Jefferson, einer der Securities des Geländes, und tippte sich an seine Schirmmütze. Wie immer stolperte er ein wenig über meinen Namen. »Ich habe schon vor einer halben Stunde mit dir gerechnet.«
Ich grinste schief und reichte ihm den Coffee-to-go-Becher, den ich in der anderen Hand balanciert hatte, und zuckte mit den Schultern. »Die Tube hat mal wieder Probleme gemacht. Du weißt schon.«
»Danke.« Genüsslich nahm er einen ersten Schluck und lächelte breit, sodass seine hellen Zähne zwischen seinen Lippen aufblitzten. »Ich will dich auch nicht länger aufhalten. Drinnen im Lesesaal wartet schon jemand auf dich.«
Mist. Ich hatte gehofft, ich würde es noch rechtzeitig zu meiner Verabredung mit Willow schaffen – die normalerweise mit chronischer Unpünktlichkeit glänzte. Seufzend nickte ich und wechselte den schweren Bücherbeutel von einer Seite auf die andere. »Dann beeile ich mich lieber. Hab einen guten Tag, Jeff.«
»Den wünsche ich dir ebenfalls. Und danke noch mal für den Kaffee.«
»Immer doch«, erwiderte ich, eine Hand zum Abschied gehoben, ehe ich mich durch den Zugang ins kühle Innere des British Museums schob. Noch im selben Moment überkam mich eine mir mittlerweile vertraute Ruhe. Eine Ruhe, die von den alten Mauern herrührte und sich immer weiter um mich legte, während ich den Weg zu dem gewaltigen Lesesaal des Museums mit seiner beeindruckenden Kuppel einschlug. Dieser Ort war einer der Gründe, warum ich London liebte. Ich konnte mich stunden- und tagelang in den unzähligen Räumen und Ausstellungen verlieren. Wenn ich gekonnt hätte, wäre ich für immer hiergeblieben, hätte studiert, mich durch die verschiedenen Epochen gearbeitet, immer mehr Wissen und Vergangenheit in mich aufgesogen … doch ich konnte nicht. Hatte ich nie gekonnt, weil es noch nie nach mir gegangen war. Das hier nicht meine Welt war.
Und da waren sie wieder, diese ganzen ungebetenen Gedanken, die mich seit Jahren verfolgten und die rein gar nichts brachten. Außer schlechter Laune.
Es sind noch ein paar Wochen, bis du zurückmusst, Sim. Tu dir selbst einen Gefallen und warte mit den miesen Vibes, bis es so weit ist.
Merci beaucoup.
Kopfschüttelnd stieg ich eine der vielen geschwungenen Treppen nach oben und trat wenig später durch die doppelflügelige Tür hinein in das Herzstück des Museums. Meine innere Stimme verstummte wie auf Knopfdruck und sofort hellte sich meine Stimmung wieder auf. Umgeben von beeindruckenden Bücherregalreihen, dem Rascheln von Papier und konzentrierter Geschäftigkeit blieb auch mir gar keine andere Wahl. Der Geruch von Büchern, die Nähe zu endlosen dunklen Regalböden, die Geschichten dieser und jeder anderen Zeit beheimateten, und das ganz eigene Wispern solcher Orte waren für mich der Inbegriff von Zuhause. Vielleicht, weil ich in einer anderen Bibliothek aufgewachsen war. In einem anderen Land, umgeben von einem ganz anderen Flüstern und Wispern, dem ich mich nicht entziehen konnte, ganz gleich, wie viele Kilometer ich auch zwischen dort und mich brachte. Ein Teil blieb immer.
Ich atmete langsam aus und setzte mich wieder in Bewegung, bevor ich noch tiefer in dieser Windung meines Kopfs verschwinden konnte. Schließlich war ich verabredet, spät dran und der Lesesaal des British Museum sicherlich nicht der richtige Platz, um über eines der größten und bestgehüteten Geheimnisse der Menschheit zu grübeln.
Dunkler Teppich schluckte meine Schritte, als ich zwischen den sternförmig angeordneten Regalreihen auf das Zentrum des Saals zulief. Dort, unter der großen Kuppel, durch deren Fenster das gräuliche Licht des Sommergewitters fiel, befanden sich mehrere Tische samt Stühlen und Leselampen. Einige Studierende, aber auch ältere Museumsbesuchende hatten sich dort niedergelassen, versunken in ihren Büchern oder Laptops. Stirnrunzelnd ließ ich den Blick auf der Suche nach Willows rotem Haarschopf über die Anwesenden schweifen und stieß im nächsten Augenblick einen französischen Fluch aus, als ich statt meiner Kommilitonin ein anderes bekanntes Gesicht entdeckte. Eines, das ich hier absolut nicht erwartet hatte und das innerhalb eines Sekundenbruchteils dafür sorgte, dass meine Laune in den Keller sank.
Als hätte er meine Anwesenheit gespürt, drehte sich Ludwig in genau diesem Moment um und winkte mir so übermütig zu, als wären wir auf dem Rummel und nicht in einer der ehrwürdigsten Institutionen Londons. Und dabei interessierte es ihn nicht im Geringsten, dass ihn die anderen musterten, als hätte er den Verstand verloren – was er vermutlich auch hatte. Schon vor sehr langer Zeit.
Das kann doch verdammt noch mal nicht sein Ernst sein.
Missmutig verzog ich das Gesicht und steuerte meinen jüngeren Bruder an, der auf dem breiten Holzstuhl fläzte, als wäre der Lesesaal sein Königreich.
»Lu«, begrüßte ich ihn mit gedämpfter Stimme, als ich vor ihm zum Stehen kam.
»Bruderherz. Ich dachte wir wären schon vor einer halben Stunde verabredet gewesen?«
Fassungslos starrte ich ihn an, als mir klar wurde, was er da gerade gesagt hatte. »Du warst das. Willow hat mir gar keine Nachricht geschrieben. Du hast mich kontaktiert. In ihrem Namen.« Und ich Idiot hatte mich noch gewundert, warum mir Willow ausgerechnet an einem Mittwoch schrieb, wo diese Tage zu ihren vollsten gehörten.
»Irgendwie musste ich dich ja aus deinem Schneckenhaus holen. Hätte ich mich direkt bei dir gemeldet, wärst du niemals aufgetaucht.«
Womit er absolut richtiglag, nur würde ich das ganz sicher nicht offen zugeben. Ich verschränkte die Arme vor der Brust und legte den Kopf schief. »Was willst du? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren es noch fünf Wochen bis Ende Juli.«
Ludwig zog ein Bein an und zupfte an seinen dunklen Hosenträgern herum, die er über einem hellblauen Hemd trug. Eigentlich hätte er damit lächerlich aussehen müssen in Kombination mit seiner braunen Chino, den Budapestern und seinen dunklen Locken, die in alle Richtungen abstanden. Doch Ludwig stand dieser schräge und etwas verstaubte Vintage-Style aus irgendeinem Grund auch noch.
»Exakt. Deswegen bin ich auch nicht hier. Vater schickt mich.«
Natürlich. Ich ließ mich auf den Stuhl neben ihn fallen, die Büchertasche auf meinen Oberschenkeln und den Blick fest auf meinen kleinen Bruder gerichtet, der die Angewohnheit hatte, immer dann aufzutauchen, wenn ich es am wenigsten gebrauchen konnte. »Vielleicht sollten wir ihm ein Buch über die Nutzung des Telefons schenken. Oder Wie man eine Mail verfasst.«
Ein freudloses Grinsen huschte über Lus Züge. »Wir wissen beide, dass er dich auf diesem Weg niemals erreicht hätte.«
Auch wieder wahr.
Als ich nichts erwiderte, zog Ludwig ein Bein an und legte locker die Arme darum. »Hör zu, mir gefällt es auch nicht, dich aus deiner kleinen London-Bubble zu holen, aber es gibt ein Problem. Ein wirklich ernsthaftes und damit meine ich nicht, dass sich Papa und Onkel Corbin wieder in die Wolle bekommen haben oder Eamon unausstehlich ist.« Eine steile Falte grub sich zwischen seine dunklen Brauen und vertrieb jeden Schalk aus seinen braunen Augen, dann sagte er: »Cassandra ist tot.«
Mein Gedankenkarussell kam mit einem Ruck zum Stehen, als mich die Wucht dieser Aussage traf. »Was!?«, rief ich und handelte mir einiges an Psst und Ruhe! ein, doch nichts davon erreichte mich wirklich. Ich sah nur Ludwig, während seine Worte wieder und wieder in meinem Schädel kreisten.
Cassandra ist tot.
Cassandra ist tot.
Cassandra ist tot.
Fassungslos fuhr ich mir durch die dunkelbraunen Haare, die schon wieder viel zu lang geworden waren, und biss die Zähne aufeinander. Das durfte nicht wahr sein, das … das war eine verdammte Katastrophe von biblischem Ausmaß.
»Pas possible! Wie?«, brachte ich schließlich hervor und krallte die Finger in den Stoff meines Beutels. »Wann?«
»Vor zwei Tagen. Und Papa … ich habe ihn noch nie so erlebt, Sim. Ich meine, wir alle wussten, dass Cassie alt ist und irgendwann sterben würde, aber ich schätze –«
»Wir haben alle gehofft, dass es noch etwas länger dauert. Dass wir mehr Zeit haben.« Dabei war es lächerlich. Alle Zeit der Welt hätte nicht gereicht, um etwas an der Tatsache zu ändern, dass Cassandra Hyde die Letzte ihrer Art gewesen war. Die letzte Ripari. Und dass wir ohne sie wortwörtlich vor einem unlösbaren Problem standen. Ein Problem, das nicht nur meine Familie betraf, sondern, so dramatisch es auch klingen mochte, die ganze verdammte Menschheit.
»Merde!« Ungehalten schlug ich mit der flachen Hand auf den Tisch und fuhr hoch. »Wieso erfahre ich erst jetzt davon?«
Lu stand ebenfalls auf, wobei er sich ebenso wenig an den bösen Blicken der anderen störte wie ich. »Daran bist du schuld, wenn ich dich erinnern darf, Bruderherz.«
Ich machte mir erst gar nicht die Mühe, etwas darauf zu erwidern und strebte stattdessen direkt den Ausgang an, durch den ich nur wenige Minuten zuvor gekommen war. In dem Glauben, nur ein einziges Mal einfach mein Ding durchziehen zu können, Zeit zu haben. Was für ein naiver Gedanke.
»Warte! Sim!« Mitten auf der breiten Treppe holte mich Lu letztlich ein und brachte mich, eine Hand an meiner Schulter, zum Stehen. Seine ungewohnt ernste Miene ging mir direkt unter die Haut. Das war alles so verkehrt. So verflucht verkehrt. »Wo willst du hin?«
»Was denkst du denn? – In den Untergrund. Nach Paris. Deswegen bist du doch hier, oder nicht?«
Ludwig nickte finster und wirkte, anders als noch Minuten zuvor, älter als seine neunzehn Jahre. »Ja, aber du brauchst nicht gleich kopflos loszustürmen. Ich habe bereits einen Flug für uns beide gebucht. Er geht heute Abend nach Charles de Gaulle.«
»Wie schön ihr euch das alles zusammengeschustert habt«, unterbrach ich ihn voller Ironie.
Lu überging meinen unnötigen Einwurf geflissentlich. »Bis dahin kannst du in Ruhe zusammenpacken und dir Gedanken machen, wie du dein plötzliches Verschwinden aus deinem Doppelleben hier erklärst. Oder wolltest du einfach sang- und klanglos verschwinden? Gerade hier in ihrer Stadt, wo sie vermutlich alles im Blick haben? Sie warten doch nur auf einen Fehler unsererseits und ein Student, der ohne Erklärung von der Bildfläche verschwindet, ist genau so ein Fehler. Mal abgesehen davon, dass ich nicht verstehe, was du überhaupt so erstrebenswert daran findest, Nachbar zu spielen mit diesen … du weißt schon.«
Sie.
Die Erwähnung dieser Plage reichte aus, um mir eine Gänsehaut zu verursachen.
Sie, die uns seit Jahrhunderten das Leben schwer machten, uns jagten und sabotierten.
Sie, die dafür sorgten, dass solche Probleme überhaupt erst entstanden.
Und sie, die unsere Schwester Tabitha –
Zähneknirschend stieß ich den Atem aus und zwang mein rasendes Herz zur Ruhe. »Vater will mich aus London abziehen? Jetzt schon?«
Ludwig neigte den Kopf und klopfte mir auf die Schulter. »Durch Cassandras Tod stehen wir unmittelbar vor einer Katastrophe, Sim. Natürlich braucht er dich vor Ort. Er braucht jeden Einzelnen von uns.«
Kapitel 3
7. Arrondissement, Paris
Remy
Das Bouquet de la Rose lag nur etwa drei Minuten mit dem Fahrrad vom Champ de Mars entfernt im siebten Arrondissement von Paris. Ein kleines, schlankes Haus, so alt wie dieser Teil der französischen Hauptstadt selbst, in einer schmalen Gasse, in der ich jeden mit Vornamen kannte. Die Holzfassade war in einem hellen Mintgrün gestrichen, zwei große Schaufenster, hinter denen sich Blumen und Pflanzen aller Art tummelten, nahmen beinahe das gesamte Erdgeschoss ein und ließen gerade noch Platz für eine Eingangstür in ihrer Mitte. Vor dem Laden auf dem Bürgersteig standen kleine Tische und Wägen mit frischen Topfpflanzen und neuen Angeboten, während das goldene Schild, auf dem in verschnörkelten Buchstaben »Bouquet de la Rose« stand, die Kunden ins Innere lockte.
Direkt hinein in das grüne Wunderland meiner Schwester.
Esther hatte das Haus und damit auch den Laden von unserem Großvater übernommen, der vor drei Jahren gestorben war, und aus den leer stehenden Geschäftsräumen unten ihren Kindheitstraum von einer Blumenboutique verwirklicht, während sie sich oben eine gemütliche Wohnung eingerichtet hatte. Nach meinem Schulabschluss im letzten Sommer war ich bei Esther eingezogen und das nicht nur, weil ich mir in dem größten Hinterzimmer eine Elektrowerkstatt hatte einrichten dürfen, sondern auch weil meine Schwester im Gegensatz zu meinen Eltern nicht ständig darauf herumritt, dass ich nicht studierte oder eine Ausbildung machte. Essie hatte sich einfach gefreut, als ich vor ihrer Tür gestanden hatte. Und unsere Zusammenarbeit und Schwestern-WG funktionierte sehr gut – wenn ich nicht gerade einen ihrer wohl wichtigsten Aufträge gegen die Wand fuhr.
»Essie! Es tut mir so leid!«, rief ich außer Atem, als ich in das La Rose stürmte und die Tür dabei heftiger als nötig aufstieß. Die kleinen Glöckchen darüber bimmelten wie verrückt und die bunten Scheiben der alten Holztür erzitterten. Sofort hüllte mich der Geruch nach frischen Blumen ein, die hier bis unter die Decke in Regalen und Vasen standen, vermischt mit der unverkennbaren Note der Bienenwachskerzen, die Esther so liebte. Egal zu welcher Jahreszeit oder welche Temperatur draußen herrschte. Im Hintergrund lief leise französische Musik, die Lichter brannten, nur von meiner Schwester fehlte jede Spur.
»Essie?« Ich lief weiter ins Innere, wobei die alten Dielen unter meinen Schritten knarrten, und fuhr mir über die verschwitzte Stirn. »Tut mir leid, dass ich zu spät bin.«
Irgendwo rumpelte es, dann hörte ich vertraute Schritte auf der etwas verzogenen Treppe, die hinter dem schweren Vorhang in die Wohnung über dem Laden führte. Einen Herzschlag später stand Esther auch schon vor mir und wirkte alles andere als begeistert.
»Himmel, Remy. Ich habe hundertmal versucht, dich zu erreichen.«
»Ich weiß«, gab ich zerknirscht zurück. »Ich habe die Zeit vergessen.«
Meine ältere Schwester schob die filigrane Brille, deren rundes, goldenes Metallgestell im weichen Licht des Ladens funkelte, auf der Nase höher und schüttelte den Kopf. »Wie dem auch sei. Das klären wir später. Der Hochzeitsplaner wird jeden Moment hier sein und mich abholen.«
»Kann ich dir noch irgendwie helfen?«
»Ich glaube nicht, es reicht voll und ganz, dass du heute den Laden übernimmst.«
»Ist doch selbstverständlich, nächstes Mal bin ich auch pünktlich.«
Esther winkte ab. »Pass mir einfach auf unsere Rose auf und ich bin glücklich.« Sie war noch nie länger als einen Wimpernschlag lang wirklich wütend auf jemanden gewesen. Manchmal glaubte ich, dass sie dazu gar nicht in der Lage war. »Sonst sollte alles passen. Ich habe die Muster für die Hochzeitsgestecke bereits nach Versailles liefern lassen und die Listen beisammen. Denke ich.« Stirnrunzelnd zupfte sie ihren Pony zurecht und strich dann über den glatten Stoff ihres roten Etuikleides, nur um im nächsten Moment wieder an ihren Haaren herumzufummeln.
Auch wenn Esther und ich keine leiblichen Schwestern waren, waren wir uns äußerlich sehr ähnlich. Eine fast zierliche Gestalt, braune Haare, die zu Locken neigten, und helle Augen, die im herzförmigen Gesicht fast zu groß wirkten. Wir hatten die gleiche leicht gebräunte Haut und dieselbe Vorliebe für Käse und Kaffee. Doch im Gegensatz zu mir liebte es Essie, Kleider und Röcke in den schillerndsten Farben ihrer geliebten Blumen zu tragen, während ich meistens in Jeans, T-Shirt und einem von Papas alten Flanellhemden steckte.
Ich berührte sie am Arm und legte den Kopf leicht schief. »Ist alles in Ordnung, Essie?«
»Ja. Ja, sicher«, gab sie eine Spur zu hoch zurück, was mich unwillkürlich lächeln ließ.
»Mach dir keine Gedanken. Du wirst sie mühelos von dir überzeugen. Sei einfach du selbst.«
»Sollte ich das nicht eigentlich dir sagen, wo ich doch drei Jahre älter bin als du?«
»Dafür gibt es keine festen Regeln, Essie. Du schaffst das und ich bin immer stolz auf dich.«
Ihre Wangen röteten sich merklich, dann zog sie mich kurz in ihre Arme. »Nicht halb so stolz wie ich auf dich.«
Ein Hupen drang von der Straße in den Laden und ließ uns auseinanderfahren.
»Meine Mitfahrgelegenheit ist da.«
»Dann lass sie besser nicht warten. Bis heute Abend, Essie. Hab Spaß.«
Mit einem angespannten Lächeln schnappte sich meine Schwester ihre Tasche vom Tresen, ehe sie aus dem Blumenladen lief und wenig später in einem schwarzen Wagen davonfuhr. Ich atmete tief ein und aus und sah mich dann im Laden nach irgendwelchen Aufgaben um, aber wie so oft entdeckte ich keine. Meine Schwester war in dieser Hinsicht eine absolute Perfektionistin. Lächelnd zupfte ich an dem großen Blumenstrauß auf der Theke herum und verschwand ins Hinterzimmer – wie so oft, wenn nicht gerade Kunden hereinschneiten, die entweder nach der Blumenexpertise meiner Schwester fragten oder nach meinen Talenten, weil ihr Babyfon oder der Mixer mal wieder streikten.
Ohne dass ich etwas dagegen hätte tun können, kehrten Ninettes Worte wieder in meinen Kopf zurück. Dass ich so viel mehr aus meinem Leben machen könnte. Dass ich in meinem Hinterzimmer nicht nur Toaster reparieren, sondern in den großen wissenschaftlichen Instituten dieser Welt an der Zukunft mitarbeiten könnte. Neue Dinge entwickeln und Probleme zusammen mit den klügsten Köpfen der Technik-Branche lösen könnte. Doch obwohl das in meinen Ohren absolut verlockend und wie ein einziger Traum klang, verspürte ich dabei keinerlei Euphorie. Keine Aufregung. Nichts. Dabei sollte ich etwas spüren, oder? Ich sollte total aus dem Häuschen sein, in die nächstbeste Métro steigen, um zur Universität zu fahren und das Angebot anzunehmen. In eine Welt der Technik abzutauchen. Das war es schließlich, was ich liebte. Was ich jeden Tag tat. Probleme lösen. Schaltkreise verstehen. Technik leben.
Stattdessen verspürte ich beinahe eine tiefe Abneigung, dort zu studieren und hatte keine Antwort darauf, warum das so war. Kopfschüttelnd fuhr ich mir durch die Haare.
Das ist doch nicht normal. Ich bin nicht normal. Wie kann sich etwas so falsch anfühlen, obwohl es genau das ist, was ich eigentlich liebe?
Das ergibt verdammt noch mal keinen Sinn, Remy.
Unsanft stieß ich gegen den Türrahmen und blickte auf. Hinein in meine Werkstatt, mein geordnetes Chaos aus Werkzeugen, alten Geräten, die als Ersatzteillager dienten, elektrischen Bauteilen und mehreren Werkbänken und Schränken. Auf dem ovalen Tisch in der Mitte lag noch immer das kleine kupferfarbene Kästchen, das vor ein paar Tagen seinen Weg zu mir gefunden hatte und von dem ich immer noch nicht sagen konnte, was genau sich unter seiner mit Ranken gravierten Oberfläche befand. Stundenlang hatte ich das kleine Ding bisher angestarrt, ohne hinter seine Bedeutung oder Funktionsweise zu kommen, und mir daran regelrecht die Zähne ausgebissen. Trotzdem hatte ich die Box noch nicht in den nächstbesten Elektroschrott verfrachtet, weil meine Neugier schlichtweg zu groß war. Eine Neugierde, die ich nun zur Seite schob, um mich den wichtigeren Aufgaben, wie beispielsweise der beinahe historischen Espressomaschine auf meiner Hauptwerkbank, zu widmen.
Entschlossen wandte ich dem mysteriösen Kästchen den Rücken zu und setzte mich vor das Innere der Maschine, deren abgeschraubtes Gehäuse auf dem Rollwagen daneben wartete. Ich hatte mir bereits eine grobe Skizze der einzelnen Schaltkreise im Inneren gemacht, denn eine Anleitung hatte der Besitzer nicht für mich gehabt. Einer der Gründe, warum andere Werkstätten ihn abgelehnt hatten, doch ich … ich brauchte meistens keine Anleitung. Ich brauchte nur das Gerät und dieses Summen, das ich Ninnie zu erklären versucht hatte. Wie gesagt, ich verstand es nicht, ich wusste nicht warum, aber wenn ich an einer technischen Maschine zu arbeiten begann, war es beinahe so, als würde sie mit mir sprechen.
Und ich wusste, wie verrückt das klang.
Nur war es eben so. Ich sah das Gerät, berührte es und begriff sein Inneres. Vielleicht weil ich schon unzählige Gerätschaften repariert hatte, vielleicht hatte es auch einen anderen Ursprung, aber es machte das hier so einfach. Mühelos, wie … wie atmen.
Nachdenklich betrachtete ich die Espressomaschine und zog die Unterlippe zwischen die Zähne, ehe ich sie in den Händen drehte und sofort wieder das Surren verspürte. Es lenkte mich zu einer Verkabelung im oberen Drittel, als wollte es mich auf einen Defekt aufmerksam machen. Blind griff ich nach einem der filigranen Schraubendreher, löste die kleine Abdeckung aus angelaufenem Metall und wurde tatsächlich fündig. Eine lose Leitung, deren Kontakt korrodiert war. Ein winziges Detail, das ich ohne das Summen vermutlich erst nach Stunden gefunden hätte, aber so … hatte ich es einfach gewusst.
Wie immer.
Ein ganzer Cocktail an unterschiedlichen Emotionen stieg in mir hoch, als ich routinemäßig den Kontakt aufschraubte, ersetzte und die Leitung fixierte. Handgriffe, die ich schon unzählige Male gemacht hatte und mir in Fleisch und Blut übergegangen waren. Sich richtig anfühlten.
Das sollte ausreichen, oder? Es musste nicht immer mehr sein. Ich musste nicht wie die anderen sein und studieren gehen.
Das Summen wurde lauter und sandte einen leichten Druck zwischen meine Schläfen. Zähneknirschend legte ich das Werkzeug beiseite und drehte mich auf dem Hocker, bis mein Blick ein weiteres Mal auf das ominöse Objekt fiel … Beinahe kam es mir so vor, als käme das Summen von dem Kästchen, als würde es die Luft mit diesem intensiven Surren aufladen und mich zu sich rufen.
C’est ridicule – das ist lächerlich.
Und trotzdem erwischte ich mich dabei, wie ich aufstand und nach der kleinen Box griff, die etwa die Größe eines Stücks Butter besaß. Sofort wurde das Summen ruhiger, gleichmäßiger, als würden wir aufeinander reagieren.