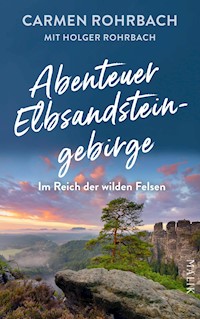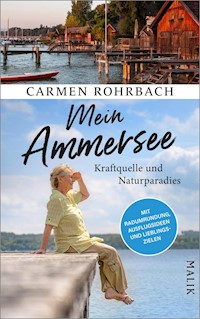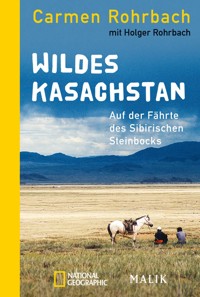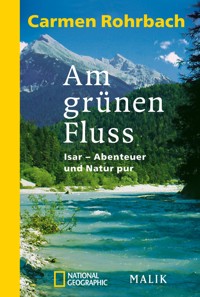12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mongolei – allein dem Namen wohnt ein Zauber inne, dem sich auch Carmen Rohrbach nicht entziehen kann. Über eine Familie in Ulan-Bator bekommt sie den lang ersehnten Kontakt zu Nomaden, die sie hinaus in die unermessliche Weite des Landes führen. An ihrer Seite lernt Carmen Rohrbach das Leben in der Jurte sowie die Sorgen und Freuden ihrer Gastgeber kennen. Schamanen darf sie bei Ritualen, Adlerjäger bei der Arbeit beobachten, und gemeinsam mit den Nomaden fiebert sie dem wichtigsten Fest des Jahres entgegen, dem Naadam. Hingerissen von der grandiosen Natur der mongolischen Gebirgswelt bezwingt sie als erste Frau den heiligen Berg Burchan Chaldun, während die Gobi sie verführt, nach den letzten wild lebenden Eseln der Erde zu suchen. Zu Fuß und auf dem Rücken von Pferden und Kamelen, allein und in Begleitung durchstreift sie die schier endlose Weite der mongolischen Landschaft. Auf ihren oft waghalsigen Touren erlebte sie einzigartige Naturschauspiele und suchte die Nähe derer, die das wahre Wesen eines Landes ausmachen: seiner Menschen. Ein Buch von berückender Intensität!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.malik.de
© Piper Verlag GmbH, München 2006Fotos: Carmen RohrbachLektorat: Susanne Härtel, MünchenCovergestaltung: Dorkenwald Grafik-Design, MünchenFotos: Carmen RohrbachKarte: Anneli Nau, MünchenLitho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Karte
Prolog – Wie alles begann
Eine Wohnung in Ulaanbaatar
Auf dem Rücken »wilder« Pferde
Steinerne Krieger
Dinosaurier in der Wüste
Ein Jahr später
Mein Pferd Goldauge
Ein See in der Wüste
Im Altai-Gebirge
Leben im Kreis
Drei Spiele für Männer
Wolken über der Mongolei
Heimkehr der Takhi
Wildes Eselleben
Im hohen Norden
Von Jurte zu Jurte
Die Straßenkinder von Ulaanbaatar
Die mit dem Adler jagen
Auf den Spuren einer Legende
ANHANG
Land
Klima
Einreise
Anreise mit dem Flugzeug
Anreise mit der Bahn
Gesundheit
Sicherheit
Richtiges Verhalten
Schreibweise mongolischer Wörter
Mongolische Namen
Adressen von Reiseveranstaltern
Literatur
Dank
Die Mongolei in Bildern
Prolog – Wie alles begann
»Tschi jadarsan uu?«, fragt Mandach.
»Bi jadraagui.« Nein, ich bin nicht müde, antworte ich, obwohl ich schon sehr gern vom Pferd gestiegen und eine Pause gemacht hätte. Inzwischen sind wir drei Stunden geritten, und meine Knie beginnen zu schmerzen. Warum ist das Reiten so anstrengend? Ich sitze doch gemütlich im Sattel, und das Pferd macht die ganze Arbeit. Vorsichtig rutsche ich mit dem rechten Fuß aus dem Steigbügel und versuche, das Bein zu strecken. Es tut höllisch weh, die verkrampften Muskeln dehnen sich nur langsam. Endlich hängt mein Bein gerade und locker herab. Wenn nun aber das Pferd in Panik davonpreschte, würde ich den Fuß nicht schnell genug zurück in den Steigbügel bringen, also winkle ich mein Bein wieder an. Doch nicht nur die Knie, auch Rücken, Hals, Bauch, Oberschenkel und selbst die Knochen senden Schmerzsignale in mein Gehirn.
Mandach, mein mongolischer Begleiter, weiß natürlich um meinen Zustand. Immer wieder fragt er fürsorglich, ob ich müde sei. Ich verneine jedes Mal. Es geht dir so schlecht, weil du Angst hast, werfe ich mir vor. Du hast nicht nur Angst zu stürzen und dir den Hals zu brechen, du fürchtest dich grundsätzlich: Hast Angst, die Sprache nicht gut genug zu beherrschen, Angst vor den halbwilden Pferden, den fremden Menschen, der extremen Natur, Angst, dir zu viel vorgenommen zu haben, Angst vor dem Unbekannten, Angst vor diesem riesigen, schier grenzenlosen Land Mongolei.
Nein, das stimmt nicht, widerspreche ich mir selbst. Ich bin kein ängstlicher Mensch, ich habe schon andere gefährliche Abenteuer gewagt und bestanden. Warum sollte ich diesmal Angst haben?
Du fürchtest dich, weil du in der Mongolei bist. Dieses Land bedeutet dir mehr als alle anderen. Du hast Angst zu versagen. Angst vor der Enttäuschung, aber auch vor dem Erfolg. Denn was ist, wenn sich alle deine Wünsche erfüllen? Wie verkraftest du die Leere, die dann folgt?
Ach was, ich mache einfach das, was ich mir vorgenommen habe: Ich sitze auf diesem Pferd und reite durch die Steppe!
Genau – weil du deine Angst nicht ernst genommen und sie verdrängt hast, ist sie dir zur Strafe in die Knochen gekrochen und wird dich quälen, bis du gestehst, dass du Angst hast.
Na gut, dann ist es eben so – dennoch gebe ich nicht auf!
»Tschi jadarsan uu?« Wieder erkundigt sich Mandach, ob ich müde sei. Warum fragt er mich das? Er sieht doch, dass ich mich kaum mehr oben halten kann. Wie viele Stunden reiten wir eigentlich schon? Nein, ich werde erst vom Pferd steigen, wenn Mandach auch müde ist und mich auffordert abzusatteln. Irgendwann muss dieses Reiten ja ein Ende haben, so lange halte ich durch, irgendwie. Mandach hatte mich gewarnt, dass wir heute, an unserem zweiten Tag im Gobi-Altai, eine besonders weite Strecke zurücklegen müssten.
Meine Rettung sind Fliegen, Tiere, die ich neben Mücken und Bremsen, Wanzen und Flöhen am wenigsten mag. Der Morgen war noch kühl gewesen. Fünf Grad hatte mein Thermometer angezeigt, als ich aus dem Zelt herausgekommen war. Die Sonne stieg höher, schickte sengende Strahlen auf die ausgedörrte Erde und erwärmte die Luft auf 35 Grad, gemessen im Schatten meines eigenen Körpers. Jetzt am Nachmittag lastet eine stickige Schwüle über dem Land, und da sind sie – die Fliegen. In dunklen Wolken umschwärmen sie die Köpfe der Pferde, lecken die Augenflüssigkeit, kriechen in die empfindlichen Nüstern. Die gepiesackten Tiere versuchen, die Quälgeister abzustreifen, reiben ihr Maul zwischen den Vorderbeinen, ziehen es durch den sandigen Boden und schlagen fortwährend mit dem Kopf auf und nieder. Im Sattel werde ich durch die heftigen Stöße vor- und zurückgeworfen. Endlich habe ich einen Grund abzusteigen.
»Ene jalaa muuchaj baina.« Ich bin stolz, dass mir der mongolische Begriff jalaa für Fliege eingefallen ist. »Jetzt gehe ich lieber zu Fuß«, sage ich entschieden.
Mandach schaut mich ungläubig an. Wenn es sich vermeiden lässt, geht ein Mongole nie zu Fuß. Selbst die wenigen hundert Meter zur Jurte des Nachbarn legt er lieber reitend zurück. Mandach kämpft mit sich. Der Gewissenskonflikt spiegelt sich deutlich in seinem breiten, gutmütigen Gesicht. Auf keinen Fall möchte er zu Fuß gehen, aber unhöflich will er auch nicht sein – das wäre noch schlimmer.
»Setz dich wieder aufs Pferd, sonst muss auch ich absteigen«, bittet er.
»Ja, ist schon gut«, vertröste ich ihn und denke nicht daran, gleich wieder aufzusitzen. Frei und beschwingt schreite ich aus, den Blick auf den Horizont gerichtet, ich spüre, wie sich mein Körper bei jedem Schritt mehr aus der Verkrampfung löst. Am Führungsseil gehe ich meinem Pferd voran und habe keine Mühe, die Geschwindigkeit zu halten. Aus eigener Kraft laufe ich über die mongolische Erde, die trocken und hart ist. Unzählige braune, vom Wind geschliffene Steinchen bedecken sie.
Freude durchströmt mich – ja, ich bin angekommen. Das ist sie, meine Mongolei! So weit war der Weg, so viele Jahre vergingen, dass ich fast glaubte, sie sei unerreichbar für mich. Dabei war sie das allererste Ziel meiner Sehnsucht. Vor der Schulzeit schon entzündete sich meine Fantasie am Klang des Wortes »Mongolei«, als würde ich eine ferne, verführerische Melodie hören.
Das Leben war noch nicht mit Bildern überflutet. Ich hatte weder Fotos noch gab es Dokumentarfilme über dieses ferne Land. Aber mein Vater erzählte mir von Nomaden, die mit ihren Herden umherziehen und dort, wo sie Weide für die Tiere finden, ihre weißen Filzjurten aufstellen. Ich wusste sofort, das würde mir gefallen, das will ich auch, immer von einem Ort zum anderen wandern. Er beschrieb mir die Grassteppe, die Wüste Gobi, den weiten Horizont so lebhaft, dass ich alles bildlich vor mir sah. Das Wissen hatte Vater aus den Berichten von Sven Hedin über seine Reisen durch Zentralasien in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts.
Nachdem ich lesen gelernt hatte, gehörten Bücher wie »In geheimer Mission durch die Wüste Gobi«, »Großer Tiger und Christian«, »Fremde auf dem Pfad der Nachdenklichkeit«, »Mongolische Heimlichkeiten« von Fritz Mühlenweg, einem Teilnehmer der Sven-Hedin-Expedition, zu meiner Lieblingslektüre. Sie entfesselten einen Sog, dem ich nicht widerstehen konnte. Ich las die Bücher wieder und wieder, bis ich sie fast auswendig konnte. Sie nährten meine Sehnsucht nach einem fernen Land, das mir schon so vertraut war, als wäre ich dort geboren. Meine Seele öffnete sich, wenn ich las: »Man war schnell daheim in der Wüste, weil alle schwierigen Dinge fehlten. Es gab überhaupt nichts als harten Boden zum Darauftreten und den Himmel zum Anschauen.« Oder: »Im Westen schwebte die Sonne über den Zackenrändern ferner Berge. Sie war groß und rot wie eine feurige Kugel, die über eine Welt rollte, von der man nicht glauben konnte, dass sie schon fertig sei.« Und der alte Mongole sprach mir aus dem Herzen, als ich las: »Nachdem eine Weile ausgiebig geschwiegen worden war, begann der alte Mann zu reden. Er sprach mit tiefer Stimme, ohne sie zu heben oder zu senken: Wie traurig muss es sein, nicht als Mongole geboren zu sein! Ein Unglück zwar, aber welch ein Glück für ihn, dass er den Weg zu uns gefunden hat.«
Ja, ich würde den Weg finden, dessen war ich mir ganz sicher. Warum auch nicht? Die Mongolei existierte schließlich nicht nur in Büchern, auch in der Wirklichkeit war sie vorhanden. Auf der Landkarte ging ich mit dem Finger spazieren und tupfte, nun doch etwas zaghaft, auf die elliptische Form, die wie ein schüsselförmiges Gefäß mitten im asiatischen Kontinent eingebettet liegt, umschlossen von China und Russland. Dorthin wollte ich, unbedingt. Aber wie? Ganz einfach: Ich werde Forschungsreisende wie Sven Hedin.
Aber die Zeiten hatten sich geändert, dieses Berufsbild gab es nicht mehr. Das am ehesten verwandte Gebiet schien mir Biologie zu sein, also entschied ich mich zu diesem Studium, obwohl mich die Ungeduld quälte und marterte. Wann endlich würde es so weit sein? Wann würde ich über die Steppen der Mongolei galoppieren?
Das Studium dauerte fünf lange Jahre und bereitete mich überhaupt nicht auf mein zukünftiges Leben in der Mongolei vor. Noch schlimmer, es gab keine Anzeichen, dass man als Biologe dort arbeiten könnte. Trotzdem trainierte ich das Ertragen von Entbehrungen, denn dass mich ein raues Land erwartete, das war mir klar. Nicht im Geringsten zweifelte ich, dass ich für das Leben dort geeignet sein würde. Nur eine Sorge plagte mich: Wovon sollte ich mich ernähren? Die Hauptnahrung der Mongolen besteht aus Fleisch. Es gibt kein Brot, keine Kartoffeln, keinen Reis, kein Gemüse, keinen Salat, einfach nichts, wovon ich leben könnte. Seit ich als Kind eine Fleischvergiftung hatte, an der ich beinahe gestorben wäre, reagiert mein Körper noch heute mit Abscheu und Übelkeit auf den Geruch von gekochtem Fleisch. Mit Gebratenem oder Gegrilltem habe ich dagegen keine Probleme.
Aber zunächst waren es keine Ernährungsfragen, die mich plagten, sondern die Befürchtung, keine Ausreisegenehmigung für die Mongolei zu bekommen. In meiner Verzweiflung schrieb ich einen Brief an die Universität in Ulaanbaatar und bat um eine Einladung – eine Antwort bekam ich nie.
Wie ein Fingerzeig des Himmels erschien es mir daher, als ich in einer wissenschaftlichen Zeitschrift den Bericht der Uni Halle über Expeditionen in die Mongolei las. Also hatte ich doch auf das richtige Pferd gesetzt: Biologen durften offenbar in der Mongolei forschen. Sofort bewarb ich mich in Halle an der Saale als Expeditionsmitglied – und erntete ein mitleidiges Lächeln. Bis heute weiß ich nicht den wirklichen Grund für die Ablehnung: Weil ich Verwandte in Westdeutschland hätte, könnte ich nicht Reisekader werden, sagte man mir. Die Unlogik passte zum System. Vielleicht äußerte ich meinen Wunsch auch zu nachdrücklich? Manchmal kann ein übermächtiges Wollen alles verderben. Jedenfalls war ich überzeugt, schon zu lange gewartet zu haben, fühlte mich gefangen in einem Land, dessen Grenzen hermetisch geschlossen waren. Wie zu hoch gestaute Wassermassen den Damm brechen, riss mich eine innere Flutwelle hinweg: Ich flüchtete aus meinem Land, verließ meine Heimat und Familie, riskierte mein Leben, weil mir die Mongolei versperrt blieb. Wer noch nie von einem so starken Wunsch besessen war, wird diese Entscheidung nur schwer verstehen, aber mir war es völlig ernst.
Später, im Westen Deutschlands, lernte ich die Freiheit schätzen, mir neue Ziele setzen und auswählen zu dürfen. Die Mongolei trat in den Hintergrund; sie verschwand zwar nicht aus meinem Bewusstsein, aber sie verwandelte sich von einem Land, das ich erforschen wollte, in einen Zufluchtsort für meine Seele. Die wirkliche Mongolei lockte mich nicht mehr, so glaubte ich. Doch das Unbewusste geht oft eigene Wege, andere als wir uns eingestehen wollen. Bei einem Fernsehinterview war es, als mir die beliebte Frage gestellt wurde: Und wohin reisen Sie als Nächstes? Diesmal wusste ich keine passende Antwort. Ein neues Buch war gerade fertig geworden, darauf hatte ich meine Energie und mein Denken verwandt. Im Augenblick wollte ich nirgendwohin, wollte mich erholen vom Schreiben, wieder ankommen in der Gegenwart. Der Moderator blickte mich erwartungsvoll an. Da hörte ich mich plötzlich laut sagten: »Mongolei! Mein nächstes Ziel wird die Mongolei sein.«
Erschrocken hielt ich inne, lauschte verblüfft dem Nachklang meiner Worte. Warum hatte ich das gesagt? Welcher Teufel hatte mir das auf die Zunge gelegt? Wie kam ich dazu, meinen Zufluchtsort öffentlich preiszugeben? Gleichzeitig war mir plötzlich bewusst: Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt, in die Mongolei zu reisen. Ich musste mich endlich selbst davon überzeugen, ob meine Fantasie der Wirklichkeit standhielt.
Eine Wohnung in Ulaanbaatar
Von Deutschland aus gesehen wirkte die Mongolei verschlossen wie eine Auster. Die bei meinen anderen Reisen bewährten Kontakthilfen versagten. Weder über die deutsch-mongolische Gesellschaft, noch über Vereine und Organisationen gelang es mir, Adressen von mongolischen Familien zu erhalten. In einem Münchner Biergarten kam mir dann der Zufall zu Hilfe. Während ich auf Freunde wartete, las ich das Buch »Beim Großkhan der Mongolen«, das von der Reise des Franziskanermönchs Wilhelm von Rubruk nach Karakorum zu Mönghe Khan, dem Enkel von Dschingis Khan, handelt. Mein Gegenüber wurde auf die Lektüre aufmerksam, wir kamen ins Gespräch und tauschten Telefonnummern.
Fast hätte ich die Begegnung vergessen, als eines Tages das Telefon klingelte und mein Gesprächspartner aus dem Biergarten mir die Nummer einer Familie in Ulaanbaatar gab. »Ruf einfach an, die Tochter spricht Deutsch! Sie hat in Leipzig studiert und weiß, dass du dich melden wirst«, ermutigte er mich. Ich zögerte. Ungeheuerlich der Gedanke, über diese unvorstellbare Entfernung zu telefonieren. Nach Amerika oder Australien – kein Problem, aber in die Mongolei? Und was sollte ich sagen, wenn zuerst mongolisch sprechende Menschen am Telefon sein würden? Ich legte den Sprachführer »Kauderwelsch« zur Hilfe neben mich und wählte mit klopfendem Herzen die Nummer. Die Leitung war frei, und schon hörte ich eine Stimme. Aufgeregt schrie ich meine mühsam einstudierte Begrüßung in den Hörer: »Sain bajana uu? Bi Carmen baina, bi german.«
»Hi Carmen! Wann kommst du?«, fragte mich jemand in perfektem Deutsch. »Wir warten schon ungeduldig.«
Vor Überraschung verschlug es mir den Atem. Dann erzählte ich von meiner Absicht, in der Hauptstadt eine Sprachschule zu besuchen und dann durch das Land zu reisen, am liebsten zu Pferde.
»Komm nur, wir helfen dir in allem. Unsere Nachbarin ist Lehrerin, die wird dich gern unterrichten. Du kannst in unserer Wohnung wohnen, wir selbst verbringen den Sommer auf dem Land«, ermunterte mich Enkhjargal. »Nenn mich einfach Enkhe«, sagte sie.
Ich legte den Hörer auf und konnte mein Glück kaum fassen – plötzlich war er da, der Schlüssel, mit dem sich die Mongolei für mich öffnen würde. Hatte ich erst einmal das Vertrauen einer Familie gewonnen, würde ich immer weitergereicht werden.
Mein Plan war, mich zunächst für drei Monate in der Hauptstadt Ulaanbaatar aufzuhalten, um die Sprache zu lernen. Nebenbei wollte ich verschiedene Erkundungstouren machen, erste Eindrücke vom Land gewinnen und Ideen entwickeln, die ich dann ein Jahr später bei einer längeren Reise versuchen würde zu verwirklichen.
Die mongolische Airline MIAT bringt mich von Berlin nach Ulaanbaatar. Nach einem Stopp in Moskau geht es weiter nach Osten. Es ist Nacht. Beim Blick aus dem Fenster leuchtet die russische Hauptstadt wie eine goldene Stickerei, dann Dunkelheit. Sehr selten kleine Lichternester inmitten des unermesslich großen, unbewohnbar wirkenden Landes.
Enkhe hatte versprochen, mich am Flughafen abzuholen. Da keine von uns weiß, wie die andere aussieht, halte ich nach einem Schild mit meinem Namen Ausschau. Vergeblich. Da trifft mein Blick den einer jungen Frau. In unseren Augen muss die gleiche Frage stehen, denn wie aus einem Mund rufen wir: »Enkhe?« – »Carmen?« Wir fallen uns in die Arme, als würden wir uns schon lange kennen.
Enkhe und ihre Tante Hauka sind mit ihrem Auto zum Flughafen gekommen. Enkhe, zu der ich sofort eine besondere Zuneigung empfinde, ist ungeheuer aufgeregt über ihren fremden Gast. Gleich auf der Fahrt will sie mir ihre Heimatstadt vorstellen.
»Sieh, diese Fabriken dort, da werden Teppiche, Schuhe und Kaschmirwaren hergestellt, dafür ist unser Land berühmt. Und dort, wo es raucht und qualmt, ist das Heizkraftwerk. Unsere Energie wird aus Kohle gewonnen, drei Kohlekraftwerke versorgen die Stadt mit heißem Wasser und Strom. Und hier werden Tierhäute zu Leder verarbeitet, leider riecht es nicht gut, und …« Enkhe bricht ab, beißt sich verlegen auf die Lippen. Sie weiß, der erste Eindruck ist prägend. Ihre Stadt möchte sie mir in einem schönen Licht zeigen und bemerkt wohl auf einmal die Löcher im Straßenbelag und fürchtet, das könnte mir missfallen. Aber sie braucht sich keine Sorgen zu machen, denn ich bin überzeugt, dass Ulaanbaatar nach dem vielen Negativen, das ich über diese Stadt gelesen habe, nur noch angenehme Überraschungen für mich bereithalten kann.
Lärm, Staub, Gestank und lebensgefährlicher Verkehr seien typisch für die mongolische Hauptstadt, heißt es. In hässlichen Plattenbauten würden alkoholkranke, ihrer nomadischen Lebensweise beraubte Menschen dahinvegetieren. Unkontrolliert wie ein Schwellkopf wuchere die Stadt, die zwischen Bergen in einem Hochtal mit geringer Luftzirkulation liegt. Sie wachse immer weiter, greife wie mit Fangarmen einer Krake in die sie umgebenden Täler.
Ja, das mag alles stimmen, und wer als Reisender nach Ulaanbaatar kommt und hier die Mongolei sucht, wird sie nicht finden und froh sein, schnell die Stadt verlassen und hinaus in die Steppe fahren zu können. Mir aber gefällt es in der »roten Heldenstadt«. Mich erstaunt das selbst am meisten, denn bisher hatte jede Häuseransammlung eine abschreckende Wirkung auf mich, und in Metropolen fühle ich mich verloren und überflüssig. In Ulaanbaatar hingegen entsteht in mir vom ersten Tag an ein Gefühl der Zugehörigkeit. Den eigenartigen Zauber dieser Stadt auf mich kann ich nicht erklären; ich spüre nur, dass sie mir auf geheimnisvolle Weise die Hand reicht. Nie befällt mich Unsicherheit, wenn ich sie nach allen Richtungen durchstreife. Kein Gedanke daran, dass ich mich verirren könnte. Als wäre der Straßenverlauf in meinem Kopf abgebildet, brauche ich keinen Stadtplan, um mich zu orientieren. Ulaanbaatar wird für mich zu einem Heimatort, zu dem ich nach anstrengenden Expeditionen durch Steppen und Wüsten gern zurückkehre und den köstlichen Gegensatz genieße zwischen dem Nomadenleben unter freiem Himmel und der quirligen, modern aufblühenden Hauptstadt.
Ulaan heißt rot, und baatar ist der Held. Der rote Held, sagt eine Legende, erlöse die Menschen von Leid und Unglück. Diesen Namen erhielt die Stadt erst 1924, als sich die Mongolen von chinesischer Herrschaft befreien konnten und die Mongolische Volksrepublik gründeten. Von da an wurde die Stadt sesshaft und »wanderte« nicht mehr wie in früheren Zeiten, als man sie mehr als zwanzig Mal verlagerte. Eine nomadisierende Stadt? Das war weder ungewöhnlich noch schwierig, denn selbst die Klöster waren anfangs in Jurten untergebracht. Im Jahr 1639 wurde das erste Kloster vom Oberhaupt der mongolischen Buddhisten in diesem Tal des Flusses Tuul gegründet. Die Nomadensiedlung, die um die Klosterjurte wuchs, erhielt den Namen Örgöö, Palastjurte. Die mit den Mongolen Handel treibenden Ausländer machten daraus Urga. Bald gab es Werkstätten, Lagerhäuser, Läden und Märkte. Die Siedlung entwickelte sich zum religiösen, wirtschaftlichen und administrativen Zentrum des Landes, doch selbst in der Stadt bevorzugten die Mongolen ihre Jurten.
Die einen Besucher beschrieben die Stadt als schmutzig, voll zerlumpter Bettler und sterbender Menschen, die im Abfall auf den Straßen lagen. Andere rühmten sie als reich, mit juwelengeschmückten Statuen, prächtigen Schreinen und goldenen Dächern, die in der Sonne leuchteten. Mehr als hundert kleine und große Tempel prägten das Bild des alten Urga, und 60 000 Lamas, in Seide und Brokat gehüllt, zelebrierten religiöse Riten. Heute erinnert nur wenig an die vergangene Zeit. Für die Hauptstadt des Nomadenvolkes begann 1954 eine neue Zeitrechnung. Eine sowjetisch-mongolische Planungskommission erarbeitete einen Generalbebauungsplan; es kam zu einem regelrechten Bauboom, der die Stadt völlig verwandelte. Wohnsilos entstanden mit in den Himmel ragenden Betonbauten nach sowjetischem Vorbild. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte bezogen Mongolen feste Häuser mit Zentralheizung, elektrischem Herd, Wasserklosett und Dusche.
Mein neues Zuhause befindet sich in einem dieser Wohnblöcke, ganz oben im 9. Stock. Im Fahrstuhl sagt Enkhe: »Meine Mutter hat sich den Vormittag freigenommen, um dich zu begrüßen. Sie ist ziemlich aufgeregt, ob es dir bei uns gefallen wird.«
Lächelnd steht Njamsuren in der Tür. Eine schlanke Frau, die mit ihren fast sechzig Jahren erstaunlich jugendlich und resolut wirkt. Sie nimmt mich in die Arme und riecht an meinen Schläfen. »Sajan baina uu, minij hüühen«, sagt sie. Sei willkommen, meine Tochter. Wie selbstverständlich werde ich als neues Mitglied in die Familie aufgenommen. Obwohl ich die erste Ausländerin bin, die bei ihnen zu Gast ist, entsteht keine Verlegenheit. Die Beachtung, die sie mir schenken, ist so unaufdringlich, als gehörte ich schon immer dazu.
Wie viele Personen in der Wohnung tatsächlich leben, bleibt mir zunächst verborgen, denn außer Njamsuren, ihren Töchtern und Enkeln sitzen Cousinen, Tanten und Nichten in der Stube – alles Frauen. Männer bekomme ich keine zu Gesicht. Die Wohnung ist europäisch eingerichtet, und nichts erinnert daran, dass ich mich in der Mongolei befinde. Dafür wird ein typisch mongolisches Gericht aufgetischt: buuds, das sind Teigtaschen mit Fleisch gefüllt und in Wasserdampf gegart. »Amttaj!«, lobe ich, nachdem ich mich erkundigt habe, wie man ein schmackhaftes Essen würdigt.
Es klingelt, und eine Nachbarin kommt. Es ist Ojunaa, die Lehrerin. Sie fragt, wann ich mit dem Unterricht beginnen möchte. So schnell es geht, am liebsten morgen. »Margasch!«, sage ich, eines der wenigen Wörter, die ich außer der Begrüßungsformel bereits gelernt habe. Erwartungsvoll blicke ich meine zukünftige Lehrerin an. Sie lächelt nicht, vermeidet es, mir in die Augen zu sehen, und wendet sich statt einer Antwort an Enkhe. Ich verstehe kein Wort. Eine Weile zügle ich meine Ungeduld, um nicht unhöflich zu sein. »Enkhe«, frage ich schließlich »in welcher Sprache kann ich mich denn mit meiner Lehrerin unterhalten?«
»Ojunaa spricht nur Mongolisch.«
»Wie bitte? Das geht doch nicht!« Ich bin fassungslos.
»Kein Problem, Ojunaa hat ihre eigene Methode, mit der sie sogar Taubstummen das Sprechen beibringt. Auch Japaner haben bei ihr schon Mongolisch gelernt, ohne dass sie selbst ein Wort Japanisch spricht.«
Am nächsten Tag lasse ich es auf einen Versuch ankommen, doch der Unterricht macht für mich keinen Sinn. Ojunaa wendet die Zeigemethode an. Sie weist mit dem Finger auf Fernseher, Kühlschrank, Fenster, Heizung und nennt mir die mongolischen Bezeichnungen. Was soll ich mit diesen Wörtern? Sie spielen im Nomadenleben keine Rolle. Wichtig sind Verben und Grammatik. Aber auf die kann man nicht zeigen, man muss sie erklären.
Ich gebe nicht auf und mache mich auf die Suche nach einer Sprachschule, habe aber kein Glück, denn es ist Ferienzeit. Universität und private Schulen sind geschlossen. Überhaupt wirkt Ulaanbaatar fast wie unbewohnt, denn die meisten Städter verbringen den Sommer auf dem Land bei ihren Verwandten oder in einem Ferienhaus, so wie meine Gastfamilie.
Vorher will Njamsuren zum Kloster, um dort zu beten, und lädt mich ein, mitzukommen. Ende der 1930er-Jahre wurden die Klöster von den kommunistischen Machthabern zerstört. Einzig das Tschojdshin-Lamyn-Kloster entging den Exzessen, die von der mongolischen Regierung im Auftrag Stalins durchgeführt wurden; angeblich hatte Diktator Tschoibalsan es im letzten Moment von der Liste der zu vernichtenden Gebäude gestrichen. Heute kann jeder das ehemalige Kloster besichtigen.
Auch das größte und heute wieder aktive Gandantegtschinlen-Kloster, eine weiträumige Tempelanlage mit stillen Innenhöfen, wurde damals niedergebrannt, doch bald ordnete Tschoibalsan den Aufbau der Ruine an. Schon 1944 wurde das Gandan-Kloster neu eröffnet und durfte als »Alibi-Kloster« weiter existieren. Erlaubt war zwar das Lesen der tibetischen Ritualtexte, nicht aber das Studium der buddhistischen Philosophie. Die Staatssicherheit hatte zahlreiche Spitzel eingeschleust. Wer heimlich gegen die Vorschriften verstieß, wurde mit Gefängnis bestraft oder riskierte sogar sein Leben.
Mit dem Beginn von Demokratie und Religionsfreiheit im Jahr 1990 blühte der Buddhismus im Lande wieder auf, nach 60-jähriger Unterdrückung eigentlich ein Wunder. Ehemalige buddhistische Mönche, die Lamas, die damals nur deshalb nicht erschossen wurden, weil sie zu jung waren, eilten zu den Plätzen, wo früher Klöster gestanden hatten, und gingen als Greise daran, die heiligen Tempel zu erneuern.
Die Sonne glüht am wolkenlos blauen Himmel, und die Luft ist glasklar. Trotzdem fegt ein eisiger Wind durch die Häuserblocks Ulaanbaatars – mitten im Sommer. Njamsuren, meine Wirtin, und ich gehen zu Fuß zu der nur wenige Minuten entfernten Klosteranlage. An einer Ampel bleiben wir stehen. »Ulaan«, sage ich. Um eine Sprache zu lernen, muss man die bekannten Wörter bei jeder sich bietenden Gelegenheit laut aussprechen. »Nogoon«, kommentiert Njamsuren das Grün beim Umschalten der Ampel. Sie lächelt mir zu, ich lächle zurück und bin doch verzweifelt: Grün und rot, damit ist nun wirklich kein Gespräch zu führen. Dabei möchte ich so viel wissen, sie fragen, wie es kommt, dass sie Buddhistin ist. Ob sie früher heimlich gebetet hat? Während ich stumm neben ihr gehe, schwirren mir Fragen über Fragen durch den Kopf. Neben uns stöckeln Mädchen über holprige Fußwege. Wie sie das nur können mit ihren bleistiftdünnen Absätzen? Trotz der Kälte sind sie spärlich bekleidet mit bauchfreien Tops, Miniröcken, Hotpants. Jede versucht, die andere in modischer Kleidung zu übertreffen.
Durch ein Tor betreten wir die weitläufige Klosteranlage mit ihren zahlreichen Tempeln, die hinter gelben Mauern verborgen liegen. Als Erstes fallen mir die Tauben auf. Froh, endlich wieder etwas sagen zu können, rufe ich laut: »Tagtaa!« Njamsuren schaut mich fragend an. Sie überlegt wohl, warum ich mich über die Vögel so freue. Ich kann ihr nicht erklären, dass ich nur Mongolisch übe.
Schon im Jahr 1809 stand hier ein Tempel aus Holz, von dem nichts erhalten geblieben ist. Die heutige Anlage geht auf das Jahr 1838 zurück. Der Baustil der Gebäude lässt deutlich den tibetischen Einfluss erkennen. Die Dächer sind an den Ecken nach oben gebogen, Drachen und Löwen bewachen die Eingänge, farbige Säulen und bunte Schnitzereien zieren das Innere der Tempel.
Die erste Begegnung der Mongolen mit dem Buddhismus ergab sich durch die Kriegszüge der Söhne und Enkel Dschingis Khans, die im 13. Jahrhundert Tibet eroberten und ihrem Großreich einverleibten. Buddhistische Mönche beeindruckten die religiös eher tolerante mongolische Oberschicht durch medizinische Kenntnisse und intellektuelle Fähigkeiten und bewegten einige Mitglieder der Fürstenfamilien zur Annahme des Buddhismus. Der mongolische Herrscher Kublai Khan ernannte den berühmtesten der tibetischen Lamas, Pags Pas, zu seinem Berater und sandte andere ins Zentrum des mongolischen Reichs, nach Karakorum. Sie gründeten zwar einige Klöster, aber es gelang ihnen nicht, breite Schichten der Bevölkerung zu bekehren, und nach weniger als einem Jahrhundert gerieten die in gelbe Kutten gekleideten Mönche in Vergessenheit.
Mitte des 16. Jahrhundert gab es eine neue, diesmal rigorosere Missionierungswelle. Innerhalb nur einer einzigen Generation wurde die Mehrheit der Mongolen buddhistisch, obgleich viele insgeheim weiter zu ihren Naturgöttern beteten, so wie es manche bis heute tun. Altan Khan, 1506–1582, ein Fürst vom Stamm der Tümed und weitläufig verwandt mit Dschingis Khan, wollte alle Mongolen vereinen und stülpte den rivalisierenden Stämmen die neue Glaubensphilosophie einfach über. Recht, Ordnung und Verwaltung sollten sich fortan an buddhistischen Grundsätzen orientieren. Die Anhänger des Schamanismus wehrten sich heftig gegen die gewaltsame Bekehrung, doch sie hatten keine Chance. Die Ausübung alter Bräuche wurde verboten. Wer das Gesetz missachtete, musste so viel Vieh abgeben, dass seine Existenz bedroht war. Den Schamanen erging es noch übler. Sie wurden mit Hundekot beschmiert und manchmal mitsamt ihrer Jurte verbrannt. Die onggot, kleine Götterfiguren aus Holz, Filz, Stoff oder Leder, die bis dahin in keiner Jurte fehlten, schichteten die buddhistischen Religionshüter zu großen Haufen und zündeten sie an.
Als der erste Widerstand gebrochen war, bediente man sich der raffinierten Methode der Umdeutung und Adaption. Onggot-Figuren ersetzte man durch ähnliche buddhistische Gottheiten. Schamanische Gesänge wurden durch lamaistische Gebete abgelöst und die Naturgötter der neuen Religion einverleibt. Das Verweben schamanischer und buddhistischer Traditionen war leicht, weil der gleiche Vorgang in Tibet bereits Jahrhunderte zuvor stattgefunden hatte. Damals ging die Naturgötter verehrende Bon-Religion im Buddhismus auf. Es gibt heute keine Religion der Welt, die unabhängig aus sich selbst schöpft; immer speisen sie sich aus älteren Quellen.
Der Buddhismus verbreitete sich zunächst entlang den Karawanenrouten, wo sich seine Anhänger bevorzugt bei den der Bevölkerung vertrauten schamanischen Heiligtümern niederließen. Allmählich wurde das dünn besiedelte Nomadenland mit einem Netz von Klöstern überzogen. Kaufleute gründeten in ihrem Schutz Handelsniederlassungen. Die Bedeutung der Klöster wuchs, sie brachten Bildung und Gelehrsamkeit ins Land. Lesen und Schreiben, handwerkliche und künstlerische Fähigkeiten wurden gefördert. Malerei, plastische Darstellung, Musik, Tanz, Erzählkunst fanden Einzug in den Alltag der Steppennomaden. Sie hielten engen Kontakt zu »ihrem« Kloster, und bald wurde es zur Regel, wenigstens einen Sohn Lama werden zu lassen. Die Mongolen wurden zum bestausgebildeten Nomadenvolk der Welt, waren aber in allen ihren Entscheidungen vom Kloster abhängig. Sie unternahmen keinen Schritt ohne die Konsultation und den Segen eines Lama. Er errechnete den günstigsten Zeitpunkt für Heirat, half bei Namensgebung, heilte Krankheiten und weissagte die Zukunft.
Diese enge Verflechtung, das fast symbiotische Verhältnis zwischen Kloster und Bevölkerung, wurde auf Befehl Stalins jäh zerrissen, und die meisten Mönche bezahlten mit ihrem Leben. 60 Jahre lang wurde Religionsausübung zuerst mit Tod, später mit langjährigen Gefängnisstrafen geahndet. Mit diesem Wissen im Hintergrund hatte ich erwartet, dass sich für den Buddhismus kaum noch jemand begeistern würde. Doch ich täuschte mich – das Gegenteil ist der Fall.
Wir schreiten von einem Tempel zum anderen. Njamsuren setzt Gebetsmühlen in Gang, ich tue es ihr gleich, und so senden wir die Gebetsformel O mani padme hum – O du Juwel im Lotos – tausendfach vervielfältigt in den Himmel.
Es ist noch früh am Morgen, und doch sind in den Räumen viele Gläubige. In einem haben Lama-Schüler übernachtet. Aufgeweckt vom Gongschlag und den hereindrängenden Menschen erheben sie sich schlaftrunken von den schmalen Holzbänken, wickeln ihre weinroten und gelben Tücher fester um den Körper, und ohne sich lange zu besinnen, beginnen sie mit der Litanei der Gebete. Auf und ab schwillt der Gesang. Im Haupttempel sitzen Mönche jeden Alters auf gepolsterten Bänken und blättern in den losen Seiten ihrer Gebetsbücher. Ein Zeremonienmeister unterbricht das Murmeln ab und zu durch lautes Ausrufen eines Mantras, dann wieder erschallt mit Getöse ein Gong oder der dumpfe Hall eines Muschelhorns.
Njamsuren und ich reihen uns ein in die Menge der Gläubigen, die sich im Uhrzeigersinn langsam um die Lamas in der Mitte bewegen. Auf einem schmalen Gang gehen wir an Vitrinen mit Bodhisattvas, den Figuren von Heiligen, vorbei. Mit aneinandergelegten Händen, die dicht vors Gesicht gehalten werden, verbeugen wir uns vor den Erleuchteten. Auf Simsen, wo Butterlampen und Weihrauch brennen, liegt Geld. Auch Njamsuren fingert einen Schein aus ihrer Tasche. Dann nimmt sie meine Hand und bedeutet mir mit Zeichensprache, dass sie mir noch etwas Besonderes zeigen will. Sie zieht mich zum größten Tempel, der allein in der Mitte auf einer Anhöhe steht und Anfang des 20. Jahrhunderts unter dem letzten mongolischen Kirchenoberhaupt Bobd Gegeen erbaut wurde. Auf dem Weg dorthin sehe ich nicht nur Gläubige im traditionellen deel, einem wadenlangen, gesteppten und wattierten Mantel, der übereinandergeschlagen, seitwärts geschlossen und in der Taille mit einem orangefarbenen Seidenschal gegürtet wird, sondern auch junge westlich gekleidete Menschen, die sich vor Buddhastatuen und Stupas dreimal der Länge nach auf dafür vorgesehene Gebetsbretter niederwerfen.
Im dunklen Inneren des Tempels schimmert eine goldene Figur. Mein Blick gleitet nach oben. Sie reicht bis unters Dach und füllt den Tempel völlig aus. Ja, das muss sie sein, die fast 30 Meter hohe Statue des Megdshid Dshanraisig, des Schutzherrn Tibets, ein Bodhisattva, dessen Reinkarnation der Dalai Lama ist. Der von Tibet vertriebene, nach Indien geflüchtete und im Westen sehr beliebte Dalai Lama wird als die 14. Inkarnation dieses Bodhisattva angesehen. Das kostbare Original aus Gold und Silber haben die Russen im Jahr 1938 geraubt. Als die Sowjetunion sich auflöste, hofften die Mongolen, ihr Eigentum zurückzuerhalten, doch ihre Bitte blieb unerhört. Niemand weiß, ob die Figur noch irgendwo versteckt ist, vielleicht im Fundus der Eremitage, oder ob sie eingeschmolzen wurde. Nach dem Scheitern aller Bemühungen begannen die Mongolen, Geld zu sammeln – eine halbe Million Euro kam zusammen, viel für ein Nomadenvolk. Ich fühle mich an die Spendenaktion für die Frauenkirche in Dresden erinnert. Menschen brauchen eben Symbole, um sich ihres Daseins bewusst zu werden, vor allem in Umbruchzeiten nach leidvoller Unterdrückung.
In fünfjähriger Arbeit wurde eine exakte Kopie des Schutzheiligen geschaffen und im Oktober 1996 feierlich vom Staatspräsidenten und dem Abt des Gandan-Klosters eingeweiht. Die Figur ist 90 Tonnen schwer. Verarbeitet wurden fast 9 Kilo Gold, 25 Kilo Silber, 20 Tonnen Kupfer und 2100 Edelsteine.
»Meine Mutter hat für dich gebetet«, erzählt mir Enkhe, als wir zurück sind, »damit deine Reise in der Mongolei glücklich verläuft.«
Früher war Mutter Njamsuren nicht religiös, nur die Großeltern hielten an der Religion fest. Waren die Enkel in den Ferien zu Besuch, wurden sie beim Abschied ermahnt, nichts davon in der Schule zu erzählen.
»Wie kam es, dass deine Mutter Buddhistin wurde?«, frage ich meine Freundin.
»Sie war traurig über den Tod ihres Bruders, da hat sie sich dem Glauben zugewandt.« Enkhe ist die Einzige, mit der ich mich unterhalten kann, aber die Gespräche werden oft von ihrem Sohn Erdenee unterbrochen, der erst ein halbes Jahr alt ist, und von der einjährigen Naraa, deren Eltern in Korea arbeiten. Als endlich einmal beide Kinder gleichzeitig schlafen, erfahre ich mehr von der Familiengeschichte: Enkhes Vater verunglückte auf tragische Weise, stürzte eine vereiste Treppe hinab. Von einen Tag auf den anderen war Njamsuren allein mit vier schulpflichtigen Kindern, drei Töchter und ein Sohn. Es gelang ihr, allen eine gute Schulbildung zu geben und sie studieren zu lassen. Enkhe ist die Jüngste und das Sorgenkind der Mutter. Ihr Medizinstudium in Deutschland musste sie wegen der Schwangerschaft abbrechen, und dann trennte sie sich auch noch von ihrem mongolischen Freund, dem Vater ihres Kindes.
Trotz guter Ausbildung oder gerade deswegen haben ihre Kinder bisher in der Mongolei keine Arbeit gefunden. Es gibt einfach zu wenige Firmen und Betriebe mit qualifizierten Stellen. Wie seit dem Tod ihres Mannes vor 20 Jahren muss Njamsuren noch immer den Lebensunterhalt für die ganze Familie finanzieren. Sie ist Ingenieurin und arbeitet bei einer Baufirma. Einen Achtstundentag gibt es nicht, selten kommt sie vor 21 Uhr nach Hause. Sie arbeitet auch samstags und sonntags, freie Wochenenden und Urlaub kennt sie nicht. Der Lohn ist erschreckend gering, wenig über 100 Euro im Monat. Wenn Hochkonjunktur herrscht, gibt es einen kleinen Zuschlag, dafür muss sie im Winter, wenn bei über 40 Grad minus nicht gebaut werden kann, ohne Gehalt auskommen und ist dann schon glücklich, wenn der Baustopp nur die Monate Januar und Februar betrifft.
Allgemein sind die Löhne in der Mongolei sehr niedrig, im Durchschnitt 60 Euro im Monat. Das verdient zum Beispiel ein Lehrer, dabei kosten die Lebensmittel ungefähr so viel wie bei uns. Wenige Produkte werden in der Mongolei selbst hergestellt, fast alles wird aus Russland oder China importiert. Um zu überleben, mussten sich die Mongolen pfiffige Ideen und Strategien einfallen lassen: Wer Verwandte auf dem Land hat, kauft bei ihnen das Hauptnahrungsmittel Fleisch im Stück. Im Winter sieht man gefrorene Hammel- und Ziegenhälften auf den Balkonen hängen. Andere nehmen mehrere Untermieter auf und hausen mit der eigenen Familie in einem einzigen Zimmer, suchen sich Nebenjobs, fahren nach China, kaufen dort Waren und verkaufen sie im Land mit Gewinn.
Eigentlich wollte Njamsuren gar nicht Bauingenieurin werden. Grafische Darstellungen sind ihre Passion, und sie wäre gern technische Zeichnerin geworden. Aber sie konnte nicht wählen und frei über ihren Beruf entscheiden. In kommunistischer Zeit wurden Pläne aufgestellt, die erfüllt werden mussten. Die zierliche junge Frau wurde genötigt, einen harten Männerberuf zu ergreifen. In Wind und Kälte, Staub und Schmutz kletterte sie auf Gerüste, balancierte über gefährlich schwankende Bretter, erteilte den Arbeitern Anweisungen und kontrollierte deren Tätigkeiten. Njamsuren bewährte sich, bekam Auszeichnungen; die Anerkennung tat ihr gut. Sie empfand es nicht als Zumutung, selbst mit vier kleinen Kindern zu arbeiten. Arbeit war Pflicht. Nach der Geburt musste eine Frau das Kind schon nach 49 Tagen abstillen und es tagsüber in eine Kinderaufbewahrungsstation geben.
»So war es eben«, übersetzt Enkhe. »Außerdem wäre ich gar nicht gern zu Hause geblieben, ich arbeite viel lieber in meinem Beruf. Da war ich froh, dass mein Mann, dessen Arbeitszeit kürzer war, das Essen gekocht, die Hausarbeiten der Kinder kontrolliert und sie manchmal schon ins Bett gebracht hatte.«
Auf dem Rücken »wilder« Pferde
Seit Tagen bin ich allein in der Wohnung. Njamsuren mit Tochter Enkhe, den Enkeln und Großmutter Altanchimeg sind aufs Land gezogen. Sie leben dort nicht in einer Jurte, sondern in einem Holzhaus. Zahlreiche dieser buntfarbenen Häuschen füllen ein weites Tal, umgeben von sanft geschwungenen Hügeln, die mit Lärchen bewachsen sind. Ein Anblick, der eher an ein skandinavisches Land erinnert. Mit dem Bus ist dieses beliebte Sommerdomizil der Ulaanbaataner Stadtbevölkerung in einer knappen Stunde zu erreichen. Manchmal besuche ich »meine« Familie, doch mir steht der Sinn nach freiem Nomadenleben. Da aus dem Sprachunterricht nichts geworden ist, habe ich viel Zeit gewonnen, die ich zum Erkunden des Landes benutzen will. Als Erstes möchte ich reiten und den Umgang mit den halbwilden mongolischen Pferden erlernen.
»Kein Problem«, hatte Enkhe gesagt, »Bazaar wird dich abholen. Er ist ein entfernter Verwandter, auf Deutsch sagt man Großonkel, glaube ich.«
Vom 9. Stock blicke ich hinunter und warte auf Bazaar, der mich in die Steppe bringen soll. Nomaden reisen möglichst nicht allein, weiß ich. Nicht weil sie sich fürchten, sondern weil man mit der Hilfe des anderen Probleme unterwegs besser bewältigen kann und es unterhaltsamer ist. Nomaden reden gern, das hatte ich im Jemen erlebt. Deshalb halte ich nach mindestens zwei Männern Ausschau. Die Wartezeit verbringe ich sinnvoll mit Vokabellernen und genieße dabei den Blick vom obersten Stockwerk auf die Stadt. Die weiß gekachelten Hochhäuser sind in Karrees angeordnet und lassen großzügig Raum für Parkanlagen und Kinderspielplätze mit Schaukeln, Wippen und Karussells. Die Kleinen üben ihre Geschicklichkeit an Klettergerüsten, schlittern vergnügt quietschend Rutschen hinunter und reiten auf bunt bemalten Tierfiguren, behütet von Geschwistern, Eltern oder Großeltern.
Für Erwachsene sind Fitnessgeräte aufgestellt, an denen sie ihre Arm-, Bein- und Bauchmuskeln trainieren und den Kreislauf in Schwung bringen. Am Straßenrand bieten Bäuerinnen in Kannen und Töpfen Milch, Joghurt, Frischkäse, Butter und Sahne zum Verkauf an, denn mitten in der Hauptstadt werden nicht nur Ziegen und Schafe, sondern auch Kühe gehalten. Fürsorgliche Väter und junge Mütter sitzen auf Parkbänken, halten fest gewickelte Babys im Arm, damit sie frische Luft atmen können. Kinderwagen sieht man so gut wie keine.
Plötzlich werde ich durch das Klingeln an der Wohnungstür aus meinen Beobachtungen aufgeschreckt. Wer kann das sein? Ich hatte niemanden das Haus betreten sehen. Verwirrt und doch gespannt öffne ich die Tür nur einen Spalt breit und erblicke eine attraktive Frau. Sie trägt einen engen Rock mit weißer Bluse, dazu hochhackige Schuhe. Ihre Haare glänzen wie schwarzer Lack. Resolut drängt sie mich beiseite, steuert das Wohnzimmer an und setzt sich aufs Sofa, als sei sie hier zu Hause. Staunend betrachte ich sie.
»Ich bin Durimaa! Wollen Sie gleich mitkommen?«
»Durimaa? Ich habe Bazaar erwartet.«
»Ach, Bazaar, das ist mein Bruder, er muss sich um die Pferde kümmern.«
Ich lächle. Wieder hat sich bestätigt, was ich schon seit meiner Ankunft beobachte: Frauen geben in der Mongolei den Ton an, und sie fallen durch exquisite Kleidung auf. Mongolinnen scheinen schneller in der neuen Zeit angekommen zu sein als die meisten Männer. In anderen Ländern sind es fast immer die Frauen, die alte Traditionen bewahren und sich länger den Änderungen verweigern.
Inzwischen habe ich im Selbststudium so viel Mongolisch gelernt, dass ich Durimaa mitteilen kann, dass ich gerne zwei Wochen bei Nomaden wohnen und an ihrem Alltagsleben teilnehmen möchte, wozu natürlich das Reiten von Pferden gehört. Sie ist einverstanden und will mich am nächsten Tag zu ihren Verwandten bringen.
Mit Sugarsuren, dem Sohn Durimaas, begegne ich tags darauf dem ersten männlichen Mitglied meiner Gastfamilie. »Mein Sohn spricht Englisch. Er wird Sie aufs Land begleiten, damit Sie dort jemanden haben, mit dem Sie sich unterhalten können.« Sugarsuren ist 18 Jahre alt. Seit einem Jahr lernt er Englisch, hat seine Kenntnisse aber noch nie bei einem Ausländer anwenden können. Ich bin überrascht, wie gut er die Sprache schon spricht; zusammen mit meinem mongolischen Kauderwelsch können wir uns verständigen.
In ihrem weißen Wagen chauffiert uns Durimaa aus Ulaanbaatar hinaus. Bei einem owoo, einem heiligen Steinhaufen, mit Blick auf die große Stadt im Tal des Tuul, halten wir an, umrunden ihn dreimal im Uhrzeigersinn und legen drei Steine dazu. Diese Steinanhäufungen, die auf Bergen und Passhöhen errichtet werden, sind der sichtbare Ausdruck für den tief verwurzelten Volksglauben, bei dem Naturgottheiten verehrt werden, die man mit Opfergaben günstig zu stimmen sucht, damit sie die Menschen beschützen.
Jeder, der an einem owoo vorbeikommt, tut gut daran, beim Umrunden drei Steine hinzuzufügen, und wenn er besonderer Fürbitte bedarf, opfert er Geld, früher auch Butter und Tee, Tierschädel und Jagdtrophäen. Während der kommunistischen Herrschaft galt solches Verhalten als volksverdummender Aberglaube, und viele owoos wurden zerstört.
Während Sugarsuren und ich vorschriftsmäßig unsere drei Runden drehen, macht Durimaa nur eine halbe. Für sie, die im Kommunismus aufwuchs und von ihm geprägt wurde, ist dies ein Zugeständnis an die neue Zeit, die uralte Traditionen wieder aufleben lässt. Statt Steinchen zu sammeln und auf den owoo zu legen, versinkt sie in Betrachtung der über die Berge ziehenden Wolken, welche die Sonne verdunkeln und zarte Schleier an den Horizont zaubern.
»Dort regnet es schon«, sagt sie und zeigt in die Ferne. »Das Gras wird wachsen, das ist gut für das Vieh. Dieses Jahr war es in den sonst regenreichen Monaten Juni und Juli zu trocken. Mitte August wird es Zeit, dass Regen kommt.«
Wir verlassen die asphaltierte nördliche Ausfallstraße. Auf sandigen Erdwegen geht es nach Südwesten, und ich lerne ein neues Wort: els – Sand. Ich hatte eine flache Steppe erwartet mit wehendem Gras, ein Meer von Gras, das sich von Horizont zu Horizont dehnt und sich bei jedem Windstoß wellenförmig bewegt. Doch das Land im Südwesten von Ulaanbaatar ist erstaunlich hügelig. Aus den grünen Erhebungen ragen entfernte Bergketten empor, die weder mit Bäumen noch Büschen bewachsen sind. Ab und zu sehe ich weiße Jurten, grasende Schafe, Ziegen und einen einsamen Hirten auf einem Pferd.
Irgendwo in dieser Weite gelangen wir zu fünf Jurten, die einen Halbkreis bilden. Vier Familien leben hier, das fünfte Filzzelt ist für Sugarsuren und mich reserviert. Bevor wir einziehen und uns bei den Nachbarn vorstellen können, kommt Bazaar angeritten, der älteste Bruder Durimaas, und erzählt etwas von einem Streit. Die Schwester steigt mit uns sofort in ihr Auto und fährt über die weglose Steppe, bis wir nach zwei, drei Kilometern auf eine Familie treffen, die ihre Jurte abbaut und auf einen Lieferwagen verlädt. Durimaa redet mit den Leuten. Der Tonfall fließt bei allen Beteiligten erstaunlich gleichmäßig dahin, keiner fällt dem anderen ins Wort. Nachdenkliche Pausen rahmen die Reden ein. Auch an den Gesichtern kann ich keine Gemütsbewegungen wie Ärger und Zorn, Wut oder Traurigkeit ablesen. Von Sugarsuren erfahre ich, es habe sogar eine Schlägerei gegeben, aber sein Englisch und mein Mongolisch reichen nicht aus, um zu erfahren, was genau passiert ist.
Zum ersten Mal in meinem Leben übernachte ich in einer Jurte, die in der Mongolei ger heißt. Das bei uns gebräuchliche Wort »Jurte« stammt aus dem Alttürkischen. Ein ger ist ein rundes Filzdeckenzelt. Seine Konstruktion ist so einfach wie genial. Als ich später beim Ab- und Aufbau helfe, begreife ich sein Geheimnis und verstehe, dass es keine vollkommenere Behausung für Menschen geben kann, die als Nomaden in einem Land mit extremen Klimaschwankungen leben. Das Filzzelt ist alles zugleich: wind- und regendicht, wärmend, Schatten spendend, transportabel und mit wenigen Handgriffen an wechselnde Temperaturen anzupassen. An heißen Sommertagen klappt man die Filzwände unten einen halben Meter hoch, so entsteht eine kühlende Zirkulation wie in einer Laube. An eisigen Tagen legt man mehrere Lagen Filz aufeinander.
Da sind zuerst die Scherengitter – Latten aus biegsamem Weidenholz, die beim Transport zu einem handlichen Bündel ineinandergeschoben und beim Aufbau wie eine Ziehharmonika mehrere Meter weit auseinandergezogen werden. Die einzelnen Latten werden nicht von Nägeln, sondern durch verknotete Lederstreifen gehalten. Diese können nicht rosten und sind so weich, dass das Holz nicht splittert oder ausbricht.
Fünf dieser Gitter werden zu einem Kreis gestellt. Dieser Gitterkreis bildet das Gerüst der Jurte. Es steht direkt auf dem Grasboden, der mit Holz oder mit einer Kunststofffolie abgedeckt wird, auf die man im hinteren Bereich Teppiche legt. In der Mitte des Kreises stehen zwei hohe Holzstelen, die den Dachkranz tragen. Der hat einen Durchmesser von etwa einem Meter und ähnelt einem Wagenrad. Zwischen seinen Speichen kann man den Himmel sehen und nachts die Sterne. Bei Regen oder zu großer Kälte zieht man ein Filzstück über die Öffnung.