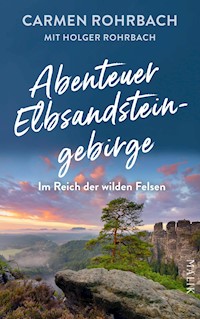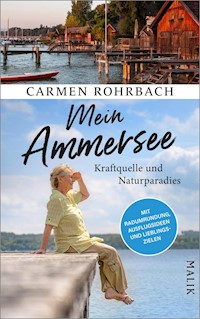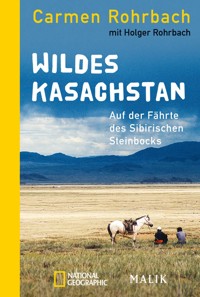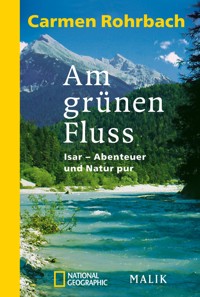12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Funkelnder Sternenhimmel und feurige Sonnenuntergänge, reiches Tierleben und karge Wüstenlandschaften, koloniales Trauma und nationales Selbstbewusstsein: Namibia ist rätselhaft und voll unterschiedlicher Facetten. Carmen Rohrbach hat dieses Land erkundet und wieder einen fesselnden Reisebericht verfasst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.malik.de
© Piper Verlag GmbH, München 2005Covergestaltung: Dorkenwald Grafik-Design, MünchenCoverfotos: Dave Hamman (vorne), Carmen Rohrbach (hinten)Bildteilfotos: Carmen RohrbachRedaktion: Susanne Härtel, MünchenKartografie: Eckehard Radehose, Schliersee
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Karte
Am Atlantischen Ozean
Ankunft
Aufbruch in eine neue Welt
Das Dampfross »Martin Luther«
Ombepera i koza – Kälte tötet
Bahnhof in Swakopmund
Die Walfischbucht
Große Stille – Namib
Wenn es Krieg gibt, gehen wir in die Wüste
Die Wüste lebt
Die weißen Siedler
Weiße Elefanten
Spitzkoppe
Bei den Himba
Die Weiße Dame vom Brandberg
Die Wunderblume
Bäume aus Stein
Der Aba Huab kommt ab
Rettet die Rhinos
Der rote Elefant
Etosha-Nationalpark
Der Gast aus dem All
Ein tragischer Unfall
Schwarz und Weiß am Waterberg
Raubkatzen
Heimkehr in ein fremdes Land
Wildes Namibia
Anhang
Geologie und Geschichte
Das Land
Bevölkerung
Klima und Reisezeit
Übernachtung
Gesundheit
Fahrtipps auf Schotterstraßen (Pads)
Wichtige Adressen
Namibia in Bildern
Literatur
Am Atlantischen Ozean
Durch dichten Nebel dringt das Tosen der Brandung. Es ist kalt. Fröstelnd ziehe ich die Schultern hoch und schlinge die Arme fest um meinen Körper. Das soll Afrika sein? Dabei ist doch jetzt im Februar Sommer auf der südlichen Halbkugel.
Wind kommt auf. Der Nebel beginnt zu treiben. Aus der stumpfgrauen Masse erhebt sich eine Riesenwelle und schlägt donnernd an den Strand. Nach einem Atemzug der Stille schwingt das Wasser zurück ins Meer, wo sich schon die nächsten Wellen sammeln.
Unvermittelt klart es auf. Die Luft ist rein wie Kristall. Weit dehnt sich der Atlantische Ozean unter kobaltblauem Himmel. Möwen segeln im Wind, ihre Rufe klingen nach Freiheit und Ferne.
Bei diesen Eindrücken fällt es mir schwer, Namibia als Teil des afrikanischen Kontinents zu begreifen. Zu sehr geistern auch in meinem Kopf klischeehafte Bilder von Afrika, die meine Vorstellungen und Erwartungen geprägt haben. Aber Namibia ist anders, das ist mir nach wenigen Tagen schon bewusst. Gleichzeitig vertraut und doch fremd erscheint es mir, sehr nah und dann wieder fern. Dieser Widerspruch erweckt meine Neugier, und es reizt mich herauszufinden, was die Faszination dieses Landes ausmacht. Ich werde fragen und zuhören, und mir von Menschen ihre Geschichte erzählen lassen. Mit dem Blick der Biologin will ich die atemberaubende Tier- und Pflanzenwelt erkunden und die Wildnis hautnah spüren. Vielleicht gelingt es mir sogar, einige Geheimnisse dieses Landes zu lüften, das mit seiner weitgehend unberührten Natur wie eine Arche Noah zwischen Atlantik und Kalahari ruht.
Ankunft
Die Nachtmaschine aus Deutschland landet pünktlich am frühen Morgen auf dem Airport von Windhoek – 40 Kilometer außerhalb der Stadt. Von der Gangway aus sehe ich handtellergroße Schmetterlinge, die zu hunderten den Landeplatz bedecken. Sie haben fein schattierte Flügel, dicke Köpfe und pelzige Leiber. Es sind Schwärmer, die nur nachts fliegen. Vom gleißenden Licht der Scheinwerfer angelockt, haben sie sich zu Tode geflattert, sind von landenden Flugzeugen und Gepäckwagen zerquetscht und von eilenden Passagieren zertreten worden. Ich beuge mich nieder, betrachte bedauernd die prachtvollen Geschöpfe und mag mir nicht vorstellen, wie viele Falter Nacht für Nacht als Gefangene des Lichts sinnlos ihr Leben verlieren. Nur eine Schar Spatzen ist begeistert und vertilgt laut tschilpend die fette Beute.
Dieses Mal werde ich auf andere Weise unterwegs sein, als bei meinen früheren Reisen, wo jede Ankunft ein Fall ins Ungewisse war und ich als Erstes möglichst schnell vom Flugplatz zum Ausgangspunkt meiner Expedition gelangen musste. Erst dann begann die eigentliche Reise, die ich meist zu Fuß unternahm. In Namibia aber ist das Land aufgeteilt in Farmen und Nationalparks, die von hohen, auch für Wildtiere unüberwindbaren Drahtzäunen umgeben sind. Öffentliche Verkehrsmittel sind rar. Das Eisenbahnnetz ist schlecht ausgebaut und dient vor allem dem Warentransport. Busse fahren nur auf wenigen Strecken, und wer auf die Idee käme, in Namibia zu trampen, hätte schlechte Karten – die Entfernungen sind einfach zu groß und das Verkehrsaufkommen ist zu gering. Deshalb kam für meine Namibia-Reise nur ein Leihwagen als Fortbewegungsmittel infrage – möglichst ein geländegängiger. Außerdem musste ich vorab meine Unterkünfte organisieren. Ich durfte nicht davon ausgehen, dass ich überall dort, wo ich es wollte, einfach mein Zelt aufstellen könnte. In den Nationalparks gibt es nur wenige Stellen, die als Zeltplätze ausgewiesen sind, und die begrenzte Kapazität macht eine Vorbuchung notwendig, wobei man angeben muss, wann, wo und wie lange man gedenkt, einen Platz zu belegen.
Zum Glück gibt es heute viele Farmer, die Gäste bei sich aufnehmen. Meist handelt es sich dabei um luxuriöse Unterkünfte, oft mit Familienanschluss. Bei meinen Vorbereitungen habe ich mich auf Farmen konzentriert, wo ich zelten und ohne Begleiter das Land durchstreifen durfte. So konnte ich sicher sein, unverfälschte Wildnis zu erleben. Denn die Farmen in Namibia bestehen nicht aus Ackerland und Viehweiden, sondern vor allem aus unberührter Dornbusch-Savanne, nur die unmittelbare Umgebung der Farmhäuser ist kultiviert und bewirtschaftet. Um ihren Besuchern ein authentisches Afrika-Feeling bieten zu können, haben viele Farmer begonnen, wieder vermehrt Wildtiere auf ihren Gebieten anzusiedeln, deshalb sind dort Begegnungen mit Antilopen, Giraffen, Zebras und bei einigem Glück sogar mit Nashörnern und Raubkatzen gar nicht so selten.
Bevor ich nach Abenteuern in der Natur suche, will ich nach Swakopmund an die Atlantikküste. Für diese Fahrt kann ich mir einen Mietwagen noch sparen, denn von Windhoek nach Swakopmund gibt es eine der wenigen Eisenbahnverbindungen. Aber der »Desert Express Luxury Train«, ein prunkvoller Hotelzug, ist ausschließlich Touristen vorbehalten und braucht für die 380 Kilometer lange Strecke einen Tag und eine Nacht. Das dauert deshalb so lang, weil die Reise mehrfach unterbrochen wird, um den Fahrgästen Sehenswürdigkeiten zu zeigen. Da ich an derart organisiertem »Luxus« wenig interessiert bin, entscheide ich mich für den billigen Bus, der mich zudem noch schneller als der Zug nach Swakopmund bringt. Wir fahren der Sonne entgegen, die auf der südlichen Halbkugel mittags im Norden steht. Über eine sehr gut ausgebaute Straße geht es fast schnurgerade zu der Stadt am Meer. Die Landschaft wirkt auf mich überraschend ursprünglich, die Weite beglückt mich, und die allgegenwärtigen Zäune sind optisch nicht so störend, wie ich befürchtet hatte. Zu beiden Seiten der Straße ziehen sich breite Grünstreifen dahin, die früher einmal dem Viehtrieb dienten. Erst dann begrenzt dicht geflochtener Maschendraht die Farmen mit ihrem wilden Buschland. Während der Fahrt sehe ich Springböcke, Paviane und Warzenschweine, sogar Giraffen und Vögel mit bunt schillerndem Gefieder. Die Tiere signalisieren mir, dass ich tatsächlich in Afrika bin – nur die Mitreisenden irritieren mich, die zwar wie Einheimische aussehen, sich aber deutsch unterhalten. Doch wer die Geschichte Namibias kennt, wird sich weniger wundern. Vieles erinnert noch immer an die Zeit, als das Land »Deutsch-Südwestafrika« hieß und die Fahnen Kaiser Wilhelms den Besitzstand für ewig festlegen wollten.
Zunächst hatte sich keine der europäischen Kolonialmächte für das knochentrockene Land interessiert, auch von Bodenschätzen und Diamanten hatte niemand eine Ahnung. Die sonst so landhungrigen Engländer hatten nur ein kleines Gebiet an der Küste wegen eines Hafens annektiert. Die Bucht diente ursprünglich Walfischern aus Nordamerika als Stützpunkt und heißt noch heute Walvis Bay, eben Walfisch-Bucht. Als die Engländer 1878 dort ihre Taue festmachten, hätte auch das aufstrebende deutsche Kaiserreich gerne noch etwas vom kolonialen Kuchen abbekommen. Aber man hielt sich zurück. Besonders Bismarck versuchte, jeden Konflikt mit den konkurrierenden Großmächten Europas zu vermeiden. Deshalb war man in Berlin froh, als private Investoren begannen, sich für das Land zu interessieren. Allen voran der Bremer Kaufmann Adolf Lüderitz, der im Jahre 1882 dem Nama-Häuptling Joseph Fredrichs ein riesiges Stück Land abhandelte – für gerade mal 500 Goldpfund und einige Gewehre.
Während der Berliner Konferenz 1884 erklärte sich das Kaiserreich zur Kolonialmacht in Südwestafrika. Zunächst waren es nur drei Beamte, die deutsche Interessen vor Ort zu vertreten hatten, aber Stück für Stück »fraßen« sich die Kolonisatoren in das Land hinein und besetzten ein Territorium von der doppelten Größe Deutschlands.
Als heute früh um 7 Uhr unser Bus Windhoek verließ, hatte mir der Fahrer versichert, mich fahrplanmäßig um 12 Uhr mittags in Swakopmund abzusetzen. Welch ein Unterschied zu früheren Zeiten, als es drei bis vier Wochen dauerte, um mit dem Ochsenwagen von der Küste ins Landesinnere nach Windhoek zu gelangen. Ich jedoch mache es mir im gepolsterten Sessel bequem und genieße den freien Blick auf die vorbeiziehende Landschaft. Aus dem flachen Buschland ragen imposante Bergformationen heraus, zuerst die Ausläufer des Khomas-Hochlands, dann die grünlich schimmernden Otjihavera-Berge. Später, als wir schon nach Westen abgebogen sind, bewundere ich die rostroten Erongo-Berge mit ihren rund geschliffenen Formen, als hätte ein Künstler moderne Skulpturen geschaffen. Und dann thront die Spitzkoppe, das afrikanische Matterhorn, wie ein Monolith über dem hügeligen Gelände.
Entlang der 400 Kilometer langen Strecke zähle ich nur drei oder vier Ortschaften. Sie tragen fremd klingende Namen: Okahandja, Karibib, Usakos. Es waren Siedlungen der Eingeborenen, deren Ortsnamen bis heute erhalten geblieben sind. Okahandja zum Beispiel bedeutet in der Sprache der Herero »große sandige Ebene«.
Dann senkt sich die Straße hinab zur Namib-Wüste. Selbst im Bus wird es jetzt kälter. Ursache ist der Benguela-Strom, eine eisige Meeresströmung aus der Antarktis. Die Küstenwüste, die auf beiden Seiten der Straße unsere Fahrt begleitet, ist an Trostlosigkeit nicht zu überbieten. Aber ich bin mir sicher, ihre Schönheit wird sich mir später erschließen, wenn ich zu Fuß unterwegs bin.
Aufbruch in eine neue Welt
Swakopmund, die zweitgrößte Stadt Namibias, hat nur 20 000 Einwohner. Klein und überschaubar lässt sie sich gut zu Fuß erkunden. Die Straßen laufen schachbrettartig von Ost nach West Richtung Meer und von Süd nach Nord an der Küste entlang. Der vom Wind herbeigewehte Wüstensand liegt auf Gehwegen und Straßen, manchmal knöcheltief. Hin und wieder erinnern mich Palmen daran, dass ich in Afrika bin. Weniger gelingt mir das mit den Menschen, da mir vor allem deutschstämmige Namibier begegnen. Auch die Bedienung im Café Anton fragt mich ganz selbstverständlich auf Deutsch: »Was hätten Sie denn gern?« Im Restaurant »Europa Hof« stellt mir der Kellner ein Bier auf den Tisch und wünscht lächelnd:
»Wohl bekomm’s!« Es ist kurios, dass 8000 Kilometer von Deutschland entfernt Namibier diese vertrauten Redewendungen verwenden. Swakopmund ist noch immer die am stärksten deutsch geprägte Stadt in Namibia. Deshalb war ich voreingenommen, erwartete spießiges Deutschtum, das die wilhelminische Ära konserviert. Aber Swakopmund wirkt keineswegs unangenehm auf mich. Gewiss, etwas befremdlich ist es schon, wenn man in Afrika Straßennamen zu Ehren deutscher Politiker und Staatenlenker aus den vorigen Jahrhunderten liest: Moltke, Bismarck und sogar Kaiser Wilhelm. Die »Kaiserstraße« zumindest ist inzwischen umbenannt in »Independence Avenue«, doch niemand hat die alten Straßenschilder entfernt. Und wie ist es zu verstehen, dass die jetzige afrikanische Regierung nicht daran denkt, das protzig-kitschige Denkmal zu Ehren der deutschen Schutztruppen zu beseitigen? Ist
es großzügige Toleranz oder einfach nur Gleichgültigkeit?
Zu den Straßennamen passt die Architektur: Fachwerk, Jugendstil, Gründerzeit. Dennoch, Swakopmund ist keine Museumsstadt, keine Vorzeige-Idylle deutscher Sauberkeit und Ordnung, sondern das lebendige Abbild seiner wechselvollen Geschichte.
Ungewöhnlich breit sind die Straßen, die von ein- und zweistöckigen Häusern aus Holz oder Stein gesäumt sind. Die Überbreite wird erst verständlich, wenn man weiß, dass die Ochsenwagengespanne mit bis zu 18 Zugtieren so viel Platz zum Wenden brauchten. Nur Ochsen konnten die schwer beladenen Holzkarren durch das wegelose Land ziehen. Sie allein besorgten den Warentransport in der deutschen Kolonie, bevor die Eisenbahn gebaut wurde. Im Jahr 1896 waren es bereits 880 Ochsenwagenfuhren, lese ich in alten Papieren in der Sam-Cohen-Bibliothek.
Dort entdecke ich auch das Buch von Margarethe von Eckenbrecher »Was Afrika mir gab und nahm«. Es wurde für mich zur Inspiration und Anregung bei meiner Reise durch Namibia, ein Land, das zu Margarethes Zeit im Mittelpunkt deutscher Kolonialbegeisterung stand. Margarethe war eine gute Beobachterin und verstand es meisterhaft, ihre Gefühle, Gedanken und Erlebnisse in eine bildhafte Sprache zu übertragen. Schon der Beginn ihrer Reise lässt mich frösteln, als sie im nasskalten Winter 1902 an Bord der
»Eduard« geht, um ihre alte Heimat mit ungewisser Zukunft für immer zu verlassen:
»Dichter, feuchter Nebel lag über der alten Hansestadt Hamburg ausgebreitet. Ein feiner Sprühregen rieselte unaufhörlich vom grauen Himmel. Über der Elbe braute der Nebel. Wenige Menschen hatten sich eingefunden, um den Scheidenden Lebewohl zu sagen. Die Hoffnung auf Zukunft schien die Gesichter zu verschönen und den bitteren Abschiedsschmerz zurückzudrängen. Ein letzter Händedruck, ein Kuss und viele Tränen. Weiße Tücher flatterten, eisiger Wind, Regen, Nebel lagerte sich zwischen die Zurückbleibenden und die Scheidenden.«
Hätte ich damals gelebt, wäre ich vielleicht auch eine der Pionierfrauen gewesen, die dem Aufruf folgten, mit ihren Männern in Afrika eine Farm aufzubauen und zu bewirtschaften. Soweit ich mich zurückerinnere, war es diese unwiderstehliche Neugier auf das Unbekannte, die mich bis heute immer wieder in die Ferne treibt.
Aber wäre ich wirklich eine von ihnen gewesen? Hätte ich tatsächlich ein solches Leben mit all seinen Widersprüchen führen können? Diese Frage beschäftigt mich. Neben den faszinierenden Erlebnissen in der Natur wird sie meine Reiseroute durch Namibia bestimmen und mich in engen Kontakt mit Menschen schwarzer und weißer Hautfarbe bringen. Hinhören. Nachspüren. Eintauchen. Gespannt werde ich den Geschichten der Farmerfrauen lauschen, werde mich in die Tagebücher und Aufzeichnungen ihrer Groß- und Urgroßmütter vertiefen, werde versuchen, mir vorzustellen, wie sie lebten, was sie dachten und fühlten.
Aber ich weiß, ich bin anders als diese Einwanderer, geformt von Erfahrungen, Denkmustern, Moralvorstellungen, die es so vor 100 Jahren nicht gab. Viele dieser Siedler hatten keine Skrupel, sich Land anzueignen, das ihnen gar nicht gehörte. Dieses Unrecht, basierend auf Rassismus und elitärem Gehabe, ist wie ein schwarzer Schatten, der mir eine Annäherung erschwert. Trotzdem beeindruckt mich der Mut, mit dem sich die Einwanderer in einer fremden Umwelt behaupteten. Tatkräftig leisteten sie Pionierarbeit, gruben Brunnen und machten das dornige Ödland fruchtbar.
Wer sich die Situation Deutschlands um die Wende vom 19. zum
20. Jahrhundert vor Augen führt, wird bald verstehen, warum damals viele bereit waren, ihre alte Heimat aufzugeben. In der Überlieferung wird diese Zeit gern als »Goldene Zeit« bezeichnet, in Wirklichkeit aber lebten die meisten Menschen in ärmlichen Verhältnissen oder als Tagelöhner von der Hand in den Mund. Die Zukunft erschien ihnen grau, ohne Chance, ihrem Leben einen Sinn, ein Ziel zu geben. Da versprach die Idee, auszuwandern, einen verheißungsvollen Neubeginn. Sie konnten ihr Schicksal endlich in die eigenen Hände nehmen und alles gewinnen. Dass sie auch alles verlieren konnten, erhöhte den Reiz, zumal jeder darauf vertraute, er werde zu denjenigen gehören, die es gewiss schafften. Auch Abenteuerlust, die Sehnsucht nach Freiheit, Wildnis und Exotik spielten bei vielen Auswanderern eine große Rolle, denn seit Urzeiten ist uns Menschen der Trieb angeboren, vertrautes Territorium zu verlassen, um neue Gebiete zu erforschen und zu erobern. So haben wir die Erde in allen Himmelsrichtungen besiedelt und kaum einen Flecken verschont, nicht einmal die eisigen Polarregionen.
Besonders als Biologin kann ich diese Entwicklung gut nachvollziehen und muss sie als naturgegeben akzeptieren. Und trotzdem fühle ich ein Unbehagen, mich unvoreingenommen mit einer Zeit auseinander zu setzen, in der man glaubte, das Recht zu haben, über andere Menschen und Länder nach Gutdünken zu verfügen. Durfte eine Regierung ihre Bürger ermutigen und auffordern, fremdes Land einfach zu besetzen? Aus Sicht der Einwanderer war Südwestafrika ein riesiges unbesiedeltes Land, das niemandem gehörte. Wirklich nicht? Es lebten doch Menschen dort. Aber keine Regierung vertrat deren Rechte, und keine Armee verteidigte sie gegen die Eindringlinge. Die Bevölkerungsgruppen und ihre Oberhäupter wurden von den Weißen nicht als ebenbürtig angesehen. Mit List und Betrug, mit Alkohol und Geschenken wurde ihnen das Land
»abgekauft«. Sie begriffen zunächst gar nicht, auf was sie sich eingelassen hatten. Ihnen fehlte vor allem die Vorstellung, dass man Land überhaupt besitzen oder sogar verkaufen konnte.
Für die deutschen Einwanderer war es abgemachte Sache, und kein Zweifel focht sie an, dass Südwestafrika zum Deutschen Reich gehörten sollte. Geprägt von dieser Vorstellung schildert Margarethe von Eckenbrecher ihre Ankunft in Afrika voller Verzückung. Noch auf dem Schiff mit Blick auf die Küste schrieb sie:
»Swakopmund im Sonnenschein sah freundlich und verheißungsvoll aus. Zur Bewillkommnung unseres Dampfers wehten Flaggen auf vielen Häusern. Hell hoben sie sich von den dunklen Dünen ab. Freudigen Herzens warteten wir darauf, an Land zu kommen. Wir standen an der Reling und sahen hinüber nach unserem Land der Verheißung, und heiß wallte es in uns auf: Dort drüben winkt dir die neue Heimat. Wirst du glücklich sein? Was steht dir bevor?«
Margarethe war bei ihrer Ankunft 27 Jahre alt. Mit ihrem Mann wollte sie in der deutschen Kolonie »Südwest« eine Farm aufbauen, obwohl beide vom Farmerleben wenig Ahnung hatten. Ihr Mann Themis fühlte sich zum Maler berufen. Sie selbst war Lehrerin, eine sehr beliebte sogar, wie zahlreiche ihrer Schüler bezeugten.
Vor mir liegt ein Foto, das sie als über 70-Jährige zeigt, mit weißem Haar und wachem Blick. Auf einem Sessel sitzend, beugt sie sich vor, um dem Gegenüber direkt in die Augen zu sehen, abwartend und voller Neugier. Sie wirkt warmherzig und zierlich, doch lässt das Foto ahnen: Diese Frau wusste, was sie wollte, und verstand dies auch durchzusetzen.
Schaudernd stehe ich am Strand von Swakopmund. Wellen donnern in gewaltiger Brandung gegen die Küste. Kaum vorstellbar, dass Boote hier anlanden konnten. Drastisch beschreibt Margarethe von Eckenbrecher ihre Ankunft:
»Weit draußen ankerte unser Dampfer. Mit Booten sollen Passagiere und Ladung an Land gebracht werden … Um von Bord in das Kanu zu gelangen, müssen die Passagiere einer nach dem anderen in einen Korb aus Weidengeflecht steigen. Ich muss gestehen, ich habe schon angenehmere Augenblicke in meinem Dasein erlebt als den, in diesem knackenden Korb zwischen Himmel und Wasser zu schweben und schließlich mit einem Ruck in dem auf und nieder gehenden Boote aufzuschlagen und von einem der Kruboys herausgerissen zu werden … Nach längerer Fahrt auf mäßig bewegtem Wasser kamen wir den gewaltigen Brechern näher und näher. Ich bewunderte die Geschicklichkeit der Kru, die mit größter Sicherheit und Kaltblütigkeit ihre Ruder in die Wellen tauchten und schnell vorwärts kamen. Als ich aber die kolossalen Brecher aus allernächster Nähe sah, die sich entweder haushoch auftürmten oder einen tiefen Abgrund schufen, konnte ich mich einer Gänsehaut nicht erwehren. Pfeilschnell schossen wir mit den Brechern dahin, und mit gewaltigem Ruck fuhr das Vorderteil des Bootes auf den Sand, während es sich hinten in die Höhe hob.«
Als würde ich es im Augenblick selbst erleben, bildet sich jetzt eine Gänsehaut auf meinen Armen, aber vielleicht liegt es auch nur an den kalten Spritzern der Brandung.
Mit der Anlage eines Hafens hatten es sich die Deutschen nicht leicht gemacht. Sie suchten die ganze Küste ab nach einer geeigneten Bucht – ohne Erfolg. Auf den einzig brauchbaren Naturhafen, Walvis Bay, konnten die Deutschen nicht zurückgreifen – er war längst im Besitz der Engländer. Die waren nicht amused, das kaiserliche Deutschland bei seinen späten Kolonialbestrebungen zu unterstützen. Schließlich entschieden sich die Deutschen für eine Stelle an der Mündung des Swakopflusses. Eine Bucht war zwar nicht vorhanden, immerhin verhinderte jedoch der Fluss, dass die Wanderdünen den Ort unter Sand begruben. Als Hafen aber war Swakopmund eine Katastrophe. Versuche, ein Hafenbecken auszubaggern, scheiterten kläglich, denn durch die starke Meeresströmung war das Becken in wenigen Tagen wieder voller Sand. Und so mussten die Schiffe notgedrungen wie zuvor weit draußen im Meer vor Anker gehen.
Wie aber sollte man schwere Waren an Land bringen? Viele Einwanderer hatten ihre eigenen Möbel dabei, und als die Eisenbahnlinie gebaut wurde, benötigte man Schienen, Lokomotiven und Waggons, außerdem Maschinen für die Bergwerksgruben. 1903, ein Jahr nach Margarethes Ankunft, versuchte man es mit dem Bau einer Mole, die jedoch in Rekordzeit versandete. 2,5 Millionen Mark waren buchstäblich in den Sand gesetzt. Der Mole folgte eine 275 Meter lange Holzbrücke, die schon nach zwei Jahren von Bohrmuscheln zersiebt war. Jetzt musste Stahl her. Berliner Kolonialbeamte planten eine 640 Meter lange Konstruktion mitten ins Meer hinaus. Als 262 Meter fertig gestellt waren, kam das Aus. Deutschland hatte den Ersten Weltkrieg verloren und musste seine Kolonien an die Siegermächte abtreten. Schließlich beauftragte der Völkerbund in Genf die Südafrikanische Union, das Mandat über Südwestafrika zu übernehmen. Die Brücke jedoch blieb auch unter den neuen Herren unvollendet, denn die Engländer wollten für ihren Hafen Walvis Bay keine Konkurrenz. Bis zum heutigen Tag trotzt die halb fertige Brücke mit ihren rostigen Pfeilern und zerborstenen Planken der Sandflut und dem Wellenschlag. Massig und dunkel liegt sie im Meer wie ein vergessenes Reptil aus der Urzeit. Aber ihre Jahre sind gezählt; dann wird auch dieses Symbol kolonialer Großmachtträume vom Meer endgültig verschlungen sein.
Das Dampfross »Martin Luther«
Mein Quartier habe ich in der »Prinzessin Rupprecht-Residenz« bezogen. Von 1901 bis 1914 diente das Gebäude als Lazarett. Heute ist es Altersheim und Gästeherberge zugleich. Ein Garten mit Blumen, blühenden Sträuchern und Palmen lädt zum Verweilen und Träumen ein. Mein Zimmer im Kolonialstil ist hell und hoch, die Umgebung regt meine Fantasie an und erleichtert meine Spurensuche in die Vergangenheit. Für Margarethe und ihren Mann gab es 1902 noch keine so komfortable Unterkunft:
»Nach mühseligem Durchwaten von tiefem Dünensand gelangten wir zu einer schwärzlichen Holzbaracke – es war das Hotel »Fürst Bismarck«, glich aber keineswegs dem späteren Prachtbau. Über den Hof, wo verschiedene nützliche Haustiere quiekend und grunzend umherliefen, wand man sich an einer Mistgrube vorbei, kroch unter Leinen voll triefender Wäsche hindurch und kam zu den Fremdenzimmern, winzigen Käfterchen, wenig schön, aber zweckentsprechend: Zwei Feldbettstellen, eine umgedrehte Kiste mit einer abgestoßenen Emailleschüssel oben drauf, sie diente als Waschbecken. Der Fußboden war reiner unverfälschter Dünensand, grundlos; Bettdecke, Kiste, Schüssel, alles bedeckt mit einer Schicht Sand. Kostenpunkt für die Nacht – zwanzig Mark.
Das Donnern und Toben der Brandung schlug an mein Ohr. Durch die Fugen des dünnen Holzwerks drang die Kälte. Ruhelos wälzte ich mich auf dem feuchten Kissen. Und dann wurden sie wach, die sechsbeinigen Peiniger. Blutgierig stürzten sie sich auf mich. Als ich mich am nächsten Morgen beim flackernden Kerzenlicht anzog, sah ich aus, als hätte ich über Nacht die Masern bekommen. Ohne Frühstück, mit steifen Gliedern und vor Kälte klappernden Zähnen stapften wir um halb sechs quersandein zum Bahnhof.«
Margarethe und Themis hatten es eilig, von Swakopmund fortzukommen. Voller Ungeduld wollten sie ihr neues Leben so bald wie möglich beginnen. Mich drängt die Zeit nicht, so lasse ich den Ort in Ruhe auf mich wirken.
Eine Woche bleibe ich in Swakopmund. Die meiste Zeit davon verbringe ich im Museum und in der Sam-Cohen-Bibliothek, wo ich mich in die alten Ausgaben der »Allgemeinen Zeitung« hineinlese, bis die Stimmen aus der Vergangenheit für mich hörbar werden. Ich stöbere in Chroniken, Berichten, Tagebüchern, beschäftige mich mit Anzeigen, Nachrufen, Leserzuschriften. So wird eine längst vergangene Epoche für mich lebendig und greifbar.
Amüsiert lese ich die Geschichte vom Dampflokomobil, einer Art Dampfkraftwagen. Ich hatte es an der Straße nach Swakopmund in natura besichtigt, doch da wusste ich noch nicht, wie und warum es dort hinkam. Außer mir bestaunte eine afrikanische Familie das altertümliche Gefährt. Die Eltern und zwei reizende Töchter, geschmückt mit vielen Zöpfen, in die bunte Schleifchen gebunden waren, stellten sich vor dem urigen Vehikel in Positur. Der Vater reichte mir seinen Fotoapparat und bat mich, ein Erinnerungsfoto zu knipsen. Ich tat ihm gern den Gefallen.
Im Jahr 1896 war das Lokomobil im Hafen von Walvis Bay entladen worden, denn es sollte den Güterverkehr in der Kolonie Südwest revolutionieren. Die Idee hatte Edmund Troost gehabt, Oberstleutnant der kaiserlichen Schutztruppe. Auf eigene Kosten hatte er das 280 Zentner schwere Dampfmobil in Halberstadt bauen und nach Namibia verschiffen lassen. Aber schon der erste Versuch endete in einem Fiasko. Das Monstrum soff Unmengen Wasser, unpraktisch in einem wüstentrockenen Land, und brauchte so viel Feuerholz, dass neben dem Brennstoff kaum noch Platz für Ladung blieb. Schlimmer noch, es versank mit seinen schweren Stahlrädern alle paar Meter im Sand. Unter glühender Sonne mussten es der Lokführer und seine Helfer immer wieder freischaufeln. Was mögen die Männer geflucht haben! Für den Weg vom englischen Hafen Walvis Bay ins 35 Kilometer entfernte Swakopmund brauchte das Ungetüm sage und schreibe drei Monate!
Endlich angekommen, war es nur für kurze Strecken einsetzbar. Für eine einzige Fahrt mussten tagelang Holz und Wasser herbeigeschafft werden. Ein Jahr nach seiner Ankunft war das Dampfmonster schrottreif. Zwei Kilometer außerhalb Swakopmunds versank es ein letztes Mal im Sand und bewegte sich nicht mehr von der Stelle. Dort steht es noch immer und heißt im Volksmund
»Martin Luther«. Der Name bezieht sich auf den angeblichen Ausspruch des Reformators vor dem Reichstag in Worms: »Hier stehe ich und kann nicht anders!«. Aber diese tapferen Worte formulierten seine Anhänger erst nach Luthers Tod, wie man heute weiß. In Wahrheit hatte er, erschrocken über seine eigene Standhaftigkeit, geflüstert: »Gott helfe mir. Amen.«
Auf einen Sockel gesetzt, schwarz lackiert und blank geputzt, ist
»Martin Luther« das weltweit einzige Denkmal für im Sand stecken gebliebene Reformen.
Ombepera i koza – Kälte tötet
Für alles gibt es Denkmäler, nur nicht für die in den Lagern der Deutschen umgekommenen Herero und Nama. Von jenem Aufstand gegen die deutsche Kolonialmacht werde ich später berichten, aber hier in Swakopmund war einer der Orte, wo die Überlebenden in Lagern zusammengepfercht wurden.
Reichskanzler von Bülow benutzte den Begriff »Konzentrationslager« erstmals in einem Telegramm vom 11. September 1904 an Generalleutnant Lothar von Trotha, den Befehlshaber der deutschen Schutztruppen, mit der Aufforderung, die Gefangenen in Konzentrationslagern unterzubringen. Von Bülow wusste offenbar von den Concentration Camps der Briten, die nach dem Sieg über die Buren, ihre Gefangenen samt Frauen und Kindern hinter Stacheldraht sperrten und die Mehrzahl von ihnen dort verhungern ließen. Die Buren waren niederländische Bauern, die seit 1652 in Südafrika eingewandert waren und sich von 1899 bis 1902 vergeblich der britischen Okkupation widersetzt hatten.
Verbrechen können nicht entschuldigt und kleingeredet werden, indem man auf andere Völker verweist, und sie dürfen auch nicht verschwiegen werden. Nur wer seine eigene Vergangenheit kennt, kann die Zukunft besser gestalten. In Swakopmund aber erinnert rein gar nichts an diese dunkle Zeit. Und niemand kann oder will mir Auskunft geben. Auf meine Frage, wo sich das Konzentrationslager befand, antwortet man empört: »Nie und nimmer gab es bei uns ein Lager! Undenkbar, ganz und gar unmöglich! Was glauben Sie denn, wie unser kleiner Ort tausende Gefangene beherbergen und mit Wasser und Nahrung hätte versorgen können?«
Doch Tatsache ist, dass 20 000 Herero den Aufstand überlebten. Ihre Führer aber waren tot oder geflüchtet, ihr Volk hatte aufgehört zu existieren. Die siegreichen Deutschen wollten die entkräfteten und traumatisierten »Wilden« nicht sich selbst überlassen. Die Gefahr war zu groß, glaubte man, dass sie sich zu Banden zusammenschließen, die aus Hunger und Rache rauben und morden würden. Die Konzentrationslager – es gab sie entlang der Eisenbahnlinie und in der Nähe größerer Siedlungen – sollten zwar keine Vernichtungslager sein, aber trotzdem kosteten sie zahlreichen Gefangenen das Leben. Die Verantwortlichen waren überfordert und vielleicht auch nicht willens, aus dem Nichts für tausende Menschen Kleidung, Nahrung und sauberes Wasser zu beschaffen. Nur Arbeit gab es im Überfluss. Die Eisenbahngesellschaft erbat sich von der Lagerleitung immer wieder frische Arbeitskräfte. Nicht nur Männer, auch Frauen und Kinder mussten beim Entladen der Frachtschiffe, dem Bau der Mole, im Straßen-, Gleis- und Bergbau schuften. Am schlimmsten erging es denen, die in das feuchte und kalte Klima der Küstenregion bei Swakopmund und auf die Haifischinsel bei Lüderitz verfrachtet wurden.
Es waren Missionare der Rheinischen Missionsgesellschaft, die
das Leiden der Verzweifelten zu lindern versuchten. Ihre Berichte konnte ich in den Archiven der Evangelisch-Lutherischen Kirche nachlesen:
»Anfang 1905 kamen große Transporte, die Menschen wurden hinter doppeltem Stacheldraht in jämmerlichen Behausungen, nur aus Sackleinen und Latten, untergebracht, und zwar so, dass in einem Raum 30 bis 50 Personen ohne Unterschied des Alters und Geschlechts gezwungen waren zu bleiben. Von früh bis zum späten Abend, auch an Sonn- und Feiertagen mussten alle, auch die Kinder, unter den Knütteln roher Aufseher arbeiten, bis sie zusammenbrachen.«
»Ombepera i koza – Kälte tötet!«, riefen die Unglücklichen dem Missionar Heinrich Vedder zu, wenn er zum Gottesdienst ins Lager kam. Die kirchliche Anteilnahme war zu jener Zeit nichts Ungewöhnliches, denn die Herero und Nama waren schon seit Jahrzehnten vom christlichen Glauben überzeugt, und viele hatten bei den Missionaren sogar Lesen und Schreiben gelernt.
Die Menschen, die an die trockene Hitze im Landesinneren gewöhnt waren, litten schrecklich unter dem neblig-kalten Klima und den rauen Winden. Notdürftig schützten sie ihre nackten Körper mit aufgetrennten Säcken. Als Missionar Vedder auf seine Dringliche Anfrage nach ausreichender Bekleidung keine Antwort von der Kolonialverwaltung aus Windhoek erhielt, bat er die Missionsgemeinde im Deutschen Reich um Kleiderspenden. Dankbar vermerkt Vedder:
»Die Missionsfreunde in der Heimat kargten nicht. Sehr bald kamen Kisten über Kisten voller zum Teil noch sehr guter Kleider. Sie wurden verteilt. Die abgemagerten Gestalten hatten wenigstens wieder etwas Warmes anzuziehen.«
Bahnhof in Swakopmund
Zum Abschied gehe ich ein letztes Mal durch die breiten, sandbedeckten Straßen Swakopmunds, in denen erstaunlich wenige Autos fahren. Ich wandere am Bahnhof vorbei, der den unbändigen Pioniergeist der Einwanderer repräsentiert und noch immer ein beeindruckend dekorativer Bau ist. Heute dient er als Kasino und beherbergt zugleich das teuerste Hotel am Ort.
Schon 1902 ging die Eisenbahnlinie zwischen der Hauptstadt Windhoek und Swakopmund in Betrieb, aber nur einmal die Woche fuhr ein Personenzug. Wer nicht so lange warten wollte, musste den Güterzug benutzen. Das war nicht nur unbequemer, sondern auch noch wesentlich teurer, denn aus unerfindlichen Gründen waren die Fahrgäste gezwungen, eine Fahrkarte 1. Klasse zu lösen. Außerdem musste jeder Reisende unterschreiben, dass er die Eisenbahn von jeglicher Haftpflicht entbinde. Trotzdem gab es immer wieder Beschwerden, wie ein wütender Leserbrief in der »Allgemeinen Zeitung« beweist. Der Unglückliche empörte sich, weil er bei einem Achsenbruch übel zugerichtet wurde, teure Arztkosten begleichen musste und vergeblich auf Schmerzensgeld hoffte.
Ein anderer, mehr humorbegabter Fahrgast schilderte, dass der Zug plötzlich auf freier Strecke hielt, weil mitgeführte Hühner ihrem Käfig entkamen und durch die offenen Zugfenster das Weite suchten. Der Besitzer rannte fluchend seinem gackernden Federvieh hinterher, und bald beteiligten sich sämtliche Reisende lachend an der heißen Verfolgungsjagd.
Die Dampfmaschine der Lok wurde damals noch mit Holz geheizt. Ging der Brennstoff während der Fahrt zur Neige, mussten die Passagiere ihre Abteile verlassen und entlang des Bahndamms Holz schlagen. Die Arbeit machte hungrig, und einige nutzten den unfreiwilligen Halt, um sich im »Supermarkt« der Natur zu bedienen. Ihre Jagdbeute wurde an Ort und Stelle zerlegt, gegrillt und verzehrt. Sie konnten sich Zeit lassen, denn einen Gegenzug musste niemand fürchten – es gab ja nur den einen.
Auch in Margarethes Erinnerung hat sich die erste Eisenbahnfahrt tief eingeprägt:
»Das Abfahrtsignal ertönte und der Zug fuhr in den grauen Morgen hinein. Wir standen auf dem Vorderperron des Wagens. Allmählich lichtete sich der Nebel. Was man nun sah, war allerdings nicht viel. Sand und Dünen und Dünen und Sand. Hin und wieder vom Sand glatt geschliffener Felsen und vom Sand fast verwehte Büsche.