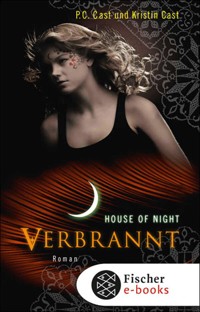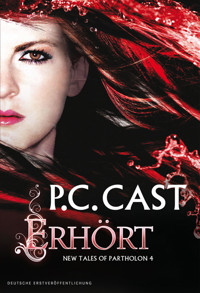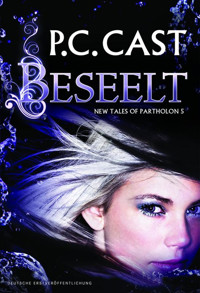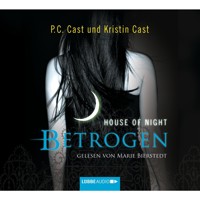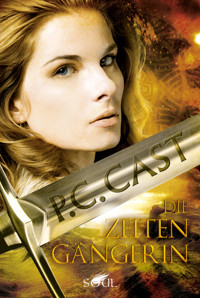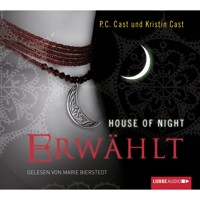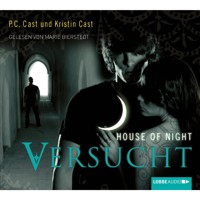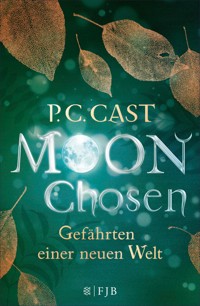
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Gefährten einer neuen Welt
- Sprache: Deutsch
Die Nr. 1- Bestseller-Autorin der »House of Night«-Serie P.C. Cast, hat mit »Moon Chosen« eine großartige Welt von archaischer Kraft geschaffen. Eine neue Welt, in der die Menschen, ihre tierischen Gefährten und die Erde selbst sich drastisch verändert haben – eine Welt voller Schönheit, Liebe, verbotener Geheimnisse und dunkler Mächte. Mari gehört zum Stamm der Erdwanderer und ist die Tochter der Mondfrau ihres Clans, Erbin der einzigartigen Heilkräfte ihrer Mutter. Es ihre Bestimmung, einmal ihren Platz einzunehmen und die Frauen und Männer des Weberclans regelmäßig vom Nachtfieber zu reinigen. Doch sie birgt ein Geheimnis in der im Wald versteckten Höhle, in der sie lebt. Und sie fühlt sich noch nicht bereit, ihrem Schicksal zu folgen. Doch als ein todbringender Angriff ihre Welt aus den Angeln reißt, enthüllt Mari die Stärke ihrer Fähigkeiten und entschließt sich, sich selbst und ihr Volk zu retten. Ihr läuft ein Hund zu, der ihr nicht mehr von der Seite weicht. Ihr neuer Begleiter wird allerdings schon gesucht – von ihren Feinden. Als Mari dem Sohn des Anführers, Nik, begegnet, verspürt sie ein zuvor nie gekanntes Gefühl. Sie bricht die Gesetze des Clans und verbündet sich mit ihm, um die Kräfte zu besiegen, die sie alle zu zerstören drohen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 837
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
P.C. Cast
Moon Chosen
Gefährten einer neuen Welt Roman
Über dieses Buch
Mari gehört zum Stamm der Erdwanderer und ist die Tochter der Mondfrau ihres Clans, Erbin der einzigartigen Heilkräfte ihrer Mutter. Es ihre Bestimmung, einmal ihren Platz einzunehmen und die Frauen und Männer des Stammes regelmäßig vom Nachtfieber zu reinigen. Doch sie birgt ein Geheimnis. Und sie fühlt sich noch nicht bereit, ihrem Schicksal zu folgen. Als ein todbringender Angriff ihre Welt aus den Angeln hebt, enthüllt Mari die Stärke ihrer Fähigkeiten und entschließt sich, sich selbst und ihr Volk zu retten. Ihr läuft ein Hund zu, der ihr nicht mehr von der Seite weicht. Ihr neuer Begleiter wird allerdings schon gesucht – von ihren Feinden. Als Mari dem Sohn des Anführers, Nik, begegnet, verspürt sie ein zuvor nie gekanntes Gefühl. Sie bricht die Gesetze des Clans und verbündet sich mit ihm, um die Kräfte zu besiegen, die sie alle zu zerstören drohen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
P.C. Cast ist die Autorin der zwölfbändigen House of Night-Serie. Sie wuchs in Illinois und Oklahoma auf und arbeitete viele Jahre als Lehrerin, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Ihre Bücher erreichten eine Gesamtauflage von über zwanzig Millionen Exemplaren und erschienen in mehr als vierzig Ländern.
Die Autorin lebt mit ihrer Familie und ihren geliebten Katzen, Hunden und Pferden in Oregon.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel ›Moon Chosen. Tales of a New World‹ bei St. Martin's Griffin, New York.
Copyright © 2016 by P.C. Cast
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Published by arrangement with St. Martin's Press, LLC. All rights reserved. Dieses Werk wurde im Auftrag von St. Martin's Press, LLC, durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen, vermittelt.
Covergestaltung und -abbildung: bürosüd, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490393-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
Epilog
Dank
Dieses Buch ist meiner Lektorin Monique Patterson gewidmet – für ihre Begeisterung für diese neue Welt, ihren Glauben an mich und ihr unglaubliches Brainstorming-Talent. Möge unsere Zusammenarbeit lange und erfolgreich gedeihen!
1
Ansteckendes Frauengelächter hallte durch den warmen, gemütlichen Bau. »O Mari! Das ist aber keine Illustration zu dem Mythos, den ich dir gerade erzählt habe!« In der einen Hand ein Blatt handgeschöpftes Papier, die andere vor den Mund gepresst, versuchte Maris Mutter vergeblich, den nächsten Lachanfall zurückzuhalten.
»Du erzählst die Geschichten, Mama. Ich zeichne sie. So geht das Spiel, das weißt du doch! Unser Lieblingsspiel.«
»Schon«, sagte Leda und versuchte, ein etwas ernsteres Gesicht zu machen. »Aber meistens läuft es darauf hinaus, dass ich die Geschichten erzähle und du zeichnest, was du gehört zu haben glaubst.«
»Ist das denn schlimm?« Mari stellte sich neben ihre Mutter und betrachtete ebenfalls die Zeichnung. »Genau das hier hab ich vor Augen gehabt, als du die Geschichte von Narziss und Echo erzählt hast.«
»Mari, so wie du die Verwandlung von Narziss in eine Blume gemalt hast, das ist – einfach urkomisch! Wie die eine Hand schon ein Blatt ist, die andere noch Hand, und genauso ist es mit«, Leda unterdrückte ein Kichern, »ein paar anderen Teilen. Und dieser Schnurrbart – und der Gesichtsausdruck! Man muss schon ein besonderes Talent haben, um eine Mischung aus jungem Mann und Blume derart komisch darzustellen! Und Echo«, Leda zeigte auf die geisterhafte Nymphe, die der Verwandlung zusah und der es Mari irgendwie gelungen war, eine restlos genervte Miene zu verpassen, »sieht aus, als …« Leda suchte nach Worten.
»Als hätte sie die Schnauze voll von Narziss und seinem Ego?«, schlug Mari vor.
Leda gab es auf, ermahnend klingen zu wollen, und lachte hemmungslos. »Ja, genau so sieht sie aus! Aber so habe ich die Geschichte nicht erzählt.«
Mari wackelte mit den Augenbrauen. »Tja, Leda, das hab ich zwar gehört, aber beim Zeichnen hab ich beschlossen, dass am Schluss definitiv etwas fehlte.«
»Am Schluss? Tatsächlich?« Leda gab ihrer Tochter einen Stoß mit der Schulter. »Und nenn mich gefälligst nicht Leda.«
»Aber du heißt doch Leda.«
»Für alle anderen. Für dich bin ich Mutter.«
»Mutter? Wirklich? Das ist doch –«
»Respektvoll und traditionsbewusst?«, bot Leda an.
»Altmodisch und fad.« Mit funkelnden Augen wartete Mari auf die vorhersehbare Antwort ihrer Mutter.
»Altmodisch und fad? Hast du mich gerade altmodisch und fad genannt?«
Kichernd hob Mari die Hände zur Kapitulation. »Ich? Dich? Niemals, Mama, nie im Leben!«
»Na gut. Und Mama ist in Ordnung. Besser als Leda.«
Mari grinste. »Mama, die Diskussion führen wir seit achtzehn Wintern.«
»Mari, mein süßes Mädchen, du hast zwar schon achtzehn Winter erlebt, aber diskutieren konntest du in den ersten davon zum Glück noch nicht! Ich bin ja froh, dass ich noch ein paar Jahre Ruhe hatte, bis du angefangen hast zu reden und damit nicht mehr aufgehört hast.«
»Mama, du hast mal erzählt, du hättest angefangen, mir das Reden beizubringen, als ich noch keine zwei Winter alt war!«, sagte Mari gespielt erstaunt, griff nach dem angespitzten Kohlestück, mit dem sie zeichnete, und nahm ihrer Mutter die Zeichnung aus der Hand.
»Ja, und ich habe auch schon zugegeben, dass ich nicht perfekt war. Ich war eine sehr junge Mutter, die versuchte, ihr Bestes zu tun«, schloss Leda theatralisch und überließ ihrer Tochter die Zeichnung.
»Extrem jung, oder?« Mari hielt die Zeichnung so, dass Leda sie nicht sehen konnte, und fügte etwas hinzu.
»Und wie.« Leda versuchte, über Maris Arm hinwegzuspähen. »Ich hatte sogar einen Winter weniger erlebt als du jetzt, als ich deinen wundervollen Vater traf, und …« Stirnrunzelnd brach Leda ab, weil Mari zu kichern begann.
»Schau mal, jetzt ist es besser!« Sie hielt ihrer Mutter die Zeichnung hin.
»Mari, er schielt«, sagte Leda.
»In der Geschichte kommt er nicht besonders schlau rüber, also finde ich, er sollte auch so aussehen.«
»Das ist dir definitiv gelungen.« Die Blicke von Mutter und Tochter trafen sich, und beide brachen wieder in Lachen aus.
Dann wischte sich Leda die Augen aus und umarmte ihre Tochter flüchtig. »Ich nehme alle Kritik an deiner Zeichnung zurück. Sie ist perfekt.«
»Danke, Mutter.« Maris Augen funkelten. Sie nahm ein neues Blatt Papier und zückte den Kohlestift. Seit sie denken konnte, liebte sie es, wenn ihre Mutter ihr die alten Geschichten erzählte, in denen sie Liebe und Tragik, Spannung und überraschende Einsichten kunstvoll zu einem Ganzen verwob – genau wie die übrigen Frauen des Weberclans jene Körbe, Kleider und Teppiche, die sie dem Fischerclan, Müllerclan und Holzschnitzerclan im Austausch gegen deren Waren verkauften. »Noch eine Geschichte! Nur eine, ja? Du erzählst soooo gut!«
»Mit Schmeicheleien bekommst du keine neue Geschichte. Höchstens ein Körbchen von den ersten Blaubeeren.«
»Blaubeeren? Oh, super! Die Tinte daraus hat eine so tolle Farbe. Ist eine schöne Abwechslung zu dem Schwarzbraun der Walnussschalen.«
Leda lächelte stolz. »Außer dir kenne ich niemanden, der sich mehr aufs Malen mit Blaubeeren freut als darauf, sie zu essen.«
»Ach was. Du freust dich doch auch darüber, dass man damit Stoffe färben kann.«
»In der Tat. Und ich habe vor, dir diesen Frühling einen neuen Mantel damit zu färben. Trotzdem gebe ich offen zu, dass ich Blaubeerkuchen lieber mag!«
»Blaubeerkuchen klingt toll! Aber noch eine Geschichte klingt auch toll – die von Leda. Mama, sag mal, warum heißt du überhaupt so? Ich meine, Leda. Deine Mutter kannte die Geschichte doch sicher. Aber sie hieß Kassandra, da frage ich mich manchmal, ob sie bei deiner Namenswahl nicht irgendwas verwechselt hat.«
»Du weißt doch, dass Mondfrauen ihren Töchtern immer den Namen geben, den die Erdmutter ihnen mit dem Wind zuflüstert. Meine Mutter Kassandra bekam ihren Namen von ihrer Mutter Penelope. Und deinen wunderschönen Namen habe ich in der Vollmondnacht, bevor du geboren wurdest, im Wind gehört.«
Mari seufzte. »Mein Name ist langweilig. Heißt das vielleicht, dass die Erdmutter mich langweilig findet?«
»Nein. Das heißt, dass die Erdmutter der Meinung ist, wir sollten uns selbst eine Geschichte um deinen Namen ausdenken – deine ganz eigene Geschichte.«
»Das sagst du, seit ich denken kann. Aber in all den Wintern hab ich keine Geschichte für mich gefunden.«
»Das wirst du noch, sobald die Zeit reif ist.« Sanft strich Leda ihrer Tochter über die Wange. Ihr Lächeln wurde traurig. »Mari, mein süßes Mädchen, so gern ich es täte, ich kann dir heute Nacht nicht noch eine Geschichte erzählen. Bald geht die Sonne unter, und es wird eine klare, strahlende Mondnacht werden. Der Clan wird dringend meine Hilfe brauchen.«
Mari öffnete den Mund, drauf und dran, Leda zu bitten, nur noch ein paar Augenblicke zu bleiben – Maris Bedürfnisse vor die des Clans zu stellen. Aber ehe sie ihren kleinen, selbstsüchtigen Wunsch äußern konnte, begann ihre Mutter zu zucken. Ihre Schultern bebten, ihr Kopf schlug unkontrolliert hin und her. Wie immer wandte Leda sich ab, um ihrer Tochter so gut wie möglich das zu ersparen, was die Nacht mit sich brachte. Doch Mari kannte es nur zu gut. Jegliche Albernheit fiel von ihr ab. Sie ließ Papier und Kohlestift fallen, trat zu Leda und nahm mit beiden Händen deren Hand. Diese fühlte sich ekelhaft kalt an, und ebenso ekelhaft war der bleiche silbergraue Schimmer, der sich über Ledas Haut legte. Wie wünschte sich Mari, die Qualen lindern zu können, von denen ihre Mutter an jedem Abend ihres Lebens mit dem Sonnenuntergang heimgesucht wurde.
»Tut mir leid, Mama. Ich hab nicht auf die Zeit geachtet. Ich wollte dich nicht aufhalten.« Bewusst schlug sie einen leichten Ton an, um ihrer Mutter in der gefahrvollen Nacht, in die diese sich gleich begeben musste, nicht noch mehr Sorgen aufzubürden. »Wir können uns meine Geschichte ein andermal ausdenken. Außerdem hab ich auch was zu tun, während du weg bist. Auf dem Bild, an dem ich gerade arbeite, ist die Perspektive noch nicht optimal.«
»Darf ich es schon sehen?«, fragte ihre Mutter.
»Es ist noch nicht fertig, und eigentlich zeige ich meine Bilder ja nicht gern, bevor sie fertig sind.« Ein Schauder ging über Ledas Haut. Automatisch verstärkte Mari ihren Griff um die Hand ihrer Mutter –, um ihr Kraft zu spenden, als Zeichen, dass sie sie verstand … und liebte. Sie zwang sich zu grinsen. »Aber heute Abend mache ich vielleicht eine Ausnahme. Schließlich bist du mein Lieblingsmodell. Und mein Lieblingsmodell muss ich bei Laune halten.«
»Ich bin mir zumindest relativ sicher, dass du mich lieber magst als Narziss«, witzelte Leda, während Mari zu dem schlichten Holztisch in der Ecke der Haupthöhle des kleinen Baus hinüberging, den sie und ihre Mutter sich teilten, seit sie denken konnte.
Der Tisch stand dort, wo an Wänden und Decke am meisten Leuchtmoos wuchs und das größte und hellste Nest Schimmerlinge herabhing wie ein lebender Kerzenleuchter. Auf dem Weg dorthin entspannte sich das verkrampfte Lächeln, das Mari ihrer Mutter zuliebe aufgesetzt hatte, und als sie sich mit einem großen Blatt sorgsam handgeschöpften Papiers aus Pflanzenfasern zu Leda umdrehte, lächelte sie aufrichtig. »Egal wie oft ich meinen Zeichentisch ansehe und daran denke, wie wir das Leuchtmoos und die Schimmerlinge dort gezüchtet haben, er erinnert mich jedes Mal an deine Märchen von den Erdgeisterchen.«
»Ach, die hast du auch immer geliebt. All diese unterhaltsamen oder lehrreichen Geschichten, die Mondfrauen ihren Töchtern erzählen. Und jede so märchenhaft und unwirklich wie die von Narziss und der unglücklichen Echo.«
Maris Lächeln wich nicht. »Wenn ich sie zeichne, werden sie für mich real.«
»Das sagst du immer, aber …« Leda brach ab, als ihr Blick auf die unvollendete Zeichnung fiel. Entzückt sog sie die Luft ein. »O Mari, das ist ja wunderschön!« Sie nahm ihrer Tochter das Blatt ab und betrachtete es genauer. »Das ist definitiv eine deiner besten.« Vorsichtig berührte sie mit der Fingerspitze ihr eigenes Porträt, wie sie an ihrem üblichen Platz am Herdfeuer saß, einen halbfertigen Korb auf dem Schoß. Doch nicht diesen sah die gezeichnete Leda an. Zärtlich lächelnd sah sie der Künstlerin in die Augen.
Mari nahm wieder die Hand ihrer Mutter und strich darüber. »Danke, dass du es magst, aber deine Hand ist viel feinknochiger, als ich sie gemalt habe.«
Leda schmiegte die Hand um die Wange ihrer Tochter. »Das wirst du schon noch verbessern. Wie immer. Und dann wird das Bild so erstklassig sein wie all deine anderen.« Sie küsste Mari sanft auf die Stirn. »Ich habe etwas für dich, mein süßes Mädchen.«
»Wie? Ein Geschenk?«
Leda lächelte. »Ganz genau. Warte hier und schließ die Augen.« Sie eilte in die hintere Höhle des Baus, die ihr als Schlafkammer wie auch als Trocken- und Vorratsraum für ihre duftenden Kräuter diente. Mit den Händen hinter dem Rücken kehrte sie zu ihrer Tochter zurück.
»Ah, es ist so klein, dass du es hinter dem Rücken verbergen kannst! Was ist es – ein neuer Federkiel?«
»Du schummelst, Mari! Augen zu!«
Mari kniff die Augen fest zu und grinste. »Ich schummle nicht. Ich bin nur schlau, genau wie meine Mama«, sagte sie glatt.
»Und wunderschön wie dein Vater.« Mit diesen Worten setzte Leda ihrer Tochter das Geschenk auf den Kopf.
»O Mama, du hast mir eine Jungfernmondkrone gemacht!« Mari hob das kunstvoll gewundene Diadem vom Kopf. Es war ein wunderbar gleichmäßiger Kranz aus Weiden- und Efeuranken, den Leda mit leuchtend gelben Blüten bestückt hatte. »Das also hattest du mit all dem Löwenzahn vor! Ich dachte, du wolltest Wein daraus machen.«
Leda lachte. »Wein habe ich auch gemacht. Aber außerdem diese Jungfernmondkrone.«
Maris Entzücken schwand. »Ich hatte ganz vergessen, dass heute Nacht der erste Frühlingsvollmond ist. Da kommt bestimmt richtig Stimmung auf.«
Matt schüttelte Leda den Kopf. »Das wäre schön, aber ich fürchte, dieses Mal wird die Stimmung auf dem Fest eher gedämpft sein, nachdem in letzter Zeit so viele Erdwanderer von den Gefährten verschleppt wurden. Mir scheint die Erdmutter ungewöhnlich unruhig, als kämen unangenehme Veränderungen auf uns zu. Der Trübsinn, der unsere Frauen überkommt, ist stärker als gewöhnlich, und unsere Männer – na, du kennst die Wut, die das Nachtfieber in unseren Männern entfacht.«
»Wut? Du meinst, sie sind noch gemeingefährlicher als sonst. Verdammte Dreckwühler!«
»Nenn dein eigenes Volk nicht so, Mari. Sie sind keine Tiere.«
»Sie sind nur mein halbes Volk, Mutter. Und nachts sind sie Tiere. Oder zumindest die Männer. Was wäre denn, wenn du sie nicht alle drei Tage vom Nachtfieber reinigen würdest? Oh, ich weiß es. Deshalb muss ja der Bau der Mondfrau geheim bleiben, selbst vor ihrem eigenen Clan.« Ihr Ton war hart vor Zorn und Angst. Doch als sie die traurige Miene ihrer Mutter sah, bereute sie den letzten Satz sofort.
»Mari, vergiss nicht, dass nachts selbst ich nahe daran bin, zum Tier zu werden.«
»Dich meine ich nicht! Du weißt, dass ich niemals dich meinen würde.«
»Nur dem Mond verdanke ich es, dass ich Erdwanderin bleibe, statt nachts zu dem zu konvertieren, was du Dreckwühler nennst. Leider besitzt in unserem Volk nun mal nicht jeder die Gabe, den Mond herabzurufen, also muss ich es mindestens alle drei Nächte für es tun. Heute ist sowohl der erste Frühlingsvollmond als auch eine Drittnacht. Das heißt, wenn der Clan sich versammelt, werde ich sie zunächst reinigen müssen, damit sie sich der Freude und der Liebe öffnen können, statt sich dem Trübsinn oder dem Zorn hinzugeben. Das weißt du sehr gut, Mari. Was bedrückt dich?«
Mari schüttelte den Kopf. Wie sollte sie ihrer Mutter – ihrer sanften, lustigen, klugen Mutter, der einzigen Person auf dieser schrecklichen Welt, die wusste, was Mari war, und sie dennoch liebte – beibringen, dass sie sich seit einiger Zeit nach mehr sehnte?
Nein. Das konnte sie ihr ebenso unmöglich gestehen, wie Leda jemals zulassen könnte, dass der Clan die Wahrheit über ihre Tochter erfuhr.
»Nichts. Liegt wahrscheinlich am Vollmond. Ich kann ihn spüren, selbst hier in der Höhle und obwohl er noch nicht mal aufgegangen ist.«
Leda strahlte vor Stolz. »Du hast meine Kräfte geerbt, und sie sind sogar noch stärker als meine. Setz die Krone auf, Mari, und komm mit zur Feier. Bei Vollmond ist es am leichtesten, die Kraft des Mondes herabzurufen, und so schön wie der Tag war, wird er heute klar und rein leuchten.«
»O Mama, bitte nicht heute. Ich hab keine Lust mehr zu versagen, erst recht nicht vor allen Leuten.«
Unbeirrt lächelte Leda weiter. »Vertrau deiner Mutter. Du hast stärkere Kräfte als ich. Und genau das macht deine Ausbildung so schwierig.«
»Schwierig?« Mari seufzte. »Du meinst hoffnungslos.«
»Sei nicht so melodramatisch! Mari, du lebst, du bist wohlauf und sogar geistig gesund. Tag oder Nacht, Regen oder klarer Himmel, Mond oder nicht, du zeigst keine Anzeichen von Wahnsinn oder Schmerz. Vertrau darauf, dass der Rest schon noch kommen wird. Übung macht den Meister. Hab Geduld!«
»Gibt es wirklich keinen leichteren Weg?«
»Leider nein. Du musst üben und nochmals üben, genau wie du geübt hast, einer einfachen Schwarzweißzeichnung Leben einzuhauchen.«
»Zeichnen ist so viel leichter!«
Ihre Mutter lachte leise. »Für dich.« Dann schwand ihr Lächeln. »Du weißt, dass ich bald einen Lehrling benennen muss. Ich kann die Frauen des Clans nicht mehr lange vertrösten.«
»Ich bin noch nicht gut genug, Mama.«
»Noch ein Grund, warum du heute Nacht mitkommen solltest. Präsentiere dich mit mir dem Clan. Übe dich darin, die Kraft des Mondes herabzurufen, und ich werde den Clansfrauen klarmachen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Weil ich dich zwar noch nicht offiziell zu meiner Nachfolgerin benannt, aber doch mit deiner Ausbildung begonnen habe.«
Mari verzog den Mund. »Begonnen? Leda, du versuchst, mich zu unterweisen, seit ich mich erinnern kann.«
»Du warst immer eine gute Schülerin. Und hör auf, mich Leda zu nennen.«
»Ich bin doch viel zu langsam, Mutter.«
»Du bist nicht langsam, Mari. Du bist kompliziert. Dein Verstand, deine Gaben, deine Macht – schon jedes für sich ist komplex. Eines Tages wirst du eine sehr gute Mondfrau sein.« Der Blick ihrer grauen Augen ruhte auf ihrer Tochter. »Außer du hast nicht den Wunsch, Mondfrau zu werden.«
»Ich will dich nicht enttäuschen, Mama.«
»Du würdest mich nie enttäuschen, egal was für einen Lebensweg du einschlagen willst.« Leda hielt inne, weil ein neuer Schmerzkrampf sie durchfuhr. Der silberne Schimmer, der ihren zarten Händen anhaftete, breitete sich über ihre Arme aus.
»Okay, Mama. Ich komme mit«, sagte Mari schnell.
Sie wurde mit dem strahlenden Lächeln ihrer Mutter belohnt. »O Mari, das freut mich!« Der Schmerz war vergessen. Leda eilte in ihr Zimmer, und Mari hörte, wie sie mit den Töpfen, Körben und kostbaren Glasgefäßen klapperte, die ihre riesige Sammlung an Kräutern, Tinkturen und Salben enthielten. »Hier!«, rief sie schließlich und kehrte mit einer vertrauten Holzschale zurück. »Heute müssen wir dir nur das Gesicht schminken. Deine Haare müssen auch bald wieder gefärbt werden, aber jetzt noch nicht.«
Mari unterdrückte einen Seufzer und hob den Kopf, damit ihre Mutter die schlammbraune Mixtur aufbringen konnte, die ihr Geheimnis verbarg.
Schweigend gab Leda der Stirn ihrer Tochter ein gewölbteres Aussehen, ließ deren hohe Wangenknochen flacher erscheinen und schmierte ihr dann die klebrige, schmutzig-lehmige Masse auch über Hals und Arme. Als sie fertig war, musterte sie Mari sorgfältig und berührte vorsichtig deren Wange. »Prüf es am Fenster nach.«
Düster nickte Mari. Gefolgt von Leda durchquerte sie die Wohnhöhle, stieg die steinernen Stufen in eine Nische empor, die sauber aus den Fels- und Lehmschichten herausgehauen war, und schob einen langen rechteckigen Stein beiseite. Durch die Öffnung strömte warme Luft herein und streichelte Maris Wangen wie eine zweite Mutter. Mari spähte hinaus in die Welt über der Erde. Der Osthimmel über ihr schimmerte bereits in den fahlen, ausgewaschenen Farben, mit denen die Nacht den grellen Tag abmilderte. Sie reckte den Arm, bis das bleiche Licht darauf fiel. Dann begegnete sie dem Blick ihrer Mutter.
Wie Maris Augen waren Ledas grau, beinahe silbern. Mari konzentrierte sich auf die Schönheit dieses Zugs, den sie beide teilten. Ihrer beider Augen leuchteten im Vollmondlicht silbern. Und wie bei ihrer Mutter schimmerte auch Maris Haut, wenn sie sich ganz der Vollmondnacht hingab und sich von deren kühlem silbernen Licht erfüllen und beruhigen ließ.
Voller Sehnsucht nach dem Mond und seiner kühlen Kraft reckte Mari die Hand weiter durch das Loch, wie um etwas davon einzufangen. Doch statt zarter Mondstrahlen erhaschten ihre Fingerspitzen das goldene Licht der sinkenden Sonne. Hitze strömte in ihre Hand ein. Mari erzitterte und zog sie schnell zurück. Sie spreizte die Finger und starrte das feine, filigrane Muster an, das selbst bei so schwachem Sonnenlicht auf ihrer Haut erschien. Mari schloss die Hand und barg sie an ihrer Brust. Das sonnenlichtfarbene Muster verblasste wie ein vager Traum während des Erwachens.
Sie war so gar nicht wie ihre Mutter.
»Das geht schon so, mein süßes Mädchen. Nimm deinen Sommermantel. Der ist so leicht, dass dir nicht zu warm sein wird …«
»Aber die Ärmel werden meine Arme und Hände verbergen, bis die Sonne untergegangen ist«, vollendete Mari den Satz. Matt wandte sie sich vom Fenster ab und ging zu dem Korb, in dem sie ihre Mäntel aufbewahrte.
»Ich wünschte, du müsstest dich nicht verstecken«, sagte ihre Mutter leise. »Ich wünschte, es ginge anders.«
»Ich auch, Mama.«
»Es tut mir so leid, Mari. Du weißt, dass …«
»Schon gut, Mama. Wirklich. Ich bin’s ja gewohnt.« Mari setzte ein möglichst unbekümmertes Lächeln auf, ehe sie sich ihrer Mutter zuwandte. »Vielleicht wächst es sich ja noch aus.«
»Nein, mein süßes Mädchen. Das wächst sich nicht aus. Das Blut deines Vaters fließt ebenso stark in dir wie das meine. Und das bereue ich nicht. Egal wie hoch der Preis ist, ich würde es nicht ändern wollen.«
Ich schon, Mama. Ich schon. Aber das sprach Mari nicht laut aus. Schweigend schlang sie den Mantel fest um sich und verließ an Ledas Seite die Sicherheit ihres kleinen Baus.
2
Seite an Seite überstiegen Leda und Mari den felsigen Hügelrücken und schauten auf den Versammlungsplatz hinab. Auf den ersten Blick unterschied er sich nicht von anderen Lichtungen in dem feuchten Wald: Übersät mit Weiden und Weißdorn, Stechpalmen und Farn und dazwischen wand sich ein kleiner Bach dahin. Er und die sanft raschelnden Zweige der Bäume und Büsche zogen das Auge des Betrachters sofort auf sich, und zwar mit Absicht. Man musste schon sehr genau hinsehen, zumindest aus der Entfernung, um zu bemerken, was sich geschickt unter Baumkronen und Farn verbarg: Grünkohl, Endivien, Kopfsalat und der letzte Winterknoblauch – all das Gemüse, das hier dank der Pflege der Clansfrauen gedieh.
Leda blieb stehen und tat einen tiefen, zufriedenen Atemzug. »Danke, Erdmutter«, sagte sie, als stände die Göttin ebenso neben ihr wie ihre Tochter. »Danke, dass du deine Erdwanderer mit der Gabe gesegnet hast, deinem fruchtbaren Schoß Leben zu entlocken.«
Auch Mari atmete tief durch und lächelte Leda zu. Sie war es gewohnt, dass ihre Mutter so vertraut mit ihrer Göttin sprach. »Ich kann das Lavendelöl schon riechen«, sagte sie.
Leda nickte. »Der Versammlungsplatz scheint gut vorbereitet zu sein. Heute Nacht wird uns keine Wolfsspinne stören.« Sie wies auf die überall verteilten Lagerfeuer. Nur eines brannte in der Mitte der Lichtung, die anderen waren strategisch entlang des Waldrands platziert. Neben jeder waren Fackeln in die Erde gesteckt, aber noch nicht angezündet. »Die Flammenstäbe sind auch bereit, falls durch die vielen Menschen ein Schabenschwarm angezogen wird.«
»Ich weiß ja, dass die Feuer vor allem zum Schutz da sind, aber so hell erleuchtet zu sein gibt der Lichtung etwas Fröhliches.«
»Das ist wahr«, stimmte Leda ihr zu.
»Ich hoffe, der Grünkohl ist bald erntereif«, sagte Mari, während sie den Abstieg begannen. »Ich kann schon fast schmecken, wie köstlich er mit unseren eingelegten Kapern sein wird.«
»Es ist früh warm geworden dieses Jahr«, sagte Leda. »Kann sein, dass man schon heute Nacht etwas davon ernten kann.«
»Allein dafür hätte sich der Weg gelohnt.«
Leda bedachte sie mit einem scharfen Blick. »Es war deine freie Entscheidung, mich zu begleiten.«
»Ich weiß, Mama. Tut mir leid, wenn es anders geklungen hat.«
Leda drückte ihr die Hand. »Nicht nervös sein. Hab Vertrauen in dich.«
Mari nickte angespannt. Da kam ein Wirbelwind herangeschossen und warf sich in ihre Arme. »Mari! Mari! Schön, dass du da bist! Das heißt, dir geht es gut?«
Mari lächelte das jüngere Mädchen an. »Ja, Jenna. Ich freu mich auch, hier zu sein.« Sie berührte die kunstvoll aus Lavendel und Efeu gewobene Jungfernmondkrone auf Jennas Kopf. »Deine Krone ist aber hübsch! Hat dein Vater sie gemacht?«
Jenna kicherte, was sie eher wie sechs als sechzehn wirken ließ. »Vater? Quatsch! Mit seinen Wurstfingern? Er sagt immer, wenn er versucht zu weben, verwandeln sie sich alle in Daumen. Ich hab sie selbst gemacht.«
»Wirklich schön, Jenna«, bemerkte Leda und lächelte der Freundin ihrer Tochter zu. »Wie kunstvoll der Lavendel in die Mitte des Musters gewoben ist. Du hast Talent.«
Jennas Wangen färbten sich auf niedliche Art rosa, und sie strahlte. »Danke, Mondfrau.« Formell verneigte sie sich vor Leda, die Hände offen nach vorn gestreckt zum Zeichen, dass sie weder eine Waffe noch sonst etwas Schädliches versteckte.
»Ach, Jenna, lass die Formalitäten! Es ist doch nur Mama«, sagte Mari.
»Sie ist vielleicht nur deine Mama, aber sie ist meine Mondfrau«, gab Jenna kess zurück.
»Und deine Freundin«, fügte Leda hinzu. »Welche Art des Webens macht dir denn am meisten Spaß – das Fadenweben oder das Garnweben?«
Jenna sah zu Boden. »Ich – ich würde gern Bilder weben, wie den Wandteppich mit der Erdmutter im Geburtsbau.«
»Dann also Fadenweben«, sagte Leda. »Ich rede heute mit Rachel, damit sie dich gut in die Lehre gibt.«
»Danke, Mondfrau«, erwiderte Jenna hastig. In ihren Augen glitzerten Tränen.
Leda nahm Jennas Gesicht zwischen die Hände und küsste sie auf die Stirn. »Deine Mutter hätte das Gleiche für Mari getan, wäre ich vor ihr zur Erdmutter gegangen.«
Mari hakte sich bei ihrer Freundin unter. »Nur bin ich im Weben genauso hoffnungslos wie dein Vater. Deine Mama hätte gar nicht gewusst, was sie mit mir machen soll.«
»Dafür kannst du wahnsinnig gut zeichnen!«, versetzte Jenna.
»Die Mondfrau! Unsere Mondfrau ist da!«, hörte man eine kräftige Männerstimme vom Versammlungsplatz rufen.
Leda erwiderte die Begrüßung mit einem fröhlichen Winken. »Wie immer sieht dein Vater mich zuerst.«
»Vater wird dich immer zuerst sehen und sich als Erster von dir reinigen lassen. Weil er mich so sehr liebt«, sagte Jenna stolz.
»Das tut er«, bestätigte Leda.
Mari lächelte ihrer Freundin zu. »Xander ist ein toller Vater.« Innerlich aber dachte sie: Ein Glück, dass er Mama zuverlässig jede Drittnacht aufsucht. Sonst wäre Jenna schlimmer dran als eine Waise – sie würde von einem Monster aufgezogen.
»Unsere Mondfrau ist da! Entzündet die Fackeln! Macht euch bereit!«, nahmen die Clansfrauen den Ruf auf. Auf dem Versammlungsplatz brach geschäftiges Treiben aus. Von überallher kamen die Clansmitglieder und nahmen ihre Plätze ein. Zwar nicht in perfektem Einklang, aber doch in erdig-anmutiger Harmonie schlängelten sich die Clansfrauen in einem Muster zwischen den Bäumen hindurch, das Mari an rieselndes Wasser über Bachkieseln erinnerte.
Es entstand ein Halbkreis, um die Mondfrau des Clans zu empfangen. Ganz innen die ältesten Frauen, dann Mütter mit ihren Kindern neben sich, dann die jungen Mädchen mit ihren farbenfrohen Kränzen und zuletzt die Männer, die sich schützend mit Fackeln in der Hand am Rand der Lichtung aufstellten. Mari konnte ihre raubtierhafte Anwesenheit fühlen – ein kaum gebändigtes Chaos, das förmlich in finsteren Schwaden über die Lichtung zu wogen schien. Sie konnte nicht anders, als immer wieder nervöse Blicke auf sie zu werfen. Seit sie als kleines Mädchen begriffen hatte, was das Nachtfieber den Clansleuten antat – welch tödliche Melancholie es in den Frauen auslöste und welch gefährlichen Wahnsinn in den Männern –, behielt sie die Männer stets wachsam im Auge, vor allem, sobald die Sonne unterging.
»Starr sie nicht an«, flüsterte ihre Mutter ihr zu. »Es ist Drittnacht. Wir werden sie reinigen, und alles wird gut sein.«
Mari nickte unbehaglich. »Geh du voraus. Jenna und ich folgen dir.«
Leda machte einen Schritt – dann hielt sie inne und streckte Mari die Hand hin. »Nicht hinter mir. Komm neben mich, wo alle dich sehen können.«
Sofort spürte Mari, wie Erregung in Jenna aufstieg. Statt die Hand ihrer Mutter zu nehmen, suchte sie deren Blick – suchte darin nach Halt.
»Vertrau mir, mein süßes Mädchen«, sagte Leda. »Ich bin bei dir. Das weißt du.«
Mari stieß die Luft aus, von der sie gar nicht gemerkt hatte, wie lange sie sie angehalten hatte. »Ich vertraue dir immer, Mama.« Und sie nahm Ledas Hand.
Neben ihr flüsterte Jenna: »Du bist fast schon eine echte Mondfrau!« Ehe Mari antworten konnte, verneigte Jenna sich noch einmal – diesmal vor Leda und Mari. Erst dann zog sie sich hinter beide zurück.
»Bereit?«, fragte Leda.
»Solange du bei mir bist, Mama.«
Leda drückte die Hand ihrer Tochter und schritt zuversichtlich voran, den Kopf erhoben, die Schultern gestrafft, ein strahlendes Lächeln auf den Lippen. »Meine Tochter und ich grüßen euch, Weberclan! Möge die Fülle des Frühlingsmonds sich für euch verdreifachen!«
Mari spürte die Blicke des Clans auf sich ruhen, hörte, wie sich gemurmelte Spekulationen erhoben. Sie ahmte die Haltung ihrer Mutter nach, richtete sich auf, straffte die Schultern und hob das Kinn. Sie versuchte, den Blick auf niemanden im Besonderen zu richten, doch unweigerlich wurde er von einem weiteren Paar grauer Augen angezogen, nicht silbergrau wie ihre eigenen und die ihrer Mutter, sondern heller, mit einem Hauch Stahl darin. Bemerkenswerte Augen, deren Besitzerin unbestreitbar eine Mondfrau unter ihren Ahninnen hatte.
»Sei gegrüßt, Mondfrau«, sagte das Mädchen und verneigte sich vor Leda –, wobei sie durch ihre Haltung klarmachte, dass es allein Leda war, der ihre Verneigung galt. Beim Aufrichten warf sie das dunkle Haar zurück, und die Federn und Perlen ihrer Jungfernmondkrone flatterten, als wären sie lebendig. Verächtlich streifte ihr Blick Mari, ehe sie sagte: »Ich wusste nicht, dass du heute Abend deine möglichen Lehrlinge um dich versammeln wolltest.«
Leda lächelte sie freundlich an. »Hallo, Sora. In der Tat war das eher eine spontane Bekundung von Stolz auf meine Tochter.« Sie hob für alle sichtbar die Hand, mit der sie Maris hielt. »Und dieser Stolz rührt teilweise daher, dass ihre grauen Augen sie als möglichen Lehrling ausweisen.«
»Wie meine auch«, sagte Sora.
Mari unterdrückte einen verärgerten Seufzer und kam der Antwort ihrer Mutter zuvor. »So wie du ständig mit den Wimpern klimperst und unter gesenkten Lidern die Männer anschielst, kann sich doch keiner mehr erinnern, welche Farbe deine Augen haben.«
»Was ist schlimm daran, dass ich unsere Männer ansehe? Ich erzeige ihnen nur die Bewunderung, die ihnen als unseren Beschützern gebührt. Eifersucht macht hässlich, Mari, vor allem wenn man seinem Äußeren sowieso so wenig Beachtung schenkt wie du«, gab Sora zurück.
»Unter Clansfrauen wird nicht gestritten«, sagte Leda scharf.
Sora und Mari warfen einander einen Blick voller kaum verhohlener Abneigung zu. Dann neigten sie respektvoll die Köpfe vor der Mondfrau.
»Natürlich nicht«, sagte Sora. »Entschuldige, Mondfrau.«
»Nicht mir schuldest du eine Entschuldigung«, sagte Leda.
Sora wandte sich Mari zu. Ihr sanftes Lächeln erreichte nicht ihre Augen. »Entschuldige, Mari.«
»Mari?«, drängte Leda, da ihre Tochter stumm blieb.
»Entschuldigung«, sagte Mari schnell.
»Gut.« Leda hielt Sora ihre andere Hand hin. »Du hast recht, Sora. In der Tat weisen deine Augen dich als möglichen Lehrling für mich aus. Bitte schließ dich uns an.«
Eifrig nahm Sora Ledas Hand. Diese blieb stehen, statt in das Rund des Clans zu treten, und rief mit erhobener Stimme: »Alle Mädchen mit grauen Augen, bitte tretet vor eure Mondfrau!«
In der Menge entstand eine kleine Welle. Ein jüngeres Mädchen löste sich daraus.
»Mari?«, sagte Leda leise.
Mari lächelte ihrer Mutter zu und hielt dem Mädchen die freie Hand hin. »Hallo, Danita.« Die Jüngere lächelte scheu, trat unter nervösen Blicken auf Leda neben Mari und nahm deren Hand. Da bemerkte Mari dicht vor sich einen hellen Schimmer und erkannte mit Schrecken, dass ihr Mantelärmel zurückgerutscht war und das Licht eines einzelnen späten Sonnenstrahls auf ihren ausgestreckten Unterarm fiel. Unter der Lehmschicht leuchteten die filigranen Konturen eines Farnwedels.
Hastig riss Mari ihre andere Hand von der ihrer Mutter los, zog den Mantelärmel über das Leuchten und schlang sich die vermummten Arme um den Leib.
Ebenso schnell trat Leda zwischen sie und den Clan, um sie vor dessen Blicken zu schützen. »Was ist, mein süßes Mädchen?«
»Ich – ich hab nur wieder Bauchkrämpfe.« Sie sah ihrer Mutter in die Augen.
Leda bemühte sich sichtlich, ihre Enttäuschung zu verbergen, aber ihr schweres Lächeln vertrieb nicht die Traurigkeit aus ihrem Blick. »Jenna«, sagte sie, »könntest du Mari zum Kochfeuer bringen und eine der Mütter bitten, ihr einen Kamillentee zu brauen? Anscheinend geht es ihr nicht so gut, wie wir hofften.«
»Klar, Leda! Keine Sorge. Ich passe auf Mari auf.« Jenna hakte sich bei Mari unter und zog sie in die Menge. Mari sah noch, wie Danita, ein anderes grauäugiges Mädchen und dann noch eines sich wie Sora neben ihre Mutter stellten.
»Sei nicht traurig«, flüsterte Jenna. »Ein paar Schlucke Tee, dann geht’s dir wieder gut. Wir können zusammen am Feuer sitzen und über die dämlichen Federn in Soras Krone lästern, während deine Mutter den Clan reinigt.« Jenna zeigte auf einen Baumstamm nicht weit von der zentralen Feuerstelle. »Setz dich hin und ruh dich aus. Ich hole dir den Tee. Bin gleich zurück!«
»Danke«, sagte Mari und ließ sich nieder, während Jenna davonflitzte. Sie spürte die mitleidigen Blicke der Clansfrauen auf sich und setzte mit Mühe die ausdruckslose Miene auf, mit der sie dem Clan stets begegnete, ohne je zu zeigen, wie sehr es sie schmerzte, abseits zu leben.
Ihnen etwas vorzumachen.
Sie sah zu, wie ihre Mutter in die Mitte des Versammlungsplatzes schritt und vor der Statue anhielt, die den Ort schmückte. Hier ließ Leda die Hände der Mädchen los und verneigte sich tief vor dem Bildnis der Erdmutter, das dem Waldboden zu entsteigen schien. Das Gesicht der Statue war ein glatter behauener Stein aus dem Bach, cremeweiß mit Quarzkristallen darin, die im Licht der Sonne und des weicheren, kühleren Mondes glitzerten, als sei die Göttin aus Wünschen und Tagträumen gewoben. Ihr übriger Körper war von dichtem, weichem Moos bedeckt, und ihr Haar war ein üppiger Farn, der liebevoll so getrimmt worden war, dass die Wedel über ihre runden Schultern und den Rücken fielen.
»Ich grüße dich in Liebe, Dankbarkeit und Ehrfurcht, Erdmutter, wie der Clan mich selbst gegrüßt hat – deine Mondfrau und Dienerin«, sprach Leda respektvoll. Dann richtete sie sich auf und wandte sich der wartenden Menge zu. »Männer des Weberclans, tretet vor mich!«
Während die Männer sich um Leda versammelten, kehrte Jenna zu Mari zurück, reichte ihr einen hölzernen Becher voll duftenden Kamillentees und setzte sich neben sie auf den Baumstamm. »Oh, schau, da ist Vater!« Sie lächelte und winkte. Der breitschultrige Mann, der die Männer anführte, antwortete mit einem Nicken. Seine Züge waren qualvoll gespannt, und in seinen zusammengekniffenen Augen schwelte der Zorn, der mit jedem Sonnenuntergang in ihm aufstieg. Ein Zorn, der überfließen würde, ließe er sich nicht mindestens alle drei Nächte von seiner Mondfrau vom Nachtfieber reinwaschen.
Gemeinsam mit den anderen Männern des Clans sank Xander vor Leda auf die Knie, während am westlichen Horizont die Sonne endgültig unterging.
Mari sah, wie ihre Mutter die Arme hob, als wollte sie den Mond ergreifen, der für den Rest des Clans noch nicht sichtbar war, den eine Mondfrau jedoch stets finden – und herabrufen – konnte, sobald die Sonne aus dem Firmament geschwunden war. Der graue Schimmer, der sich auf Ledas Arme gelegt hatte, wurde schwächer und verschwand dann ganz. Mit strahlendem Lächeln legte Maris Mutter den Kopf in den Nacken und bot Gesicht und Arme dem dunkler werdenden Himmel dar. Ihr Atem wurde tief und regelmäßig. Automatisch wurden auch Maris Atemzüge tiefer, und sie verfiel in die meditative Trance, die Voraussetzung für das Herabrufen des Mondes war. Sie sah ihre Mutter die Lippen bewegen, eine stumme Zwiesprache mit ihrer Göttin, um sich auf das Kommende vorzubereiten.
Mari ließ den Blick über den Halbkreis der Clansleute schweifen und zählte sie – zweiundzwanzig Frauen, zehn Kinder und sieben Männer –, um ihrer Mutter zu helfen, dies richtig in ihren Aufzeichnungen zu vermerken, wenn sie nach Hause zurückkehrten.
Als ihr Blick auf Sora fiel, runzelte sie die Stirn. Das gibt’s doch nicht!, schäumte sie innerlich. Alle anderen beten oder bereiten sich innerlich vor, nur die dumme Zicke nicht. Statt zu beten oder Leda zu beobachten, wie es einem möglichen Mondfrauenlehrling angestanden hätte, lächelte Sora einem der jungen Männer zu, die vor Leda knieten. Mari reckte den Hals und erkannte, dass auch der junge Mann, den sie als Jaxom erkannte, verstohlene Blicke mit Sora wechselte –, wobei die Glut in seinen Augen nichts mit dem Nachtfieber zu tun hatte.
Mari durchfuhr ein Stich der Eifersucht. Sora hat es so leicht! Sie ist selbstbewusst, kühn und wunderschön. Wie wäre es wohl, wie sie zu sein – nur einen Tag, ach was, nur eine Stunde lang? Wenn ein Mann mich so glühend und sehnsüchtig anstarren würde? Es wäre so schön, dachte Mari. So undenkbar schön.
Da ertönte in das Schweigen des Clans hinein die Stimme ihrer Mutter, ihrer zauberhaften, lieblichen Mondfrauenmutter. Kraftvoll, sicher und weich begann sie zu sprechen, und alle Augen des Weberclans richteten sich auf sie.
»Als Mondfrau, die dir folgt und an dich glaubt,
senke ich vor dir mein bares Haupt.
Mutter, von der meine Gaben sind,
leihe Kraft auch heute deinem Kind.
Dein Silberlicht erfülle mich mit Leben
und heile, die in meine Hut gegeben.«
Während Leda die Beschwörung rezitierte, begann ihr Körper, von innen heraus zu glühen – nicht im ungesunden Glimmen des Nachtfiebers, sondern im erhabenen Silberglanz der eisigen Kraft des Mondes. Mari hatte schon unzählige Male beobachtet, wie ihre Mama den Mond herabrief, und jedes Mal faszinierte es sie aufs Neue. Nie hatte Ledas Erdmutter auch nur einen Laut zu Mari gesprochen, doch Mari war überzeugt: Sollte die Göttin jemals wahrhaft aus der Erde aufsteigen, dann sähe sie genauso aus wie ihre Mama.
»Gewähre mir, was seit Geburt mein Erbe,
mein Reichtum und mein Schicksal, bis ich sterbe«,
sprach Leda die Schlussworte, mit denen sie aus dem Himmel die unsichtbaren Ströme der Macht in sich herabrief, die nur einer Mondfrau gehorchten. Dann begann sie von Mann zu Mann zu gehen, legte die Hände auf jede aufwärtsgekehrte Stirn. Sie war wie ein lebender Pinsel, dachte Mari, der das Bild des Clans mit Magie und Mondlicht kolorierte, so dass einen Moment lang jeder Einzelne silbern erglänzte. Selbst hier, wo sie saß, konnte sie die erleichterten Seufzer der Männer vernehmen, die durch die Mondfrau von der Qual und Wut des Nachtfiebers gereinigt wurden.
Neben sich spürte Mari, wie ein Zittern Jennas zarten Leib durchlief, und erinnerte sich, dass ja auch sie eine Rolle zu spielen hatte. Sie trank ihren Tee aus und schlang die Arme um sich, tat, als spürte sie einen Schmerz, der nie da gewesen war.
»Das wird schon, Mari. Sie ist fast fertig mit den Männern«, sagte Jenna.
Mari öffnete den Mund, um Jennas Besorgnis zu zerstreuen, aber stattdessen klappte sie ihn wieder zu und knirschte vor Ärger mit den Zähnen, als sie sah, wie Sora jedem der frisch gereinigten Clansmänner kokett zulächelte, ehe diese sich wieder auf ihre Wachtposten rund um den Versammlungsplatz begaben.
Jenna folgte ihrem Blick und schnaubte unfein. »Ist die schamlos. Ich frag mich, warum Leda ihr keinen Rüffel gibt.«
Mari erwiderte nichts. Sie befürchtete zu wissen, warum ihre Mama Sora nicht für ihre Unverschämtheiten rügte. Weil die Mondfrau sich endlich eine Nachfolgerin suchen und offiziell als Lehrling annehmen muss. Und diese Nachfolgerin darf keine Abnormität sein, deren Haut im Sonnenlicht zu glühen anfängt. So arrogant und unerträglich Sora war, sie war im Clan beliebt und offenbar fest entschlossen, die nächste Mondfrau zu werden.
Da kam Leda auf Mari und Jenna zu. Wie alle anderen Clansfrauen hob Jenna den Kopf. Leda legte ihr die Hände auf den Scheitel über die feingewobene Jungfernmondkrone. Ihre Worte galten dem Clan, aber ihr Blick ruhte auf Mari.
»Ich wasche dich rein von aller Traurigkeit und schenke dir die Liebe unserer Erdmutter.«
Im Chor mit dem Clan murmelte Mari: »Danke, Mondfrau.« Heimlich lächelte sie ihrer Mutter zu. Leda berührte den Kopf ihrer Tochter, beugte sich rasch über diese und küsste sie auf die Stirn, ehe sie sich der nächsten Gruppe wartender Frauen zuwandte.
Mari sehnte sich danach, sich ihrer Mutter anzuschließen, dem Clan zu zeigen, dass sie nicht kränklich war, dass sie der Mondfrau eine Hilfe sein, ja eines Tages möglicherweise selbst zu dieser werden konnte.
»Bleib du mal lieber sitzen. Wir wollen doch nicht, dass deine Bauchschmerzen wiederkommen.«
Mari sah auf – genau in Soras Gesicht. An Soras Worten war eigentlich nichts auszusetzen, doch hinter der höflichen Fassade war deutlich ihr Spott zu spüren. Oh, wie gern wäre Mari aufgesprungen und hätte laut verkündet, dass sie gar keine Bauchschmerzen hatte! Dass sie nur anders war! Aber das preiszugeben war unmöglich – sie hätte nicht nur ihre eigene Sicherheit gefährdet, sondern, viel wichtiger, die ihrer Mutter. Also sagte Mari nur: »Lauf du mal lieber meiner Mama nach. Wir wollen doch nicht, dass sich ein anderes grauäugiges Mädchen bei ihr einschleimt.«
Ein unmutiges Stirnrunzeln entstellte Soras hübsches Gesicht, und sie drehte sich um und marschierte wortlos zu Leda hinüber.
»Spaßbremse«, sagte Jenna.
»Für die Männer anscheinend nicht«, versetzte Mari.
Jenna erstickte ihr Kichern hinter vorgehaltener Hand. Mari grinste und beugte sich zu ihr hinüber, um sich über die lächerlichen Federn in Soras Jungfernmondkrone auszulassen und darüber, wie vogelartig sie damit aussah. Da fühlte sie den Blick ihrer Mutter auf sich ruhen und hob den Kopf. Über die Köpfe des Clans hinweg formten sich Ledas Lippen zu zwei Worten: Sei gütig.
Mari schenkte ihrer Mutter ein entschuldigendes Lächeln und seufzte. Leda hatte ja recht. Die Mondfrau war die Matriarchin des Clans: Heilerin, Ratgeberin, Anführerin und gütige Mutter. Leda war dies von ganzem Herzen. Sie tat nicht nur so, sie liebte und schätzte jeden Einzelnen ihres Clans.
Doch war Mari so gütig? Sie wusste es nicht. Sie bemühte sich nach Kräften, sich so zu verhalten, dass ihre Mutter stolz auf sie sein konnte. Sie versuchte, alles richtig zu machen, aber egal wie viel Mühe sie sich gab, irgendwas schien immer zu fehlen. Oder vielleicht war fehlen nicht das richtige Wort. Vielleicht war sie nur so anders als alle anderen im Clan, selbst anders als ihre Mama, dass in ihr einfach nie ein echtes Gemeinschaftsgefühl aufkam. Mit bittersüßer Sehnsucht sah Mari zu, wie Leda sich den Müttern und Alten zuwandte. Wenn sie sich nur so unbeschwert in ihrer Haut fühlen könnte wie Leda, Sora und der Rest des Clans.
Automatisch überprüfte sie noch einmal die Ärmel ihres Mantels, obwohl die Sonne längst untergegangen war. Als sie erkannte, was sie tat, zwang sie ihre rastlosen Hände zur Ruhe. Eine solche Traurigkeit ergriff sie, dass sie kaum noch Luft bekam.
Was tue ich hier eigentlich? Ich gehöre nicht dazu, und meinetwegen wirkt Mama jetzt schwach und unentschlossen. Ich hätte nicht mitkommen sollen.
»Mari? Alles okay?«, fragte Jenna, und Mari wurde bewusst, dass die andere ihr schon seit geraumer Zeit lang und breit erzählte, wie sie den Frauen aus den nahe gelegenen Bauen geholfen hatte, den Versammlungsplatz für die heutige Feier vorzubereiten.
»Tut mir leid, Jenna. Nein, mir geht’s nicht so toll. Ich gehe lieber nach Hause, bevor es ganz dunkel wird. Richtest du Mama aus, dass ich zu starke Bauchschmerzen habe und mich lieber hinlege?«
»Klar. Hey, übrigens hab ich ein riesiges Feld blühender Purpurlilien gefunden. Hast du nicht mal gesagt, dass die toll zum Färben sind?«
»Ja.«
»Willst du sie morgen mit mir ernten?«
Mari wollte ja sagen. Sie wollte einfach nur mit ihrer Freundin lachen, reden und tuscheln und nicht ständig auf der Hut vor dem Sonnenlicht sein müssen.
Doch das musste sie. Es war unmöglich vorherzusagen oder zu kontrollieren, ob ihre Haut in der Sonne zu leuchten beginnen würde, aber oft tat sie das – und viel zu selten nicht. Und die letzten Tage waren so sonnig gewesen, dass sie das Risiko nicht eingehen durfte.
»Ich weiß nicht, ob ich mich morgen schon fit genug fühle. Ich würde wahnsinnig gern – wirklich.«
»Hey, kein Ding, Mari. Ich komme um die Mittagszeit hierher, und wenn’s dir gutgeht, kommst du auch, okay?«
Mari nickte. »Ich versuch’s.« Sie betete stumm, dass es bewölkt sein würde. Dann umarmte sie Jenna. »Ich danke dir so, dass du meine Freundin bist, auch wenn wir uns nicht so oft sehen, wie ich mir wünschen würde.«
Jenna drückte sie fest an sich und trat dann zurück. Mit spitzbübischem Grinsen sagte sie: »Hey, ist doch egal. Hauptsache, wir haben Spaß, wenn wir uns sehen, und den haben wir ja! Wir gehören zum Clan, Mari. Das ist alles, was zählt. Ich werde immer deine Freundin sein!«
Mari lächelte unter Tränen. »Wenn es irgend geht, komme ich morgen.«
Ehe sie davoneilte, warf sie noch einen raschen Blick auf Leda. Da stand ihre magische Mutter inmitten der Erdwanderer und wusch dank der Kraft des Mondes ihren Clan vom Nachtfieber rein, ohne zu bemerken, dass ihre Tochter still im dunkelnden Wald verschwand – allein und unbeachtet wie so oft.
3
Weit im Nordwesten, gleich jenseits der Grenze der Ruinenstadt, traf Fahlauge eine Entscheidung, die die Ordnung seiner Welt verändern sollte.
Seit kurzem hatte die Rastlosigkeit, die sein ganzes Leben geprägt hatte, ein beinahe unerträgliches Maß erreicht. Er wusste, warum. Weil es ihn schlicht und einfach anekelte, so zu tun, als sei die Schnitterin, Göttin seines Volkes, noch am Leben. Fahlauge wusste, dass sie tot war, schon seit dem Tag, als er ihr vorgestellt worden war.
Damals war er ebenso aufgeregt gewesen wie all die anderen Jünglinge, die die sechzehn Winter überlebt hatten, die man brauchte, um zu einem aus dem Volk erklärt zu werden. Fahlauge hatte gefastet, gebetet und sein Lebendopfer mitgebracht. Nackt hatte er mit den anderen Jünglingen den Tempel der Schnitterin im Herzen der Stadt betreten und war die endlose Treppe zur Kammer der Wächterinnen hinaufgestiegen.
Die Kammer war vom süßen, stechenden Rauch nach Zedernholz erfüllt gewesen. An den Wänden waren Knochen von Anderen, die das Volk der Göttin geopfert hatte, zu kunstvollen Gebilden aufgetürmt gewesen, um ihr Dankbarkeit für ihre Großzügigkeit zu erweisen. Zwischen Schlafmatten standen Feuerschalen, gefüllt mit duftendem, stets brennendem Holz, und alles war von Vorhängen aus Schlingpflanzen umflochten, denen erlaubt worden war, durch Risse in der Decke in den Raum hineinzuwachsen.
Damals waren die Wächterinnen nicht nur eine Schar alter Weiber gewesen, die beschlossen hatten, am Ende ihrer Tage der Göttin zu Diensten zu sein. Fahlauge erinnerte sich, dass viele Schlafmatten jungen Wächterinnen gehört hatten, die den Tribut der jungen, kräftigen Männer aktiv entgegengenommen hatten.
»Konzentriere dich auf die Göttin«, hatte Fahlauges Fürsorgerin ihn ermahnt, als seine Aufmerksamkeit zu lange auf einem recht lauten Paar lag. »Wenn ihr dein Opfer und deine Frage gefallen, wirst du später genug Zeit haben, deine Bedürfnisse zu befriedigen.«
»Ja, Fürsorgerin«, hatte er geantwortet, den Blick abgewandt und seine Gedanken nach innen gerichtet.
Schon damals, mit kaum mehr als sechzehn Wintern, hatte er geglaubt, dass seine Göttin etwas mit ihm vorhatte. Geglaubt? Er war sich dessen sicher gewesen, hatte es niemals bezweifelt. Ja, sein Volk litt. Nein, Fahlauge verstand nicht, warum. Er verstand nicht, warum die wunderschöne, aber unerbittliche Schnitterin zuließ, dass unter dem Volk Tod und Krankheit herrschten. Er verstand nicht, warum sie ihrem Volk gebot, Andere lebend zu häuten, um die eigene, sich lösende Haut zu heilen und die Macht der Anderen in sich aufzunehmen –, und warum dennoch viele aus dem Volk krank wurden, ihre Haut sich schälte und sie starben.
Fahlauge hatte vorgehabt, es an jenem Tag herauszufinden.
Die Göttin würde sein Opfer annehmen und seine Frage beantworten, und er würde sich auf ewig in ihren Dienst stellen.
Da stürzte ihm ein Jüngling entgegen. Er presste ein kleines totes ausgenommenes Ding an seine Brust und weinte verzweifelt.
»Das Opfer ist nicht gefällig! Die Göttin nimmt es nicht an!«, ertönte von der Galerie die hohe, brüchige Stimme der Ersten Wächterin.
Mit Schrecken war Fahlauge klargeworden, dass er der einzige verbliebene Jüngling in der Kammer war. Sein Blick flog zur Galerie. Er hielt sein Opfer sehr fest und betete, dass sein Instinkt richtig gewesen war –, dass er eine kluge Wahl getroffen hatte, indem er aus all der Beute seiner tagelang aufgestellten Fallen die weiße Taube ausgewählt hatte, die er in den Händen barg.
»Fürsorgerin, stelle den nächsten Jüngling vor!« Die Erste Wächterin trat vor die riesigen glaslosen Fenster, hinter denen die Galerie lag, von der aus die enorme Statue der Schnitterin die Stadt überblickte und ihr Volk zu sich zu winken schien.
»Ich stelle Fahlauge vor«, sagte die Fürsorgerin. Dann trat sie beiseite, da der Jüngling den restlichen Weg durch die Kammer allein gehen musste.
Als er die Erste Wächterin erreichte, drehte diese sich um, und gemeinsam traten sie auf die geheiligte Galerie hinaus.
Obwohl Fahlauge inzwischen wusste, dass die Statue nur totes Metall und die Göttin eine leere Hülle war, würde Fahlauge niemals vergessen, wie er sich ihr damals genähert hatte. Wie immer war sie von einem Halbkreis aus Feuerschalen umgeben gewesen, der sie in Licht hüllte und wärmte. In Faszination und Ehrfurcht vor ihrer herrlichen Gegenwart hatte Fahlauge zu ihr aufgesehen.
Sie war, wie eine Göttin sein musste – stark, furchterregend und wunderschön. Ihre unsterbliche Haut bestand aus Metall, das im Feuerschein verführerisch glitzerte. Sie war größer als zehn Männer und herrlicher als jede Frau, die Fahlauge je gesehen hatte. Hoch über dem Eingang zu ihrem Tempel kniete sie, eine Hand nach unten ausgestreckt, um ihr Volk zu sich zu rufen. In der anderen Hand hielt sie aufrecht den Dreizahn, das tödliche dreigespitzte Häutmesser, das sie ihrem Volk nach der Zeit der Flammen geschenkt hatte.
»Was für ein Opfer hast du deiner Göttin mitgebracht?«, fragte die Wächterin.
Wie er es eingeübt hatte, sprach er: »Ich bringe der Schnitterin den Geist dieses Wesens dar und seinen Leib ihren erwählten Dienerinnen, den Wächterinnen.« Mit einer ehrfürchtigen Verbeugung reichte Fahlauge der alten Frau die weiße Taube.
»Ja, das sieht gut aus. Komm zum Kessel.« Die Alte bedeutete ihm, sie zu der größten Feuerschale zu begleiten, die direkt vor der Göttin stand. Drumherum wartete gierig eine Schar Wächterinnen, ausnahmslos Greisinnen. Tuschelnd leckten sie sich die Lippen.
Fahlauge erschauerte in der Erinnerung an ihren muffigen Geruch und ihre unsteten, blutunterlaufenen Augen.
Die alte Anführerin hatte den zeremoniellen Dreizahn gehoben und den Bauch des zappelnden Vogels von den Lenden bis zum Kinn aufgeschlitzt – eine Wunde wie eine wunderschöne scharlachrote Blüte. Das Blut spritzte so hoch und stark auf, dass ein paar Tropfen die Statue besprenkelt hatten.
Die alte Frau hielt den blutenden, zuckenden Vogel in die Höhe. »Ah! Dies ist ein Zeichen, dass die Göttin zufrieden mit diesem Jüngling ist! Welche Tätigkeit möchtest du gern unter dem Volk ausüben?«
»Ich möchte ihr Mal tragen und ein Schinder sein«, hatte Fahlauge gesagt. Stolz erinnerte er sich daran, dass seine Stimme nicht gewankt und er erhobenen Hauptes vor der Alten und der Statue gestanden hatte, die sie hoch überragte.
»So sei es!« Die Wächterin hatte den anderen Frauen zugenickt. Sofort waren sie auf ihn zugestürzt und hatten ihn an den Armen gepackt. Mit erstaunlicher Kraft hatten sie ihn von den Füßen gezerrt und mit gespreizten Armen auf dem Boden der Galerie festgehalten. Die Alte hatte aus dem Feuerkessel der Göttin einen kleinen Dreizahn gezogen. Das tödliche Metall der dreispitzigen Klinge hatte geglüht wie frisches Blut. Mit Schwung hatte die Wächterin die Waffe erhoben, um den Segen der Göttin gefleht und sich neben Fahlauge gekniet. »Durch großen Schmerz erlangt man große Weisheit. Fortan stehst du im Dienst der Schnitterin. Nun darfst du der Göttin eine Frage stellen –, und sie wird antworten.« Damit presste sie die glühende Klinge auf Fahlauges Unterarm.
Er war nicht zusammengezuckt. Er hatte nicht aufgeschrien. Voller Eifer hatte er zum Antlitz der Göttin hinaufgeblickt und ihr seine Frage gestellt.
»Was kann ich tun, damit das Volk wieder stark wird?«
Fahlauges Finger ertasteten die erhabene dreigezackte Narbe. Er streichelte sie, während er sich daran erinnerte, was nun passiert war.
Nichts.
Die Göttin hatte nicht gesprochen.
Fahlauge hatte dort gelegen, den rasenden Schmerz in seinem Arm ignoriert und darauf gewartet, dass die mächtige Stimme der Göttin seinen Geist erfüllen möge.
Plötzlich hatte sich die Alte aufgerichtet, den mit Blut und Hautfetzen bedeckten Dreizahn in die Höhe gehalten und gerufen: »Sie antwortet Fahlauge! Sie nimmt ihn an!«
»Ich habe sie gehört! Sie nimmt ihn an!«, schrie eine andere der Frauen.
»Sie hat gesprochen! Sie hat ihn angenommen!«, fiel eine dritte ein.
»Seht!«, schrie die Anführerin, noch immer mit dem rauchenden Dreizahn in der Hand. »Er ist kein Jüngling mehr! Er ist Fahlauge, ein Schinder der Göttin!«
Die Frauen wollten Fahlauge auf die Füße helfen, doch er schüttelte ihre knochigen Hände ab. Kaum schwankend stand er vor der Göttin und starrte zu deren Gesicht hinauf, suchte nach irgendeinem Anzeichen, dass sie gesprochen hatte.
Alles, was er sah, war eine leblose Statue, umgeben von siechen alten Frauen.
Er sah die Anführerin an und fragte: »Die Göttin hat zu dir gesprochen?«
»Genau wie zu allen Wächterinnen und auch zu dir. Doch es ist nicht leicht, sie zu hören, wenn man nicht die Ohren einer Wächterin hat. Hast du nichts gehört, junger Schinder?«
»Nein«, sagte Fahlauge.
»Sei unbesorgt. Sie wird immer durch ihre Wächterinnen sprechen, und wir werden immer hier sein und das Volk nach ihrem Willen führen.«
Fahlauge hatte den Blick über die anderen Greisinnen schweifen lassen, die nun mit spitzen Stöcken die dampfenden Innereien aus der Taube rissen und sie sich lachend und tuschelnd in den Mund stopften.
Dann sah er noch einmal zur Göttin auf – sah die Statue zum ersten Mal wirklich. Und in jenem Moment geschah es. Er blickte der Göttin in die metallenen Augen und brüllte ihr mit aller Kraft seines Geistes zu: Wenn du am Leben wärst, könntest du diese ekelhaften alten Weiber nicht ertragen. Wenn du am Leben wärst, würdest du dein Volk wieder stark machen. Die Schnitterin existiert nicht. Es gibt keine Göttin. Du bist tot!
Fahlauge erinnerte sich, wie er dort gestanden und sich so sehr gewünscht hatte, er irrte sich, selbst wenn das bedeutete, dass die Göttin ihn für seine Blasphemie niederstrecken würde.
Aber das geschah nicht.
Fahlauge hatte sich von der Statue abgewandt. Diejenigen Wächterinnen, die nicht zu sehr darin vertieft waren, das Opfer bis auf die Knochen abzunagen oder den Männern zu Willen zu sein, hatten entsetzt aufgeschrien. Ohne sie zu beachten, war er davongeschritten, zurück ins Gebäude und die lange Treppe hinunter. Dabei hatte er sich geschworen, erst zurückzukehren, wenn er eine Antwort gefunden hatte – und da seine Göttin tot war, war er entschlossen, sie allein zu finden.
Aus diesem Grund stand er nun hier, fünf Winter später, am Rand des Waldes, der den Anderen gehörte.
Wie der Mond die Gezeiten, so hatte der uralte Kiefernwald Fahlauge schon immer angezogen. Anders als sein restliches Volk war er davon fasziniert. Seit er erkannt hatte, dass die Göttin tot war, konnte er sich des Gedankens nicht erwehren, dass es hier vielleicht mehr geben könnte als Feinde und Tod – Antworten zum Beispiel.
Aber man fühlte sich hier sehr allein. Hier gab es keine dicken Wände aus Glas oder Metall, keine labyrinthischen Pfade durch Gebäude voller Zufluchtsorte und Fluchtwege. Nur den gnadenlosen Himmel, den Wald und die Anderen.
Fahlauge strich über die erhabene Narbe des Dreizahns auf seinem Unterarm. Dabei fiel sein Blick auf seine Handgelenke und Ellbogen. Dort war seine Haut rissig geworden, und Schmerz strahlte in seine Gelenke aus. Eine schrecklich vertraute Lethargie war dabei, sich in seinen Muskeln einzunisten. Er biss die Zähne zusammen. »Nein, ich gebe nicht auf«, knurrte er trotzig. »Mein Leben wird mehr sein als dieser immer wiederkehrende Kreis aus Krankheit und Tod. Die Anderen kommen nicht in die Stadt, also muss ich in den Wald gehen. Es muss einfach einen Ausweg geben, und da die Göttin tot ist, werde ich mein eigenes Zeichen finden – mein eigenes Opfer.« Fahlauge fiel auf die Knie und neigte den Kopf. »Ja, ich werde ein Zeichen finden, und dann werde ich meinem Volk davon berichten.«
Im Wald um ihn wurde es sehr still. Und mit einem Mal trat, kaum weniger hoheitsvoll anzusehen als das Bildnis der Göttin im Herzen der Stadt, ein Hirsch aus dem Unterholz.
Fahlauge zögerte keine Sekunde. Er warf sich auf das Tier und bekam es zu fassen, ehe es zurückspringen konnte. Die Fersen in den feuchten Lehm des Waldbodens gegraben, umklammerte er ihm den Hals. Das Tier wollte sich aufbäumen und Fahlauge mit seinen gespaltenen Hufen treten, doch Fahlauge packte es beim Geweih und begann, ihm mit aller Kraft seiner muskulösen Arme den Kopf nach hinten zu ziehen – immer höher –, bis das Tier das Gleichgewicht verlor und hart zur Seite fiel.
Zitternd und nach Atem ringend lag es da. Fahlauge verlor keine Zeit. Er rammte das Knie in die Beuge zwischen Kopf und Hals des Hirschs, um ihn am Boden zu halten. Dann zog er seinen dreigezähnten Dolch aus der Scheide an seinem Gürtel und hob ihn, bereit, ihn in die weiche Stelle im Nacken zu stoßen, um das Tier zu lähmen. Aber ehe er den Stoß ausführen konnte, begegnete ihm der Blick des Tiers. In den Augen des Hirschs sah Fahlauge sein Spiegelbild, so klar, als stünde er vor einem Spiegel. Eine seiner Hände reckte den Dreizahn in die Höhe. Die andere war nach unten ausgestreckt, in einer lockenden Geste, als habe er selbst den Hirsch gerufen. Das Bild, das Fahlauge sah, zeigte nicht ihn selbst. Es war ihr Bild – das seiner toten Göttin.
Wild und heiß durchtoste ihn die Macht der Erkenntnis.
Das war das Zeichen, und es war kristallklar. Fahlauge selbst war zu dem Gott geworden!
Und er begriff, was er zu tun hatte.
»Ich bin ein Schinder. Ich werde nicht töten. Ich werde mich laben, nicht morden. Ernten, nicht erlegen. So werde ich mein Volk wieder stark machen. Und meine Ernte wird zur Saat werden, sich ausbreiten, über die Stadt hinaus – über das Volk hinaus – in alle Welt!«
Er steckte das Messer zurück in die Scheide, zog aus dem Reisesack über seiner Schulter ein Stück Seil und band damit Vorder- und Hinterläufe des Hirschs zusammen. Als das Tier nicht mehr entkommen konnte, knüpfte er ihm ein zweites Seil um den Hals, befestigte das freie Ende am tief hängenden Ast einer jungen Kiefer und zog es so straff, dass das Tier mehr damit zu tun hatte, um Atem zu ringen, als damit, sich zu befreien.
Daraufhin zückte Fahlauge zum zweiten Mal seinen Dreizahn. Statt ihn gegen den Hirsch zu wenden, zog er ihn über seine eigene Haut, schnitt in die Risse um seine Gelenke, bis rötliche Flüssigkeit aus den Wunden trat. Erst dann begann er, dem lebenden Hirsch die Haut abzuziehen.