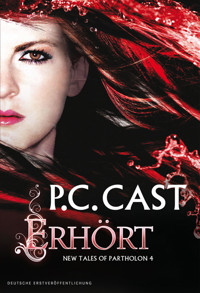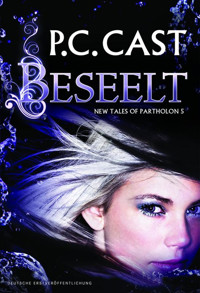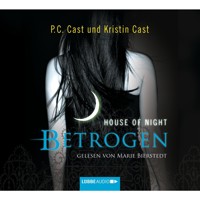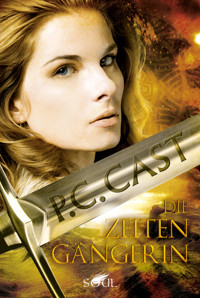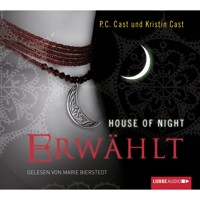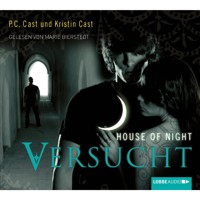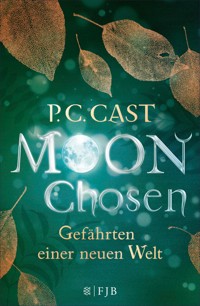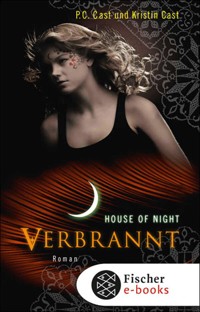
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: House of Night
- Sprache: Deutsch
Wenn Freunde sich nicht mehr vertrauen können, gewinnt das Böse die Oberhand Die Dinge stehen schlecht im House of Night. Zoeys Seele ist zerschmettert. Um sie herum ist alles zerstört, wofür sie je gekämpft hat. Und mit einem gebrochenen Herzen will sie lieber in der Schattenwelt bleiben. Stark scheint der Einzige zu sein, der zu ihr durchdringen könnte, doch dafür müsste er sterben. Und das würde Zoey umbringen. Doch auch Stevie Rae und Aphrodite könnten helfen, wenn sie nur wollten. Warum zögern sie? Ein Spiel mit dem Feuer, das alle verbrennen könnte… »Verbrannt« ist der siebte Band der House of Night-Serie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2011
Sammlungen
Ähnliche
P.C. Cast | Kristin Cast
Verbrannt/House of Night 7
Biografie
P.C. Cast und Kristin Cast sind das erfolgreichste Mutter-Tochter-Autoren-gespann weltweit. Sie leben beide in Oklahoma, USA. House of Night erscheint in über 40 Ländern und hat weltweit Millionen von Fans.
Impressum
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie nach einer Idee von Angela Goddard Coverabbildung: © Herman EstevezErschienen bei FJB, einem Unternehmen der S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am MainDie Originalausgabe erschien unter dem Titel »Burned A House of Night Novel«© 2010 by P.C.Cast and Kristin CastDieses Werk wurde im Auftrag von St. Martin’s Press LLC durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH,30827 Garbsen, vermittelt.Für die deutschsprachige Ausgabe:© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2011Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401059-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
P. C.: Dieser Band ist [...]
Danksagung
Eins
Kalona
Zwei
Rephaim
Drei
Stevie Rae
Vier
Aphrodite
Fünf
Zoey
Sechs
Stevie Rae
Stevie Rae
Stevie Rae
Sieben
Stevie Rae
Stevie Rae
Acht
Aphrodite
Neun
Stark
Stark
Zehn
Stark
Zoey
Elf
Stevie Rae
Zwölf
Stevie Rae
Dreizehn
Rephaim
Vierzehn
Stevie Rae
Fünfzehn
Stark
Stark
Sechzehn
Zoey
Stevie Rae
Siebzehn
Stevie Rae
Stevie Rae
Stevie Rae
Achtzehn
Rephaim
Neunzehn
Stark
Zwanzig
Stark
Stark
Einundzwanzig
Stevie Rae
Stevie Rae
Zweiundzwanzig
Stevie Rae
Dreiundzwanzig
Rephaim
Rephaim
Vierundzwanzig
Stark
Fünfundzwanzig
Aphrodite
Sechsundzwanzig
Stark
Siebenundzwanzig
Heath
Achtundzwanzig
Kalona
Stark
Neunundzwanzig
Zoey
Dreißig
Zoey
Einunddreißig
Stevie Rae
Zoey
Deckblatt
Eins
Neferet
Zwei
Neferet
Drei
Zoey
P. C.: Dieser Band ist meinem Wächter gewidmet. Ich liebe dich.
Kristin: (Sie meint dich, ›Shawnus‹.)
Danksagung
P. C.:
Dieses Buch hätte nicht geschrieben werden können, hätten nicht drei außergewöhnliche Männer ihre Lebensgeschichte und ihr Inneres mit mir geteilt. Seoras Wallace, Alain Mac au Halpine und Alan Torrance, ich bin euch zu tiefer Dankbarkeit verpflichtet. Alle eventuellen Fehler bei meiner fiktiven Darstellung eures schottisch-irischen Mythos sind allein mir zu verdanken. Krieger, ich danke euch. Außerdem: DANKE VIELMALS, Denise Torrance, für meine Rettung vor all dem Clan-Wallace-Testosteron!
Während meiner Recherchen auf der Isle of Skye war mein Hauptquartier das wunderhübsche Hotel Toravaig House. Vielen Dank an die Betreiber für den angenehmen Aufenthalt – nur gegen den Regen waren selbst sie machtlos!
Manchmal ziehe ich mich im letzten Stadium der Arbeit an einem Buch in meine ›Schreibhöhle‹ zurück, wie meine Freunde und Familie es nennen. So war es auch bei Verbrannt. Dank Paawan Arora vom Cayman Ritz Carlton sowie Heather Lockington und ihrem wunderbaren Team vom Cotton Tree Hotel (www.caymancottontree.com) war meine Isolationshaft mehr als erträglich! Vielen, vielen Dank, dass ihr mir dabei geholfen habt, mich auf Grand Cayman ganz zu Hause zu fühlen und mich vor der Welt zu verstecken, damit ich schreiben, schreiben, schreiben konnte.
Dieses Buch enthält ein paar gälische Worte. Ja, Gälisch ist extrem schwierig auszusprechen (ähnlich wie Cherokee) und es gibt Hunderte verschiedener Dialekte (ähnlich wie bei Cherokee). Mit Hilfe meines/r schottischen Experten habe ich hauptsächlich den historischen dalriadischen und Galloway-Dialekt verwendet, der an der schottischen Westküste und der irischen Nordostküste gesprochen wurde. Diese Sprachvariante wird gemeinhin als Gal-Gaelic oder GalGael bezeichnet. Jegliche Fehler und Irrtümer stammen von mir.
Kristin:
Danke an Coach Mark von Bootcamp Tulsa und dem Precision Body Art-Studio dafür, dass sie mich dabei unterstützt haben, mich stark, energiegeladen und schön zu fühlen.
Und vielen Dank an den Shawnus, dass er mir mal etwas Zeit zum Durchatmen verschafft hat!
Beide:
Wie immer ein Lob auf unser Team von St. Martin’s Press: Jennifer Weis, Matthew Shear, Anne Bensson, Anne Marie Tallberg; nicht zu vergessen das unglaubliche Designteam, das sich immer wieder mit phantastischen Coverideen überschlägt! WIR LIEBEN SMP!
Vielen Dank an MK Advertising für die genialen Websites www.pccast.net und www.houseofnightseries.com.
Wieder einmal gilt unsere Freundschaft und Dankbarkeit unserer wundervollen Agentin und Freundin Meredith Bernstein. Ohne sie gäbe es kein House of Night.
Und schließlich noch ein dickes Dankeschön an unsere treuen Fans. Ihr seid absolute Spitze!
Eins
Kalona
Kalona hob die Hände. Er zögerte nicht. In ihm war kein irgend gearteter Zweifel, was er zu tun hatte. Nichts und niemand hatte das Recht, ihm im Weg zu stehen, und dieser Menschenjunge stand zwischen ihm und dem, was er begehrte. Er wünschte dem Jungen nicht ausdrücklich den Tod; er wünschte ihm aber auch nicht das Leben. Es war eine Sache der Notwendigkeit. Er verspürte weder Reue noch Gewissensbisse. Wie eh und je, seit er gefallen war, spürte Kalona ziemlich wenig. Gleichgültig drehte der geflügelte Unsterbliche dem Jungen den Hals um und setzte dessen Leben ein Ende.
»Nein!«
In dem Wort allein steckte solche Panik, dass Kalona das Herz gefror. Er ließ den leblosen Körper des Jungen fallen und wirbelte herum, gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie Zoey auf ihn zustürmte. Ihre Blicke trafen sich. In dem ihren sah er verzweifelten Unglauben. Er versuchte, Worte zu finden, mit deren Hilfe sie es begreifen könnte – mit deren Hilfe sie ihm vielleicht vergeben würde. Aber nichts, was er sagte, hätte ungeschehen machen können, was sie gesehen hatte, und selbst wenn er das Unmögliche hätte möglich machen können, es blieb keine Zeit dazu.
Zoey schmetterte ihm die geballte Macht des Elements Geist entgegen.
Es traf den Unsterblichen mit einer Kraft, die über das rein physische Maß hinausging. Geist war seine Essenz, sein Kern, das Element, das ihn jahrhundertelang genährt hatte, mit dem er am vertrautesten war und das ihm die größte Macht verlieh. Zoeys Angriff durchbohrte ihn wie ein gleißender Pfeil und schleuderte ihn mit solcher Kraft in die Luft, dass er über die hohe Mauer geworfen wurde, die die Insel der Vampyre vom Golf von Venedig trennte. Eisiges Wasser schlug über ihm zusammen, erstickte ihn. Einen Augenblick lang war der Schmerz so betäubend, dass Kalona nicht dagegen ankämpfte. Vielleicht sollte er diesem aufreibenden Kampf um das Leben mit all seinem Drum und Dran ein Ende setzen. Vielleicht sollte er sich wie schon einmal von ihr besiegen lassen. Aber kaum kam ihm der Gedanke, da spürte er es. Zoeys Seele zerbarst – und so sicher wie sein Fall ihn von einer Welt in eine andere gebracht hatte, verließ ihr Geist das Reich des Diesseits.
Diese Erkenntnis traf ihn viel bitterer als ihr Angriff.
Nicht Zoey! Ihr hatte er nie ein Leid zufügen wollen. Durch alle Intrigen Neferets hindurch, im Angesicht aller Pläne und Machenschaften der Tsi Sgili hatte er sich an dem Wissen festgeklammert, dass er, komme, was wolle, seine enorme Macht als Unsterblicher einsetzen würde, um Zoey zu beschützen, denn schlussendlich war sie das, was in dieser Welt Nyx am nächsten kam – und diese Welt war die einzige, die ihm geblieben war.
Er kämpfte nun doch gegen Zoeys Angriff an. Während er seinen muskulösen Körper der Umklammerung der Wellen entwand, erfasste er schlagartig die ganze Wahrheit. Seinetwegen war Zoeys Geist entflohen, und das bedeutete, sie würde sterben. Mit seinem ersten Atemzug stieß er einen wilden Schrei der Verzweiflung aus, der ein Echo ihres letzten Wortes zu sein schien: »Nein!«
Hatte er wirklich geglaubt, er könnte seit seinem Fall keine richtigen Gefühle mehr entwickeln? Ein Narr war er gewesen, sich so unglaublich zu irren! Während er schlingernd dicht über der Wasseroberfläche dahinflog, tobten Gefühle in ihm, kratzten an seinem bereits verwundeten Geist, wüteten gegen ihn, schwächten ihn, brachten seine Seele zum Bluten. Sein Blick verschwamm und drohte, sich zu verfinstern. Er kniff die Augen zusammen, um am Rande der Lagune die Lichter erkennen zu können, die Land verhießen. Dorthin würde er es niemals schaffen. Er hatte keine Wahl – ihm blieb nur der Palast. Er nahm seine letzten Kraftreserven zusammen und schraubte sich durch die eisige Luft höher, bis er die Mauer überwinden konnte. Dahinter brach er auf der eisigen Erde zusammen.
Er wusste nicht, wie lange er dort in der kalten, friedlosen Finsternis lag und in seiner erschütterten Seele der Aufruhr tobte. Irgendwo weit hinten in seinem Verstand begriff er, dass das, was ihm zugestoßen war, nichts Unvertrautes war. Er war wieder einmal gefallen – diesmal eher geistig denn körperlich, obgleich auch sein Körper ihm nicht mehr zu gehorchen schien.
Schon ehe sie sprach, war er sich ihrer Gegenwart bewusst. So war es von Anfang an zwischen ihnen gewesen, ob er es sich wirklich gewünscht hatte oder nicht. Sie waren schlicht in der Lage, einander wahrzunehmen.
»Du hast zugelassen, dass Stark Zeuge wurde, wie du den Jungen getötet hast!« Neferets Ton war noch eisiger als das winterliche Meer.
Kalona drehte den Kopf, um mehr von ihr sehen zu können als nur das Vorderteil ihres Stilettostiefels, und er blinzelte, weil sein Blick noch immer benebelt war. Seine Stimme war ein tonloses Krächzen. »Unglücklicher Zufall. Zoey hätte nicht da sein dürfen.«
»Unglückliche Zufälle darf es nicht geben. Und dass sie da war, interessiert mich nicht. Tatsächlich kommt uns das Ergebnis dessen, was sie gesehen hat, sehr gelegen.«
»Du weißt, dass ihre Seele zersprungen ist?« Die Wirkung, die Neferets eisige Schönheit auf ihn hatte, war Kalona noch verhasster als die unnatürliche Schwäche seiner Stimme und die merkwürdige Lethargie seines Körpers.
»Ich würde sagen, die meisten Vampyre auf der Insel dürften es wissen. Wie bei Zoey üblich, war ihr Geist nicht gerade diskret darin, sich zu verabschieden.« Sie tippte sich nachdenklich mit dem langen scharfen Fingernagel ans Kinn. »Ich frage mich allerdings, wie viele der Vampyre gespürt haben, welch einen Schlag dir das Gör noch in allerletzter Sekunde verpasst hat.«
Kalona schwieg. Er bemühte sich mit aller Kraft, die zerfaserten Enden seines aufgeriebenen Geistes wieder zu festigen, aber die Präsenz der Erde, auf der sein Körper lag, war zu erdrückend, und ihm fehlte die Kraft, sich geistig nach oben zu recken und seine Seele aus den flüchtigen Fragmenten der Anderwelt zu nähren, die dort drifteten.
»Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand von ihnen gespürt hat«, fuhr Neferet in kühlem, berechnendem Ton fort. »Niemand von ihnen ist der Finsternis – dir – so tief verbunden wie ich. Ist das nicht so, mein Geliebter?«
»Unsere Verbindung ist einzigartig«, gelang es Kalona zu krächzen, doch plötzlich wünschte er, die Worte wären nicht wahr.
»In der Tat …« Sie schien noch immer in Gedanken versunken. Dann weiteten sich ihre Augen in einer neuen Erkenntnis. »Ich habe mich schon lange gefragt, wie es A-ya gelungen ist, dich, einen körperlich so starken Unsterblichen, derart zu verwunden, dass diese lächerlichen Cherokee-Hexen dich in die Falle locken konnten. Ich denke, die kleine Zoey hat mir gerade die Antwort geliefert, die du so sorgfältig vor mir verborgen hieltest. Dein Körper kann sehr wohl beschädigt werden – aber nur durch deinen Geist. Ist das nicht faszinierend?«
»Das wird wieder heilen.« Er legte so viel Kraft wie möglich in seine Stimme. »Bring mich nach Capri auf unsere Festung, aufs Dach, dem Himmel so nahe wie möglich, dann werde ich wieder zu Kräften kommen.«
»Das würdest du sicherlich – wenn ich die Absicht hätte, es zu tun. Aber ich habe andere Pläne, Geliebter.« Neferet reckte die Arme über ihn. Während sie weitersprach, woben ihre langen Finger komplizierte Muster in die Luft, wie bei einer Spinne, die ihr Netz spann. »Ich werde nicht zulassen, dass sich Zoey jemals wieder in unsere Angelegenheiten mischt.«
»Eine zerborstene Seele ist ein Todesurteil. Zoey stellt keinerlei Gefahr mehr für uns dar«, sagte er und folgte mit den Augen Neferets Bewegungen. Sie sammelte eine klebrige Finsternis um sich, die er nur zu gut kannte. Er hatte viele Menschenleben damit verbracht, diese Finsternis zu bekämpfen, um sich schließlich ihrer kalten Macht zu ergeben. Vertraut und rastlos pulsierte sie unter Neferets Fingern. Wie das Echo eines Todesstoßes schallte ein Gedanke durch seinen matten Geist: Sie sollte nicht in der Lage sein, die Finsternis so offenkundig zu beherrschen. Über solche Macht sollte eine Hohepriesterin nicht verfügen.
Aber Neferet war nicht mehr nur eine Hohepriesterin. Vor einiger Zeit hatte sie die Grenzen jenes Daseins überschritten, und es bereitete ihr keine Mühe, die sich windende Schwärze unter Kontrolle zu halten.
Sie ist auf dem besten Weg, unsterblich zu werden, erkannte Kalona, und mit dieser Erkenntnis gesellte sich ein weiteres Gefühl zu der Reue, Verzweiflung und Wut, die bereits in dem gefallenen Krieger der Nyx wühlten: Angst.
»Ja, man sollte denken, es sei ein Todesurteil«, sagte Neferet ruhig, während sie mehr und mehr der tintigen Stränge zu sich zog, »aber Zoey hat die schrecklich lästige Angewohnheit zu überleben. Diesmal will ich ganz sichergehen, dass sie stirbt.«
»Zoeys Seele hat aber auch die Angewohnheit, wiedergeboren zu werden«, sagte er, in der Hoffnung, Neferet würde den Köder schlucken und sich ablenken lassen.
»Dann werde ich sie jedes Mal aufs Neue vernichten!« Durch den Zorn, den seine Worte bei ihr auslösten, verstärkte sich ihre Konzentration nur noch. Die Schwärze, die sie spann, verdichtete sich und wand sich in der Luft, aufgebläht vor Macht.
»Neferet.« Er versuchte, zu ihr durchzudringen, indem er ihren Namen aussprach. »Ist dir eigentlich gänzlich bewusst, was du da zu beherrschen versuchst?«
Sie sah ihn an, und zum ersten Mal bemerkte Kalona den leichten Hauch von Scharlachrot in ihren dunklen Augen. »Natürlich ist mir das bewusst. Es ist, was geringere Wesen das Böse nennen.«
»Ich bin kein geringeres Wesen, doch auch ich habe es das Böse genannt.«
»Oh, aber schon seit Jahrhunderten nicht mehr.« Sie lachte grausam. »Mir scheint allerdings, in letzter Zeit hast du dich zu sehr mit den Schatten deiner Vergangenheit beschäftigt, statt in der herrlichen dunklen Macht der Gegenwart zu schwelgen. Ich weiß, wer die Schuld daran trägt.«
Mit immenser Anstrengung stemmte Kalona sich ins Sitzen.
»Nein, ich wünsche nicht, dass du dich bewegst.« Neferet schnippte mit den Fingern, und ein Strang aus Finsternis schlang sich um seinen Hals, zog sich zusammen, riss ihn wieder zu Boden und hielt ihn dort gefesselt.
»Was willst du von mir?«, keuchte er.
»Ich will, dass du Zoeys Geist in die Anderwelt folgst und dafür sorgst, dass keiner ihrer Freunde« – sie sprach das Wort voller Hohn aus – »einen Weg findet, ihn wieder zurück in ihren Körper zu locken.«
Den Unsterblichen durchfuhr ein Schock. »Nyx hat mich aus der Anderwelt verbannt. Ich kann Zoey nicht dorthin folgen.«
»Oh, du irrst dich, mein Geliebter. Schau, du denkst stets zu wörtlich. Seit Jahrhunderten ist für dich beschlossene Sache: Nyx hat dich verstoßen – du bist gefallen – du kannst niemals zurück. Nun, wörtlich betrachtet kannst du es tatsächlich nicht.« Als er sie ratlos ansah, seufzte sie dramatisch. »Dein prächtiger Körper wurde verbannt, mehr nicht. Hat Nyx irgendetwas über deine unsterbliche Seele gesagt?«
»Das war nicht notwendig. Wenn eine Seele zu lange von ihrem Körper getrennt ist, stirbt dieser.«
»Aber dein Körper ist nicht sterblich, das heißt, er und deine Seele können gefahrlos unendlich lange getrennt sein.«
Kalona gab sich alle Mühe, das Entsetzen, das bei ihren Worten in ihm aufkam, nicht nach außen hin zu zeigen. »Sicher, ich kann nicht sterben, aber das bedeutet nicht, dass ich keinen Schaden davontragen würde, wenn meine Seele meinen Körper zu lange verließe.« Verschiedene Möglichkeiten wirbelten ihm durch den Geist. Ich könnte altern … dem Wahnsinn verfallen … auf ewig zu einer leeren Hülle meiner selbst werden …
Neferet zuckte mit den Schultern. »Dann wirst du dich bei deiner Aufgabe beeilen müssen, damit du in deinen wunderschönen unsterblichen Körper zurückkehren kannst, ehe er unwiderruflichen Schaden davonträgt.« Verführerisch lächelte sie ihn an. »Ich würde es zutiefst bedauern, wenn deinem Körper etwas zustieße, Geliebter.«
»Tu das nicht, Neferet. Du setzt Dinge in Gang, die einen Preis haben, und nicht einmal du wirst diese Art von Preis gerne zahlen.«
»Du wirst mir nicht drohen! Ich habe dich aus der Gefangenschaft befreit. Ich habe dich geliebt. Und dann habe ich mit ansehen müssen, wie du dieser einfältigen Halbwüchsigen hinterherhechelst. Ich will, dass sie aus meinem Leben verschwindet! Preis? Mit Freuden werde ich ihn zahlen! Ich bin nicht mehr die schwache, machtlose Hohepriesterin einer dogmatischen, betulichen Göttin. Verstehst du das nicht? Hättest du dich nicht von diesem Kind ablenken lassen, dann hättest du es erkannt, ohne dass ich es dir sagen muss. Ich bin eine Unsterbliche, genau wie du, Kalona!« Etwas Schauriges, Machtvolles ließ ihre Stimme anschwellen. »Wir sind ein perfektes Paar. Auch du hast das einmal geglaubt, und du wirst wieder zu diesem Glauben zurückfinden, wenn es keine Zoey Redbird mehr gibt.«
Kalona starrte sie an und begriff: Neferet war wahrhaftig, unwiderruflich wahnsinnig. Er fragte sich, warum dieser Wahnsinn ihre Macht und Schönheit nur zu vermehren schien.
»Also, hier ist, was ich beschlossen habe.« Nüchtern und methodisch setzte sie es ihm auseinander. »Ich werde deinen traumhaften, unsterblichen Körper irgendwo unter der Erde sicher verwahren, und währenddessen wird deine Seele in die Anderwelt reisen und dafür sorgen, dass Zoey niemals wieder hierher zurückkehrt.«
»Das wird Nyx niemals zulassen!«, entfuhr es ihm unwillkürlich.
»Nyx gewährt grundsätzlich jedem den freien Willen. Als ihre ehemalige Hohepriesterin hege ich nicht den geringsten Zweifel daran, dass sie dir erlauben wird, im Geiste in die Anderwelt zu reisen«, erklärte Neferet listig. »Denk daran, Kalona, meine wahre Liebe, indem du für Zoeys Tod sorgst, wirst du das letzte Hindernis aus dem Weg räumen, das uns davon abhält, Seite an Seite zu herrschen. Du und ich werden in dieser Welt der modernen Wunder unvorstellbar mächtig sein. Male es dir aus – wir werden uns die Menschen untertan machen und die Herrschaft der Vampyre zurückbringen, in all ihrer Schönheit, Leidenschaft und uneingeschränkten Macht. Die Erde wird unser sein. Wahrlich, wir werden der goldenen Vergangenheit neues Leben einhauchen!«
Kalona war klar, dass sie mit seinen Schwächen spielte. Im Stillen verwünschte er sich dafür, ihr so tiefen Einblick in seine tiefsten Begierden gegeben zu haben. Er hatte sich ihr anvertraut. Daher wusste Neferet, dass er, da er nicht Erebos war, niemals an Nyx’ Seite in der Anderwelt hätte herrschen können und von dem Wunsch verzehrt wurde, hier, in dieser technisierten Welt, so viel wie möglich von dem, was er verloren hatte, nachzubilden.
»Du siehst, mein Geliebter, logisch betrachtet ist es nur recht und billig, wenn du Zoey folgst und das Band zwischen ihrem Körper und ihrer Seele durchtrennst. Es ist nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Erfüllung deiner größten Wünsche«, sagte sie im Plauderton, als sprächen sie lediglich über die Wahl des Stoffes für ihr neuestes Kleid.
Er versuchte, den gleichen ungezwungenen Ton anzuschlagen. »Wie soll ich Zoeys Seele denn finden? Die Anderwelt ist von solch unermesslicher Größe, dass nur die Götter und Göttinnen in der Lage sind, sie ganz zu durchqueren.«
Die Milde in Neferets Blick wich einer Ungeduld, durch die ihre grausame Schönheit schrecklich anzusehen war. »Wage nicht zu behaupten, du hättest keine Verbindung zu ihrer Seele!« Nach einem tiefen Atemzug fuhr die Tsi Sgili ruhiger fort: »Gib es zu, mein Geliebter: Du könntest Zoey immer finden, selbst wenn es niemand sonst könnte. Was wählst du, Kalona? An meiner Seite über die Erde zu herrschen oder ein Sklave deiner Vergangenheit zu bleiben?«
»Ich wähle es zu herrschen. Ich werde immer die Wahl treffen zu herrschen«, sagte er ohne Zögern.
Bei seinen Worten veränderten sich Neferets Augen. Das Grün darin wurde vollkommen von Scharlachrot verschluckt. Sie richtete die glühenden Augäpfel auf ihn – und er war gefesselt, verzaubert, gelähmt. »Dann höre mich an, Kalona, Gefallener Krieger der Nyx. Ich schwöre dir hiermit einen Eid, dass ich deinen Körper beschützen werde. Und wenn Zoey Redbird, Jungvampyrin und Hohepriesterin der Nyx, nicht mehr ist, so werde ich, das schwöre ich dir, diese dunklen Ketten lösen und deinem Geist erlauben zurückzukehren. Dann werde ich dich auf das Dach unserer Festung in Capri bringen, dann mag der Himmel dir wieder Kraft und Leben einhauchen, und du wirst dieses Reich an meiner Seite regieren, als mein Gefährte, mein Beschützer, mein Erebos.« Hilflos, unfähig, sie aufzuhalten, musste Kalona zusehen, wie sie einen langen, spitzen Fingernagel über ihre rechte Handfläche führte. Das austretende Blut hob sie in der hohlen Hand empor wie ein Opfer. »Dies Blut gibt mir die Macht; dies Blut bindet den Eid.« Überall um sie herum regte sich Finsternis, stieß auf ihre Handfläche nieder, wand sich, pulsierte und trank. Kalona spürte die Verlockung, die von der Finsternis ausging. Ihr machtvolles, verführerisches Wispern sprach zu seiner Seele.
»Ja!« Mit einem Aufstöhnen, das sich den Tiefen seiner Kehle entrang, gab sich Kalona der gierigen Finsternis hin.
Als Neferet weitersprach, war ihre Stimme nochmals angeschwollen, von Macht gesättigt. »Aus deiner eigenen Wahl heraus habe ich diesen Eid auf die Finsternis mit Blut besiegelt, doch solltest du versagen und ihn brechen –«
»Ich werde nicht versagen.«
Die Schönheit ihres Lächelns war nicht von dieser Welt; in ihren Augen wallte Blut. »Solltest du, Kalona, Gefallener Krieger der Nyx, diesen Eid brechen und darin versagen, Zoey Redbird, Jungvampyrin und Hohepriesterin der Nyx, zu vernichten, so wird dein Geist mir untertan sein, solange du ein Unsterblicher bist.«
Ohne dass er danach suchen musste, flog ihm die korrekte Antwort zu, eingeflüstert durch die verführerische Finsternis, die er jahrhundertelang gegen das Licht eingetauscht hatte. »Sollte ich versagen, so wird mein Geist dir untertan sein, solange ich ein Unsterblicher bin.«
»Also schwöre ich.« Noch einmal schnitt sich Neferet in die Handfläche und schuf so ein blutiges X. Wie Rauch von einem Feuer wehte der metallene Geruch zu ihm hin, als sie der Finsternis wieder ihre Hand darbot. »Also sei es!« Neferets Gesicht verzog sich vor Schmerz, als die Finsternis wieder von ihr trank, aber sie zuckte nicht zusammen. Sie blieb vollkommen reglos, bis die Luft um sie herum gesättigt waberte, wie aufgedunsen von ihrem Blut und ihrem Schwur.
Erst dann senkte sie die Hand. Ihre Zunge glitt aus ihrem Mund, leckte über die scharlachroten Linien und beendete die Blutung. Schließlich trat sie vor ihn hin, beugte sich herunter und legte ihm sanft die Hände um beide Wangen, ganz ähnlich wie er es bei dem Menschenjungen getan hatte, ehe er diesem den Tod gegeben hatte. Er konnte die Finsternis um sie förmlich mit den Hufen scharren hören wie einen wütenden Stier, der ungeduldig auf den Befehl seiner Herrin wartet.
Ihre blutroten Lippen näherten sich den seinen, hielten jedoch inne, ohne sie zu berühren. »Bei der Macht, die mein Blut durchströmt, und bei der Kraft der Leben, die ich genommen habe, befehle ich euch, meine feinen Fühler der Finsternis, zieht die Seele dieses eidgebundenen Unsterblichen aus seinem Körper und sendet sie eilig hinfort in die Anderwelt. Geht und tut wie befohlen, und ich verspreche euch ein unschuldiges Leben, das noch nicht durch euch getrübt wurde. Sei du mir treu, das Werk gedeih!«
Neferet holte tief Atem, und Kalona sah, wie die dunklen Fäden, die sie gerufen hatte, zwischen ihren vollen roten Lippen wimmelten. Sie atmete Finsternis ein, bis sie davon anschwoll, und dann legte sie ihren Mund auf seinen und blies ihm die Schwärze in einem finsteren, blutbefleckten Kuss mit solcher Kraft ein, dass seine bereits verwundete Seele von seinem Körper losgerissen wurde. Schreiend in lautloser Qual wurde Kalona nach oben geschleudert, immer höher und höher, in das Reich, aus dem seine Göttin ihn verbannt hatte, während sein Körper zurückblieb – leblos, gefesselt, durch Eid an das Böse gebunden und Neferet auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.
Zwei
Rephaim
Der Klang der Trommel war wie der Herzschlag eines Unsterblichen: stetig, packend, überwältigend. Im Takt seines strömenden Blutes dröhnte sie durch Rephaims Seele. Dann gesellten sich im Rhythmus der Trommelschläge die uralten Worte hinzu, legten sich um seinen Körper, bis noch im Schlaf sein Puls gänzlich mit der alterslosen Melodie verschmolz.
Uralter Schlaf, erwarte dein Erwachen,
wenn Erdenmacht vergießet heilig Blut.
Was Königin Tsi Sgili sann – das Mal getroffen –
spült ihn nun aus dem Grab, wo er geruht,
sangen die Frauenstimmen in seinem Traum. Verführerisch kreiste das Lied wie ein Labyrinth, weiter und weiter.
Durch Hand der Toten wird er sich befreien,
grausame Schönheit, schreckliche Gestalt,
und beugen werden Weiber sich von neuem
ihm, der regiert mit finsterer Gewalt.
Die Musik war eine geflüsterte Verlockung. Ein Versprechen. Eine Gnade. Ein Fluch. Die Erinnerung daran, was sie vorhersagte, säte Unruhe in Rephaims schlafenden Körper. Er zuckte mit den Gliedern und murmelte wie ein verlassenes Kind: »Vater?«
Die Melodie schloss mit dem Reim, der sich Rephaim vor Jahrhunderten ins Gedächtnis eingebrannt hatte:
Süß klingt und mächtig Kalonas Weise –
Wir reißen die Beute mit glühendem Eise.
»… mit glühendem Eise.« Selbst im Schlaf reagierte Rephaim auf die Worte. Er erwachte nicht, aber sein Herzschlag beschleunigte sich, seine Hände ballten sich zu Fäusten, sein Körper spannte sich an. Auf dem schmalen Grat zwischen Schlaf und Wachen stolperte der Trommelschlag plötzlich, versiegte, und die leisen Stimmen der Frauen wurden von einer anderen verdrängt, männlich, tief und nur zu vertraut.
»Verräter … Feigling … Betrüger … Lügner!« Die Worte waren Urteil, Verdammnis. Ihr wütender Strom fraß sich in Rephaims Traum und riss ihn gewaltsam in die Wirklichkeit.
»Vater!« Mit einem Ruck setzte Rephaim sich auf und warf dabei die alten Zeitungen und Pappstücke ab, aus denen er sich ein Nest gebaut hatte. »Vater, bist du hier?«
Aus dem Augenwinkel nahm er eine flirrende Bewegung wahr und schnellte vorwärts, um aus dem mit Zedernholz ausgekleideten Wandschrank nach draußen zu spähen, wobei er sich den verletzten Flügel schmerzhaft stauchte.
»Vater?«
Im Herzen wusste er, dass Kalona nicht da war, noch bevor der lichte Schimmer die Gestalt eines Kindes annahm.
»Was bist du?«
Rephaim richtete seinen brennenden Blick auf das kleine Mädchen. »Hinweg mit dir, Spuk.«
Statt zu verblassen, wie es angebracht gewesen wäre, kniff das Kind die Augen zusammen und musterte ihn sichtlich neugierig. »Du hast Flügel, aber du bist kein Vogel. Und du hast Arme und Beine, aber du bist kein Junge. Und deine Augen sind auch wie bei einem Jungen, nur rot. Also, was bist du?«
In Rephaim wallte Zorn auf. Wie der Blitz sprang er aus dem Wandschrank, was in seinem Körper ein gleißendes Feuerwerk aus Schmerz auslöste, und landete ein, zwei Schritte vor dem Gespenst – ein Raubtier, gefährlich und zu allem bereit.
»Ich bin ein lebendig gewordener Albtraum, Geist! Geh und lass mich in Frieden, ehe du erkennen musst, dass es weit schlimmere Dinge zu fürchten gibt als den Tod!«
Bei seinem Sprung war das Geisterkind einen kleinen Schritt zurückgewichen, bis es mit der Schulter an die Scheibe des tiefliegenden Fensters stieß. Dort aber blieb es stehen und betrachtete ihn weiter mit neugierigem, klugem Blick.
»Du hast im Schlaf nach deinem Vater geschrien. Ich hab dich gehört. Mich täuschst du nicht. Ich bin ganz schön schlau, und ich kann mich an Sachen erinnern. Außerdem jagst du mir keine Angst ein, weil du in Wahrheit doch nur verletzt und allein bist.«
Und der Geist des kleinen Mädchens kreuzte trotzig die Arme vor der schmalen Brust, warf das lange blonde Haar zurück und verschwand. Rephaim blieb zurück, genau wie sie gesagt hatte: verletzt und allein.
Er lockerte die Fäuste. Sein Herzschlag beruhigte sich. Schwerfällig stolperte er in sein improvisiertes Nest zurück und ließ den Kopf gegen die Wand sinken.
»Jämmerlich«, murmelte er. »Der Lieblingssohn eines uralten Unsterblichen muss sich unter Müll und Lumpen verstecken und mit einem menschlichen Kindergespenst herumärgern.« Er versuchte zu lachen, aber es gelang ihm nicht. Zu laut war noch das Echo der Musik aus seinem Traum, aus seiner Vergangenheit. Und das jener anderen Stimme – derjenigen, von der er geschworen hätte, dass sie seinem Vater gehörte.
Er konnte nicht mehr stillsitzen. Ohne sich um den Schmerz in seinem Arm und die dumpfe Qual zu kümmern, aus der sein Flügel zu bestehen schien, stand Rephaim auf. Er hasste die Schwäche, die von seinem Körper Besitz ergriffen hatte. Wie lange war er schon hier, verwundet, erschöpft von seiner Flucht aus dem Bahnhof, eingezwängt in diesen Kasten in einer Wand? Er konnte sich nicht erinnern. War ein Tag vergangen? Oder zwei?
Wo war sie? Sie hatte gesagt, sie werde in der Nacht zu ihm kommen. Doch hier war er, an dem Ort, wohin sie ihn gesandt hatte, und es war Nacht, doch Stevie Rae kam nicht.
Er stieß einen bitteren Laut aus, verließ sein Nest im Wandschrank und ging an dem Fenster, vor dem sich das kleine Mädchen materialisiert hatte, vorbei zu einer Tür, die auf eine Dachterrasse führte. Instinktiv war er, als er kurz nach Sonnenaufgang hier angelangt war, nach oben in den ersten Stock gestiegen. Zu dieser Zeit waren selbst seine gewaltigen Kräfte aufgezehrt gewesen, und er hatte sich einzig nach Sicherheit und Schlaf gesehnt.
Jetzt war er nur zu wach.
Er blickte auf das verlassene Museumsgelände hinunter. Das Eis, das tagelang vom Himmel gefallen war, war versiegt, aber überall an den hohen Bäumen, mit denen die sanften Hügel rund um das Gilcrease-Museum und das heruntergekommene Haus bepflanzt waren, sah man gesplitterte oder niedergebogene Äste. Mit seiner hervorragenden Nachtsicht konnte Rephaim nicht die kleinste Bewegung wahrnehmen. Die Wohnhäuser zwischen dem Museum und dem Zentrum von Tulsa waren fast genauso dunkel wie auf seiner frühmorgendlichen Wanderung. Verstreut in der Landschaft blinkten kleine Lichter – nicht der gewaltige, strahlende elektrische Lichterreigen, den Rephaim erfahrungsgemäß mit modernen Städten verband. Es waren schwache, flackernde Kerzen, nichts verglichen mit der Fülle an Macht, die diese Welt zu entfalten in der Lage war.
Natürlich lag darin nichts Geheimnisvolles. Wie die Äste und Zweige der Bäume waren auch die Leitungen, die Strom in die Häuser der modernen Menschen brachten, unter dem Eis zusammengebrochen. Rephaim war klar, dass das für ihn von Vorteil war. Auf den Straßen lagen außer einigen abgebrochenen Ästen und etwas Müll keine großen Hindernisse, und wäre nicht die große elektrische Maschine ausgefallen, hätte das Alltagsleben in der Stadt wieder begonnen, und Menschen wären in das Museum geströmt.
»Die fehlende Elektrizität hält die Menschen von hier fern«, murmelte er. »Aber was hält sie fern?«
Mit einem Schrei purer Frustration zerrte Rephaim die baufällige Tür auf. Seine aufgewühlten Nerven verlangten nach der Freiheit des offenen Himmels. Die Luft war kühl und schwer von Feuchtigkeit. Tief über dem Wintergras hingen Nebelschwaden wie unbewegliche Wellen, als scheute die Erde seinen Blick.
Rephaim richtete die Augen nach oben und holte tief und zitternd Luft, versuchte den Himmel einzuatmen. Gegen die verdunkelte Stadt wirkte dieser unnatürlich hell. Die Sterne und die scharf geschnittene Sichel des abnehmenden Mondes schienen ihm zuzublinzeln.
Mit jeder Faser seines Leibes sehnte er sich nach dem Himmel. Er wollte ihn unter den Schwingen spüren, wollte mit seinem schwarzgefiederten Körper darin aufgehen, wollte von ihm liebkost werden wie von der Mutter, die er nie gekannt hatte.
Sein unverletzter Flügel entfaltete sich in seiner ganzen übermannslangen Pracht. Sein anderer Flügel bebte, und mit einem qualvollen Stöhnen wich die Nachtluft aus Rephaims Lungen.
Verkrüppelt!, bohrte es sich ihm weißglühend in die Seele.
»Nein. Noch steht es nicht fest.« Er sprach es laut aus und schüttelte den Kopf, um die ungewohnte Mattigkeit zu verscheuchen, derentwegen er sich zunehmend hilflos fühlte – zunehmend beschädigt. »Konzentration!«, ermahnte er sich. »Es wird Zeit, dass ich Vater finde.« Noch war er alles andere als gesund, aber sein Geist war trotz der Mattigkeit klarer als bisher nach seinem Fall. Er musste in der Lage sein, wenigstens eine Spur seines Vaters zu erspüren. Mochten auch noch so viel Zeit und Raum zwischen ihnen liegen, sie waren durch Blut und Geist und vor allem durch das Geschenk der Unsterblichkeit, Rephaims Geburtsrecht, miteinander verbunden.
Er blickte zum Himmel auf und dachte an die Aufwinde, in denen er so heimisch war. Mit einem tiefen Atemzug hob er den unverletzten Arm und streckte die Hand nach den flüchtigen Strömungen und Schatten dunkler anderweltlicher Magie aus, die träge dort oben wallten. »Lasst mich etwas von ihm spüren!«, richtete er flehend seine Bitte an die Nacht.
Einen Augenblick lang glaubte er, weit, weit im Osten das Flackern eines Echos zu verspüren. Dann legte sich wieder die Mattigkeit über ihn. Frustriert und ungewohnt erschöpft, ließ er den Arm sinken. »Warum kann ich dich nicht spüren, Vater?«
Ungewohnte Mattigkeit …
»Bei allen Göttern!« Plötzlich begriff Rephaim, was ihm die Kraft geraubt und ihn als erbärmlichen Schatten seiner selbst zurückgelassen hatte. Und er wusste, weshalb er nicht spüren konnte, wohin sein Vater entschwunden war. »Das war sie.« Hart klang seine Stimme, und seine Augen loderten scharlachrot.
Sicher, er war schwer verwundet worden, aber er war der Sohn eines Unsterblichen. Schon längst hätte der Heilungsprozess beginnen müssen. Zweimal hatte er geschlafen, seit der Krieger ihn vom Himmel geschossen hatte. Sein Geist war wieder licht. Auch seinen Körper hätte der Schlaf beleben müssen. Selbst wenn, wie er befürchtete, sein Flügel dauerhaft geschädigt war, hätten seine übrigen Wunden merkliche Fortschritte machen müssen. Er hätte längst wieder zu Kräften gekommen sein müssen.
Aber die Rote hatte sein Blut getrunken, hatte ihm eine Prägung auferlegt. Und dies hatte das Gleichgewicht unsterblicher Kraft in ihm geschädigt.
In seine Frustration mischte sich Wut.
Sie hatte ihn nur benutzt und dann verlassen.
Genau wie Vater.
»Nein!«, widersprach er sofort. Sein Vater war von der Jungvampyr-Hohepriesterin vertrieben worden. Sobald er konnte, würde er zurückkehren, und dann würde Rephaim ihm wieder zur Seite stehen. Die Rote aber hatte ihn nur benutzt und dann achtlos weggeworfen.
Warum löste der bloße Gedanke daran einen solch sonderbaren Schmerz in ihm aus? Er schob das Gefühl weg und hob den Blick in den vertrauten Himmel. Er hatte diese Prägung nicht gewollt. Er hatte Stevie Rae allein deshalb gerettet, weil er ihr ein Leben schuldete und nur zu gut wusste, dass in einer unbezahlten Lebensschuld eine Macht lag, die eine der größten Gefahren dieser wie auch der nächsten Welt darstellte.
Nun, sie hatte ihn gerettet – ihn gefunden, versteckt und dann ziehen lassen – doch auf dem Dach des Bahnhofs hatte er ihr die Schuld zurückgezahlt, indem er sie vor dem sicheren Tod gerettet hatte. Sie waren quitt. Rephaim war kein schwacher Menschenmann, sondern der Sohn eines Unsterblichen. Es bestand kaum ein Zweifel, dass er diese Prägung – diese lächerliche Nebenwirkung dessen, dass er Stevie Rae das Leben gerettet hatte – brechen konnte. Er würde all seine verbliebene Kraft dazu aufwenden, sie fortzuwünschen. Und dann würde er wahrhaft anfangen können zu heilen.
Wieder ließ er die Nacht in sich einströmen. Ohne sich um die Mattigkeit seines Körpers zu kümmern, richtete Rephaim all seine Willenskraft auf sein Ziel.
»Wie es mein angestammtes Recht ist, rufe ich die Geistesmacht der uralten Unsterblichen zu mir, um zu brechen, was –«
Wie eine Flutwelle schlugen Entsetzen und Verzweiflung über ihm zusammen. Rephaim taumelte rücklings gegen das Balkongeländer. Überwältigende Traurigkeit drang mit solcher Gewalt in jede Faser seines Körpers, dass er in die Knie brach. So verharrte er, keuchend vor Schmerz und Grauen.
Was geschieht mit mir?
Dann breitete sich eine seltsam fremde Angst in ihm aus, und Rephaim begann zu verstehen.
»Das sind nicht meine Gefühle«, redete er sich zu, während er versuchte, in dem Strudel der Verzweiflung die Orientierung wiederzufinden. »Sondern ihre.«
Im Gefolge der Angst überrollte ihn Mutlosigkeit. Mit einem scharfen Atemzug versuchte er, sich gegen den steten Ansturm zu wappnen, versuchte Stevie Raes tobende Gefühle abzuwehren und wieder auf die Füße zu kommen. Entschlossen zwang er sich, durch Mattigkeit und emotionalen Wirbelsturm hindurch seine Konzentration wiederzufinden, den Ort in sich zu ertasten, der in jedem schlummert, den Menschen aber in der Regel zeitlebens verschlossen bleibt – den Ort der Macht, zu dem sein Blut der Schlüssel war.
Von neuem begann er seine Beschwörung – diesmal in vollkommen anderer Absicht.
Später würde er sich einreden, dass es eine völlig automatische Reaktion gewesen war – dass er unter dem Einfluss der Prägung gehandelt hatte, welche schlicht mächtiger gewesen war, als er geglaubt hatte. Dass es diese verwünschte Prägung gewesen war, die ihn hatte glauben machen, der schnellste und sicherste Weg, den schrecklichen Ansturm von Gefühlen der Roten zu beenden, sei es, sie zu sich zu rufen und somit von dem zu trennen, was ihr solchen Schmerz bereitete.
Es war nicht so, dass ihr Leid ihm naheginge. Niemals.
»Wie es mein angestammtes Recht ist, rufe ich die Geistesmacht der uralten Unsterblichen zu mir«, sprach er eilig. Ungeachtet der Schmerzen in seinem zerschlagenen Körper zog er aus den tiefsten Schatten der Nacht Energie heran und setzte ihr, als sie ihn durchströmte, etwas von seiner eigenen Unsterblichkeit hinzu. Die Luft um ihn begann zu funkeln, geschwängert von dunklem, scharlachrotem Glanz. »Im Namen der Macht meines unsterblichen Vaters Kalona, der mir in Blut und Geist seine Kraft verlieh, sende ich dich zu meiner –« Abrupt brach er ab. Seine? Sie war nicht seine irgendwas. Sie war … sie war … »Zu der Roten! Der Vampyr-Hohepriesterin der Verlorenen«, stieß er schließlich hervor. »Die mit mir verbunden ist durch Blutsband und Lebensschuld. Geh zu ihr. Stärke sie. Führe sie zu mir. Dies befehle ich dir im Namen meines unsterblichen Anteils!«
Sofort zerstreute sich der rote Nebel und wehte nach Süden davon – dorthin, woher Rephaim gekommen war und wo sie noch immer sein musste.
Rephaim blickte ihm lange nach. Und dann wartete er.
Drei
Stevie Rae
Als Stevie Rae erwachte, fühlte sie sich wie ein Haufen Matsch. Genauer gesagt, wie ein Haufen total gestresster Matsch.
Sie hatte eine Prägung mit Rephaim.
Sie war auf diesem Dach fast verbrannt.
Eine Sekunde lang dachte sie an die geniale Folge in der zweiten Staffel von True Blood, wo Godric sich auf einem Dach von der Sonne hatte verbrennen lassen. Sie lachte schnaubend. »Im Fernsehen sah’s viel leichter aus.« »Was?«
Stevie Rae zog reflexartig das weiße, krankenhausartige Leintuch, unter dem sie lag, bis zum Hals hoch. »Herrschaftszeiten, Dallas! Ich mach mir ja fast in die Hose! Was zum Geier machst du da?«
Dallas runzelte die Stirn. »Hey, Mann, beruhige dich. Ich bin kurz nach Sonnenuntergang hergekommen, weil ich nach dir schauen wollte, und Lenobia meinte, es wäre okay, wenn ich ein bisschen hierbliebe, falls du aufwachst. Du bist echt ganz schön schreckhaft.«
»Ich bin fast gestorben. Da hab ich wohl das Recht, ’n bisschen schreckhaft zu sein.«
Sofort sah Dallas reuig drein. Er rückte den kleinen Stuhl näher heran und nahm ihre Hand. »Sorry. Hast recht. Sorry. Ich hab einen totalen Schrecken gekriegt, als Erik uns erzählt hat, was passiert ist.«
»Was hat er denn gesagt?«
Dallas’ warme braune Augen wurden hart. »Dass du auf dem Dach fast verbrannt wärst.«
»Ja, das war so doof von mir. Ich bin hingefallen und hab mir den Kopf angeschlagen.« Sie war unfähig, ihn anzuschauen, während sie das sagte. »Als ich aufgewacht bin, war ich schon ziemlich durchgebraten.«
»Ja. Schwachsinn.«
»Was?«
»Spar dir diesen Scheiß für Erik und Lenobia und so weiter. Diese Arschlöcher wollten dich umbringen, oder?«
»Dallas, ich hab keine Ahnung, was du meinst.« Sie versuchte, ihre Hand aus seiner zu befreien, aber er hielt sie fest.
»Hey.« Seine Stimme wurde weicher, und er berührte zärtlich ihre Wange, bis ihr Blick wieder zu ihm kroch. »Bin doch bloß ich. Du weißt, dass du mir die Wahrheit sagen kannst und ich das Maul halte.«
Stevie Rae stieß einen langen Atemzug aus. »Ich will nich, dass Lenobia oder sonstwer es erfährt, vor allem keiner von den blauen Jungvampyren.«
Dallas sah sie lange an, bevor er sprach. »Ich werd keinem was sagen. Aber weißt du, ich glaub, du machst da ’nen Riesenfehler. Du kannst die nicht ewig beschützen.«
»Ich beschütze sie nich!«, protestierte sie. Diesmal hielt sie Dallas’ sanfte, warme Hand ganz fest und versuchte, ihm durch die Berührung etwas zu vermitteln, was sie ihm niemals mit Worten sagen konnte. »Ich will das – das alles – auf meine Art erledigen. Wenn jeder hier wüsste, dass die mir da oben ’ne Falle stellen wollten, dann dürfte ich ab jetzt garantiert nichts mehr unternehmen.« Wenn Lenobia sich nun Nicole und ihre Leute schnappen würde und die ihr das mit Rephaim erzählen würden?, flog ihr ein schuldbewusstes Flüstern durch den Kopf, und ihr wurde fast übel.
»Aber was willst du mit ihnen machen? Das kannst du ihnen nicht durchgehen lassen.«
»Tu ich auch nich. Aber sie sind meine Sache, und ich werd mich persönlich darum kümmern.«
Dallas grinste. »Wirst ihnen ganz schön das Fell über die Ohren ziehen, hm?«
»Ja, so ungefähr.« Stevie Rae hatte nicht den leisesten Schimmer, was sie tun wollte. Hastig wechselte sie das Thema. »Hey, wie viel Uhr isses eigentlich? Ich verhungere.«
Dallas’ Grinsen verwandelte sich in ein Lachen, und er stand auf. »Na, das klingt schon viel besser!« Er küsste sie auf die Stirn und ging zu dem Mini-Kühlschrank, der in die Regalzeile an der Wand eingebaut war. »Lenobia meinte, hier wären Beutel mit Blut drin. So tief, wie du geschlafen hättest, und so schnell, wie du geheilt wärst, würdest du wahrscheinlich beim Aufwachen Hunger haben.«
Während er die Blutbeutel holte, setzte Stevie Rae sich auf und schielte in den Kragen ihres typischen Krankenhausnachthemds nach hinten auf ihren Rücken. Sie war auf alles gefasst. Wirklich, ihr Rücken war so verkohlt wie ein übel verbrannter Hamburger gewesen, als Lenobia und Erik sie aus dem Loch unter dem Baum herausgezogen hatten … weg von Rephaim …
Denk jetzt nicht an ihn. Denk nur an –
»Achduliebegüte«, flüsterte Stevie Rae beim Anblick dessen, was sie von ihrem Rücken sehen konnte, entgeistert. Er sah nicht mehr hamburgermäßig aus. Sondern gut. Okay, die Haut war noch leuchtend pink wie nach einem Sonnenbrand, aber glatt und neu wie bei einem Baby.
»Wahnsinn«, hörte sie Dallas gedämpft sagen. »Ein totales Wunder.«
Stevie Rae sah ihn an. Eindringlich erwiderte er ihren Blick.
»Du hast mir ’nen ganz schönen Schrecken eingejagt, Mädel. Mach das nie wieder, ja?«
»Ich werd’s versuchen«, sagte sie leise.
Dallas lehnte sich vor und berührte vorsichtig, nur mit den Fingerspitzen, die neue rosa Haut hinten auf ihrer Schulter. »Tut’s noch weh?«
»Nich wirklich. Ist nur noch ’n bisschen steif.«
»Wahnsinn«, wiederholte er. »Ich meine, klar hat Lenobia gesagt, dass es im Schlaf besser geworden ist, aber du warst echt böse verwundet. Nie im Leben hätt ich gedacht, dass –«
»Wie lange hab ich denn geschlafen?«, unterbrach sie ihn. Sie versuchte, sich vorzustellen, was es bedeutete, wenn sie tagelang geschlafen hatte. Was würde Rephaim denken, wenn sie nicht auftauchte? Oder noch schlimmer – was würde er tun?
»Nur einen Tag.«
Eine Woge der Erleichterung überflutete sie. »Einen Tag? Echt?«
»Na ja, ’n bisschen länger, wenn man einrechnet, dass es schon ’n paar Stunden her ist, dass die Sonne untergegangen ist. Die haben dich kurz nach Sonnenaufgang hergebracht. War ganz schön dramatisch. Erik hat mit dem Hummer ’nen Zaun niedergewalzt und ist mit Vollgas quer übers Gelände gefahren, mitten in Lenobias Stall rein. Dann haben wir dich in ’nem Affentempo durch die ganze Schule hierher in die Krankenstation getragen.«
»Ja. Ich weiß noch, auf dem Weg hierher hab ich im Auto noch kurz mit Z geredet, und mir ging’s eigentlich fast gut, aber dann gingen – zack – die Lichter aus. Da muss ich wohl ohnmächtig geworden sein.«
»Oh ja, bist du.«
Stevie Rae zwang sich zu lächeln. »Schade aber auch. Das Drama hätt ich gern mitgekriegt.«
»Ja« – er grinste sie an –, »genau das hab ich mir auch gedacht, nachdem ich über die Phase weg war, wo ich dachte, du stirbst.«
»Ich sterbe nich«, sagte sie fest.
»Na, da bin ich aber froh.« Dallas beugte sich vor und küsste sie zart auf die Lippen.
Stevie Rae reagierte automatisch und für sie selbst völlig unerwartet: sie zuckte zurück.
»Äh, wie war das mit ’nem Blutbeutel?«, fragte sie hastig.
»Ach ja, klar.« Dallas verlor kein Wort über ihre Reaktion, aber als er ihr den Blutbeutel gab, waren seine Wangen unnatürlich gerötet. »Sorry, hab nicht nachgedacht. Ich weiß, du bist verletzt und willst nicht unbedingt, äh, na ja, du weißt schon …« Er verstummte und sah wahnsinnig verlegen aus.
Stevie Rae war klar, dass sie etwas sagen sollte. Schließlich lief zwischen ihr und Dallas etwas. Er war süß und clever, und wie gut er sie verstand, bewies schon die Tatsache, wie reumütig er jetzt dastand, den Kopf so niedlich gesenkt, dass er wie ein kleiner Junge aussah. Und hübsch war er auch – groß und schlank, mit dichtem sandfarbenem Haar und genau der richtigen Menge an Muskeln. Eigentlich küsste sie ihn gern. Bisher wenigstens.
Jetzt etwa nicht mehr?
Ein ganz komisches Unbehagen hinderte sie daran, Worte zu finden, die seine Verlegenheit gelindert hätten, also sagte sie gar nichts, nahm nur den Blutbeutel, den er ihr reichte, riss eine Ecke auf, setzte ihn an den Mund und ließ das Blut durch ihre Kehle in den Magen fließen, wo es ihr wie ein doppelter Red Bull einen kribbelnden Energiestoß versetzte.
Tief im Innern dachte sie unwillkürlich darüber nach, wie dieses normale, gewöhnliche, sterbliche Blut auf sie wirkte – und was für ein Kugelblitz aus Hitze und Energie Rephaims Blut gewesen war.
Ihre Hand zitterte nur ein kleines bisschen, als sie sich den Mund abwischte und endlich wieder Dallas ansah.
»Besser?«, fragte er. Er wirkte wieder ganz normal, als sei die seltsame Situation gerade eben spurlos an ihm vorübergegangen.
»Kann ich noch einen haben?«
Er grinste und hielt ihr den nächsten Blutbeutel hin. »Sofortissimo, Mädel.«
»Danke, Dallas.« Bevor sie den Beutel ansetzte, hielt sie inne. »Ich fühl mich noch nich ganz auf der Höhe, verstehst du?«
Dallas nickte. »Schon klar.«
»Ist das okay für dich?«
»Klar. Solange’s dir gutgeht, ist für mich alles okay.«
»Gut. Das hier hilft jedenfalls schon mal enorm.«
Sie war gerade dabei, den letzten Schluck aus dem Beutel zu saugen, als Lenobia hereinkam.
»Hey, Lenobia, schauen Sie mal, Schneewittchen ist endlich aufgewacht«, sagte Dallas.
Stevie Rae saugte den letzten Tropfen auf und sah zur Tür. Aber das fröhliche Lächeln gefror ihr auf den Lippen, als sie das Gesicht der Pferdeherrin erblickte.
Lenobia hatte geweint. Und zwar heftig.
»Achduliebegüte, was ist los?« Stevie Rae war so entsetzt, die sonst so unerschütterliche Lehrerin in Tränen aufgelöst zu sehen, dass sie automatisch als Aufforderung, sich zu setzen, neben sich aufs Bett klopfte, so wie ihre Mama es früher immer gemacht hatte, wenn Stevie Rae sich verletzt hatte und trostsuchend angerannt kam.
Lenobia trat hölzern näher, aber sie setzte sich nicht. Sie blieb am Fußende des Bettes stehen und holte tief Luft, als müsste sie gleich etwas Schreckliches tun.
»Soll ich gehen?«, fragte Dallas zögernd.
»Nein. Bleib. Vielleicht braucht sie dich.« Lenobias Stimme klang rau und tränenerstickt. Sie sah Stevie Rae in die Augen. »Etwas ist passiert. Zoey.«
Furcht schoss Stevie Rae wie ein eisiger Speer in den Magen, und bevor sie es verhindern konnte, brachen die Worte aus ihr hervor. »Aber Zoey geht’s gut! Ich hab doch noch mit ihr geredet, wissen Sie noch? Nachdem wir aus dem Bahnhof draußen waren, bevor mich die Schmerzen und das Licht und so weiter doch noch ausgeknockt haben. Das war erst gestern!«
»Erce, meine Freundin, die dem Hohen Rat als Assistentin dient, versucht seit Stunden, mich zu erreichen. Ich hatte gedankenloserweise mein Handy im Hummer vergessen, deshalb habe ich erst jetzt mit ihr gesprochen. Kalona hat Heath getötet.«
»Oh Shit«, stieß Dallas aus.
Stevie Rae hörte ihn kaum. Sie starrte Lenobia an. Rephaims Dad hat Heath getötet! Die nagende Übelkeit in ihr wurde von Sekunde zu Sekunde stärker. »Aber Zoey ist nicht tot. Wenn sie tot wär, dann wüsste ich das.«
»Sie ist nicht tot, aber sie hat gesehen, wie Kalona Heath tötete. Sie hat versucht, es zu verhindern, aber es war zu spät. Das hat Zoey zerstört, Stevie Rae.« Über Lenobias porzellanfarbene Wangen rannen neue Tränen.
»Zerstört? Was heißt das?«
»Das heißt, dass ihr Körper noch atmet, aber ihre Seele ist zerborsten. Und wenn die Seele einer Hohepriesterin zerbirst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie auch körperlich diese Welt verlässt.«
»Verlässt? Was meinen Sie? Dass sie verschwindet?«
»Nein«, sagte Lenobia stockend. »Dass sie stirbt.«
Stevie Rae begann ganz von allein den Kopf zu schütteln, hin und her, hin und her. »Nein. Nein. Nein! Wir müssen sie herholen. Hier kommt sie sicher wieder auf die Beine.«
»Selbst wenn wir Zoeys Körper hierherholen würden, käme ihre Seele dadurch nicht zurück, Stevie Rae. Du musst versuchen, das zu akzeptieren.«
»Tu ich nich!«, schrie Stevie Rae. »Kann ich nich! Dallas, hol mir meine Klamotten. Ich muss hier raus. Ich muss mir was überlegen, wie ich Z helfen kann. Sie hat mich nich aufgegeben, und jetzt werd ich sie nich aufgeben.«
»Es liegt nicht in deiner Hand«, sagte Dragon Lankford aus der offenen Tür. Sein markantes Gesicht wirkte hager und düster, der kürzliche Tod seiner Gemahlin war ihm deutlich anzusehen, aber seine Stimme klang ruhig und sicher. »Die Sache ist, dass Zoey ein Schmerz zugefügt wurde, den sie nicht ertragen konnte. Ich kenne diese Art Schmerz aus eigener Erfahrung. Er kann eine Seele in Stücke zerschellen lassen. Dann findet sie nicht mehr in den Körper zurück, und ohne den steten Austausch mit dem Geist kann unser Körper nicht überleben.«
»Nein. Bitte. Das kann nich stimmen. Das kann nich passieren«, sagte Stevie Rae.
»Du bist die erste Hohepriesterin der Roten Vampyre. Du musst die Kraft finden, mit diesem Verlust fertig zu werden. Denn die Deinen brauchen dich.«
»Wir wissen nicht, wohin Kalona verschwunden ist«, erklärte Lenobia, »und wir wissen nicht, welche Rolle Neferet bei alledem spielte.«
»Wir wissen nur, dass Zoeys Tod ein hervorragender Zeitpunkt für die beiden wäre, zum Schlag gegen uns auszuholen«, fügte Dragon hinzu.
Zoeys Tod … Die Worte hallten durch Stevie Raes Gedanken und ließen Schock und Angst zurück.
»Deine Kräfte sind gewaltig«, sagte Lenobia. »Man muss sich nur ansehen, wie rasch du dich erholt hast. Gegen die Finsternis, von der ich ahne, dass sie sich unentrinnbar über uns senken wird, werden wir alle Kraft brauchen, die wir aufbieten können.«
»Lass dich nicht von deiner Trauer beherrschen«, bat Dragon, »und nimm an Zoeys statt den Kampf auf.«
»Niemand kann Zoey ersetzen!«, schrie Stevie Rae.
»Wir verlangen nicht von dir, sie zu ersetzen«, sagte Lenobia. »Wir bitten dich nur, uns zu helfen, die Lücke zu füllen, die sie hinterlässt.«
»Ich – ich muss nachdenken«, stotterte sie. »Könntet ihr mich bitte ’ne Weile allein lassen? Ich muss mich anziehen und nachdenken.«
»Natürlich«, sagte Lenobia. »Wir sind im Ratszimmer. Komm dorthin, wenn du fertig bist.« Und schweigend, voller Trauer, aber auch Entschlossenheit verließen sie und Dragon das Zimmer.
Dallas trat zu Stevie Rae und legte seine Hand auf ihre. »Geht’s?«
Sie ließ die Berührung nur einen Moment lang zu, dann drückte sie kurz seine Hand und zog ihre zurück. »Ich brauch meine Klamotten.«
Dallas nickte zur gegenüberliegenden Wand hin. »Die sind in dem Schrank da.«
»Gut, danke«, sagte sie schnell. »Kannst du mal rausgehen, damit ich mich anziehen kann?«
Er betrachtete sie genau. »Du hast meine Frage nicht beantwortet.«
»Nein. Mir geht’s scheußlich, und das wird auch so bleiben, solange die davon reden, dass Z stirbt.«
»Aber Stevie Rae, selbst ich hab schon gehört, was passiert, wenn eine Seele einen Körper verlässt. Die Person stirbt.« Er gab sich sichtliche Mühe, die harten Worte schonend auszusprechen.
»Diesmal nich«, sagte Stevie Rae. »Und jetzt verdufte, damit ich mich anziehen kann.«
Dallas seufzte. »Na gut. Ich warte draußen.«
»Gut. Ich brauch nich lange.«
»Lass dir Zeit, Mädel«, sagte er leise. »Ich kann warten.«
Als er die Tür hinter sich geschlossen hatte, sprang Stevie Rae nicht sofort auf und warf sich in ihre Klamotten, wie sie es eigentlich vorgehabt hatte. Ihr Gedächtnis war damit beschäftigt, sich eine schrecklich traurige Geschichte aus dem Handbuch für Jungvampyre I in Erinnerung zu rufen, wo es um eine Hohepriesterin in der Antike ging, deren Seele zerborsten war. Aus welchem Grund, konnte sich Stevie Rae nicht erinnern – eigentlich konnte sie sich an fast gar nichts mehr in der Geschichte erinnern, außer dass die Hohepriesterin gestorben war. Egal, was versucht worden war, um sie zu retten – die Hohepriesterin war gestorben.
»Die Hohepriesterin ist gestorben«, flüsterte Stevie Rae. Und Zoey war nicht mal eine richtige, erwachsene Hohepriesterin. Sie war faktisch noch ein Jungvampyr. Wie konnte man von ihr erwarten, dass sie sich von etwas erholte, was eine ausgereifte Hohepriesterin getötet hatte?
Tatsache war: Man konnte es nicht.
Aber das war nicht fair! So viel hatten sie zusammen durchgestanden, und jetzt sollte Zoey sterben? Stevie Rae konnte es einfach nicht glauben. Sie wollte um sich schlagen und schreien und eine Möglichkeit finden, ihre beste Freundin zu retten, aber wie? Z war in Italien und sie selbst in Tulsa. Und, verflixt nochmal! Stevie Rae hatte ja nicht mal eine Ahnung, wie sie diesen Haufen asozialer roter Jungvampyre retten sollte. Wie konnte sie sich da einbilden, sie könnte etwas gegen eine so furchtbare Sache tun, wie dass Z’s Seele zerbrochen und aus ihrem Körper geflohen war?
Sie war ja sogar unfähig, den anderen zu gestehen, dass sie mit dem Sohn der Kreatur, die an der ganzen Misere schuld war, eine Prägung hatte.
Eine Woge der Traurigkeit übermannte Stevie Rae. Sie rollte sich zusammen, das Kopfkissen an die Brust gedrückt, wickelte sich eine Strähne ihrer blonden Locken mechanisch um den Finger, wie sie es als kleines Kind immer getan hatte, und fing an zu weinen. Die Schluchzer schüttelten sie, und sie vergrub das Gesicht im Kissen, damit Dallas sie nicht hörte, und gab sich ganz dem Grauen, der Angst und der totalen, bedingungslosen Verzweiflung hin.
Tiefer und tiefer rutschte sie in den schwarzen Abgrund – da regte sich auf einmal die Luft um sie. Fast als hätte jemand die Fenster in dem kleinen Zimmer einen Spaltbreit geöffnet.
Zuerst achtete sie nicht darauf, zu sehr in Tränen aufgelöst, um so was wie einen kleinen dummen kalten Luftzug zu bemerken. Aber er ließ nicht locker. Mit einer kühlen Liebkosung, die erstaunlich guttat, streichelte er die frische rosa Haut ihres bloßen Rückens. Einen Augenblick lang entspannte sie sich und ließ sich ein bisschen von der Berührung trösten.
Berührung? Sie hatte ihn doch gebeten, draußen zu warten!
Stevie Rae hob blitzartig den Kopf, die Zähne zu einem Knurren gefletscht, mit dem sie Dallas begrüßen wollte.
Aber niemand war im Zimmer.
Sie war allein. Vollkommen allein.
Stevie Rae ließ das Gesicht in die Hände sinken. Drehte sie jetzt vor Kummer durch? Dafür hatte sie keine Zeit. Sie musste aufstehen, sich anziehen. Sie musste einen Fuß vor den anderen setzen, nach draußen gehen und sich darüber klarwerden, was mit Zoey, ihren roten Jungvampyren, Kalona und – schließlich und endlich – Rephaim passiert war.
Rephaim …
Sein Name schien in der Luft widerzuhallen und sich um sie zu legen wie eine weitere kühle Liebkosung. Sie strich nicht nur über ihren Rücken, sondern weiter ihre Arme entlang und nach unten um ihre Taille und Beine. Und überall, wo die Kühle sie berührte, schien ein bisschen Gram von ihr abgestreift zu werden. Als sie diesmal aufsah, hatte sie sich besser unter Kontrolle. Sie wischte sich die Tränen aus den Augen und starrte an sich herunter.
Um sie herum schwebte ein Nebel winziger, funkelnder Tröpfchen, die genau dieselbe Farbe hatten wie seine Augen.
Gegen ihren Willen flüsterte sie seinen Namen. »Rephaim.«
Er ruft dich …
Unter Stevie Raes Trauer regte sich Wut. »Was zum Geier soll das?«
Geh zu ihm …
»Zu ihm gehen?« Sie wurde zunehmend sauer. »An allem ist sein Dad schuld.«
Geh zu ihm …
Die kühle Liebkosung und der blutrote Zorn schlugen über ihr zusammen und nahmen ihr die Entscheidung ab. In aller Eile zog sie sich an. Sie würde zu Rephaim gehen, aber nur, weil er vielleicht irgendwas wusste, was sie tun konnte, um Zoey zu helfen. Als Sohn eines mächtigen, gefährlichen Unsterblichen hatte er sicher Fähigkeiten, von denen sie nichts ahnte. Dieses rote Zeug, das um sie herumschwebte, kam definitiv von ihm, und es schien aus einer Art Geist zu bestehen.
»Na schön«, sagte sie laut zu dem Nebel. »Ich gehe.«
Kaum sprach sie die Worte aus, verflog der rötliche Dunst. Nur eine schwache Kühle auf ihrer Haut und ein seltsam unirdisches Gefühl der Ruhe blieben zurück.
Ich gehe zu ihm, aber wenn er mir nich helfen kann, dann – Prägung oder nich – muss ich ihn, glaube ich, töten.
Vier
Aphrodite
»Hören Sie, Erce, ich sag das nur noch einmal. Ihre blöden Regeln können mich mal. Zoey ist da drin.« Aphrodite deutete mit einem tadellos gepflegten Fingernagel auf die verschlossene Steintür. »Und das heißt, ich gehe jetzt da rein.«
»Aphrodite, du bist ein Mensch – und nicht einmal die Gefährtin eines Vampyrs. Du kannst nicht in all deiner jugendlichen, sterblichen Hysterie einfach in den Ratssaal platzen, erst recht nicht in einem Krisenmoment wie diesem.« Der kühle Blick der Vampyrin glitt über Aphrodites zerzauste Frisur, ihr tränenfleckiges Gesicht und ihre rotgeweinten Augen. »Der Rat wird dich hereinbitten. Wahrscheinlich. Bis dahin musst du warten.«
»Ich. bin. nicht. hysterisch.« Langsam und deutlich, mit erzwungener Ruhe sprach Aphrodite die Worte aus, in der Absicht, zumindest einen der Gründe außer Kraft zu setzen, warum Erce sie aufgehalten hatte, während Stark, gefolgt von Darius, Damien, den Zwillingen und sogar Jack, Zoeys leblosen Körper nach drinnen getragen hatte – weil sie nämlich wirklich hysterisch gewesen war, und zwar hochgradig. Sie hatte nicht mit den anderen Schritt halten können, weil sie so in Tränen aufgelöst gewesen war, dass sie vor Rotz und Wasser kaum noch hatte atmen oder sehen können. Als sie sich endlich wieder unter Kontrolle hatte, war die Tür schon verschlossen gewesen, und Erce hatte sich wie ein räudiger Wachhund davor postiert.
Aber wenn Erce glaubte, Aphrodite könnte sich nicht gegen überhebliche, herrschsüchtige Erwachsene behaupten, dann irrte sie gewaltig. Verglichen mit der Frau, die Aphrodite aufgezogen hatte, war Erce Mary Poppins.
»Sie halten mich also für ein kleines Menschenmädchen, ja?« Aphrodite baute sich so nahe vor Erce auf, dass diese automatisch einen Schritt zurückwich. »Denken Sie mal nach. Ich bin eine Prophetin der Nyx. Nyx – die kennen Sie doch noch, oder? Ihre Göttin, Ihr Oberboss sozusagen? Ich habe es nicht nötig, mich von irgendwem runterkühlen zu lassen, um vor den Hohen Rat treten zu können. Dieses Recht hat mir Nyx selbst gewährt. Und jetzt gehen Sie mir verdammt nochmal aus dem Weg.«
»Auch wenn sie es höflicher hätte formulieren können, hat das Argument des Mädchens etwas für sich, Erce. Lass sie durch. Ich werde die Verantwortung für ihre Anwesenheit übernehmen, falls es dem Rat missfällt.«
Aphrodite spürte, wie sich die feinen Härchen auf ihren Unterarmen aufstellten, als hinter ihr Neferets seidige Stimme ertönte.
»Das ist nicht üblich«, sagte Erce, aber man hörte ihrem Ton schon die Kapitulation an.
»Es ist auch nicht üblich, dass die Seele einer Jungvampyrin zerbirst«, hielt Neferet ihr entgegen.
»Da muss ich Euch zustimmen, Priesterin.« Erce trat beiseite und öffnete die dicke Steintür. »Nun denn, die Anwesenheit dieses Menschen im Ratssaal obliegt Eurer Verantwortung.«
»Danke, Erce. Sehr großzügig von dir. Oh, ich habe einige Krieger des Rates beauftragt, etwas herzubringen. Lass sie bitte auch durch, ja?«
Aphrodite würdigte Erce keines Blickes mehr, die vorhersehbarerweise so etwas wie »Gewiss doch, Priesterin« murmelte. Entschlossen betrat sie das altertümliche Bauwerk.
»Ist es nicht seltsam, dass wir so plötzlich wieder Verbündete sind, Kind?«, ertönte Neferets Stimme dicht hinter ihr.
Aphrodite sah weder zurück, noch verlangsamte sie. »Ich bin kein Kind, und wir werden nie Verbündete sein.« Die Eingangshalle mündete in ein großes steinernes Amphitheater, das sich in vielen Halbkreisen vor ihr erstreckte. Sofort wurde Aphrodites Blick wie magisch von dem Buntglasfenster gegenüber angezogen, das Nyx zeigte, die schlanken Arme erhoben, in den Händen eine Mondsichel, umrahmt von einem leuchtenden Pentagramm.