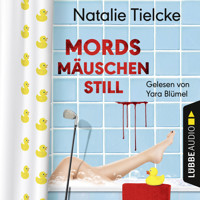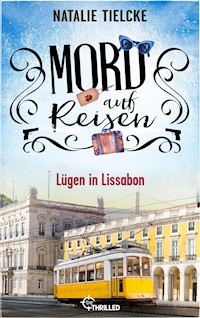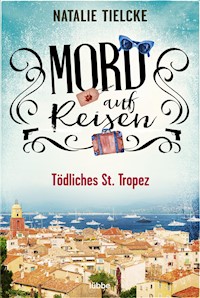
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Claire und Andrew
- Sprache: Deutsch
Eine Reise wider Willen
Claire leidet unter ständigem Fernweh - und ihr Job im Reisebüro hilft nicht gerade dagegen. Denn ihre Phobie vor Autos, Zügen und Flugzeugen macht das Verreisen unmöglich. Doch dann verschwindet ihre Kollegin und beste Freundin Leslie während eines Urlaubs in Frankreich spurlos. Und auf dem Konto des Reisebüros fehlt Geld. Ist Leslie damit durchgebrannt? Oder ist ihr etwas zugestoßen? Die Polizei ist ratlos und Claire beschließt, die Suche nach ihrer Freundin selbst in die Hand zu nehmen. Zusammen mit dem attraktiven Privatdetektiv Andrew findet sich Claire plötzlich im Zug nach Frankreich wieder - auf der abenteuerlichsten Reise ihres Lebens!
Ein amüsanter Urlaubskrimi vor wunderschöner Kulisse.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
Danksagung
Weitere Titel der Autorin
Kaltes Verlangen
Mordsmäuschenstill
Psychospiel
Über dieses Buch
Claire leidet unter ständigem Fernweh – und ihr Job im Reisebüro hilft nicht gerade dagegen. Denn ihre Phobie vor Autos, Zügen und Flugzeugen macht das Verreisen unmöglich. Doch dann verschwindet ihre Kollegin und beste Freundin Leslie während eines Urlaubs in Frankreich spurlos. Und auf dem Konto des Reisebüros fehlt Geld. Ist Leslie damit durchgebrannt? Oder ist ihr etwas zugestoßen? Die Polizei ist ratlos und Claire beschließt, die Suche nach ihrer Freundin selbst in die Hand zu nehmen. Zusammen mit dem attraktiven Privatdetektiv Andrew findet sich Claire plötzlich im Zug nach Frankreich wieder – auf der abenteuerlichsten Reise ihres Lebens!
Über die Autorin
Natalie Tielcke wurde 1986 in Aachen geboren. Nach dem Abitur zog es die kreative Frohnatur zum Fernsehen und dort findet man sie noch heute. Sie schreibt Drehbücher und entwickelt TV-Serien. Die Kölnerin ist schon seit ihrer Kindheit davon begeistert, wenn nicht sogar besessen, sich Geschichten auszudenken. Ohne Stift und Papier geht sie nicht aus dem Haus.
NATALIE TIELCKE
Mord auf Reisen
Tödliches St. Tropez
Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2021/2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Motiven © shutterstock – RATOCA | Tamiris6 | Elena100 | Ana Gram | Victoria Sergeeva | iri.art | Rasto SK
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7517-1853-0
luebbe.de
lesejury.de
Für Gravy
»Ich glaube, dass die Angst, die man hat, wenn man an einem Abgrund steht,
in Wahrheit vielmehr eine Sehnsucht ist. Eine Sehnsucht, sich fallen zu lassen
– oder die Arme auszubreiten und zu fliegen.«
Isabel Abedi
Prolog
Saint-Tropez
Louis Bernart hasste Wandern. Es gab viele Dinge, die der französische Kommissar liebte. Sein Wasserbett, schweren Rotwein, Musik aus den 50er-Jahren, ein gutes Buch in seinem Ledersessel mit Massagefunktion. Außerdem natürlich seine Frau und seine beiden Töchter – auch wenn die es ihm beizeiten mit pubertärem Gehabe schwermachten. Doch er war kein besonders großer Freund von Bewegung. Sein Körper dankte es ihm mit steifen Gelenken und einer Wampe, die bald so voluminös sein würde, dass er seine Füße nicht mehr sehen könnte. Trotzdem fühlte er sich wohl in seiner Haut.
Das Wetter war an diesem Freitagmorgen genau nach seinem Geschmack. Sonnig, aber nicht zu heiß. Mit einer leichten Brise. Dementsprechend hatte es viele Einheimische und Touristen hinaus ins Hinterland von Saint-Tropez gezogen. Heute früh um sieben Uhr – noch etwas, dass Bernart nicht verstand: Menschen, die gerne wanderten und dazu auch noch freiwillig so früh aufstanden – war die Meldung eingegangen, dass eine Gruppe Wanderer eine Leiche gefunden hatte. Das Massif des Maures war ein beliebtes Ziel für Naturfreunde. Und nun wurde ausgerechnet er zum Fundort bestellt. Ob es sich dabei auch um den Tatort handelte, ließ sich noch nicht sagen.
Bernart blieb keine Wahl. Es gab keine Abkürzung zu der Stelle, die ihm sein GPS anzeigte. Er parkte am Moulin Saint Roche in Grimaud und folgte dem Weg unterhalb der alten Mühle. Stufen führten zu einer Quelle hinab, Stufe um Stufe sagten seine Knie ihm, dass sie lieber im Bett geblieben wären. Er erreichte den Fluss La Garde und folgte ihm bis zu einer Steinbrücke, wo er kurz haltmachte und sich umsah. Sie stammte aus dem Mittelalter und wurde Feenbrücke genannt. Als seine Töchter noch klein waren, waren sie manchmal hier gewesen und hatten nach Feen Ausschau gehalten. Damit waren aber nicht die Fabelwesen, sondern die griechischen Landschildkröten gemeint, die sich hier angesiedelt hatten. Er ging weiter und verlangsamte seinen Schritt, als er am dicht bewachsenen Eichenwald ankam. Hier führte ein Pfad wieder bergauf, aber Bernart musste querfeldein gehen, um das Team zu finden, das den Weg mit Flatterband abgesperrt hatte. Denn man hatte die Tote nicht akkurat auf einem Wanderweg liegend, sondern etwas abseits mitten im Wald entdeckt. Er kraxelte die Anhöhe hinauf, bis er die ersten bekannten Gesichter sah.
Keuchend kam er am Fundort an und wurde allerseits mit »Guten Morgen, Monsieur le Commissaire« begrüßt. Während er zu Atem kam und jedem freundlich zunickte, überlegte er, wie es dem Täter gelungen sein konnte, sein Opfer hierher zu schaffen. Oder der Mörder hatte sie lebendig in den Wald gelockt – vielleicht ein romantisches Liebesspiel, das eskaliert war.
Dann warf er einen Blick auf die Tote. Die junge Frau war übel zugerichtet worden. Ihre Kleidung war blutverschmiert, ihr Körper derart verrenkt, dass jeder einzelne Knochen gebrochen sein musste. Ihr Gesicht war kaum zu erkennen. Grausam. Selbst nach fast dreißig Jahren Berufserfahrung gingen ihm solche Bilder sehr nah.
Er wandte sich an die Rechtsmedizinerin, die sich soeben neben die Leiche gekniet hatte. Dr. Sophie Dumont war eine alte Bekannte, trotzdem siezten sie sich bei der Arbeit. Geduzt wurde sich erst ab dem zweiten Glas nach Feierabend. »Können Sie schon was sagen?«
Dumont schüttelte den Kopf. Sie war keine Frau vieler Worte, was er sehr an ihr schätzte. Sie begutachtete den Leichnam und drehte das Handgelenk der Toten in Bernarts Richtung. Er erkannte ein Tattoo – ein chinesisches Schriftzeichen. »Wenn hier eine Straße wäre, würde ich auf den ersten Blick davon ausgehen, dass sie einen schweren Autounfall hatte – entweder angefahren wurde oder vielleicht sogar aus dem Wagen geschleudert wurde«, sagte sie und sah sich in alle Richtungen um. »Aber wie soll das gehen, mitten im Wald?«
Bernart winkte einen Kollegen von der Spurensicherung heran, der ein Foto von dem gestochenen Bild aus Tinte schoss. Er dachte an seine älteste Tochter, die sich letztes Jahr hatte tätowieren lassen, heimlich, da er es verboten hatte. Jetzt zierte ein Schmetterling, der aussah wie das verschwommene Bild eines Rorschach-Tests, ihren Knöchel. Würden die Eltern dieser Frau, die fast noch ein Mädchen war, ihre Tochter anhand des Tattoos identifizieren können?
Er beugte sich über das Opfer und besah ihre blutunterlaufenen Augen, ihr aufgeschlagenes Gesicht, den Knochen, der aus ihrem Unterschenkel hervorragte. Er hörte ein leises Pfeifen, dann ein Röcheln. Es dauerte einen Moment, bis er begriff, was das zu bedeuten hatte. Und plötzlich riss die Tote die Augen auf.
KAPITEL 1
»Ich sehe tote Menschen.«
Cole in The Sixth Sense
Los Angeles, 1986
Sie lag auf der Motorhaube eines schnell fahrenden SUV. Neben ihr geriet ein Laster ins Schlingern und knallte mehrmals gegen den Wagen. Sie klammerte sich am Scheibenwischer fest, ihre Finger schmerzten bis in die Spitzen, ihr ganzer Körper war nur noch ein einziger blauer Fleck. Und sie genoss es. Susan hielt den Blick starr auf den Fahrer gerichtet und gab sich alle Mühe, mit ihren Haaren ihr Gesicht zu verdecken. Sie musste immer genau darauf achten, dass man sie nicht erkannte. Zumindest vom Kamerafahrzeug aus, das neben ihnen herfuhr. Sie war als Stuntfrau für eine Newcomerin angefragt worden. Und wenn diese Frau als neuer Star am Firmament Hollywoods erstrahlen sollte, bedeute das für Susan mehr Aufträge.
»Cut!«, rief der Regisseur. Das Fahrzeug kam langsam zum Stehen, und sie rollte von der Motorhaube.
»Na, bereit zu brennen?«, fragte Garry, der Stuntkoordinator, und spielte damit auf die nächste Szene an, in der Susan wortwörtlich in Flammen aufgehen sollte.
Sie hatte es vermisst, als Stunt-Double zu arbeiten. Erst jetzt wurde ihr bewusst, wie sehr diese Form der Action ihr gefehlt hatte. Zu Hause in London bestand Action aus Wurfgeschossen aus Babybrei, dem gefährlichen Inhalt von Windeln und schwindelerregenden Stunts auf dem Spielplatz. Denn sie hatte die Arbeit für die schönste Sache der Welt aufgegeben: ihren inzwischen fünfjährigen Sohn und ihre knapp einjährige Tochter. Sie sehnte sich nach den beiden und nach ihrem Mann. Trotzdem war es schön, wieder in L. A. zu sein, sich mit Schurken zu prügeln, selbst der Bösewicht zu sein, von Dächern zu springen, Treppen hinabzustürzen oder sich – wie jetzt – anzünden zu lassen. Und da ihre Rolle nach dieser Szene nicht wieder auf wundersame Weise auferstand, hieß es: Susan ist abgedreht. Und es war an der Zeit, die Heimreise anzutreten.
Als sie am Flughafen ankam, rochen ihre Haare noch nach Rauch, und sie entschuldigte sich gleich bei ihrer Sitznachbarin im Flugzeug. Falls es verkohlt riechen würde, gäbe es keinen Anlass zur Sorge.
Doch das interessierte die ältere Dame herzlich wenig. Sie zitterte am ganzen Leib und umklammerte einen Becher mit einer klaren Flüssigkeit, die zwar aussah wie Wasser, aber eindeutig nach Alkohol roch. Ihr Gesicht war blass und von einem Schweißfilm überzogen. Da brauchte es vermutlich mehr als einen Drink zur Beruhigung.
»Sie müssen keine Angst haben«, sagte Susan und legte der Frau behutsam ihre Hand aufs Knie. »Flugzeuge sind das sicherste Verkehrsmittel auf der Welt.«
»Und das, in dem man am sichersten umkommt, wenn was schiefgeht«, erwiderte die Frau und starrte weiter auf die Rückenlehne des Sitzes vor ihr.
»Also, ich hab meinem Mann und meinen Kindern versprochen, dass ich zum Abendessen zu Hause bin. Wenn ich das nicht schaffe, muss ich mir richtig was anhören. Das will ich lieber nicht erleben.«
Die Frau sah sie mit weit aufgerissenen Augen an. »Würden Sie in dem Fall ja auch nicht. Es erleben, meine ich.«
»Stimmt. Puh, dann bin ich ja froh.« Susan schenkte ihrer Sitznachbarin ein breites Lächeln, das zögerlich erwidert wurde.
»Eine Amerikanerin mit englischem Humor. Trifft man selten. Woher kommen Sie, Schätzchen?«
»Eigentlich Washington. Der Staat, nicht die Stadt. Aber mein Mann und ich wohnen schon seit über fünf Jahren in London.«
Susan erzählte ihr von ihrem Zuhause und ihren beiden Kindern. Kurz rückte die Flugangst der Dame in den Hintergrund. Doch das hielt nur bis zum Start. Sofort verkrampfte sie sich wieder.
»Wird schon alles gut gehen«, versuchte sie die Frau zu beruhigen. Doch die Dame reagierte nicht mehr, sie hatte sich in ihre Angstwelt zurückgezogen. Es war nicht so, dass Susan keine Angst kannte. Aber ihre größte Sorge war, sich später fragen zu müssen: Was wäre, wenn ich es getan hätte? Susan hatte mehr Angst, zu bereuen, etwas nicht probiert zu haben, als davor zu scheitern. Besser man bereute etwas, das man getan hatte als etwas, das man nie versucht hatte.
Der Flieger hob ab, brach durch die Wolkendecke und begann leicht zu wackeln. Die Frau neben ihr schrie auf.
»Nur leichte Turbulenzen. Ist gleich vorbei.« Susan lehnte sich zurück. Sie bemerkte, dass der Rauchgeruch ihrer Haare sich verstärkte. Das Ruckeln wurde heftiger. Die Frau neben ihr schrie immer noch. Dann sah Susan die brennende Turbine. Und jetzt schrie auch sie.
KAPITEL 2
»Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen – man weiß nie, was man kriegt.«
Forrest Gump in Forrest Gump
London, heute
Claire hatte zwar keinen Führerschein zu verlieren, aber betrunken Rad zu fahren, vermied sie trotzdem. Also schob sie mit der linken Hand ihren geliebten Drahtesel neben sich her, während sie mit der anderen einen Pizzakarton balancierte. Sie hätte im Pub dieses dämliche Spiel nicht mitspielen dürfen. Jetzt hatte sie einen sitzen, obwohl morgen Montag war und sie früh aufstehen musste.
Das Kneipenspiel hieß Tindertrinken, und Barkeeper Scott hatte es eingeführt. Er war ein bärtiger Schotte Ende sechzig, der ständig auf London schimpfte, aber trotzdem nicht zurück nach Schottland zog. Da Claire oft allein in den Pub ging, hatte sie ein beinahe freundschaftliches Verhältnis zu ihm entwickelt. Und jetzt spielten sie ständig dieses Spiel, nur dass er weitaus trinkfester war als sie. Die Regeln waren simpel: Man beobachtete Pärchen, und wenn sich rausstellte, dass die beiden ein erstes Date hatten, musste man einen Schnaps trinken. Woran man erkannte, dass es ein erstes Date war, dafür hatte Scott seine eigenen Maßstäbe festgelegt. Untermauert wurden seine Entscheidungen stets mit dem Argument eines angeblich magischen Barkeeper-Auges. Claire vermutete, dass er einfach nur riet und Spaß daran hatte, sie abzufüllen. Aber immerhin trank sie so gratis.
Als Claire zu Hause ankam, zog sie zuallererst ihren BH aus. Das schaffte sie, ohne ihr Oberteil dafür ausziehen zu müssen. Ihr Ex-Freund fragte sich bestimmt bis heute, wie das funktionierte. Vermutlich war es sogar umständlicher, den BH unter dem Shirt zu öffnen, die Träger abzustreifen, wieder in die Ärmel zu schlüpfen und ihn dann an seinen Bügeln zu packen und unter dem Shirt hervorzuziehen. Aber diese in Perfektion einstudierte Choreografie gehörte zu ihrer täglichen Routine und lief automatisch ab. Als Zweites streifte sie die Schuhe ab und legte sich mit der Pizza aufs Bett. Ihre Freude währte allerdings nicht lange. Denn die Begrüßung ihres aktuellen Mitbewohners fiel so charmant aus wie eh und je.
»Igittigittigitt! Du Ekel, du! Igittigittigitt! Bah! Bah!«, krächzte es unaufhörlich aus dem Käfig in der Ecke neben dem Fenster.
Der Kakadu gehörte ihrer Kollegin, und Claire hatte sich bereit erklärt, ihn zu hüten, während Leslie im Urlaub war. Auf einen Vogel aufpassen, wie schwer kann das schon sein, hatte sie gedacht und sich gründlich geirrt. Ließ man ihn frei fliegen, dauerte es Stunden, ihn wieder in seinen Käfig zu befördern. Doch das war nicht das Problem. Der Kakadu war extrem laut, aufmüpfig und dazu auch noch ein Sexist. Er kreischte und schrie, sobald er Claire sah. Und dass er sprechen konnte, machte die Zwangsgemeinschaft nicht besser. Denn Nettigkeiten kamen dem Federvieh nur selten über den Schnabel. Sein Name war Sir Howard, und ein solch launischer Vogel war ihr noch nie untergekommen. Obwohl sie zugeben musste, von Vögeln keine Ahnung zu haben. Ein Satz, den sie nur einmal laut gesagt hatte. Seither brüllte Scott jedes Mal, wenn sie den Pub betrat: Claire hat vom Vögeln keine Ahnung.
Der Kakadu ließ keine Gelegenheit aus, sie zu beleidigen. Vor allem, wenn sie sich umzog oder nackt aus der Dusche kam. Dann verdrehte er den Kopf, plusterte sich auf, und streckte die Flügel aus, während er ein pfeifendes Geräusch machte und Dinge schnatterte wie »Igittigittigitt! Ekel, du Ekel, bah!«. Und wenn sie ihn dann strafend ansah, drehte er sich weg, blickte selbstverliebt in den kleinen runden Spiegel, der in seinem Vogelgefängnis hing, und krächzte: »Schöner Vogel, na du, schöner Vogel.«
Sie warf ein Handtuch über Sir Howards Käfig, schaltete den Fernseher an und biss genüsslich in das Stück Salamipizza, das zwar kalt, aber trotzdem extrem lecker war. So wie fast alles unfassbar gut schmeckte, wenn man über eine Promille im Blut hatte.
Im Fernsehen lief Pretty Woman. Claire liebte und hasste diesen Film gleichermaßen. Wenn es wirklich so einfach wäre, seine große Liebe zu finden, dann wäre sie auch Prostituierte geworden, war ihr letzter Gedanke, bevor ihr die Augen zufielen.
Ausgeliefert. Es gab keine Warteschlange. Sie war die Einzige, die auf der Achterbahn Platz nahm. Und das ausgerechnet auf dem schlimmsten Platz – direkt in der ersten Reihe. Der unmotiviert dreinblickende Mitarbeiter des Freizeitparks presste den Schulterbügel herunter, aber sie hörte, dass die Verriegelung nicht richtig einrastete. Sie rüttelte an der Befestigung, die viel zu locker saß. Sie schrie nach dem Mitarbeiter, der ihr nur mit der Hand signalisierte, dass sie sich beruhigen solle. Er drückte einen großen Knopf, und die Fahrt begann mit einem harten Ruck. Sie klammerte sich an die Schulterbügel und versuchte, sie näher an ihren Körper zu drücken, aber ihr fehlte die Kraft. Sie schrie, doch kein Ton kam aus ihrer Kehle, und die Achterbahn wurde eine gefühlte Ewigkeit bergauf gezogen. Wo es hochgeht, geht's auch wieder runter, hörte sie eine Stimme, die klang wie die ihres Vaters. Doch er war nicht bei ihr. Niemand war bei ihr. Sie war allein. Und machtlos.
Sie erreichte die Kuppe, ein kurzes Gefühl der Schwerelosigkeit, gefolgt von einer rasanten Abfahrt. Endlich löste sich die Klammer um ihre Luftröhre, sie schrie, und das Echo ihres Schreis hallte ihr entgegen. Der Sicherheitsbügel sprang auf, und sie wurde aus dem Sitz geschleudert. Sie hielt sich nur noch an dem Metallgriff fest und baumelte einem tödlichen Abgrund entgegen. Sie sah den Looping, nahm ihn, wirbelte herum und verlor den Halt. Sie fiel ins Leere, fiel und fiel ... und plötzlich befand sie sich in einem Zug, der entgleiste, in einem Auto, das sich überschlug, in einem brennenden Flugzeug, das auf den Boden zuraste. Doch bevor es aufschlug, wurde Claire wach. Schweißgebadet. Aber glücklich, am Leben zu sein.
Normalerweise liebte Claire es aufzuwachen, bevor der einen Herzinfarkt auslösende Alarm ihres Weckers schrillte. Sie war kein Morgenmensch, aber wenn sie von allein wach wurde, bedeutete das, dass der Tag gleich besser begann. Ein gemütlicher Kaffee am Fenster ihres Dachgeschossappartements. Eine lange Dusche, vielleicht mit Haarkur und Peeling. Es war herrlich, wenn sie vor der Arbeit etwas Zeit hatte, sich noch ein wenig um sich selbst zu kümmern, bevor sie sich acht Stunden lang mit den Belangen anderer beschäftigte. Normalerweise fühlte Claire sich dann wunderbar erholt. Aber nicht nach Träumen wie diesen, die sie regelmäßig heimsuchten. Sie hatte schon alles Mögliche versucht: natürliche Schlafmittel, Kräutertinkturen und Tees bis hin zu Einschlafritualen und Hypnose. Doch die Albträume waren seit der hochgepriesenen Hypnosetherapie sogar noch schlimmer geworden. Claire war bereit, sich mit ihrem Schicksal zu arrangieren, ihr Unterbewusstsein jedoch war es nicht.
Sie war hellwach, obwohl es draußen noch stockduster war. Jetzt aufzustehen, würde wenig Sinn machen, also schloss sie für einen kurzen Moment die Augen. Sie spürte, wie ihr Herzschlag langsamer wurde, ihre Atmung sich beruhigte. Es war nur ein Traum, Claire, sagte sie sich immer wieder. Nur ein Traum. Und wenn sie es jetzt schaffen würde, einfach an nichts zu denken, dann konnte sie vielleicht behaupten, so etwas wie meditiert zu haben. Schalte den Kopf aus ... höre tief in dich hinein ...
Als sie die Augen wieder öffnete, war es taghell. Von wegen meditieren – sie war eingeschlafen. Doch sie fühlte sich bereit, voller Elan in den Tag zu starten. Und als sie sich aufsetzte und einen Blick auf die Uhr warf, wurde ihr schlagartig klar, warum.
Es war schon nach zehn. Geistesabwesend hatte sie ihren Wecker ausgeschaltet, als sie in der Nacht aufgewacht war. Schon vor einer Stunde hätte sie auf der Arbeit sein müssen! Als sie jetzt mit einem Puls von gefühlt 210 auf der Bettkante saß, stellte sie sich die Frage, die sich wohl jeder stellte, der verschlafen hatte. Duschen? Zähneputzen? Wie viel Körperpflege war jetzt wirklich noch notwendig? Sie schnupperte an ihren Achseln. Ein paar Sprühstöße ihres Deos mussten ausreichen – es handelte sich schließlich um ein 72-Stunden-Anti-Transpirant – wobei Claire sich fragte, wozu ein Konzern ein Deo mit einer Wirkung von drei Tagen konzipiert hatte. Gab es wirklich Menschen, die sich drei Tage lang nicht wuschen?
Claire ging so effektiv vor wie ein Geheimagent im Einsatz. Sie putzte sich die Zähne auf dem Klo, bürstete ihre Haare, während sie ihre Kleidung herauslegte, schminkte sich notdürftig und huschte zwölf Minuten, nachdem sie den Fuß auf den Boden gesetzt und in die Mitternachtssnack-Pizza von gestern getreten war, aus dem Haus.
»Hast du den Vogel gefüttert?«, rief ihr Vater.
Claire stand auf dem gepflasterten Weg, der durch den Vorgarten führte, und drehte sich zum Haus um. Aber da war niemand. »Hallo?« Ein Hirngespinst? Wurde sie verrückt?
»Was ist mit Sir Howard?« Wieder die Stimme ihres Vaters, irgendwo im Vorgarten musste er sein.
»Dad?« Claire sah sich um, als sie plötzlich die Blätter des großen Ahorns, unter dem sie stand, rascheln hörte.
»Hier oben. Im Baumhaus.«
Das Baumhaus, das Claire und ihr Bruder als Kinder geliebt hatten, bestand nur noch aus drei von Moos und Dreck zusammengehaltenen Holzbalken, die früher einen Teil des Bodens gebildet hatten. Weder von den Wänden noch dem Dach war etwas übrig geblieben. Und lebensmüde, wie ihr Vater war, saß er dort oben, paffte seine Pfeife und ließ den Blick über die Nachbarschaft schweifen.
Sie und ihr Vater hatten genaue Verhaltensregeln für ihr Zusammenleben definiert. Besser gesagt: Claire hatte sie festgelegt. Das Dachgeschoss gehörte ihr, sie hatte einen eigenen Eingang, und sie hatten sich vorgenommen, so zu tun, als würden sie nicht im selben Haus wohnen. Natürlich gelang das so gut wie nie.
Claire hätte einfach gehen können, ihn dort oben im Baum zurücklassen. Aber zu sehen, wie entspannt ihr Vater seine Beine von dem Balken baumeln ließ, machte sie von Sekunde zu Sekunde nervöser, und sie würde im Büro an nichts anderes denken können als daran, seine Leiche im Vorgarten zu finden, wenn sie nach Hause kam. Vermutlich noch mit Pfeife im Mund und einem breiten Grinsen auf den Lippen.
»Guten Morgen«, sagte Claire und legte den Kopf in den Nacken. »Was machst du da oben? Komm runter! Nicht, dass du noch fällst.«
»Und warum fallen wir, Claire?« Es war nicht wirklich eine Frage. An dem bedeutungsschwangeren Tonfall, den ihr Vater anschlug, erkannte sie sofort, dass es sich wie immer nur um ein Filmzitat handeln konnte.
»Keine Ahnung«, seufzte sie. »Schwerkraft?«
»Also bitte, Kind. Das ist aus Batman begins. Als Alfred nach dem Tod der Eltern dem kleinen Bruce Wayne erklärt, dass ... Ach, was rede ich. Das musst du doch wissen!«
»Batman kann ja auch fliegen. Jetzt komm runter.«
»Batman kann ... was? Habe ich etwa eine Tochter großgezogen, die Batman und Superman nicht auseinanderhalten kann?«
»Kann der nicht auch fliegen? Fledermaus und so?«
Ihr Vater schüttelte energisch den Kopf. »Batman ist ein Mensch wie du und ich.«
Claire kannte niemanden, der ein so großer Filmfan war wie ihr Vater. Als Kind hatte sie sich beinahe eine Ohrfeige eingehandelt, als sie mit einem Stock gespielt und so getan hatte, als wäre er ein Lichtschwert und dabei gesagt hatte: Guck mal, Dad! Ich bin Mister Spock. Wer Starwars und Star Treck nicht unterscheiden konnte, galt für ihren Vater als ungebildet. Geometrie und Algebra waren weniger wichtig, als die Namen der Hobbits aus Der Herr der Ringe zu kennen oder alle Teile von Der Pate vorwärts und rückwärts gesehen zu haben. Die absolute Meisterleistung bestand darin, so etwas wie eine Verbindung zwischen dem weißen Kaninchen in Alice im Wunderland und dem in Matrix zu sehen.
»Jetzt komm da runter, Batman. Ich muss zur Arbeit.«
»Soll ich dich fahren?«, fragte er.
Sie schickte ihrem Vater einen alles sagenden Blick. »Sehr witzig.«
»Einen Versuch war es wert.« Er lachte. Es war ein warmes, kratziges Lachen und so tief, dass man es in der Magengrube spürte. »Apropos fliegen, was ist jetzt mit dem Vogel?«
»Ach, Scheiße.« Claire hatte den Kakadu komplett vergessen. Das Handtuch lag noch über seinem Käfig. Und ihr fiel es von Tag zu Tag schwerer, es morgens herunterzunehmen.
Sir Howard hatte Claire durch sein Verhalten mehr als einmal klargemacht, dass er sie abstoßend fand, und sie war heilfroh, ihn an diesem Tag wieder loszuwerden. Leslies dreiwöchiger Frankreich-Urlaub war vorbei, und Claire würde ihr nachher auf der Arbeit ein für alle Mal erklären, dass sie den Vogel nie wieder betreuen würde.
Ihr Vater hingegen fand den Kakadu toll und hatte ihm in den letzten zwei Wochen sogar seinen Namen beigebracht. Jetzt hieß es: »William. Na du, William, schöner Vogel.« Warum auch immer, aber wenn ihr Vater nach Sir Howard sah, kreischte dieser nicht direkt laut los, sondern ließ sich kraulen und überhäufte ihn mit Komplimenten. Claire nahm an, dass sie es schlichtweg mit einem frauenfeindlichen Vogel zu tun hatte, aber Leslie hatte nichts dergleichen erwähnt.
»Hast dich wieder nicht getraut, ihn heute Morgen zu wecken, was?« Anscheinend konnte ihr Vater Gedanken lesen. Zumindest die seiner Tochter. »Vögel spüren, wenn du Angst vor ihnen hast.«
»Ich dachte, das wären Hunde. Außerdem ist es keine Angst. Es ist nacktes Grauen. Kannst du dich um ihn kümmern?«, bat Claire.
Ihr Vater streckte sich, packte das Seil, das neben ihm an dem Ast befestigt war, und schwang sich daran hinunter auf den Rasen, wobei er ein tarzanmäßiges »Huahuahua« ausstieß. »Mach ich, Liebes. Und es bleibt bei heute Abend, ja?«
»Als ob ich eine Wahl hätte.«
»Ich bin doch auch nur ein Vater, der vor seiner Tochter steht und sie bittet ...«
»Notting Hill. Hab's verstanden. Und wenn ich aussehen würde wie Julia Roberts, wäre ich bestimmt nicht mehr Single.«
»Du siehst fast so aus wie sie. Obwohl ... noch mehr erinnerst du mich an Emma Stone.« Tatsächlich ließ sich eine gewisse Ähnlichkeit mit der rothaarigen Schauspielerin nicht abstreiten. Allerdings waren Claires Haare nicht gefärbt, sondern von Natur aus rotbraun. Und zudem hatte Claire grüne und keine blauen Augen. Und ihr Vater merkte in diesem Moment ungefragt noch einen Unterschied an: »Du hast was von Emma Stone, definitiv. Nur mit etwas mehr auf den Rippen. Aber das mögen die Männer.«
»Danke, Dad, das schreib ich in mein Online-Dating-Profil. Ich sehe aus wie eine dicke Emma Stone.«
Und statt Nein, Schatz, du bist nicht dick oder wenigstens etwas dergleichen zu äußern, sagte er: »Du machst endlich Online-Dating? Wie toll!«
»Nein, immer noch nicht. War ein Witz.« Es war die Wahrheit, aber Claire hatte keine Lust, ihrem Vater von ihren Online-Dating-Experimenten zu erzählen, die immer gleich ausgingen – nämlich frustrierend.
»Na, ein Blind Date wird dich schon nicht umbringen. Und er ist ein Freund von Jake. Der wird schon nett sein.«
»Wenn du das sagst.« Claire gab ihrem Vater einen flüchtigen Kuss auf die Wange und ging zu ihrem Fahrrad, während sie fieberhaft überlegte, wie sie das Date mit Jakes Kumpel Mortimer absagen könnte, ohne dass es ein schlechtes Licht auf ihren Bruder warf. Wer nannte sein Kind schon Mortimer? Das ließ nur den Schluss zu, dass dieser Typ seltsame Eltern haben musste. Und seltsame Eltern zeugten noch seltsamere Kinder. Deshalb hatte sie schon allein wegen seinem Namen keine Lust, Mortimer kennenzulernen. Wenn sie ehrlich war, hatte sie nie große Lust, irgendwen kennenzulernen. Genau deshalb war sie seit Jahren glücklicher Single. Auch wenn das glücklich eher als zufrieden oder ganz okay zu bezeichnen war. Claire fummelte das Schloss vom Reifen ihres Fahrrads und machte sich endlich auf den Weg in das Reisebüro, in dem sie bereits ihre Ausbildung gemacht hatte.
Ihre Chefin Victoria würde es ihr sicherlich nicht übel nehmen, dass sie mehr als eine Stunde zu spät kam, denn in der Regel war sie ihre verlässlichste Mitarbeiterin. Die Konkurrenz war allerdings nicht groß, denn bis auf Victoria gab es nur noch Sir Howards Frauchen Leslie, für die mit ihren Anfang zwanzig das Leben eine einzige Party war. Claire kam sich mit ihren gerade einmal vierunddreißig manchmal vor wie Leslies Mutter.
Sie radelte durch Richmond, den in ihren Augen schönsten Teil Londons. Sie liebte es hier. Allein wegen des riesigen immergrünen Parks, in dem es sogar wilde Hirsche gab – von denen sie allerdings noch nie einen gesehen hatte, obwohl sie fast jeden Tag hier war. Langsam hielt sie es für einen Mythos. Die einzigen wilden Tiere hier waren Eichhörnchen, die dank der Touristen immer fetter wurden und kaum noch von Ast zu Ast springen konnten. London war eine volle Stadt, Menschen quetschten sich eng aneinander in die U-Bahn – selbstverständlich andere Menschen, nicht Claire. Doch im Park konnte sie die Weite genießen, ein angenehmes Gefühl von Isoliertheit. Die idyllische Landschaft ließ sie völlig vergessen, dass sie sich inmitten einer hektischen Metropole befand. Zumindest wenn sie die Tatsache ignorierte, dass alle vierzig Sekunden ein Flieger über Richmond Richtung Heathrow donnerte. Und es – wie auch heute – regnete. Claire war die Einzige, die bei diesem Wetter mit dem Rad unterwegs war. Natürlich wäre sie mit der Bahn oder dem Auto um einiges schneller am Ziel gewesen, aber sie mied jegliche elektrischen oder motorisierten Fortbewegungsmittel. Und meiden war da ein ziemlicher Euphemismus.
Sie war seit ihrem dreizehnten Lebensjahr weder in ein Auto noch in einen Zug oder gar ein Flugzeug gestiegen. Und an Deck eines Schiffes brachten sie keine hundert Pferde – hatte denn niemand den Film Titanic gesehen? Zudem gab es absolut keinen Grund, die nähere Umgebung ihrer Wohnung zu verlassen. Alle Geschäfte des täglichen Bedarfs waren fußläufig erreichbar, wie es immer hieß. Was sie nicht in der näheren Umgebung besorgen konnte, bestellte sie online. Auch wenn ihr Umweltbewusstsein sie wissen ließ, dass das nicht nachhaltig war. Aber im Vergleich zum Durchschnitt lebte sie vermutlich fast so klimaneutral wie Greta Thunberg.
Claire hatte England noch nie verlassen. Ein Fakt, den sie gekonnt unter den Tisch fallen ließ, wenn sie ihren Kunden Reisen zu den exotischsten Orten der Welt verkaufte. Auf der Arbeit gab sie vor, bereits die halbe Welt kennengelernt zu haben. Und das fiel ihr nicht mal schwer. Selbst ihrer Chefin war das bisher nicht aufgefallen. Wenn Claire Urlaub nahm, behauptete sie regelmäßig, eine Reise anzutreten. Das geschah aber nur in ihren Gedanken. Stattdessen schaute sie sich sämtliche Dokumentationen über das Land an, in das sie angeblich fuhr, las Bücher und Artikel darüber, träumte sich in die Ferne und sorgte durch ihr theoretisches Wissen dafür, dass sie so gut wie jedem vormachen konnte, dort gewesen zu sein. So weit gegangen, ein Foto vor einer tropischen Fototapete als Urlaubsbild auszugeben, war sie allerdings noch nicht. Doch wenigstens ihr Gaumen konnte nahezu jedes Land erkunden. Spanische Tapasbars, indische Restaurants und unzählige andere kulinarische Angebote gab es vor Ort, nicht zuletzt Chinatown. Um die Welt zu bereisen, musste Claire London nicht verlassen.
Von Europa über Asien nach Afrika, Südamerika bis Polynesien – sie interessierte sich sehr für fremde Kulturen und ferne Länder und wenn es jemals möglich sein sollte, sich dorthin zu beamen, wäre sie vermutlich die Erste in der Schlange. Aber solange es nötig war, dafür in ein Auto, einen Zug oder ein Flugzeug zu steigen, blieb Claire in England und radelte mit ihrem treuen roten Drahtesel durch den Regen.
KAPITEL 3
»Falls ich in fünf Minuten nicht zurück sein sollte, warten Sie einfach etwas länger.«
Ace Ventura in Ace Ventura – Ein tierischer Detektiv!
Tropfnass kam Claire im Reisebüro an und sah sich nach Leslie um, doch am Schreibtisch ihrer Kollegin war niemand. Victorias Arbeitsplatz, der mehr einem hermetisch abgeriegelten Glaskasten als einem Büro glich, lag am Ende des großen Raums. Alles war vollgekleistert mit Bildern von malerischen Stränden, Sehenswürdigkeiten und Angeboten für Kreuzfahrten. Ihre Chefin winkte sie in ihr Büro.
Victoria trug an diesem Tag einen kurzen Lederrock und eine weit ausgeschnittene weiße Bluse, durch die man ihren schwarzen Spitzen-BH deutlich mehr als nur erahnen konnte. Und wieder fiel Claire auf, wie verdammt sexy sie aussah – und das mit Anfang fünfzig. Sie hatte volles, lockiges dunkelbraunes Haar, das sie meist offen trug, grüne Augen und lange Wimpern, von denen Claire sich immer fragte, ob sie echt waren oder so professionell angeklebt, dass man den Unterschied nicht bemerkte. Dazu hatte diese Frau eine Figur, um die sie viele weibliche Mitstreiter – darunter auch Claire – beneideten. Victoria war schlank, aber nicht dürr. Sie hatte einen runden, knackigen Po, ein üppiges C-D-Körbchen, einen flachen Bauch und lange Beine. Sie war eine der Frauen, deren Oberschenkel sich nicht berührten. Wenn Victoria vor ihr stand, schien die Sonne durch ihre Beine, da, wo Claires Schenkel aneinanderrieben. Was vor allem im Hochsommer unangenehm werden konnte.
Sie streifte ihre nasse Regenjacke ab, hängte sie über ihre Stuhllehne und ging zu ihrer Chefin, die sie mit besorgter Miene begrüßte. »Wenigstens du tauchst heute noch auf.«
»Sorry«, entschuldigte sie sich. »Ich hab verschlafen. Kommt nicht wieder vor.«
»Du? Verschlafen? Was ist denn los? Kam gestern ein Stirb-langsam-Marathon, und dein Vater hat dich gezwungen, das mit ihm anzusehen?« Victoria lachte kurz, wurde aber schnell wieder ernst, was für sie sehr ungewöhnlich war. Claires Chefin war normalerweise stets gut gelaunt, und sie hatte sie noch nie wütend oder bekümmert erlebt. Der Gesichtsausdruck, den sie heute an den Tag legte, war neu. Etwas musste passiert sein.
Claires Gedanken überschlugen sich. Dem Reisebüro ging es finanziell gesehen nicht besonders gut. Die meisten Leute buchten ihre Reisen inzwischen online, und es war nur eine Frage der Zeit, bis Claire durch einen Logarithmus ersetzt werden würde.
»Setz dich.« Victoria deutete auf den Stuhl ihr gegenüber.
»Ist was passiert?«, fragte Claire, als sie Platz nahm.
»Es geht um Leslie. Sie ist nicht da.«
»Vielleicht hat sie ihren Urlaub verlängert?«
»Ohne Bescheid zu geben? Obwohl ... na ja ... ungewöhnlich für sie wäre das nicht. Da hast du recht.«
»Hast du es auf ihrem Handy versucht?«, fragte Claire, die sich auch schon darüber gewundert hatte, dass sie in den letzten zwei Wochen nichts von ihrer Kollegin gehört hatte. Normalerweise schickte Leslie hin und wieder ein Urlaubsfoto, wenn sie unterwegs war. Zudem betreute Claire zum ersten Mal den Kakadu, und Leslie hatte sich nicht ein einziges Mal nach ihm erkundigt. Vielleicht war ihr der Vogel aber auch einfach egal, was bei seinem unausstehlichen Verhalten nur verständlich gewesen wäre.
»Natürlich habe ich das. Da springt direkt die Mailbox an.« Victorias PC gab einen Piepton von sich, eine Mail war eingegangen. Ihre Chefin überflog sie und sprach nebenbei weiter. »Ich habe ihr eine Nachricht hinterlassen.«
»Ich hab jedenfalls auch nichts von ihr gehört.«
Victoria konzentrierte sich wieder auf Claire. »Aber ihr seid doch befreundet. Also privat. Oder nicht?«
»Ja, irgendwie schon ...«
»Aber irgendwie auch nicht?«
»Doch, wir sind Freundinnen ... denke ich.«
Victoria sah sie schief an. Claire wusste nicht recht, was sie dazu sagen sollte. Man sprach nicht so über den Status einer Freundschaft wie über den Stand einer Beziehung. Sind wir jetzt fest zusammen?, war zu gegebener Zeit eine legitime Frage, aber Sind wir jetzt richtig befreundet oder nur Kollegen?, so was fragte man nicht. Leslie und sie unternahmen regelmäßig etwas zusammen und verstanden sich gut. Aber Leslie hatte auch viele Interessen, die Claire nicht teilte: Party machen bis zum nächsten Morgen, ständig Typen abschleppen – nicht zu vergessen Haustiere wie Kakadus. Aber irgendwie war Leslie die einzig greifbare Freundin, die sie hatte, und Claire vertraute ihr. Sie hatten manchmal nächtelang einfach nur geredet, Musik gehört, gelacht und rumgealbert. Leslie war ihr ans Herz gewachsen, sie war die kleine Schwester, die Claire nie hatte.
»Ich habe von Anfang an gedacht, dass es für eine junge, attraktive Frau wie sie keine gute Idee ist, allein zu verreisen«, sagte Victoria. »Aber sie wollte sich ja unbedingt ins große Abenteuer stürzen. Leslie ist so schrecklich unbekümmert, was das angeht. Aber was soll ich sagen? Ich war nicht anders in dem Alter.«
»Ich könnte ihre Eltern anrufen und mich erkundigen, ob sie wissen, was los ist«, schlug Claire vor.
»Gut, gut. Mach das.« Victorias PC piepte erneut, diesmal mehrfach hintereinander. »Und dann ran an die Arbeit.« Sie bedeutete Claire mit einem kurzen Wink, dass das Gespräch beendet war, und Claire verließ den Glaskasten.
Froh, dass es nicht um das Thema Kündigung ging, aber trotzdem besorgt, Leslie könnte etwas zugestoßen sein, suchte sie die Nummer von Leslies Eltern heraus, die regelmäßig im Reisebüro vorbeikamen und bei ihrer Tochter alles buchten – egal ob Fernreise oder Tickets für eine Londoner Touristenattraktion wie Madame Tussauds.
Claire fand die Telefonnummer bei den Kundendaten in ihrem PC und wählte. Kurz darauf meldete sich eine trällernde Frauenstimme.
»Hallo?«
»Hallo, Mrs Simpson, hier ist Claire Carter, die Kollegin Ihrer Tochter.«
»Ach, Claire, Darling, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst mich Samantha nennen?«
»Heute ist Leslies erster Arbeitstag nach ihrem Urlaub, aber sie ist bisher nicht aufgetaucht. Haben Sie von ihr gehört?«
»Oh, Darling, das muss jetzt schon über eine Woche her sein. Oder? Warte mal ... Bill!«, schrie Samantha, ohne den Hörer vom Mund wegzubewegen, sodass Claires Ohren klingelten. »Bill, Liebling, wann haben wir zuletzt mit Leslie telefoniert?«
Claire konnte Leslies Vater durchs Telefon hören. »Habe ich mit ihr geredet oder du?«
»Nicht wer, sondern wann!«, fauchte Samantha ihren Ehemann an.
»Was weiß ich. Da drüber führe ich nicht Buch «, antwortete er wesentlich entspannter, als Claire erwartet hätte.
»Also, Darling«, wandte Samantha sich wieder an Claire, »es ist bestimmt schon eine Woche her. Frankreich hat ihr super gefallen. Vor allem wegen den Männern, wenn du verstehst ...«
»Hat sie jemanden kennengelernt?«
»Sie hat es nur angedeutet, aber ich kenne meine Tochter. Sie hatte diesen verträumten Ton in ihrer Stimme, weißt du. Wie ihn nur junge Frauen haben, die noch von den Männern umschwärmt werden.« Claire spürte, dass der letzte Satz an Bill und nicht an sie gerichtet war.
»Wir machen uns einfach nur Sorgen, weil wir sie nicht erreichen können.«
»Ach, Darling, Leslie kann gut auf sich allein aufpassen. Du kennst sie doch.«
Eben, dachte Claire. Sie kannte Leslie. Sie war zwar nicht dumm und äußerst selbstbewusst, aber sie war erst einundzwanzig und in manchen Punkten noch ziemlich naiv. Sie wäre mit jedem mitgegangen, der ihr eine tolle Party versprach, und hätte jede Droge eingeschmissen, um gut draufzukommen. Das wollte sie ihrer Mutter aber natürlich nicht sagen. »Es ist nur so ungewöhnlich, dass sie nicht an ihr Handy geht«, sagte Claire, und das entsprach definitiv der Wahrheit, denn normalerweise war Leslie mit ihrem Smartphone verwachsen.
»In der Tat, das ist seltsam ... Bill!«, brüllte Samantha erneut ins Telefon, aber diesmal war Claire vorbereitet und hielt den Hörer schnell von ihrem Ohr weg. »Bill, Leslie ist weg.«
»Wie, weg?«, wollte ihr Mann wissen, der dem Geräuschpegel nach jetzt direkt neben seiner Frau stand.
»Nicht auf der Arbeit und nicht erreichbar«, erklärte sie ihm. »Vielleicht sollten wir die Polizei einschalten?«