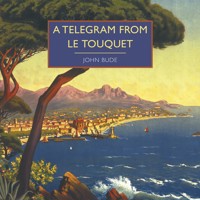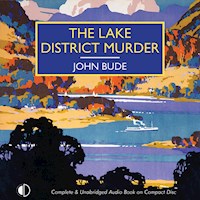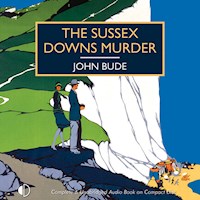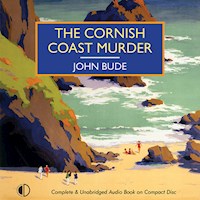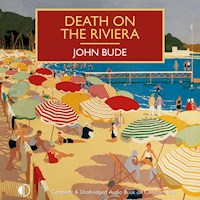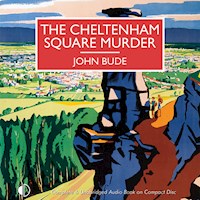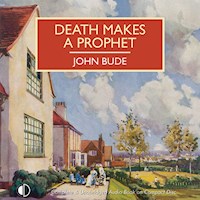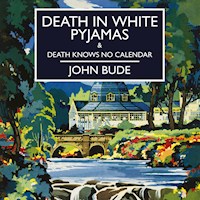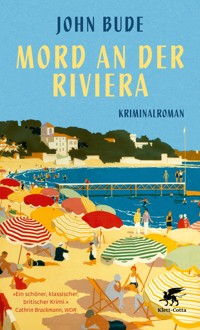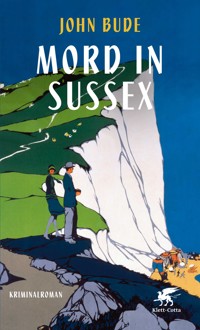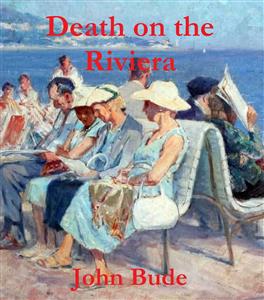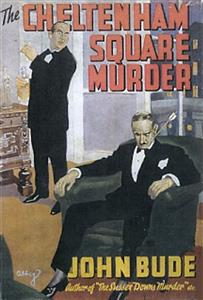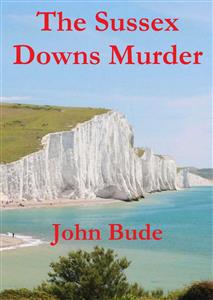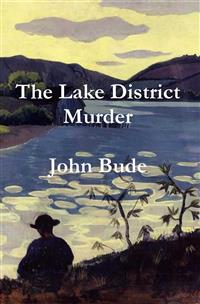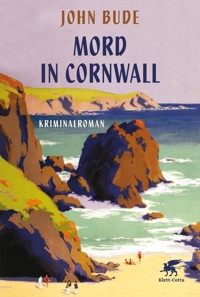
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Krimi
- Serie: British Library Crime Classics
- Sprache: Deutsch
Reverend Dodd ist Vikar in einem sonnigen Fischerdorf an der Atlantikküste Cornwalls. Die Abende verbringt er damit, in seinem Lehnsessel Krimis zu schmökern. Gott bewahre, dass der Schatten eines echten Verbrechens auf seine kleine Seegemeinde fällt. Doch der Frieden des Vikars wird in einer stürmischen Nacht empfindlich gestört, als der unbeliebte Richter Julius Tregarthan tot in seinem Haus aufgefunden wird. Polizeiinspektor Bigswell hätte nie damit gerechnet, in seinem ruhigen Küstendorf mal einen Mord aufklären zu müssen. Da verwundert es nicht, dass er bei der Frage nach dem Tathergang oder den Motiven schnell an die Grenzen seiner Vorstellungskraft stößt. Glücklicherweise hat der Vikar als eifriger Leser von Kriminalromanen davon mehr als genug. Und er ist bereit, seinen scharfen Verstand an dem Mordfall zu beweisen. Als jedoch Ruth, die Nichte des Ermordeten, und ihr Freund zu Hauptverdächtigen werden, verliert Vikar Dodd den Spaß am Detektivspiel. Nun gilt es, die beiden von jedem Verdacht zu befreien. Aber kann er auch den rätselhaften Mord ohne Spuren aufklären? Oder braucht er dafür göttlichen Beistand?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
John Bude
Mord in Cornwall
Deutsch von Eike Schönfeld
Mit einem Nachwort von Martin Edwards
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien 1935 unter dem Titel »The Cornish Coast Murder« bei Skeffington & Son, London.
2014 wurde der Roman wiederveröffentlicht von der British Library, London.
© 2014 by Estate of John Bude
Nachwort © 2014 by Martin Edwards
Für die deutsche Ausgabe
© 2018, 2020 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: ANZINGER UND RASP Kommunikation GmbH, München
unter Verwendung einer Illustration von © NRM/Pictorial Collection/Science & Society Picture Library
Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98320-3
E-Book: ISBN 978-3-608-11029-6
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
Kapitel 1
Mord!
Kapitel 2
Die nicht zugezogenen Vorhänge
Kapitel 3
Das Rätsel der Fußspuren
Kapitel 4
Ruth Tregarthans seltsames Verhalten
Kapitel 5
Der Inspector erstellt eine Theorie
Kapitel 6
Der fehlende Revolver
Kapitel 7
Ein Gespräch im Pfarrhaus
Kapitel 8
War es Ronald Hardy?
Kapitel 9
Unter einer Decke?
Kapitel 10
Der eine Schuss
Kapitel 11
Leichenfledderei
Kapitel 12
Das offene Fenster
Kapitel 13
Gerichtliche Leichenschau
Kapitel 14
Der Zettel
Kapitel 15
Cowper macht eine Aussage
Kapitel 16
Der Pfarrer macht ein Experiment
Kapitel 17
Ronald Hardy Tritt Auf
Kapitel 18
Perfektes Alibi
Kapitel 19
Wieder Vereint
Kapitel 20
Der kleine Schneider von Greystoke
Kapitel 21
Des Rätsels Lösung
Kapitel 22
Geständnis
Kapitel 23
Der Pfarrer erklärt
Martin Edwards
Nachwort
Kapitel 1
Mord!
Reverend Dodd, Pfarrer von St.-Michael’s-on-the-Cliff, stand am Fenster seines behaglichen Junggesellenstudierzimmers und schaute in die Nacht hinaus. Es regnete heftig, und Windböen vom Atlantik her rüttelten an den Fensterrahmen und heulten jämmerlich in den wenigen dürren Fichten, die das Pfarrhaus umstanden. Es war eine bedrohliche Nacht. Kein Mond. Doch weit hinten am Horizont überm Meer lag vor dem schwindenden Licht des Tages eine finstere Wolkenbank.
Der Pfarrer, leiblichen Annehmlichkeiten durchaus zugeneigt, seufzte in tiefster Zufriedenheit. Hinter ihm im offenen Kamin prasselte ein stattliches Holzfeuer. Eine Leselampe warf einen orangefarbenen Kreis über den Sitz seines Lieblingssessels, ihr Licht schimmerte schwach auf den vielfarbigen Bücherrücken, welche einen Großteil des Zimmers säumten. Mitten auf dem Kaminteppich stand, exakt zwischen den beiden Sesseln, eine kleine Holzkiste.
Der Pfarrer seufzte erneut. Alles war genau so, wie es sein sollte. Nichts an der falschen Stelle. Alles ging seinen bedächtigen Gang wie in den letzten fünfzehn Jahren. Friede, vollkommener Friede.
Er warf einen letzten Blick aus dem Erkerfenster und suchte dabei die stockfinstere Straße nach dem Wagen des Arztes ab. Er schaute kurz auf die Wanduhr. Zwanzig Minuten nach sieben. Ach … noch zehn Minuten bis zum Abendessen, der alte Halunke verspätete sich ja nie. Zu ihrer kleinen montagabendlichen Zeremonie kam er immer pünktlich, darauf war Verlass. Sie beide hätten sie um nichts auf der Welt versäumt. In einem abgeschiedenen Dorf wie Boscawen mit seinen rund vierhundert Seelen waren solche altehrwürdigen Bräuche für Männer der gehobenen Stände wie Pendrill und den Pfarrer die reine Wonne.
Dodd schloss die schweren Vorhänge vor dem düsteren Spektakel, das ganz nach einem nahenden Unwetter aussah, und machte es sich mit seinem Spectator bequem, um auf seinen Gast zu warten.
Nach fünf Minuten hörte er einen Wagen die Zufahrt heraufrauschen und ein munteres Hupen, als er das Fenster passierte, beinahe sofort gefolgt vom Klingeln der Türglocke.
Gleich darauf schüttelte Pendrill seinem ältesten Freund die Hand, wobei er sich über das üble Wetter beklagte.
»Genau zur rechten Zeit«, scherzte der Pfarrer. »Ich wollte den Sherry schon allein verkosten. Setzen Sie sich, mein Lieber, und wärmen Sie sich die Zehen, bis der Gong ertönt.«
Der Arzt ließ sich, behaglich ächzend, nieder und nippte an dem Sherry.
»Gibt’s was Neues?«, fragte der Pfarrer.
Das war eine seiner beliebtesten Gesprächseröffnungen. Er fand, dass es die Leute zum Reden brachte. Nicht, dass Pendrill in diese Richtung ermuntert zu werden brauchte. Er konnte stundenlang dasitzen und ohne die geringsten Ermüdungserscheinungen aus dem Nähkästchen plaudern.
»Ach, nichts weiter. Nur das Übliche. Ein Schnitt in die Hand, zweimal Rheuma, ein Nagelgeschwür und ein Fall von Masern.«
»Masern?«
»Fred Rutherford – einer Ihrer Chorcherubim, glaube ich. Unverbesserlich, der Bengel. Macht immer nur Ärger im Dorf.«
Die Pausbacken des Pfarrers weiteten sich zu einem gütigen Lächeln.
»Die Masern dürften aber eher Begeisterung auslösen – jedenfalls bei der jüngeren Generation. Ich weiß noch, als ich ein Junge war, bejubelten wir eine Epidemie immer als ein Geschenk Gottes. Da wurde nämlich die Schule geschlossen.«
Der Arzt nickte. Er wusste nie so recht, ob er sich hinsichtlich seiner Arbeit Leichtfertigkeiten erlauben durfte. Über die Chorknaben und Wohltätigkeitsveranstaltungen des Pfarrers machte er sich durchaus gern lustig, medizinische Dinge dagegen waren doch etwas ganz anderes.
Der Gong erschallte melodisch im Flur.
»Ah«, sagte der Pfarrer und wurde sogleich hellwach. »Essen!«
Er wackelte auf seinen kurzen Beinen hinter der knochigen Gestalt seines Gastes ins Esszimmer.
Später kam der Arzt ganz unvermeidlich auf seine kleine Welt der Stethoskope und Fieberthermometer zurück.
»Übrigens, fast hätte ich’s vergessen. Eine gute Nachricht für Sie. Es sieht ganz so aus, als wären Sie für eine doppelte Taufe gebucht.«
»Ach ja?«
»Mrs. Withers – Zwillinge.«
»Du liebe Güte – wann?«
»Heute Nacht. Ich komme eben von dort. Ich habe Mrs. Mullins bei ihr gelassen.«
»Zwillinge«, sinnierte der Pfarrer. »Sehr ungewöhnlich. Ich erinnere mich an kein anderes Paar im Dorf, seit Mrs. Drears uns damit überrascht hat – mal überlegen. Vor sechs Jahren.«
»Sieben«, korrigierte ihn der Arzt. »Ich war dabei.«
Der Pfarrer lächelte etwas wehmütig über dem Haufen Nussschalen, der sich auf seinem Teller ansammelte.
»Es geht immer weiter«, sagte er leise. »Fünfzehn Jahre, und alles geht seinen alten Gang. Geburten, Hochzeiten, Tode. Allesamt große Ereignisse. Ich denke mal, Pendrill, unsere erfolgreicheren Kollegen würden sagen, wir verschwenden unser Leben in einem verschlafenen Nest. Hier passiert nie etwas. Nichts! Alles fließt langsam und geruhsam dahin, aber Gott bewahre, dass sich daran etwas ändert! Ich liebe diesen Flecken, Pendrill. Er ist mein Zuhause – mein geistiges Zuhause. Ich würde meine Gemeinde gegen keine andere in ganz Cornwall eintauschen.«
»Auch nicht Ned Salter?«, fragte der Arzt.
»Nein! Nein! Auch Ned nicht. Verflixt, mein Lieber, eine Seele muss ich doch retten. Was wäre denn sonst meine Stellung wert? Ich würde vor Trägheit fett werden.«
»Die Arbeit«, bemerkte der Arzt, als sie sich vom Tisch erhoben, »scheint an Ihnen nur wenige Verheerungen bewirkt zu haben. Würde ich Sie nicht besser kennen, ich würde auf eine Neigung zu Diabetes tippen.«
Sie kehrten in die Wärme und Behaglichkeit des Studierzimmers zurück, wo der Pfarrer einige mächtige Scheite aufs Feuer warf. Er hielt Pendrill eine Kiste Zigarren hin.
»Versuchen Sie mal eine«, drängte er. »Henry Clays.«
Das alles war Teil des feierlichen Montagabendrituals. Jedes Mal bot er ihm eine Henry Clay an, und jedes Mal klopfte sich Pendrill auf die Taschen und sagte, ohne die Vortrefflichkeit der Zigarren herabzusetzen, ziehe er doch seine Pfeife vor.
Der Kaffee kam. Sie ließen sich in die Sessel sinken und rauchten mit der satten Wohligkeit zweier Junggesellen, die gut gespeist hatten und sich nun im milden Licht ihrer gegenseitigen Freundschaft und Wertschätzung sonnten.
Schließlich tippte der Arzt achtlos mit dem Fuß gegen die kleine Kiste auf dem Kaminteppich.
»Da sind sie also«, sagte er beiläufig.
»Wie immer.«
»Ich glaube, diesmal haben wir eine ganze Menge. Eine sehr gute Auswahl. Ich habe mir Mühe gegeben. Jedes Mal, wenn ich an der Reihe bin, habe ich das Gefühl, ich muss Ihre treffliche Sammlung aus der Vorwoche noch überbieten.«
Der Pfarrer machte eine abschätzige Handbewegung.
»Darf ich?«, sagte er und zog ein großes, zweckmäßiges Federmesser aus der Hosentasche.
»Selbstverständlich.«
Gemächlich, als wollte er die Vorfreude verlängern, durchtrennte der Pfarrer die Schnur, womit die Kiste umwickelt war, und hob den Deckel ab. Tief in eine Polsterung aus braunem Papier eingebettet, lagen zwei Stapel grellbunter Bücher. Der Pfarrer nahm sie eines nach dem anderen heraus, begutachtete die Titel, machte eine Bemerkung dazu und legte sie auf den Tisch neben seinem Sessel.
»Eine sehr katholische Auswahl«, befand er. »Dann mal sehen – ein Edgar Wallace – ganz richtig, Pendrill, den habe ich noch nicht gelesen. Welch ein Gedächtnis, mein Lieber! Der neue J. S. Fletcher. Großartig. Ein Farjeon, eine Dorothy L. Sayers und ein Freeman Wills-Croft. Und meine alte Freundin, meine sehr liebe alte Freundin, Mrs. Agatha Christie. Neue Abenteuer dieses nicht aufzuhaltenden Burschen Poirot, hoffe ich doch. Ich muss Sie beglückwünschen, Pendrill. Da haben Sie ja das gesamte Spektrum von Verbrechen, Rätseln, Schauer und Aufklärung in sechs Bänden!«
Der Arzt hüstelte und paffte ernst an seiner Pfeife.
Man einigte sich auf eine Teilung der Beute, drei der Bände gingen an Pendrill. Diese würden dann am Donnerstag darauf gegen die des Pfarrers eingetauscht werden. Samstagabend kamen alle sechs wieder in die Kiste und wurden zur Leihbücherei in Greystoke zurückgebracht, am Freitag schickte der Pfarrer die Liste für die kommende Woche ab, nachdem er seine Wahl aus den diversen Zeitungen und Zeitschriften getroffen hatte, welche stets seinen Schreibtisch übersäten.
Jahrelang hatten der Arzt und der Pfarrer dieser indirekten, wenngleich wohl absolut verbreiteten Lust am Kriminellen gefrönt, was einer der kleinen Gemeindescherze war. Sie versuchten gar nicht erst, ihre gemeinsame Bewunderung für die Autoren zu verbergen, die mit spinnengleicher Hartnäckigkeit ein Netz woben und von dem armen, geplagten Leser erwarteten, das Muster aufzulösen und den einen Faden zu seinem Ursprung zurückzuverfolgen.
Begegneten sie einander in der Cove Street, etwa an einem Freitag, gestaltete sich ihr Gespräch ausnahmslos ungefähr so:
Der Pfarrer: »Na, Pendrill, haben Sie’s heraus?«
»Welches?«
»Natürlich das Rätsel der drei Kröten. Die anderen waren ja ein Kinderspiel.«
Dabei zwinkerte Pendrill mit einem wissenden Blick.
»Haben Sie’s erraten, Dodd?«
»Allerdings.«
»Wer?«
»Nein – ich frage Sie.«
»Ich habe den sehr starken Verdacht«, sagte der Arzt daraufhin mit der Miene eines Mannes, der keinen starken Verdacht hat, sondern ein bestimmtes Wissen, »dass es Lucy Garstein war.«
Woraufhin Reverend Dodd einen kleinen triumphalen Schrei ausstieß.
»Das habe ich mir gedacht. Hab ich’s mir doch gedacht.«
Und mit dem Blick eines Mannes, der über eine immense Weisheit verfügt, eine Art esoterisches Wissen, machte sich der Pfarrer freudig auf den Weg zum Tee mit Lady Greenow auf Boscawen Grange. Dass der alte Pendrill über so eine simple falsche Fährte stolperte! Der Mann wurde ja schon senil. Er hatte nicht mehr die Form der frühen zwanziger Jahre. Diese neuen harten, psychologischen Nüsse mit ihren vielen technischen Kniffen erwiesen sich für Pendrill doch als etwas zu schwierig. Man müsste ihn in einen Kursus bei dem jungen Conan Doyle schicken.
Vielleicht hatte der Pfarrer die Schliche des Verbrechergewerbes doch ein wenig besser als sein Mit-Leser durchschaut. Er erinnerte sich an eigenartige Wendungen aus früheren Büchern, winzige Abweichungen bei Indizien, raffinierte Aufklärungsmethoden, Fallstricke beim Verhör, all die minutiösen Kleinigkeiten, aus denen sich des Autors Requisiten bei der Abfassung von Kriminalgeschichten zusammensetzen. Sein Kopf, der nun leider rasch der Kahlheit entgegenstrebte, war randvoll mit dem Handwerkszeug des professionellen Detektivs. Häufig überraschte, ja verärgerte er seine Schäfchen mit dem Einsatz seiner sehr genauen Beobachtungen, indem er ihnen auf den Kopf zusagte, was sie an einem bestimmten Tag getan hatten. Gott, nein! – Er hatte sie nicht beschattet. Doch nicht etwas so Plumpes. Er hatte nur mittels schlichtester Deduktionsmethoden zwei und zwei zusammengezählt.
Aber der Himmel bewahre, dass auch nur der Schatten eines Verbrechens je über die grauen Steinhäuschen, die mit Ginster durchsetzten Anger und das mit Steilküsten bewehrte Meer seiner Gemeinde fiel. Viel lieber bezog er seine Aufregungen aus zweiter Hand und folgte den abstrusen Machenschaften rein imaginärer Verbrecher.
Nach der Bücherzeremonie verfielen die beiden in eine zwanglose Unterhaltung. Sie drehte sich überwiegend um das, was im Ort gesagt und getan wurde, denn weder Pendrill noch der Pfarrer fanden viel Zeit für Erquickungen und Besuche außerhalb von Boscawen.
»Was macht eigentlich unser hiesiger Literat?«, fragte der Arzt, womit er ein langes Schweigen brach. »Ich habe ihn länger nicht mehr gesehen. Arbeitet er?«
»Sehr«, erwiderte der Pfarrer. »Gibt seinem Kriegsroman den letzten Schliff. Autobiographisch, hat Ronald mir bei unserer letzten Begegnung anvertraut. Unter uns gesagt, Pendrill, der Junge sieht nicht sehr gut aus. Er kommt mir … nun, angespannt vor – fast schon verzweifelt. Überarbeitet, würde ich sagen.«
»Möglich«, lautete Pendrills unbeteiligte Antwort. »Er ist ein übernervöser Zeitgenosse. Natürlich, der Krieg hat seine Nerven übel zugerichtet. Aber was kann man schon erwarten? – Er war ja noch ein Junge, als sie ihn nach Frankreich geschickt haben. Das kann noch Jahre dauern, bis er die Strapazen und den Schock des Krieges überwunden hat. Das Buch könnte ihm dabei helfen.«
»Wie das?«
»Damit kann er das Gift aus dem Körper drücken – um es mal medizinisch zu sagen. Den Kopf von angesammelten Phantasmen reinigen. Es hat schon Fälle gegeben …«
Der Pfarrer nickte. Er dachte an seine letzte Begegnung mit Ronald Hardy auf dem Küstenpfad und wie sehr ihn das weiße Gesicht und die ruckartigen Bewegungen des Jungen verstört hatten. Junge, sagte er. Aber selbst ein Mann von vierunddreißig Jahren wirkt jung, wenn man sich den letzten Sprossen auf der Lebensleiter nähert. »Ein prächtiger, sensibler Charakter«, dachte der Pfarrer. Ein Geist wie Stahl, der immer weiter gekrümmt worden war, aber nicht brach. Ein typisches Produkt jener albtraumartigen Erlebnisse, die das Leben der jungen Leute der ganzen Welt noch vor nicht allzu vielen Jahren bedrängt hatten. Vielleicht schade, dass der Junge nie geheiratet hatte. Er war der Typus, der auf weibliche Fürsorge positiv reagieren würde. Er brauchte Zuwendung. Er zeigte jenes gewisse Verlorensein eines Mannes, der so sehr in seiner Arbeit lebt, dass die stumpfsinnigen Faktoren der Existenz ihn ebenso verstören wie ärgern. Natürlich gab es Gerüchte. In Boscawen gab es immer Gerüchte, besonders um Ronald. Seit er vor zwei Jahren im Cove Cottage eingezogen war, galt er als rätselhafte, romantische Gestalt. Ein Schriftsteller war im Dorf eine neue Spezies. Doch gründete das Gerücht, so fragte sich der Pfarrer, das Ronald mit Ruth Tregarthan verband, auf mehr als bloße Vermutungen? Er selbst hatte sie einige Male zusammen spazierengehen und reden sehen. Aber meine Güte! Das war doch nur natürlich. Ruth war eine reizende, intelligente junge Frau – vielleicht ein bisschen einsam bei dem abgeschiedenen Leben in diesem düsteren, alten Haus mit ihrem Onkel. Ronald war, überwand er erst seine natürliche Zurückhaltung, ein lebhafter, unterhaltsamer Gesprächspartner. Irgendwie schien es zwangsläufig, dass die beiden in ihrer Gesellschaft einen gewissen Trost fanden. Aber darüber hinaus … also … da könnte es durchaus auch etwas Wärmeres als bloßes geistiges Interesse geben – aber dann auch wieder nicht.
Seine Gedankengänge wurden von einem jähen Ausruf abgeschnitten. Pendrill zeigte aus dem Fenster.
»Puh. Haben Sie das gesehen? Durch den Spalt im Vorhang … ein Blitz. Da steht uns ja ein ordentliches Gewitter bevor.«
Wie zur Bestätigung seiner Worte grollte es dumpf, erst fern, dann barst ganz nah ein Donnerschlag, offenbar direkt überm Pfarrhaus.
»Das habe ich erwartet«, sagte der Pfarrer und setzte, nachdem er genüsslich an seiner Zigarre gepafft hatte, hinzu: »Ich habe eine unselige Angst vor Gewittern, Pendrill. Nicht um mich natürlich – aber um meine Kirche. Sie steht so isoliert und offen da. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn der Turm einstürzt und mit ihm die Greenow-Uhr. Ich behalte immer die Standuhr da im Blick, mein Lieber, bis das Gewitter vorbei ist.«
»Warum das?«
»Ach, nur zur Sicherheit. Ich schaue jeden Tag aus dem Fenster und stelle die Uhr nach der Greenow im Turm. Ausnahmslos. Wenn meine Uhr schlägt und die Kirchturmuhr nicht antwortet … verstehen Sie das nicht?«
»Das gäbe so einen allmächtigen Knall …«, warf der Arzt ein. »Da wären Uhren nicht wichtig.«
»Hören Sie nur«, sagte der Pfarrer.
Schwach und melodisch schlug die Greenow-Uhr die Stunde, und die darauf folgenden neun Schläge drangen leise durch den Wind. Noch bevor die Kirchturmuhr ihre Aufgabe ganz erfüllt hatte, schnurrte die Standuhr wie ein Kätzchen und begann eine bimmelnde Begleitung.
Der Arzt zog seine Uhr hervor und schüttelte tadelnd den Kopf.
»Geht zwei Minuten nach, Dodd. Das kann doch nicht sein. Lassen Sie lieber Ihre altmodischen Methoden und stellen Sie Ihre verflixten Uhren nach dem Radio.«
»Ach, dieser Geist der Moderne«, seufzte der Pfarrer. Er konterte die Kritik seines Freundes mit einer altersgrauen Mahnung. »An dem Tag, an dem ich Sie im Gottesdienst sehe, Pendrill, stelle ich im Pfarrhaus ein Radio auf. All die Jahre hatten Sie nie den Anstand, dort zu sitzen. Ich habe da eine Predigt …« Er nickte zu dem großen Mahagoni-Schreibtisch am Fenster hin. »Etwas Hochsinniges und, wenn ich das sagen darf, Kontroverses. Nächsten Sonntag halte ich sie. Na, was meinen Sie? Ich muss mir hier Ihre Ausführungen über Medizin anhören. Möchten Sie mir nicht einmal das Kompliment zurückgeben und mich zur Abwechslung über Religion sprechen hören?«
»Wenn Sie mich in meiner Praxis besuchen, besuche ich auch Ihre«, wehrte sich der Arzt. »Sollte ich mich seelisch unwohl fühlen, komme ich zu Ihnen und lasse mich reparieren, Dodd. Aber bis dahin bleibe ich –«
»Atheist?«, fragte der Pfarrer boshaft.
»Agnostiker«, bemerkte der Arzt.
»Aber mein lieber Pendrill, sehen Sie denn nicht den unwiderlegbaren Beweis, dass Gott –«
Und damit begann wieder eine ihrer endlosen metaphysischen Streitereien. Der Arzt verdrießlich und wissenschaftlich – der Pfarrer übersprudelnd von weihevollem Eifer und Überzeugungsdrang, die pummeligen Hände aufwerfend, auf dem Stuhl rutschend, heftig an seiner kalten Zigarre ziehend, sogar sich aufs Knie schlagend, wenn Pendrill sich durch vorgebliche Ignoranz weigerte, in ihrem Streit ein pro-christliches Argument gelten zu lassen.
Über ihren Köpfen schienen mit zunehmender Intensität ihrer Auseinandersetzung auch die Elemente zu ringen. Ein Donnerschlag nach dem anderen brandete vom Meer heran und brach sich hoch über der regengepeitschten Küste.
»Ach, das gestehe ich Ihnen zu! Das gestehe ich Ihnen zu!« Der Pfarrer wurde schrill vor Erregung. »Aber warum alle Wahrheit auf wissenschaftliche Beweise gründen? Was ist mit dem Glauben, mein Lieber? Ja, GLAUBE. Guter, alter, frühchristlicher Glaube. Schließlich ist der Glaube das eine, wesentliche …«
Der Pfarrer brach gewissermaßen mitten in der Luft ab. Die Hand, auf halbem Weg zu einer Geste, fiel auf seinen rundlichen Schenkel herab. Das Telefon auf seinem Schreibtisch schrillte mit der aufreizenden Hartnäckigkeit eines gefangenen Moskitos. Über ihnen baute sich ein weiterer langer Donner in wütendem Crescendo auf und detonierte mit einem Kanonenschlag.
»Die Ruhe unserer Landpfarreien …«, lachte Pendrill, als Reverend Dodd sich aus dem Sessel hievte und zu dem klingelnden Gerät tappte. »Englands ländliche Stille bleibt eines der …«
»Bitte!«, seufzte der Pfarrer und funkelte Pendrill an wie ein unverbesserliches Kind. »Das könnte der Bischof sein!«
Er nahm den Hörer ab. »Hallo? Ja. Am Apparat. Wer? Ah, ja, der ist da. Dringend? Einen Augenblick – ich sag’s ihm.«
»Für Sie. Es ist Ruth Tregarthan. Sie klingt aufgewühlt, Pendrill. Es ist dringend.«
Pendrill ergriff den hingehaltenen Hörer, wobei ein weiterer Blitz durch die Ritzen im Vorhang zuckte.
»Ja, hier«, sagte er rasch. »Was ist?«
Derweil empfand der Pfarrer rasende Neugier. Was war los? Was war geschehen? Ruth hatte seltsam geklungen und – welchen Ausdruck gebraucht man dafür? – wie von Entsetzen gepackt. Ja, das war’s.
Nachdem eigenartige Stakkatogeräusche aus dem Hörer gedrungen waren, Pendrills Stimme: »Großer Gott! Ich komme sofort. Unternehmen Sie nichts, bis ich da bin.« Und zum Pfarrer gewandt, sagte er knapp: »Tregarthan wurde erschossen! Sie müssen sofort die Polizei benachrichtigen. Rufen Sie Grouch an und sagen Sie ihm, er soll, so schnell er kann, nach Greylings fahren.«
»Tregarthan erschossen?«
Reverend Dodd stand völlig verstört in seinem Arbeitszimmer. Seine verwirrten Augen funkelten seltsam durch die Linsen seiner goldgefassten Brille. Erschossen? Tregarthan? Die arme Ruth. Welche Tragödie!
Pendrill war schon in den Flur geeilt, hatte seinen Mantel übergeworfen und sich den Hut auf den Kopf gedrückt. Als er durch die Haustür zu seinem Wagen stürzte, rief der Pfarrer ihm nach:
»Pendrill! Das war doch sicher ein Unfall?«
Die Stimme des Arztes drang durch das Brummen des Motors zu ihm.
»Ein Unfall? Nein! So, wie ich Ruth verstanden habe – ich kenne natürlich noch keine Einzelheiten –, wurde ihr Onkel ermordet!«
Kapitel 2
Die nicht zugezogenen Vorhänge
Greylings, das Haus, auf das Dr. Pendrill mit seinem Wagen zusteuerte, stand dicht am Meer. Es war ein kantiger, einfallsloser Bau aus grauem Stein und grüngrauem Schiefer, Materialien, die natürlich aus Steinbrüchen in der Umgegend stammten. Ganz abgeschieden, war es an der Landseite von einigen wetterverkrümmten Buchen eingesäumt, während die Fenster an der Westseite auf die träge Dünung des Atlantiks blickten. Das Gelände zwischen Landstraße und Haus war recht abschüssig, und beide waren durch eine ziemlich steile Zufahrt von einem halben Kilometer Länge verbunden.
An der Meerseite des Hauses lag ein kleines ummauertes, mit ungepflegten Blumenrabatten gesäumtes Rasenrechteck, hinter dem der Küstenpfad verlief. Jenseits des Weges fiel die Küste, hier fünf Meter hoch, steil ins tiefe Wasser ab. An diesem Abschnitt war nie ein Strand zu sehen, aus dem einfachen Grund, weil das Gelände sich vom Dorf ausbuchtete und eine breite Landzunge bildete, deren vorderste Spitze der alte Tregarthan, Ruths Großvater, als Standort für sein Haus gewählt hatte. Bei rauhem Wetter wurden die Fenster beständig von Gischt besprüht, denn die Atlantikbrecher, die gegen den Steilhang hämmerten, brandeten herauf wie eine Glasfront, die schartigen Kronen vom Wind gepeitscht. Ruths Großvater hatte erklärt, wäre sein Schlafzimmer nur groß genug, um mit einer Angel auszuholen, dann könnte er von den oberen Fenstern aus fischen. Diese Prahlerei war nicht ohne Berechtigung, da der kleine Rasen kaum die Länge eines durchschnittlichen Angelwurfs hatte.
Ab der Stelle, wo der Küstenpfad an Greylings’ Garten stieß, wich er in einem weiten Bogen Richtung Boscawen zurück. Das Dorf schmiegte sich um eine mit Felsbrocken übersäte Sandbucht, wie sie typisch für diesen Küstenstreifen war. Greylings lag, nahm man den Küstenpfad, einen guten Kilometer von der Bucht entfernt, auf der Landstraße war es etwas weiter, da diese und die Zufahrt zwei Seiten eines Dreiecks bildeten.
Gegenüber der Stelle, an der diese Zufahrt auf die Straße traf, stand die Pfarrei. Von Dodds Studierzimmer aus gesehen, lag Greylings zwischen Pfarrhaus und Atlantik, wegen des starken Abfalls des Landes allerdings deutlich tiefer. Neben dem Pfarrhaus stand die Kirche, ein normannischer Bau mit einem gedrungenen, viereckigen Turm und natürlich der berühmten Uhr, die ein Vorfahr der heutigen Lady Greenow gespendet hatte. Ob die Architekten der Kirche diese anderthalb Kilometer vom Dorf entfernt errichtet hatten, um den angeblich unerschütterlichen Glauben seiner Bewohner auf die Probe zu stellen, lässt sich nicht mehr sagen. Jedenfalls war in Boscawen Sonntag für Sonntag ein auseinandergezogener Tross gläubiger Christen zu beobachten, die die triste, baumlose Landstraße entlangtrotteten, um sich dann am Ziel der Reise von ihrem äußerst liebenswürdigen Reverend Dodd eine milde Strafpredigt anzuhören.
Der Arzt musste also nur wenige hundert Meter zurücklegen, um an dem unbeleuchteten Eingang von Julius Tregarthans Haus vorzufahren. Es hatte aufgehört zu regnen, und ein rauchfarbener Mond schien, immer wieder von Wolkenfetzen verdeckt. Im Landesinnern grollte noch der Donner, doch es war klar, dass das Gewitter abgezogen war und seine Energie nun anderswo entlud.
Dennoch war Pendrills Gehirn auf dieser wenige Minuten währenden Fahrt angestrengt mit Spekulationen befasst. Warum war Julius Tregarthan erschossen worden? Pendrill kam nicht weiter. Gewiss, er hatte keine allzu hohe Meinung von Ruths Onkel, eine Empfindung, die im ganzen Dorf vorherrschte, doch zwischen nicht mögen und umbringen lag schließlich eine tiefe Kluft. Tregarthan war reserviert, ja verschlossen, neigte zu Übellaunigkeit, welche mit Anfällen von grämlichem Zynismus und genereller Missachtung der Gefühle anderer wechselte. Allerdings besaß er eine gute Urteilskraft und war, soweit Pendrill wusste, von absoluter Integrität. Er war Mitglied des Gemeinderats, besuchte regelmäßig die Kirche, war Vorsitzender eines oder zweier örtlicher Vereine und Friedensrichter in Greystoke. Mit seinem Privatvermögen hatte er die diversen karitativen Einrichtungen des Bezirks großzügig, wenn auch nur sporadisch unterstützt. Seine Vergangenheit barg keine Rätsel. Seit dem Tod von Ruths Vater fünfzehn Jahre zuvor hatte er in Greylings gelebt, und seit Ruths Mutter in deren früher Kindheit gestorben war, hatte er auch die alleinige Vormundschaft über seine Nichte übernommen – eine Rolle, die er offenbar mit Verstand und einem gehörigen Maß an Großzügigkeit ausgeübt hatte. Ruth hatte ein Internat besucht, zwei Jahre lang den Kontinent bereist und war nach Boscawen mit der festen Absicht zurückgekehrt, Greylings zu ihrem dauerhaften Wohnsitz zu machen, bis sie dereinst, wenn überhaupt einmal, heiraten würde.
Und nun war über die beschauliche Routine dieses sehr gewöhnlichen Haushalts eine Tragödie hereingebrochen.
Pendrill hatte kaum die Tür seiner Limousine zugeknallt, als Ruth auch schon die Haustür aufriss und ihm entgegenlief. Ihr Anblick schockierte Pendrill. Aus ihren Wangen war alle Farbe gewichen. Ihre übliche praktische Art schien von einem Übermaß starker Emotionen erschüttert. Als sie seine Hand ergriff, merkte er, dass sie heftig zitterte. Wortlos hakte er sie bei sich unter und schritt in den hellen Flur, warf seinen Hut auf das Telefontischchen und ging ins Wohnzimmer.
Tregarthan lag vor der vorhanglosen Verandatür auf der Seite. Ein Arm steckte verkrümmt unter ihm. Der andere stand im rechten Winkel wie ein Signalarm vom Körper ab. Sein massiger Kopf lag in einer Blutlache, die sich noch immer ausbreitete und schon fast einen Meter über die polierten Dielen die Fußleiste entlanglief. Der schwere Kiefer war wie ein Schiffsbug vorgereckt, die Zähne, fest zusammengebissen, waren zu einem scheußlich unnatürlichen Grinsen gebleckt. Ein wenig links in seiner hohen Stirn war ein kreisrundes, schwarz gerändertes Loch.
Kein Zweifel, Tregarthan war tot. Der Tod musste sofort eingetreten sein. Pendrill wusste, dass dieser Mann jenseits jeder ärztlichen Hilfe war.
Während er flüchtig die Leiche untersuchte, brach Ruth auf dem Sofa zusammen, das Gesicht in den Händen verborgen, worauf Mrs. Cowper, die Haushälterin, die sich großäugig im Hintergrund gehalten hatte, nun einen nicht enden wollenden Wortschwall des Trostes von sich gab.
Cowper, der Gärtner und Mädchen für alles war, näherte sich ehrerbietig und bot seine Hilfe an.
Pendrill schüttelte den Kopf.
»Da ist nichts mehr zu machen, Cowper, bis die Polizei eintrifft. Er ist wirklich tot.« Dann wandte er sich an Mrs. Cowper und schnitt ihr törichtes Gebrabbel mit der gebotenen Autorität ab. »Nun, Mrs. Cowper, Sie bringen bitte Miss Ruth auf ihr Zimmer.« Er half der jungen Frau vom Sofa auf. »Es ist sinnlos, dass Sie hier länger bleiben, meine Liebe. Ich regle das mit der Polizei, wenn sie kommt. Die werden Sie später sprechen wollen, aber bis dahin bleiben Sie schön ruhig im Bett. Verstehen Sie?«
Ruth, von der nüchternen Stimme des Arztes etwas beruhigt, nickte wortlos und tat pflichtschuldig, wie ihr geheißen. Als Mrs. Cowper ihr aus dem Zimmer folgen wollte, rief der Arzt sie noch einmal zu sich.
»Heiße Milch mit einem ordentlichen Schuss Brandy«, sagte er. »Und sehen Sie zu, dass sie sie auch trinkt. Ernste Sache. Großer Schock.«
Allein mit Cowper, schloss der Arzt die Tür und untersuchte rasch den Raum. Zunächst lenkte er seine Aufmerksamkeit auf die Verandafenster. Diese waren dreigeteilt; zwei waren nicht zu öffnen, und durch eines trat man auf das kleine Rasenkarree hinaus. Jeder Flügel war in sechs Scheiben unterteilt. Drei Kugeln hatten Sterne in das Glas geschlagen – einer in dem rechten, nicht zu öffnenden Fenster, einer in ungefähr einem Meter achtzig Höhe in der Tür, der dritte mitten im linken, ebenfalls starren Fenster. Es lag auf der Hand, dass diejenige, die Tregarthan in den Kopf gefahren war, sich durch die mittlere Scheibe gebohrt hatte.
Die Vorhänge, die sich in der Mitte teilten, waren ganz zurückgezogen. Pendrill drehte sich zu Cowper um, der ihm mit aufmerksamem Schweigen durchs Zimmer gefolgt war.
»Diese Vorhänge, Cowper – ist das immer so? Ich meine, war Mr. Tregarthan es gewohnt, hier mit offenen Vorhängen zu sitzen?«
»Nein, Sir. Genau das hab ich nicht verstanden, wie ich hier reingekommen bin. Meine Frau zieht die Vorhänge immer extra zu, bevor sie den Kaffee serviert.«
»Und heute Abend?«
»Ach, auch da waren sie zu. Kurz nachdem Mr. Tregarthan seinen Kaffee getrunken hat, bin ich mit einem Korb Holz rein. Da waren sie zu – das kann ich beschwören, Sir.«
»Das können Sie später – bei der Polizei«, sagte Pendrill. »Das dürfte der Constable sein«, setzte er hinzu, als die Türglocke in die Stille des Hauses bimmelte. »Machen Sie ihm doch auf, Cowper.«
Aber es war nicht der Constable. Es war der Pfarrer.
»Mein lieber Pendrill, ich musste einfach herkommen. Ich habe Grouch angerufen. Er ist auf dem Weg. Ich musste einfach kommen. Ich dachte an Ruth. Vielleicht kann ich …« Sein Blick fiel auf Tregarthan, der am Fenster hingesackt lag. »Es ist also hoffnungslos«, sagte er noch leise. »Der arme Kerl.«
Cowper schlich heran, ein wenig blass um die Nase.
»Wenn nichts mehr ist, Sir … das da … wühlt mich doch auf.«
»Nein. Nehmen Sie sich einen ordentlichen Schluck Whisky. Aber hören Sie – die Polizei wird sie später noch befragen wollen.«
Dankbar nickend, wandte Cowper seinen gebannten Blick von der Leiche und stapfte rasch hinaus.
Pendrill zog seine Pfeife hervor und entzündete sie. Der Pfarrer schlenderte achtsam im Zimmer umher und spähte durch seine goldgeränderte Brille auf diverse Dinge.
»Die haben Sie bemerkt?«, fragte er und zeigte dabei auf die Fenster.
»Ja – drei Schüsse. Der mittlere hat Tregarthan erwischt. Daran besteht kein Zweifel.«
»Nicht der mindeste. Vorausgesetzt, er hat gestanden. Aber warum sollte er vor einem Fenster ohne Vorhang stehen, wenn es draußen nichts zu sehen gibt?«
»Vielleicht die Blitze«, gab Pendrill zu bedenken. »Er könnte die Vorhänge beiseitegezogen haben, um das Unwetter überm Meer zu betrachten.«
»Er hat die Vorhänge wohl nicht selbst weggezogen?«
Der Arzt erzählte ihm von Cowpers Erklärung.
»Seltsam«, sagte der Pfarrer, während er sich vom Fenster weg zur anderen Seite des Zimmers bewegte.
Er erlebte ein eigenartiges Gefühlsgemisch. Entsetzen und Bestürzung ob der Tragödie, welche so schnell aus der Nacht gekommen war und Julius Tregarthans Leben ein Ende gemacht hatte. Tiefes Mitgefühl mit der Frau, die einen so unerwarteten Verlust erlitten hatte. Doch hinter diesen vollkommen natürlichen Reaktionen brannte er vor heftiger Neugier und Interesse. Die eine Seite stritt gegen die andere. Er fand es grässlich, ein Verbrechen, zumal einen Mord, als etwas anderes als abscheulich und unvorstellbar zu betrachten. Zugleich zerrte ihn dieser kleine Neugierteufel unaufhörlich am Ärmel und verlangte Aufmerksamkeit. Ja – er musste es gestehen. Neben dem tragischen menschlichen Aspekt des Falls war er zutiefst von der Klärung des Rätsels absorbiert. Das detektivische Element in ihm wurde nun, da er mitten in einem Mord im wirklichen Leben und nicht in einer Kriminalgeschichte steckte, mit frischer Energie angefacht. Natürlich war das falsch und sogar sündig, doch der kleine Teufel war stärker als sein Gewissen. Er wollte ermitteln. Er wollte den Fall von Julius Tregarthans Tod lösen, wenn sich denn erwies, dass das Verbrechen von einem Rätsel umgeben war. Selbstverständlich würde die Polizei ihm die Sache aus der Hand nehmen. Es war ihr Beruf, Verbrecher dingfest zu machen. Und sein Beruf war es, seine Mitmenschen mit einer brüderlichen Liebe zu erfüllen, die Verbrechen unmöglich machen sollte. Das Argument war gut. Doch der kleine Kobold der Neugier war besser.
»Pendrill«, sagte er scharf. »Kommen Sie mal. Sehen Sie sich das an!«
Er zeigte auf ein mittelmäßiges, aber plastisches Ölgemälde eines Windjammers unter vollen Segeln, der kopfüber in einen nassen Abgrund stürzte. Die recht große Leinwand war weit oben an der Wand befestigt, und der Sturmhimmel war in ungefähr drei Zentimetern Entfernung vom Goldrahmen ganz eindeutig von einer Kugel durchbohrt.
»Kugel Nr. 1«, sagte Pendrill. »Das linke Fenster.«
»Und da?«, drängte der Pfarrer und deutete auf ein splittriges Loch in einem Eichenbalken unmittelbar unterhalb der Decke.
»Nr. 2«, sagte Pendrill. »Das rechte Fenster.«
»Und die dritte?«, fragte der Pfarrer.
»Wahrscheinlich irgendwo im Zimmer. Natürlich gebremst. Die Kugel ging geradewegs durchs Gehirn. Das habe ich festgestellt.«
»Womöglich hat das etwas damit zu tun«, sagte der Pfarrer, während er mit den Fingern über eine tiefe Kerbe in der Vorderseite des Eichenbüffets strich. »Die Kugel muss irgendwo auf dem Fußboden sein. Vielleicht –«
Der Satz wurde von einem weiteren Scheppern der Hausglocke abgeschnitten, die verkündete, dass Constable Grouch nach einer strammen Fahrt bergan in Greylings eingetroffen war. Cowper öffnete ihm und kehrte nach einem Nicken Pendrills zu seinem Whisky in der Küche zurück.
Der Constable von Boscawen keuchte vor Erschöpfung, nachdem er mit seinen neunzig Kilo den langen Anstieg von der Bucht heraufgestrampelt war. Er war nicht zur Schnelligkeit geboren, und die ungewohnte Notwendigkeit von Eile, verbunden mit der bestürzenden Nachricht, dass Tregarthan erschossen worden war, hatte ihm etwas den Atem geraubt. Er nahm den Helm ab, wischte dessen Innenseite mit seinem Taschentuch aus, betupfte sich die Stirn und nickte den beiden Männern zu.
»’n Abend, die Herren. Es ist doch nichts bewegt worden?«
»Nichts, Constable«, sagte der Arzt. »Nicht einmal die Leiche.«
»Er war wohl schon tot, als Sie eintrafen, Sir?«
»Ja.«
Der Constable schritt zu dem Leichnam und betrachtete ihn lange. In seiner gesamten Berufslaufbahn war es das erste Mal, dass er zur Untersuchung eines möglichen Mordes gerufen wurde, und er war nicht gewillt, die Bedeutung dieses Ereignisses zu unterschätzen.
»Hm«, sagte er. »Kopfschuss. Wohl ausgeschlossen, dass es Selbstmord war?«
Der Pfarrer zeigte auf die Schusslöcher in den Fenstern.
»Genau«, sagte Grouch. »Niemand erschießt sich durch ein Fenster. Und ein Unfall, die Herren?«
»Wohl kaum«, warf der Arzt ein. »Ein Schuss, ja, aber nicht drei. Drei Kugeln sind ins Zimmer abgefeuert worden.«
»Wer hat den Toten entdeckt, Sir?«
»Miss Tregarthan. Sie hat sich in ihrem Zimmer hingelegt. Ich habe sie weggeschickt, bis Sie kommen, Constable. Ich habe ihr schon gesagt, dass sie noch einige Fragen beantworten müsse.«
»So ist es, Sir. Ich brauche eine Aussage. War zu der Zeit noch jemand im Haus?«
»Die Cowpers. Mrs. Cowper ist oben bei Miss Tregarthan. Cowper ist in der Küche.«
»Mit denen möchte ich auch reden«, sagte Grouch. »Ich habe das Kommissariat in Greystoke angerufen. Die schicken einen Inspector. Bis dahin …« Er zog sein Notizbuch hervor und schlug es mit dem Daumen auf, »… wollen wir uns doch mal mit Miss Tregarthan unterhalten.«
»Vielleicht möchten Sie, dass ich …«, sagte der Pfarrer und rückte ein wenig Richtung Tür.
»Nein, schon gut, Sir. Ich könnte mir denken, dass der Inspector auch Ihnen ein paar Fragen stellen möchte. Außerdem bin ich sicher, dass es für die junge Dame angenehmer ist, wenn die Herren mit dabei sind.«
Ruth kam herunter, noch immer sichtlich erschüttert, nun aber mehr Herrin ihrer Gefühle. Auch ihre Wangen hatten wieder etwas Farbe bekommen. Der Arzt wollte ihr schon einen Stuhl bereitstellen, doch der Constable schüttelte den Kopf.
»Vielleicht gibt’s ja noch ein anderes Zimmer«, sagte er, wobei er kurz zu dem Toten hin nickte. »Das Esszimmer vielleicht.«
In der normaleren Atmosphäre des Esszimmers, wo noch immer ein Feuer flackerte, war es schon deutlich entspannter. Ruth sank sogleich in einen Sessel, während Pendrill und der Pfarrer sich zwei Stühle am Tisch nahmen. Grouch legte seinen Helm auf der Anrichte ab und stellte sich vor Ruth auf dem Kaminteppich auf.
»Also, Miss Tregarthan. Dem Arzt zufolge haben Sie den Toten als Erste vorgefunden. Haben Sie eine Vorstellung, zu welcher Zeit dies geschah?«
»Das weiß ich fast auf die Minute genau«, erwiderte Ruth mit gepresster Stimme. »Als ich hereinkam, schlug die Uhr im Flur gerade ein Viertel, wie ich mich erinnere.«
»Und Sie sind direkt ins Wohnzimmer gegangen?«
»Ja.«
»Dann waren Sie wohl draußen.«
»Ja.«
»Und die Leiche haben Sie also um 21.15 Uhr entdeckt.«
»Nach der Uhr im Flur genau um Viertel nach neun.«
»Von wo aus sind Sie ins Haus gekommen, Miss? Von der Zufahrt her?«
Ruth zögerte einen Moment, blickte ins Feuer und sagte dann rasch:
»Nein – vom Küstenpfad. Ich war spazieren.«
Der Constable sah sie durchdringend an.
»Ah! – Auf dem Küstenpfad. Und Ihnen ist dort niemand Verdächtiges aufgefallen?«
»Nein.«
»Ihnen ist doch sicher klar, Miss, dass Mr. Tregarthan von jener Seite des Hauses aus erschossen wurde?«
»Ja, das ist mir jetzt klar«, erwiderte Ruth leise.
»Von welcher Seite haben Sie sich dem Haus genähert?«
»Vom Dorf her.«
»Und auf dem Weg ist Ihnen niemand begegnet?«
»Niemand.«
»Und Sie haben nichts Außergewöhnliches gehört – Schüsse, beispielsweise – kein Gewehrfeuer?«
»Nichts.«
Der Constable seufzte und trommelte mit seinem Stift auf dem Kaminsims. Diese Form der Ermittlung führte offenbar zu nichts.
»Sie haben das Haus wo betreten, Miss –?«
»Durch die Seitentür. Da ist ein Weg –«
»Ich weiß«, warf Grouch ein. »Der Weg verläuft im rechten Winkel zum Küstenpfad die Gartenmauer entlang.« Er lächelte mild. »Wissen Sie, Miss, ich kenne das Haus schon länger, als Sie auf der Welt sind.«
Eine Pause entstand, in welcher der Constable sich offenbar seinen nächsten Ansatz überlegte.
»Als Sie auf dem Küstenpfad unten am Garten vorbeikamen, ist Ihnen da aufgefallen, dass die Vorhänge zurückgezogen waren?«
Ruth nickte.
»Aber Sie wussten nicht, dass etwas nicht stimmte?«
»Wie sollte ich?«, fragte Ruth leise.
»Stimmt. Sie wussten es nicht. Sie trugen einen Regenmantel?«
»Ja – es hat geregnet, wie Sie ja wissen.«
»Dann sind Sie wohl ziemlich nass geworden?«
»Ich war völlig durchnässt«, bestätigte Ruth, von den scheinbar unwichtigen Fragen verwirrt.
»Und dennoch«, fuhr der Constable fort, »sind Sie direkt ins Wohnzimmer gegangen, ohne Ihre nassen Sachen auszuziehen und ohne zu bemerken, dass mit Mr. Tregarthan etwas nicht stimmte?«
»Ja – nein – das heißt …«
»Nun?«
Pendrill und der Pfarrer waren von Ruths plötzlichem Zögern verblüfft. Bislang hatte sie die Fragen des Constable ohne großes Überlegen ihrer Erwiderungen beantwortet. Diese anscheinend harmlose Frage nach einem nassen Regenmantel jedoch schien sie aus irgendeinem Grund zu verstören.
»Nun, Miss?«, wiederholte Grouch.
»Ich glaube, ich habe mir da keine Gedanken wegen meiner Sachen gemacht. Ich bin Nässe gewöhnt. Es war nicht ungewöhnlich, dass ich zu meinem Onkel hineinging, ohne meine Regensachen auszuziehen.«
»Und als Sie sahen, dass Ihr Onkel offenbar tot war, was taten Sie?«
Ruth beschrieb nun, wie sie die Cowpers herbeigerufen hatte und dann zum Telefon gerannt war, um den Arzt im Rock House anzurufen. Als sie erfahren hatte, dass er im Pfarrhaus zu Abend aß, hatte sie dort angerufen und ihm von der Tragödie berichtet. Danach sei sie wieder ins Wohnzimmer gegangen und habe sich, soweit sie das konnte, davon überzeugt, dass ihr Onkel tot war. Als sie den Wagen des Arztes gehört habe, sei sie dann zu ihm hinausgeeilt.
Nachdem Ruth ihre Schilderung beendet hatte, wandte der Constable sich an Pendrill.
»Könnten Sie, Sir, mir ungefähr sagen, um welche Uhrzeit Sie den Anruf entgegennahmen?«
Der Arzt überlegte kurz.
»Leider nicht. Es war nach neun. Das weiß ich, aber der Pfarrer und ich unterhielten uns –«
»Einen Augenblick«, schaltete sich der Pfarrer erregt ein. »Ich glaube, ich kann Ihnen helfen, Constable. Das Telefon läutete ungefähr zwanzig Minuten nach neun. Das weiß ich zufällig, weil es zu meinen – äh – Idiosynkrasien gehört, bei einem Gewitter auf die Kirchturmuhr zu horchen.« Sodann erklärte er, wie sehr er um die Sicherheit des Turmes fürchtete. »Unbewusst habe ich während meiner Unterhaltung mit Dr. Pendrill wohl auf die Viertelschläge gewartet. Ich erinnere mich deutlich, sie gehört zu haben. Wie Sie wissen, ist der Turm nur einen Steinwurf vom Pfarrhaus entfernt, und wenn der Wind aus der richtigen Richtung kommt …«
»Danke, Sir«, sagte Grouch und nickte dem Pfarrer anerkennend zu. »Ich glaube, das passt mehr oder weniger zu Miss Tregarthans Vorstellung bezüglich der Zeit, zu der sie den Toten fand.« Darauf wandte er sich an Ruth, die sich mit geschlossenen Augen auf dem Sessel zurückgelehnt hatte, wie um das abnorme Schauspiel eines Polizisten im Esszimmer von Greylings auszublenden. »Vielen Dank, Miss. Ich glaube, ich habe keine weiteren Fragen mehr. Sie haben mir sehr geholfen, Miss Tregarthan, und als Privatperson möchte ich Ihnen meine ehrliche Anteilnahme zu dem Geschehenen aussprechen.« Als Ruth sich dann in Begleitung des Pfarrers unsicher zur Tür wandte, setzte der Constable hinzu: »Und, Sir, rufen Sie doch bitte nun Mrs. Cowper. Ich würde gern hören, was sie zu sagen hat.«
Kapitel 3
Das Rätsel der Fußspuren
Mrs. Cowper kam ins Zimmer, als beträte sie einen Löwenkäfig. Sie schaute nervös und furchtsam um sich. Ihre rot geweinten Augen blickten vom Arzt zum Pfarrer und blieben dann mit faszinierter Glasigkeit am Constable hängen. Grouch bat die Haushälterin mit einer Handbewegung auf den Sessel und unterzog sie ohne weiteren Verzug einem ähnlichen Verhör, wie er es bei Ruth Tregarthan angewandt hatte.
»Also, Mrs. Cowper, bitte seien Sie sich dessen, was Sie mir nun sagen werden, ganz sicher«, warnte er. »In solchen Zeiten bildet man sich leicht Dinge ein. Doch ich will die Fakten. Sonst nichts. Die reinen Fakten. Also – wann haben Sie Mr. Tregarthan das letzte Mal lebend gesehen?«
Mrs. Cowper, die sich des Constables Warnung zu Herzen nahm, erwog diese Frage gründlich, bevor sie sich zu einer Antwort anschickte. Sie warf einen misstrauischen Blick auf die anderen im Zimmer, als argwöhnte sie eine Falle, und antwortete mit einer gewissen trotzigen Bedächtigkeit.
»Das war, wie ich ihm seinen Kaffee wie immer um Viertel vor neun gebracht hab. Mr. Tregarthan, das war ein pünktlicher Mann, und er hatte es gern, wenn alles pünktlich geschah. Um Viertel vor neun wollte er seinen Kaffee, um Viertel vor neun hat er ihn bekommen.«
»Waren die Vorhänge zugezogen, als Sie hineingingen?«
»Nein. Die habe ich selber zugezogen. Wie immer.«
»Die Fenster ganz zu?«
»Ganz zu, Mr. Grouch«, sagte Mrs. Cowper entschieden. »Niemand kann mir vorwerfen, dass ich meine Pflichten heute Abend nicht wie sonst auch erledigt habe.«
Es war unübersehbar, dass Mrs. Cowpers Nervosität die Form empörter Verärgerung darüber annahm, man könne sie in irgendeiner Weise verdächtigen, für den Tod ihres Herrn verantwortlich zu sein. Sie kannte Grouch privat, da er ihre Schwägerin geheiratet hatte, was aber nichts dazu beitrug, die Abnormität der Situation zu mildern. Grouch in seiner offiziellen Eigenschaft war etwas anderes als der Grouch, der in Annies Wohnzimmer im Laburnum Cottage bei einer Tasse Tee saß. Was Mrs. Cowper aus dem Gleichgewicht brachte.