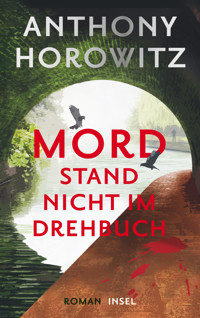
21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hawthorne ermittelt
- Sprache: Deutsch
»Tut mir leid, Hawthorne. Aber die Antwort ist nein«. Entschieden erklärt Anthony Horowitz die Zusammenarbeit mit Privatdetektiv Daniel Hawthorne für beendet. Er ist mit anderen Dingen beschäftigt, denn sein Theaterstück Mindgame soll in den nächsten Tagen uraufgeführt werden.
Noch während der Premierenfeier macht die vernichtende Besprechung in der Sunday Times die Runde. Vor allem das Skript wird verrissen. Und am nächsten Morgen wird die Kritikerin tot aufgefunden, ermordet mit einem antiken Dolch, der dem Autor gehört, und auf dem seine Fingerabdrücke verteilt sind. Er wird verhaftet, und in seiner Zelle wird ihm voller Verzweiflung klar, dass ihm jetzt nur noch einer helfen kann – Daniel Hawthorne. Aber wird der sich darauf einlassen, nach allem, was vorgefallen ist?Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cover
Titel
Anthony Horowitz
Mord stand nicht im Drehbuch
Hawthorne ermittelt
Roman
Aus dem Englischen von Lutz-W. Wolff
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel The Twist of a Knife bei Penguin Random House UK, London
eBook Insel Verlag Berlin 2024
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2024.
Erste Auflage 2024Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Insel Verlag Anton Kippenberg & Co. KG, Berlin, 2024Copyright © Anthony Horowitz 2022Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b vor.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung von hißmann, heilmann, hamburg unter Verwendung des Originalumschlags von Penguin Random House UK, Abbildungen: Franks/Alamy; Shutterstock; Getty Images
eISBN 978-3-458-77958-2
www.insel-verlag.de
Widmung
Für Sophia und Iona, die jetzt auch zur Familie gehören
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
1 Getrennte Wege
2 Mindgame
3 Premiere
4 Die erste Rezension
5 Messer raus
6 Der eine Anruf
7 Die Frist
8 Palgrove Gardens
9 Sieben Verdächtige
10 Garderobe Nummer 5
11 Starqualiäten
12 Noch ein Messer
13 Pechsträhne
14 Vorahnungen
15 Clerkenwell bei Nacht
16 Frost & Longhurst
17 Ein Auszug aus
Bad Boys
von Harriet Throsby
18 Moxham Hall
19 Lange Schatten
20 Sünden der Vergangenheit
21 Das Jai Mahal
22 Das sicherste Haus in ganz London
23 Privatangelegenheiten
24 Zurück ins Vaudeville
25 Der letzte Akt
26 Die gestrichelte Linie
Danksagung
Fußnoten
Informationen zum Buch
1
Getrennte Wege
»Tut mir leid, Hawthorne. Die Antwort ist nein. Unsere Vereinbarung ist beendet.«
Sich mit Hawthorne zu streiten war scheußlich. Und das lag nicht nur daran, dass ich unweigerlich immer verlor. Ich fühlte mich schon scheußlich, wenn ich auch nur versuchte, recht zu behalten. Seine braunen Augen konnten sehr wütend blitzen, aber wenn er sich angegriffen fühlte, wurden sie sehr verletzlich und zwangen mich zu hastigen Entschuldigungen, auch wenn ich ganz sicher im Recht war. Ich habe das schon früher bemerkt: Seine Launen konnten fast kindlich sein. Man wusste nie, wo man bei ihm dran war, und das machte es nahezu unmöglich, über ihn zu schreiben. Und genau das war es, worüber wir gerade stritten.
Ich hatte Hawthornes Ermittlungen bei drei verschiedenen Fällen begleitet und Bücher darüber geschrieben. Das erste war schon veröffentlicht, das zweite lag bei meiner Agentin zum Lesen (sie hatte jetzt schon seit über zwei Wochen nichts von sich hören lassen). Das dritte wollte ich demnächst anfangen, und ich glaubte nicht, dass es sehr schwierig sein würde; denn ich hatte alles miterlebt und wusste genau, wie es ausgehen würde. Ich hatte mich auf einen Drei-Buch-Vertrag eingelassen, und damit reichte es mir jetzt auch.
Ich hatte Hawthorne schon eine ganze Weile nicht mehr getroffen. Wenn man die vielen Krimis im Fernsehen oder in den Buchläden sieht, denkt man, dass praktisch jeden Augenblick jemand umgebracht wird, aber im wirklichen Leben trifft das glücklicherweise nicht zu. Es waren schon einige Monate vergangen, seit wir aus Alderney zurückgekehrt waren, und auch dort hatten wir bloß drei Leichen zurückgelassen. Ich hatte keine Ahnung, was er seitdem gemacht hatte, und ehrlicherweise muss ich wohl zugeben, dass ich auch nicht viel an ihn gedacht hatte.
Aber jetzt war er plötzlich am Telefon und lud mich ein, zu ihm in die Wohnung zu kommen. Schon das war ungewöhnlich genug. Wenn ich auch nur bis zu seiner Tür kommen wollte, hatte ich bisher meistens bei jemand anderem klingeln und so tun müssen, als ob ich von einem Lieferdienst käme. River Court war ein Wohnblock aus den Siebzigerjahren am Themseufer neben der Blackfriars Bridge, und Hawthorne hauste in einer Wohnung im obersten Stock. Außer kahlen Wänden, einem riesigen Tisch mit seinen Flugzeug-Modellen und einem Computer, mit dem er die Datenbank der Londoner Polizei anzapfte, gab es dort praktisch nichts.
Bei seinen Recherchen im Internet half ihm ein Nachbarsjunge, Kevin Chakraborty, der mich ziemlich schockiert hatte, als ich auf seinem Laptop ein Foto von mir und meinem Sohn gesehen hatte, das er von meinem Smartphone geklaut hatte. Kevin hatte sich auch in die automatische Kennzeichenerfassung der Verkehrspolizei Hampshire gehackt. Große Vorwürfe hatte ich ihm nicht gemacht, er hatte uns nützliche Informationen verschafft. Und wer streitet sich schon gern mit einem Teenager, der im Rollstuhl sitzt? Hawthorne gegenüber hatte ich den ganzen Zwischenfall nicht erwähnt. Er hatte schließlich den Polizeidienst verlassen müssen, weil er im Verdacht stand, einen Pädophilen die Treppe hinuntergestoßen zu haben. Er hatte sicher einen moralischen Kompass, aber wohin der zeigte, bestimmte er lieber selbst.
Die Wohnung gehörte ihm übrigens nicht, er hatte sie nicht mal gemietet. Er hatte mir gesagt, er sei bloß der Verwalter für einen Makler, den er »eine Art Halbbruder« nannte. Das war so typisch für Hawthorne. Er hatte keine normale Familie mit Schwägerinnen oder Cousins. Er lebte von seiner Frau getrennt, stand ihr aber immer noch nahe. Alles an ihm war undurchsichtig und kompliziert, und es hatte auch keinen Sinn, dass ich ihm Fragen stellte, denn die Antworten führten nie irgendwo hin. Es war sehr frustrierend.
Und jetzt saßen wir hier in seiner Küche, umgeben von blitzendem Chrom und unberührten, spiegelnden Arbeitsflächen. Ich war zu Fuß von Clerkenwell zu ihm herunterspaziert, denn ich wohnte nur eine Viertelstunde entfernt – was den emotionalen Abstand nur umso deutlicher machte. Hawthorne trug wie üblich eine schwarze Hose und ein weißes Hemd. Ungewöhnlich war nur der graue Pullover anstelle der Anzugjacke. Offenbar war er im Freizeitmodus. Er hatte mir nicht nur eine Tasse Tee angeboten, sondern auch ein paar KitKat-Kekse, die wie ein Hashtag auf ihrem Teller arrangiert waren. Er selbst trank schwarzen Kaffee, und die Zigarettenschachtel war auch da.
Er wollte, dass ich ein viertes Buch schrieb. Darum ging es bei diesem Treffen, aber ich hatte mich längst dagegen entschieden. Warum? Nun ja – dass ich gleich zweimal in der Unfallklinik gelandet war und notoperiert werden musste, will ich erst gar nicht erwähnen. Aber Hawthorne hatte mich auch nie besonders freundlich behandelt. Er hatte von Anfang an klargemacht, dass es eine rein geschäftliche Beziehung für ihn war. Er wollte, dass jemand die Bücher über ihn schrieb, weil er Geld brauchte, und hatte mich obendrein wissen lassen, dass ich nicht einmal seine erste Wahl war. Deshalb stand meine Entscheidung fest, noch ehe ich zu ihm gekommen war. Es reichte. Ich hatte es satt, als lästiges Anhängsel hinter ihm herzutrotten. Es gab genug Geschichten, die ich allein verantworten konnte, und das war etwas, das er sowieso nie verstehen würde. Autoren schreiben nicht für andere Leute. Wir schreiben für uns.
»Sie können nicht einfach aufhören«, sagte Hawthorne. Er dachte einen Augenblick nach. »Ein perfider Plan war richtig gut.«
»Haben Sie’s denn gelesen?«, fragte ich.
»Ein bisschen. Aber die Rezensionen waren doch großartig. Sie können echt stolz auf sich sein. Die Daily Mail hat gesagt, es wäre wunderbar unterhaltsam.«
»Ich lese nie Rezensionen – und außerdem war das der Express.«
»Der Verlag will auch, dass Sie weiterschreiben.«
»Woher wissen Sie das?«
»Hilda hat’s mir erzählt.«
»Hilda?« Ich traute meinen Ohren nicht. Hilda Starke war meine Agentin, die mir gleich zu Anfang dringend davon abgeraten hatte, mich auf diese Sache einzulassen. Ich erinnere mich nur allzu gut an ihr Gesicht, als ich ihr sagte, dass ich die Honorare zur Hälfte an Hawthorne abtreten wollte. Sie hatte ihn kürzlich kennengelernt, aber ich fand es doch sehr überraschend, dass die beiden sich unterhalten hatten, ohne dass ich davon wusste. »Wann haben Sie denn mit ihr gesprochen?«, fragte ich.
»Letzte Woche.«
»Was? Haben Sie bei ihr angerufen?«
»Nein. Wir haben uns zum Lunch getroffen.«
Mir wurde ganz schwindlig, als ich das hörte. »Sie essen doch nie was zu Mittag!«, rief ich. »Und wozu treffen Sie sich mit Hilda? Sie ist meine Agentin.«
»Und meine ist sie jetzt auch.«
»Ist das Ihr Ernst? Sie zahlen ihr fünfzehn Prozent?«
»Na ja, ich hab den Prozentsatz ein bisschen gedrückt.« Er redete hastig weiter. »Sie glaubt, sie könnte noch einen Drei-Buch-Vertrag für uns aushandeln. Mit einem höheren Vorschuss!«
»Ich schreib nicht wegen des Geldes.« Ich wollte gar nicht so prüde klingen, aber es stimmte. Schreiben war für mich etwas sehr Persönliches. Es war mein Leben. Es machte mich glücklich. »Wie auch immer. Ich kann kein weiteres Buch über Sie schreiben«, sagte ich. »Außerdem haben Sie gar keinen neuen Fall.«
»Zurzeit nicht«, gab er zu. »Aber ich könnte Ihnen von ein paar älteren Fällen erzählen.«
»Als Sie noch bei der Polizei waren?«
»Nein, als ich schon ausgeschieden war. Da war zum Beispiel diese Geschichte in Richmond, im Riverside Close. Das würde Ihnen gefallen, Tony! Ein Mann in einer schicken Villa! Mit einem Hammer erschlagen. Das war meine erste private Ermittlung.«
Ich erinnerte mich, dass er das in Alderney schon erwähnt hatte. »Das ist vielleicht eine tolle Geschichte«, sagte ich. »Aber darüber kann ich nicht schreiben. Ich bin ja nicht dabei gewesen.«
»Ich könnte Ihnen erzählen, wie es gewesen ist.«
»Tut mir leid. Ich bin nicht interessiert.« Ich griff nach einem der Kekse, verzichtete dann aber doch lieber. Ein Hashtag aus Schokolade war nicht sehr appetitanregend. »Es geht ja nicht bloß um die Verbrechen, Hawthorne. Wie soll ich über Sie schreiben, wenn ich nichts über Sie weiß?
»Ich bin Detektiv. Was müssen Sie sonst wissen?«
»Das haben wir doch schon mehrfach besprochen. Ich weiß, dass Sie sehr zurückhaltend sind. Aber man kann nicht über jemanden schreiben, über den man nichts weiß. Und wenn ich Sie etwas frage, habe ich immer das Gefühl, dass ich gegen die Wand rede.«
»Was wollen Sie wissen?«
»Meinen Sie das jetzt ernst?«
»Fragen Sie einfach!«
»Na schön.« Mindestens zwanzig verschiedene Fragen schossen mir durch den Kopf, aber ich fragte gleich das Erstbeste. »Was ist damals in Reeth passiert?«
»Ich weiß gar nicht, wo das sein soll.«
»Als wir in diesem Gasthof in Yorkshire gewesen sind, hat Sie ein gewisser Mike Carlyle angesprochen. Er hat gesagt, er kennt Sie aus Reeth. Allerdings hat er Sie Billy genannt.«
»Das war eine Verwechslung. Der kannte mich gar nicht.«
»Da gibt es aber noch etwas.« Ich machte eine Pause. »Das habe ich Ihnen nicht erzählt. Nachdem ich aus Alderney zurück war, kam eine Postkarte. Von Derek Abbott.«
Abbott war der Mann, der wegen der Verbreitung von Kinderpornografie im Gefängnis gewesen war. Vor seiner Verurteilung war er im Polizeigewahrsam eine Treppe hinuntergefallen.
»Hat er Ihnen aus der Hölle geschrieben?«, fragte Hawthorne.
»Nein, er hat mir geschrieben, bevor er starb. Er hat gesagt, ich sollte Sie fragen, was damals in Reeth passiert ist.«
»Ich weiß nichts von Reeth. Ich bin da niemals gewesen.«
Ich wusste, dass Hawthorne log. Aber es hatte keinen Sinn, ihm das zu sagen. »Na, schön«, sagte ich. »Dann erzählen Sie mir etwas über Ihre Frau. Und Ihren Sohn. Was ist mit Ihrem Bruder, dem Immobilienmakler? Wie alt sind Sie wirklich? In Alderney haben Sie gesagt, Sie wären neununddreißig, aber ich glaube, Sie sind schon älter.«
»Das ist nicht sehr nett.«
Ich überhörte das. »Warum bauen Sie all diese Flugzeug- und Panzermodelle? Wofür soll das gut sein? Warum essen Sie nie etwas Richtiges?«
Man sah, dass sich Hawthorne nicht wohlfühlte. Seine Finger wanderten zu dem Zigarettenpäckchen, und es war offensichtlich, dass er sich gern eine angesteckt hätte. »Das sind doch völlig überflüssige Fragen«, sagte er. »Darum geht es in den Büchern doch gar nicht. Das sind Kriminalromane, da geht es um Mord!« Das sollte offenbar attraktiv klingen, so als wäre ein gewaltsamer Tod etwas Tolles. »Wenn Sie unbedingt solches Zeug über mich schreiben wollen, dann können Sie es doch einfach erfinden.«
»Genau darum geht’s ja!«, rief ich. »Am liebsten erfinde ich alles. Bücher zu schreiben, bei denen ich nicht schon am Anfang weiß, wie sie ausgehen, finde ich ziemlich anstrengend. Ich habe keine Lust, drei Schritt hinter Ihnen herzudackeln wie der Prinzgemahl hinter der Königin. Es tut mir leid, Hawthorne. Aber ich habe bei Ihren Ermittlungen nicht sehr viel Spaß gehabt. Zweimal hat man mich beinahe abgestochen! Ich bin der Lösung nie auch nur nahegekommen. Und selbst wenn ich noch etwas schreiben wollte, hätten Sie gar keinen Fall für uns, in dem wir ermitteln könnten. Außerdem fallen mir bald keine Titel mehr ein.«
»Sie hätten einfach schreiben sollen Hawthorne ermittelt.«
»Das meine ich nicht.« Ich schnappte mir eins von den KitKats. Ich hatte nicht die Absicht, jetzt Kekse zu essen. Ich wollte das dämliche Muster zerstören. »Das Konzept passt jetzt nicht mehr.«
Ich hatte mir vorgenommen, die Titel zu einem grammatischen Puzzle zu arrangieren. Ich war schließlich kein Detektiv, sondern Schriftsteller. Das erste Buch hieß The Word is Murder, das zweite The Sentence is Death und das dritte A Line to Kill. Ich war richtig stolz auf diesen Einfall gewesen. Aber wie sollte es weitergehen? Life Comes to a Full Stop? Das würde schon in Amerika nicht funktionieren. Die Amis haben ja keine Punkte, sondern »Perioden«. Nein, nein. Die Serie war als Trilogie angelegt, und dabei sollte es bleiben.
»Sie können sich ja jemand anderen suchen«, sagte ich müde.
Er zuckte die Achseln. »Ich arbeite lieber mit Ihnen, Sportsfreund. Wir kommen doch gut miteinander aus … irgendwie. Wir verstehen uns.«
»Ich bin mir nicht so sicher, ob ich irgendwas verstehe«, gab ich zurück. Es war wirklich merkwürdig. Ich hatte gar nicht erwartet, dass dieses Treffen so trübsinnig werden würde. Ich hatte gedacht, dass wir einfach nur getrennte Wege einschlagen würden. »Es ist ja nicht das Ende unserer Beziehung«, erklärte ich. »Zwei von den Büchern sind ja noch gar nicht erschienen. Wir werden bestimmt noch gemeinsame Auftritte haben. Vielleicht lädt man uns ja zu Lesungen oder literarischen Festivals ein. Obwohl – nach dem, was in Alderney los war, haben die Veranstalter womöglich Angst.«
»Aber wir waren doch ganz gut, oder?«
»Ja schon. Aber am Ende waren drei Leute tot.«
Ich hatte Hawthorne noch nie so niedergeschlagen gesehen. Und in diesem Augenblick wurde mir klar, dass trotz allem, worüber ich mich beschwert hatte, zwischen uns eine starke Beziehung gewachsen war. Wenn man den Tod von sieben Menschen ergründet, kommt man sich schon näher. Ich bewunderte Hawthorne. Ich mochte ihn, und hatte mir immer Mühe gegeben, ihn so liebenswert wie nur möglich erscheinen zu lassen. Plötzlich wollte ich unbedingt gehen.
Das KitKat habe ich nicht gegessen. Ich trank meinen Tee aus und stand einfach auf. »Hören Sie«, sagte ich. »Wenn Sie irgendwas haben, eine neue Ermittlung, dann lassen Sie es mich wissen. Dann kann man ja noch mal darüber nachdenken.« Schon während ich das sagte, wusste ich, dass ich das nicht tun würde. Andererseits war ich mir aber auch nicht sicher, ob er sich noch einmal melden würde.
»Ja, mach ich«, sagte er.
Ich ging zur Tür, aber dann drehte ich mich noch einmal um. Ich wollte dem Gespräch noch eine irgendwie freundliche Note geben. »Nächste Woche hat mein Stück Premiere«, erklärte ich. »Wollen Sie vielleicht eine Freikarte?«
»Was für ein Stück?«
Ich war mir ganz sicher, dass ich ihm davon erzählt hatte. »Es heißt Mindgame. So eine Art Thriller. Jordan Williams und Tirian Kirke spielen die Hauptrollen.« Das waren zwei sehr prominente Schauspieler, aber Hawthorne kannte die Namen offenbar nicht. »Es wird Ihnen bestimmt gefallen.«
»Wo ist denn die Aufführung?«
»Im Vaudeville Theatre. Am Strand. Direkt gegenüber vom Savoy. Anschließend haben wir noch eine Party. Und Hilda ist auch da.«
»An welchem Tag?«
»Dienstagabend.«
»Tut mir leid, Sportsfreund.« Die Antwort kam prompt, ohne Zögern. »Dienstag hab ich was anderes vor.«
Na, wenn er sich dermaßen anstellte, würde ich ihm nicht nachlaufen. »Schade«, sagte ich und verließ die Wohnung.
Als ich an der Themse zur Blackfriars Bridge ging, war ich deprimiert. Ich wusste, dass ich hinsichtlich der Bücher richtig entschieden hatte, aber trotzdem hatte ich das unangenehme Gefühl, etwas unerledigt gelassen zu haben. Ich hatte die Chance verpasst, ernsthaft mit Hawthorne zu reden und mehr über ihn zu erfahren. Ich hatte sogar schon daran gedacht, eine Reise nach Reeth zu machen. Aber jetzt sah es so aus, als ob ich ihn nie wieder sehen würde.
Aber das eigentlich Blöde ist etwas anderes …
Trotz allem, was ich gerade geschrieben habe, ist ja offensichtlich, dass es tatsächlich noch einen Mord gegeben hat und ich darüber geschrieben habe, sonst gäbe es dieses Buch nicht, das Sie in Händen halten. Schon das Blut auf dem Umschlag und der Titel verraten ja alles! Da sieht man, in welcher aussichtslosen Lage ein Schriftsteller ist, der sich mit dem beschäftigen muss, was tatsächlich passiert ist, statt frei fantasieren zu können.
Was ich allerdings noch nicht wusste: Obwohl alles, was mir bei den drei ersten Büchern passiert ist, schon schrecklich genug war, standen mir jetzt noch weitaus schlimmere Dinge bevor.
2
Mindgame
Ich liebe das Theater. Ich erinnere mich an so viele schöne Abende in meinem Leben, an denen ich vollkommen glücklich war, weil das Zusammenspiel von Sprache und Handlung, Musik, Regie und Kostümen bei einer Inszenierung vollkommen war. Die Inszenierung von Guys and Dolls am National Theatre im Jahre 1982 gehört dazu. Nicholas Nickleby von der Royal Shakespeare Company. Michael Frayns Noises Off!, diese wunderbare Komödie. John Bartons Richard II, bei dem Ian Richardson und Richard Pasco jeden Abend die Rollen tauschten. Damals war ich gerade achtzehn, und ich sehe noch immer, wie sie die »hohle Krone« anstarrten, die zum Spiegel geworden war. Das Theater ist eine Kerze, die nie erlischt, und viele Inszenierungen brennen heute noch in meiner Erinnerung.
Mit Anfang zwanzig war ich eine Zeitlang Platzanweiser im National und sah Dutzende Male Harold Pinters Betrayal, Peter Shaffers Amadeus, Arthur Millers Death of a Salesman und Alan Ayckbourns Bedroom Farce, ohne mich auch nur eine Minute zu langweilen. Am Nachmittag, vor den Aufführungen, hielt ich mich in der Kantine hinter der Bühne auf. Ich trug mein graues Nylonhemd und die etwas schräge lila Krawatte, aber ich war ganz in der Nähe von Leuten wie John Gielgud oder Ralph Richardson, die sogar in Jogginghosen und Laufschuhen königlich aussahen. Ich habe sie natürlich nie angesprochen. Sie waren Götter für mich. Donald Sutherland hat mir mal zwanzig Pence Trinkgeld gegeben, als ich an der Garderobe gearbeitet habe. Die habe ich immer noch irgendwo.
Ehe ich anfing, Romane zu schreiben, wollte ich unbedingt zum Theater. Das fing beim Laienspiel in der Schule an. An der Uni führte ich manchmal sogar Regie. Ich ging drei-, viermal die Woche ins Theater, mehr als die Stehplätze hinter der letzten Reihe konnte ich mir allerdings nicht leisten. Die kosteten nur zwei Pfund. Ich wollte unbedingt auf die Schauspielschule und bewarb mich auch als Regieassistent, aber nichts davon klappte. Allmählich begriff ich, dass irgendetwas an mir nicht zu meinem Traumberuf passte. Irgendwie gehörte ich nicht zu dieser Welt, an der ich unbedingt teilhaben wollte. »Ehrgeiz ist der Großen Wahnsinn«, heißt es in der Duchess of Malfi, die ich 1971 bei der Royal Shakespeare Company gesehen habe, mit Judi Dench in der Titelrolle. Aber was einen tatsächlich verrückt macht, ist die Erkenntnis, dass man seinen Ehrgeiz niemals befriedigen wird.
Vielleicht war das einer der Gründe, warum ich Mindgame geschrieben hatte: Ich wollte das Feuer am Leben erhalten.
Angeregt hatte mich ein anderes Stück, das ich als Teenager gesehen und das mich seitdem fasziniert hatte. Sleuth von Anthony Shaffer war eine Parodie auf Agatha Christie, aber zugleich ein sehr originelles Kriminalstück. Es gab nur drei Personen: einen wohlhabenden Schriftsteller, den Liebhaber seiner Frau und einen tieftraurigen Detektiv namens Inspektor Doppler – aber in den zwei Akten brachte Shaffer etliche verblüffende Überraschungen unter. Es war ein Riesenerfolg. Dem Publikum stockte der Atem. Allein in London gab es mehr als zweitausend Vorstellungen. Das Stück erhielt mehrere Preise und wurde gleich zweimal verfilmt. Es gilt bis heute als bahnbrechend.
Natürlich gab es Versuche, einen ähnlichen Erfolg zu erzielen, aber außer Deathtrap von Ira Levin kam kein anderes Stück auch nur in die Nähe. Wenn man genauer darüber nachdenkt, kann man ja auf der Bühne auch nicht allzu viel machen. Ein paar Tricks und Illusionen sind Teil des Zaubers, aber das Wichtigste sind doch die Worte. Es geht um Menschen, die sich im Raum hin und her bewegen und dabei reden. Shaffer brach die physikalischen Gesetze: Wenn der Strom ausfällt, geht das Licht an. Aber einen solchen Regie-Einfall kann man nur einmal haben. Jeder, der ihn nachzuahmen versucht, langweilt die Leute bloß.
Trotzdem war ich besessen davon, mich daran zu versuchen. Ich wollte unbedingt ein Stück mit wenigen Personen und zahlreichen überraschenden Wendungen schreiben, und die Bühne dabei auf eine sensationelle neue Weise nutzen. Jedes Mal, wenn ich gerade kein Fernsehdrehbuch und keinen Roman schrieb, notierte ich mir tolle Ideen und hatte schon drei Stücke fertig, als mir der Plot für Mindgame einfiel. Meine Erfolge als Dramatiker waren bis dahin sehr überschaubar gewesen. A Handbag, einer meiner drei Einakter, war bei einem lokalen Theaterfestival aufgeführt worden, die beiden anderen hatten es nicht auf die Bühne geschafft.
Auch Mindgame wäre nie aufgeführt worden, wenn meine Schwester Caroline damals nicht eine kleine, aber sehr erfolgreiche Schauspiel-Agentur geführt hätte. Sie hatte Mindgame gelesen und, ohne es mir zu sagen, an einen Produzenten namens Ahmet Yurdakul weitergegeben. Ein paar Tage später rief er mich an und lud mich zu einem Gespräch ein.
Ich werde diese Begegnung niemals vergessen. Ahmet hatte ein Büro in der Nähe der Euston Station. Es lag so nahe an den Gleisen, dass der Boden zitterte und die Kekse auf dem Teller tanzten, wenn draußen die Züge vorbeifuhren. Es erinnerte mich an einen alten Schwarzweißfilm. Ahmet war ein adretter, zierlicher Mann mit pechschwarzem Haar und bot mir eine Tasse Tee an, die nach Maschinenöl schmeckte. Er redete sehr schnell und kaute dabei auf seinen Fingernägeln herum. An seiner Anzugjacke fehlte ein Knopf, und während er sprach, konnte ich meine Augen nicht von der Stelle abwenden, wo er hätte sein sollen und wo stattdessen drei schwarze Fäden heraushingen. Seine Assistentin, Maureen Bates, war im selben Alter wie er – ungefähr fünfzig. Sie hatte silbergraues Haar und trug eine Strickjacke mit Zopfmuster. Ihre Brille hing an einer dünnen Kette. Sie schien äußerst skeptisch und misstrauisch, und die Art und Weise, wie sie ihren Chef betüttelte, erinnerte an eine ältere Tante oder eine Art Leibwächterin. Sie sagte kaum ein Wort, machte sich aber fleißig Notizen in einer winzigen Handschrift.
Sehr vertrauenswürdig wirkte das Büro nicht. Es lag im Untergeschoss eines dreistöckigen Hauses, und das Fenster war so staubig, dass kaum Licht hereindrang. Die Möbel passten nicht zusammen und waren auffallend hässlich. Ich ließ die Augen über die Plakate gleiten, die an den Wänden hingen, und fragte mich, ob ich für mein Meisterstück die richtige Heimat gefunden hatte. Run for Your Wife, eine Farce von Ray Cooney war in Norwich uraufgeführt worden. It Ain’t Half Hot Mum, nach der erfolgreichen Sitcom der BBC, war im Gaiety Theatre auf der Insel Man aufgeführt worden. Rolf Harris hatte im Epsom Playhouse den Robin Hood gespielt, und auf einer Freiluftbühne im Middleham Castle war mit sechs Personen eine gekürzte Fassung von Shakespeares Macbeth inszeniert worden.
Zu seiner Ehre muss man sagen, dass Ahmet mein Stück wirklich liebte. Als ich sein Büro betrat, stand er auf und umarmte mich in einer Wolke von Aftershave und Tabakdunst. Als wir uns setzten, sah ich amerikanische Zigaretten und ein schweres Onyx-Feuerzeug auf seinem Schreibtisch.
»Das ist ein großartiges Stück! Ein sehr großartiges Stück!« Das waren fast seine ersten Worte. Das Typoskript lag vor ihm auf dem Tisch, und er unterstrich sein Lob, indem er mehrfach mit dem Handrücken darauf schlug. Er trug einen schweren Siegelring, der eine Delle auf dem obersten Blatt hinterließ. »Finden Sie nicht auch, Maureen?«
Maureen sagte nichts.
»Kümmern Sie sich nicht um sie! Sie liest nie etwas. Sie hat keine Ahnung. Wir gehen mit dem Stück auf Tour. Und am Ende kommt die Premiere in London! Ich liebe Ihre Schwester, weil sie mir das geschickt hat. Ich weine vor Glück, dass Sie heute bei mir sind.«
Ahmet war Türke. Ich glaube, er mochte seine Rolle und benutzte ganz bewusst eine blumige Sprache, um seine Andersartigkeit zu betonen. Als ich ihn ein bisschen besser kennenlernte, merkte ich, dass er keinerlei Problem mit der englischen Sprache hatte. Seine Eltern stammten aus Zypern und waren Anfang der Siebzigerjahre nach England gekommen, als es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen auf der Mittelmeerinsel kam. Sie fanden eine kleine Wohnung in Enfield, im Norden von London. Während seine Eltern ein Kleidergeschäft aufbauten, fuhr der damals zehnjährige Ahmet jeden Tag mit dem Bus zur Schule. Er erwähnte mal, dass er an der Roehampton University Computerwissenschaften studiert hatte und noch jahrelang bei seinen Eltern gelebt und am Aufbau des EDV-Systems der sozialen Dienste in Enfield mitgearbeitet hatte. Jedes Mal, wenn wir uns trafen, erzählte er mir etwas mehr von sich selbst. Offenbar hoffte er, dass ich ein Buch über ihn schreiben würde – genau wie Hawthorne. Ich hörte ihm höflich zu, aber ich gebe zu, dass ich mich mehr dafür interessierte, was er für mein Stück tun wollte und ob eine Aussicht bestand, dass er seine Absichten auch verwirklichen konnte.
Maureen hatte bereits einen Tournee-Plan entworfen und legte ihn mir jetzt hin: Bath, Southampton, Colchester, York … Das waren alles Städte mit guten Theatern, und wie sich bald zeigen sollte, war Ahmet durchaus in der Lage, seine Versprechungen in die Tat umzusetzen. Er holte Ewan Lloyd an Bord, einen namhaften Regisseur, und in den folgenden Wochen erhielt ich regelmäßige Updates. Das Budget war gesichert. Jordan Williams interessierte sich für die Rolle des Dr. Farquhar. Die Theater hatten unterschrieben. An der Gestaltung wurde gearbeitet. Jordan Williams hatte die Rolle des Dr. Farquhar übernommen. Ein Probenraum war gebucht worden. Ich fasse die Ereignisse mehrerer Monate hier in wenigen Zeilen zusammen, weil ich zu dem kommen will, was schließlich bei der Premiere in London geschah. Aber ich kann gar nicht genug betonen, wie aufregend und spannend das alles für mich gewesen ist. Es war der Traum meiner Jugend, der sich da verwirklichte, ein Ehrgeiz, der mich nie verlassen hatte.
Die Handlung von Mindgame ist folgende: Der Journalist und Krimischreiber Mark Styler besucht eine Irrenanstalt namens Fairfields in der Hoffnung, dort ein Interview mit dem berüchtigten Serienmörder Easterman machen zu können. Aber dazu muss er erst einmal an Dr. Farquhar vorbeikommen, dem skeptischen Leiter der Anstalt, der ihm den Zugang zu seinem Patienten verweigert. Schnell bemerkt der Journalist, dass in Fairfields nicht alles mit rechten Dingen zugeht. So fragt er sich, warum in Dr. Farquhars Büro ein Skelett an der Garderobe hängt, und er hat das Gefühl, dass die Assistentin des Direktors ihn vor etwas warnen will, aber erst als offene Gewalt ausbricht, wird ihm klar, dass in dieser Anstalt die Irren die Macht übernommen haben. Der echte Dr. Farquhar ist tot, und Styler sitzt in der Falle.
Die zentrale Idee bestand darin, dass nicht nur die Figuren, sondern auch das Publikum jederzeit spüren sollten, dass in dieser Welt nichts so war, wie es schien. Deshalb spielte ihnen auch das Bühnenbild ein paar Streiche. Eine Schranktür führt in einen Korridor und später plötzlich ins Badezimmer. Die Aussicht aus dem Fenster wird von einer Ziegelmauer versperrt, die in wenigen Minuten emporwächst. Die Bilder an der Wand zeigen unversehens andere Gegenstände. Die Vorhänge verändern die Farbe, und die Möbel werden ausgetauscht, ohne dass es die Zuschauer mitkriegen. Ursprünglich sollte das Stück Metanoia heißen, aber das hatte Maureen rasch verhindert. Metanoia ist ein psychologischer Fachbegriff für einen transformativen Sinneswandel, aber Maureen hatte darüber den Kopf geschüttelt. »Warum soll ich gutes Geld bezahlen, um mir etwas anzusehen, wovon ich gar nicht weiß, was es bedeutet?«, fragte sie.
Die Welturaufführung von Mindgame fand in Colchester statt und war erstaunlich erfolgreich. Es gab gute Besprechungen in der Lokalpresse, und das Publikum war begeistert. Ich kann das insofern bestätigen, als ich bei einigen Vorstellungen persönlich dabei war. In der Pause habe ich mich dann in die Bar geschlichen und zugehört, was die Leute gesagt haben. Der erste Akt endet dramatisch: Der Serienmörder Easterman ist ausgebrochen und hat die Rolle von Dr. Farquhar übernommen. Er hat dessen Assistentin ermordet und geht mit einem Skalpell auf Mark Styler los, der hilflos in einer Zwangsjacke steckt. Es scheint keine Rettung zu geben, und in diesem Augenblick fällt der Vorhang. Es klappte hervorragend. Die Leute gingen richtig mit. Ich hörte, wie sie sich fragten, was wohl als Nächstes passieren würde. Niemand machte sich in der Pause davon.
In den folgenden Monaten hatte ich andere Dinge zu tun, aber das Stück blieb weiterhin auf Erfolgskurs. Oft dachte ich wochenlang nicht daran, aber immer wieder rief Ahmet mich an und erzählte von besonders guten Besprechungen oder kleinen Problemen. Die wirklich große Nachricht kam dann Ende Februar. Nachdem er die bisherigen Einnahmen mit seinem Buchhalter geprüft hatte, beschloss Ahmet den Sprung ins Londoner West End zu wagen. Er investierte eine Menge Geld und buchte für zwölf Wochen das Vaudeville, ein hübsches altes Theater am Strand, ganz in der Nähe vom Trafalgar Square. Für Proben waren nur drei Wochen Zeit. Einer der Schauspieler war ausgeschieden. Aber der Regisseur, Ewan Lloyd, war geblieben. Die Premiere sollte in der zweiten Aprilwoche sein.
Ehe ich wusste, wie mir geschah, begannen in einer ehemaligen Lagerhalle in Dalston die Proben, und ich durfte dabei sein. Der Probenraum war genauso, wie ich ihn mir vorgestellt hatte: ein großer, leerer Saal. Die Decke war dreimal so hoch wie üblich, und von den Wänden blätterte die Farbe ab. Im Küchenbereich gab es eine bunte Sammlung von Tassen, zwei Wasserkocher, Teebeutel und Keksdosen. Ein paar Plastikstühle für den Regisseur und die Schauspieler standen im Kreis wie bei einem Treffen der Anonymen Alkoholiker. Der Grundriss der Bühne war mit Kreide auf die Dielenbretter gemalt, und die Stellen, wo die Türen und Fenster sein würden, waren mit Absperrkegeln markiert. Die Requisiten lagen auf Tapeziertischen, und Stylers Zwangsjacke und ein paar andere Sachen hingen an einer Kleiderstange. An der Wand standen weitere Plastikstühle für den Regieassistenten, die Kostümassistentin, den Beleuchter und anderes Bühnenpersonal. Die Atmosphäre war immer sehr angespannt … oder zumindest sehr konzentriert.
In diesen wenigen Tagen lernte ich Ewan Lloyd und die Schauspieler erst richtig kennen. Ich würde nicht behaupten, dass ich zu einem Teil der Truppe wurde, aber ich gehörte immerhin zum äußeren Kreis. Gelegentlich tranken wir nach Feierabend noch etwas zusammen, und es entstand so etwas wie Kameradschaft.
Als ich Ewan kennenlernte, nahm ich an, dass er schwul sei. Er gab sich sehr manieriert, trug einen langen Schal und einen Hut wie Oscar Wilde, und ich stellte mir vor, dass er eine Zigarettenspitze aus Elfenbein hatte. Ich war sehr überrascht, als mir Ahmet erzählte, dass Ewan zwar jetzt geschieden sei, zuvor aber lange mit einer Schauspielerin zusammengelebt hatte. Aus dieser Ehe seien nicht weniger als vier Kinder hervorgegangen.
Ewan war Ende vierzig und hatte sich den Schädel komplett kahlrasiert. Er war sehr genau, ja fast schon pingelig, was seine Arbeit anging, und sein leichtes Stottern machte die Sache nicht besser. Er trug eine Brille mit einem dünnen Rahmen und benutzte sie wie ein Dirigent seinen Taktstock. Mal tippte er damit auf das Textbuch, mal stach er sie mir fast ins Gesicht, um seine Erläuterungen zu unterstreichen. Maureen hatte mir seinen Lebenslauf gezeigt: Er hatte in vielen guten Theatern gearbeitet, allerdings war nicht zu übersehen, dass die Inszenierungen in den letzten Jahren seltener geworden waren. Er hatte ein paar Stücke in Antwerpen auf die Bühne gebracht, war dann aber nach England zurückgekehrt, um Macbeth in Middleham Castle für Ahmet zu inszenieren.
An einem Abend waren wir zusammen essen gegangen. Nur wir beide, beim Chinesen. Er erzählte mir von seinen Inszenierungen und den Auszeichnungen, die er erhalten hatte, und brach dann plötzlich in eine lange Beschimpfung des ganzen Betriebs aus. Vielleicht war der Wein daran schuld. Auf der ganzen Welt werde er anerkannt, sagte er. In Belgien sei er eine Berühmtheit. Aber hier in England, wo er zu Hause war, hätte man ihn nie so richtig zu schätzen gewusst. Er wäre gern mal künstlerischer Leiter einer guten Bühne in der englischen Provinz geworden, aber er wüsste schon, dass es dazu nie kommen würde, weil sich alle gegen ihn verschworen hatten.
Wir waren mittlerweile bei der zweiten Flasche. Ich fühlte mich sehr unbehaglich und sagte kein Wort, als er mir sein Leid klagte.
»Das ist alles nur wegen diesem verdammten Chichester«, sagte er. »Dieses elende Nest! Theaterleute sind wirklich ein mieses Pack. So viel Boshaftigkeit! Ständig gehen sie sich an die Gurgel. Sie lauern nur darauf, dass sie dir einen reinwürgen können, und sobald sich die Gelegenheit ergibt, schlagen sie zu.«
Nach dem, was er sagte, hatten all seine Probleme beim Chichester Festival angefangen. Genau vor acht Jahren. Er hatte Die heilige Johanna von George Bernard Shaw inszeniert, mit Sonja Childs in der Titelrolle. Die eigentliche Verbrennung sieht man ja meistens nicht. Die findet immer hinter der Bühne statt. Aber Ewan hatte beschlossen, mit einem Knalleffekt anzufangen: mit einem prasselnden Scheiterhaufen und dichten Rauchwolken; man sollte den halbnackten Henker sehen und die johlende Menge. Das sollte ein Vorspiel sein, das auf das Ende hindeutete. Es sollte das Schicksal der Heldin beleuchten.
Aber bei der Premiere war alles schiefgegangen.
»Es war nicht meine Schuld«, sagte er. »Ich hatte alles nach Vorschrift gemacht. Die Haftungsfragen waren geklärt, die Bühnenaufsicht und das Management waren vorbereitet, es gab einen genauen Notfallplan. Wir hatten mit der Polizei, der Feuerwehr, den örtlichen Behörden geredet … mehr hätte ich wirklich nicht tun können. Danach fand eine genaue Untersuchung statt. Ich wurde stundenlang befragt, und anschließend waren sich alle einig, dass ich keine Schuld hatte. Natürlich wurde das Stück sofort vom Spielplan abgesetzt. Aber das war ohnehin schon egal. Für das, was mit Sonja geschah, werde ich mir ohnehin nie vergeben. Es war alles so schrecklich.«
»Ist sie gestorben?«, fragte ich.
»Nein.« Ewan warf mir über sein Glas hinweg einen traurigen Blick zu. »Aber ihre Verbrennungen waren so schwer, dass ihre Karriere beendet war. Allerdings meine auch. Danach wollte niemand mehr etwas von mir wissen. Zwei Regieaufträge wurden mir einfach weggenommen, obwohl die Verträge längst unterschrieben waren. Als ob ich das verdammte Streichholz angesteckt hätte! Sehen Sie, was aus mir geworden ist! Ich meine … Ahmet ist ein feiner Kerl, aber er ist nicht gerade Cameron Mackintosh, oder?«
Die Schauspieler blieben mehr auf Distanz. Jordan Williams habe ich ja schon erwähnt. Er hatte sich bereit erklärt, Dr. Farquhar zu spielen, und war ohne Zweifel der Star der Show. Er stammte von den amerikanischen Ureinwohnern ab – der erste Lakota, den ich je kennenlernte. Ich hatte mich bei Wikipedia über ihn informiert und herausgefunden, dass er in der Rosebud Reservation in South Dakota das Licht der Welt erblickt hatte. Er hatte zehn Jahre in Hollywood gearbeitet und war für seine Rolle als psychopathischer Mörder in der American Horror Story mit einer Emmy-Nominierung belohnt worden. Er hatte seine Visagistin geheiratet, und weil sie Engländerin war, lebte er jetzt im Vereinigten Königreich. Als er ankam, hatten die Zeitungen darüber spekuliert, ob er vielleicht die Rolle von Peter Capaldi übernehmen und der erste ethnisch diverse Doctor Who werden würde, aber das erwies sich als falsch. Stattdessen hatte er eine ganze Reihe verschiedener Rollen im Fernsehen, Film und Theater übernommen und sich damit einen Namen gemacht. Wirklich berühmt war er nicht, aber man schätzte und respektierte ihn.
Der Umgang mit Schauspielern fällt mir nicht leicht, und auf ihn traf das ganz besonders zu. Er war ein breitschultriger Mann mit durchdringenden Augen. Jedes Mal, wenn wir uns unterhielten, schien mich sein Blick zu durchbohren. Seine Züge waren von mathematischer Präzision, seine Nase war eine vollkommene Gerade und sein Kinn war quadratisch. Sein ergrauendes Haar war nicht lang genug für einen Pferdeschwanz, aber wenn er nicht auf der Bühne stand, hatte er es am Hinterkopf mit einem farbigen Bändchen zu einem Knoten geschlungen. Er war mit Abstand das älteste Mitglied der Truppe, aber sein Alter stand ihm nicht schlecht. Er wirkte sehr lässig, wenn er vornübergebeugt in den Probenraum schlurfte, die Hände tief in den Taschen der Jeans oder Jogginghose vergraben und sehr weit weg mit seinen Gedanken. Wenn er redete, wählte er seine Worte sorgfältig, ohne den geringsten amerikanischen Akzent. Man hatte jeden Augenblick das Gefühl, dass er eine Rolle spielte … das war das Typische an ihm. Man wusste nie, wo der Schauspieler aufhörte – und das führte manchmal zu Missverständnissen.
Am Ende der ersten Probenwoche in Dalston kam es zu einem hässlichen Zwischenfall. Wir probten die Szene, in der Dr. Farquhar sich auf Nurse Plimpton stürzt, die von Sky Palmer gespielt wurde. Ich sah, wie die beiden in der Mitte der Spielfläche standen, umringt von den anderen. Jordan hatte Sky Palmer an beiden Armen gepackt und brüllte sie an. Sein Gesicht war ihrem ganz nahe. Sie mussten die Szene mittlerweile schon hundertmal geprobt und gespielt haben, aber plötzlich fing Sky an zu schreien. Erst dachte ich, sie improvisiert und probiert etwas Neues aus. Dann sah ich das erschrockene Gesicht des Regisseurs und begriff, dass Sky tatsächlich Schmerzen litt. Jordan hatte sich so in seine Rolle hineingesteigert, dass er die Frau erst losließ, als Ewan ihn anbrüllte und die anderen eingriffen. Sky fiel zu Boden, und ich sah die roten Striemen auf ihren Armen. Sie hatte große Angst gehabt und Quetschungen an den Armen erlitten. An diesem Tag gab es keine weiteren Proben.
Als wir den Probenraum verließen, erzählte mir Ewan, dass sich Jordan nicht zum ersten Mal so benommen hatte. Offenbar war sein Verhalten berüchtigt. Er war ein Method Actor, der sein Rollenstudium außerordentlich ernst nahm. Als er den Wegelagerer Dick Turpin für die BBC spielte, hatte er nicht nur Reiten gelernt, sondern auch darauf bestanden, den berühmten Zweihundert-Meilen-Ritt von London nach Yorkshire persönlich nachzuspielen, und war beim Überqueren der M 1 fast zu Tode gekommen. Als er King Lear spielte, hatte er während der Proben gelegentlich draußen auf Hampstead Heath übernachtet.
Fairerweise muss man erwähnen, dass er auch sehr großzügig sein konnte. Es war ihm entsetzlich peinlich, was er getan hatte, und als wir die Proben am Montag fortsetzten, brachte er Sky einen riesigen Blumenstrauß mit.
Sky Palmer selbst war ein ziemliches Rätsel. Ich hatte sie oft auf der Bühne gesehen, aber ich hätte nicht sagen können, dass ich sie gut kannte. Was insofern auch nicht erstaunlich war, als sie erst Mitte zwanzig war, also dreißig Jahre jünger als ich. Außer dem Stück hatten wir gar nichts gemeinsam. Als ich sie kennengelernt hatte, war ich von ihren dunklen Augen, ihrer Selbstsicherheit und ihren leuchtenden rosa Haaren beeindruckt gewesen, aber die Farbe hatte sie ausspülen müssen, als sie die Rolle der Assistentin in Mindgame übernahm. Auch die bunten Fingernägel und den Nasenring trug sie jetzt nicht mehr. Richtige Zigaretten rauchte sie nicht, sondern dampfte bloß E-Zigaretten, die einen leichten Mentholgeruch hinterließen. Ich hatte gefürchtet, dass die Rolle der Nurse Plimpton schwer zu besetzen sein würde, denn ich hatte sie ganz in der Tradition der Horrorfilme der Fünfziger- und Sechzigerjahre ziemlich sexistisch beschrieben. Sky schien das gar nichts auszumachen. Sie stellte mir nie eine Frage und machte alles so, wie Ewan es wollte. Ob es ihr Spaß machte, wusste man nicht so recht.
Das lag unter anderem daran, dass sie sofort ihre Kopfhörer aufsetzte und nur noch mit ihrem iPhone kommunizierte, wenn sie ihren Auftritt hinter sich hatte. Es war das allerneueste Modell, in Goldrosa mit einer glitzernden Schutzhülle. Sie spielte vor allem Minecraft und Monument Valley und scrollte ihren Twitter-Account rauf und runter. Ich habe nie gehört, dass sie sich mal mit jemandem unterhalten hätte, aber sie war ständig am Texten, was darauf hindeutete, dass sie eine Beziehung hatte. Oft hörte man mitten in einer Szene das laute Ping ihres Handys, was Ewan Lloyd zur Verzweiflung trieb. Sie entschuldigte sich jedes Mal höflich und tippte gleichzeitig ihre Antwort. Ich habe noch nie jemand mit so schnellen Daumen gesehen.
Nichts bei ihr passte zusammen. Die Sweatshirts und Leggings, in denen sie herumlief, kamen von Sports Locker, aber sie hatte auch eine Uhr von Cartier und Schuhe von Jimmy Choo. Bei den Besprechungen erwähnte sie Star Wars und The Hunger Games, aber ich sah sie auch Kafka lesen. Die Playlist auf ihrem iPhone war gespickt voll mit Björk und Madonna, aber als sie das Klavier im Probenraum einmal offen fand, setzte sie sich und spielte ein paar Takte des Präludiums von Bach. Ich war mir ziemlich sicher, dass sie uns etwas verheimlichte.
Damit blieb noch Tirian Kirke, der den Journalisten Mark Styler spielte. Er war erst später dazugekommen, als der Schauspieler, der die Rolle zuvor gehabt hatte, nach fünf Monaten auf Tournee nicht mehr länger herumziehen wollte. Tirian war der Einzige im Team, den ich nicht leiden konnte – aber das lag daran, dass ich früher mal Ärger mit ihm gehabt hatte.
Tirian war etwas älter als Sky und hatte schon verschiedene Fernsehauftritte hinter sich, unter anderem als Polizeibeamter in Spooks und Line of Duty und Bediensteter in Downton Abbey. Er war noch nicht allzu bekannt, aber durchaus auf dem Weg, sich einen Namen zu machen. Ich hatte mich daher sehr gefreut, als er vor einigen Jahren die Rolle eines jungen Strafgefangenen in einem Fünfteiler übernahm, zu dem ich das Drehbuch geschrieben hatte. Er hatte eine Menge starker Szenen, die mit einem sehr eindrucksvollen Selbstmord endeten. Beim Vorsprechen hatte er alle beeindruckt, und man hatte ihm sofort einen Vertrag angeboten. Aber kurz vor der Unterschrift zickte er plötzlich rum. Seine Agentin erklärte, das Drehbuch gefiele ihm nicht, was mich nicht wirklich freute. Die Rolle übernahm dann Joe Cole, der sie fabelhaft spielte und bald ein richtiger Star wurde. Bei den Dreharbeiten von Unrecht! hatte ich dann übrigens Hawthorne kennengelernt. Aber das änderte nichts daran, dass ich von Tirian sehr enttäuscht war. Er hatte Zeit und Geld verschwendet und uns im Stich gelassen.
Ich war daher etwas beunruhigt, als ich hörte, dass er die Rolle des Mark Styler übernehmen sollte. Einerseits fürchtete ich, er könnte uns wieder hängenlassen, andererseits fand ich aber, dass Tirian zu eitel war, um die Rolle des Journalisten zu spielen. Seine schicke Frisur, seine Designerklamotten und die Ducati, mit der er bei den Proben vorfuhr, schienen mir etwas zu selbstgefällig. Andererseits durfte ich nicht vergessen, dass all diese Dinge daher gekommen waren, dass er ein sehr erfolgreicher Schauspieler war, und wir froh sein konnten, dass wir ihn hatten. Außerdem sah er genauso aus, wie ich mir Mark Styler vorgestellt hatte: schlank und knochig, mit einem kantigen Gesicht und dunklen Augen. Seine Nase war etwas schräg, und sein freches Lächeln kam immer erst mit Verzögerung. Er wirkte ganz anders als die meisten gutaussehenden jungen Schauspieler in England mit ihren oft viel zu glatten Gesichtern. Er war einer dieser Typen, die man sich merkte. Und genau das war auch geschehen. Er war dem Hollywoodregisseur Christopher Nolan aufgefallen, der ihn für eine sehr aufwändige Produktion engagiert hatte, die später im Jahr gedreht werden sollte.
Tenet würde Tirian berühmt machen, was durchaus nützlich für unsere Londoner Premiere sein konnte. Nur leider wusste er, dass er berühmt werden würde. Das führte dazu, dass er ziemlich unbeliebt war. Jordan Williams, der mit seinem Vorgänger sehr gut ausgekommen war, mochte ihn überhaupt nicht. Er beschwerte sich, dass Tirian seinen Text nicht beherrschte, ihm die Schau zu stehlen versuchte und nicht auf Augenhöhe mit ihm sprach. Tirian wiederum fauchte zurück. Jordan betreibe Effekthascherei, schwadroniere und spiele sich fürchterlich auf. Sky wiederum hielt sich da raus.
Das also war die Truppe, die in der ersten Aprilwoche ins Vaudeville Theatre einzog. Bei den technischen und den Kostümproben war ich nicht dabei. Für mich gab es nichts mehr zu tun, aber das steigerte nur meine Nervosität. Es war sehr eigenartig. Das Theater war doch meine Leidenschaft und mein Ehrgeiz. Das war, was ich immer gewollt hatte. Als ich mit meiner Frau, meiner Schwester und meinen zwei Söhnen zur Premiere ins Theater ging, hätte ich viel aufgeregter und begeisterter sein müssen. Da oben strahlte mein Name in Leuchtbuchstaben! (Naja, nicht ganz vollständig: Das ›t‹ von Anthony war durchgebrannt.) Aber ich war kein bisschen begeistert. Mir war einfach schlecht.
Es wird schon alles gutgehen, sagte ich mir. Das Publikum in York und Southampton hat das Stück geliebt. Warum sollte es hier anders sein?
»Ist alles in Ordnung?«, fragte meine Frau.
»Ja«, sagte ich. Aber das war eine Lüge.
Dann betraten wir das Theater.
3
Premiere
Das Vaudeville ist ein herrliches Haus. Die Viktorianer wollten, dass man seinen Theaterabend von Anfang bis Ende genießt, und überschütteten einen mit Blattgold und rotem Samt, mit Spiegeln und Kronleuchtern. Die freudige Erwartung des Dramas beginnt schon lange, ehe man sich auf seinen Platz gesetzt hat. Die Beinfreiheit, der Blick auf die Bühne und die Toiletten waren ihnen nicht ganz so wichtig, aber man kann ja nicht alles haben.
Das Foyer war schon voller Besucher, die in alle Richtungen durcheinanderwuselten: zur Abendkasse, ins Parkett, in die Logen, zur Treppe, auf die Ränge, zur Bar. Es war gar nicht so einfach, zum Saal vorzudringen, aber dann entdeckte ich ein paar vertraute Gesichter in der Menge. Ahmet trug einen zweireihigen schwarzen Anzug mit Knebelknöpfen. Maureen war wie immer an seiner Seite, behängt mit großen Mengen von Modeschmuck und einem vor langer Zeit gestorbenen Tier um den Hals. Ahmet hatte nie von einer Ehefrau oder Familie gesprochen, und ich hatte mich schon mehrfach gefragt, ob seine Beziehung zu Maureen mehr umfasste als nur die Bürostunden.
Es waren auch einige Schauspieler unter den Zuschauern, deren Gesichter ich kannte, ohne dass mir die Namen gleich einfielen. Wahrscheinlich Freunde und Bekannte des Regisseurs und des Teams. Ewan Lloyd verschwand gerade die Treppe hinunter in Richtung der vorderen Reihen. Er schien ganz für sich zu sein. Ich hätte es nie zugegeben, aber als ich mich in der Menge umsah, suchten meine Blicke nach Hawthorne. Ich fragte mich, ob er mich nicht überraschen würde und vielleicht doch gekommen war. Aber er war nicht da.
Wir gingen ins Parkett hinunter, wo sehr gute Plätze in der Mitte einer der vorderen Reihen für uns reserviert waren. Während wir uns an den Leuten vorbeischoben, die schon vor uns gekommen waren, hatte ich plötzlich das Gefühl, dass ich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand. Das stimmte natürlich nicht. Ich bezweifle, dass mich überhaupt jemand erkannte. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, in der Falle zu sitzen. Das Theater war voll: siebenhundert Menschen, verteilt auf drei Stockwerke. Sie waren überall um mich herum. Viele davon in den Schatten, verkleinert durch die Entfernung. Sie waren keine Einzelnen mehr, sondern ein Publikum. Ein Gerichtshof. Mein Magen brannte. Ich fühlte mich wie ein Verurteilter.
Und dann sah ich sie: meine wirklichen Richter.
Die Kritiker.
Sie waren überall im Parkett verstreut. Sie waren leicht zu erkennen an ihren ausdruckslosen Gesichtern und manche auch an den Notebooks, die sie auf den Knien hatten. Michael Billington vom Guardian, Henry Hitchings vom Standard, Libby Purves von der Times, Harriet Throsby von der Sunday Times, Dominic Cavendish vom Telegraph. Viele kannte ich vom Old Vic, wo ich seit kurzem im Vorstand saß. Man hatte sie ganz bewusst auseinandergesetzt, und sie vermieden jeden Augenkontakt, vor allem untereinander. Sie waren zwar keine Rivalen, aber auch keine Freunde, schien mir. Sie standen jeder für sich.
Hatte ich vor ihnen Angst?
Ja.
Wegen der Rezensionen von Büchern oder Fernsehserien habe ich mir nie besondere Sorgen gemacht. Sie können zwar ätzend sein, aber wie groß der Einfluss ist, den sie haben, ist fraglich. Letztlich lesen und sehen die Leute das, was sie wollen. Und die Kritiken treffen mich nicht direkt. Sie beziehen sich auf Dinge, die ich schon vor längerer Zeit geschrieben habe – bei Fernsehdrehbüchern liegen oft Jahre dazwischen –, und inzwischen bin ich mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Sie können der ganzen Welt mitteilen, dass ich unfähig bin, aber es ist schon zu spät.
Die Kritiker hier im Theater waren etwas ganz anderes. Sie waren direkt vor Ort. Einige saßen in derselben Reihe wie ich. Ihre Rezensionen konnten uns einfach den Hahn zudrehen. Während ich so dasaß und darauf wartete, dass der Vorhang sich hob, kamen mir immer mehr Zweifel an dem, was ich geschrieben hatte. Würden sie die Witze witzig finden? Was würden sie über den Angriff auf Nurse Plimpton sagen, am Ende vom Ersten Akt? War es ein Fehler gewesen, über Dr. Farquhars sexuelle Präferenzen zu spekulieren? Gerade eben hatte ich mir noch wegen des Premierenpublikums Sorgen gemacht. Aber die Zuschauer waren gar nicht entscheidend, die waren auf meiner Seite. Die meisten hatten sowieso Freikarten, oder nicht? Die Kritiker hielten mein Schicksal in ihren Händen.
Meine Frau berührte mich am Arm. »Es fängt mit Verspätung an!«, sagte sie.
Ich warf einen Blick auf die Uhr, und mein Puls setzte ein paar Sekunden lang aus. Sie hatte recht. Es war bereits fünf nach halb acht. Was war da los? War Tirian nicht erschienen? War jemand krank? Ich sah mich um. Bis jetzt war noch alles ruhig. Niemand schien nervös zu werden. Nur ich hatte Angstschweiß auf der Stirn, während ich wartete.
Endlich wurde es dunkel im Zuschauerraum. Ich holte tief Luft, als der Vorhang sich hob.
Erster Akt
Das Stück spielt im Büro von Dr. Alex Farquhar im Fairfield Institut für geistesgestörte Straftäter. Das Sprechzimmer ist gemütlich und altmodisch eingerichtet. Es scheint aus den Sechzigerjahren zu stammen, so wie die Hammer-Horrorfilme.
Ein großer, unaufgeräumter Schreibtisch beherrscht den Raum. Ein Fenster öffnet den Blick auf Felder, Obstbäume und eine niedrige Mauer. Eine Tür auf der anderen Seite gehört zu einem großen Schrank. In einer Ecke hängt unpassenderweise ein menschliches Skelett an einem Stativ.
Auf dem Besucherstuhl vor dem Schreibtisch sitzt Mark Styler, ein Autor und Journalist Anfang dreißig. Seine Kleidung ist leger, sein Gesicht ist blass und seine Frisur vielleicht etwas merkwürdig … ansonsten ist er der typische »Experte«, wie man sie aus dem Fernsehen kennt.
Man hat ihn offenbar warten lassen. Er wirft einen Blick auf seine Uhr, dann nimmt er ein digitales Aufnahmegerät aus der Tasche, stellt es an und sagt:
STYLER: Aufnahme vom 22. Juli, Donnerstag, achtzehn Uhr fünfzehn.
So geht das Stück los. Ich weiß nicht, ob ich auch nur einmal Atem holte, als Styler seinen Anfangsmonolog sprach. Ich sah ihm zu, wie er im Büro auf und ab ging und seine Gedanken aufzeichnete, wie er das schon Hunderte Male getan hatte. Ich wusste, auf welche Stelle ich wartete. Mindgame ist unter anderem auch eine Komödie. So hatten wir es verkauft, und meine Beobachtungen während der Tournee hatten mich gelehrt, dass immer der erste Lacher entscheidend ist. Danach sind alle entspannter.
Die Stelle kam, an der sich Styler vom Fenster entfernt und die Bücherregale mustert:
STYLER: Hmm, Doktor Farquhar ordnet seine Bücher nach Alphabet. Ich weiß nicht, ob man ihm trauen kann.
Es war keine besonders witzige Pointe, aber beim Publikum hatte sie jedes Mal eingeschlagen. Und so war es auch diesmal. Ich hörte, wie sich in der Dunkelheit ein halb unterdrücktes Gelächter ausbreitete, das mich angenehm im Genick kitzelte. Zum ersten Mal an diesem Abend dachte ich, dass alles gutgehen würde.
Die nächste Stunde verging wie im Flug, und das Stück lief unglaublich gut, schien mir. Niemand verhaspelte sich, und niemand hatte den Text vergessen. Das Bühnenbild funktionierte. Die Lacher kamen häufiger, und je düsterer die Handlung wurde, desto mehr stieg die Spannung. Das spürte ich. Nurse Plimpton wurde angegriffen. Mark Styler wurde mit einem Trick dazu gebracht, eine Zwangsjacke anzuprobieren. Dr. Farquhar ging mit einem Skalpell in der Hand auf ihn los. Vorhang, Beifall und Pause.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:


![Der Tote aus Zimmer 12. Susan Ryeland ermittelt [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/f29b5c5fba27049bb29f9e3f1876fde2/w200_u90.jpg)


![Mord in Highgate. Hawthorne ermittelt [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/089fc19c4ec8b4ecb2d6573d5df1cc74/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Stormbreaker [Band 1] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a50942d1747f6f8e55b49793c0526659/w200_u90.jpg)

![Alex Rider. Gemini-Project [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5c4cca9cd875693fa38bd1fe5643672c/w200_u90.jpg)
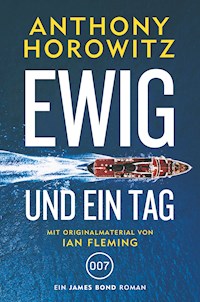

![Wenn Worte töten. Hawthorne ermittelt [Band 3] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/fd859681bbb599e306846498660819cf/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Skeleton Key [Band 3] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/320ebe043418750c249478304f43c699/w200_u90.jpg)

![Alex Rider. Ark Angel [Band 6] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0edb9586d5f912fe388eb13780edd96f/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Scorpia [Band 5] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8818b99503b4fee6aa78484cc0275aa9/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Eagle Strike [Band 4] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/e46a21054c8da2b3c0d46afe9bc7c865/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Scorpia Rising [Band 9] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3c94c2aaec60d2997fb8da5488146852/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Crocodile Tears [Band 8] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3d4c3c2ca6b7c5bf541a32fa57f1bbf3/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Snakehead [Band 7] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/18daaba796e373f6fd5944e2f667ed7b/w200_u90.jpg)









