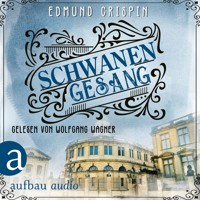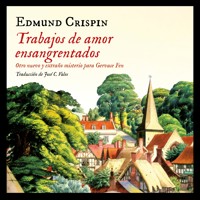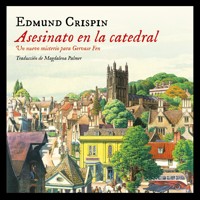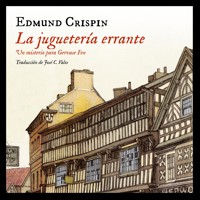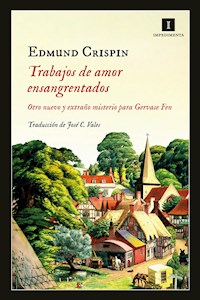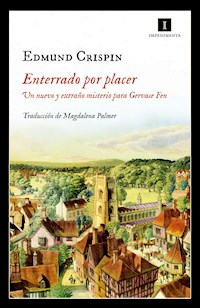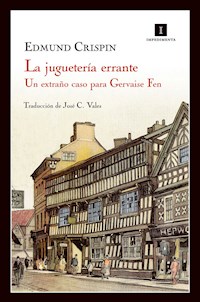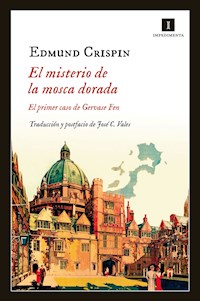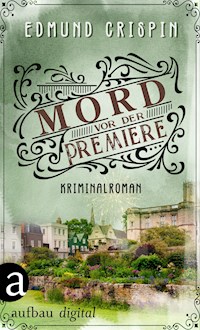
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Professor Gervase Fen ermittelt
- Sprache: Deutsch
»Dolly, könntest Du kurz einmal einen Selbstmord begehen?« Im Winter 1940 verschlägt es den Theaterregisseur Robert Warner für die Premiere seines neuesten Stücks nach Oxford. Gemeinsam mit einem bunt zusammengewürfelten Haufen rund um die provokante Schauspielerin Yseut Haskell, reist er für die Proben an. In der Truppe ist sie mehr als unbeliebt und sorgt für Unruhe in der ebenso verschworenen wie zerstrittenen Gemeinschaft. Kurz darauf wird sie erschossen in einem hermetisch verschlossenen Raum aufgefunden. Der Großteil der Schauspieler hatte ein Interesse die Exzentrikerin loszuwerden und nur wenige haben ein Alibi. Die Polizei ist ratlos und will den Fall schon mit Selbstmord abtun. Doch Gervase Fen, seines Zeichens Oxford Professor und Literaturkritiker mit einem Hang zum Lösen kniffliger Fälle, nimmt sich der Sache an ... „Mord vor der Premiere“ erschien erstmals 1944 und war Edmund Crispins Debüt sowie der erste Roman rund um den exzentrischen Oxford Professor Gervase Fen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Edmund Crispin
Edmund Crispin, geboren 1921, war das Pseudonym des englischen Krimiautors und Komponisten Robert Bruce Montgomery. 1944 erschien der erste Band seiner Reihe um den Ermittler Gervase Fen, Professor für englische Literatur in Oxford. Crispins Kriminalromane zeichnen sich durch ihren humoristischen Stil, der bis ins Absurde reicht, und gleichzeitig einen hohen literarischen Anspruch aus. Er verstarb 1978. Alle neun Romane der Krimireihe um Gervase Fen sind bei Aufbau Digital verfügbar.
Informationen zum Buch
»Dolly könntest Du kurz einmal einen Selbstmord begehen?«
Im Winter 1940 verschlägt es den Theaterregisseur Robert Warner für die Premiere seines neuesten Stücks nach Oxford. Gemeinsam mit einem bunt zusammengewürfelten Haufen rund um die provokante Schauspielerin Yseut Haskell, reist er für die Proben an. In der Truppe ist sie mehr als unbeliebt und sorgt für Unruhe in der ebenso verschworenen wie zerstrittenen Gemeinschaft. Kurz darauf wird sie erschossen in einem hermetisch verschlossenen Raum aufgefunden. Der Großteil der Schauspieler hatte ein Interesse die Exzentrikerin loszuwerden und nur wenige haben ein Alibi. Die Polizei ist ratlos und will den Fall schon mit Selbstmord abtun. Doch Gervase Fen, seines Zeichens Oxford Professor und Literaturkritiker mit einem Hang zum Lösen kniffliger Fälle, nimmt sich der Sache an …
»Mord vor der Premiere« erschien erstmals 1944 und war Edmund Crispins Debüt sowie der erste Roman rund um den exzentrischen Oxford Professor Gervase Fen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Edmund Crispin
Mord vor der Premiere
Übersetzt von Joanna Bold
Inhaltsübersicht
Über Edmund Crispin
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel I: Prolog in der Eisenbahn
Kapitel II: Yseut
Kapitel III: Zarte Stimmen proben
Kapitel IV: Überholte Aktion
Kapitel V: »Cave Ne Exeat«
Kapitel VI: Lebt wohl, Wonnen der Welt
Kapitel VII: Lebt Wohl, Wonnen der Welt
Kapitel VIII: Ein feiner und privater Ort
Kapitel IX: Letzter Wille und Testament
Kapitel X: Verscherzte Hoffnungen
Kapitel XI: Das Questentier
Kapitel XII: Vignetten
Kapitel XIII: Ein Vorfall bei der Abendmesse
Kapitel XIV: Schrecklich, überführt zu werden
Kapitel XV: Der Fall ist geschlossen
Kapitel XVI: Epilog: Die goldene Fliege
Anmerkungen
Impressum
Kapitel IProlog in der Eisenbahn
Hast thou done them? speak;
Will every savor breed a pang of death?
Hast du sie präpariert? Sprich;
Birgt jeder Hauch die Todesqual?
CHRISTOPHER MARLOWE (1564–1593)
Für den unaufmerksamen Reisenden bedeutet die Didcot Station die baldige Ankunft in Oxford, für den erfahreneren mindestens eine weitere halbe Stunde Frustration. In diese beiden Kategorien kann man die Reisenden für gewöhnlich einteilen. Die der ersten schleudern unter Entschuldigungen ihr Gepäck vom Netz auf die Sitze, wo es bis zum Ende der Reise liegenbleibt, als sperriges Hindernis mit einer Vielzahl unerwartet scharfer Ecken; die der zweiten starren weiter düster aus dem Fenster auf die öden Wälder und Felder, in deren Mitte der Bahnhof von einer geistlosen Lokalgottheit ohne ersichtlichen Grund deponiert wurde, und auf die Reihen von Lastwagen aus allen Teilen des Landes, die sich hier zusammengefunden haben wie die Insel der verlorenen Schiffe des zeitgenössischen Mythos inmitten der Sargassosee. Eine beständige Geräuschkulisse aus dunklem Gemurmel und Schreien sowie heftigem Reißen von Holz und Metall, das fern an eine frühe Walpurgisnacht auf einem nahen Friedhof erinnert, lässt die Reisenden, die über etwas mehr Vorstellungskraft verfügen, vermuten, dass die Lok auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt wird. Der Aufenthalt in Didcot beläuft sich in der Regel auf knapp zwanzig Minuten.
Dann folgen etwa drei Fehlstarts unter ungeheurem Krachen und Stampfen der Maschine, was die Fahrgäste in einen Zustand tiefster Ergebenheit rüttelt. Mit unendlichem Widerstreben setzt sich der Zug schließlich in Bewegung und trägt seine unglückliche Fracht auf außerordentlich entspannte Weise durch die flache Landschaft. Es folgen noch eine ziemlich überraschende Anzahl von Zwischenstationen und kurzen Halten vor Oxford. Der Zug lässt keine aus. Oft verweilt er ohne jeden ersichtlichen Grund, da niemand ein- oder aussteigt. Hat der Schaffner jemanden verspätet die Bahnhofsstraße herabeilen sehen oder einen Fahrgast aus dem Ort schlafend in seiner Ecke entdeckt und es war ihm unangenehm, ihn zu wecken? Steht eine Kuh auf dem Gleis oder das Signal ist gegen uns? Eine Überprüfung beweist, da ist keine Kuh, oder ein Signal, weder das eine noch das andere.
Kurz vor Oxford wird die Angelegenheit etwas heiterer, sagen wir in Sichtweite des Kanals oder des Tom Tower. Eine Atmosphäre des Zielbewusstseins wird spürbar. Jetzt noch sitzenzubleiben, hut- und mantellos, den Koffer im Gepäckträger und das Ticket in der Innentasche zu lassen, erfordert höchste Willenskraft. Hoffnungsvollere Insassen bahnen sich schon ihren Weg auf die Gänge. Aber unweigerlich hält der Zug direkt vor dem Bahnhof, die monolithische Erscheinung des Gaswerks auf der einen und die eines Friedhofs auf der anderen Seite. Dort verweilt die Lok mit dämonischer Starrköpfigkeit, stößt gelegentlich mit nekrophilem Genuss ächzende Laute und schrille Pfiffe aus. Unbändige, nervöse Frustration setzt ein; da ist Oxford, dort, nur wenige Meter entfernt, ist der Bahnhof, und hier ist der Zug. Aber den Passagieren ist es nicht erlaubt, am Gleis entlangzugehen, falls überhaupt jemand auf die Idee käme. Sie durchleben die Qualen des Tantalus in der Unterwelt. Dieses Zwischenspiel, dieses memento mori, mit dem die Eisenbahngesellschaft die vielversprechenden Burschen und Mädchen in ihrer Obhut daran erinnert, dass sie unausweichlich zu Staub werden, dauert für gewöhnlich zehn Minuten. Danach setzt der Zug missmutig seine Fahrt fort und fährt in den Bahnhof ein, den Max Beerbohm so zutreffend »das letzte Relikt des Mittelalters« genannt hat.
Falls jedoch irgendeiner der Reisenden glaubt, dies sei das Ende, dann irrt er. Einmal dort angekommen, inzwischen beginnen sich sogar die größten Skeptiker zu regen, bemerkt jeder sofort, dass sich der Zug an gar keinem Bahnsteig, sondern auf einem Zwischengleis befindet. Auf beiden Seiten warten Freunde und Verwandte, eilen, nachdem ihnen die Wiedervereinigung in letzter Minute noch verwehrt wird, Freudenschreie ausstoßend hin und her oder verharren mit verdrossenen, ängstlichen Gesichtern und versuchen einen flüchtigen Blick von jenen zu erhaschen, die sie abholen wollen. Es ist, als würde Charons Boot manövrierunfähig mitten auf dem Styx dümpeln, weder fähig, die Reise zu den Toten fortzuführen, noch dazu, zu den Lebenden zurückzukehren. Unterdessen lassen Erschütterungen von seismografischer Stärke die Passagiere samt Gepäck auf den Gängen und im Ausstiegsbereich hilflos schreiend durcheinanderpurzeln. In wenigen Augenblicken werden jene, die auf den Bahnsteigen warten, überrascht den Zug mit einer Rauchwolke und üblem Gestank in Richtung Manchester verschwinden sehen. Bald darauf wird er rückwärts wiederkehren und wie durch ein Wunder ist die Reise vorbei.
Verunsichert strömen die Passagiere durch die Fahrkartenschalter, verstreuen sich wieder auf der Suche nach Taxis, die im Krieg ihre Fahrgäste ohne Rücksicht auf Stellung, Alter oder Vorrang aufnehmen, jedoch mit einer strikt eingehaltenen Logik, die nur sie kennen. Der Strom wird dünner und verliert sich in einem Labyrinth aus alten Gemäuern, Mahnmalen, Kirchen, Universitätsgebäuden, Büchereien, Hotels, Kneipen, Schneidereien und Buchläden, aus denen Oxford besteht. Die Klügeren schauen, wo sie sofort etwas zu trinken bekommen, die Hartnäckigeren schlagen sich zu ihrem endgültigen Ziel durch. Der Wettkampf um Fahrgelegenheiten lässt nur ein paar Einsame zurück, die hier umsteigen müssen und sich unglücklich zwischen den Milchkannen auf dem Bahnsteig die Zeit vertreiben.
Auf die eingangs beschriebene schwere Prüfung reagierten die elf Personen, die zu unterschiedlichen Zeiten und aus unterschiedlichen Gründen in der Woche vom vierten bis elften Oktober 1940 von der Londoner Paddington Station aus nach Oxford reisten, auf unterschiedliche und charakteristische Weise.
Gervase Fen, Professor für englische Sprache und Literatur, von Natur aus kein geduldiger Mensch, war unübersehbar nervös. Die Verzögerungen trieben ihn in den Wahnsinn. Er hüstelte und stöhnte und gähnte, scharrte mit den Füßen und warf seinen großen, schlaksigen Körper in der Ecke, in der er saß, hin und her. Sein freundliches, glattrasiertes und stets leicht gerötetes Gesicht wurde röter als gewöhnlich; seine dunklen, sorgfältig mit Wasser niedergehaltenen Haare befreiten sich missmutig vereinzelt aus der Zähmung. Unter den gegebenen Umständen war sein normaler Überschuss an Energie schlicht lästig. Für gewöhnlich ließ ihn diese Eigenschaft alle möglichen Verpflichtungen eingehen, um anschließend düster zu klagen, er sei mit Arbeit überlastet, was allem Anschein nach niemanden kümmere. Da zudem seine einzige Ablenkung darin bestand, noch einmal aufmerksam eines seiner eigenen Bücher über die unbedeutenderen Satiriker des 18. Jahrhunderts zu lesen, um sich zu erinnern, wie seine Meinung zu diesem Thema damals war, wurde er im späteren Verlauf der Reise zutiefst unglücklich. Er kehrte von einer jener zahllosen Bildungskonferenzen nach Oxford zurück, die am laufenden Band stattfinden und auf denen über die Zukunft der einen oder anderen Institution entschieden werden soll – Entscheidungen, falls welche getroffen werden, die zwei Tage später wieder vergessen sind. Während sich der Zug im Schneckentempo vorwärtsbewegte, dachte er mit schwermütiger Resignation an die William-Dunbar-Vorlesungen, die er vorbereitete, rauchte eine beträchtliche Anzahl Zigaretten und fragte sich, ob es ihm vergönnt sein würde, einen neuen Mordfall zu untersuchen, vorausgesetzt es gäbe einen. Später erinnerte er sich ohne Genugtuung an diesen Wunsch, weil er ihm in jener äußerst ironischen Weise, die den Göttern Vergnügen zu bereiten scheint, gewährt werden sollte.
Er reiste erster Klasse, da er sich immer gewünscht hatte, es sich leisten zu können. Aber im Moment machte ihm selbst das keine Freude. Gelegentlich plagten ihn Gewissensbisse über diese zur Zurschaustellung relativ bescheidenen Wohlstands. Es war ihm jedoch mithilfe einer ex tempore entwickelten Beweisführung zur Belehrung jemands, der ihm unklugerweise Snobismus vorgeworfen hatte, gelungen, sich durch ein etwas wackliges ökonomisches Argument zu rechtfertigen. »Mein lieber Freund«, hatte Gervase Fen geantwortet, »die Eisenbahn hat gewisse konstante Betriebskosten; wenn wir, die wir es uns leisten können, nicht erster Klasse reisen würden, müssten alle Preise in der dritten Klasse steigen, und das würde doch wohl niemandem nützen. Ändern Sie zunächst einmal Ihr ökonomisches System«, fügte er an den Unglücklichen gewandt mit einer weit ausladenden Geste hinzu, »dann stellt sich das Problem erst gar nicht.« Später unterbreitete er dieses Argument mit einigem Triumph dem Professor für Ökonomie, der ihm stotternd in Bruchstücken seine Bedenken kundtat.
Jetzt, da der Zug wieder einmal anhielt, zündete er sich eine Zigarette an, warf sein Buch beiseite, seufzte tief und murmelte vor sich hin. »Ein Verbrechen! Ein richtig herrlich kompliziertes Verbrechen!« Er begann, sich Fantasieverbrechen auszudenken und löste sie mit unglaublicher Geschwindigkeit.
Sheila McGaw, die junge Regisseurin des Oxforder Theaters, reiste in der dritten Klasse. Sie tat dies, weil sie der Meinung war, die Kunst müsse sich zunächst dem Volk zuwenden, bevor sie wieder an Vitalität gewinnen könne. Sie zeigte gerade einem Bauern, der neben ihr saß, ein Buch über Gordon Craigs Bühnenbilder. Sie war eine große junge Frau in Hosen, hatte klar gezeichnete Gesichtszüge, eine hervorstechende Nase und glattes, flachsfarbenes, in Glockenform geschnittenes Haar. Der Bauer schien nicht sehr interessiert an den Techniken der zeitgenössischen Bühnenkunst. Die Darstellung der Nachteile der Drehbühne bewegten ihn nicht besonders; er zeigte keinerlei Emotionen, lediglich einen momentanen Widerwillen, als ihm erklärt wurde, Schauspieler würden in der Sowjetunion Verdiente Künstler des Volkes genannt und erhielten von Josef Stalin große Geldbeträge. Als die Rede auf Stanislawski kam, sah er keinen anderen Ausweg, als die Defensive aufzugeben und die Flucht nach vorn anzutreten. Er beschrieb die in der Landwirtschaft angewandten Methoden. Mit steigender Begeisterung erzählte er von Silage, der Besamung von Kühen, dem Weizen- und Getreidebrand und anderen durch die Saat übertragenen Krankheiten, dem verbesserten Typ einer Spezialegge und dergleichen; er beklagte mit großem Detailreichtum die Aktivitäten des Landwirtschaftsministeriums. Die Tirade dauerte, bis der Zug endlich in Oxford ankam. Der Bauer verabschiedete sich sehr herzlich von Sheila und ging etwas überrascht über seine eigene Eloquenz von dannen. Sheila, die dieser Ausbruch zunächst etwas verblüfft hatte, gelang es schließlich, sich durch eine Art Selbsthypnose davon zu überzeugen, dass das alles doch sehr interessant gewesen sei. Allem Anschein nach, so überlegte sie jedoch mit Bedauern, hatte das Leben in der Landwirtschaft nur wenige Berührungspunkte mit dem in Eugene O'Neills Drama Gier unter den Ulmen.
Robert Warner und seine jüdische Freundin, Rachel West, reisten gemeinsam zur Uraufführung seines neuen Stückes Metromania am Oxforder Theater an. Es war für seine Freunde ein ziemlicher Schock, dass ein satirischer Dramatiker vom Ruf eines Robert Warner sein neues Stück in der Provinz aufführen musste, aber es gab ein oder zwei durchaus triftige Gründe dafür. Erstens war die Aufführung seines letzten Stücks in London trotz seiner Reputation kein Erfolg gewesen, zudem ließen die Theater aufgrund des beträchtlichen Besucherrückgangs infolge der deutschen Luftangriffe äußerste Vorsicht walten. Zweitens enthielt sein Stück gewisse experimentelle Elemente und er war sich unsicher, ob sie beim Publikum ankommen würden. Aufgrund all dieser Gesichtspunkte war ein Testlauf in der Provinz angebracht und aus Gründen, die hier nicht weiter erörtert werden müssen, wurde Oxford ausgewählt. Robert würde das Stück mit dem dortigen Ensemble selbst inszenieren, allerdings mit Rachel in der Hauptrolle, deren Ruf aus erfolgreichen Produktionen im Londoner West End einen hinreichenden Ansturm auf die Theaterkasse garantierte. Die Beziehung zwischen Robert und Rachel war freundschaftlich und beständig. Während des letzten Jahres war sie fast platonisch geworden; darüber hinaus jedoch getragen von gemeinsamen Interessen sowie echter gegenseitiger Achtung und Zuneigung. Seit Didcot schwiegen sie. Robert war Ende dreißig, mit struppigem, dunklem Haar (eine nicht zu bändigende Locke fiel ihm bis über die Brauen), einer dicken Hornbrille, die seine wachsamen, intelligenten Augen abschirmte, groß, ziemlich hager und unauffällig in einen dunklen, sportlichen Anzug gekleidet. Er strahlte eine gewisse Autorität aus. Seine Bewegungen vermittelten einen Eindruck von Ernsthaftigkeit, fast von Askese. Auf die Bummelei der Eisenbahngesellschaft reagierte er mit geübter Selbstbeherrschung, stand nur einmal auf, um auf die Toilette zu gehen. Während er den Gang hinunterschlenderte, sah er Yseut und Helen Haskell, die zwei oder drei Abteile weiter saßen. Da er aber keine Lust hatte, mit ihnen zu sprechen, ging er rasch vorbei und hoffte, sie würden ihn nicht bemerken. Wieder auf seinem Platz erzählte er Rachel, dass die beiden im Zug säßen.
»Ich mag Helen«, reflektierte Rachel nachdenklich. »Sie ist süß und zudem eine hervorragende Schauspielerin.«
»Yseut ist mir zuwider.«
»Nun, wir können ihnen nicht aus dem Weg gehen, wenn wir in Oxford ankommen. Ich dachte, du magst Yseut.«
»Ich mag Yseut nicht.«
»Ab Dienstag musst du ohnehin mit den beiden arbeiten. Ich verstehe nicht, was es für einen Unterschied macht, ob wir schon jetzt mit ihnen zusammenkommen oder erst später.«
»Je später, desto besser, wenn du mich fragst. Ich könnte die Frau mit großem Vergnügen umbringen«, antwortete Robert Warner aus seiner Ecke. »Ich könnte die Frau mit großem Vergnügen umbringen.«
Yseut Haskell war ganz offensichtlich gelangweilt. Wie es ihre Art war, machte sie auch keinen Hehl daraus. Während jedoch Fens Ungeduld ein spontaner, unbewusster Ausbruch war, stellte Yseut ihre bewusst zur Schau. Wir sind alle in einem beträchtlichen Maße mit uns selbst beschäftigt, aber bei ihr schloss diese Beschäftigung alles andere aus und war obendrein hauptsächlich sexueller Natur. Sie war noch jung – vielleicht fünfundzwanzig –, mit vollen Brüsten und Hüften, die sie krude durch die Kleidung betonte, hatte prachtvolles, sorgsam gepflegtes rotes Haar. Hier endete jedoch, aus Sicht der meisten, ihr Anspruch auf Attraktivität. Ihr Gesicht, obgleich auf konventionelle Weise hübsch, ließ wenig Charakter erkennen: ein wenig egoistisch, ein wenig eitel. In Gesprächen erwies sie sich als pseudo-intellektuell und etwas dümmlich. Ihr Verhalten gegenüber dem anderen Geschlecht war unverhohlen einladend, sprach daher nur sehr wenige an. Ihr Verhalten gegenüber dem eigenen war boshaft und hinterlistig. Sie gehörte zu jener großen Gruppe von Frauen, die bereits in sehr zartem Alter über sexuelles Wissen verfügen, ohne sexuell erfahren zu sein, und noch als Erwachsene in diesem pubertären Zustand verharren. Innerhalb bestimmter Grenzen war sie hilfsbereit, innerhalb bestimmter Grenzen sich ihrer Schauspielerei bewusst, doch auch hier reizte sie hauptsächlich die Möglichkeit zur Selbstdarstellung. Seit der Schauspielschule gehörte sie überwiegend fest dem Ensemble eines Theaters an, obgleich ihr eine kurze Affäre mit einem Londoner Manager einmal eine Hauptrolle in einer West-End-Produktion beschert hatte, die aus dem einen oder anderen Grund nicht sehr erfolgreich gewesen war. Nun war sie seit zwei Jahren in Oxford und sprach noch immer von ihrem Agenten, über den Zustand der Londoner Theaterszene und die Wahrscheinlichkeit, bald dorthin zurückzukehren, wobei sie eine Herablassung an den Tag legte, die nicht nur angesichts der Tatsachen völlig unberechtigt war, sondern auch verständlicherweise jedermann auf die Palme trieb. Das Ganze wurde gekrönt durch unzählige Affären, was sie den anderen Frauen des Ensembles entfremdete. Ein völlig unschuldiger Student, der ihr nicht widerstehen konnte, musste ihretwegen das College verlassen. Männer ließ sie mit dem unbefriedigten Gefühl zurück, um eine Erfahrung reicher zu sein – oft das einzig erkennbare Resultat sexueller Promiskuität. Man duldete sie weiterhin im Ensemble, da das Repertoiretheater dank seiner oft wechselnden Arbeitsstile und Rangordnungen emotional auf einer sehr komplexen und reizbaren Ebene agiert und von kleinsten Störungen aus der Bahn geworfen wird. Aus diesem Grund enthielten sich die einfühlsameren Mitglieder des Ensembles jedes direkten Ausdrucks von Feindseligkeit. Sie erkannten klar, dass zumindest oberflächlich freundliche Beziehungen aufrechterhalten werden mussten, sonst würde die delikate zwischenmenschliche Balance über den Haufen geworfen, es würden sich feindliche Gruppen bilden und grundsätzliche Änderungen wären notwendig.
Yseut hatte bereits ein Jahr vor den Ereignissen, mit denen wir uns hier befassen, Robert Warners Bekanntschaft gemacht, genauer gesagt seine intime Bekanntschaft. Aber er war ein Mann, der von seinen Affären sehr viel mehr verlangte als reine körperliche Stimulation, und so wurde die Beziehung von ihm nach kurzer Zeit abrupt beendet. Normalerweise zog es Yseut vor, selbst den Schlussstrich zu ziehen. Da Robert, weil er schier unerträglich gelangweilt war, ihr in diesem Fall zuvorgekommen war, hegte sie nicht nur eine beträchtliche Abneigung gegen ihn, sondern, wie nicht anders zu erwarten, auch den sehnlichen Wunsch, ihn wieder zurückzugewinnen. Auf der Reise brütete sie über seinen bevorstehenden Besuch am Theater und fragte sich, was wohl in der Angelegenheit zu tun wäre. In der Zwischenzeit konzentrierte sie ihre Aufmerksamkeit auf einen jungen Captain der Artillerie, der ihr gegenübersaß, den Krimi Keine Orchideen für Miss Blandish las, und die zermürbende Langsamkeit des Zuges überhaupt nicht wahrnahm. Sie versuchte erfolglos, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Er wandte sich jedoch nach kurzer Zeit mit einem charmanten, aber distanzierten Lächeln wieder seinem Buch zu. »Ach zum Teufel!«, sagte sie, »ich wünschte, dieser verdammte Zug würde einen Zahn zulegen.«
Helen war Yseuts Halbschwester. Ihr Vater, ein Experte für mittelalterliche französische Literatur und ein Mann mit wenigen weiteren Interessen, hatte durch die Heirat einer reichen Frau trotzdem eine ausreichende Einsicht in weltliche Dinge bewiesen. Yseut war sein erstes Kind, ihre Mutter war drei Monate nach der Geburt gestorben und hinterließ dem Kind ihr halbes Vermögen. Bis zu ihrem einundzwanzigsten Lebensjahr wurde es treuhänderisch verwaltet. Die Folge war, dass Yseut jetzt beträchtlich reicher war, als ihr guttat. Bevor die Mutter starb, hatte es noch einen wütenden Streit über Yseuts fremdartigen Namen gegeben, auf dem der Gatte jedoch mit unerwarteter Festigkeit bestand. Er hatte die besten Jahre seines Lebens der intensiven, wenn auch äußerst fruchtlosen Beschäftigung mit den höfischen Tristan-Romanen gewidmet und war entschlossen, ein Symbol seiner Studien weiterbestehen zu lassen; schließlich, fast ein wenig zu seiner eigenen Überraschung, hatte er seinen Willen durchgesetzt. Zwei Jahre später heiratete er wieder, nach weiteren zwei Jahren wurde Helen geboren. Anlässlich dieser zweiten Taufe machten die sarkastischeren unter seinen Freunden den Vorschlag, sollten noch weitere Töchter das Licht der Welt erblicken, müssten diese wohl Nicolette, Heloise, Julia und Cressida genannt werden. Doch als Helen drei Jahre alt war, kamen ihre Eltern bei einem Eisenbahnunglück ums Leben. Sie und Yseut wurden von einer entfernten, sehr geschäftstüchtigen Cousine ihrer Mutter aufgezogen. Der gelang es, Yseut, als diese einundzwanzig war, zu überreden (mit welchen Mitteln, weiß der Himmel allein, denn Yseut konnte Helen überhaupt nicht leiden), ein Schriftstück zu unterschreiben, mit dem sie im Falle ihres Todes ihr gesamtes Vermögen ihrer Halbschwester vermachte.
Die Abneigung war gegenseitig. Zunächst einmal war Helen in fast jeder Hinsicht anders als Yseut. Sie war klein, schlank, blond, hübsch (auf eine kindliche Art, die sie viel jünger aussehen ließ, als sie eigentlich war), hatte große, blaue Augen und ein offenes, aufrichtiges Wesen. Obgleich ihr Interesse nicht so sehr im Intellektuellen lag, verstand sie es, sich intelligent und mit einer bezaubernden Bescheidenheit auszudrücken, die dem Gegenüber schmeichelte. Sie war einem Flirt durchaus nicht abgeneigt, jedoch nur, solange es ihre Arbeit, die sie mit berechtigter, fast ein wenig komischer Ernsthaftigkeit betrachtete, nicht beeinträchtigte. Tatsächlich war sie für ihr Alter eine höchst begabte Schauspielerin und obgleich sie nichts von der starken intellektuellen Brillanz einer Shaw-Darstellerin hatte, überzeugte sie in leiseren Rollen. Vor zwei Jahren hatte sie als Julia einen erstaunlichen und hochverdienten Erfolg. Yseut war sich der Überlegenheit ihrer Schwester in dieser Hinsicht nur allzu bewusst, eine Tatsache, die nicht gerade dazu beitrug, ihr Verhältnis zueinander herzlicher werden zu lassen.
Helen hatte die ganze Fahrt über noch kein einziges Wort gesagt. Sie las Cymbeline. Auf ihrer Stirn zeigten sich kleine Konzentrationsfalten. Sie war sich nicht sicher, ob sie die Lektüre genoss. Gelegentlich, wenn der Zug besonders lange irgendwo hielt, seufzte sie und blickte aus dem Fenster, dann wandte sie sich wieder ihrem Buch zu. ›Ein sterbliches Mineral‹, dachte sie, was in aller Welt soll das sein? Und wer ist wessen Sohn und weshalb?
Sir Richard Freeman, Chief Constable von Oxford, kehrte von einer Polizeikonferenz des Scotland Yard zurück. Er saß bequem zurückgelehnt in der Ecke seines Erste-Klasse-Abteils, die eisengrauen Haare sorgfältig zurückgebürstet. In seinen Augen blitzte Kampflust. Er hielt eine Ausgabe von Fens DieUnbekannteren Satiriker des XVIII. Jahrhunderts vor sich und verspürte gerade heftigsten Widerspruch gegen die Meinung des Experten, was das Werk von Charles Churchill betraf. Als Fen diese Kritik später hörte, war er nicht beeindruckt. Öffentlich zeigte er unter keinen Umständen etwas anderes als überlegene Gleichgültigkeit gegenüber seinem Fachgebiet. Die Beziehung zwischen den beiden Männern war schon seltsam: Sir Richards Hauptinteresse galt der englischen Literatur, Fens hingegen der Arbeit der Polizei. Sie konnten stundenlang zusammensitzen und fantastische Theorien über die Arbeit des anderen ausarbeiten, wobei sie über die Jahre einen feinen Spott für die Kompetenz des Gegenübers entwickelt hatten. Wenn es aber um Detektivgeschichten ging, die Fen mit großer Begeisterung las, kam es häufig fast zu einem handfesten Streit, da Fen hinterlistig, aber mit einer gewissen Berechtigung darauf bestand, dass es sich dabei um die einzige literarische Form handele, die die wahre Tradition des englischen Romans fortführe, während Sir Richard seiner Verärgerung über die lächerlichen Methoden, mit denen die Fälle gelöst wurden, freien Lauf ließ. Ihre Beziehung wurde weiter kompliziert durch die Tatsache, dass Fen etliche Fälle gelöst hatte, bei denen die Polizei in eine Sackgasse geraten war, während Sir Richard drei Bücher zu literarischen Themen veröffentlicht hatte (über Shakespeare, Blake und Chaucer), die nach Ansicht der begeisterungsfähigeren Feuilletonisten der Wochenzeitschriften die konventionelle akademische Gelehrsamkeit, wie Fen sie betrieb, weit hinter sich ließen. Es war jedoch der Amateurstatus der beiden, der für ihren bemerkenswerten Erfolg verantwortlich zu machen war. Wenn sie jemals die Plätze getauscht hätten, wie ein verschmitzter alter Dozent an Fens College einmal vorschlug, so hätte Fen die Arbeit der Polizei ebenso unerträglich gefunden wie Sir Richard die krittelnde Finesse der Literaturwissenschaft. Was ihre Hobbys für sie reizvoll machte, war ja gerade, dass sie all diese lästigen Details nicht zu beachten brauchten, sich vielmehr ihren spontanen Impulsen hingeben konnten. Ihre Freundschaft währte bereits sehr lange und jeder der beiden genoss die Gesellschaft des anderen außerordentlich.
Sir Richard, in den Autor der Rosciad vertieft, entging das unstete Verhalten der Eisenbahn völlig. In Oxford entstieg er würdevoll dem Zug. Ohne Schwierigkeiten verschaffte er sich einen Träger und ein Taxi. Als er einstieg, kam ihm Churchill in den Sinn. »›Ein großer und fruchtbarer Wildapfelbaum‹«, murmelte er zur großen Überraschung des Fahrers, »›ein großer und fruchtbarer wilder Apfelbaum‹.« Dann etwas schroffer: »Sitzen Sie nicht da und starren mich an, Mann! Ramsden House.« Das Taxi brauste los.
Donald Fellowes war auf der Rückreise von einem glücklichen Wochenende in London. Er hatte von Orgelemporen aus Messen zugehört und sich an endlosen Diskussionen über Kirchenmusik, Orgeln, Chorknaben, kirchliche Laienarbeit sowie die kleinen Schwächen und gelegentliche Exzentrik anderer Organisten beteiligt, wie sie sich immer ergeben, wenn Kirchenmusiker aufeinandertreffen. Als der Zug von Didcot abfuhr, schloss er nachdenklich die Augen und fragte sich, ob es wohl eine gute Sache wäre, an einer Stelle des Benedictus den Takt leicht zu variieren, und wie lange er wohl damit durchkäme, das Te Deum pianissimo zu spielen, bevor sich jemand beklagen würde. Donald war ein stiller, dunkler, kleiner Mensch, er trug mit Vorliebe Fliege statt Krawatte, hatte eine Schwäche für Gin und war sehr friedlich in seiner Art (wenn überhaupt irgendetwas, dann vielleicht ein wenig ausdruckslos). Er war Organist an Fens College, das ich Sankt Christopher nennen werde. Während seines Geschichtsstudiums hatte er sich so sehr mit Musik beschäftigt, dass seine Tutoren große Bedenken hatten – zu Recht, wie sich herausstellte –, ob sie ihn jemals durch irgendeine Prüfung bekommen würden. Nach dem vierten erfolglosen Versuch hatten alle Beteiligten mit einem Gefühl der Erleichterung aufgegeben. Im Moment hing er einfach nur herum, ging seiner Arbeit als Organist nach, bereitete sich nur wenig auf Gruppen oder Übungen vor, schrieb an seiner Bachelorarbeit in Musik und wartete auf die Einberufung. Sein weltabgewandtes Nachsinnen über die Lobgesänge wurde oft unterbrochen von weit weltlicheren Gedanken an Yseut. Wie Nicholas Barclay es später ausdrücken sollte, war er »ernsthaft verliebt in sie.« Theoretisch kannte er ihre Schwächen, aber wenn er mit ihr zusammen war, spielte das alles nicht die geringste Rolle. Er war ihr absolut verfallen, bis über beide Ohren in sie verknallt. Als er jetzt an sie dachte, fühlte er sich plötzlich zutiefst unglücklich, und die Bummelei des Zuges steigerte sein Elend durch Verärgerung. »Zur Hölle mit der Frau!«, sagte er sich. »Und dieser verdammte Zug – ich frag mich, ob Ward sein Solo am Sonntag schaffen wird. Zur Hölle mit allen Komponisten, die in den Soli das hohe A verwenden.«
Nicholas Barclay und Jean Whitelegge verließen, nachdem sie schlecht gelaunt und schweigend im Victor's zu Mittag gegessen hatten, gemeinsam London. Beide waren an Donald Fellowes interessiert. Nicholas, weil er ihn für einen brillanten Musiker hielt, der sich wegen einer Frau zugrunde richtete. Jean, weil sie in ihn verliebt war (und somit übrigens allen Grund hatte, Yseut nicht zu mögen). Zugegeben, Nicholas war nicht gerade der Richtige dafür, andere zu kritisieren, wenn sie sich wegen irgendetwas gehenließen. Als Englischstudent war ihm eine brillante akademische Karriere vorausgesagt worden. Er hatte all die gewaltigen kommentierten Ausgaben der Klassiker gelesen, in denen der Kommentar den größten Teil der Seite einnimmt (mit kleinem Zugeständnis an den Originaltext des Autors ganz oben in der Nähe der Seitenzahl in Form eines dünnen Textrinnsals) und deren aufmerksames Studium für all jene, die so verwegen sind, eine akademische Laufbahn anzustreben, eine Pflicht darstellt. Unglücklicherweise erlag er einige Tage vor den Abschlussprüfungen der Versuchung, die endgültigen Ziele der akademischen Ausbildung infrage zu stellen. Wenn Buch auf Buch und Untersuchung auf Untersuchung folgte, würde dann je eine Zeit anbrechen, in der das letzte Wort über irgendein Thema gesprochen war? Und wenn nicht, worum ging es dann überhaupt? Alles schön und gut, hatte er sich überlegt, für jeden, der ein persönliches Vergnügen aus der Sache zog. Was ihn betraf, war das allerdings nicht der Fall. Warum also weitermachen? Da er keine Antwort darauf gefunden hatte, zog er die logische Konsequenz, tat keinen Schlag mehr und fing an zu trinken, liebenswert umgänglich, aber beständig. Nachdem er nicht zu seiner Prüfung erschienen war und sich gegenüber allen Vorhaltungen taub gestellt hatte, wurde er vom College verwiesen. Da er aber über ausreichende Geldmittel verfügte, machte ihm das nicht das geringste aus. Er frequentierte die Bars von London und Oxford, kultivierte einen leicht sardonischen Humor, schloss viele Freundschaften und las nur noch Shakespeare, den er inzwischen fast auswendig konnte. Was im Prinzip die weitere Lektüre überflüssig machte. Zum Verdruss seiner Freunde, die dies als den Gipfel des Müßiggangs betrachteten, saß er einfach da und dachte Shakespeare. Während sich der Zug Oxford näherte, der Stadt der schreienden Chöre, wie er sie wegen ihrer allgegenwärtigen Musik einmal genannt hatte, nippte Nicholas zufrieden an seiner Whiskyflasche und überflog im Kopf ganze Szenen aus Macbeth: Erlebte Gräuel sind schwächer als das Grau'n der Einbildung. Mein Traum, dass Mord nur noch ein Hirngespinst… Über Jean gibt es weniger zu erzählen. Sie war groß, dunkel, bebrillt und recht unscheinbar. Sie hatte nur Interessen an zwei Dingen: Donald Fellowes und dem Theater Club der Oxforder Universität, einer Studentengruppe, die uninteressante Experimentalstücke aufführte (wie es solche Theatergruppen für gewöhnlich tun), und deren Sekretärin sie war. Was das Erste dieser beiden Interessen betraf, so war sie klar ihrer Obsession ausgeliefert. Donald, Donald, Donald, dachte sie, die Armstützen ihres Sitzes fest umklammernd: Donald Fellowes. Ach verdammt! Das muss aufhören. Er liebt Yseut, nicht dich… Dieses Flittchen. Diese eitle, selbstgefällige Schlampe. Wenn es sie bloß nicht gäbe… Wenn nur jemand…
Nigel Blake war zufrieden und es gingen ihm viele Dinge durch den Kopf, während der Zug dahinkroch: wie schön es werden würde, Fen wiederzusehen; die Eins, sein hart erkämpfter Erfolg im Englischexamen als Jahrgangsbester vor drei Jahren; sein mühsames, aber auch recht interessantes Leben als Journalist seither; sein verspäteter zweiwöchiger Urlaub, von dem er mindestens eine Woche in Oxford verbringen würde; Robert Warners neues Stück, das er sehen würde und das sicherlich gut war… Vor allem aber dachte er an Helen Haskell: Jetzt mach mal halblang, sagte er sich, du hast du sie ja noch gar nicht getroffen. Schön ruhig bleiben. Es ist gefährlich, sich in Menschen zu verlieben, die man nur von der Bühne kennt. Sie ist wahrscheinlich eingebildet und unerträglich, verlobt oder verheiratet. Was auch immer. Sicher ist sie ständig von jungen Männern umgeben. Lächerlich, anzunehmen, du könntest sie dazu bringen, in einer Woche überhaupt Notiz von dir zu nehmen, wo du sie noch nicht einmal kennengelernt hast …
Trotzdem, befahl er sich selbst grimmig, wirst du dir jedenfalls alle Mühe geben.
Die Ziele dieser Personen in Oxford waren unterschiedlich: Fen und Donald Fellowes kehrten ins Sankt Christopher zurück; Sheila McGaw in ihre Wohnung in der Walton Street; Sir Richard Freeman in sein Haus am Boars Hill; Jean Whitelegge in ihr College; Helen und Yseut zum Theater und anschließend in ihre Zimmer in der Beaumont Street; Robert, Rachel, Nigel und Nicholas ins »Amtsstab und Zepter« im Zentrum der Stadt. Am Dienstag, den elften Oktober, waren alle in Oxford.
Und innerhalb der folgenden Woche starben drei dieser elf eines gewaltsamen Todes.
Kapitel IIYseut
Ahi! Yseut, fille de Roi,
Franche, cortoise, bone foi!
Ach! Isolde, Königstochter,
Edle, höfische, aufrichtige.
BÉROUL (12. Jahrhundert)
Nigel Blake kam um zwanzig nach fünf in Oxford an und fuhr direkt ins Hotel »Amtsstab und Zepter«, wo er Zimmer gebucht hatte. Das Hotel, sinnierte er betrübt, während er sich ihm näherte, war nicht gerade einer der architektonischen Glanzpunkte Oxfords. Es war in einer merkwürdigen Stilmischung gebaut, die ihn an nichts so sehr wie an einen riesengroßen, schrecklich deprimierenden Nachtclub mit Restaurant am Brandenburger Tor in Berlin erinnerte, den er einmal besucht hatte, und wo jeder Raum auf aggressive, romantische, absurde Art scheinbar einen anderen Nationalstil darstellen sollte. Seine eigenen Räumlichkeiten erschienen ihm, als seien sie eine groteske Parodie des Baptisteriums in Pisa. Er packte seine Sachen aus, wusch Schmutz und Unbehagen ab, was eine Zugreise immer mit sich bringt, und schlenderte die Treppe hinunter, auf der Suche nach etwas zu trinken.
Inzwischen war es halb sieben. In der Bar spielten sich vor bemüht gotischer Kulisse dezente Vorspiele zum Sex ab, verhalten anstößiges Puppentheater. Insgesamt war der Ort noch fast genauso, wie Nigel ihn in Erinnerung hatte. Jedoch war die Zahl der Studenten gesunken und die der Soldaten beträchtlich gestiegen. Ein paar ältere, künstlerisch angehauchte Theologiestudenten, die vermutlich geblieben waren, um während der Ferien zu arbeiten, oder ein paar Tage früher zurückgekommen waren, diskutierten im hohen Klageton sich in esoterische Höhen erhebend über die poetische Schönheit der Empfängnis in der Jungfrauengeburt. Eine Gruppe von Offizieren der Royal Air Force goss an der Bar mit geräuschvoll infantilem Eifer Bier hinunter. Es gab ein oder zwei sehr alte Männer und eine durcheinandergewürfelte Mischpoke aus Kunststudenten, Lehrern und Berühmtheiten auf Besuch, die in der Hoffnung, man erkenne sie, ohne die Oxford niemals vollständig ist, umhersahen. Eine bunte Ansammlung von Frauen war vor allem damit beschäftigt, die Aufmerksamkeit der jungen Männer in ihrer Begleitung auf sich zu lenken. Ein oder zwei indische Studenten bummelten, nach Aufsehen heischend, umher, aggressiv Ausgaben der bekannteren zeitgenössischen Autoren zur Schau stellend.
Nigel besorgte sich etwas zu trinken sowie einen leeren Stuhl und ließ sich mit einem kleinen Seufzer der Erleichterung nieder. Der Ort hatte sich nicht im Geringsten verändert. In Oxford, dachte er, ändern sich die Gesichter, aber die Typen bleiben dieselben. Sie tun und sagen dasselbe, von Generation zu Generation. Er zündete sich eine Zigarette an, sah sich um und fragte sich, ob er noch am selben Abend Fen besuchen solle oder nicht.
Um zwanzig vor sieben kamen Robert Warner und Rachel herein. Nigel kannte Robert ein wenig – eine flüchtige Bekanntschaft, die auf einigen literarischen Gesprächen, bei gemeinsamen Mittagessen, auf Begegnungen bei Theaterpartys sowie Premieren basierte – und winkte ihm freundlich zu.
»Dürfen wir uns zu Ihnen gesellen?«, fragte Robert. »Oder meditieren Sie?«
»Überhaupt nicht«, antwortete Nigel, etwas zweideutig. »Darf ich Ihnen etwas zu trinken holen?« Er fragte, was sie haben wollten, dankte dem Himmel, dass Robert nicht zu der Art von Menschen gehörte, die sofort schrien: »Nein, ich übernehme das«, und ging zur Bar.
Als er zurückkehrte, unterhielten sie sich gerade mit Nicholas Barclay. Man stellte sich vor und Nigel zog wieder los, in Richtung Bar. Als sie es sich schließlich alle bequem gemacht hatten, saßen sie für einen Moment schweigend da, sahen sich gegenseitig erwartungsvoll an und schlürften an ihren Getränken.
»Ich freue mich außerordentlich darauf, nächste Woche Ihr Stück zu sehen«, sagte Nigel zu Robert. »Obgleich ich gestehen muss, es überrascht mich, dass Sie es hier herausbringen.«
Robert machte eine unbestimmte Geste. »Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig«, sagte er. »Mein letztes Stück im West End war ein solch erbärmlicher Flop, dass man mich in die Provinz verbannt hat. Mein einziger Trost ist, ich kann es selbst inszenieren. Das hat man mir schon Jahre nicht mehr erlaubt.«
»Nur eine Woche Proben für ein neues Stück?«, sagte Nicholas. »Das wird Schweiß kosten.«
»Es ist eigentlich eine Art Provinztest. Verschiedene Agenten und Manager werden aus London kommen, um sich ihre Meinung zu bestätigen, ich sei im Begriff, wie ein Löwenzahnsamen vom Wind davongetragen zu werden und habe völlig den Verstand verloren. Ich hoffe, ich werde sie enttäuschen. Doch Gott allein weiß, was für eine Art von Inszenierung dabei herauskommen wird. Das Theater hier ist ein Sammelbecken für die grünen Zöglinge der Schauspielschulen, mit einem Unterbau an abgehalfterten Schauspielern und ein oder zwei der berüchtigtsten Schmierenkomödianten in ganz Europa. Ob ich es schaffen werde, ihnen innerhalb einer Woche das richtige Timing, die passende Gestik und Intonation einzubläuen, weiß ich wirklich selbst noch nicht. Aber Rachel ist ja mit dabei, das wird helfen.«
»Das bezweifle ich ehrlich gesagt«, warf Rachel ein. »Eine Außenseiterin in der Hauptrolle im Ensemble, nur damit die Kasse stimmt, das schafft vor allem eine schlechte Stimmung. Du weißt schon, Tuscheln in allen Ecken.«
»Wie ist eigentlich das Theater?«, fragte Nigel. »Ich bin kaum je in die Nähe davon gekommen, als ich noch hier oben war.«
»So viel haben Sie gearbeitet?«, warf Nicholas ungläubig ein. Er gab immer vor, nichts dergleichen getan zu haben.
»Es ist nicht schlecht«, sagte Robert. »Ein altes Gemäuer. Es wurde um die sechziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts gebaut, aber kurz vor dem Krieg renoviert. Vor etwa zehn Jahren habe ich dort gearbeitet. Mein Gott, war das schrecklich: quietschende Dimmer, unberechenbare Zwischenvorhänge, und die Kulissen fielen bei der leichtesten Berührung um. Aber all das ist jetzt vorbei. Eine gute Seele mit Geld und Ambitionen hat das Theater mit allen möglichen technischen Finessen vollgestopft. Es gibt sogar eine Drehbühne.«
»Eine Drehbühne?«, sagte Nigel unsicher.
»Eine drehbare Bühne. Wie ein runder Drehteller, in der Mitte geteilt. Man kann die nächste Szene auf der dem Publikum verborgen Seite aufbauen, zur richtigen Zeit dreht man das Ganze einfach herum. Allerdings bedeutet das auch, dass man keine seitlichen Kulissen benutzen kann, und das schränkt den Entwurf des Bühnenbildes ziemlich ein. Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass sie oft benutzt wird – es ist eine kostspielige, aber ziemlich überflüssige Anschaffung. Ich jedenfalls werde sie nicht brauchen. Sie ist einfach lästig, weil man die ganze Bühnentiefe verliert, die man sehr gut nutzen kann.«
»Und wovon handelt das Stück?«, fragte Nicholas, während er sich bequem in seinem Stuhl zurücklehnte. »Oder hieße das, Geschäftsgeheimnisse preiszugeben?«
»Das Stück?« Robert schien diese Frage zu überraschen. »Es ist die Bearbeitung eines gleichnamigen Stücks. Geschrieben wurde es von einem recht unbedeutenden französischen Autor namens Prions. Sie werden wahrscheinlich die Geschichte kennen. Ich glaube es war etwa um 1730, als Voltaire die ersten Briefe von einem gewissen Fräulein Malcrais de la Vigne erhielt, auf die er galant antwortete. Daraus entwickelte sich ein umfangreicher, sehr amouröser und literarischer Briefwechsel. Später kam Fräulein de la Vigne jedoch nach Paris. Zu Voltaires Wut, aber sonst zu jedermanns Vergnügen, entpuppte sie sich als ein großer, ziemlich fetter junger Mann namens Desforges-Maillard. Piron hat diese Situation als Ausgangspunkt für sein Stück verwendet. Ich habe das übernommen und etwas abgeändert, vor allem habe ich das Geschlecht der Personen vertauscht. Meine Hauptfigur ist eine Schriftstellerin und ihre Briefpartnerin eine boshafte Journalistin. Ich weiß, das klingt nicht nach viel«, schloss er entschuldigend ab, »aber das war eigentlich nur das Gerüst der ganzen Sache.«
»Wer spielt die Schriftstellerin?«
»Oh, Rachel natürlich«, sagte Robert freundlich. »Eine wunderbare Rolle für sie.«
»Und die Journalistin?«
»Um ganz offen zu sein, ich bin mir noch nicht sicher; wahrscheinlich Helen. Yseut ist einfach nicht in der Lage, komische Rollen zu spielen. Außerdem ist sie mir so zuwider, dass ich es einfach nicht ertragen könnte. Es gibt da wohl noch eine andere junge Frau, abgesehen von den älteren Damen. Aber man hat mir gesagt, sie würde so eigenartige Dinge auf der Bühne machen, dass ich ihr auf keinen Fall mehr als eine Nebenrolle geben dürfe. Für Yseut habe ich auch eine kleine Rolle – sie ist nur im ersten Akt auf der Bühne. Aber«, fügte er hinterlistig hinzu, wobei ein kleines Lächeln seine Mundwinkel umspielte, »ich werde darauf bestehen, dass sie nach jeder Vorstellung mindestens einmal vor dem Vorhang erscheint, keine Chance, sich einfach abzuschminken und nach Hause zu gehen.«
Nicholas stieß einen Pfiff aus, nahm sein Zigarettenetui, öffnete und balancierte es mit einer einladenden Geste auf dem Tisch. »Yseut ist wirklich sehr unbeliebt«, sagte er. »Ich habe noch nie jemanden getroffen, der ein gutes Haar an ihr lässt.«
Nigel glaubte, während er sich eine Zigarette nahm, sein Feuerzeug anknipste und es dann an die anderen weitergab, einen Funken von Interesse in Roberts Augen wahrzunehmen.
»Wer speziell mag sie nicht?«, fragte Robert.
Nicholas zuckte die Achseln. »Ich zum Beispiel, aus mehr oder weniger irrationalen Gründen, obwohl ich einen Freund habe, der ihretwegen einen verdammten Narren aus sich macht, Sie kennen das sicher – Ich bin so treu wie nur der Treue Einfalt und einfältiger als der Treue Kindheit –, Helen, um noch jemanden zu nennen – was für eine Schwester sie da am Hals hat! –, Jean. Oh, die kennen Sie natürlich nicht, eine junge Frau namens Jean Whitelegge, weil sie in den zuvor erwähnten Troilus verliebt ist, eine bescheidene Maid vom Lande, die nur darauf wartet, dass ihr Ritter endlich damit aufhört, sich mit der bösen Prinzessin herumzutreiben. Das ganze Ensemble, weil sie ein unerträgliches Flittchen ist. Sheila McGaw, weil – Oh Mann!«
Er brach abrupt ab. Nigel sah auf, um den Grund für die Unterbrechung herauszufinden, und sah Yseut die Bar betreten.
»Wenn man vom Teufel spricht«, sagte Nicholas düster.
Nigel studierte Yseut neugierig, während sie in Begleitung von Donald Fellowes näherkam. Er war äußerst überrascht. Sie hatte keinerlei Ähnlichkeit mit Helen. Er fand den kurzen, gerade gehörten Austausch interessant. Erstaunlich, welche Feindseligkeiten sie auslöste. Derzeit war er jedoch nicht geneigt, über den zugegeben oberflächlichen Eindruck hinauszugehen, Yseut sei nicht mehr als eine allgemeine Belustigung. Sie wirkte wie ein Verbund negativer Eigenschaften – Eitelkeit, Egoismus, Koketterie (später sollte er Boshaftigkeit als weitere zutreffende Eigenschaft erkennen). Sie war sehr einfach in einen blauen Pullover und eine blaue Hose gekleidet, die das rote Haar vorteilhaft zu Geltung brachten. Nigel bemerkte kaum wahrnehmbare, unangenehme Züge in ihrem Gesicht. Er seufzte. Dennoch glich sie einem Modell, das Rubens oder Renoir sicher liebend gerne gemalt hätten. Zweifellos hatte sie einen herrlichen Körper, gestand sich Nigel mit nicht rein wissenschaftlichem Interesse ein.
Donald Fellowes erschien dagegen vergleichsweise uninteressant, er bewegte sich unbeholfen und linkisch. Nigel meinte, ihn von irgendwoher zu kennen; aber wo um alles in der Welt war er ihm begegnet? Vergeblich versuchte er, sich seine Bekannten während der Jahre in Oxford in Erinnerung zu rufen, und, wie meist in solchen Fällen, konnte er sich an keinen einzigen erinnern. Alles, was sich heraufbeschwören ließ, war eine Phantom-Pantomime ausdrucksloser, ununterscheidbarer Masken. Glücklicherweise wurde das Problem für ihn dadurch gelöst, dass in Donalds Augen Wiedererkennen aufleuchtete. Nigel antwortete mit einem schwachen Lächeln. Er sah eine unbeholfene und verlegene Begegnung voraus. Schon immer hatte es ihm an Mut gefehlt, den Menschen einfach zu sagen, dass er sich nicht an sie erinnern könne.
Es folgte die übliche Zeremonie aus Gemurmel, Entschuldigungen und Wiedererkennen, wie immer, wenn eine Gruppe von Menschen aufeinandertrifft, in der sich nur einige vertraut sind, anschließend begann ein umfangreiches, kompliziertes Stühlerücken. Nicholas kam Nigel, der sich gerade wieder Richtung Bar in Bewegung setzen wollte, zuvor. Während er Pink Gins bestellte, sah er mit unverhohlener Freude die äußerst unangenehmen Gesprächsbeziehungen voraus, die sich in den nächsten Minuten herausbilden würden.
Nach oberflächlicher, doch offenbar vernichtender Begutachtung von Nigel nahm Yseut Robert fest in Beschlag. Rachel unterhielt sich mit Donald; Nigel und Nicholas hörten vergleichsweise schweigend zu.
Yseut eröffnete das Gespräch ernst und vorwurfsvoll. »Ich wünschte, du würdest mir erlauben, die Journalistin zu spielen«, sagte sie zu Robert. »Ich weiß, es ist albern, über die Besetzung zu debattieren, aber um ganz ehrlich zu sein, ich habe viel mehr Erfahrung mit solchen Rollen als Helen. Und ich dachte, vielleicht auch, weil wir uns einmal so nahe standen …«
»Standen wir uns so nahe?«
»Ich hätte nicht gedacht, dass du das so schnell vergessen würdest.« In Yseuts Stimme war eine Spur Bitterkeit.
»Mein liebes Kind, das ist keine Frage des Vergessens.« Instinktiv senkten beide ihre Stimmen. »Du weißt verdammt gut, wir sind niemals miteinander ausgekommen – dass du das jetzt hier im Zusammenhang mit der Besetzungsfrage zur Sprache bringst …«
»Es geht nicht nur um die Besetzung, Robert, das weißt du so gut wie ich.« Sie machte eine Pause. »Du hast dich mir gegenüber verdammt mies verhalten. Keine einzige Zeile an mich seither. Bei keinem anderen hätte ich das toleriert.«
»Hast du etwa vor, mich wegen eines gebrochenen Eheversprechens zu verklagen? Da wirst du eine Aufgabe haben, das versichere ich dir.«
»Ach, sei nicht so ein verdammter Idiot. Nein – ich hätte das nicht sagen dürfen.« Sie improvisierte mit Stimme und Gestik. »Vermutlich war es ja auch meine eigene Schuld, auf eine Art, ich konnte dich nicht halten, nicht mal als deine Geliebte.«
»Ich hatte bereits eine Geliebte.« Diese Unterhaltung, dachte Robert, wird verdammt unangenehm. Laut sagte er: »Überhaupt, Yseut, ich dachte, wir wären uns über all dies bereits vor langer Zeit einig gewesen. Es hatte keinen Einfluss auf die Besetzungsfrage, wenn du das meinst.« (Eine Lüge, dachte er, aber, wenn jemand so unerträglich ist …)
»Ich habe dich vermisst, Robert.«