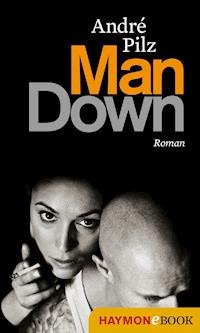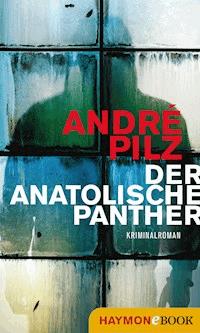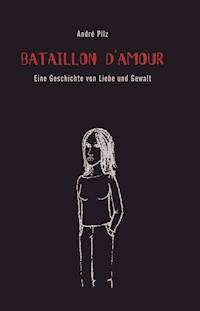13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 2000 wird die Studentin Angelika R. vor ihrem Studentenwohnheim in einer österreichischen Universitätsstadt ermordet – mit einem einzigen Stich ins Herz. Der Täter wurde nie gefunden. Sechzehn Jahre später taucht plötzlich ihre Mutter bei Jan Halder auf, einem Kommilitonen, in den Angelika verliebt war. Die Mutter bezichtigt ihn, mehr zu wissen, als er damals ausgesagt hat, und möglicherweise selbst der Mörder zu sein. Jan, inzwischen ein mittelmäßiger Autor in der Schaffenskrise, ist gerade in eine Kleinstadt gezogen, um sich neu zu sortieren. Die quälende Erinnerung an den Mord zwingt ihn, in die Universitätsstadt aufzubrechen und das Verbrechen noch einmal zu rekonstruieren. Ein Problem dabei ist, dass Jan ein notorischer Lügner ist, der auch sich selbst die Wahrheit zurechtgelegt hat. Als er die Bloggerin und Aktivistin Haddah trifft, die dort hinter den Mördern zweier südafrikanischer Studenten her ist, erkennen beide, dass sie einem Komplott auf der Spur sind. Jan muss sich, ob er will oder nicht, der Wahrheit stellen, denn inzwischen ist auch er ins Fadenkreuz der Täter von damals geraten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Titel
André Pilz
Morden und lügen
Thriller
Herausgegeben von Thomas Wörtche
Suhrkamp
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5285.
Originalausgabe© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagfoto: Roy Bishop/Arcangel
eISBN 978-3-518-77439-7
www.suhrkamp.de
Widmung
A la flor más linda
de mi querer,
Camila
&
Marietta & Gerhard
Michaela & Kai
&
Tesfay Kidane †
&
Mekateko Mashaba †
Motto
Oya na
Fine lady
Fine lady
Scatter the floor
Fine lady
Give it to them
Fine lady
Kpakurumo
Fine lady
Ric Hassani, Beautiful to me
Sag, wie viel hast du getrunken
Gar nicht so viel
Pauls Jets, Blizzard
Morden und lügen
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Motto
1 GELI
2 HADDAH
3 BECKY
4 MARGARETHE
5 MEKATEKO
6 EDUARD
7 MARIA
8 DUSHAN
9 HANA
Informationen zum Buch
1
GELI
»Schöne alte Mauern hat das Haus, nicht?«, sagte sie. »Man fühlt sich irgendwie geborgen darin.«
Ich stellte den Umzugskarton auf den Boden und sah mich um. Delma hatte es geschafft, ein wenig Ordnung in das Chaos zu bringen, und das in der einen Stunde, in der ich weg gewesen war, um uns in der Gemeinde unseres neuen Wohnorts anzumelden.
Sie stand gebeugt am Fenster, stützte sich mit den Ellbogen auf dem Sims ab und sah hinaus. »Ich habe den Schwimmer im Spülkasten repariert«, sagte sie. »Weißt du, warum da ein Leck war?«
»Weil die Wohnung uralt ist?«
»Da ist eine tote Maus drinnen gelegen.«
»What the fuck«, sagte ich. »Ich hätte das machen sollen. Tut mir leid.«
»Mir tut die kleine Maus leid. Sie hat so arm ausgesehen.«
Ihre Haare waren länger denn je, es fehlte nicht mehr viel, dann würden sie ihr bis zum Hintern reichen. Wir waren nun dreieinhalb Jahre verheiratet, aber nie hätte ich mir träumen lassen, dass wir jemals in eine solche Bruchbude in einer trostlosen Einöde ziehen würden, weitab jeden Stadtlebens.
»Wenn ich mir die Bude ansehe, tu ich mir selber leid«, sagte ich leise, biss mir auf die Unterlippe und stapfte aus dem Zimmer. Über eine hohe Schwelle und durch einen winzigen, dunklen Flur ging es links in das kleine Badezimmer mit Waschbecken, Toilette und Dusche, das gleichzeitig auch Küche war, mit Mikrowelle, Kühlschrank und einer verschmutzten Herdplatte auf einem Minitisch.
Das also war nun unser Zuhause. Eine winzige Dachbodenwohnung in einem Haus aus dem sechzehnten Jahrhundert, das, wie schon bei der ersten Besichtigung nicht zu übersehen gewesen war, dringender Reparaturarbeiten bedurfte.
»Wir haben alles, was wir brauchen«, sagte sie, als sie ihren roten Lieblingsmantel an den Kleiderhaken neben der Eingangstür hängte. »Du kannst wochenlang noch so ein langes Gesicht ziehen, es wird nichts ändern.«
Ich öffnete den Kühlschrank, bückte mich und sah hinein, er war gut gefüllt, ich musste heute nicht mehr zum Supermarkt im Nachbarort. Delma quittierte meinen zufriedenen Blick mit einem Lächeln. »Das richtige Bier?«
»Lieblingsbier.«
»Siehst du«, meinte sie. »Und da draußen liegt ein Paradies für dich, wenn du Laufen gehen willst. So viel Wald und Wiese. Vielleicht ist das der Arsch der Welt, aber ein bisschen sexy ist er ja doch auch. Sogar ein Fluss fließt da hinter den Büschen und Bäumen.«
»Fluss ist eine Übertreibung. Sieht mir mehr wie ein Bach aus.«
»Wasser auf jeden Fall. Du liebst doch dieses romantische Naturzeugs, Bäumchen, Bienchen, Flüsschen. Wir können uns ans Ufer legen und faulenzen. Du wirst hier sicher nicht an Traurigkeit zugrunde gehen.«
Sie stand in der Tür, den Kopf erhoben, keine Spur von Frust, Erschütterung. Delma war nicht kleinzukriegen, und das nicht nur, weil sie siebzehn Jahre jünger war. In Mittelamerika zu Bürgerkriegszeiten geboren, das hatte sie abgehärtet. Alles schien gut zu sein, wenn es ein Dach über dem Kopf, eine funktionierende Dusche und genügend Milch gab, während ich, privilegiert und satt, so oft wegen Kleinigkeiten jammerte, in Selbstmitleid zerfloss und in Weltuntergangsstimmung verging.
Sie kam zu mir, wir umarmten uns, während draußen zwei Motorräder in Düsenjetlautstärke auf der Bundesstraße um die Wette fuhren und auf dem Bauernhof über dem Fluss ein Hahn krähte.
Ich war nicht in Kuschelstimmung. Das alles war meine Schuld. Von A bis Z. Keine Entschuldigung. Keine Ausrede. Ich hatte es vermasselt, niemand sonst. Ich bekam in letzter Zeit nichts mehr auf die Reihe. Kein verkaufbares Skript, nicht einmal ein Treatment, mit dem ich wieder mal etwas Geld beim Film verdienen hätte können, kein Theaterstück, keine Lesungen. Nichts.
Es war ein seltenes Glück gewesen, vom Schreiben leben zu können, das wusste ich, es gab dafür keine Urlaubsreise, keinen Schnickschnack, kein Erspartes. Meine Romane hatten es auf Theaterbühnen geschafft, und Filmproduzenten hatten sich die Rechte gesichert. Ich schrieb weder Rohrkrepierer noch Bestseller. Die Leidenschaft für das Schreiben war nie erloschen, ich hatte nur ganz selten, in kurzen, verzweifelten Momenten voller Frust und Zorn, bereut, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Ich genoss die Reisen zu Lesungen in anderen Städten und Ländern, genoss die Fanpost, die Mails, die mir zeigten, dass ich treue Fans hatte, denen meine Geschichten und Figuren etwas bedeuteten. Aber ich konnte nur so lange davon leben, solange ich konzentriert arbeitete, etwas schrieb, das ich verkaufen konnte. Und im Moment wollte man mein Zeug nicht mal geschenkt.
Dass Delma trotzdem an meiner Seite stand, war ein ebenso seltenes Glück, denn der Job war verdammt egoistisch. Er gab mir viel, o ja, aber er war riskant, und das Risiko übertrug sich auch auf die Person, mit der man lebte. Zukunftsplanung? Umzug in eine andere Stadt, eine bessere Wohnung? Kinder? Das konnte man alles vergessen. Ich balancierte ohne Sicherheitsnetz, und sollte ich fallen, war alles aus und vorbei und ich würde mich mit Schulden wiederfinden und wahrscheinlich für den Rest meines Lebens Jobs annehmen müssen, die ich hasste.
»Mach dir doch nicht ständig Sorgen«, flüsterte Delma und riss mich aus den trüben Gedanken. »Alles wird gut.«
»Und wenn nicht? Was, wenn wir auch die Miete nicht mehr bezahlen können? Wohin ziehen wir dann?«
»Papa hat immer ein Zimmer für uns.«
Ich küsste sie auf die Stirn. »Ich liebe den Dschungel. Ich liebe deinen Papa. Aber ich hasse Moskitos und ewigen Sommer. Ich bin im Schnee aufgewachsen.«
»Wenn du einen Ozelot siehst, vergisst du die langweilige Gegend hier.« Sie machte ein fauchendes Geräusch, biss mich so heftig in die Schulter, dass ich aufschrie. »Wenn du an unserer Pazifikküste stehst und ein mächtiger Wal aus dem Meer aufsteigt, wirst du nie mehr zurückwollen.«
»Ich werde langsam ein alter Arsch«, meinte ich nach ein paar Küssen.
»Du bist alt«, sagte Delma und kniff mich in den Hintern. »Aber immer noch sexy. Solange du kein schlecht gelaunter Jammerlappen wirst.«
»Ich bin müde.«
»Der Umzug war anstrengend und stressig, jetzt ist er vorbei.« Sie stand vor mir auf den Zehenspitzen, kampfbereit wie ein wütender Teenager, hob den Zeigefinger, fuchtelte damit vor meiner Nase. »Ruh dich ein bisschen aus, aber dann krieg deinen Hintern hoch, hörst du? Ich will meinen Mann zurück« – und ganz leise – »den Kerl von Mann, in den ich mich verliebt habe.«
Ihre Haare waren pechschwarz, ihre Augen dunkel, sie hatte in kürzester Zeit Deutsch gelernt, während ich bis heute nur ein paar Brocken Spanisch beherrschte.
Als wir hörten, dass jemand mit klappernden Stöckelschuhen die Holztreppe hochkam, hielten wir beide inne. »Wir machen einfach nicht auf«, flüsterte sie und legte ihren Zeigefinger auf meine Lippen. Aber schon klopfte jemand an die Außentür, zaghaft nur, kaum hörbar.
»Könnt aber wichtig sein«, sagte ich. »Vielleicht der Hausmeister. Mit den Münzen für die Waschmaschine im Keller.«
»Wenn der Hausmeister Stöckelschuhe trägt, ist er eine interessantere Person, als ich gedacht habe.« Delma verschwand in unserem künftigen Mehrzweck-Wohn-Arbeits-und-Schlaf-Zimmer. »Vielleicht ist es auch deine Verlegerin, die nachschaut, ob du endlich ein neues Skript fertig hast.«
Ich öffnete erst die wurmstichige Holztür, dann die solide, graue Metalltür, die aussah, als würde sie einen Schließfachraum einer großen Bank verbergen. Das Licht im Gang war düster, eine Frau, etwa sechzig Jahre alt, stand vor mir, schlank, mit den Stöckelschuhen etwas größer als ich, grau-schwarze, lange Haare und tiefe Schatten unter den Augen. »Hallo, Jan«, sagte sie. »Ich bin Angelikas Mama.« Sie streckte mir ihre Hand entgegen. »Elisabeth Reitmann.«
Ich schluckte, nahm ihre Hand und quälte mich zu einem Lächeln. »Aaah.«
»Meine Tochter Angelika hat mit dir im Studentenheim Rathenau gewohnt.«
»Jaja, natürlich.« Ich nickte wie blöd, und mein Herz schlug sofort ganz wild, ganz bös. »Na klar. Die Geli.«
Angelika Reitmann
Zimmer 101
Mit einer Geste ließ ich sie wissen, dass sie hereinkommen solle. Und bevor ich ihr sagen konnte, dass sie nicht ihre Schuhe ausziehen müsse, schlüpfte sie auch schon aus ihren Highheels. Sie stand vor mir und musterte mich eindringlich. Ich versuchte, meine Gedanken zu ordnen, ich versuchte, mich wieder einzukriegen, aber in mir tobte das Chaos und meine Stimme klang fremd. Ich bat sie, Platz zu nehmen, dabei war doch kein einziger freier Stuhl in dem Zimmer.
Angelika Reitmann
* 10. Mai 1979 † 26. Juni 2000
Die Inschrift auf dem Grabstein ihrer Tochter, kaum vierzig Kilometer von meinem Elternhaus entfernt, was auch der Grund war, dass wir miteinander fast ausschließlich in unserem für fast alle anderen im Heim unverständlichen Dialekt gesprochen hatten.
Delma nahm eine Schachtel von meinem Schreibtischsessel, die Frau setzte sich, nachdem sie auch Delma mit Handschlag höflich begrüßt hatte, und sah mich an. »Bist du das?« Sie hielt eine Bastelei aus Papier in die Höhe. »Ich glaube, das bist du.«
Was mir Elisabeth präsentierte, war ein Himmel-und-Hölle-Spiel, das, wenn geschlossen, eine Bleistiftzeichnung einer Person zeigte, die ohne Zweifel große Ähnlichkeit mit Angelika hatte. Ich setzte die Papierbastelei auf meine Finger, wie wir es als Kinder oft getan hatten. Ich öffnete sie waagrecht. Im aufwendig ausgeschmückten Himmel befand sich das cartoonhafte Porträt eines Kerls mit wilder Frisur, in dessen Mundwinkeln eine Zigarette hing und neben dem eine Flasche mit der knallig-roten Aufschrift WODKA schwebte. Auf der anderen Seite des Paradieses ein lächelnder, unspektakulärer Typ mit Seitenscheitel und Heiligenschein. Ich öffnete senkrecht, spürte, wie ihr Blick auf mir ruhte. Im Höllenfeuer schmorte ein Typ mit Bomberjacke und einer Mütze mit Adleremblem sowie ein Lockenkopf mit Brille und Bartstoppeln.
Himmel und Hölle
Ich schluckte, während ich mich zu einem Lächeln quälte. Der Wodka-Trinker war ohne Zweifel Florian aus Zimmer 214, BWL-Student und Partybiest aus Fürth, zwei Semester so offensichtlich scharf auf Geli, dass jeder im Heim schon darüber Witze machte, vor allem weil er nicht den geringsten Erfolg bei seinen Flirtversuchen zu haben schien. Der Mann mit Heiligenschein war Angelikas Freund, Manuel, der zu jener Zeit in Zürich studierte. Den Lockenkopf in der Hölle konnte ich nicht identifizieren, dafür war mir der Bomberjackentyp mit der Fußballmütze bestens bekannt.
»Warum bist du auf Gelis Himmel-und-Hölle-Spiel?«
»Ich weiß nicht«, sagte ich kleinlaut und mühte mich zu einem Lächeln. »Ich habe wirklich keine Ahnung. Bin das denn wirklich ich?«
»Na, aber hallo! Sieht mir schon sehr danach aus.« Sie seufzte. »Du hast vor der Polizei immer behauptet, dass zwischen dir und meiner Tochter nichts gewesen sei.« Sie sah mich an, nickte. »Das ist doch so, oder?«
Ich spürte, wie falsch mein Lächeln war. »Ja, das habe ich gesagt.«
»Warum bist du dann für meine Tochter jemand gewesen, der in ihren Augen in die Hölle gehört?«
Delma und ich wechselten Blicke, sie spürte wohl, dass mir das Gespräch in ihrer Anwesenheit unangenehm war, also stand sie auf und ging ins Badezimmer, schloss die Tür hinter sich.
»Weißt du vielleicht doch mehr?«, fragte die Reitmann leise, um sich gestikulierend zu entschuldigen. »Ich will dich nicht beschuldigen, um Gottes willen. Nein. Vielleicht war sie ja in dich verliebt, ohne dass du es gewusst hast.« Sie stockte kurz, als wartete sie auf einen Einwand meinerseits. »Ich versuche nur zu verstehen. Ich versuche nur, mir e…«
»Woher haben Sie das?«, unterbrach ich sie und hielt das Papierkonstrukt in die Höhe.
»Spielt das eine Rolle?«
»Es ist also echt?«
Sie zuckte mit der Schulter. »Was denkst du? Natürlich ist das echt. Ich werde ja wohl die Schrift meiner Tochter kennen. Und glaubst du, ich klopfe hier an deine Tür, we…«
»Aber wo ist das jetzt plötzlich aufge…«
Sie unterbrach mich mit lauter Stimme: »Ich habe ihr altes Zimmer endlich ausgeräumt und das Ding eingeklemmt zwischen Schreibtisch und Wand gefunden. Ich habe sofort Eduard Veith angerufen. Du erinnerst dich doch an den Veith? Den Chefermittler in den ersten Wochen?«
»M-hm.« Ich nickte mit einem spöttischen Lächeln, wieder ein Lächeln aus purer Verlegenheit, dazu hob ich etwas zu theatralisch die Hände. »Sorry! Ich weiß nicht, warum ich auf dem Papier bin. Ich schwör. Ich habe keine Ahnung.«
»Es geht nicht nur um das Himmel-und-Hölle-Spiel. Weißt du, wie oft ich mir in den letzten Jahren gedacht habe: Alles, was in der Nacht Fragen aufwirft, führt über Umwege irgendwie zu dir. Immer zu dir.« Sie leckte sich die Lippen, fuhr sich durchs Haar. »Du hast den Ermittlern nicht alles erzählt, Jan. Nein, das hast du nicht.«
Ich lächelte blöd. »Doch, doch. Ich habe denen alles erz…«
»Komm, Jan.« Ihr Ton war harsch, fast schon aggressiv jetzt, sie erschrak wohl selbst, denn sie sprach dann leiser, sanfter: »Hör auf. Ich bitte dich.«
Ich wiederholte nur: »Ich habe denen alles erzählt, was ich weiß.«
Dann starrte sie gebannt auf etwas an der Wand, und ich wusste, um was es sich handelte, ohne ihrem Blick zu folgen. Da hing ein Eintracht-Frankfurt-Schal, auf dem derselbe Adler war wie auf der Mütze, die das kahlköpfige Männchen in dem Himmel-und-Hölle-Spiel trug.
Ich räusperte mich. »Wer ist der Vierte? Wer ist der Mann mit den Bartstoppeln und der Brille mit viereckigen Gläsern? Der ist ja mit mir in der Hölle. Vielleicht sollte man rausfinden, wer er ist.«
Sie starrte mich an, ich erwiderte ihren Blick nicht, sie misstraute mir, sie hielt mich für einen Lügner. Das letzte Mal, dass eine Boulevardzeitung über sie geschrieben hatte, war vom Tod ihres Mannes, Gelis Vater, die Rede gewesen. Sie wurde zitiert, dass sie Angelikas Mörder, wenn der Staat es nicht schaffe, eben selber finden würde. Koste es, was es wolle. Sie hatte auch ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie den Mörder im Studentenheim vermutete.
»Du lügst«, sagte sie und stand auf. »Das weiß ich jetzt. Um das zu wissen, habe ich dir in die Augen sehen müssen. Du lügst. Und ich verspreche dir, ich werde dich nicht in Ruhe lassen, bis du mir die Wahrheit erzählt hast.«
»Und was sollte mein Motiv sein? Warum zum Teufel sollte ich etwas verheimlichen? Glauben Sie im Ernst, ich wollte nicht, dass man das Schwein endlich erwischt?«
Sie zögerte kurz, sah sich mit skeptischem Blick in dem Zimmer um, ehe sie mich wieder fixierte. »Du lügst. Ich weiß nicht warum. Aber du lügst.« Sie klapperte mit ihrem Autoschlüssel in der Hand. »Wir sehen uns sehr bald wieder, Jan-Peter Halder. Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt.«
Sie ging zur Tür, schlüpfte in ihre Schuhe und verabschiedete sich von Delma, die gerade in dem Moment aus dem Bad trat.
Niemand auf der Welt hatte ein größeres Recht zu fragen, wer Angelika getötet hatte, als ihre Mutter. Immer und immer wieder. Denn es gab ja eine Antwort. Es konnte keinen Graubereich geben, kein Dazwischen. Es gab ein Ja, ein Nein. Kein Vielleicht. Ein Vielleicht war unmöglich. Der, der Angelikas Tod zu verantworten hatte, war kein Dämon, kein Geist, kein Alien, kein Schatten, keine Naturgewalt.
Nein. Der, der Angelika aus dem Leben gerissen hatte, war ein Mann. Und er hatte einen Namen. Ein Gesicht. Eine Geschichte. Wenn er nicht in der Zwischenzeit gestorben war, führte er irgendwo auf der Welt ein Leben. Trotzdem empfand ich ihren Besuch als Affront. Sie hätte vorher mit mir Kontakt aufnehmen können, anstatt einfach so in unserer Wohnung aufzukreuzen.
Delma und ich spazierten auf der frisch gemähten Wiese etwas flussabwärts, suchten nach einem versteckten Uferplätzchen, und solche gab es hier zuhauf. Überhaupt schien hier weit und breit keine Menschenseele unterwegs zu sein.
Wir legten eine Decke auf den Sand, ich trank Dosenbier, sie aß zwei vegetarische Sandwiches mit viel zu viel Mayonnaise. Sie kaute laut und schlang die beiden Dinger so hastig runter, dass ich lachen musste. Sie fragte, was los sei, ich schüttelte nur den Kopf. Ich liebte diese Frau mehr als mein Leben. Und warum erzählst du ihr dann nicht alles?, fragte ich mich. Jetzt und hier. Bei Bier und Sandwich und dem Geräusch des fließenden Gewässers, dem Duft des frisch geschnittenen Grases. Der Frau, ohne die du dir das Leben nicht mehr vorstellen könntest. Der Frau, der du als einzigem Menschen bedingungslos vertraust.
Vielleicht hätte ich es getan. Vielleicht hätte ich es ein paar Minuten später wirklich getan. Aber sie stand auf und zog sich aus, splitternackt, lediglich ihre Badeschuhe ließ sie an, und ging so zum Wasser, machte einen Handstand dort, und ich öffnete die nächste Dose, sah ihr zu und dachte mir: Nicht heute und nicht hier. Die alte Welt würde noch früh genug zusammenbrechen, nach Elisabeth Reitmanns Auftritt war es nicht länger die Frage ob, sondern nur noch die Frage wann.
Ich konnte seither keine Ruhe mehr finden. Immer wieder überkam mich ein Anflug von Panik, der mein Herz schneller schlagen ließ, mir in den Magen fuhr, mich nervös nach Delma blicken ließ, ob sie irgendwas bemerkte, ob sie mir ansah, dass mich alte Gespenster heimsuchten und eines dieser Gespenster ich selber war.
Sie stand nun auf einem mächtigen Steinbrocken, der in der Mitte des Flusslaufes lag, und posierte als Ballerina.
Sie spielte mit mir.
Geli und Delma hatten eines gemeinsam: Sie waren smart as fuck. Genau diese Worte gebrauchte Delmas beste Freundin in einer kalten Winternacht am Bahnhof, wohin ich sie nach einem mehrtägigen Besuch begleitet hatte. Sie sei in guten Händen, davon hätte sie sich überzeugen können, und das mache sie glücklich. Und bevor sie in den Zug stieg, der sie nach München bringen sollte, meinte sie eben: »Delma’s got a big heart. But she’s smart as fuck.« Was sie mir damit sagen wollte, habe ich nie so recht verstanden. Vielleicht weil ich nicht smart as fuck war. War’s eine Warnung?
Delma kam zurück ans Ufer, zog sich laut singend Shorts und Top an. Auch Geli hatte lange, pechschwarze Haare gehabt und dunkle Augen, aber sonst hatten sie äußerlich keinerlei Ähnlichkeit. Ich habe Geli auch kein einziges Mal singen hören, Delma hingegen sang den ganzen Tag. Geli sprach Bregenzerwälder-Dialekt, Delma Schriftdeutsch. Gelis Zimmer war picobello aufgeräumt und sauber, und als ich einmal mit Doc Martens auf ihren Teppich stieg, flippte sie aus. Delma hingegen räumte ungern auf und fühlte sich im Saustall und im Chaos wohl.
Geli hat sich nie von jemandem etwas sagen lassen. Und sicher nicht von einem Mann. Es war eine verdammt toxische Machowelt damals, und Männern lautstark zu widersprechen im Studentenheim oder auf der Uni, war damals nicht die Selbstverständlichkeit, die es hätte sein sollen. Und so mauserte sich Geli in kürzester Zeit zu einer kleinen Berühmtheit am Institut, angry young bitch, schimpfte sie ein Professor aus England, als sie in einem Hörsaal lautstark mit anderen Studentinnen gegen seine Vorlesung protestierte, sie führte Hörsaaldiskussionen und Sitzungen der Studierendenvertretung der Fakultät an, ja, sie war die erste Studentin in der Geschichte der Universität, die ein Stipendium für ein renommiertes Seminar in den USA erhielt, das sie aber nie besuchen konnte, weil es erst drei Monate nach ihrem Tod stattgefunden hätte.
Man rief Geli Emanze, Feministin, als wären’s Beleidigungen. Als wären’s keine Komplimente, den herrschenden Herrenmännlein an der Universität in die Eier zu treten. Hinter ihrem Rücken tobte auch vulgärer Hass, wie oft hörte ich in biertrinkender, rauchender Männerrunde, die Reitmann sei ja bloß eine ungefickte Grantscherben, eine frigide Möse, eine freche, besserwisserische, linke Göre.
Und so lag Delma neben mir auf der Decke, spielte auf ihrem Handy, fluchte lautstark und ordinär auf Spanisch, wenn sie einen Fehler machte. Wie nebenbei und ohne aufzublicken fragte sie: »Wie ist sie gestorben?«
»Wie ist wer gestorben?«
»Warum hast du mir nie erzählt, dass ihr euch nahegestanden seid? Es hat immer so geklungen, als wäre das eine Fremde gewesen, die man ermordet hätte, mit der du zufällig im selben Haus gewohnt hast.«
Ich seufzte. »Ich hab mit ihr die Gemeinschaftsküche geteilt, natürlich ist man sich da öfters übern Weg gelaufen.«
»Wie ist sie gestorben?«
»Stich ins Herz. Wahrscheinlich mit einem Messer.«
Leise sagte sie: »Ich spüre, dass da mehr war. Es tut mir weh, dass du mir nicht hundertprozentig vertraust, aber ich kann dich nicht zwingen, mir alles zu erzählen.« Sie sah mich an. »Hast du was mit ihr gehabt? Nein, oder? Das kann nicht sein.«
»Da war nichts.« Ich erwiderte ihren Blick fest. »Da ist nichts gelaufen.«
»One-Night-Stand?«
»Nein. Ich schwör.« Ich schluckte. »Wir haben ein bisschen geflirtet vielleicht.«
»Vielleicht?«
»Wir haben geflirtet.«
Ich nahm ein paar Schlucke Bier und sah dann auf das Display meines Handys und öffnete eine Mail von Elisabeth Reitmann: Ich wollte nicht aufdringlich sein. Es tut mir leid, ich hätte mein Kommen ankündigen sollen und gewiss nicht vor Deiner Frau so reden dürfen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich hätte trotzdem immer noch gerne, dass Du Dich mit Eduard Veith triffst, ihm noch einmal Punkt für Punkt erzählst, was Du weißt. Ich übernehme sämtliche Reisekosten inklusive 4 Übernachtungen im neuen Luxushotel neben dem Museum. 12. Stock mit Aussicht über die ganze Stadt. Für Deine Frau und Dich.
Delma schnippte mit den Fingern, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen. »Du hast nichts mit der Frau gehabt, o.k., ich glaube dir. Aber hat ihre Mutter recht? Hast du der Polizei nicht alles erzählt?«
»Warum sollte ich? Alles, an was ich mich erinnert habe, habe ich denen erzählt. Aber ich war dermaßen betrunken in der Nacht, dass es natürlich ein paar Lücken gibt.«
Delma nahm meine Hand, küsste sie und drehte sich auf den Rücken. »Du warst Hölle für ein Mädchen, das ermordet worden ist. Das muss ich erst mal verarbeiten.«
»Hölle auf einem blöden Papierspiel«, protestierte ich. »Das kann doch keiner ernst nehmen.«
Wieder tippte sie mit beiden Daumen auf dem Display ihres Handys. Ich drehte mich nun auch auf den Rücken, mehrere Rotmilane kreisten am dunkelblauen Himmel, schlugen nicht mit den Flügeln, bewegten nur ruckartig ihre Köpfe, hielten Ausschau nach Beute.
»Der Mord ist draußen passiert. Am Flussufer hinter dem Heim. Zu der Zeit war ich längst auf meinem Zimmer. Ich habe ein wasserdichtes Alibi. Ich kann es gar nicht gewesen sein.«
Sie legte ihr linkes Bein auf mein rechtes. »Ich würde nicht hier mit dir liegen, wenn ich glauben würde, du wärst zu einem Mord fähig. Aber egal, was du mir erzählst, ich werde das Gefühl nicht los, dass du mir irgendwas verheimlichst.«
Ich zögerte lange, ehe ich sagte, was ich sagte. »Vielleicht war’s ja der Flo von 214.« Ich richtete meinen Oberkörper auf, um mein Bier trinken zu können. »Der ist an dem Abend mal mit der Geli auf ihrem Zimmer verschwunden.«
»Und das heißt?«
»Es kann alles Mögliche heißen.«
»Sie haben Sex gehabt?«, fragte sie.
»Ich sag doch, es kann alles Mögliche heißen.«
»Sie hat doch einen Freund gehabt?«
»Yep. Aber der war ja so gut wie nie da.«
»Aha.« Sie zuckte mit der Schulter. »Und selbst wenn sie mit Flo gefickt hat? Hat er keinen hochbekommen, und sie hat ihn ausgelacht? Hat sie ihn abgewiesen, und sein armes Machoherzchen war gekränkt?« Sie sah mich zweifelnd an. »Irgendein Indiz dafür, dass da was aus dem Ruder gelaufen sein könnte?«
»Er ist mit ihr auf dem Zimmer verschwunden, mehr weiß keiner, selbst er behauptet bis heute, sich nicht mehr daran zu erinnern.«
»Bei der Obduktion wird man wohl festgestellt haben, ob das Opfer Sex gehabt hat in den Stunden davor.«
»Ist nie was an die Öffentlichkeit gedrungen.«
»Gut. Geht auch niemanden was an.«
Die Kreise der Greifvögel wurden enger, sie flogen tiefer jetzt, sie flogen direkt über uns, als wären wir die Beute.
»Es hat keine Zeugen gegeben. Keine Tatwaffe und kein Motiv.« Ich trank das Bier ex und legte mich wieder hin. »Neben dem Studentenheim steht so eine kleine, abgefuckte Tankstelle, die vierundzwanzig Stunden lang geöffnet hat. Wir sind oft in den Shop, Bier oder Wodka kaufen, wenn die Supermärkte alle schon zu waren. Die Geli hat dort eine Flasche Tequila geholt, das ist minutengenau dokumentiert. Um 01.56 Uhr ist Try Again von Aaliyah im Radio gelaufen, und Geli hat im Shop den Refrain leise mitgesungen. Als die Nachrichten um zwei Uhr angefangen haben, war sie schon wieder weg, behauptet der Angestellte dort. Die Becky und der Ole haben sie noch gesehen. Die haben im Gebüsch geknutscht, sie sei vorbei, einfach an ihnen vorbei, hätte nicht auf Oles Zuruf reagiert.« Meine Stimme zitterte nun leicht. »Auch ich habe sie gesehen. Vom Fenster im zweiten Stock aus. Mit der blöden Flasche Tequila in der Hand. Der letzten Flasche Tequila aus der Tankstelle. Hinter dem hohen Maschendrahtzaun. Nur für ein paar Sekunden. Nur für den Moment, als sie im Licht der Laterne zu sehen war.«
»Das ist gruselig.«
»Niemand hat einen Unbekannten gesehen. Niemand hat irgendwas Verdächtiges beobachtet.«
»Und es hat keinerlei DNA-Spuren gegeben?«
»Man hat DNA-Spuren an Gelis Kleidung gefunden, aber keine brauchbaren. Nichts in der Datenbank.«
Sie sah mich überrascht an. »Die Kriminalpolizei hat nie einen Massentest gemacht?«
Ich schüttelte den Kopf. »Geli war mit den Klamotten auf der Uni in mehreren Hörsälen, auf der Mensa, im Unicafé und in der Gemeinschaftsküche im Heim, auf dem Klo in ihrem Zimmer, auf das im Laufe des Abends noch andere Partygäste gegangen sind. Was hätte das schon ausgesagt?«
»Sie ist doch an einem Zaun ermordet worden. Hat man da gar nichts gefunden?«
»Der Arbeiter, der die Tote gefunden hat, hat kurz vorher mit einem Hochdruckreiniger jeden Quadratmeter um den Tatort abgesprüht, weil da so viele Blätter vom Gewittersturm rumgelegen sind. Kannst dir ja vorstellen, was da übrig geblieben ist.«
»Sie ist auf der Baustelle gefunden worden?«
»Nein. Aber direkt hinter dem Zaun.«
Sie richtete sich auf und sah auf einmal so müde aus, meine Kleine. Und sie hätte noch viel müder ausgesehen, hätte sie alles gewusst. All meine Lügen in meinem Gesicht lesen können. Also drehte ich mich zu ihr und sagte: »In meinem Dialekt gibt es kein Ich liebe dich. Aber nur wenn ich Dialekt rede, kommt es von ganz tief drinnen, verstehst du? Jetzt weiß ich nicht, was ich dir sagen soll, um zu beschreiben, was ich für dich fühle.«
»Dann solltest du deine Bücher künftig vielleicht im Dialekt schreiben.« Schon den ganzen Tag war da eine Gereiztheit in ihrem Ton.
»Alles o.k., Delma?«
»Warum fragst du?«
»Du bist sonst nicht so.«
»Jetzt bin ich so.«
»…«
»Ich stelle bloß Fragen. Das darf ich doch, oder?«
Als ich elf war, meinte der Pfarrer in einer Religionsstunde, dass dem ganzen Universum zeitlich ein Ende gesetzt sei. Nichts würde, nichts könnte übrig bleiben. Egal, wie sehr wir uns auch bemühen würden, einen atomaren Weltkrieg oder eine Zerstörung der Erde zu verhindern, egal, ob Menschen es je schaffen würden, auf andere Planeten auszuwandern, vielleicht sogar die ganze Milchstraße zu bevölkern, am Ende würde alles ausgelöscht, das wären die unumstößlichen Erkenntnisse der Kosmologie. Natürlich würde das seine Milliarden von Jahren dauern, aber es würde geschehen. Das Universum, so meinte unser Pfarrer, würde kollabieren, zerrissen werden oder so abkühlen, dass absolut kein Leben mehr möglich wäre.
Keine Erzählung von einem Gott oder einem Teufel hat mir je mehr Furcht eingeflößt. Und keine Erzählung hat mich mein Leben lang so verfolgt und beschäftigt.
Nichts von uns würde übrig bleiben. Alles war egal. Manchmal deprimierte mich der Gedanke, manchmal berauschte er mich. Er hatte etwas unendlich Befreiendes. Etwas Wildes. Nichts und niemand würde übrig bleiben.
Gelis Tod traf mich jedoch mit solcher Wucht, dass ich nicht länger glauben konnte, dass alles vergehen würde. Ein junger Mensch war gewaltsam aus dem Leben gerissen worden, und das würde niemals ausgelöscht werden, es schien unvergänglich, jenseits von Vergeben und Vergessen und Endlichkeit.
Am frühen Morgen des 26. Juni 2000 sah der zweiundvierzigjährige Bauarbeiter Mehmed H. Angelikas leblosen Körper hinter dem Zaun der Baustelle, nur wenige Meter vom Gehweg am Ufer entfernt. Die umzäunte Baustelle war über Nacht nicht zugänglich, das Zufahrtstor versperrt und gut gesichert. Trotzdem durchsuchte die Polizei das Areal mit einem Großaufgebot nach Spuren und der Tatwaffe. Aber weder dort noch am Ufer fand man irgendetwas Brauchbares.
Fast sämtliche Zeitungen und TV-Sender legten in ihren Berichten den Fokus auf die Drogendealer bei der Tankstelle, obwohl wir fast alle aus dem Heim der Meinung waren, dass die fast nie so spät nach Mitternacht dort draußen zu finden waren. Wenn schon, dann trauten wir die Tat eher rechten Hooligans zu, die sich immer mal wieder an der Tankstelle mit Bier eindeckten und am Wochenende illegale Autorennen veranstalteten, aber von denen war in der Nacht keine Spur gewesen. Ja, fast alle Heimbewohner waren von Anfang an überzeugt, dass der Mörder weder aus dem Heim kam noch der böse Drogendealer aus Nordafrika war, der weit nach Mitternacht mit einem großen Messer durch die Gegend schlich; dieses Bild, das die Boulevardmedien in den ersten Wochen landesweit verbreiteten, hatte viel mehr mit plumpem Rassismus als mit ernsthaftem Journalismus zu tun. Die meisten glaubten, die Geli wäre zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen und der Mörder war irgendwo in den angrenzenden Hochhäusern zu finden.
Aber auch hierfür gab es keinerlei Anhaltspunkte. Alles blieb mysteriös und die wildesten Gerüchte und Verschwörungstheorien fluteten in den kommenden Jahren die Online-Foren.
Es war, als hätte Gelis Mutter einen Schalter in meinem Kopf umgelegt, der sich nicht mehr zurückbewegen ließ. Wie der Refrain eines verhassten Ohrwurms, der im Kopf spielt, immer und immer wieder, war ich in einer Endlosschleife von Gedanken gefangen.
Ich konnte in den folgenden Nächten kaum mehr schlafen, lag lange wach, wälzte mich im Bett. Ich musste ständig an den Streit mit Geli denken, noch bevor die Party überhaupt richtig angefangen hatte, in der Gemeinschaftsküche des ersten Stocks vor allen Leuten. Ein Streit, der so heftig wie vermeintlich nichtig war, dass alle nach und nach verstummten und uns schließlich mit offenen Mündern anblickten. Sogar Felix, der Kater, den Maria aus 118 verbotenerweise im Heim hielt, sprang aus Angelikas Armen und nahm verängstigt Reißaus. Manchmal versuchte ich mich exakt daran zu erinnern, was wir sagten. Jeden verdammten Satz unseres Zankes wiederholte ich.
Dann wieder sah ich Geli vor mir gegenüber am Lagerfeuer, Stunden später, rücklings auf dem Baumstamm liegend. Die Blicke, die sie mir hie und da zuwarf, hatten sich tief in mich eingebrannt. In einer Nacht, die mehr Schwarze Löcher hatte als jede andere Nacht in meinem Leben, überstrahlte dieser Blick alles. Ich ahnte, wie tief verletzt sie war. Ich ahnte, dass sie mir in tausend Jahren nicht verzeihen würde. Und ich trank und trank, bis die Welt anfing, sich zu drehen.
An einem schwülen, gewittrigen Freitagnachmittag beschloss ich, zum Doktor zu gehen, weil mein Hals seit Tagen heftig und auf eine Art schmerzte, die sich nicht mehr nach einer normalen Erkältung anfühlte. In einem der Behandlungszimmer der Arztpraxis saß ich auf dem Stuhl vor einem Tisch und starrte hinaus auf einen prächtigen Lindenbaum vor der Fensterfrontseite, überlegte mir, ob ich meine alten Kumpels aus dem Heim kontaktieren sollte, um herauszufinden, ob die Reitmann auch schon bei ihnen vorstellig geworden war, und wenn ja, was sie so über den Mord und vor allem mich gemutmaßt hatte.
Hinter meinem Rücken ging die Tür auf, ich drehte mich zur Seite, erwartete eine Frau Doktor Braun, aber es war Elisabeth Reitmann, die sich wie selbstverständlich einen Stuhl aus der Ecke holte und neben meinen stellte.
»Hallo, Jan.« Sie trug dezentes Make-up, eine kleine Handtasche und feine Kleider. »Entschuldige. Kann ich nochmals mit dir reden? Nur ganz kurz.« Ich blieb reglos sitzen, ich musste nicht fragen, woher sie gewusst hatte, wo ich war, mir war sofort klar, dass sie mir gefolgt war. »Ich weiß, du hast nichts mit dem Mord an meiner Tochter zu tun. Aber du könntest vielleicht helfen, die Sache aufzuklären, wenn du mit Eduard Veith sprichst.« Ich bewegte meinen Kopf etwas zur Seite, schwieg aber weiter, sie setzte sich, sprach zu mir wie zu einem Kind. »Vielleicht könntest du ihm ja helfen, herauszufinden, wer der vierte Mann auf dem Himmel-und-Hölle-Spiel ist, hm?«
Ich schüttelte langsam den Kopf. »Ich bin in Gedanken mehrmals alle Leute durchgegangen, die in der Rathenau gewohnt haben oder öfters dort zu Besuch waren.« Ich zog die Mundwinkel nach unten. »Kein Treffer. Keiner hat solche Locken gehabt. Keiner eine solche Brille.«
»Ich bitte dich, Jan.« Sie beugte sich weit vor, ihre Ellbogen auf ihre Schenkel gestützt, ich wich etwas zur Seite, zu nahe war sie mir. »Ich spüre, dass dieses Himmel-und-Hölle-Spiel eine Bedeutung hat. Es spricht zu mir. Ich verstehe nicht, was es mir sagen will, aber es will mir etwas sagen.«
»Es tut mir leid.« Jetzt sah ich sie an, ich erwartete, dass sie weinte, aber sie weinte nicht, im Gegenteil, da war eine Stärke in ihrem Blick, eine Entschlossenheit, die ebenso beeindruckend wie furchteinflößend war. »Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich habe mich damit abgefunden, dass …« Ich stockte, presste meine Lippen aufeinander. »Ich weiß, dass ich nichts weiß und nichts verstehe und Gelis Tod schon tausendmal nicht.«
»Nein, Jan, nein, so kommst du mir nicht davon.« Sie stand wieder auf, schnäuzte sich leise die Nase. »Ich habe dir geglaubt, Jan. Sechzehn Jahre lang. Aber jetzt. Jetzt glaube ich dir nicht mehr. Du verheimlichst Dinge. Du kannst mir helfen. Und du wirst mir helfen, Jan.«
Ich schüttelte den Kopf, aber zaghaft, nicht überzeugend genug. »Ich …«
»Jan.« Sie kämpfte um jedes Wort, trotzdem spürte ich ihre Kraft, ihren Willen. »Ich kann nicht leben, ich kann nicht sterben. Ich muss wissen, wer es war. Wer meiner Tochter das angetan hat. Und warum. Ich muss. Ich muss, Jan, ich muss.« Ich sah wieder hinaus aus dem Fenster. »Du warst also nicht verliebt in sie?«
»Nein.«
»Da ist nichts gelaufen zwischen euch?«
»Nein.«
»Jan?«
»Nein!« Ich schnaufte wie ein altes Schlachtross nach einem Aufstieg, es war auf einmal so heiß und stickig hier drinnen, meine Kehle ausgetrocknet. »Ich hab die Geli gemocht. Wirklich. Aber ich war vergeben. Und die Geli hat ja auch einen Freund gehabt, den Manuel. Den hat sie doch geliebt, oder? Mit dem war sie doch glücklich.«
»Nein«, sagte sie. »War sie nicht. Nicht mehr. Aber das ist eine andere Geschichte. Und der Manuel war’s ganz sicher nicht, bevor du irgendwas reininterpretierst. Der ist in Salzburg auf einem Konzert gewesen in der Nacht.«
Danach Stille. Sekunden für Sekunden vergingen, aber keiner sagte etwas. Nach einiger Zeit legte sie etwas auf den Tisch vor mir. Es waren großformatige Fotos, ich musste nicht hinschauen, um zu wissen, was darauf abgebildet war. »Warum bist du auf dem Himmel-und-Hölle-Spiel, Jan?«
»Das weiß ich nicht.«
»Warum hast du uns all die Jahre angelogen?«
»Aber das habe ich doch nicht.«
»War meine Tochter in dich verliebt? Hat sie dir das jemals zu verstehen gegeben?«
Ich schüttelte den Kopf. Müde. Erschöpft. Mit den blöden Schmerzen im Hals. Wo blieb Frau Doktor Braun?
»Angelika hat ein Tagebuch geführt. In kleine Hefte geschrieben. Den letzten Eintrag hat sie am 10. März 2000 verfasst.« Sie liest vom Handydisplay: »Bin IHM in der Küche begegnet. Und ER hat mich die ganze Zeit angeschaut. Ich habe keine Reaktion gezeigt, einen auf cool gemacht, aber ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, es hätte mir nicht gefallen.« Sie sah mich herausfordernd an. »IHM und ER in dicken Großbuchstaben.«
»Aha.«
»Du bist ER«, sagte sie leise. »Du. Jan. Niemand sonst.«
»…«
»Mensch, was soll das Theater. Was hast du zu verlieren? Du warst es nicht, das glaube ich dir, aber du musst reden. Du musst endlich reden. Nach all den Jahren dein Maul aufmachen. Irgendjemand von euch muss das jetzt tun. Oder ich zwinge euch.«
»Fuck!« Ich fegte die Fotos vom Tisch. »Ich will den Scheiß nicht sehen.« Meine Lippen zitterten. »Ich kann die Scheißwelt doch auch nicht retten. Ich kann nicht helfen, den Fall zu lösen. Ich kann’s doch nicht! Ich würd’s so verdammt gerne, aber es ist unmöglich!«
Sie hob die Fotos hastig wieder auf, und ich konnte erkennen, dass es entgegen meiner Vermutung nicht die Tatortfotos des unverpixelten Leichnams waren, die ein Boulevardblatt veröffentlicht hatte und die bis heute im Netz umherschwirrten, sondern alte Aufnahmen, Fotos einer fröhlichen Angelika. Ich entschuldigte mich mehrmals, stand auf und wollte hinausmarschieren. Da hielt sie mich am Arm fest: »Ich erwarte mir nicht von dir, dass du verstehst oder auch nur ahnst, was ich in den letzten sechzehn Jahren durchgemacht habe. Niemand kann das. Ich möchte aber, dass dir klar ist, dass ich es ernst meine. Dass du mir nicht entkommen kannst. Es gibt Fragen, die du mir beantworten musst und mir beantworten wirst.«
»Ich verstehe nicht«, sagte ich heiser. »Ich verstehe gar nichts mehr. Ich bin krank. Ich will nur noch heim ins Bett.«
»Der Fall wird gelöst werden. Es wird passieren. Und du kannst nicht länger schweigen, es spielt keine Rolle, wie sehr du dich dagegen sträubst. Ich war sechzehn Jahre nur eine lästige Frau für die Kripo, für die Politiker und Journalisten, eine verzweifelte Mutter, die um ihre tote Tochter trauert, mit der man Mitleid hat, aber der keiner wirklich helfen will. Niemand hat mir zugehört, aber jetzt sind die Karten neu verteilt. Ich bin kein Bajazzo mehr, Jan. Ich habe Trümpfe in der Hand.«
»Ich verstehe wirklich nicht, Frau Reitmann«, sagte ich leise, und sie ließ mich los.
»Ich war auch dieses Mal wieder bei der Polizei. Mit dem Tagebuch. Mit dem Himmel-und-Hölle-Spiel. Ich habe die angefleht, ein Cold-Case-Team aus der Hauptstadt zu schicken.« Sie lachte böse. »Aber nein. Nein, die unternehmen nichts. Das wären keine grundlegend neuen Erkenntnisse, sagen sie.«
Ich verspürte eine große Erleichterung, als ich hörte, dass es wohl kein Cold-Case-Team geben würde. Scham erfasste mich bei dem Gedanken, dass mir es lieber war, dass niemand den Fall noch einmal aufarbeitete, als dass mein Lügengebäude zertrümmert wurde. Aber dann sagte sie: »Mein Onkel ist vor einem Monat gestorben. Sein Leben lang hat er sich nie um mich gekümmert. Ich habe gar nicht existiert für den. Vielleicht hat er am Ende Mitleid mit mir gehabt. Er hat mir nämlich mehr Geld vererbt, als ich in meinem Leben noch ausgeben kann. Ausgerechnet er, der nicht einmal auf Gelis Beerdigung gekommen ist. Und ich werde jetzt jeden Cent dafür verwenden, die Wahrheit herauszufinden.« Sie tippte auf ihrem Handy. Dann hielt sie es mir vor die Nase. »Das ist die Summe auf dem Konto. Kannst du lesen?«
Ich konnte nicht. Ihre Hand zitterte. Es interessierte mich nicht, wie viel Nullen da standen. Ich ging zur Tür, öffnete sie und hörte sie noch: »Wenn du nicht mit Eduard redest und ich rausfinde, dass da was gelaufen ist zwischen ihr und dir, dass du irgendwas mit dem Mord zu tun hast, und wenn’s nur indirekt ist und wenn du nur irgendjemanden deckst, dann mache ich dich fertig, Jan.« Sie wurde laut. »Die Todesangst, die meine Tochter in den letzten Sekunden ihres Lebens erlitten hat … Ich werde dafür sorgen, dass du sie tausendfach erlebst, falls du für ihren Tod verantwortlich bist.«
Ich drehte mich nach ihr um. »Ich habe alles gesagt damals, Frau Reitmann. Es gibt nichts mehr zu sagen.«
Sie lächelte. »Du glaubst, du würdest in nächster Zeit einen neuen Verlag finden? Als zwielichtige Gestalt in einem Mordfall? Ich kann das verbreiten, glaube bloß nicht, ich hätte da irgendwelche Skrupel. Und deine Frau, die stammt doch aus Mittelamerika und muss bald ihre Aufenthaltsgenehmigung verlängern lassen. Wenn ich intensiv suchen lasse, werde ich was finden? Ich könnte da mal nachschauen lassen. Ich habe das Geld jetzt. Ich habe die Macht.«
»Schön für Sie«, sagte ich und stürmte aus der Praxis. Lief die Stiege runter, stürzte durch den Hinterausgang hinaus ins Freie, musste auf dem Parkplatz so sehr nach Luft schnappen, dass die Halsschmerzen sich noch verstärkten. Aber ich wollte nicht zurück.
Erst habe ich mich ja selbst belogen, mir eingeredet, es wäre nur eine flüchtige Spinnerei. Etwas, das in ein paar Tagen verflogen sein würde wie so oft. Als das nicht geschah, war ich immer noch überzeugt, es unter Kontrolle zu haben. Dabei saß ich ja schon jeden Tag am Ufer, schwänzte die Vorlesungen und Seminare, verpasste Prüfungen, starrte in den grünen Fluss und las Liebesgedichte und Romane. Ich hörte stundenlang auf Zimmer 204 lautstark Musik und stellte mir immer und immer wieder vor, wie es wäre, sie zu küssen. Ich lief meine Joggingrunde in Rekordzeit, war vollgepumpt mit Energie, ich bekam weniger Dresche im Boxclub, und nicht nur das, ich teilte endlich auch ordentlich im Ring aus, war nicht länger Fallobst. Und wenn ich Stella von hinten nahm, fragte ich mich, wie Gelis Po wohl geformt war, wie viel dunkler ihre Haut war, wie anders ihr Stöhnen klang und ob sie es wie Stella liebte, schmutzige Sachen zu sagen. Und das erregte mich so, dass ich sofort kam und danach mehr als einmal beinahe Gelis Namen in Stellas Ohr hauchte.
Ja, ich wusste, es hatte mich erwischt, ich war verliebt in die Geli. Aber ich hatte Stella, und sie hatte Manuel, ihren Zürcher Freund. Wir waren beide vergeben. Wir waren beide nicht frei.
Unser erstes Treffen war ein furchtbares Desaster für mich gewesen. Ich hatte ihren Namen auf der Telefonliste gesucht, die im Flur jeder Etage neben dem Stocktelefon hing, das zwischen dem ersten Zimmer auf der Nord und der kleinen, fensterlosen Putzkammer an der Wand installiert war. Alles, was ich wusste: Sie wohnte auf Zimmer 101, denn auf der kleinen Pinnwand neben der Tür war ein Foto von ihr und ihrer Zimmerkollegin. Ich brüllte durch den Gang im zweiten Stock, in dem wie üblich viele Zimmertüren offen standen. »Ey, Jungs, wir müssen heuer wieder mal eine Miss-Rathenau-Wahl veranstalten. Ich kaufe Rum für eine feine Tigermilch und verteile ein paar Zettel mit den verschiedenen Kategorien. Oh yeah, heute Nacht küren wir the one and only Miss Rathenau!«
Eine tiefe Stimme aus einem Zimmer der Südseite: »Was für Kategorien?«
»Die üblichen. Wer sieht am besten aus, wen würde man am liebsten bumsen, mit wem könnte man sich eine Beziehung vorstellen, geilste Titten, geilster Ar… Malle? Andi? Hört ihr mich? Also, bei mir spielt die Neue von 101, die Schwarzhaarige, ganz oben mit … hab sie gestern kurz in der Küche gesehen, und ich sag euch, so ein süßes Ärschlein in einer blauen Jogginghose gibt es auf der ganz…«
In dem Moment kam Geli in ihrer blauen Jogginghose mit einer Telefonwertkarte in der Hand aus Zimmer 206, denn Andi war nicht nur Heimsprecher, sondern auch Telefonwertkartenverkäufer, und weil viele noch gar kein Handy hatten, und wenn doch, das Telefonieren damit sehr teuer war, benutzten die meisten die beiden Telefonzellen bei der Bushaltestelle zwanzig Meter vom Heim entfernt.
»Eine Misswahl?« Sie schlenderte lässig auf mich zu, blieb vor mir stehen, musterte mich von oben bis unten, ihr Blick voller Spott. »Ernsthaft jetzt? Wen man gerne bumsen würde? Wer die geilsten Titten