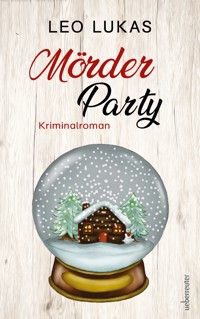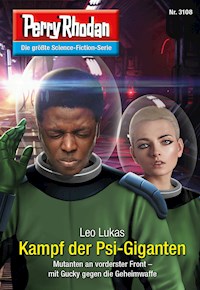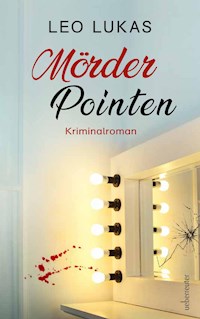
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Ueberreuter Verlag GmbH
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Jemand tötet Kabarettisten. In schöner Regelmäßigkeit. Peter "Pez" Szily, mäßig erfolgreicher Komiker und Teilzeit-Detektiv wider Willen, fühlt sich gleich doppelt bedroht. Er glaubt zu wissen, wer der Serienmörder ist. Aber auch Chefinspektorin Karin Fux hegt einen Verdacht. Ein neuer Fall für Pez und den Bravo führt das ungleiche Ermittler-Duo hinter die Kulissen des Showgeschäfts. Wo viele ums nackte Überleben raufen, manche zu unsauberen Mitteln greifen – und dabei noch ganz andere Kreise stören. Was hat es mit dem Mega-Freizeitzentrum auf sich, in dem alle drei Mordopfer aufgetreten sind? Was will der Ortskaiser vertuschen? Die Spur der Immobilien-Spekulation reicht bis in die Vorzimmer der Macht … Mit feinem Witz und viel schwarzem Humor schildert Leo Lukas das ungewöhnliche Dreiecksverhältnis von Komiker, Killer und Kriminalistin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klappentext
Jemand tötet Kabarettisten. Am Linzer Hafen, beim Wiener Klinik-Clown-Fest, nach dem Auftritt in Kitzbühel.
Stimmakrobat Peter Szily glaubt zu wissen, wer der Serienmörder ist. Auch Chefinspektorin Karin Fux hegt einen Verdacht – und die Falle für den Bravo droht zuzuschnappen.
Hinter den Kulissen des Showgeschäfts verbergen sich dunkle Geheimnisse. Was verbindet die Mordopfer mit Immobiliendeals am Grazer Fliegerhorst? Die Ermittlungen führen sowohl in die Unterwelt als auch in höchste Kreise …
Autor
Leo Lukas, geboren in der Steiermark, arbeitete als Lokalreporter, Kulturkritiker und Kolumnist u. a. bei der „Kleinen Zeitung“. Er hat die österreichische Kabarettszene maßgeblich beeinflusst, ist aber auch einer der meistgelesenen deutschsprachigen SF-Autoren („Perry Rhodan“). Zahlreiche Preise, darunter „Salzburger Stier“, Österreichischer Kabarettpreis „Karl“ und „Goldenes Buch“ für „Jörgi, der Drachentöter“ (mit Gerhard Haderer).
Ebenfalls bei Ueberreuter erschienen: „Das große Leo Lukas Lesebuch“ und der Krimi „Mörder Quoten“.
Danke, dass Sie sich für unser Buch entschieden haben.
Wir freuen uns, wenn wir Sie auch weiterhin über unsere
Neuerscheinungen informieren dürfen, und laden Sie ein
unser Newsletter unter www.ueberreuter.at zu abonnieren.
1. Auflage 2022
© Carl Ueberreuter Verlag, Wien 2022
ISBN 978-3-8000-9007-5
ISBN 978-3-8000-9907-8 (E-Book)
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigungund Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das giltinsbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitungin elektronischen Systemen sowie das öffentliche Zugänglichmachenz. B. über das Internet.
Lektorat: Marina Hofinger
Covergestaltung: Saskia Beck, s-stern.com
Coverfoto: Adobe Stock
Fotos Innenklappe: Homajon Sefat, abgelichtet.at
Satz: Gabi Schwabe, grafik design
Konvertierung: bookwire.de, Frankfurt/Main
www.ueberreuter.at
Leo Lukas
MÖRDERPOINTEN
Kriminalroman
Inhalt
Prolog
Erste Bahn: Geradschlag
Zweite Bahn: Passagen
Dritte Bahn: Salto
Vierte Bahn: Brücke
Fünfte Bahn: Stumpfe Kegel
Sechste Bahn: Schleife
Siebente Bahn: Doppelkeile/Sandkasten
Achte Bahn: Winkel
Neunte Bahn: Doppelwelle
Zwischenspiel
Zehnte Bahn: Mittelhügel
Elfte Bahn: Pyramiden
Zwölfte Bahn: Niere
Dreizehnte Bahn: Rohr
Vierzehnte Bahn: Labyrinth
Fünfzehnte Bahn: Vulkan
Sechzehnte Bahn: Blitz
Siebzehnte Bahn: Hochteller
Achtzehnte Bahn: Mausefalle
Nachbemerkung
Leo Lukas über „Mörder Pointen“
Wie Pez den Bravo kennenlernte
Prolog
Schade, dass du tot bist. Dadurch verpasst du einiges.
Zum Beispiel, dass man auch als Leiche noch im Weg sein kann.
Drei Personen stehen um dich herum, eine Frau und zwei Männer. Sie sind sehr bunt gekleidet, schreiend bunt sozusagen. Hingegen reden sie gedämpft. Offenbar glauben sie, dass du nur schläfst, und wollen dich nicht aufwecken. Ihre Unterhaltung hätte dich zu Lebzeiten gewiss amüsiert. Nicht bloß, weil alle drei stark geschminkt sind und kugelrunde rote Nasen aufhaben.
„Oh Mann. Die liegt aber ungünstig“, sagt die Frau.
„Oder der.“
„Eh. Und was machen wir jetzt?“
„Können wir nicht einfach …“
„Pst! Falls der Typ zuckt und die Scheibe bewegt wird, gibt das einen Strafpunkt.“
„Wieso? Wenn wir ihn vorsichtig ansprechen, sodass er munter wird und sie hinunterrutscht …“
„Hätten wir ihre Position dennoch beeinflusst.“ Der Besserwisser, ein typischer Weißclown, hebt den Zeigefinger. „Die Regeln sind da eindeutig. Ein Bewusstloser, vermutlich Besoffener ist kein natürliches Hindernis.“
„Ich spiele doch eh mit einem anderen Frisbee weiter. Mit meinem Top-Finalizer-3000. Praktisch sicherer Birdie. Sind ja nur noch 20, höchstens 25 Meter bis zum Korb.“
„Das glaube ich dir gern, Dorothea. Aber die Regeln besagen, dass du vom exakten Landelatz des zuvor benutzten Spielgeräts abwerfen musst. ‚Dabei ist‘, ich zitiere, ‚ein Stand innerhalb eines 20 Zentimeter breiten und 30 Zentimeter langen Rechtecks dahinter einzunehmen.‘“
„Schwachsinn! Ich kann dem Kerl ja nicht gut auf den Hintern steigen.“
Dir wäre es herzlich egal, würdest du denken, wenn du noch denken könntest.
„Also was tun wir?“, fragt der Dritte ein wenig lallend. Er tritt schwankend von einem Bein aufs andere. Aus der Plastikblume am Revers seines lächerlich groß karierten Sakkos spritzt ein dünner Wasserstrahl und trifft deinen Hinterkopf.
„Pass doch auf, Doc Tonto!“
„Tschulligung. Aber nix passiert.“
Du hast dich nicht gerührt. Wie auch.
„Zum Glück. – Tut mir leid, Doktor Doro, aber meines Erachtens kommst du nicht um einen Strafpunkt herum.“
„Wir könnten schummeln“, sagt die Frau. Wie zur Bekräftigung entlockt sie der Kinderziehharmonika, die vor ihrem mit einem Polster ausgestopften Bauch hängt, einige klägliche Quietschtöne. „Schließlich geht es um nichts.“
„Oho! Die ‚Goldene Ananas‘ ist nicht nichts.“
„Eine Urkunde und eine Trophäe aus Salzteig.“
„Gebastelt von Kindern auf der Krebsstation, daher ein wertvolles Einzelstück.“
„Na schön, Professor Pronto. Dann wecke ich ihn halt auf und nehme den Strafpunkt.“ Sie beugt sich zu dir herunter, schüttelt dich sanft an der Schulter, bringt ihren Kopf noch näher an deinen, horcht, horcht angestrengt, greift dir an den Hals, zur Schlagader, fährt entsetzt hoch. „Der atmet nicht! Und er hat keinen Puls. Der ist …“ Ihre Stimme versiegt.
„Tot?“, sagt Tonto. Plötzlich ernüchtert, wiederholt er: „Tot? Echt jetzt?“
„Nicht anfassen!“, ruft Professor Besserwisser, nestelt sein Handy aus den Falten der blau und gelb gestreiften Pluderhose und wählt den Notruf.
„Müssen wir …?“
„Dableiben, natürlich.“
„Mist“, sagt Doro. „Ich war so gut im Rennen.“ Sie hüstelt. „Sorry, das war pietätlos, gell?“
„Ja.“
„Ja.“
Es folgt peinliches Schweigen. Das Trio wartet eine gute halbe Stunde. Nachfolgende Dreierpartien winken sie wortlos vorbei und verscheuchen alle, die neugierig stehen bleiben wollen.
Endlich trifft eine Funkstreifenbesatzung ein. Kurz darauf kommen weitere Polizisten hinzu, noch zwanzig Minuten später ein Trupp Kriminaltechniker. Sie machen Fotos, stecken Schildchen in den Boden, machen mehr Fotos, während die uniformierten Kollegen ringsum zwischen den Bäumen rot-weiß-rote Absperrbänder aufspannen.
Dann wirst du aus der Bauchlage auf den Rücken gedreht. Deine Augen sind offen, erstarrt in einem verdutzten Gesichtsausdruck. Mitten auf der Stirn klafft eine Wunde. Dunkelrotes, gestocktes Blut bedeckt einen Großteil des Gesichts.
Die Clownfrau erkennt dich trotzdem. „Oh, mein Gott!“, haucht sie. „Das ist ja …“
Erste Bahn:Geradschlag
Empfohlene Bälle: Tiffany 3, Fun for Kids marineblau,Europaball Bottrop-Essen, ÖSM 2013 Christine Nestler
Warum setzen die Burgenländer zumZeitunglesen einen Sturzhelm auf? –Sie wollen sich vor den Schlagzeilen schützen.
Ta-taaa! Ta-taaa!
Das englische point-blank bedeutet auf Deutsch glatt,unverblümt, schnurgerade, aus nächster Nähe;„point-blank range“ steht für Kernschussweite.
Auf dem Weg zum Tatort ist der Bravo stets die Ruhe selbst. Grundsätzlich, weil er Morde nur begeht, nachdem er sich penibel vorbereitet hat. In diesem Fall sowieso; aller Wahrscheinlichkeit nach droht kein Widerstand. Das designierte Opfer ist zugleich der Auftraggeber.
Nicht, dass der Bravo deswegen leichtsinnig würde. Leichtsinn kennt er nicht. Jegliche Form von Schlendrian verbietet er sich. Immer schon, von Anfang an. Sonst wäre er nicht geworden, wer und was er ist: einer der gefragtesten, da verlässlichsten Profi-Killer des Landes, wenn nicht ganz Mittel- und Westeuropas.
Aber diesmal kann er es sich, seiner gründlichen Recherche zufolge, leisten, auf ein privates Fluchtfahrzeug zu verzichten. Stattdessen reist der Bravo mit einem öffentlichen Verkehrsmittel an. Und auch wieder ab, falls alles nach Plan läuft.
Wogegen rein gar nichts spricht. Denn das Zielobjekt hat die Umstände bereits optimal aufgeschlüsselt.
Die „Badner Bahn“ mag der Bravo. Er fühlt sich ihr irgendwie verwandt.
Sie ist ein Unikat, wie er. Historisch verwurzelt – sein Deckname „Bravo“ bezeichnet seit der italienischen Renaissance einen gedungenen Meuchelmörder –, aber in der Gegenwart alltäglich und unauffällig. Dabei ist das die einzige aus Wien hinausführende Bahnlinie, in die man mitten im ersten Stadtbezirk einsteigen kann, vor dem Hotel Bristol, schräg gegenüber der Staatsoper. Außerdem wechselt sie auf der insgesamt etwas über 27 Kilometer langen Strecke vom Ring bis zur Kurstadt Baden gleich zweimal quasi den Charakter. Anfangs nutzt sie, teilweise in Tieflage oder unterirdisch, die Geleise des Wiener Tramwaynetzes. Danach verläuft sie auf einem selbstständigen Gleiskörper, wie ein „richtiger“ Regionalzug, um sich für die letzten zwei Kilometer wieder in eine lokale Straßenbahn zu verwandeln. Damit einher gehen unterschiedliche Spannungen der elektrischen Oberleitung, von 600 über 750 bis am Ende 850 Volt Gleichstrom.
Dem Bravo gefällt diese Variabilität. Er versteht sich ja selbst als changierende, der jeweiligen Umgebung angepasste und dadurch schwer fassbare Existenz. Das bringen die Anforderungen der Profession, die er seit rund zwei Jahrzehnten ausübt, automatisch mit sich. Gute Mörder hinterlassen keine Spuren oder Hinweise auf irgendwelche individuellen Vorlieben.
Auch die Inneneinrichtung des Waggons, in dem er Platz genommen hat, wirkt undefiniert. Manche Sitze sind hintereinander angeordnet, andere wieder paarweise gruppiert, mit geräumigen Ablagen für weiter als ein paar Stationen reisende Passagiere.
Der Bravo hat eine Fahrkarte gekauft und entwertet. Obwohl er weiß, dass ein etwaiger Kontrollschaffner ihn übersehen würde. Er wird immer übersehen. Blicke gleiten an ihm ab, als wäre er gar nicht da. Das ist eine angeborene Gabe, die er später kultiviert hat.
Nicht einmal er selbst würde sich das Gesicht merken, das sich in der Fensterscheibe spiegelt. Es erscheint durchschnittlich, komplett uninteressant, nicht im Mindesten charakteristisch. Gleiches gilt für die Körperhaltung. Der Bravo sitzt entspannt, den Rucksack auf dem Schoß, die Lenkstange eines Elektrorollers zwischen den Knien. Beide Produkte sind Dutzendware ohne spezielle Merkmale, so allgegenwärtig und häufig anzutreffen wie die Schuhe und die gesamte Kleidung.
Auf einer Skala von minus fünf, „sträflich unbesonnen“, bis plus fünf, „extrem vorsichtig“, rangiert der Bravo bei cirka plus acht. Ist das paranoid? Ja, aber vernünftig.
Er hat keine Freunde, nicht einmal gute Bekannte. Seine Geschäftsbeziehungen laufen über mehr Umleitungen als die Hacker-Angriffe von „Anonymus“. Mindestens ebenso schwer sind sie zurückzuverfolgen. Zwischen den Wohnungen und Unterschlüpfen, die er unter verschiedenen Namen gemietet hat, wechselt er in unregelmäßigen, durch Würfeln bestimmten Abständen, ähnlich wie weiland Fidel Castro in Havanna, der den Weltrekord an überlebten Mordversuchen hält: 638. Die durchaus beträchtlichen Honorare, die auf ebenso vielfältig verschleierten Konten eingehen, investiert er zum größten Teil in nur noch ausgefeiltere Sicherheitsvorkehrungen.
Fragt er sich manchmal, ob das ein Leben ist? Natürlich. Er hält viel auf Selbstüberprüfung. Immer wieder gibt er sich zur Antwort, dass er genau so leben will, und nur so.
„Der Starke ist am mächtigsten allein“, legte schon Friedrich Schiller seinem Helden Wilhelm Tell in den Mund, nicht zufällig einem erfolgreichen Attentäter.
Von der Endstation im Zentrum der Kurstadt rollert der Bravo an die Peripherie. Er kommt an Einfamilienhäusern vorbei, deren Bewohner sich durch bemüht originelle Vorgartengestaltung sowie halblustige Schilder, die vor Wachhunden warnen, aus der Masse hervorheben möchten, und ehedem prunkvollen Villen, die das nie nötig hatten.
Am Waldrand erstreckt sich, eingebettet in die Flanke eines sanften grünen Hügels, das „Sanatorium Lazarus“. Es handelt sich um ein dreistöckiges Gebäude mit hufeisenförmigem Grundriss und umlaufenden Balkonen. Aus den am Geländer hängenden Töpfen wuchert üppiger Blumenschmuck. Der Bravo nimmt, wie ihm angeraten wurde, den näher zum Personalparkplatz gelegenen Seiteneingang. Im Schatten des Vordachs streift er Einweghandschuhe über.
Drei Meter rechts von der Tür befindet sich ein Schaltkasten. Er ist versperrt. Der Bravo hat den passenden Schlüssel mitgebracht. Sorgfältig darauf bedacht, im toten Winkel der suboptimal montierten Überwachungskamera zu bleiben, schraubt er die innere Abdeckung ab und legt die Verkabelung frei. Zügig, jedoch ohne Hektik appliziert er ein Kästchen, das ihm nach wenigen Sekunden die Kontrolle über die Alarmanlage verschafft. Deren Bauweise verhält sich zum Stand der Technik wie ein Trabi zum neuesten Tesla-Modell. Auch diesbezüglich erweisen sich die Angaben des Auftraggebers als korrekt.
Die ganze Sache sieht nach einer, wie die Wiener sagen, „g’mahten Wies’n“ aus. Aber der Bravo bleibt wachsam. Er klappt den Roller zusammen und verstaut ihn in einer Nische neben der Tür. Dem Rucksack entnimmt er einen weißen Arbeitsmantel und streift ihn über. An der Oberkante der Seitentasche ist lindgrün und schon leicht verwaschen „Sanatorium Lazarus“ aufgedruckt, selbstverständlich im Originalschriftzug, bei dem das S sich schlangengleich um einen Äskulapstab windet. Der Bravo schätzt es sehr, wenn auch kleinste Details stimmen.
Er schließt die Personaltür auf, tritt ein und lauscht.
Alles ist still. Kein Alarm ertönt.
Mit den festen, auf dem Fliesenboden klackenden und im verwaisten Korridor hallenden Schritten eines Insiders, der genau weiß, wohin er will, bewegt sich der Bravo durch das Gebäude. Niemand kommt ihm entgegen. Es ist kurz vor 19 Uhr. Auf den jeweiligen Stationen übergeben die Pfleger und Krankenschwestern gerade an den stark reduzierten Nachtdienst; die wenigen Ärzte sind längst nach Hause gegangen.
In den Fluren und Stiegenhäusern riecht es nach chlorhaltigen Desinfektionsmitteln. Aus manchen Zimmern dringt Musik, Stimmengewirr von Vorabend-Fernsehserien, immer wieder mal Stöhnen, ersticktes Husten oder mattes Röcheln.
Als der Bravo im Oberstock angelangt ist und die sirrend aufgleitende Schiebetür zum rechten Gebäudeflügel durchquert hat, versperrt ihm ein Gespenst den Weg. Das himmelblaue Nachthemd flattert um einen Körper, der nicht viel mehr ist als Haut und Knochen. Skelettöse Gliedmaßen ragen heraus und ein mumienhafter Schädel, gekrönt von vereinzelten, in alle Richtungen abstehenden Haarbüscheln.
„Gut, dass Sie da sind, Herr Doktor“, krächzt die alte, auf einen Rollator gestützte Frau. Ihre tief in den Höhlen liegenden Augen flackern. „Die Watzlawick aus Zimmer 307 hat mir schon wieder meine Leibschüssel gestohlen. Ich weiß eh, was sie mit dem Inhalt vorhat.“
Der Bravo fragt nicht nach. Ihm fällt nicht ein, was er sagen könnte. Normalerweise wäre er einfach vorbeigehuscht. Aber das geht nicht, merkt er, und diese Erkenntnis verstört ihn. Sonst nehmen ihn nur Todgeweihte wahr. Knapp vor ihrem Ende, wenn überhaupt …
„Sie baut daraus kleine Puppen“, setzt die Greisin fort, mit raspelnd gehauchter Grabesstimme. „Weil sie ein Luder ist, die Watzlawick, eine Hexe. Ich habe Ethnologie studiert. Ich war“, sie bäumt sich auf, am ganzen Leib schlotternd, „Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften! Mir braucht man nichts über Voodoo-Magie erzählen. Ich habe keine Angst. Die Watzlawick kann mir nichts antun. Mich schützt mein Amulett.“ Sie nestelt an dem roten Band um ihren Hals und zieht aus dem Kragenausschnitt ein kleines, verschmuddeltes Lebkuchenherz hervor.
Die an vielen Stellen durchbrochene, kaum noch lesbare Aufschrift aus Zuckerglasur entziffert der Bravo als „DICKE WADL, FESCHES MADL“. Das wird wohl vor Jahrzehnten so gewesen sein. „Ich muss aufs Klo“, sagt die Alte. „Herr Doktor, helfen Sie mir?“
Der Bravo erfüllt ihr die Bitte und geleitet sie zur Gangtoilette. Unangenehm berührt hält er Wache, bis sie ihre Notdurft erledigt hat. Dann führt er sie zurück zu dem ein paar Meter weiter hinten gelegenen Zimmer, dessen Tür offensteht.
„Danke“, nuschelt sie, nachdem er sie ins Bett gehievt und zugedeckt hat. Über das faltige, eingefallene Gesicht legt sich ein koketter Schimmer. „Junger Mann, wenn Sie wüssten, mit wem ich dazumal gelegen bin und verdammt viel Spaß gehabt habe. Sagt Ihnen der Name …“ Sie verstummt abrupt und beginnt zu schnarchen, stoßweise abgehackt, die Augen immer noch halb offen, die Lider flatternd.
Lautlos verlässt der Bravo das Einzelzimmer. Es hat die Nummer 307. Auf dem Schild steht „DDr. Heidrun Watzlawick“.
Ist das ein Leben? Natürlich, und unbedingt bewahrenswert, findet der Bravo: mit allen verfügbaren Mitteln, so lange wie irgend möglich. Nicht zuletzt dafür gibt es medizinische Einrichtungen wie diese.
Andere Personen wiederum möchten nichts lieber, als von ihrem Leid und ihren Schmerzen erlöst zu werden. Der Bravo wischt die Erinnerung an die Großtante, bei der aufgewachsen ist, weg und konzentriert sich wieder auf seine Mission.
Es ist nicht die erste dieser Art.
In Österreich steht aktive Sterbehilfe, anders als etwa in der Schweiz, nach wie vor unter Strafe.
Zwar wurde das Verbot der passiven Beihilfe zum Selbstmord modifiziert. Aber „Tötung auf Verlangen“, etwa durch Verabreichung tödlicher Medikamente, ist laut §77 StGB weiterhin mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bedroht. Menschen, die ihrem qualvollen Leben ein Ende setzen wollen, jedoch selbst nicht mehr dazu fähig sind, Suizid zu begehen – beispielsweise, weil eine unheilbare Krankheit sie ans Bett fesselt –, können der gnadenlosen Intensivmedizin nicht entkommen, wenn nicht vorab eine Patientenverfügung ausgefertigt wurde. Außer sie oder ihre engsten Angehörigen haben genügend Vermögen und Kontakte zur Dunkelwelt, um jemand wie den Bravo zu engagieren.
Sein aktueller Klient liegt auf Zimmer 312. Zahlreiche medizinische Geräte flankieren die Hightech-Pritsche. Das spärliche Licht stammt hauptsächlich von roten und grünen Lämpchen, bläulichen Digitalanzeigen und Monitoren mit oszillierenden Kurven. Einige der Apparate piepsen leise. Mehrere Schläuche und Kabel führen unter das Laken, das den Leib bedeckt. Eine Atemmaske ist über Mund und Nase geschnallt. Die fahlen Wangen blähen sich leicht in einem von der Maschine vorgegebenen Rhythmus.
Der Bravo vergewissert sich, dass der Name auf der Tafel am Fußende des Bettes mit seinen Informationen übereinstimmt. Dann nimmt er den Beutel, der den Venentropf speist, aus der Halterung und ersetzt ihn durch das mitgebrachte, binnen weniger Minuten wirksame Giftpaket.
Im selben Moment richtet die Gestalt den Oberkörper auf, fegt die Zuleitungen beiseite, reißt sich die Maske vom Kopf und sagt: „Ah ja. Und da sind Sie nun.“
Der Bravo erstarrt.
Er kennt die Stimme, erkennt das Zitat, auch das Gesicht, das unter der doppelten Verkleidung zum Vorschein gekommen ist. Keinem Sterbenskranken sieht er sich gegenüber, sondern …
„Peter Szily“, sagt der Bravo, sofort wieder eiskalt beherrscht. „Was soll das sein? Ein Witz?“
Nach versteckten Kameras hält er nicht Ausschau. Die wären ihm längst vom übernommenen Alarmsystem angezeigt worden. Oder …?
Szily schrubbt sich die Reste der Maskierung ab und säubert die Finger mit einem Feuchttuch. „Mitnichten“, sagt er. „Herzlich willkommen, Bravo. Aus der Erfahrung unserer bisherigen Begegnungen gehe ich davon aus, dass Sie nicht zu überstürzten Reaktionen neigen. Gleichwohl appelliere ich an Ihre hoch ausgeprägte Intelligenz, inklusive Vernunft und Hausverstand, mich erst einmal anzuhören, ehe Sie versuchen, mich doch noch um die Ecke zu bringen.“
Baff wie selten stößt der Bravo hervor: „Was sollte mich daran hindern?“
Seine Gedanken überschlagen sich. Er ist getäuscht, ja düpiert worden. Daran besteht kein Zweifel. Anstelle eines komatösen Wracks sieht er sich dem deutlich lebendigeren, wenngleich verlebten, um nicht zu sagen: abgehalfterten Komödianten gegenüber, mit dem er voriges Jahr die Morde am Wiener Dombrowski-Platz aufgeklärt hat.
„Erinnern Sie sich noch an die Apollofabrik?“, fragt Szily. „An Yojimbo und die anderen Whizzkids? Sie haben mich und diesen Raum ausgestattet nach allen Regeln ihrer Kunst. Nicht schlecht, was? Freilich könnten Sie mich auf der Stelle umbringen. Mir ist völlig klar, dass ich nicht in der Lage bin, Ihnen körperlichen Widerstand zu leisten. Killer gegen Komiker, das ginge eins zu null für Sie aus, keine Frage. Jedoch kämen Sie nicht davon. Sondern Sie würden in flagranti ertappt. Denn der Fluchtweg ist versperrt.“
„Du bluffst, Pezi.“
„Glauben Sie wirklich, Herr Bravo, ich hätte mich, nach allem, was ich über Sie weiß, auf diese Konfrontation eingelassen, ohne wasserdichte Vorkehrungen zu treffen?“
Die Zimmertür, die der Bravo hinter sich angelehnt hat, schließt sich mit einem saugenden Geräusch, gefolgt von einem satten Klicken.
„Arretiert“, sagt Peter Szily. „Ich nehme an, dass Sie, wie angeregt, die Alarmanlage unter Kontrolle gebracht haben. Allerdings nur teilweise. Bitte überzeugen Sie sich, dass Sie keinen Zugriff mehr auf diesen Raum haben.“
Der Bravo zückt seine Fernsteuerung, tippt darauf herum, scheitert. Szily hat nicht gelogen. „Mag sein. Aber sterben willst du nicht. Oder leiden.“
„Keineswegs. Wahrscheinlich beherrschen Sie mindestens ebenso viele Folter- wie Tötungsmethoden. Bloß nützen die in der gegebenen Situation gar nichts. Ich weiß den Code, der uns beide aus dieser Lage befreit, selber noch nicht. Erst in zehn Minuten wird er an mein Handy gesendet, und auch nur dann, wenn mein Blutdruck und Puls“, Szily deutet auf die Manschette an seinem Oberarm, „stressfreie Normalwerte ausweisen. Ansonsten ergeht eine voraufgezeichnete Alarmmeldung an die nächstgelegenen Polizeidienststellen. Ich traue Ihnen allerhand zu, jedoch nicht, dass Sie das rechtzeitig verhindern könnten.“
„Viel Aufwand“, sagt der Bravo. „Wozu eigentlich?“
Kühl überlegt er, womit der merklich schwitzende Komiker zu bezwingen wäre. Soll er das Klappmesser aus dem Stiefel ziehen oder den unter der linken Achselhöhle verborgenen Elektroschocker?
„Sie grübeln“, sagt Peter Szily, wenigstens ohne Triumph in der Stimme. „Sehen Sie der Realität ins Auge: Sie sitzen mit mir in der Falle. Die Tür ist massiv, das Fenster vergittert. Aber hören Sie, ich will Sie eigentlich nicht ausliefern. Obwohl ich dafür viel Ruhm einheimsen könnte, als der Mann, der den legendären Bravo zur Strecke gebracht hat, gell?“
Er setzt sich auf, lupft das Nachthemd, schwingt die nackten Beine über die Kante der Pritsche und spreizt spielerisch die Zehen. „Nein, das will ich nicht. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Und wertvolle Erfahrungen, die ich nicht missen möchte. Sie haben mich damals einbezogen, oder eher zwangsverpflichtet, um einen Mord aufzuklären, den ursprünglich Sie hätten begehen sollen.“
„Den Mord am Buchmacher Pekarek.“
„Und nicht nur den. Umgekehrt möchte ich diesmal Sie engagieren. Zumal Ihr Engagement ohnehin bereits bezahlt wurde.“
„Von dir?“
„Von mir, richtig. Da sind wir nun. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie stecken hinter der jüngsten Mordserie an meinen Kollegen. Dann könnten Sie auch mich noch eliminieren. Jedoch um den Preis, dass demnächst diverse Sondereinheiten der Polizei aufmarschieren, um endlich den mysteriösen Bravo zu fangen.“
„Oder?“
„Sie hören mir noch ein paar Minuten lang zu.“
„Rede“, sagt der Bravo.
Zweite Bahn:Passagen
Empfohlene Bälle: Reisinger SEM 2002,Deutschmann Majestix, Deutschmann Venus
Graf Bobby drischt auf einem gebirgigen Golfplatzden Ball in eine Schlucht. Baron Mucki hört daraus erschallen:Hack! Hack! Hack! Hack! Hack! Hack … Endlich ist der Ballwieder auf dem Fairway.„Wie viele Schläge hast du gebraucht?“, fragt Mucki.„Zwei.“„Mich dünkte, ich hätte sechs gehört.“„Hast du was auf den Ohren? Vier davon waren Echos!“
Ta-taaa! Ta-taaa!
Das französische Wort pointe hat seinen Ursprung imspätlateinischen puncta, „Stich“.
Angefangen hat es mit dem dicken Laimgruber.
Die Nachricht von seinem Tod, erzählt Peter Szily, löste landesweites Bedauern aus, obgleich wenig Verwunderung.
Der allseits beliebte Komödiant war schwer übergewichtig, und er hielt sich nicht unbedingt streng an die von den Ärzten angeratene Diät. Schließlich wurde er gern als Werbe-Testimonial gebucht, weil er Lebenslust und Genussfreude verkörperte. „Rund und g’sund“, auch wenn Letzteres nicht zutraf … Ein Herzinfarkt hatte ihn ereilt, nächtens auf dem Heimweg von einer Vorstellung im Linzer Posthof. Wonach er in das Becken des Handelshafens gekippt und entweder ertrunken ist oder bereits tot war, Friede seinem Angedenken.
Szily tut es ehrlich leid um ihn. Er hat Laimgruber nur oberflächlich gekannt, aber sehr sympathisch gefunden. Mit ihm kam man gut zurecht. Der ehemalige Religionslehrer war ein Profi ohne Allüren, lustig von Natur aus, bodenständig, gemütlich, jedoch keineswegs träge, schon gar nicht geistig. Manchmal blitzten zwischen seinen Kalauern fein ziselierte gesellschaftskritische Pointen auf, ein Interesse an tiefer gehenden Themen und Kenntnisse, die man ihm auf den ersten Blick nicht zugetraut hätte. Zuletzt hatten Pez und er einen Drehtag am Kulm im steirischen Salzkammergut. Der entstandene Kurzfilm ist ein übles, von vorn bis hinten unstimmiges Machwerk. Dennoch hat er einige Preise eingeheimst, bei Festivals in Kuala Lumpur, Puerto Rico und sogar Japan.
Jetzt ist Gerhard Laimgruber Geschichte. Die ganze österreichische Szene der Kabarettisten, Comedians und sonstigen Bühnenkünstler, der Peter Szily nur am Rande angehört, betrauert den im wahrsten Wortsinn schwerwiegenden Verlust.
Auch Pez trägt sich ins Online-Kondolenzbuch ein, mit einem flott gedichteten Vierzeiler: „Dein Abgang, lieber Gerhard, / trifft uns alle sehr hart. / Ach, wie das Herz uns schwer ward! / Das hätt’ ma uns gern DERspart.“
Tags darauf schreibt Szilys Ex-Gattin via WhatsApp: „Könntest du bitte in nächster Zeit vorbeikommen? Ich bräuchte deine Hilfe.“
Da er sowieso nichts Besseres zu tun hat, antwortet Pez, dass es auch gleich sein könne. Sie sendet eine Reihe begeisterter Emojis, die außer ihr wohl nur mehr Volksschul-Erstklässler verwenden würden. Eine halbe Stunde später steht er im Zimmer-Küche-Kabinett-Palast, den Nora bewohnt, seit sie Pez verlassen hat, zusammen mit der gemeinsamen, mittlerweile zwölf Jahre alten Tochter Elisabeth, genannt Li Si, wie die Prinzessin aus „Jim Knopf“.
„Was liegt an?“, fragt Pez, beschwingt wie immer, wenn er Eindruck schinden will.
„Wir haben einen neuen Nachbarn. Vor cirka zwei Monaten eingezogen. Er rückt mir auf die Pelle.“
„Inwiefern?“
„Anzügliche Bemerkungen bei den Mistkübeln im Hinterhof. Scheinbar unabsichtliches Anstreifen, wenn wir einander begegnen. Vorgestern ein Zettel auf dem Gepäckträger meines Fahrrads, mit der krakeligen Botschaft ‚Na, einsam?‘ und einem roten Herz drumherum. Letzte Nacht hat er an meiner Tür geläutet. Um drei Uhr früh!“
„Ah ja. Übel. Du hast nicht aufgemacht.“
„Natürlich nicht. Aber ich habe ihn durch den Spion gesehen. Schätze, er war betrunken.“
„Verstehe. Was ist er für ein Typ?“
„Ein Lulu. Ungefähr dein Alter. Halbglatze. Vom Gewand und dem gestutzten Vollbart her Türke der zweiten Generation. Keine Ahnung, was er beruflich macht. Untermittelgroß, eher schmächtig.“
„Die Kleinen sind meistens gefährlicher als die Großen.“
„Weiß ich.“ Nora hat sich ihr Psychologiestudium als Barkeeperin in einem Nachtlokal finanziert. Sie kann sowohl theoretisch als auch praktisch beurteilen, ob sie den Kerl besser nicht alleine zur Rede stellt. „Er ist daheim, ich habe ihn durchs Vorhaus schlurfen gehört.“
„Soll ich Vau Zwei dazu holen?“
V2 steht für „Verrückter Vrtala“. Das ist ein Ottakringer Original, gegen dessen Wahnsinn der Hutmacher aus „Alice im Wunderland“ die personifizierte Vernunft darstellt. Im Grunde harmlos, aber furchteinflößend, vor allem wegen seines irren Blicks. Pez, dem der fast zwei Meter große, am ganzen Leib tätowierte Vrtala als einem von wenigen Zeitgenossen vertraut, hat ihn schon das eine oder andere Mal benutzt, um gewissen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Allerdings kann V2 sich auch als Rohrkrepierer erweisen oder schlimmer noch als „unguided missile“ …
„Nein, nicht nötig“, sagt Nora. „Es reicht, wenn du dem Arsch illustrierst, dass ich keine schutzlose Alleinerzieherin bin. Mach einfach den Brando. Sollte das wider Erwarten nicht fruchten, kannst du immer noch Vau Zwei aufmarschieren lassen.“
„Okay. – Wo ist Li Si? Ich möchte nicht, dass sie mich so erlebt.“
„Bei einer Schulfreundin. Sie bleibt über Nacht.“
„Hast du …?“
„Das mit den Eltern abgeklärt. Sei unbesorgt, die Mädels ziehen sich höchstens bis zur Erschöpfung TikTok-Videos rein.“
„Auch nicht so super.“
„Aber momentan relativ egal, oder?“
Pez seufzt. Dass er recht wenig Einfluss auf den Werdegang seiner pubertierenden Tochter hat, missfällt ihm, ist jedoch nicht zu ändern.
Also imitiert er, wie versprochen, Marlon Brando in dessen Bravourrolle als Mafia-Pate. Zum Glück trägt Pez ohnehin fast immer schwarze Kleidung, die Individualisten-Uniform der Ach-so-Kreativen. Er ignoriert die Klingel am Türrahmen, sondern klopft so hart, eins-, zwei-, dreimal, dass ihm die Knöchel schmerzen.
Was tut man nicht alles für die Patchwork-Familie …
Schlurfende Schritte ertönen. Die Tür wird geöffnet, nur einen Spalt weit, gesichert durch eine Sperrkette. Der Nachbar äugt heraus. Er grinst schmierig, als er Nora erkennt, und zuckt zurück, als Pez sich vor sie schiebt.
„Hör mir bitte ganz genau zu“, raunt Pez mit Brandos heiseren, schleppenden, fast weinerlichen Stimme. „Denn ich werde das nur einmal sagen. Du hast dich heute Nacht ein bisschen verirrt, nicht wahr? Und schon davor, höre ich, hast du gegenüber meiner lieben Freundin den gebotenen Respekt vermissen lassen. So etwas stimmt mich traurig. Sehr, sehr traurig werde ich da. Das darf nie wieder vorkommen.“
„Äh, ich, äh, ich wollte nicht …“
„Pst.“ Pez legt den Finger an die Lippen. Der andere verstummt, was Pez zeigt, dass die Einschüchterungstaktik wirkt. Noch langsamer und eindringlicher setzt er fort: „Du musst dich nicht verteidigen. Wir zwei werden keinen Richter brauchen. Und auch keine Polizei. Es besteht kein Grund, sich Sorgen zu machen, wirklich nicht. Ich erteile dir einen Rat, taxfrei, vollkommen gratis. Sicher bist du so klug, ihn zu beherzigen, und alles ist paletti. Wer niemanden belästigt, dem passiert auch nichts. Haben wir uns verstanden?“
Der Nachbar würgt etwas heraus, das wie ein sehr verklemmtes, unterwürfiges „Ja“ klingt. Dann drückt er die Tür zu.
Nora schickt ihm noch einen gereckten Mittelfinger hinterher. Zurück in ihrem Puppenheim prustet sie los. Dann wischt sie sich die Tränen aus den Augenwinkeln und sagt: „Puh. Das war überzeugend. Schau, sogar ich hab eine Gänsehaut! Danke, Pez. Ich bin ziemlich sicher, dass der in Zukunft einen weiten Bogen um mich macht.“
„Es war mir ein Vergnügen“, haucht Brando, „meine bescheidenen Fähigkeiten ausnahmsweise einmal sinnvoll einsetzen zu können.“ Szily räuspert sich, spricht wieder normal. „Na schön. Hätten wir das auch bereinigt.“
„Apropos …“
„Die Alimente überweise ich dir morgen, okay?“
„Wäre gut. Der Juli dauert nämlich nicht mehr lang, falls es dir aufgefallen ist. Sonntag haben wir bereits August. Habe ich dir schon mal erzählt, wie oft Teenager im Wachstumsschub neue Schuhe brauchen?“
„Zweimal monatlich. Das gilt auch für die Schuhe.“
Nora kneift ein Auge zu. „Ha, ha.“
„Im Ernst, ich werde den August gleich mit einzahlen. Das versprochene Ausfallshonorar für die Moderationen beim abgesagten Fremdsprachen-Wettbewerb ist endlich eingelangt.“
„Na prima. Wer schnell gibt, gibt doppelt.“
„Heißt das, der September ist dann automatisch inkludiert?“
„Übertreib’s nicht mit den Flachwitzen, Pezi.“
Einen Tag danach, am Samstagnachmittag, wird der Kabarettist Lorenz Buchta tot aufgefunden: im Volkspark Laaer Berg, einem Teil des Wiener Grüngürtels am südlichen Stadtrand, während einer Veranstaltung zugunsten der Klinik-Clowns.
Jemand hat Buchta den Schädel eingeschlagen. Markant. Ihm wurde quasi ein blutiger Scheitel gezogen. Es war also definitiv ein Mord. Entsprechend viel Aufsehen zieht er nach sich.
Nicht nur Peter Szily ist schockiert, als er davon erfährt. Alle Welt reagiert bestürzt.
Anders als Gerhard Laimgruber, der selbst den „Oberösterreichischen Nachrichten“ grade mal einen zweispaltigen Nachruf im Lokalteil wert war, schafft Buchta es auf fast alle Titelseiten der Sonntagszeitungen und sogar zur Spitzenmeldung der „ZIB 24“. Er galt als einer der führenden Satiriker des Landes, als herausragend „kritischer Geist“, der immer wieder skandalöse Vorgänge aufspürte und in seinen Kolumnen und TV-Auftritten wortgewaltig anprangerte. Sollte er, spekulieren die Boulevardmedien, in ein Wespennest gestochen haben, das sich als allzu reizbar herausstellte? War Lorenz Buchta etwa gar einer Verschwörung auf die Spur gekommen und musste beseitigt werden?
Wie üblich versuchen diverse Trittbrettfahrer, das tragische Ereignis für ihre jeweilige Agenda zu vereinnahmen. Hart am rechten Rand des politischen Spektrums angesiedelte Internetportale zaubern fast glaubwürdige Zeugen aus dem Hut, die sich fast sicher sind, fast zur selben Stunde an fast demselben Ort fast eindeutig als islamistische Terroristen erkennbare Unholde fast „Allahu Akbar!“ brüllen gehört zu haben. Zeitgleich behauptet eine Splittergruppe von Umweltschützern, Buchta wäre ermordet worden, weil er sich gegen den Bau einer Schnellstraße durch ein Naturschutzgebiet eingesetzt hat. Der Innenminister tritt zur besten Sendezeit vor die Fernsehkameras und kündigt zackig an, man werde gleichermaßen hart gegen Extremisten von links und rechts sowie insbesondere gegen illegale Einwanderer aus Afghanistan vorgehen, und zwar gnadenlos. Hinter ihm stehen martialisch gewandete, mit Sturmgewehren bewaffnete und schwarzbehelmte Gestalten, offensichtlich Angehörige einer Eliteeinheit. Einer hat auf der Uniform, neben dem Rangabzeichen, ein eigentlich verbotenes Nazi-Symbol angeheftet, die „Schwarze Sonne“. Aber lass gut sein, jeder Mensch darf ein Hobby pflegen.
Die Frage bleibt: Wer erschlägt am helllichten Tag einen weithin bekannten Unterhaltungskünstler?
Und warum?
Auch Peter Szilys Tochter beschäftigt diese Frage. Wie jeden Montag geht er mit ihr Mittagessen, in ihr Lieblings-Chinarestaurant.
Sie wählt das Menü 15, wie immer, „Knusprige Ente nach Szechuan-Art“. Pez nimmt diesmal Menü 21, „Hexen-Tofu mit Pilzen“. Es schmeckt schal, wässrig. Aber er beschwert sich nicht, sondern spritzt noch ein paar Tropfen Sojasoße mehr darüber.
„Der Buchta“, Li Si deutet auf die alte Zeitung, die am Nebentisch liegen geblieben ist, „der war doch ein Kollege von dir. Hast du ihn gekannt?“
„Na ja, Kollege … Er hat in einer weit höheren Liga gespielt. Wir sind uns dennoch gelegentlich über den Weg gelaufen. Das bleibt nicht aus in der einzigen Metropole des Landes.“
„Über ein Fünftel aller Österreicher und Österreicherinnen leben in Wien. Das haben wir schon in der Volksschule gelernt.“
„Richtig. Trotzdem ist es ein Dorf. Außerdem wurde ich ab und zu für kleine Nebenrollen in Buchtas Fernsehshows engagiert, meistens als steirischer oder kärntnerischer Bauerndodel. Oder für Voiceovers, also Stimmen aus dem Off.“
„Ich weiß, was das ist, Papa. – War er nett?“
„Zumindest nicht sonderlich unfreundlich oder herablassend. Da gibt’s andere Kanaillen. Freilich …“ Pez zögert. Wie sag ich’s meinem Kinde, das hoffentlich noch ans Gute in der Welt und in den Menschen glaubt? „Der Name Buchta stammt aus dem Tschechischen. Unsere Buchteln kommen ebenfalls da her. Die Kalorienbomben, diese mit Powidl gefüllten Germteig-Dinger, die dir deine Oma immer aufdrängt.“
„Viel zu süß.“ Li Si schüttelt sich. Wie zur Abwehr der Erinnerung nimmt sie mit den Essstäbchen ein Stück Entenbrust, taucht es geschickt in die Knoblauchsoße und führt es zum Mund. Kauend sagt sie: „Und Wuchteln sind dasselbe? Also Fußbälle oder Gags von Kabarettisten?“
„Im Sinne von aufgeblasen, ja.“
„Dein Kollege Buchta war also …?“ Sie zwinkert.
Pez zwinkert zurück, dankbar für den seltenen Moment eines generationenübergreifend verschwörerischen Einverständnisses. „Sagen wir, er litt nicht unter mangelndem Selbstbewusstsein. Aber davon abgesehen, hat Lorenz sich meines Wissens immer äußerst korrekt verhalten. Ausgesucht feine Schale“, Szily streift sich über sein dünnes, verschlissenes Sommersakko, „ebenso feine Manieren. Und absolute Handschlagqualität. Faire Verträge. Nie Probleme mit der Abrechnung. Vielmehr hat er großen Wert darauf gelegt, dass alle Mitwirkenden anständig und prompt bezahlt wurden. Da war er extrem pingelig. Klar, das wäre auch nicht gut gekommen bei ihm, dem selbst ernannten Korruptionsjäger und Aufdecker der Nation.“
„Warum, glaubst du, musste Buchta sterben?“
„Ich habe nicht die geringste Ahnung“, sagt Pez wahrheitsgemäß.
In der folgenden Nacht schläft er nicht gut. Er schreckt aus Albträumen hoch, an die er sich nicht erinnern kann, nur an Momentbilder wie eine Bärenfalle, die um seinen rechten Fuß zuschnappt, oder eine Küchenmaschine, in der seine linke Hand geschreddert wird, zusammen mit einem Büschel Petersilie.
Am nächsten Abend geht er vorsorglich etwas trinken. Pez zieht durch ein paar Kaffeehäuser und Bars, allesamt traditionelle Szene-Treffpunkte. Halbherzig beteiligt er sich an den unausweichlichen Diskussionen über Lorenz Buchtas abruptes, gewaltsames Ende. Seiner nicht sehr repräsentativen Meinungsumfrage zufolge steht auf der Liste der Verdächtigen ganz oben die Russenmafia, knapp gefolgt vom israelischen Geheimdienst Mossad, radikalisierten Impfgegnern und außerirdischen Reptiloiden. Vernünftigerweise lässt Pez sich weder auf Streitgespräche mit Flacherdlern noch Flirtangebote unterbeschäftigter Jungschauspielerinnen ein, sondern geht zufrieden nach Hause. Ausreichend müde fällt er ins Bett.
Unmittelbar nach den penetranten Mittagsglocken der nahen Kirche läutet sein Handy. Pez hat die Nummer noch eingespeichert. Als er den Namen liest, hebt er sofort ab.
„Wir würden Sie gern als Auskunftsperson befragen“, sagt Chefinspektorin Karin Fux ohne Umschweife. „Könnten Sie im LKA vorbeikommen? Heute noch, sagen wir zwischen 14 und 15 Uhr? Die Adresse kennen Sie ja.“
„Muss ich?“
„Sie müssen nicht. Aber ich könnte Sie auch vorführen lassen.“
„Per Gericht?“
„Per Streifenwagen. – Herr Szily, Sie wissen genauso gut wie ich, dass ich notfalls recht schnell allerhand Hebel in Bewegung setzen kann, und daraufhin auch Sie.“ Die rauchige Altstimme klingt nach wie vor freundlich und ebenso routiniert befehlsgewohnt. „Außerdem haben Sie doch nichts zu verbergen, oder?“
„Selbstverständlich nicht. Nur, äh … Wozu die Eile? Worum geht’s überhaupt? Was wollen Sie von mir?“
„Das erkläre ich Ihnen gern. Aber nicht am Telefon. Also, sehen wir uns?“
Er beschließt, nicht weiter nachzufragen, sondern brav zu tun, was die Polizistin von ihm verlangt. Widerstand wäre im Endeffekt zwecklos, und inzwischen ist er neugierig geworden. „Bin unterwegs.“