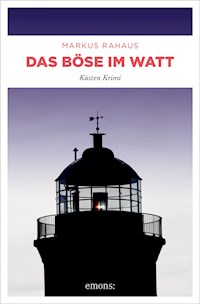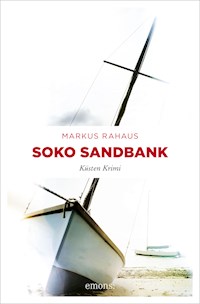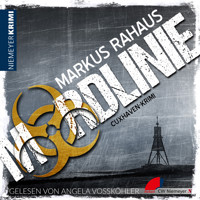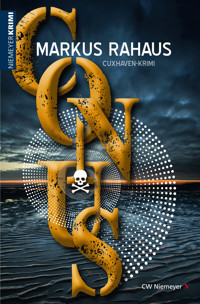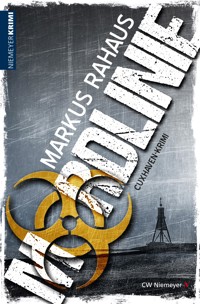
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Auf der Suche nach seinem Platz im Leben stolpert Konrad Georg Brichtner am Duhner Strand in Cuxhaven über eine Leiche. Das Opfer sitzt im Auto und hält einen mysteriösen Gegenstand in der Hand – eine Petrischale mit Nährboden für Bakterien. Das Bizarre: Die Bakterien wachsen in Form einer numerischen Reihenfolge. Was hat es mit diesen Zahlen auf sich? Ein Code vielleicht? Konrad beschließt, eigene Nachforschungen anzustellen, als er erfährt, dass das Opfer ein ehemaliger Kollege seines Onkels und Ziehvaters ist. Alles deutet darauf hin, dass der Mord etwas mit einer früheren BKA-Ermittlung zu tun hat, in die sein Onkel eingebunden war. Dann überschlagen sich die Ereignisse, denn es werden weitere Leichen mit ähnlichen Bakterienschalen aufgefunden …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Für Nathalie und Yannicka.
Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über https://www.dnb.de© 2023 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.com eISBN 978-3-8271-9783-2
Markus RahausMordlinie
Prolog
März 2014, Cuxhaven
Langsam senkte sich die Dämmerung des späten Märztages herab. Es war kalt, graue Wolken hingen am Himmel und eine steife Brise wehte aus Südwest. Die Wasseroberfläche im Amerikahafen kräuselte sich, draußen auf der Elbe, westwärts der Kugelbake würde es deutlich rauer zugehen. Von Sturm konnte zwar noch keine Rede sein, aber es war zweifelsfrei ungemütlich auf dem Wasser.
Die Männer standen auf dem schwankenden Pier vor den Booten und prüften ihre Ausrüstung. Sie trugen dunkle, fast schwarze Überlebensanzüge und ebenso dunkle automatische Rettungswesten – Unsichtbarkeit war essenziell für die bevorstehende Operation. Schon zuvor, während der Vorbereitungen, war Verborgenheit großgeschrieben worden. Obwohl es eine sehr aufwendige Aktion war, waren außer den BKA-Beamten bei ihren Booten nur einige handverlesene Mitarbeiter dieser und ein oder zwei anderer Behörden eingeweiht. Die lokale Polizei hatte man noch gar nicht informiert, dies würde erst nach dem Ablegen der Boote geschehen, denn man wollte jede Art der Einmischung unbedingt vermeiden. Jeder Mann auf dem Pier war mit kurzläufigen Schnellfeuerwaffen und Pistolen bewaffnet und hatte ein wasserfestes Handfunkgerät und zwei Signalfackeln. Sollte einer der Männer später in der unruhigen See über Bord gehen, waren diese Hilfsmittel die beste und einzige Chance, entdeckt und gerettet zu werden.
Insgesamt waren sie zu sechst, mit drei Booten, von denen es jedes auf knapp zehn Meter Länge brachte und mit zwei einhundertvierzig PS starken Suzuki-Außenbordmotoren ausgestattet war. Die schwarzen Aluminiumrümpfe und die minimalistischen grauen Aufbauten – eigentlich nur der Fahrstand mit einer kleinen Frontscheibe gegen Spritzwasser und ein Hardtop darüber – wären später auf dem Wasser kaum zu sehen.
Einer der Männer schaute auf seine Armbanduhr und nickte den anderen zu. „Es ist Zeit. Wir brechen auf.“
Behände sprangen die Männer in die Boote, zwei in jedes Gefährt. Einer begab sich ans Steuer und startete die Motoren, der jeweils andere löste nacheinander die Bug- und die Heckleine, die das Boot am Pier hielten. Mit einem tiefen Brummen schoben sich die Fahrzeuge hinaus ins Hafenbecken. Schon nach wenigen Metern wurden sie vom eintönigen Grau der spätnächtlichen Dunkelheit und des tiefen Wassers verschluckt, nur das Dröhnen der Motoren war noch zu hören.
Kaum hatten sie die Hafeneinfahrt mit den rot und grün blinkenden Markierungen hinter sich gelassen, drehten die Boote nach Westen und beschleunigten. Dabei querten sie die Fahrrinne der Elbe und folgten anschließend den roten Fahrwassertonnen in Richtung Nordsee.
Im ersten Boot schaute der Mann abermals auf die Uhr. In Gedanken überschlug er, wann sie bei der aktuellen Geschwindigkeit, der Strömung und dem herrschenden Wellengang an der Zielposition eintreffen würden. Er hatte sich eine ruhigere See gewünscht, war aber dennoch zuversichtlich, dass alles wie geplant ablaufen würde. Optimismus war ebenfalls Teil der Ausrüstung.
Unerwartet schlug das Boot hart in eine Welle, die Motoren heulten auf, Gischt wehte den beiden Männern in die Gesichter, sie ließen sich davon jedoch nicht beirren. Der Fahrer schob trotzig den Gashebel ein Stückchen weiter nach vorne. Auch das zweite Boot hielt mühelos mit. Es fuhr an der Backbordseite ein kleines Stückchen hinter dem ersten Boot.
„Nummer drei – aufschließen“, ordnete der Teamleiter, mit seinen vierundfünfzig Jahren der Älteste im gesamten Team, im ersten Boot über eine abhörsichere Frequenz per Funk an. Er warf einen schnellen Blick nach achtern. Das dritte Boot war deutlich zurückgefallen.
„Hier Nummer drei“, ertönte es aus dem Funklautsprecher. „Wir habe Probleme mit den Motoren. Wahrscheinlich die Benzinzuleitung. Wir müssen abbrechen.“
„Verdammt“, zischte der Teamleiter und schlug mit der flachen Hand auf den Rand des Armaturenbretts.
Der Mann am Steuer, der aufgrund des Motorenlärms das Funkgespräch nicht hatte mithören können, sah ihn überrascht an. „Was ist los?“
„Nummer drei ist raus. Technische Probleme.“
Ohne das Steuer loszulassen, warf der Fahrer einen schnellen Blick über die Schulter und sah das letzte Boot ausscheren und eine Wende fahren. Es nahm wieder Kurs auf Cuxhaven. „Wir kommen auch mit zwei Einheiten klar“, stellte er fest.
„Wir haben keine Wahl.“
Die beiden Boote hatten längst die Kugelbake, das Wahrzeichen Cuxhavens, passiert. Die hölzerne Konstruktion, die das geografische Ende der Elbe markierte, wäre in der Dunkelheit ohne die Scheinwerfer, von denen sie beleuchtet wurde, nicht zu sehen gewesen.
Wie erwartet nahm die Dünung an Höhe zu, Schaumkronen tänzelten auf den Wellen. Sofort mussten die beiden verbliebenen Boote die Geschwindigkeit reduzieren, um gegen die Kraft der Wellen zu bestehen.
Plötzlich verwandelte sich das statische Rauschen aus dem Funkgerät des Teamleiters in schwer verständliche Wortfetzen. Es schloss die Augen, drückte sich das Gerät ans Ohr und hörte konzentriert zu. „Adler meldet, die Sunshine hat soeben das Zielgebiet erreicht.“
Der Bootsführer nickte und schob den Gashebel trotzig wieder ein Stückchen vor. Dabei hob er den Kopf und blickte in den Himmel, als hoffte er, das Aufklärungsflugzeug trotz der Dunkelheit entdecken zu können. Das Boot beschleunigte ein wenig, die Gischt zischte wie kleine Geschosse an den Männern vorbei. Das zweite Boot schloss auf.
Der Mond brach unerwartet durch die zuvor dichte Wolkendecke. Das Bild, das sich in seinem fahlen Licht bot, war Furcht einflößend. Wellenberge in diffusen Grauschwarz-Tönen, wohin der Blick fiel. Von den Schaumkronen rissen Spritzer groß wie Fußbälle ab. Immer dann, wenn sich das Boot aus einem Wellental erhob, waren für einige Augenblicke die grünen oder roten Signale der Fahrwassertonnen und in größerer Entfernung die Befeuerung des Gelbsands zu erspähen.
„Verdammtes Mistwetter“, murmelte der Teamleiter leise.
„Da drüben“, schrie der Bootsführer und deutete mit einer Hand schräg voraus.
„Sichtkontakt“, brüllte der Teamleiter in sein Funkgerät. „Bereithalten.“
Synchron verringerten beide Boote nun wieder die Geschwindigkeit und fuhren nur noch gerade so schnell, um in dem Wellenchaos steuerfähig zu bleiben.
„Team an Adler“, sprach der Teamleiter in das Funkgerät. „Benötigen Informationen zu weiteren Fahrzeugen im Zielgebiet.“
Statisches Rauschen, verschluckt vom Tosen der Wellen.
„Adler an Team“, klang es aus dem Lautsprecher. „Keine relevanten Fahrzeuge.“
„Verdammt.“
„Adler an Team. Korrektur: ein weiteres Fahrzeug östlich eurer Position, Kurs West. Nähert sich schnell.“
„Team an Adler. Verstanden.“
Es geht los, schoss es dem Teamleiter durch den Kopf. „Das Kurierfahrzeug nähert sich“, schrie er wieder in sein Funkgerät. „Zugriff erst nach Übernahme der Ware und nur auf mein Kommando.“
„Bestätige“, kam es nach wenigen Sekunden zurück. „Zugriff nur auf Kommando.“
Die Zeit floss dahin wie zäher Schleim über eine Tischkante, jeder Tropfen eine Minute. Ein paar Wolken schoben sich langsam am Mond vorbei, sodass es für einige Schleimtropfenminuten dunkler wurde. Die Männer in den Booten hatten sich mittlerweile an das Auf und Ab ihrer Fahrzeuge gewöhnt, der Adrenalinspiegel hatte sich auf hohem Niveau eingependelt.
„Hier Boot zwei“, tönte es aus dem Funklautsprecher. „Haben Sichtkontakt zur Sunshine.“
„Entfernung?“, fragte der Teamleiter.
„Gut vierhundert Meter. Das Schiff dreht in den Wind.“
„Wo ist der Kurier?“, wollte der Teamleiter wissen. Gleichzeitig musste er sich gegen eine gewaltige Gischtwolke stemmen, die über ihn hinwegfegte.
„Kein Sichtkontakt.“ Die Antwort vom zweiten Boot kam prompt.
„Adler an Team. Der Transfer fährt auf der euch abgewandten Seite am Heck der Sunshine.“
„Das ist das Übergabemanöver“, donnerte der Teamleiter. „Zugriff.“
Beide Boote beschleunigten gleichzeitig. Die Bugspitzen stachen in die Wellen wie Speere, die Motoren brüllten, als wollten sie mit einem Kriegsgeheul den Wellen erklären, wer der Stärkere war. Meter für Meter näherten sie sich dem Frachter und dem Kurierfahrzeug.
Trotz der Kälte und des Wassers standen dem Mann am Steuer Schweißperlen auf der Stirn. Jedes Mal, wenn sein Boot eine Welle erklomm, gab er Gas, jedes Mal, wenn sie über den Kamm ins Wellental rutschten, zog er den Gashebel ein Stückchen zurück.
„Noch einhundert Meter.“ Boot eins hatte nur noch einen kleinen Vorsprung.
An Bord der Sunshine flammte ein Scheinwerfer auf und beleuchtete das Kurierboot. Das Fahrzeug, gute zwölf Meter lang, hatte einen hellen, wahrscheinlich weißen Rumpf und eine ebenso helle Kabine.
„Das ist nur eine ganz gewöhnliche Motorjacht“, presste der Bootsführer angespannt zwischen den Zähnen hervor.
„Wollen die uns verarschen?“, brummte der Teamleiter. „Wozu die Festbeleuchtung?“ Er griff nach seinem Fernglas und versuchte, es sich trotz der unberechenbaren Bewegungen des Bootes vor die Augen zu setzen, ohne dabei seinen sicheren Halt zu verlieren.
„Was zur Hölle –“, weiter kam er nicht, denn das Boot krachte erneut in eine Welle und ein ordentlicher Schwall Salzwasser flutete über sie hinweg. „Da turnen zwei hinten im Schiff herum. Mit Bootshaken oder Stangen.“
Eine weitere Gischtwolke raubte ihm Atem und Sicht.
„Ha“, schrie er, unklar, ob aufgebracht, erschrocken oder erheitert. „Die Ware ist im Wasser, markiert mit Schwimmer und rotem Blinklicht. Die stochern mit den Bootshaken danach.“
„Dann holen wir uns das jetzt“, antwortete der Bootsführer mürrisch und ungeachtet des Wellengangs.
Der Teamleiter gab die Information an das andere Boot weiter.
Plötzlich änderte der Scheinwerfer auf der Sunshine seinen Winkel und leuchtete direkt in die Richtung der beiden sich nähernden Boote.
„Die haben uns entdeckt.“ Der Bootsführer spuckte einmal aus.
„Scheiße“, bestätigte der Teamleiter. Abermals gab er Anweisungen über Funk.
Beide Boote näherten sich mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit der weißen Jacht.
Die Männer im Achterschiff hatten die beiden herankommenden Fahrzeuge nun auch entdeckt. Einer von ihnen warf den Bootshaken von sich und verschwand in der Kabine. Nur Augenblicke später kehrte er zurück.
„Achtung“, schrie der Teamleiter. „Der Kerl ist bewaffnet.“
Wie zur Bestätigung blitzte es auf dem anderen Boot in schneller Folge auf. Mündungsfeuer. Das Rauschen des Fahrtwindes und der Wellen sowie das Dröhnen der Motoren übertönten das Knallen der Schüsse. Nur Sekundenbruchteile später schossen Backbord neben dem ersten Boot eine Reihe kleiner Wasserfontänen in die Höhe, die vom Wind jedoch augenblicklich in die Waagerechte gerissen wurden.
„Feuer erwidern“, brüllte der Teamleiter ins Funkgerät und zog selbst eine kurzläufige Maschinenpistole vor, die er bis zu diesem Moment auf dem Rücken getragen hatte. Mit einem Arm hielt er sich am Sitz fest, den anderen streckte er aus und richtete die Waffe auf den Gegner. Ohne auch nur einen Moment zu zögern, zog er den Abzug durch. Es ratterte ohrenbetäubend und Mündungsfeuer blitzte auf. Das Boot erhob sich auf einen Wellenkamm. Sie waren bereits so nah an die Jacht herangekommen, dass er einige seiner Geschosse in den Rumpf und die Seitenscheiben der Kabine des gegnerischen Bootes einschlagen sehen konnte.
Noch einmal zog er den Abzug durch, feuerte eine weitere Salve. Seine Mitstreiter auf dem anderen Boot taten es ihm nach. Abermals schlugen Kugeln in das weiße Boot ein. Im gespenstischen Licht des Scheinwerfers der Sunshine konnten sie sehen, wie einer der Männer im Heck mit zuckenden Bewegungen über Bord ging.
Plötzlich drehte sich der Bug der Jacht und nahm direkten Kurs auf das Gefährt des Teamleiters.
Nun zog auch der Mann am Fahrstand seine Maschinenpistole hervor. Mit einer Hand hielt er das Boot auf Kurs, mit der anderen visierte er den Angreifer an.
„Boot zwei, schnappt euch die Lieferung.“
„Verstanden“, kam die prompte Antwort. „Wir sehen außerdem Aktivitäten im Heck der Jacht. Ja, leck mich! Die wollen tatsächlich das Beiboot ausbringen. Einer von den Kerlen steigt ein. Wenn der nicht kentert, erreicht er die Ware wahrscheinlich vor uns. Wir sind dran!“
Wütend ließ der Teamleiter das Funkmikrofon fallen und rammte ein volles Magazin in seine Waffe. Unerwartet erlosch der Scheinwerfer, alle Boote verloren sich wieder in der Dunkelheit. Schemenhaft konnte er erkennen, wie die helle Jacht näher kam. Er hob den Lauf seiner Waffe und zielte vage. Doch bevor er den Abzug betätigte, drehte das Boot ab.
„Der will abhauen. Hinterher!“
Der Mann am Steuer reagierte sofort. Das Boot legte sich trotz der Wellen in eine steile Kurve. Kurzzeitig hob sich sogar der Propeller des in der Kurve außen liegenden Außenbordmotors aus dem Wasser, was dieser jäh mit einem bedrohlich klingenden Pfeifen quittierte.
Sie waren genau hinter der Jacht, keine fünfzig Meter entfernt. Der Teamleiter hob erneut seine Waffe und zog den Abzug durch. Einige Geschosse verfehlten ihr Ziel, andere trafen. Ein Teil der aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigten Bordwand explodierte in tausend Splitter, einer der Männer im Achterschiff wurde nach hinten geschleudert, seine Waffe flog im hohen Bogen über Bord.
„Neutralisiert“, stellte der Bootsführer am Steuer emotionslos fest.
Schlagartig brach die Hölle los.
Mehrere Schnellfeuerwaffen auf dem anderen Boot feuerten gleichzeitig. Es musste unter Deck noch weitere Männer gegeben haben, die sich bislang zurückgehalten hatten. Der Bootsführer schrie auf und verzog schmerverzerrt das Gesicht. Er drohte vom Sitz abzurutschen und klammerte sich mit der Kraft der Verzweiflung an sein Steuer. Das Hardtop über ihm zerbarst mit kreischenden Geräuschen. Nur der Rumpf des Bootes wurde auf wundersame Weise nicht getroffen.
„Ihr Scheißkerle“, brüllte der Teamleiter, der sich geistesgegenwärtig auf den Boden hatte fallen lassen. „Bist du okay, Ralf?“, fragte er seinen Begleiter.
Der nickte nur und deutete auf seinen blutenden Oberschenkel. „Nur ein Kratzer.“
Synchron rissen beide ihrerseits die Waffen hoch und feuerten, bis die Magazine leer waren und die Waffen nur noch metallische Klickgeräusche von sich gaben. Sie konnten beobachten, wie auf dem anderen Boot eine weitere Person über Bord ging und eine andere getroffen zusammensackte. Ein dritter Mann reckte beide Arme in die Luft und warf seine Waffe über Bord. Dann wedelte er ununterbrochen mit den Armen umher.
„Ich schätze, die haben genug“, sagte der Teamleiter.
Der Bootsführer grunzte zustimmend.
„Wir versuchen, die Person im Wasser rauszuziehen. Dann gehen wir längsseits, egal wie, nehmen die Vögel fest und schleppen die Jacht nach Cuxhaven“, bestimmte der Teamleiter. „Die Küstenwache wird sich, wie geplant, den Frachter vornehmen und zum Anlegen in Cuxhaven zwingen.“
Der Mann am Steuer fuhr einen Bogen und schob dann den Gashebel behutsam vor, um Fahrt aufzunehmen.
„Boot zwei, kommen“, sprach der Teamleiter ins Funkgerät. „Statusmeldung.“
Er bekam keine Antwort.
Kapitel 1
Frühsommer 2022
Mein Name ist Connor Royce Brichton und ich bin siebenundzwanzig Jahre alt, meine Freunde nennen mich Coro. Das klingt so ähnlich wie Zorro – eine meiner Lieblingsserien, die ich früher immer zusammen mit meinem Vater im Fernsehen geschaut habe, bevor er aus meinem Leben verschwand. Aber nur meine Freunde dürfen mich Coro nennen. Wer es trotzdem macht, riskiert einen gebrochenen Zeigefinger. Da kenne ich nichts.
Trotz meiner jungen Jahre bin ich ein ausgebuffter und erfahrener Privatermittler. Sie glauben mir nicht? Sollten Sie aber. Wenn ich einen Fall annehme, bringe ich ihn auch zum Ende. Immer. Und „Ende“ bedeutet, dass er gelöst ist. Ihr Hund ist entlaufen? Ihr Partner betrügt Sie? Sie sind einem Internetbetrüger auf den Leim gegangen? Ein Haufen krimineller Säcke erpresst Schutzgeld von Ihnen? „CCPS“ lautet die Lösung! Call Connor – problem solved.
Wenn ich nicht gerade in einem Fall ermittle, trainiere ich. Meinen Körper und meinen Geist. Stahlharte Muskeln und ein blitzgescheites Hirn haben noch niemandem geschadet. In meinem Fall bedeutet es, meinem Gegner immer einen Schritt voraus zu sein. Immer. Ich renne schneller, ich schlage härter, ich denke um mehr Ecken, als ein Schachspiel Felder hat. Sie glauben mir nicht? Sollten Sie aber.
Aber Sie fragen sich jetzt bestimmt, wie es sein kann, dass ich diesen ungewöhnlichen Weg eines Privatermittlers gegangen bin und nicht wie meine Altersgenossen entweder tagsüber studiere, nachts feiere und ununterbrochen vom großen Geld und der unglaublichen Karriere schwadroniere, eine Ausbildung zum Klempner, Schreiner oder Fliesenleger gemacht habe und nun mit zwei Kleinkindern zu Hause sitze und Fußball auf Sky gucke oder gar zwischen Nadel und Joint pendle und rein gar nichts auf die Reihe bekomme. Die Antwort ist ganz einfach: Ich bin anders. Und das kommt nicht von ungefähr. Mein Onkel John ist Kommissar bei der Kripo. Er ist auch gut. Verdammt gut. Er bekommt immer die ganz harten Sachen auf seinen Schreibtisch. Schwerste Verbrechen. Serienkiller. Glatzköpfige Mafiosi mit mehr Waffen am Körper als Haare auf dem Kopf – solche Typen buchtet Onkel John reihenweise ein. Beim Abendessen erzählte er immer davon. Anders als Tante Betty konnte ich gar nicht genug von seinen Geschichten hören. Meine Tante hat sich immer die Ohren zugehalten und ist in die Küche geflüchtet, Onkel John hat herzhaft gelacht – und weitererzählt. Ich habe auch gelacht – und ihm weiter zugehört. Irgendwann, einen genauen Zeitpunkt kann ich gar nicht benennen, stand für mich fest, dass ich werden wollte wie er – nur noch besser.
Heute weiß ich, dass das Erzählen wichtig für ihn war. Es war sein Weg, Druck abzulassen, dem Abschaum, mit dem er sich tagein, tagaus herumzuschlagen hatte, das Grauen zu nehmen. Indem er alles zu Abenteuergeschichten umdichtete, hat er den Schrecken von seiner Seele genommen, wie ein Staubsauger die Krümel aus dem Teppich saugt. Manchmal geht es mir ähnlich. Dann schreibe ich. Ich setze mich an meinen Schreibtisch in meinem Büro im vierten Stock, habe einen hervorragenden Pu-Erh-Tee, optimal temperiert versteht sich, neben mir stehen, dessen Duft meine Fantasie sofort beflügelt. Ich genieße für ein paar Augenblicke die Aussicht über die Elbmündung, nehme dann die Kappe von meinem Füllfederhalter ab und schreibe. Ich schreibe mir von der Seele, was mich bedrückt und belastet. Ich schreibe per Hand – das halte ich für wichtig –, denn nur so können die schlechten Gedanken wirklich aus mir herausfließen. Später, meist auf dem Heimweg, mache ich einen Abstecher zum Strand und verbrenne die beschriebenen Seiten in einem Loch im Sand. Erst dann bin ich wirklich gereinigt. Ich verstehe gar nicht, warum andere über Jahre zu meditieren lernen, zu buddhistischen Mönchen in den Himalaya reisen oder zu Urvölkern im Amazonasbecken. Aufschreiben, verbrennen – fertig. CCPS, so einfach ist das.
Aber ich schweife ab. Versetze ich mich in Sie, kenne ich schon Ihre nächste Frage: Wie kommt es, dass so ein Pfundskerl bei Onkel und Tante lebt? Nun, „Pfundskerl“ ehrt mich. Obwohl es natürlich auch nicht falsch ist. Ich habe schon etwas auf dem Kasten. Mit Onkel und Tante – das kam so: Die ersten Jahre nach meiner Geburt habe ich natürlich bei meinen Eltern gelebt, wie jeder normale Sohn in einer normalen Familie. Oder Tochter, aber ich war ja nun einmal der Sohn. Dann geschah die Katastrophe: Meine Mutter Angela starb bei einem Autounfall. Details habe ich nie erfahren und jetzt möchte ich es auch nicht mehr wissen. Es ist Vergangenheit, die selbst ich nicht mehr ändern kann. Mein Vater, Michael hieß er, ist nie über den Verlust seiner geliebten Angela weggekommen. Er hat sich in seine Arbeit gestürzt, war Manager bei irgendeinem Großkonzern. Er war immer auf Reisen, es war wohl sein Weg, dem Kummer zu entfliehen. Wenn er weg war, blieb ich bei Onkel John und Tante Betty. Seine Reisen wurden immer länger, irgendwann nahm er eine Stellung im Ausland an und ließ mich bei den Verwandten. Ich glaube, er hat mich vergessen. Und ich ihn auch. Er war ja nie da. Heute habe ich kein Interesse mehr an diesem Menschen. Tante und Onkel sind mir zu Mutter und Vater geworden. Onkel John, der Kommissar, wurde mein stiller Mentor. Und ich wurde ich – der, der ich jetzt bin: Coro, der eisenharte Privatermittler.
Gerade erscheinen mir wieder die Bilder meines letzten Falls vor Augen. Das war eine Sache! Also, als ich –
Die Tür flog mit einem Schwung auf und Tante Bettina stand im Rahmen. Wie immer trug sie ein geblümtes Kleid, hatte sich eine Schürze umgebunden und wippte mit dem Kopf leicht hin und her, sodass ihre zu einem Dutt aufgebundenen grauen Haare bedrohlich schwankten. Beide Arme hatte sie in die Hüfte gestemmt.
„Konrad Georg Brichtner“, intonierte sie mit ihrer hohen, fast piepsigen und so gar nicht zu ihrer ausladenden Körperform passenden Stimme. „Sitzt du auf den Ohren oder ignorierst du mein Rufen absichtlich?“
Der junge Mann an dem alten, abgewetzten Schreibtisch ließ vor Schreck seinen Bleistift fallen. „Ich –“
„Ich sehe schon. Du träumst vor dich hin.“ Tante Bettina lachte. „Jetzt komm schon nach unten. Onkel Johann und ich warten. Das Abendessen steht auf dem Tisch. Frisches Labskaus.“
Beflissen sprang Konrad auf und folgte seiner Tante. Die Stufen der Holztreppe in dem alten Haus knarzten vernehmlich. An manchen Tagen fürchtete Konrad, die Treppe würde einfach einstürzen, aber sie hielt doch immer stand. So dünn wie er war, stellte er selbst für die Stabilität der Treppe kein ernstzunehmendes Risiko dar, nur bei seiner Tante sah dies deutlich anders aus.
Onkel Johann saß bereits am Esstisch in der gemütlichen Wohnküche. Die über dem Esstisch hängende Lampe – ein antiquiertes Modell mit gewelltem Milchglasschirm – spendete gelblich-warmes Licht. Der stämmige Mann mit kahlem Schädel und Vollbart, der sich gerade eine große Portion auf seinen Teller lud, wirkte eher wie ein früh gealterter Hipster aus der Bartshampooreklame denn wie ein Kripobeamter kurz vor seinem Ruhestand.
„Setz dich, mein Junge.“ Ein zufriedenes Lächeln zog sich über sein Gesicht, als er Konrad sah. „Greif zu. Deine Tante hat sich wieder einmal selbst übertroffen.“
„Johann, rede keinen Unsinn“, wehrte sich die Tante gegen das Kompliment. Ihre Wangen waren dennoch ein wenig rot angelaufen.
„Wow, Labskaus.“ Konrad mühte sich, die Mundwinkel nach oben zu ziehen oder aber mindestens in die Waagerechte zu bekommen. Er ließ sich auf seinen Stuhl fallen, der dies sofort mit einem bedenklichen Knirschen quittierte. Der Hamburger Küchenklassiker gehörte nicht unbedingt zu seinen Lieblingsgerichten. Aber auch wenn ihm Currywurst mit Pommes wesentlich lieber waren, musste Konrad zugeben, dass Tante Bettinas Zubereitung trotzdem akzeptabel war.
„Wie war’s an der Uni?“, erkundigte sich Onkel Johann mit vollem Mund.
Tanta Bettina drehte sich am Ofen um. „Ich kann es noch immer nicht glauben, dass du studierst. Wie heißt das doch gleich? Biotechnologie der –“
„Marinen Ressourcen“, beendete Konrad den Satz. „Aber ich bin mittlerweile schon im vierten Semester. Das ist wirklich nichts Neues mehr.“
„Papperlapapp.“ Die Tante wedelte mit dem Kochlöffel durch die Luft. „Für mich klingt das alles noch ebenso gut wie an deinem ersten Tag. Wie schön wäre es nur gewesen, hättest du direkt nach dem Abitur das Studium begonnen. Du wärest schon fertig. Mit Titel und so.“
Konrad verdrehte die Augen. So sehr er seine Ersatzeltern auch liebte, er konnte diese Diskussion nicht mehr hören. „Habe ich aber nicht. Das freiwillige ökologische Jahr im MoorInformationsZentrum in Wanna war super, ich habe da auch verdammt –“
„Du sollst nicht fluchen“, fuhr ihm Tante Bettina in seine Erklärung. Im nächsten Moment lächelte sie jedoch schon wieder.
„‘tschuldigung“, stammelte Konrad. „Da habe ich so viel gelernt.“
„Ich weiß.“ Tante Bettina tätschelte seine Schulter. „Die Ausbildung als Schiffsmechaniker hat dir ganz bestimmt auch gutgetan. Aber so lange weg, auf See? Fast ein Jahr.“
„Nun lass aber mal gut sein“, unterbrach Onkel Johann den verbalen Klammergriff seiner Frau. „Der Junge muss seinen eigenen Weg gehen. Punkt.“
„Genau“, stimmte Konrad zu. „Eigentlich hätte ich ja auch zur Polizei gewollt.“
„Unfug“, unterbrach ihn Onkel Johann. „Du lernst etwas Vernünftiges. Sieh mich an.“ Er machte eine ausladende Geste, die sich und seine ganze Welt umfassen sollte. „Ich bin nur noch ein Dinosaurier und verstaube am Schreibtisch. Willst du so enden?“
Konrad schüttelte ungläubig den Kopf. „Aber du hast reihenweise Ganoven eingebuchtet.“
Onkel Johann machte eine abschätzige Handbewegung. „Das ist alles lange her. Heute wollen mich die jungen Schnösel nicht mehr dabeihaben. Und dieses ganze Gewurstel – Handys, online, Daten –, das sollen die auch mal schön selbst machen. Richtige Ermittlungsarbeit fand früher auf der Straße statt, nicht in irgendwelchen Netzen.“
Konrad schüttelte den Kopf. „Erzähl doch noch mal. Wie war das damals mit Tampen-Tammo?“
„Ha, Tampen-Tammo“, Onkel Johann ließ den Zeigefinger wie einen Dolch auf Konrad zu schießen, als wollte er ihn durchbohren. „Das war eine Nummer. Der Typ hat rund um den Hafen willige Frauen abgeschleppt und sie später mit einem Tampen erdrosselt. Sechsmal hat er zugeschlagen, bevor wir ihm das Handwerk legen konnten.“
„Wie hast du ihn überführt?“, fragte Konrad.
Onkel Johann antwortete nicht sofort, da er sich gerade eine volle Gabel in den Mund geschoben hatte.
„Solche Geschichte gehören wirklich nicht an den Essenstisch“, nutzte Tante Bettina ihre Chance zur Intervention. Johann zog die Schultern hoch. Was sollte er machen?
„Wenn ich meinen Abschluss habe“, erklärte Konrad, „werde ich auch Ermittler. Umweltermittler – ich habe mir das genau überlegt.“
Tante und Onkel sahen ihn mit hochgezogenen Brauen an. „Wie soll das gehen?“
Das war der schwierige Punkt, musste sich Konrad innerlich eingestehen. Denn trotz seiner vollmundigen Ankündigung wusste er es nicht. Aber er würde es zu gegebener Zeit herausfinden. Eine Art von Grundstein hatte er immerhin schon gelegt. Ob sich darauf aufbauen ließ, würde sich zeigen.
Wie zur Bestätigung läutete sein Handy, das er in der Hosentasche mit sich herumtrug.
„Du sollst das verdammte Ding nicht –“
„Du sollst nicht fluchen“, erinnerte Konrad seine Tante grinsend und stand auf. „Tut mir leid, das ist wichtig.“
Der junge Mann stürmte die Treppe nach oben, immer zwei Stufen auf einmal nehmend. Das Handy hatte er bereits am Ohr. „Ja?“
„Verdammt, wo bleibst du?“, ranzte ihn eine raue Stimme an. „Ich habe doch gesagt, du sollst um sieben da sein.“
„Oh.“ Konrad blickte auf den Digitalwecker auf seinem Nachttisch, den er vom Türrahmen aus sehen konnte. „Bin in zehn Minuten da.“
Missbilligung klang aus dem Telefon. „Was bist du bloß für ein Vogel. Ich hätte einen echten Privatdetektiv anheuern sollen, keinen Amateur.“
„Ich bin ein echter Privatdetektiv.“ Konrad versuchte, möglichst entrüstet zu klingen. „Ein anderer Fall hat mich aufgehalten.“
„Quatsch nicht rum, schieb deinen Arsch hierher.“ Damit war das Gespräch beendet.
„Blöder Affe“, brummte Konrad. Er ließ sich auf den Stuhl an seinem Schreibtisch fallen und starrte ins Leere. Ohne es zu bemerken, griff er nach dem Stift und ließ ihn über das Papier gleiten.
„Connor, wann kommst du endlich? Die Sache brennt mir wirklich unter den Nägeln. Ich weiß, du bist ein vielbeschäftigter Mann und hast alle Hände voll zu tun. Aber ich brauche dich hier, lange kann ich das nicht mehr durchhalten, dann haben sie mich in die Knie gezwungen. Ich brauche den Besten. Ich brauche dich.“
„Entspann dich, Mann“, antwortete ich. „Connor Royce Brichton ist bereits auf dem Weg. CCPS – das weißt du ja. Hast du die Kohle? Für Nüsse arbeite ich nicht. Und immer im Voraus. Alles klar?“
„Natürlich! Kleine Scheine, genau wie du es wolltest.“
„Blöder Affe“, wiederholte Konrad. Den Stift legte er auf seinen Block. Aus dem Kleiderschrank zog er seine Jeansjacke hervor und zog sie über. Die Jacke war schon so alt, dass sich der Jeansstoff wie edles Gewebe an seine Schulter schmiegte, die Löcher an beiden Ärmeln wirkten wie von Nobeldesignern entworfen. Konrad fühlte sich wohl. Sein Handy steckte in der Hosentasche, eine digitale Spiegelreflexkamera mit einem 200-mm-Objektiv hängte er sich über die Schulter. Fast wäre sie von seinen dürren Knochen abgerutscht, mit einem beherzten Griff konnte er Schlimmeres verhindern.
„Wo willst du denn um diese Uhrzeit noch hin?“, rief Tante Bettina ihm aus der Küche zu, als Konrad die Haustür öffnete.
„Nun lass den Jungen.“ Onkel Johann stellte sich schützend vor die Pläne seines Neffen, auch wenn ihm die Details unbekannt waren.
„Es ist erst sieben Uhr“, verteidigte sich Konrad.
„Aber komm nicht so spät nach Hause.“
„Nein, Tante Bettina, bestimmt nicht.“ Konrad zog die Tür hinter sich zu und atmete auf. Mit schnellen Schritten war er am Schuppen neben dem Haus.
„Scheiße“, stöhnte er dann und beugte sich zum platten Hinterrad seines Fahrrads herunter. Das Ventil war abgeschraubt worden. „Connor würde dich mit einer Dachlatte vermöbeln, du kleine Ratte.“
„Wer ist Connor?“ Hinter ihm stand die kleine Ratte: Frank Grau. Ein stämmiger Fünfzehnjähriger – der schlecht erzogene Schrecken der Straße und von seinen unterwürfigen Freunden in der Nachbarschaft nur Bully genannt – hielt das Ventil in der Hand und grinste Konrad herausfordernd an.
Konrad griff zu, doch der Junge war schneller. „Gib her. Ich hab’s eilig.“
„Wer ist Connor?“, wiederholte Frank seine Frage und strich sich mit der freien Hand durch die Stoppelhaare.
„Das geht dich nichts an.“
Mit einer blitzschnellen Bewegung schleuderte Frank das Ventil von sich weg. Es flog in hohem Bogen durch die Luft und verschwand in irgendwelchen Büschen.
„Blöder Clown“, schimpfte Konrad.
„Hähä“, äffte Frank, drehte sich um und rannte weg. Konrad wollte hinterher, aber die Kamera rutschte von seiner Schulter, und außerdem erinnerte er sich siedend heiß daran, dass Harro Hansen auf ihn wartete – noch schlechter gelaunt als gerade noch am Telefon, wie er aufgrund seiner immer größer werdenden Verspätung folgerte.
Fünfzehn Minuten später lief Konrad atemlos in Duhnen auf die Strandpromenade. Harro Hansen stierte ihn böse an und tippte dabei mit dem Zeigefinger auf seine Armbanduhr. „Verdammt spät.“
Konrad brauchte ein paar Sekunden, um zu Atem zu kommen. „Es ist noch hell, da passiert jetzt sowieso noch nichts.“
„Keine faulen Ausreden“, konterte Hansen. Er stellte sich noch ein wenig breitbeiniger hin als sonst und griff sich demonstrativ in den Schritt. „Sieben Uhr heißt sieben Uhr. Wenn ich mich auf dich nicht verlassen kann, suche ich mir einen anderen.“
„Steck dir doch deine abgebrannten Strandkörbe sonst wohin“, murmelte Konrad.
„Was hast du gesagt?“
„Nichts“, sagte Konrad lauter. „Kommt nicht wieder vor.“
„Dann los“, beschied ihm Hansen. „Und bringe Ergebnisse. Sonst kürze ich dein Honorar.“
Mit hängenden Schultern und gesenktem Blick machte sich Konrad auf den Weg zum Strand. In diesem Abschnitt standen die blau-roten Strandkörbe der Strandkorbvermietung Hansen und Söhne. Vor ein paar Tagen hatte sich Hansen über Facebook bei Konrad gemeldet, der dort eine Seite betrieb, auf der er seine Dienste als privater Ermittler für Untersuchungen unterhalb des Niveaus der Polizei anpries. Hansen hatte ihm geklagt, dass wiederholt seine Strandkörbe des Nachts aufgebrochen, die Sitze zerschnitten und sogar angezündet wurden. Die Polizei würde rein gar nichts unternehmen. Unglaublich. Er hatte Konrad beauftragt, sich der Sache anzunehmen, bei minimaler Vergütung natürlich – und heute war der erste Einsatztag.
Bis zum Sonnenuntergang würde es wohl noch anderthalb Stunden dauern. Es war ein schöner, warmer Tag gewesen. Ein leichter Wind aus Südwest hatte vereinzelte Schäfchenwolken über den Himmel getrieben. Im Moment näherte sich das auflaufende Wasser dem Höchststand. Noch immer waren Spaziergänger auf der Promenade und unten am Strand unterwegs, vereinzelt tummelten sich noch abgehärtete Badewütige im Wasser. Weiter draußen konnte Konrad eine ganze Reihe riesiger Containerschiffe sehen, die mit dem auflaufenden Wasser Hamburg entgegenstrebten.
Konrad suchte sich ein ruhiges Plätzchen, von dem aus er sowohl das Strandkorbareal Hansens als auch den Schiffsverkehr auf der Elbe gut beobachten konnte, ohne selbst auf den ersten Blick entdeckt zu werden. Der Platz bedeutete für ihn gleich doppelte Tarnung: Er wurde nicht zu schnell entdeckt, und falls doch, konnte er sich – dank der mitgebrachten Kamera – geschickt als Fotograf ausgeben, der die maritime Romantik samt Sonnenuntergang im Bild festhalten wollte. Aber natürlich auch potenzielle Strandkorbvandalen. Er zog einen kleinen Schreibblock und einen Stift hervor, die er in einer Tasche immer bei sich trug.
So sieht es also aus – Connor Royce im Einsatz. Mit Adleraugen und für die Umwelt unsichtbar, dank exzellenter Tarntechniken. Verschmolzen mit dem Sand des Bodens, nicht auszumachen gegen den Horizont. Hellwach und unbesiegbar.
„Das FBI-Handbuch über verdeckte Ermittlungstaktik, das ich mir über ein paar zwielichtige Kanäle im Internet beschafft habe, ist wirklich jeden Cent wert.“ Ein lobendes Selbstgespräch ist auch immer gut – ganz besonders im Laufe einer Undercover-Operation.
Außer dem Umstand, dass langsam die Dämmerung einsetzte, geschah in der nächsten Stunde nichts. Konrad begann der Magen zu knurren – das Abendessen hatte er ja mehr oder weniger abgebrochen – und er ärgerte sich, nichts Ess- und Trinkbares mitgebracht zu haben.
„Mensch, Kon, was machst du denn hier?“
Die Stimme schreckte Konrad aus seinen Gedanken über die schlechte Vorbereitung dieser Unternehmung. Vor ihm stand Jantje Schulte-Meier, eine Kommilitonin, die ebenfalls in Cuxhaven wohnte und wie er selbst zur Fachhochschule nach Bremerhaven pendelte. Konrad hatte mal überlegt, mit ihr eine Fahrgemeinschaft zu gründen, hatte dann aber nicht den Mut gefunden, sie anzusprechen. Auf ihn wirkte sie wie eine junge Frau, die mit Typen wie ihm eher nichts am Hut hatte. Wie eine, die auf coole Jungs und Party stand. Außerdem war sie mit Sebastian Karschullski zusammen, einem muskelbepackten Riesen mit viel Hohlraum zwischen den Ohren und schlechten Manieren, der – wie auch immer er das geschafft hatte – ebenfalls in Bremerhaven studierte.
„Ich fotografiere“, nuschelte Konrad verlegen.
Jantje strich sich eine blonde Strähne aus dem Gesicht, ließ sich neben ihn in den noch von der Sonne warmen Sand fallen und streckte sich. Dabei gab sie Geräusche von sich, die Konrad leichte Röte ins Gesicht schießen ließen. „Das sehe ich. Aber was fotografierst du?“
„Ich …äh …“ Konrad wusste nicht, was er darauf antworten sollte. Die Wahrheit über seinen Auftrag konnte er ihr wohl kaum erzählen.
Jantje blickte ihn neugierig an. „Ich mache dich nervös, was?“
„Äh … ich“, gab Konrad eine alternative Version seines Satzes von Sekunden zuvor zum Besten.
Sie lachte. „Schon verstanden. Aber ich glaube, du liegst falsch. Ich komme gern abends hier an den Strand, wenn es nicht mehr so voll ist. Basti ist beim Training und geht danach mit seinen Kumpels noch ein Bier trinken.“
Sie sah ihn herausfordernd an.
Konrad wusste nicht, was er sagen sollte. Zwischen Hirn und Mund klaffte ein Abgrund, den er nicht zu überwinden wusste.
„Es ist schön, mal jemanden zu treffen, den ich kenne und der sehr wahrscheinlich etwas anderes im Kopf hat als Party, Training oder Bier.
Sie reckte ihre langen Beine. „Fotografieren finde ich toll. Besondere Augenblicke dauerhaft festzuhalten, sie später mit den Bildern wiederaufleben zu lassen, das hat etwas. Leider kann ich es nicht, meine Bilder sehen immer ganz fürchterlich aus.“ Sie warf einen Blick auf Konrads Kamera.
Konrad malte mit dem Finger Striche und Kringel in den Sand. „Soll ich es dir zeigen?“
„Wirklich?“ Sie blickte ihn von der Seite an. Ihre strahlend blauen Augen hatten auf Konrad die gleiche Wirkung wie sengende Wüstensonne in der Mittagszeit – sein Mund trocknete augenblicklich aus, ließ seine Worte zu Staub zerfallen.
Er nickte nur, da er sicher war, sowieso keinen Ton herauszubekommen, würde er den Mund aufmachen.
„Super.“ Jantje lachte ihn an. „Ich kann gut mit Computern umgehen. Wenn du mal Hilfe brauchst.“
„Aber Sebastian“, brachte Konrad den dümmsten aller denkbaren Einwände heraus.
„Ach was, ich bin doch nicht sein Eigentum“, baute ihm Jantje eine Brücke. „Auch wenn er das manchmal denkt.“
„In Gedanken notiert“, krächzte er.
„Aber heute nicht mehr.“ Jantje sprang auf. „Ich muss zurück. Anna will gleich noch vorbeikommen. Wir wollen uns noch einmal die Mikrobiologie-Kapitel ansehen, um bei der Klausur in der übernächsten Woche nicht völlig unterzugehen.“
„Okay.“ Mehr fiel Konrad nicht ein. Gerne hätte er ihr noch so vieles gesagt, nur war sein Hirn immer noch wie leergefegt. Nie im Leben hätte er sich vorstellen können, hier zusammen mit Jantje im Sand zu sitzen. Er hatte sie immer für eine dieser zwar attraktiven, aber arroganten Tussis gehalten, die von Charakter keine Ahnung hatten und nur auf Äußerlichkeiten achteten. Wie zum Henker würde man auch sonst mit einem Typen wie Karschullski zusammen sein wollen – oder können? „Vielleicht ist sie doch ganz anders“, flüsterte er leise zu sich selbst. Die Mikrobio-Klausur machte ihm keine Sorgen. Das Thema fand er spannend und er hatte das Lehrbuch bereits nach dem ersten Drittel der Vorlesungsreihe verschlungen.
Eine Gruppe Teenager riss ihn aus seinen Gedanken, die, mit Bierflaschen, Zigaretten und gefüllten Pommesschalen bewaffnet, zwischen den Strandkörben hin und her liefen. Alle trugen dunkle Hoodies mit bunten Aufdrucken, kombiniert mit kurzen Hosen. Es waren vier Jungs – alle mit identischem Haarschnitt, den Konrad schon einmal in der Sportschau bei irgendwelchen bekannten Fußballern glaubte gesehen zu haben – und zwei Mädchen. Sie waren zwischen fünfzehn und siebzehn Jahre alt, schätzte Konrad. Er hob seine Kamera hoch und beobachtete, wie einer der Jungen an den Strandkorbgittern rüttelte. Nichts geschah, die Gitter hielten. Konrad zoomte den Jungen heran und drückte den Auslöser. Es klickte, das Bild war im Kasten. Sollten das die Randalierer sein? Er war sich nicht sicher.
Der Junge marschierte zum nächsten Strandkorb, rüttelte erneut am Gitter – wieder erfolglos. Eines der Mädchen kam zu ihm und tat es ihm nach. Wie Konrad es erwartet hatte, blieb auch bei ihr der Erfolg aus, allerdings fiel ihr die Bierflasche aus der Hand. Sie lachte schrill auf und stürzte bei dem Versuch, die Flasche aufzuheben, bäuchlings in den Sand. Abermals klickte die Kamera. Das Mädchen giggelte und spuckte Sand aus, der Junge lallte, bald standen sie wieder auf den Füßen und torkelten zum nächsten Strandkorb.
Konrad legte die Kamera zur Seite. „Das sind die falschen. Besoffen zwar, aber harmlose Idioten.“
Er wartete weiter. Die Zeit verging, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Die Dämmerung war zwischenzeitlich der Dunkelheit gewichen. Das Hungergefühl hatte er überwunden und vergessen. Der Strand war menschenleer, vereinzelt liefen noch Leute über den Deich, was auf der Promenade dahinter geschah, konnte Konrad nicht sehen. Er erhob sich, um sich die eingeschlafenen Beine zu vertreten. Nach ein paar Schritten beschloss er, zum Wasser hinunterzulaufen und von dort aus die Strandkörbe weiterzubeobachten. Wieder verging die Zeit, wieder geschah nichts. Insgeheim bereute er es bereits, den Auftrag angenommen zu haben – es würde eine langwierige und vor allem langweilige Angelegenheit werden. Aber er stand ja auch noch ganz am Anfang seiner Karriere als Privatermittler – da musste er wohl oder übel nehmen, was ihm angeboten wurde.
Mal wanderte Konrad am Flutsaum entlang, mal setzte er sich auf seinen Beobachtungsposten. Mitternacht kam, der neue Tag begann. Konrad fielen fast die Augen zu, als er sich anderthalb weitere Stunden später entschied, die Aktion abzubrechen und nach Hause zu gehen. Er rechnete nicht mehr damit, dass hier und jetzt noch etwas geschehen würde.
Auf dem Rückweg würde er noch ein wenig am Wasser entlanggehen, vorbei am nun geschlossenen Restaurant Leuchtfeuer und dem Strandbistro Duhner Spitze bis hin zum FKK-Strand. Das wären zwar noch einige Meter, aber trotz der Müdigkeit hatte Konrad Lust bekommen, durch Nacht und Einsamkeit zu laufen.
Kapitel 2
Konrad schlenderte an der Wattkante durch die Dunkelheit. Da es trotz der Uhrzeit noch angenehm warm war, hatte er die Sandalen ausgezogen und ließ sich die seichten Wellen über die Füße schwappen. Gedanken plätscherten durch seinen Kopf. War es wirklich eine gute Idee, Privatermittler werden zu wollen? War das in Deutschland überhaupt möglich? Sollte er sich nicht lieber voll auf sein Studium konzentrieren und sich danach einen soliden Job suchen – ganz so, wie es sich Tante Bettina und Onkel Johann von ihm wünschten?
„Um wessen Zukunft geht es eigentlich?“, fragte er sich selbst. Hier am Strand konnte er seine leisen Selbstgespräche führen, ohne dass ihn jemand deswegen schräg von der Seite ansah. „Es ist meine Zukunft. Aber Tante Bettina und Onkel Johann sind älter, haben mehr erlebt, konnten ihre Erfahrungen machen.“
Er wandte sich nach rechts und ging ein wenig tiefer ins Wasser. Die kühlen Wellen wogten ihm über die Knie und durchfeuchteten den Saum seiner kurzen Hose. „Verdammt, alle wollen nur mein Bestes. Und ich? Ich will meine eigenen Erfahrungen machen, auch wenn es länger dauert.“
Mit dem rechten Bein kickte er durch das Wasser, als wollte er einen imaginären Fußball wegschießen. Es spritzte in alle Richtungen. Sein Blick folgte den Spritzern, bis er in den Himmel blickte. Unzählige leuchtende Punkte standen dort am Firmament, unbeweglich, unerschütterlich, seit Milliarden von Jahren.
„Scheiß drauf“, brummte Konrad. „Ich muss meine eigenen Erfahrungen machen. Ein bisschen habe ich ja schon und jetzt kommt noch einiges dazu.“
Der Strand ging langsam in eine Salzwiese über. In der Dunkelheit konnte Konrad zwar keine der dort wachsenden Pflanzen erkennen, aber er wusste, dass er dort die buschige Salzmelde, die langen Halme des Strandhafers, ein paar Strand-Platterbsen mit leuchtend violetten Blüten, die dicht am Boden wachsende und nur fingerhohe Salzmiere und direkt am Wasser das Andelgras und den wie kleine Kakteen anmutenden Queller vorfinden würde. Er war schon oft hier gewesen, an der Grenze des tagsüber von Touristen überfluteten Sandstrandes und dem Duhner Anwachs.
Mit schnellen Schritten verließ Konrad das Wasser wieder und marschierte den Strand hoch.
„Was ist das denn?“ Erstaunt blieb er stehen und starrte auf das Auto, das nur wenige Meter von ihm entfernt im Sand stand. Ein Golf älteren Baujahrs mit Kennzeichen aus Cuxhaven. Verärgert ging er auf den Wagen zu. Mussten diese Dorschköppe wirklich auch noch bis auf den Strand fahren? Was war so schwierig daran, die paar Meter vom Parkplatz zu Fuß zu gehen? Er klopfte an das dunkle Seitenfenster und rechnete damit, zuerst einen gedämpften spitzen Schrei zu hören und dann, nachdem das Fenster heruntergelassen worden war, eine junge Frau zu erblicken, die hektisch ihre Bluse richtete, und einen Kerl, der ihn böse als Spanner beschimpfte und gleichzeitig versuchte, seine Hose hochzuziehen.
Doch nichts dergleichen geschah. Im Wagen regte sich nichts. Konrad presste sein Gesicht an das Glas und schirmte es mit seinen Händen ab, um besser sehen zu können.
Was er sah, ließ ihn augenblicklich zurücktaumeln.
„Scheiße“, entfuhr es ihm.
Ohne weiter darüber nachzudenken, zog er am Türgriff und die Beifahrertür des Golfs schwang ohne jedes Geräusch auf. Ein Körper fiel aus dem Wagen heraus.
Konrad schrie einmal kurz auf – diese Art von spitzem Schrei, den er eigentlich nur Augenblicke zuvor von jemandem aus dem Wageninneren erwartet hatte – und stürzte rücklings in den Sand. Mit hektischen Bewegungen versuchte er, von dem Körper, der ganz offensichtlich der eines Mannes war, wegzurobben. Aber er rührte sich nicht vom Fleck, schaufelte nur Sand, konnte seinen Blick nicht von dem anderen lösen.
Der Oberkörper ragte aus dem Wagen heraus, ein Arm baumelte nach unten, die zugehörige Hand strich durch den Sand. Der Kopf hing schief zur Seite, sodass Konrad das Gesicht nicht sehen konnte. Die Beine des Mannes klemmten im Wageninneren fest, wodurch der Körper zunächst in dieser Position verharrte. Doch dann siegte das Gewicht von Kopf und Oberkörper und der Mann stürzte aus dem Fahrzeug heraus, nur die Beine hingen nach wie vor im Fußraum fest. Er fiel geräuschlos auf den Boden, rollte auf die Seite. Zwei leere, gebrochene Augen starrten Konrad an.
Nur ein knapper Meter des feinen Duhner Sandes trennte Konrad und den unbekannten Toten. Er schloss die Augen, presste die Lider zusammen, als hoffte er, nach dem Öffnen wäre der ganze Spuk vorbei. Aber das war er nicht – auch nachdem er die Augen wieder geöffnet hatte, lag der Tote noch immer neben ihm im Sand.
„Reiß dich zusammen! Was bist du für ein Waschlappen! Ein richtiger Ermittler wird sich doch nicht von einer Leiche im Sand ins Bockshorn jagen lassen. Das gehört zum täglich Brot. Steh‘ auf und tue, was Connor Royce jetzt machen würde. Schau dir die Sache genau an. Gewöhnlich stirbt man nicht vor Altersschwäche in einem Auto am Strand, und schon gar nicht mit einem kleinen roten Loch in der Stirn. Schau dir den Typen an. Denke, beobachte, kombiniere – ermittle gefälligst. Im wahrsten Sinne des Wortes fällt dir ein Fall vor die Füße, von dem du nur träumen kannst, und du steckst den Kopf in den Sand, du Pfeife. Krieg auf der Stelle den Arsch hoch, und wenn du alles gesehen hast, was du sehen kannst und sollst und musst, dann ruf die Bullen.“
Ein Ruck ging durch Konrad. „Steh‘ auf, du Pfeife“, motzte er sich selbst an.
„Hallo?“