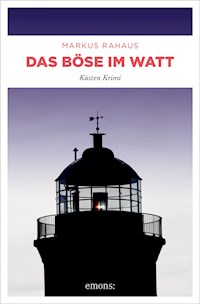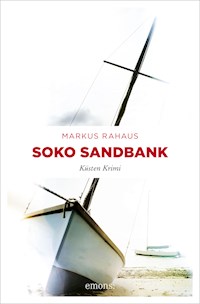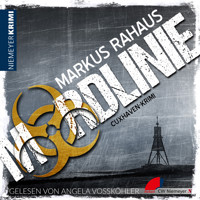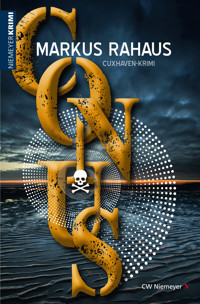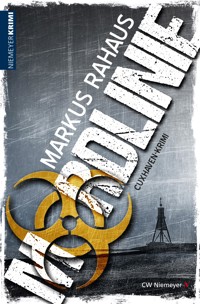Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ermittler-Duo Olofsen/Greiner
- Sprache: Deutsch
Kommissar Olofsen ermittelt in einem fesselnden Wissenschaftskrimi. Im Otterndorfer Watt wird eine Leiche gefunden, kurz darauf eine weitere auf der "Alten Liebe" in Cuxhaven. Die Ermittlungen führen die Kommissare Olofsen und Greiner zu einer Otterndorfer Biotechnologiefirma. Will man ein verunreinigtes Medikament auf den Markt bringen? Als plötzlich immer mehr Menschen an einer unbekannten Virusinfektion sterben, beginnt mitten in der Tourismushochburg Cuxhaven ein Wettlauf gegen die Zeit. Olofsen und Greiner müssen hinter die Kulissen der pharmazeutischen Industrie schauen, um eine Katastrophe zu verhindern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Rahaus wurde 1970 im nordrhein-westfälischen Herten-Westerholt geboren. Der habilitierte Virologe lebt und arbeitet in Cuxhaven. In seiner Freizeit beschäftigt er sich ausgiebig mit der Fotografie, veröffentlicht regelmäßig Artikel in Fachzeitschriften und zeigt seine Bilder im Rahmen von Ausstellungen und Vorträgen.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
©2018 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: mauritius images/dieKleinert/Hans Steen Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer Umsetzung: Tobias Doetsch Lektorat: Lothar Strüh eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-346-2 Küsten Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Nathalie und Yannicka
Prolog
Metall vibrierte, Ausrüstung klapperte in Aluminiumboxen. Die Rotorblätter des großen Helikopters der südafrikanischen Luftwaffe durchschnitten dröhnend und donnernd die Luft wie scharfe Messerklingen eine reife Wassermelone. Die Turbinen der Maschine heulten in einem gleichbleibend hohen Ton. Auf dem Flug von Lusaka in den Osten Sambias überflog der Hubschrauber gerade den langsam dahinströmenden Fluss Luangwa.
In der Kabine saßen vier Männer. Alle vier trugen unförmige gelborange Tyvek-Schutzanzüge. Die Hände steckten in doppelten Latexhandschuhen, deren Übergänge zu den Anzugärmeln mit breitem hellgelben Klebeband geschlossen waren. Auch die Schuhe waren Teil der Anzüge. Das tropisch warme Klima der Region wurde durch die Anzüge auf das Niveau eines Backofens verstärkt. Zwischen ihnen lagen transparente Kopfhauben aus Kunststoff, die sie unmittelbar nach der Landung am Zielort überstülpen und luftdicht verschließen würden. Dann würden auch Augen, Nase und Mund geschützt sein, da sie gefilterte Luft atmeten. Durch die Maske würden ihre Gesichtszüge kaum noch zu erkennen sein. Und die Hitze würde sich noch schlimmer anfühlen.
Durch die Fenster des Helikopters konnten sie die Miombo unter sich vorbeiziehen sehen– eine weitläufige, teils karge, leicht hügelige Baumsavanne. Vor ihnen wurde die Vegetation jedoch dichter, die Savanne ging in Wald über.
Plötzlich zog der Pilot die Maschine abrupt in die Höhe, die Passagiere im hinteren Teil klammerten sich an ihren Sitzen fest. Dann beruhigte sich der Flug wieder, die verkrampften Hände lösten sich langsam von den Sitzen.
Nach einer weiteren Flugstunde setzte die Maschine über einer kleinen Lichtung inmitten eines nun dichten Waldes zur Landung an, in der Nähe floss ein kleiner Fluss ruhig dahin. Kaum hatte die Maschine den Boden berührt, wurden die Türen aufgerissen, und die vier Insassen kletterten aus der Kabine. Mit geübten Griffen entluden sie ihre Ausrüstung, pro Person ein großer Metallkoffer mit gepolsterten Kanten, um die hermetisch dichten Anzüge nicht zu beschädigen. Alle vier trugen nun die Kopfhauben und hängten sich tragbare Sauerstoffsysteme um, durch die die Anzüge mit Atemluft versorgt wurden. Keiner von ihnen sagte ein Wort, obwohl sie über in die Anzüge integrierte Funkgeräte miteinander sprechen konnten.
Etwa einhundert Meter rechts von ihnen, am Rand der Lichtung, entdeckten sie die Reste eines kleinen Jagdlagers. Mehrere zusammengebrochene Zelte, deren Planen sich sanft im leichten Wind bewegten. In der Mitte des Lagers sahen sie eine ausgebrannte Feuerstelle, mehrere Kanister– wahrscheinlich mit Trinkwasser– und einige Aluminiumkisten. Neben einem der Zelte stand ein Campingtisch, darauf ein Funkgerät, das mit einer Autobatterie verbunden war. Kein Mensch war zu sehen, kaum ein Geräusch war zu hören, nur das leise Summen der Atemgeräte. Es schien, als wollte die Natur ihren Beitrag zu dieser bedrückenden Szenerie leisten, indem sie sich völlig still verhielt.
»Seht in den Zelten nach. Ich schaue mir die Ausrüstung an«, drang die verzerrte Stimme eines der Männer aus den Ohrhörern der anderen drei. Sie nickten und machten sich auf den Weg, jeder zu einem anderen Zelt.
»Leer«, lautete die knappe Information von einem der drei.
»Hier liegen zwei Leichen«, antwortete die zweite Stimme.
»Hier ist eine weitere.« Nummer drei hatte ebenfalls einen Blick in eines der Zelte geworfen.
»Nehmt die Proben, dann verschwinden wir«, kam die Anweisung. »In ein paar Stunden wird die Armee eintreffen und alles verbrennen. Hier am Funkgerät ist niemand. Ich sehe mich in der näheren Umgebung um, es waren vier Leute im Camp. Wie ist der Zustand der Leichen?«
Die drei Toten in den Zelten waren im Wesentlichen unversehrt. Keiner war von Tieren angefressen worden, aber die hier herrschende und durch die Zeltplanen noch verstärkte Hitze hatte bereits zu deutlichen Verwesungserscheinungen geführt. Insekten umschwirrten die toten Körper. Ohne ihre hermetisch dichten Anzüge wäre der Gestank kaum auszuhalten gewesen, daran bestand bei diesem Anblick kein Zweifel.
Die Zelte waren verwüstet, nichts stand an dem Platz, an dem man es vermutet hätte. Die Pritschen waren umgestürzt, der Inhalt eines Erste-Hilfe-Koffers verteilte sich über die Bodenplane. Überall war Blut und Schleim, wahrscheinlich auch Erbrochenes. Die Körper der Toten lagen in ungewöhnlich verkrampfter Haltung inmitten des Chaos. Einer der Männer im gelben Anzug drückte ohne jede Anteilnahme mit dem Fuß gegen den dort liegenden Körper. Die Leichenstarre hatte sich bereits wieder gelöst, und der Tote rollte, begleitet von einem schmatzenden Geräusch und einem dichten Schwarm entrüstet auffliegender Insekten, auf den Rücken. Seine offenen, aber leeren Augen waren tief eingefallen und blutunterlaufen. Die Gesichtshaut wirkte nekrotisch, die Wangen waren bis hinunter zum Halsansatz übersät mit dunkelbraunen bis schwarzen Flecken. Der Nacken war geschwollen, und offensichtlich hatte der Tote in feinen, nun getrockneten Rinnsalen aus Nase, Mund und Ohren geblutet.
Der Mann vor ihm ging in die Hocke, öffnete seinen Koffer und entnahm ihm eine in einen Sterilbeutel eingeschweißte Schere mit abgerundeten Spitzen. Vorsichtig schnitt er das Hemd des Toten auf, um den Oberkörper freizulegen. Auch dessen Brust war übersät mit dunklen Hautläsionen, aus einigen floss noch immer eine bräunliche Flüssigkeit.
Wieder griff der Mann in seinen Koffer und entnahm mehrere steril verpackte Tupfer. Er öffnete einen nach dem anderen und strich mit der wattierten Spitze über die geplatzten Läsionen, um ein wenig von der Flüssigkeit aufzunehmen. Anschließend steckte er jeden Tupfer in ein separates Kunststoffröhrchen, das er mit einem Schraubdeckel dicht verschloss.
Als Nächstes kamen drei Zwanzig-Milliliter-Spritzen zum Vorschein. Nachdem er jede der Spritzen mit einer der Kanülen bestückt und in jede Spritze einige Milliliter Heparin aufgezogen hatte, machte sich der Mann daran, der Leiche Blut abzunehmen– kein leichtes Unterfangen bei dem Zustand. Er zog die Kanülen ab, legte sie zur Seite, verschloss die Spritzen mit kleinen roten Plastikstopfen, verpackte sie in einen weiteren Sterilbeutel mit aufgedruckten Biohazard-Zeichen und legte sie zurück in den Koffer.
Ein letztes Instrument kam zum Vorschein. Ein knapp zwanzig Zentimeter langer Stab aus dunkelgrünem Kunststoff, ähnlich einem Kugelschreiber, mit einem rasiermesserscharfen, runden Stanzkopf mit einem Durchmesser von sechs Millimetern– eine Hautstanze zur Entnahme von Gewebeproben. Er setzte sie direkt neben eine der Läsionen auf der Brust des Toten und bohrte mit einer schnellen Drehbewegung den scharfen Kopf des Gerätes einige Millimeter tief in die Haut und das darunterliegende Gewebe. Die auf diese Weise gewonnene Biopsie gab er mitsamt der Edelstahlspitze in ein passendes Plastikröhrchen, das er wiederum in seinem Koffer verstaute.
Nach einem letzten Rundblick packte er seine Sachen zusammen und trat nach draußen.
Seine Kollegen hatten ebenfalls Proben bei den beiden Leichen im anderen Zelt genommen und traten unter dem Vordach hervor.
»Ich habe das vierte Mitglied der Gruppe gefunden«, kam es knisternd aus der Sprechanlage.
Die drei blickten auf und sahen ihren Anführer etwa hundertfünfzig Meter vom Lager entfernt am Ende der Lichtung stehen.
»Lebt er noch?«
»Nein, er ist genauso tot wie die Übrigen. Anscheinend hat er über sein Handfunkgerät die Ranger im Südluangwa-Nationalpark alarmiert und Hilfe angefordert. Die haben uns dann gerufen. Er muss da schon am Ende seiner Kräfte gewesen sein, das Funkgerät ist blutverschmiert. Wahrscheinlich ist er auf dem Weg zurück ins Lager zusammengebrochen. Er weist einige tiefe Bisswunden auf, ein Arm ist völlig zerfetzt, der linke Fuß fehlt, seine Augen auch.«
Ein erbärmliches Ende, aber die hiesige Tierwelt kannte keine Gnade.
»Okay, erspar uns weitere Einzelheiten«, sagte einer der drei. »Wir sollten zusehen, dass wir wegkommen.«
Die Männer bewegten sich zurück zum Helikopter, und nur wenig später verließ dieser den grausigen Ort.
»Habt ihr von jeder Leiche die Blutproben genommen?«, fragte einer der vier. »Wir sollen so schnell wie möglich von jedem der Opfer jeweils eine Probe zum CDC nach Atlanta und eine zu USAMRIID weiterschicken. Die Sondermaschine für den Weitertransport steht schon seit gestern Abend in Johannesburg bereit.«
Als Antwort erhielt er ein dreiköpfiges Nicken.
Zwei Tage später trafen sich abends dieselben vier Männer in der Lobby eines kleinen Hotels in Kapstadt. Sie hatten Sambia hinter sich gelassen, ihre gelben Anzüge gegen leichte, sommerliche und farbenfrohe Kleidung getauscht, und die Atemmasken waren abgenutzten Baseballcaps gewichen. Sie saßen in komfortablen, mit weichem Antilopenleder bezogenen Sesseln aus gediegenem dunkelbraunen Holz. Auf dem auf Hochglanz polierten Tisch vor ihnen standen schwere Gläser, zwei Finger hoch mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit gefüllt. Whisky. Schottisch natürlich.
»Jungs«, sagte derjenige, der schon vorher als Leiter der Gruppe aufgetreten war und als Einziger einen Anzug mit Krawatte trug. »Es war mir eine Freude und eine Ehre zugleich, endlich mal wieder der Einöde meines Büros zu entfliehen und zusammen mit euch noch einmal als Virenjäger an die Bazillenfront zu ziehen.«
Sie hoben ihre Gläser und nahmen einen Schluck, anschließend sprach er mit etwas rauerer Stimme weiter. »Sechs Jahre ist es jetzt her, dass ich zum letzten Mal die Möglichkeit hatte, im Feld dabei zu sein, wenn die Menschheit wieder von fiesen Viren bedroht wird und gerettet werden muss.«
Die anderen nickten und nahmen noch einen Schluck Whisky.
Dann hing jeder von ihnen seinen eigenen Gedanken nach, und Stille legte sich wie eine Decke über die Männer. Was bedeutete es schon, die Menschheit zu retten
EINS
Montag, 19.September. Für viele Menschen begann ein ganz normaler Abend. Sie saßen vor dem Fernseher, telefonierten mit Freunden oder gingen online, um zu chatten. Ein paar Jogger und Hundehalter waren am Strand unterwegs. Einige glutrote Wolken standen nach dem Sonnenuntergang noch am Himmel über dem kleinen Sandstrand von Otterndorf. Ein Segelboot lief langsam in den Hafen ein. Die Luft war klar, kein Dunst lag über dem Wasser der Elbe. Wer genau hinschaute, konnte die Umrisse der Küste von Schleswig-Holstein auf der anderen Seite des Flusses ausmachen. Im Moment herrschte noch ablaufendes Wasser, weite Wattflächen lagen frei, aber bald würde der Gezeitenstrom kentern und die Flut sich das Land zurückholen.
Seit einer Woche kam Holger mit seiner Hündin an den Strand, um noch ein bisschen Luft zu schnappen und am Ende eines langen Arbeitstages vor dem Laptop endlich noch ein wenig Bewegung zu bekommen. Lady, seine schwarze Labradordame, liebte es, durch das Watt zu rennen. Manchmal fegte sie wie der Blitz über den fast trockenen Boden, manchmal versank sie tief im Matsch. Holger wohnte eigentlich in einer kleinen Wohnung in Bremen, in der Nähe der Universität. Strand gab es dort logischerweise nicht, und er konnte mit seiner Hündin nur durch Parks oder Straßen laufen. Aber im Augenblick hatte er sich bei seiner Freundin Cornelia in Otterndorf einquartiert, um in Ruhe an einem Manuskript über seine neusten Forschungsergebnisse schreiben zu können. Er hatte gehofft, auf seinem abendlichen Spaziergang noch ein paar dicke Containerschiffe oder ein Kreuzfahrtschiff auf dem Weg nach Hamburg zu sehen.
Mit Freude beobachtete er Lady, wie sie Wasser und Schlamm spritzen ließ. »Lady, zurück. Zeit, nach Hause zu gehen!« Meist kam das Tier sofort, aber heute nicht. Da war wohl noch viel überschüssige Energie, die verbrannt werden musste. Noch immer jagte die Hundedame direkt an der Kante des Hafenpriels über das Watt, dachte überhaupt nicht daran, zu Herrchen zurückzukommen. Plötzlich wurde sie langsamer, drehte eine enge Runde und blieb stehen. Sie fing an zu schnüffeln und mit den Vorderpfoten im Schlick zu wühlen, direkt neben einer der langen Holzstangen, die das Fahrwasser markierten und bei Niedrigwasser frei standen.
»Hör auf und komm endlich.«
Aber Lady hörte nicht. Widerwillig marschierte Holger los, seine Hündin zu holen. »Was ist denn bloß los mit– oh Shit.« Direkt vor dem Hund ragte etwas über die Prielkante. Eine Hand. Die Hand eines Menschen.
»Oh Shit!«
Mit der linken Hand zog Holger den Hund am Halsband zurück, mit der Rechten stocherte er nervös in der Jackentasche nach seinem Handy.
***
Die Szenerie hatte etwas Gespenstisches. Bereits wenige Minuten nach Eingang des Notrufs bezüglich einer gefundenen Leiche war der erste Streifenwagen am Strand eingetroffen. Kurze Zeit später war der ganze Bereich bis zum Yachthafen abgesperrt. Einsatzwagen von Polizei und Feuerwehr standen auf dem sonst von Touristen bevölkerten Deichweg. Knapp hundert Meter ins Watt hinein hatten Mitarbeiter des ebenfalls herbeigerufenen Technischen Hilfswerks zwei Scheinwerfermasten errichtet, von dort strahlte kaltes Licht auf den Wattboden und die unzähligen Personen in Uniform und weißen Overalls, die dort einer Ameisenkolonie gleich herumwuselten.
»Bewegt euch endlich. Wir haben nicht die ganze Nacht Zeit«, bellte eine raue Stimme durch die angespannte Stille. »Wo zum Henker ist der Typ, dem wir das alles hier zu verdanken haben? Und sorgt gefälligst dafür, dass keine Touristen mehr über den Strand latschen und dumme Fragen stellen! Die sollen sich in ihre Ferienhäuser verziehen und Krabbenbrote mampfen.«
Obwohl er eigentlich heute einen freien Tag hatte, war Hauptkommissar Arne Olofsen schon vor Ort.
»Ich will mehr Licht haben. Und weniger Wasser. Und Matsche auch nicht, verdammt noch mal. Welcher Vollpfosten legt eine Leiche im Watt ab?«
Olofsen war für seine rustikale und sehr direkte Art bekannt. Aber er galt als guter Ermittler, was auch immer das für einen Kriminalpolizisten in Cuxhaven bedeuten mochte. Er war erst seit knapp zwei Jahren hier. Hatte sich aus Berlin über die Ländergrenzen hinweg an die Nordseeküste versetzen lassen. Warum und was er vorher gemacht hatte, lag irgendwie im Nebel. Neugierige Frager wurden gewöhnlich mit dem kurzen, aber prägnanten Hinweis, was sie ihn mal konnten, abgefertigt. Wenig überraschend fragte niemand mehr.
»Hier ist alles unter Kontrolle. Wenn du einen sinnvollen Beitrag leisten willst, setz dich irgendwohin und bau eine Sandburg.«
Martin Greiner, Olofsens Partner, war als Einziger in der Lage, dessen Launen zu bändigen, ohne Gefahr zu laufen, »an den Eiern an die Kugelbake genagelt zu werden«, wie sonst jedem angedroht wurde, der dumm genug war, ihm die Stirn zu bieten. Die beiden kannten sich schon lange. Auch hier wusste niemand Genaues. Greiner war zusammen mit Olofsen aus Berlin in den Norden gekommen.
Olofsen grummelte irgendetwas Unverständliches, blieb ansonsten aber ruhig.
»Wir haben noch knapp zwei Stunden Zeit, bis das auflaufende Wasser hier alles überflutet hat. Bis dahin müssen wir den Leichnam geborgen haben. Gelegenheit, ausführlich nach Spuren zu suchen, werden wir nicht bekommen«, erklärte Greiner. »Die Staatsanwaltschaft Stade hat bereits grünes Licht gegeben. Obduktion, das volle Programm.«
»Okay. Eigentlich wollte ich mich in meinen Schuppen zurückziehen und ein neues Bücherregal für Nele bauen.«
Nele war Olofsens sechsjährige Nichte, die er vergötterte. Und er selbst war ein begeisterter Hobbytischler, der seine gesamte Freizeit– sofern er welche fand– in seiner nahezu professionell eingerichteten Werkstatt verbrachte.
»Wo finde ich den Typen, der die Hand entdeckt hat?«
»Oben am Restaurant. Er saß vorhin am Rettungswagen. Du erkennst ihn an dem schwarzen Hund in seiner Begleitung.«
»Schwarzer Hund? Sind es nicht eigentlich schwarze Katzen, die Unglück bringen?«
»Wie’s scheint, ändern sich die Zeiten.«
Einige Augenblicke später hatte Olofsen den Mann entdeckt. Er war noch immer kreidebleich und klammerte sich an einen Kaffeebecher, als hinge sein Leben davon ab.
»Guten Abend. Mein Name ist Arne Olofsen, Hauptkommissar bei der Polizeiinspektion Cuxhaven. Ich leite die Ermittlungen hier vor Ort. Man hat mir gesagt, Sie hätten das Opfer im Watt gefunden.«
»Ja, das stimmt. Ich habe hier mit meinem Hund noch eine Runde gedreht. Wie jeden Abend. Aber meist nicht hier. Also, ich wohne in Bremen…«, stammelte der Mann. »Bin nur heute hier… fast zufällig. Oh mein Gott, so etwas habe ich noch nie erlebt…«
ZWEI
Cuxhaven, Dienstag, 20.September, vier Uhr morgens. Es war noch dunkel, auf dem Wasser im Hafen und an der Alten Liebe lag ein leichter Dunstschleier. Der Himmel war klar, und die Dämmerung ließ auf sich warten, sodass neben einem sichelförmigen Mond auch viele Sterne zu sehen waren. Fast kein Wind wehte, das Wasser der Elbe bewegte sich kaum.
Nächtliche Stille hüllte den Hafen ein, als drei Gestalten langsam an den fest vertäuten Ausflugsschiffen vorbeiliefen. Die weiß gestrichene Neuwerkfähre Flipper lag bewegungslos an der Pier. Zwei der Gestalten hatten die dritte in ihre Mitte genommen und schienen diese zu stützen, da sie selbst offenbar kaum mehr laufen konnte. Alle drei trugen dunkle Arbeitsanzüge, Masken über Mund und Nase, Handschuhe und Schutzbrillen. Zu dieser Uhrzeit waren sie allein in diesem sonst besonders von Touristen viel besuchten Teil des Hafens. Knapp eine Minute später hatten sie die Alte Liebe, die hölzerne Galerie, die den Hafen vom Elbfahrwasser abgrenzte, erreicht. Sie begaben sich sofort auf die obere Aussichtsplattform. Auch dort waren sie allein. Erst in einigen Stunden würden Scharen von Besuchern die Plattform bevölkern, um den Schiffen auf der Elbe sehnsüchtige oder hoffnungsvolle Blicke nachzuwerfen.
Die zwei Gestalten legten die dritte, jetzt völlig reglose Person vorsichtig auf eine der Bänke. Mit geübten Handgriffen streiften sie ihr die Handschuhe und die Schutzbrille ab. Einer der beiden begann, mit einer scharfen, langen Schere den Arbeitsanzug des Liegenden aufzuschneiden. Nach einigen Minuten hatte er den Anzug komplett entfernt und den darunterliegenden dunkelgrünen Jogginganzug freigelegt. Schließlich breitete er mit geschickten Handgriffen eine zerknitterte Zeitung über Körper und Gesicht. Jetzt sah es so aus, als läge hier ein schlafender Obdachloser.
Eine der beiden Gestalten holte eine kleine Flasche aus den Tiefen eines Rucksacks und sprühte eine wasserklare Flüssigkeit auf die Bänke und das umlaufende Holzgeländer der Plattform. Nachdem er dies beendet hatte, verschwand die Flasche wieder im Rucksack. Stattdessen kam eine weitere Sprühflasche zum Vorschein, diesmal deutlich größer als die erste. Nun begann er, zunächst sich selbst und dann seinen Begleiter, der bewegungslos neben der Bank mit dem vermeintlichen Obdachlosen gewartet hatte, am ganzen Körper einzusprühen. Dann tauschten sie die Flasche und wiederholten die Prozedur. Je mehr sie sprühten, desto stärker roch es nach Essig.
Beide nickten sich Einverständnis signalisierend zu, dann liefen sie mit schnellen Schritten los und verließen die Alte Liebe. Keine zehn Minuten waren die Männer hier gewesen. Nun lag der Hafen wieder einsam und ruhig.
***
Kurz vor neun, mittlerweile war es hell, und die aufgehende Sonne hatte den über dem Wasser liegenden Dunst vertrieben. Nach wie vor wehte so gut wie kein Wind. Langsam erwachte der Hafen zum Leben, die ersten Souvenirläden öffneten. Einige Frühaufsteher waren bereits unterwegs. Aber keiner der frühen Besucher auf der Alten Liebe nahm die unter Zeitungspapier auf der Bank liegende Gestalt zur Kenntnis. Der eine oder andere missmutige Gedanke über das Pack, das sich nun auch schon hier breitmachte, wurde gedacht– aber alle gingen weiter. Auch die Hunde hielten sich auffällig fern.
Erst eine Stunde später, nachdem die ersten Touristen eingetroffen waren, wurde der Mann auf der Bank entdeckt.
»Mama, Mama, warum liegt da ein Mann unter der Zeitung?«, wollte ein kleiner, vielleicht achtjähriger Junge von seiner Mutter wissen, nachdem er einige der Papierseiten weggezogen hatte.
Ein plötzlicher Windstoß blies die restliche Zeitung vom Körper. Erschrocken schrie die Frau auf, ihr kleiner Sohn verschwand verängstigt hinter ihrem Rücken.
Der Mann auf der Bank war kreidebleich und hatte tief eingefallene, blutunterlaufene Augen. Ein dünnes Rinnsal Blut war aus seinem rechten Nasenloch gelaufen und zwischen den Stoppeln eines ungepflegten Dreitagebartes getrocknet. Eine seiner Hände hing an der Seite herunter und berührte den Boden. Am Handgelenk waren blutige Abschürfungen sichtbar.
Der kleine Junge weinte und machte damit andere Besucher aufmerksam. Ein junger Mann kam angelaufen und kniete sich vor den Mann auf der Bank. Er versuchte, ihn mit leichten Schlägen auf die Wange zu wecken.
»Hallo?«, rief er. »Können Sie mich hören? Geht es Ihnen gut?«
Offensichtlich nicht, denn der Mann zeigte keinerlei Reaktion. Nur hatte sich sein Kopf durch die Schläge auf die Wangen leicht zur Seite gedreht, sodass nun auch frisches Blut aus seinem Mundwinkel lief und auf die Bank und den Holzboden tropfte. Erschrocken wich der junge Mann zurück. Nun ebenfalls etwas bleich im Gesicht, wischte er seine blutverschmierten Hände an der Rückenlehne der Bank ab. Weitere Menschen eilten herbei, ein Hund sprang ungestüm vor dem auf der Bank liegenden Mann auf und ab, wurde aber schnell von seinem Herrchen an der Leine zurückgerissen.
»Wir brauchen einen Notarzt!«, rief eine Stimme aus der Gruppe, und wie auf Kommando griffen gleich mehrere der Umstehenden nach ihrem Handy.
Die junge Frau, deren Sohn noch immer weinte, schaute sich verstört um. Sie verstand nicht, was hier passierte. Sie wollte nur weg.
***
Dienstag, 20.September, früher Vormittag. Olofsen hatte schlecht geschlafen. Da die Nacht außerdem recht kurz gewesen war, hatte er entsprechend schlechte Laune. Mit einem Becher dampfendem Kaffee in der Hand marschierte er durch die Gänge des Cuxhavener Krankenhauses. Nach einigen Minuten Fußmarsch, einer ganzen Reihe nicht druckreifer Flüche und diversen verschlossenen Türen fand er schließlich den Saal, in dem die Obduktion stattfinden sollte. Hierhin hatte man noch in der Nacht die im Watt ausgegrabene Leiche gebracht. Normalerweise wurden Obduktionen an Leichen aus Cuxhaven im Institut für Rechtsmedizin in Hamburg durchgeführt. Nur in Ausnahmefällen kamen die Rechtsmediziner direkt nach Cuxhaven und erledigten ihre Arbeit in den Räumlichkeiten der Helios-Klinik.
Der Chefpathologe Dr.Walberg wartete bereits. Gewöhnliche Fälle überließ er seinen Mitarbeitern. Aber dieser Fall schien alles andere als gewöhnlich zu sein. Seine Neugier war geweckt und hatte ihn sogar in den frühen Morgenstunden von Hamburg nach Cuxhaven gelockt.
»Ah, Götterdämmerung. Hat der Herr ordentlich geruht, oder ist er falsch abgebogen und in der Kantine gelandet?«
Offensichtlich war Walberg heute Morgen ebenfalls noch nicht allerbester Laune. Wahrscheinlich war er für seine Verhältnisse doch entschieden zu früh aufgestanden, die lange Fahrt von Hamburg nach Cuxhaven– ans Ende der Welt, wie er häufig konstatierte– hatte nicht geholfen.
»Zuerst mal guten Morgen. Und jetzt quatsch kein dummes Zeug. Sag mir, was da in Otterndorf am Strand vorgefallen ist.«
»Mann, du bist ja schon richtig gut drauf. Ich nicht so, denn während du noch verschlafen an deinem Kaffee genuckelt hast, habe ich schon ein wenig vorgearbeitet. Pro-aktiv nennt man das heutzutage. Aber um nun zur Sache zu kommen: Unser Opfer ist männlich, etwa vierzig Jahre alt.«
Klaus Walberg erhob sich langsam von einem Schreibtisch und machte ein paar Schritte auf den Obduktionstisch zu. Er wusste, dass Olofsen der Obduktion unbedingt beiwohnen wollte, und jetzt, da er endlich da war, konnte er mit der Arbeit beginnen. Der Körper des Opfers war noch mit einem grünen OP-Tuch abgedeckt.
Der gesamte Raum strahlte eine bedrückende Atmosphäre aus, alles war auf reine Funktionalität ausgelegt. Bläulich weiße Fliesen an den Wänden bis zur Decke, graue Keramik auf dem Fußboden. Viel Edelstahl, alles leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Ein penetranter Geruch nach Desinfektionsmitteln hing in der Luft. Im Hintergrund brummte eine Klimaanlage.
Über dem OP-Tisch, auf dem der Leichnam lag, war ein enorm großes Lichtsystem mit diversen einzeln einstellbaren Halogenstrahlern installiert. Sie schaltete Walberg nun ein, dann zog er mit einem plötzlichen Ruck das Tuch vom Körper des Toten, als würde er gerade ein neues Kunstwerk für die Öffentlichkeit enthüllen.
Olofsen musste schlucken. Auch nach all den Jahren verursachte ihm der Anblick eines entkleideten, leblosen und meist verunstalteten Körpers auf dem kalten Stahltisch stets Übelkeit. Aber er wollte hier sein, er sah es als seine Pflicht an, jedes Detail aus erster Hand zu erfahren, alle Teile des Puzzles zu Gesicht zu bekommen, um in der Lage zu sein, den Täter zu überführen und so dem Opfer wenigstens ein Minimum an Würde zurückzugeben.
»Dann wollen wir mal.« Walberg schaltete das über dem Obduktionstisch hängende Mikrofon ein, um seine Kommentare für den späteren Bericht aufzuzeichnen. Er begann wie immer mit der äußeren Leichenschau, das heißt, er inspizierte den toten Körper vor ihm von Kopf bis Fuß, ohne seine zahlreichen Sägen einzusetzen. Es herrschte angespannte Stille, Olofsen wagte nicht, Walberg mit irgendwelchen Bemerkungen oder Fragen zu stören. Er würde sowieso keine Antwort erhalten. Sobald Walberg etwas entdeckte, das beider Aufmerksamkeit verdiente, würde er sich unaufgefordert äußern.
»Nun«, war die Stimme des Gerichtsmediziners nach einigen Minuten zu vernehmen. »Es gibt keine äußerlichen Auffälligkeiten oder Anzeichen einer Gewalteinwirkung. Keine Stich- oder Schnittwunden, auch keine Hämatome, Schürfwunden oder Blutergüsse, die auf einen Kampf oder auf Einwirkung eines stumpfen Gegenstandes schließen lassen. Zu Nadeleinstichen kann ich jetzt noch nichts sagen.«
»Aber tot ist er trotzdem«, bemerkte Olofsen.
»Danke für den Hinweis, Sherlock.« Walberg verzog keine Miene. »Tot ist er tatsächlich. Aber um herauszufinden, warum, müssen wir wohl noch ein wenig arbeiten. Der Bauchnabel sieht mir irgendwie komisch aus, ungewöhnlich geweitet, als wäre er aufgeschnitten worden. Seltsam…«
Walberg griff zu den Werkzeugen, die auf einem rollbaren Beistelltisch neben dem Obduktionstisch vorbereitet waren. Olofsen sah ein blitzendes Skalpell und einen Kettenhandschuh. Er wusste, was nun kam, und musste erneut schlucken.
Professionell und unbarmherzig öffnete Walberg den Körper. Er begann an den Schultern und arbeitete sich langsam und zielsicher über den Brustkorb bis zum unteren Bauchbereich vor. In der Zwischenzeit war ein zweiter, wesentlich jüngerer Mitarbeiter zu ihnen gestoßen, der Walberg assistierte. Wieder sprach niemand, wieder brummte nur die Klimaanlage penetrant vor sich hin.
Walberg machte sich gerade daran, die Bauchhöhle zu öffnen, als ein leises Klirren zu hören war. Glasklirren. »Was war das?«, fragte der Assistent.
»Hmpf«, kam es von Walberg. »Halten Sie hier die Klammer. Das haben wir gleich.«
Nochmals war ein leises Klirren zu hören. Olofsen war angespannt und stand nur noch zwei Schritte hinter dem Assistenten. Er hatte es auf seinem Stuhl nicht mehr ausgehalten.
Walberg hatte die Bauchhöhle nun weit geöffnet und griff mit der linken Hand nach oben, um einen der Halogenstrahler näher zu ziehen.
»Mein lieber Herr Gesangsverein. Ich habe ja schon so einiges gesehen. Aber das hier… Himmel!«
***
»Bitte? Ihr habt was gefunden?« Greiner saß in Olofsens Büro und hörte angespannt zu, was ihm sein Kollege über die Obduktion zu berichten hatte. Inzwischen war es später Nachmittag.
»Ja, du hast verdammt noch mal richtig gehört. In der Bauchhöhle des Toten hat Walberg über vierzig Glasfläschchen mit irgendeinem Zeug gefunden. Alle Flaschen waren unversehrt und verschlossen. Bis jetzt weiß ich nicht, worum es sich handelt.«
»Schmuggel?«, spekulierte Greiner drauflos.
Olofsen sah ihn an, als hätte sein Kollege sie nicht mehr alle. »Verstand einschalten bitte. Kleine Päckchen mit Drogen zu schlucken und sie später wieder auszukacken ist eine Sache. Und gefährlich genug. Aber sich ein Loch in den Bauch zu schneiden und dann vierzig kleine Glasflaschen da hineinzustecken, das ist doch ’ne Nummer zu abgefahren. Und warum liegt er dann tot im Watt– mit dem Zeug im Bauch? Nee, da steckt mehr dahinter.«
»Wissen wir eigentlich schon, um wen es sich handelt?«, fragte Greiner.
»Ja, freundlicherweise hat man ihm sein Portemonnaie gelassen. Und sogar der Personalausweis war noch drin– allerdings kein Geld mehr. Na ja, das braucht er ja nun auch nicht mehr. Er heißt Wolfgang Meister, geboren am 22.Juli 1965, und wohnte in Altenbruch. Nach den Informationen vom Meldeamt der Stadt hat er dort allein gelebt. Und ich glaube, wir sollten ihn finden und schnell identifizieren.«
»Ich denke, wir sollten uns die Wohnung ansehen.«
Olofsen wollte gerade zu seinem Kaffeebecher greifen, als das Telefon klingelte. »Das machst du. Ich habe noch zu tun.«
Er drehte sich um und griff zum Telefonhörer. Greiner erkannte, dass die Besprechung zu Ende war. Er schnappte sich seine über den Stuhl gehängte Jacke und ging. Doch schon im nächsten Moment rief Olofsen hinter ihm her: »Martin, bleib hier. Es wird noch heftiger.«
Das Telefongespräch war bereits beendet. Greiner setzte sich wieder an Olofsens Schreibtisch. »Schieß los!«
»Nun ja«, setzte Olofsen an. »Das war noch einmal Walberg. Er hat festgestellt, dass Wolfgang Meister keines natürlichen Todes gestorben ist.«
»Sag an«, grummelte Greiner. »Der Mann ist jeden Cent wert. Ein Hoch auf den Gerichtsmediziner Walberg.«
»Ist ja gut. Wenn du jetzt die Luft anhalten würdest, könnte ich dir den Rest erzählen. Darf ich also?« Ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr Olofsen fort: »Erstens: Der arme Kerl, also Meister, scheint im Matsch erstickt zu sein. Walberg hat Salzwasser und Sand in seiner Luft- und Speiseröhre gefunden, sogar in der Lunge. Zu viel und vor allem zu tief, als dass er zufällig in den Mundraum eingedrungen sein könnte. Zweitens: Der Schnitt im Bauchnabel, durch den diese Glasfläschchen eingeführt wurden, wurde von jemandem gesetzt, der wusste, was er tat. Sauber geschnitten, mit einem äußerst scharfen Werkzeug, wahrscheinlich einem chirurgischen Skalpell. Anschließend wurde dieser Schnitt fachmännisch wieder verschlossen– genäht mit kleinen und kurzen Stichen, drei Stück. Walberg hätte dies fast übersehen.«
»Du willst also sagen–«, begann Greiner.
»Mund halten, ich bin noch nicht fertig. Drittens: Es gibt bereits einen ersten Hinweis aus der Toxikologie. In Meisters Blut konnte Liquid Ecstasy nachgewiesen werden.«
»Liquid Ecstasy– K.o.-Tropfen?«
»Himmel, welcher Teil von ›Mund halten‹ ist so schwer zu verstehen?«, schimpfte Olofsen, bevor er antwortete: »Ja, ich meine K.o.-Tropfen. Wir hatten verdammtes Glück, dass Walberg auf die Idee gekommen ist, sofort auf diese Substanz testen zu lassen, und den Laborfuzzis mächtig in den Hintern getreten hat, damit die auch vorwärtsmachen. Liquid Ecstasy lässt sich nur innerhalb der ersten zwölf Stunden nach Verabreichung nachweisen. Die genaue Dosis haben die Jungs in der Toxikologie noch nicht berechnen können, aber alles deutet darauf hin, dass unser Mann zunächst betäubt, dann aufgeschnitten, mit Glasampullen gefüllt, zugenäht und anschließend im Otterndorfer Watt halb vergraben, halb an die Pricke gefesselt wurde. Und das innerhalb einer ziemlich kurzen Zeitspanne, die auch noch gar nicht lange zurück liegt. So, und jetzt darfst du reden.«
Greiner gehorchte prompt. »Wenn das stimmt, bedeutet es, dass unser Opfer noch nicht lange dort lag. Wahrscheinlich bei ablaufendem Wasser hingebracht, gefunden wurde er dann eine Tide später. Was wird das hier? Hier ist Cuxhaven, plattes Land mit Möwenschiss und Sandburgen, nicht New York oder London. Solche Geschichten kenne ich aus ›CSI Miami‹, aber nicht von der Nordseeküste!«
»Das müssen wir herausfinden. Und um die Herausforderung noch ein wenig zu steigern, kommt jetzt ein ›Viertens‹.«
Olofsen beugte sich über seinen Schreibtisch und sah Greiner an. »Die Glasflaschen aus dem Bauch unseres Toten waren etikettiert. Das Etikett war zwar teilweise aufgelöst, aber Walbergs Assistenten ist es gelungen, zumindest die Hauptinfo wieder sichtbar zu machen. Bei dem Zeug handelt es sich um eine Substanz namens ›Vertovir‹. Irgendein Pharmazeug, ein Impfstoff oder Therapeutikum, was weiß ich. Die Jungs im Labor werden überprüfen, was es damit auf sich hat, kann allerdings etwas dauern. Hergestellt wurde es anscheinend bei einer kleinen Biotechfirma in Otterndorf, Theravactec GmbH. Der Name ist echt klasse, die hätten aber noch mindestens einy und zweix einbauen sollen, damit es richtig future-space-abgefahren klingt. Egal, du fährst zu Meisters Wohnung und schaust dich dort um, ich werde mal bei Thera-was-auch-immer-tec vorbeischauen.«
Greiner war anzusehen, dass er mit dieser Idee nicht glücklich war.
»Was?«, fragte Olofsen.
»Schau mal auf die Uhr. Gleich sechs. Beim besten Willen, ich bin kaputt. Und ich glaube kaum, dass du um diese Uhrzeit in Otterndorf noch viel erreichst.«
DREI
Draußen war es bereits dunkel, und die mickrige Lampe über dem Küchentisch schaffte es kaum, den Raum zu erhellen. Eine Glaskanne mit dampfendem schwarzen Tee und drei Tassen standen auf dem Tisch. Christoph Gell griff sich die Kanne und goss die vor ihm stehenden Tassen voll.
»Milch und Zucker müsst ihr euch selbst nehmen«, sagte er.
Tanja Muster und Paul Mahn nahmen ihre Tassen, sprachen aber kein Wort. Die Atmosphäre war angespannt. Der Raum war fast unmöbliert, die Tapete an den Wänden hatte ihre beste Zeit weit hinter sich gelassen, an manchen Stellen löste sie sich bereits von der Wand. Neben dem Tisch gab es nur noch funktionale Einrichtung, einen alten Elektroherd, einen laut vor sich hin rumpelnden Kühlschrank und ein Sideboard ohne Türen, in dem sich zwei Töpfe, eine Pfanne, ein paar Teller, Tassen und Gläser stapelten. Auf dem Board standen eine alte Kaffeemaschine und ein Wasserkocher. In einer Ecke des Raumes, neben dem Mülleimer, lag auf dem alten PVC-Fußboden ein Karton mit einer noch nicht ausgepackten Mikrowelle.
»Manchmal frage ich mich, ob das alles richtig ist.« Paul blickte suchend in seine Tasse, als sei dort die Antwort verborgen.
»Was soll das heißen?«, fuhr Tanja ihn an. »Hast du etwa die Hosen voll?«
»Red keinen Scheiß. Diese ganzen Miniaktionen sind doch für’n Arsch. Das bringt doch alles nichts.« Paul stand auf und lief durch den Raum. »Was haben wir denn bislang erreicht? Wir hocken hier in diesem Loch, diskutieren und trinken Tee, während draußen alles nur noch schlimmer wird.«
»Nun mach mal ’nPunkt«, sagte Christoph überheblich. »Wenn wir Erfolg haben wollen, muss alles richtig laufen. Alles! Wir wollen nicht schlechter sein als diese bärtigen Spinner, die Buddhas in die Luft sprengen, sondern besser. Ja, die Küche ist ein Dreckloch. Aber das war’s auch schon. Warst du heute schon hinten? Hast du da irgendwelchen Dreck gesehen? Da ist alles top, genau so, wie es sein soll. Und keiner um uns herum weiß irgendetwas. Wir sind fast so weit. Wir haben unseren letzten Test gestartet. Schon vergessen?«
Paul setzte sich wieder und starrte angestrengt auf den Fußboden.
»Scheiße. Ich bin nervös. Unser Test war wichtig. Aber das Warten, bis es wirklich losgeht, bis sich auszahlt, wofür wir in den ganzen letzten beiden Jahren gekämpft haben, macht mich wahnsinnig.«
Tanja griff zu ihrem Tee. »Unsere Aktion wird völlig den Rahmen sprengen. So etwas hat es noch nicht gegeben. Wir werden nicht nur endlich Aufmerksamkeit auf unsere Sache lenken, wir werden einen definitiven Beitrag zur Lösung des Problems leisten. Den Beitrag schlechthin. Aber jetzt will ich endlich wissen, wie es heute Morgen gelaufen ist.« Sie blickte die beiden Männer erwartungsvoll an.
Tanja Muster war knapp dreißig Jahre alt, groß gewachsen und schlank. Ihre Augen wirkten allerdings zehn Jahre älter. Nach dem Abitur hatte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr bei einer internationalen Non-Profit-Organisation gemacht, die humanitäre Hilfe in Krisengebieten leistete. Aus dem einen Jahr waren sechs geworden, und Tanja hatte Leid und Elend in vielen Teilen der Welt gesehen. In Kolumbien war sie nur knapp einer Entführung entkommen. Ihre damaligen Mitstreiter hatten weniger Glück gehabt, einer von ihnen hatte sich auf den endlosen Märschen durch die Bergwälder von dem schlechten Essen eine Magen-Darm-Infektion zugezogen und war allein und qualvoll irgendwo im Busch gestorben.
Nach Deutschland zurückgekommen, kehrte Tanja dieser Art von Hilfe den Rücken. Ihre Erlebnisse hatten sie so stark traumatisiert, dass sie mit ihrer Familie, mit ihren alten Freunden und dem idyllischen Leben auf dem Lande in der Nähe von Freiburg nichts mehr anzufangen wusste. Sie ging nach Hamburg, wo sie sich zum Studium von Sozialwissenschaften und Psychologie an der Uni einschrieb. Nachdem sie ihren Magister in der Tasche hatte, blieb sie dennoch rastlos und unzufrieden. Aber sie brauchte Geld zum Leben und somit einen Job. Sie fand eine Assistentenstelle in der Hamburger Sozialbehörde. Nebenher begann sie, sich abermals bei Umweltschutz- und Menschenrechtsgruppen zu engagieren.
Christoph Gell, zwei Jahre jünger als Tanja und Sohn eines wohlhabenden Hamburger Reeders, hatte hingegen weder vor noch während seines BWL-Studiums Hamburg verlassen. Trotzdem konnte er jedem die Welt und ihre politischen, wirtschaftlichen und religiösen Zusammenhänge erklären. Zumindest seine Version davon. Sein Studium lief nur noch pro forma, denn so ließ sich sein Vater am besten überzeugen, weiterhin monatlich eine ansehnliche Summe Geld zu überweisen und ihn ansonsten in Ruhe zu lassen.
Sein Plan, sich ins Studentenparlament wählen lassen, hatte nicht funktioniert, da er niemanden mit seinen konfusen Themen überzeugen konnte. Frustriert hatte er sich von studentischen Bewegungen abgewandt und in der Bibliothek der Universität sozial- und gesellschaftskritische Wälzer aller Epochen studiert– verschlungen wäre das bessere Wort. Ebenso hatte er die Inhalte diverser Fachjournale über ethische, moralische und soziophilosophische Fragestellungen in sich aufgesogen. Danach war er der Auffassung, wirklich Durchblick zu haben, aber nun benötigte er eine Zuhörerschaft.
Er gründete auf Facebook eine eigene Gruppe. Anfangs gab es zwar einige Likes, jedoch keine Freundschaftsanfragen oder Follower. Das frustrierte ihn, aber er gab nicht auf. Dann meldeten sich tatsächlich einige Interessierte über den Chatroom, unter ihnen Tanja Muster. Man beschloss, sich nicht nur im Netz auszutauschen, sondern auch in der realen Welt.
Das erste Treffen fand in einer kleinen, verqualmten Eckkneipe in St.Pauli statt. Sie redeten viel und tranken Astra. Am meisten redete Christoph. Er schwafelte und schwadronierte, und bereits nach einer Stunde hatte sich sein Publikum schon von fünf auf drei Personen reduziert.
Dem neben Tanja letzten verbliebenen Zuhörer– es war Paul– war es gelungen, das Gespräch geschickt von der diffusen Umgestaltung und Rettung der Gesellschaft auf Sorgen, Nöte und Probleme der Hamburger umzulenken und den Blick auf die eigene Haustür zu richten. Über die Elbvertiefung und die kaum abzuschätzenden Folgen diskutierten sie besonders lange.
Irgendwann nach Mitternacht zahlten sie und gingen nach draußen in die Nacht.
»So weit, so gut. Wie soll es denn nun weitergehen?«, wollte Paul wissen.
Weder Christoph noch Tanja fiel etwas ein.
»Wir werden die Welt retten. Genau«, sagte Tanja mit schwerer Zunge. »Schluss mit dem Krieg um Öl oder Wasser. Und die Elbe bleibt auch so, wie sie ist. Ich glaub, ich muss kotzen.«
Die beiden Männer schauten ihr verdutzt nach, als sie im Eilschritt um die Hausecke verschwand. Sie hörten einige Würge- und Spuckgeräusche, dann war es ruhig.
»Ich will jetzt endlich wissen, wie es heute Morgen gelaufen ist!«, beharrte Tanja und holte alle wieder aus ihren Gedankenwelten in die Realität der kleinen, heruntergekommenen Küche zurück.
Paul blickte ihr in die Augen. »Genau wie geplant. Ganz sauber, keine Pannen. Die Sache läuft. Und bald kocht der Topf über– wart’s nur ab.«
Christoph sagte nichts, nickte bloß.
Paul stand auf. »Ich bin hinten. Ich brauche eine Stunde, danach haue ich ab. Ich bin erledigt für heute.«
»Brauchst du Hilfe?«, wollte Tanja wissen.
»Nein, ich schaffe es schneller allein.« Damit ging er und ließ Tanja und Christoph zurück.
»Hat sich der Chef schon gemeldet?«, fragte Christoph.
»Er hat gegen Mittag eine SMS
VIER
Mittwoch, 21.September. Olofsen war gegen acht in seinem Büro angekommen, um noch einmal alle Notizen durchzusehen. Am Abend zuvor hatte er im Internet noch ein wenig über Theravactec recherchiert.
Eine knappe Stunde später machte er sich auf den Weg. Er hatte gerade das Gebäude der Polizeiinspektion an der Werner-Kammann-Straße verlassen, als sein Handy summte. Es war Greiner.
»Ich habe mir die Wohnung von Meister angeschaut. Die Wohnung war abgeschlossen, keine Anzeichen für einen Einbruch. Wir haben den Schlüsseldienst angefordert, um reinzukommen. Alles war aufgeräumt und in bester Ordnung. Aber eins habe ich herausgefunden– und das ist jetzt wichtig: Der Typ arbeitete auch bei Theravactec. Er hatte seine letzte Gehaltsabrechnung auf dem Schreibtisch liegen, da stand es drauf.«
»Was? Der arbeitet bei Theravactec?«, rief Olofsen. Diese Info konnte für die ganze Ermittlung von entscheidender Bedeutung sein. »Dann treffen wir uns in einer halben Stunde bei Theravactec auf dem Parkplatz.«
Olofsen setzte sich in seinen Wagen, einen noch recht neuen dunkelblauen 3er BMW. Er hoffte, dass zu dieser Uhrzeit die Strecke zwischen Cuxhaven und Otterndorf von nicht zu vielen Traktoren verstopft wurde. Nachdem er über einige Nebenstraßen die B73 erreicht hatte, schaltete er in der Hoffnung auf etwas entspannende Musik das Radio ein. Lieber wäre ihm eineCD mit Musik von Schandmaul gewesen, aber die hatte er in seiner Schreibtischschublade liegen lassen.
»…überall auf unserem Planeten tobt der Wahnsinn. Und es wird täglich schlimmer.«
»Und was sollte Ihrer Meinung nach unternommen werden?«, fragte der Moderator.
Noch vor einer Antwort schaltete Olofsen genervt das Radio wieder aus. »Müssen die so einen Quatsch bringen? Den Wahnsinn habe ich schon jeden Tag in meinem Job. Spinner…«
Er fuhr ohne musikalische Untermalung weiter und überlegte sich stattdessen neue Strategien, CDs nicht mehr im Büro zu vergessen. Zum Beispiel, sie sofort ins Auto zu legen.
Er hatte Glück, knapp dreißig Minuten und nur drei riskante Trecker-Überholmanöver später rollte er auf den Parkplatz von Theravactec. Greiner war schon da und lehnte gelangweilt an seinem Wagen.
Das Gebäude von Theravactec, ein neuer Bau mit viel Stahl und Glas, wie es für moderne Hightech-Tempel typisch war, lag an der Besenhalmer Trift, nur knapp dreihundert Meter vom Elbdeich entfernt. Eigentlich passte ein solcher Bau gar nicht in die Landschaft um Otterndorf. Vom obersten Geschoss des insgesamt vierstöckigen Gebäudes hatte man aber bestimmt eine phantastische Sicht über die Deichwiesen und die Elbe. In Olofsen stieg ein wenig Neid auf, als er an sein trauriges Büro im tristen Gebäude der Cuxhavener Polizeiinspektion dachte.
Durch eine große Glastür betraten sie die Eingangshalle. Auch hier Marmor und viel Glas. Am Empfang saß eine junge Frau.
»Guten Morgen, die Herren, und willkommen bei Theravactec. Wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie mit perfektem Stewardessenlächeln.
Mir sagen, wer deinen Kollegen Wolfgang Meister umgebracht hat– das wäre ein guter Start, dachte Olofsen. »Guten Morgen. Mein Name ist Olofsen. Der nette Herr neben mir ist mein Kollege Greiner. Kriminalpolizei Cuxhaven. Wir möchten uns gerne mit dem Chef des Hauses unterhalten.«
»Haben Sie einen Termin? Falls nicht, glaube ich kaum, dass unser Managing Director, Dr.Korz, so kurzfristig Zeit für Sie erübrigen kann. Er ist ein viel beschäftigter Mann.«
»Hören Sie, junge Dame. Das war eigentlich keine Frage«, antwortete Olofsen bereits leicht gereizt. »Wir sind die Polizei. Und wir wollen jetzt mit Ihrem Dr.Wer-auch-immer reden. Seien Sie also so gütig und pfeifen ihn herbei.«
»Also bitte, was erlauben–«
»Jetzt!«, schnauzte Olofsen.
»Schon gut.« Sie griff zum Telefon, wählte eine Nummer und sprach ein paar Sekunden leise in den Hörer. Ihr Blick streifte dabei immer wieder die beiden Polizisten.
Nur Sekunden nachdem sie den Hörer aufgelegt hatte, öffnete sich eine Tür, und eine weitere Frau, elegant gekleidet und bereits etwas älter, trat zu ihnen in die Halle.
»Mein Name ist Hausch. Ich bin die persönliche Assistentin von Dr.Korz. Er wird es einrichten können, Ihnen für ein paar Minuten zur Verfügung zu stehen. Wenn Sie so nett wären, mir Ihre Namen und den Grund Ihres unangemeldeten Besuches zu nennen. Und Ihre Dienstausweise würde ich mir auch gerne ansehen.«
Greiner, der spürte, dass sein Chef in wenigen Sekunden aus der Haut fahren würde, schob Olofsen zur Seite.
»Mein Name ist Martin Greiner. Das ist mein Kollege Olofsen.« Er zog seinen Dienstausweis aus der Innentasche seiner Jacke und hielt ihn ihr kurz vor das Gesicht. »Wir möchten mit Herrn Korz sprechen. Und was wir besprechen wollen, werden wir ausschließlich ihm mitteilen. Und nun sollten wir uns auf dem Weg machen. Zeit ist schließlich Geld, nicht wahr?«
Frau Hausch blieb gelassen. Sie schob den beiden Polizisten einen Besucherausweis zu, drehte sich um und schritt wortlos voran. Greiner und Olofsen folgten ihr. Sie durchquerten einen lichtdurchfluteten Korridor, an den Wänden hingen Fotografien mit Küstenmotiven in modernen Aluminiumrahmen. Am Ende des Korridors blieb die Frau stehen und deutete auf eine Glastür. »Herr Dr.Korz erwartet Sie.« Dann drehte sie sich um und ging.
Olofsen öffnete die Tür und trat in das Büro des Geschäftsführers von Theravactec. Dieser saß am anderen Ende des ebenfalls lichtdurchfluteten Raumes an einem Schreibtisch aus Glas. Vor ihm standen ein Notebook und ein kompliziert aussehendes Telefon, daneben lag ein kleines Notizbuch. An der Wand hinter dem Schreibtisch hing ein großes, edel gerahmtes Bild– eine abstrakte Acrylmalerei, die verschiedenfarbig fluoreszierende Zellen darstellte, wie man sie mit modernen Techniken unter dem Mikroskop sehen kann. An der gegenüberliegenden Seite, unter zwei großen Fenstern, war eine Couchgarnitur in beigem Leder platziert. Auf dem Glastisch davor stand eine Schale mit frischen Früchten. Der gesamte Raum strahlte schlichte Eleganz aus. Olofsen war beeindruckt, Kompetenz gepaart mit Leidenschaft, aber auch einer gewissen Überheblichkeit.
Dr.Korz erhob sich. »Meine Herren, wie ich sehe, haben Sie meinen Vorzimmerdrachen unbeschadet überwunden. Was kann ich für Sie tun– es ist doch hoffentlich nichts Ernstes vorgefallen?«
Im Gegensatz zum besagten »Vorzimmerdrachen« machte Korz einen freundlichen und aufgeschlossenen Eindruck. Selbst sein Lächeln wirkte echt, aber Olofsen war nicht sicher, ob es vielleicht doch nur künstliche Professionalität war.
»Es geht um Ihren Mitarbeiter Wolfgang Meister«, sagte Greiner.
»Was ist mit ihm?«
»Er wurde gestern tot aufgefunden. Wir gehen von einem Gewaltverbrechen aus«, schaltete sich nun Olofsen ein.
»Tot? Gewaltverbrechen?« Korz wirkte erschüttert. »Bitte, lassen Sie uns dort drüben Platz nehmen.« Er deutete auf die Couchgarnitur. »Was ist passiert?«
»Dazu können wir Ihnen im Moment noch nichts sagen. Laufende Ermittlungen– Sie verstehen. Aber wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns stattdessen einige Fragen beantworten könnten.« Ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr Olofsen fort. »Was hat Meister bei Ihnen getan?«
»Keine langen Vorreden, wie mir scheint. Also, Herr Meister leitet bei uns die Abteilung für Logistik und Supply Chain Management«, erklärte Korz.
»Was bedeutet Theravactec eigentlich?«, wollte Greiner wissen.
Korz lächelte schief. »Ein typisches Kunstwort aus der Biotechindustrie. ›Thera‹ steht für Therapie, ›vac‹ als Abkürzung für Vakzine, also Impfstoffe, und ›tec‹ für Technologie. Diese drei Begriffe, die im Firmennamen zusammengefasst sind, beschreiben unser Tätigkeitsfeld. Wir entwickeln neuartige Therapeutika und Impfstoffe, alles mit hochmoderner Technologie. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dies jetzt unser Thema sein soll.«
»Richtig«, fuhr Olofsen fort. »Es wäre gut, wenn Sie uns Meisters Tätigkeit genauer beschreiben könnten. Logistik, Supply-irgendwas.«
Korz nahm den Faden wieder auf. »Herr Meister ist, war, muss ich nun wohl leider sagen, neben der Abteilungsleitung für den Versand der hier hergestellten und geprüften Waren sowie für die Annahme und Bestandsverwaltung aller Roh- und Hilfsstoffe zuständig. ›Head of Supply Chain and Logistics‹ lautete sein Titel. Es ist eine sehr verantwortungsvolle Position. Meister war ebenso zuverlässig wie vertrauenswürdig.«
»Hm«, brummte Olofsen. »Wenn er nicht tot wäre, würde ich ihn sofort heiraten wollen. Wissen Sie etwas über sein Privatleben– Feinde, Frauen, Freunde, Hobbys?«
»Nein, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ich bin nur sein Arbeitgeber. Von dieser Warte aus kann ich nur positiv von ihm sprechen, und genau das tue ich auch.«
Greiner rutschte auf seinem Platz nach vorn. »Was können Sie uns über Vertovir sagen?«
»Da muss ich Sie leider enttäuschen. Ja, Vertovir befindet sich in unserer Produktpipeline, und wir werden damit bald die klinischen Studien beginnen. Alles Weitere unterliegt strengster Vertraulichkeit, wenn Sie verstehen.«
»Verstehen ja, akzeptieren nein. Ihr Mitarbeiter Wolfgang Meister wurde nicht nur umgebracht, sondern derjenige, der dies getan hat, hat ihm auch den Bauch aufgeschnitten und vierzig Fläschchen Ihres hoch geheimen Vertovir dort deponiert. Sie sollten uns ruhig mehr erzählen. Wir erfahren es sowieso. Die Fläschchen sind Beweismittel und werden in unserem Labor untersucht.«
Korz war blass geworden. Plötzlich sprang er auf und lief sichtlich aufgebracht durch das Büro. An seinem Schreibtisch griff er zum Telefonhörer und bellte: »Frau Hausch, ich will sofort Körner aus der Rechtsabteilung hier haben. In null Komma nichts.«
Er knallte den Hörer zurück auf das Telefon. Für einen kurzen Moment fiel alle Eleganz des weltmännischen Geschäftsmannes von ihm ab, und er zeigte das Gesicht eines rücksichtslosen Profiteurs, dem gerade ein Untergebener Rotwein auf das weiße Hemd gekleckert hatte. Dann fing er sich wieder, und die undurchdringliche, lächelnde Fassade des lässigen und väterlichen Firmenlenkers kehrte zurück.
»Vertovir«, sinnierte er und blickte aus dem Fenster. »Es ist unser neustes Produkt, mit dem wir die begründete Hoffnung haben, eine effiziente Therapie gegen Gebärmutterhalskrebs auf den Markt zu bringen. Sie wissen vielleicht, dass dieses Marktsegment heiß umkämpft ist. Jedes Detail über unsere Entwicklung, das nach außen dringt, kann uns schaden und den Mitbewerbern nützen. Es geht hier um Millionen. Es ist fürchterlich, was mit Wolfgang Meister geschehen ist, aber ich bin nicht willens, die Existenz dieser Firma aufs Spiel zu setzen und über unsere Kronjuwelen zu plaudern. Meister ist tot– finden Sie seinen Mörder. Ich bin überzeugt, dass unser Produkt damit nichts zu tun hat.«
»Ihr Mitarbeiter wurde umgebracht, und in seinem Bauch findet sich Ihr wichtigstes Produkt. Meinen Sie nicht auch, dass sich hier ein Zusammenhang geradezu aufdrängt?«, fragte Greiner.
»Keinesfalls«, entgegnete Korz mit steinerner Miene. »Meister war Leiter der Logistik. Er hatte überhaupt keinen Zugang zu Forschungs- oder Produktionsbereichen. Wahrscheinlich wusste er nicht einmal, wozu Vertovir überhaupt gut sein soll.« Die mangelnde Logik seiner Argumentation schien Korz nicht weiter zu stören.
Die Tür öffnete sich, und ein untersetzter Mann betrat den Raum. Er war außer Atem und hatte einen hochroten Kopf– als wäre er gerade vom Strand bis zum Büro gerannt.
»Sie wollen mich sprechen?«, fragte er und registrierte erstaunt, dass noch zwei weitere, ihm nicht bekannte Personen im Raum waren.
»Ja«, entgegnete Korz. »Die beiden Herren hier sind von der Cuxhavener Polizei. Olofsen und Greiner, wenn ich mich recht erinnere. Es gibt zwei Probleme. Erstens: Wolfgang Meister, unser Logistikleiter, ist tot. Er wurde ermordet. Ich möchte Sie bitten, der Polizei alle vertretbare Hilfe für die Aufklärung des Falles zukommen zu lassen.«
Körners Gesichtsfarbe wechselte schlagartig von Rot zu Weiß. Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber Korz ließ ihn nicht zu Wort kommen.
»Zweitens«, fuhr er fort, »hat die Polizei einige Fläschchen Vertovir bei ihm gefunden. Setzen Sie Himmel und Hölle in Bewegung, damit wir das Material so schnell wie möglich vollständig und unversehrt zurückerhalten. Ich werde nicht zulassen, dass ein paar naseweise Polizeilaboranten die Zukunft der Firma ruinieren.«
Körner versuchte erneut, zu Wort zu kommen, hatte aber wie zuvor keine Chance.
»Sie sind verantwortlich und erstatten nur mir direkt Bericht. Zunächst jedoch beantworten Sie den beiden Herren ihre Fragen, zeigen Sie ihnen Meisters Arbeitsplatz, dann den Ausgang.«
Greiner war sprachlos. Selbst Olofsen war so überrascht von Korz’ Verhaltenswechsel, dass es ihm die Sprache verschlug. Aber nur für einen kurzen Moment. Dann holte er tief Luft und wandte Korz seine volle Aufmerksamkeit zu.
»Jetzt hören Sie mir mal ganz genau zu, Herr Dr.Geschäftsführer. Ein Mensch ist tot. Ihr Mitarbeiter.« Olofsen kam jetzt in Fahrt. »Ihr toter Mitarbeiter hatte flaschenweise Ihr heilig geheimnisvolles Vertozeugs im Bauch. Glauben Sie allen Ernstes, dass Sie kraft eigener Arroganz ausschließen können, dass zwischen seinem Tod und Ihrem Wundermittel ein Zusammenhang besteht? Den Zahn kann ich Ihnen ziehen. Sie mögen vielleicht sogar recht haben, und es besteht tatsächlich kein Zusammenhang– aber wenn dies so sein sollte, werden wir diejenigen sein, die es herausfinden. Und falls Sie sich nicht kooperativ zeigen wollen, könnte es passieren, dass jede Zeitung zwischen Cuxhaven und Passau den Ausgang der Geschichte schneller kennt als Sie. Natürlich erfährt die Presse nichts von mir, aber irgendwie kriegen die ja immer was mit, nicht wahr? Lassen Sie sich von Ihrer Sekretärin eine Gesprächsnotiz zum Thema verfassen. Noch Fragen?«
Olofsen funkelte Korz wütend an. »Nein? Gut! Dann werden wir uns jetzt Meisters Arbeitsplatz anschauen und danach mit seinen Kollegen reden. Und wenn ich dann noch immer nicht zufrieden bin– wovon ich ausgehe–, werden wir in Ihrem ganzen Laden das Innerste nach außen krempeln und Sie täglich vorladen. Wir werden ganz viele Fragen haben.«
Dann verließ er im Sturmschritt das Büro, dicht gefolgt von Greiner, einige Schritte hinter ihnen folgte Körner.
Greiner wandte sich ihm zu und sagte: »Gehen Sie bitte voraus. Sonst müssen wir raten, wo Meisters Arbeitsplatz ist. Und wer weiß, was wir unterwegs alles zu sehen kriegen?!«
Eine knappe Stunde später standen Olofsen und Greiner wieder auf dem Parkplatz. Die Untersuchung von Wolfgang Meisters Arbeitsplatz hatte nichts Brauchbares zutage gefördert. Sie hatten sich auch mit den Arbeitskollegen unterhalten. Meister schien allseits beliebt gewesen zu sein. Aber Privates wusste eigentlich keiner über ihn zu berichten. Nur seine Assistentin hatte angemerkt, dass Meister sich sehr im Umweltschutz engagierte. Angeblich war er Mitglied der Cuxhavener NABU-Gruppe und außerdem noch in irgendeinem Verein gegen die Überbevölkerung der Erde.
»Was soll das bloß mit dieser Überbevölkerung?«, wollte Olofsen wissen. »Schau dich doch mal um«, er drehte sich auf dem Parkplatz einmal um die eigene Achse. »Sieht es hier irgendwo nach Überbevölkerung aus?«
Das Klingeln seines Handys unterbrach seine Betrachtungen. Das Gespräch dauerte nur wenige Sekunden.
»Das war Walberg. Es gibt noch eine Leiche«, informierte er seinen Kollegen. »Schon seit gestern. Er kommt gleich auch zur Teambesprechung. Klang recht sonderbar am Telefon.«