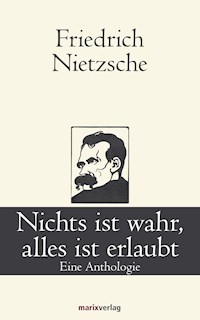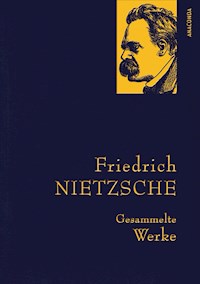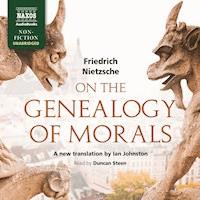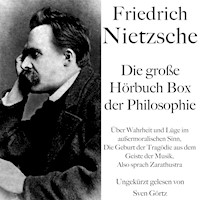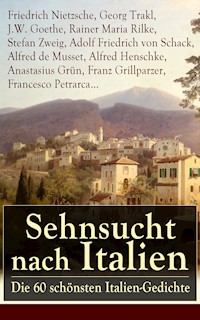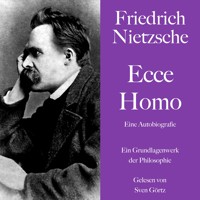Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorurteile (Originaltitel: Morgenröthe. Gedanken über die moralischen Vorurtheile) ist ein Anfang Juli 1881 erschienenes philosophisches Werk Friedrich Nietzsches. In dem aus Aphorismen unterschiedlicher Länge bestehenden Buch hinterfragte Nietzsche die Entstehung und den Wahrheitsgehalt moralischer und religiöser Systeme. Dabei setzte er dem tragischen Pathos einer christlichen Existenz das kontemplative Glück eines Erkennenden gegenüber und interpretierte die Glaubensekstase als psychopathologisches Phänomen. In der Morgenröte skizzierte Nietzsche erstmals Umrisse der Formel vom Willen zur Macht, die später von Zarathustra in aller Deutlichkeit vorgetragen wurde. (aus wikipedia.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Morgenröte
Gedanken über die moralischen Vorurteile
Friedrich Nietzsche
Inhalt:
Friedrich Nietzsche – Biografie und Bibliografie
Morgenröte
Vorrede
Erstes Buch
Zweites Buch
Drittes Buch
Viertes Buch
Morgenröte, Friedrich Nietzsche
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849616328
www.jazzybee-verlag.de
Friedrich Nietzsche – Biografie und Bibliografie
Namhafter philosophischer Schriftsteller, geb. 15. Okt. 1844 in Röcken bei Lützen, gest. 25. Aug. 1900 in Weimar, war der Sohn eines Pfarrers, der zeitig starb, wurde von seiner Mutter in Naumburg a. S. erzogen, besuchte die Landesschule Pforta und studierte von 1864–67 in Bonn und Leipzig klassische Philologie. Frühreif, ein bevorzugter Schüler Ritschls, erhielt er noch vor seiner Promotion (1869) einen Ruf als außerordentlicher Professor der klassischen Philologie an die Universität Basel, wurde 1870 schon ordentlicher Professor daselbst, welche Stellung er bis 1870 bekleidete. In diesem Jahre nötigte ihn ein schweres Augenleiden, verbunden mit Überreizung des Gehirns, sein Amt aufzugeben, nachdem er schon den Winter 1876/77 in Sorrent zugebracht hatte. Von da ab führte er, beständig schriftstellerisch äußerst tätig, ein Wanderleben, hielt sich mit Vorliebe in Venedig, in der Schweiz, in Turin, Genua, Nizza, bisweilen auch in Leipzig und Naumburg auf, bis er im Frühjahr 1889 in Turin nach übermäßiger geistiger Anstrengung und zu starkem Gebrauch von Schlafmitteln geisteskrank wurde. Kürzere Zeit brachte er in der Heilanstalt in Jena zu, wo ihm keine Genesung wurde; dann lebte er wieder bei seiner Mutter in Naumburg und nach deren Tode in treuester Pflege seiner Schwester zu Weimar in einer oberhalb der Stadt gelegenen Villa, wo sich jetzt das Nietzsche-Archiv befindet (vgl. Kühn, Das Nietzsche-Archiv zu Weimar, Darmst. 1904). Mit Rich. Wagner war er längere Jahre eng befreundet, brach aber den Verkehr später mit ihm hauptsächlich wegen dessen religiösen Ansichten ab. Im persönlichen Umgange sehr gewinnend, aber doch die Einsamkeit liebend, ging er in seinen Schriften schonungslos gegen alles ihm nicht Gefallende vor. Als Stilist ist er in der Gegenwart unübertroffen, seine Sprache hat oft einen geradezu bestrickenden Zauber, und ihr ist zum Teil die große Wirkung seiner Werke zuzuschreiben.
Seine schriftstellerische Laufbahn begann N. mit kürzern philologischen Arbeiten über Theognis und Diogenes Laertius, aber schon in seiner ersten größern Schrift: »Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik« (Leipz. 1872), wandte er sich von der rein philologischen Methode ab, indem er sich von allgemeinen philosophischen und künstlerischen Anschauungen, namentlich solchen Schopenhauers u. Wagners, leiten ließ. Derselben Richtung folgt er auch, zugleich ein deutsches Kulturideal anstrebend'. in den »Unzeitgemäßen Betrachtungen« (4 Stücke, Leipz. 1873–76), verläßt sie aber in seinen weitern aphoristischen Werken: »Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister« (Chemn. 1878–80, 3 Tle.); »Morgenröte. Gedanken über moralische Vorurteile« (das. 1881); »Die fröhliche Wissenschaft« (das. 1882), wo der Glaube an Ideale preisgegeben, der Mensch als reines Naturprodukt betrachtet wird, auch die Sittlichkeit sich mit ihren Gesetzen nicht von höhern Mächten oder der allgemeinen Vernunft, sondern aus den natürlichen Trieben der Menschen herleiten soll. So hatte N. mit aller sittlichen und religiösen Tradition gebrochen, war nicht mehr an Vorurteile, nicht mehr an die sogen. ewigen Gesetze der Vernunft gebunden, namentlich nicht an die christliche Welt- und Lebensanschauung, von der diese unsre Welt im Gegensatz zu einer erdichteten jenseitigen mißachtet werde, bei der die natürlichen Triebe des Menschen nicht zu ihrem Rechte kämen, aber die Schwäche der Unterwerfung für das Höhere gelte. Der Mensch muß nach N. seine Instinkte möglichst befriedigen, sich selbst zum Zweck seines Daseins setzen, diesen nicht außer sich, nicht in selbstlosen Handlungen suchen, er muß sich selbst leben, den Willen zur Macht, den er hat, möglichst zur Erfüllung bringen, die Tugenden nicht über sich stellen, nicht ihnen dienen, sie vielmehr als sein Machwerk betrachten. So zeichnet N. die Gestalt des Übermenschen, der nur sich selbst will und sich seine Welt gewinnt, für den nur gut ist, was er will, der weltfreudig und stark ist in seinem Wollen und alles, was sich ihm entgegenstellt, niederwirft, nichts von Ergebung weiß, nichts von Mitleid, das nur die Tugend des Schwachen ist. Nicht alle können gleiche Macht und gleichen Genuß haben, nur gemäß ihrer verschiedenen Stärke können die einzelnen das Ziel des Menschen erreichen; deshalb gibt es auch nicht gleiche Rechte für alle Menschen: der Starke hat das Recht, der Schwache muß ihm zur Erreichung seiner Ziele dienen. Diese Gedanken sind ausgeführt in. »Also sprach Zarathustra« (1.–3. Teil, Chemn. 1883 bis 1884; 4. Teil, Leipz. 1891); »Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel zu einer Philosophie der Zukunft« (Leipz. 1886); »Zur Genealogie der Moral« (das. 1887); »Der Fall Wagner« (das. 1888); »Götzendämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert« (das. 1889). Alle diese Werke sind in einer Reihe von Auflagen erschienen. Von »Also sprach Zarathustra« sind schon 50,000 Exemplare gedruckt. Von der Gesamtausgabe der »Werke« Nietzsches enthält die erste Abteilung (Leipz. 1895, 8 Bde.) das von N. selbst Veröffentlichte und außerdem: »N. contra Wagner«, »Der Antichrist. Versuch einer Kritik des Christentums« und »Gedichte«. Eine 1893 schon begonnene (von Peter Gast) mußte nach Ausgabe von 5 Bänden abgebrochen werden. Der »Antichrist« ist das erste Buch des nicht vollendeten philosophischen Hauptwerkes Nietzsches: »Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwertung aller Werte«, dessen unvollendete weitere drei Bücher den Titel haben: »Der freie Geist. Kritik der Philosophie als einer nihilistischen Bewegung«, »Der Immoralist. Kritik der verhängnisvollsten Art von Unwissenheit der Moral«, »Dionysos, Philosophie der ewigen Wiederkunft«. Von der ersten Abteilung der Werke ist 1899 auch eine Ausgabe in kleinerm Format erschienen. Die zweite Abteilung der Gesamtausgabe ist in 7 Bänden 1901–04 erschienen und enthält aus den ungedruckten Papieren Nietzsches die unvollendeten Schriften und Fragmente, Entwürfe, Nachträge und Aphorismen. Übersetzungen der ersten Abteilung der gesamten Schriften ins Englische und Französische erschienen in London 1897 ff. und Paris 1899 ff. Von Nietzsches gesammelten Briefen sind 3 Bände veröffentlicht worden (Berl. u. Leipz. 1900–05), besonders wichtig sind die an Erwin Rhode und Malvida v. Meysenbug. Das »Leben Fr. Nietzsches« ist von seiner Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche (Leipz. 1895 bis 1904, 2 Bde.) geschrieben. Das Werk enthält auch viele Briefe und Aufzeichnungen Nietzsches. Sein Bildnis s. Tafel »Deutsche Philosophen II«.
Die Nietzscheschen Ansichten haben viele Gegner gefunden, wie dies bei dem vielen Paradoxen und Umstürzenden in ihnen natürlich, anderseits auch viele Freunde besonders in der jüngern Generation, in dieser zum Teil wegen der Zersetzung des Traditionellen. Im ganzen hat die Verehrung Nietzsches nach seinem Tod eher noch zu-als abgenommen; namentlich hat sein »Zarathustra« große Verbreitung und Bewunderung erfahren. Man fängt an, das dauernd Wertvolle bei N., namentlich sein Streben nach einer höhern Kultur und seinen Individualismus anzuerkennen und betont, daß N. selbst eine vornehme reine Natur voller Ideale war, und daß niedriger Egoismus in seiner Lehre keine Stelle findet. Manche seiner Ansichten freilich, so die von ihm selbst hochbewertete von der ewigen Wiederkunft des Gleichen, finden wenig Anerkennung. Infolge der verschiedenen Stellung zu N. ist eine große Reihe von Schriften und Abhandlungen über ihn, gegen ihn und für ihn erschienen, von denen hier nur die wichtigsten genannt sein mögen: O. Hansson, Friedrich N. (Leipz. 1890); Kaatz, Die Weltanschauung Fr. Nietzsches (Dresd. 1892–93, 2 Tle.; 2. Aufl. 1898); L. Stein, Fr. Nietzsches Weltanschauung und ihre Gefahren (Berl. 1893); Andreas-Salomé, Friedr. N. in seinen Werken (Wien 1894); Steiner, Friedr. N., ein Kämpfer gegen seine Zeit (Weim. 1895); Meta v. Salis-Marschlins, Philosoph und Edelmensch (Leipz. 1897); Th. Ziegler, Friedr. N. (Berl. 1900); Schellwien, Max Stirner und Friedr. N., Erscheinungen des modernen Geistes und das Wesen des Menschen (Leipz. 1892); Alex. Tille, Von Darwin bis N. Ein Buch Entwickelungsethik (das. 1895); Riehl, Fr. N. der Künstler und der Denker (Stuttg. 1897, 3. Aufl. 1901); Deussen, Erinnerungen an F. N. (Leipz. 1901); Vaihinger, N. als Philosoph (Berl. 1902, 3. Aufl. 1905); Richter, F. N. Sein Leben und sein Werk (Leipz. 1903); Ewald, Nietzsches Lehre in ihren Grundbegriffen (Berl. 1903); Drews, Nietzsches Philosophie (Heidelb. 1904); Lichtenberger, La philosophie de Fr. N. (Par. 1898, 6. Aufl. 1901; deutsch, 2. Aufl., Dresd.1900); J. de Gaultier, De Kant à N. (2. Aufl., Par. 1900) und N. et la réforme philosophique (das. 1905); Seillière, Apollon ou Dionysos. Étude critique sur F. N. (das. 1905; deutsch, Berl. 1905); Zoccoli, Federico N. La filosofia religiosa, la morale, l'estetica (Modena 1898, 2.Aufl. 1901); Orestano, Le idee fondamentali di Fed. N. (Palermo 1903).
Morgenröte
»Es gibt so viele Morgenröten, die noch nicht geleuchtet haben.«
Rigveda
Vorrede
1
In diesem Buche findet man einen »Unterirdischen« an der Arbeit, einen Bohrenden, Grabenden, Untergrabenden. Man sieht ihn, vorausgesetzt, daß man Augen für solche Arbeit der Tiefe hat –, wie er langsam, besonnen, mit sanfter Unerbittlichkeit vorwärts kommt, ohne daß die Not sich allzusehr verriete, welche jede lange Entbehrung von Licht und Luft mit sich bringt; man könnte ihn selbst bei seiner dunklen Arbeit zufrieden nennen. Scheint es nicht, daß irgendein Glaube ihn führt, ein Trost entschädigt? Daß er vielleicht seine eigne lange Finsternis haben will, sein Unverständliches, Verborgenes, Rätselhaftes, weil er weiß, was er auch haben wird: seinen eignen Morgen, seine eigne Erlösung, seine eigne Morgenröte?... Gewiß, er wird zurückkehren: fragt ihn nicht, was er da unten will, er wird es euch selbst schon sagen, dieser scheinbare Trophonios und Unterirdische, wenn er erst wieder »Mensch geworden« ist. Man verlernt gründlich das Schweigen, wenn man so lange, wie er, Maulwurf war, allein war – –
2
In der Tat, meine geduldigen Freunde, ich will es euch sagen, was ich da unten wollte, hier in dieser späten Vorrede, welche leicht hätte ein Nachruf, eine Leichenrede werden können: denn ich bin zurück gekommen und – ich bin davongekommen. Glaubt ja nicht, daß ich euch zu dem gleichen Wagnisse auffordern werde! Oder auch nur zur gleichen Einsamkeit! Denn wer auf solchen eignen Wegen geht, begegnet niemandem: das bringen die »eignen Wege« mit sich. Niemand kommt, ihm dabei zu helfen; mit allem, was ihm von Gefahr, Zufall, Bosheit und schlechtem Wetter zustößt, muß er allein fertig werden. Er hat eben seinen Weg für sich – und, wie billig, seine Bitterkeit, seinen gelegentlichen Verdruß an diesem »für sich«: wozu es zum Beispiel gehört, zu wissen, daß selbst seine Freunde nicht erraten können, wo er ist, wohin er geht, daß sie sich bisweilen fragen werden »wie? geht er überhaupt? hat er noch – einen Weg?« – Damals unternahm ich etwas, das nicht jedermanns Sache sein dürfte: ich stieg in die Tiefe, ich bohrte in den Grund, ich begann ein altes Vertrauen zu untersuchen und anzugraben, auf dem wir Philosophen seit ein paar Jahrtausenden wie auf dem sichersten Grunde zu bauen pflegten, – immer wieder, obwohl jedes Gebäude bisher einstürzte: ich begann unser Vertrauen zur Moral zu untergraben. Aber ihr versteht mich nicht?
3
Es ist bisher am schlechtesten über Gut und Böse nachgedacht worden: es war dies immer eine zu gefährliche Sache. Das Gewissen, der gute Ruf, die Hölle, unter Umständen selbst die Polizei erlaubten und erlauben keine Unbefangenheit; in Gegenwart der Moral soll eben, wie angesichts jeder Autorität, nicht gedacht, noch weniger geredet werden: hier wird – gehorcht! So lang die Welt steht, war noch keine Autorität willens, sich zum Gegenstand der Kritik nehmen zu lassen; und gar die Moral kritisieren, die Moral als Problem, als problematisch nehmen: wie? war das nicht – ist das nicht – unmoralisch? – Aber die Moral gebietet nicht nur über jede Art von Schreckmitteln, um sich kritische Hände und Folterwerkzeuge vom Leibe zu halten: ihre Sicherheit liegt noch mehr in einer gewissen Kunst der Bezauberung, auf die sie sich versteht, – sie weiß zu »begeistern«. Es gelingt ihr, oft mit einem einzigen Blicke, den kritischen Willen zu lähmen, sogar zu sich hinüberzulocken, ja es gibt Fälle, wo sie ihn gegen sich selbst zu kehren weiß: so daß er sich dann, gleich dem Skorpione, den Stachel in den eignen Leib sticht. Die Moral versteht sich eben von alters her auf jede Teufelei von Überredungskunst: es gibt keinen Redner, auch heute noch, der sie nicht um ihre Hilfe anginge (man höre zum Beispiel selbst unsere Anarchisten reden: wie moralisch reden sie, um zu überreden! Zuletzt heißen sie sich selbst noch gar »die Guten und Gerechten«.) Die Moral hat sich eben von jeher, so lange auf Erden geredet und überredet worden ist, als die größte Meisterin der Verführung bewiesen – und, was uns Philosophen angeht, als die eigentliche Circe der Philosophen. Woran liegt es doch, daß von Plato ab alle philosophischen Baumeister in Europa umsonst gebaut haben? Daß alles einzufallen droht oder schon in Schutt liegt, was sie selber ehrlich und ernsthaft für aere perennius hielten? Oh wie falsch ist die Antwort, welche man jetzt noch auf diese Frage bereit hält, »weil von ihnen allen die Voraussetzung versäumt war, die Prüfung des Fundamentes, eine Kritik der gesamten Vernunft« – jene verhängnisvolle Antwort Kants, der damit uns moderne Philosophen wahrhaftig nicht auf einen festeren und weniger trüglichen Boden gelockt hat! (– und nachträglich gefragt, war es nicht etwas sonderbar, zu verlangen, daß ein Werkzeug seine eigne Trefflichkeit und Tauglichkeit kritisieren solle? daß der Intellekt selbst seinen Wert, seine Kraft, seine Grenzen »erkennen« solle? war es nicht sogar ein wenig widersinnig? –) Die richtige Antwort wäre vielmehr gewesen, daß alle Philosophen unter der Verführung der Moral gebaut haben, auch Kant –, daß ihre Absicht scheinbar auf Gewißheit, auf »Wahrheit«, eigentlich aber auf »majestätische sittliche Gebäude« ausging: um uns noch einmal der unschuldigen Sprache Kants zu bedienen, der es als seine eigne »nicht so glänzende, aber doch auch nicht verdienstlose« Aufgabe und Arbeit bezeichnet, »den Boden zu jenen majestätischen sittlichen Gebäuden eben und baufest zu machen« (Kritik der reinen Vernunft II, S. 257). Ach, es ist ihm damit nicht gelungen, im Gegenteil! – wie man heute sagen muß. Kant war mit einer solchen schwärmerischen Absicht eben der rechte Sohn seines Jahrhunderts, das mehr als jedes andre das Jahrhundert der Schwärmerei genannt werden darf: wie er es, glücklicherweise, auch in bezug auf dessen wertvollere Seiten geblieben ist (zum Beispiel mit jenem guten Stück Sensualismus, den er in seine Erkenntnistheorie hinübernahm). Auch ihn hatte die Moral-Tarantel Rousseau gebissen, auch ihm lag der Gedanke des moralischen Fanatismus auf dem Grunde der Seele, als dessen Vollstrecker sich ein andrer Jünger Rousseaus fühlte und bekannte, nämlich Robespierre, »de fonder sur la terre l'empire de la sagesse, de la justice et de la vertu« (Rede vom 7. Juni 1794). Andrerseits konnte man es, mit einem solchen Franzosen-Fanatismus im Herzen, nicht unfranzösischer, nicht tiefer, gründlicher, deutscher treiben – wenn das Wort »deutsch« in diesem Sinne heute noch erlaubt ist –, als es Kant getrieben hat: um Raum für sein »moralisches Reich« zu schaffen, sah er sich genötigt, eine unbeweisbare Welt anzusetzen, ein logisches »Jenseits«, – dazu eben hatte er seine Kritik der reinen Vernunft nötig! Anders ausgedrückt: er hätte sie nicht nötig gehabt, wenn ihm nicht eins wichtiger als alles gewesen wäre, das »moralische Reich« unangreifbar, lieber noch ungreifbar für die Vernunft zu machen, – er empfand eben die Angreifbarkeit einer moralischen Ordnung der Dinge von seiten der Vernunft zu stark! Denn angesichts von Natur und Geschichte, angesichts der gründlichen Unmoralität von Natur und Geschichte war Kant, wie jeder gute Deutsche von alters her, Pessimist; er glaubte an die Moral, nicht weil sie durch Natur und Geschichte bewiesen wird, sondern trotzdem daß ihr durch Natur und Geschichte beständig widersprochen wird. Man darf sich vielleicht, um dies »trotzdem daß« zu verstehen, an etwas Verwandtes bei Luther erinnern, bei jenem andern großen Pessimisten, der es einmal mit der ganzen lutherischen Verwegenheit seinen Freunden zu Gemüte führte: »wenn man durch Vernunft es fassen könnte, wie der Gott gnädig und gerecht sein könne, der so viel Zorn und Bosheit zeigt, wozu brauchte man dann den Glauben?« Nichts nämlich hat von jeher einen tieferen Eindruck auf die deutsche Seele gemacht, nichts hat sie mehr »versucht«, als diese gefährlichste aller Schlußfolgerungen, welche jedem rechten Romanen eine Sünde wider den Geist ist: credo quia absurdum est: – mit ihr tritt die deutsche Logik zuerst in der Geschichte des christlichen Dogmas auf: aber auch heute noch, ein Jahrtausend später, wittern wir Deutschen von heute, späte Deutsche in jedem Betrachte – etwas von Wahrheit, von Möglichkeit der Wahrheit hinter dem berühmten realdialektischen Grund-Satze, mit welchem Hegel seiner Zeit dem deutschen Geiste zum Sieg über Europa verhalf – »Der Widerspruch bewegt die Welt, alle Dinge sind sich selbst widersprechend« –: wir sind eben, sogar bis in die Logik hinein, Pessimisten.
4
Aber nicht die logischen Werturteile sind die untersten und gründlichsten, zu denen die Tapferkeit unsres Argwohns hinunterkann: das Vertrauen auf die Vernunft, mit dem die Gültigkeit dieser Urteile steht und fällt, ist, als Vertrauen, ein moralisches Phänomen... Vielleicht hat der deutsche Pessimismus seinen letzten Schritt noch zu tun? Vielleicht muß er noch einmal auf eine furchtbare Weise sein credo und sein absurdum nebeneinanderstellen? Und wenn dies Buch bis in die Moral hinein, bis über das Vertrauen zur Moral hinweg pessimistisch ist, – sollte es nicht gerade damit ein deutsches Buch sein? Denn es stellt in der Tat einen Widerspruch dar und fürchtet sich nicht davor: in ihm wird der Moral das Vertrauen gekündigt – warum doch? Aus Moralität! Oder wie sollen wirs heißen, was sich in ihm – in uns – begibt? denn wir würden unsrem Geschmacke nach bescheidenere Worte vorziehn. Aber es ist kein Zweifel, auch zu uns noch redet ein »du sollst«, auch wir noch gehorchen einem strengen Gesetze über uns, – und dies ist die letzte Moral, die sich auch uns noch hörbar macht, die auch wir noch zu leben wissen, hier, wenn irgendworin, sind auch wir noch Menschen des Gewissens: daß wir nämlich nicht wieder zurückwollen in das, was uns als überlebt und morsch gilt, in irgend etwas »Unglaubwürdiges«, heiße es nun Gott, Tugend, Wahrheit, Gerechtigkeit, Nächstenliebe; daß wir uns keine Lügenbrücken zu alten Idealen gestatten; daß wir von Grund aus allem feind sind, was in uns vermitteln und mischen möchte; feind jeder jetzigen Art Glauben und Christlichkeit; feind dem Halb-und Halben aller Romantik und Vaterländerei; feind auch der Artisten-Genüßlichkeit, Artisten-Gewissenlosigkeit, welche uns überreden möchte, da anzubeten, wo wir nicht mehr glauben – denn wir sind Artisten –; feind, kurzum, dem ganzen europäischen Feminismus (oder Idealismus, wenn man's lieber hört), der ewig »hinan zieht« und ewig gerade damit »herunter bringt«: – allein als Menschen dieses Gewissens fühlen wir uns noch verwandt mit der deutschen Rechtschaffenheit und Frömmigkeit von Jahrtausenden, wenn auch als deren fragwürdigste und letzte Abkömmlinge, wir Immoralisten, wir Gottlosen von heute, ja sogar, in gewissem Verstande, als deren Erben, als Vollstrecker ihres innersten Willens, eines pessimistischen Willens, wie gesagt, der sich davor nicht fürchtet, sich selbst zu verneinen, weil er mit Lust verneint! In uns vollzieht sich, gesetzt daß ihr eine Formel wollt, – die Selbstaufhebung der Moral. – –
5
– Zuletzt aber: wozu müßten wir das, was wir sind, was wir wollen und nicht wollen, so laut und mit solchem Eifer sagen? Sehen wir es kälter, ferner, klüger, höher an, sagen wir es, wie es unter uns gesagt werden darf, so heimlich, daß alle Welt es überhört, daß alle Welt uns überhört! Vor allem sagen wir es langsam... Diese Vorrede kommt spät, aber nicht zu spät, was liegt im Grunde an fünf, sechs Jahren? Ein solches Buch, ein solches Problem hat keine Eile; überdies sind wir beide Freunde des lento, ich ebensowohl als mein Buch. Man ist nicht umsonst Philologe gewesen, man ist es vielleicht noch, das will sagen, ein Lehrer des langsamen Lesens: – endlich schreibt man auch langsam. Jetzt gehört es nicht nur zu meinen Gewohnheiten, sondern auch zu meinem Geschmacke – einem boshaften Geschmacke vielleicht? –, nichts mehr zu schreiben, womit nicht jede Art Mensch, die »Eile hat«, zur Verzweiflung gebracht wird. Philologie nämlich ist jene ehrwürdige Kunst, welche von ihrem Verehrer vor allem eins heischt, beiseite gehn, sich Zeit lassen, still werden, langsam werden –, als eine Goldschmiedekunst und -kennerschaft des Wortes, die lauter feine vorsichtige Arbeit abzutun hat und nichts erreicht, wenn sie es nicht lento erreicht. Gerade damit aber ist sie heute nötiger als je, gerade dadurch zieht sie und bezaubert sie uns am stärksten, mitten in einem Zeitalter der »Arbeit«, will sagen: der Hast, der unanständigen und schwitzenden Eilfertigkeit, das mit allem gleich »fertig werden« will, auch mit jedem alten und neuen Buche: – sie selbst wird nicht so leicht irgend womit fertig, sie lehrt gut lesen, das heißt langsam, tief, rück- und vorsichtig, mit Hintergedanken mit offengelassenen Türen, mit zarten Fingern und Augen lesen... Meine geduldigen Freunde, dies Buch wünscht sich nur vollkommne Leser und Philologen: lernt mich gut lesen! –
Rutabei Genua, im Herbst des Jahres 1886
Erstes Buch
1
Nachträgliche Vernünftigkeit. – Alle Dinge, die lange leben, werden allmählich so mit Vernunft durchtränkt, daß ihre Abkunft aus der Unvernunft dadurch unwahrscheinlich wird. Klingt nicht fast jede genaue Geschichte einer Entstehung für das Gefühl paradox und frevelhaft? Widerspricht der gute Historiker im Grunde nicht fortwährend?
2
Vorurteil der Gelehrten. – Es ist ein richtiges Urteil der Gelehrten, daß die Menschen aller Zeiten zu wissen glaubten, was gut und böse, lobens- und tadelnswert sei. Aber es ist ein Vorurteil der Gelehrten, daß wir es jetzt besser wüßten als irgendeine Zeit.
3
Alles hat seine Zeit. – Als der Mensch allen Dingen ein Geschlecht gab, meinte er nicht zu spielen, sondern eine tiefe Einsicht gewonnen zu haben: – den ungeheuren Umfang dieses Irrtums hat er sich sehr spät und jetzt vielleicht noch nicht ganz eingestanden. – Ebenso hat der Mensch allem, was da ist, eine Beziehung zur Moral beigelegt und der Welt eine ethische Bedeutung über die Schulter gehängt. Das wird einmal ebensoviel und nicht mehr Wert haben, als es heute schon der Glaube an die Männlichkeit oder Weiblichkeit der Sonne hat.
4
Gegen die erträumte Disharmonie der Sphären. – Wir müssen die viele falsche Großartigkeit wieder aus der Welt schaffen, weil sie gegen die Gerechtigkeit ist, auf die alle Dinge vor uns Anspruch haben! Und dazu tut not, die Welt nicht disharmonischer sehen zu wollen, als sie ist!
5
Seid dankbar! – Das große Ergebnis der bisherigen Menschen ist, daß wir nicht mehr beständige Furcht vor wilden Tieren, vor Barbaren, vor Göttern und vor unseren Träumen zu haben brauchen.
6
Der Taschenspieler und sein Widerspiel. – Das Erstaunliche in der Wissenschaft ist dem Erstaunlichen in der Kunst des Taschenspielers entgegengesetzt. Denn dieser will uns dafür gewinnen, eine sehr einfache Kausalität dort zu sehen, wo in Wahrheit eine sehr komplizierte Kausalität in Tätigkeit ist. Die Wissenschaft dagegen nötigt uns, den Glauben an einfache Kausalitäten gerade dort aufzugeben, wo alles so leicht begreiflich scheint und wir die Narren des Augenscheins sind. Die »einfachsten« Dinge sind sehr kompliziert, – man kann sich nicht genug darüber verwundern!
7
Umlernen des Raumgefühls. – Haben die wirklichen Dinge oder die eingebildeten Dinge mehr zum menschlichen Glück beigetragen? Gewiß ist, daß die Weite des Raumes zwischen höchstem Glück und tiefstem Unglück erst mit Hilfe der eingebildeten Dinge hergestellt worden ist. Diese Art von Raumgefühl wird folglich, unter der Einwirkung der Wissenschaft, immer verkleinert: so wie wir von ihr gelernt haben und noch lernen, die Erde als klein, ja das Sonnensystem als Punkt zu empfinden.
8
Transfiguration. – Die ratlos Leidenden, die verworren Träumenden, die überirdisch Entzückten, – dies sind die drei Grade, in welche Raffael die Menschen einteilt. So blicken wir nicht mehr in die Welt – und auch Raffael dürfte es jetzt nicht mehr: er würde eine neue Transfiguration mit Augen sehen.
9
Begriff der Sittlichkeit der Sitte. – Im Verhältnis zu der Lebensweise ganzer Jahrtausende der Menschheit leben wir jetzigen Menschen in einer sehr unsittlichen Zeit: die Macht der Sitte ist erstaunlich abgeschwächt und das Gefühl der Sittlichkeit so verfeinert und so in die Höhe getragen, daß es ebensogut als verflüchtigt bezeichnet werden kann. Deshalb werden uns, den Spätgeborenen, die Grundeinsichten in die Entstehung der Moral schwer, sie bleiben uns, wenn wir sie trotzdem gefunden haben, an der Zunge kleben und wollen nicht heraus: weil sie grob klingen! Oder weil sie die Sittlichkeit zu verleumden scheinen! So zum Beispiel gleich der Hauptsatz: Sittlichkeit ist nichts anderes (also namentlich nicht mehr!), als Gehorsam gegen Sitten, welcher Art diese auch sein mögen; Sitten aber sind die herkömmliche Art zu handeln und abzuschätzen. In Dingen, wo kein Herkommen befiehlt, gibt es keine Sittlichkeit; und je weniger das Leben durch Herkommen bestimmt ist, um so kleiner wird der Kreis der Sittlichkeit. Der freie Mensch ist unsittlich, weil er in allem von sich und nicht von einem Herkommen abhängen will: in allen ursprünglichen Zuständen der Menschheit bedeutet »böse« so viel wie »individuell«, »frei«, »willkürlich«, »ungewohnt«, »unvorhergesehen«, »unberechenbar«. Immer nach dem Maßstab solcher Zustände gemessen: wird eine Handlung getan nicht weil das Herkommen sie befiehlt, sondern aus anderen Motiven (zum Beispiel des individuellen Nutzens wegen), ja selbst aus eben den Motiven, welche das Herkommen ehemals begründet haben, so heißt sie unsittlich und wird so selbst von ihrem Täter empfunden: denn sie ist nicht aus Gehorsam gegen das Herkommen getan worden. Was ist das Herkommen? Eine höhere Autorität, welcher man gehorcht, nicht weil sie das uns Nützliche befiehlt, sondern weil sie befiehlt. – Wodurch unterscheidet sich dies Gefühl vor dem Herkommen von dem Gefühl der Furcht überhaupt? Es ist die Furcht vor einem höheren Intellekt, der da befiehlt, vor einer unbegreiflichen, unbestimmten Macht, vor etwas mehr als Persönlichem, – es ist Aberglaube in dieser Furcht. – Ursprünglich gehörte die ganze Erziehung und Pflege der Gesundheit, die Ehe, die Heilkunst, der Feldbau, der Krieg, das Reden und Schweigen, der Verkehr untereinander und mit den Göttern in den Bereich der Sittlichkeit: sie verlangte, daß man Vorschriften beobachtete, ohne an sich als Individuum zu denken. Ursprünglich also war alles Sitte, und wer sich über sie erheben wollte, mußte Gesetzgeber und Medizinmann und eine Art Halbgott werden: das heißt, er mußte Sitten machen, – ein furchtbares, lebensgefährliches Ding! – Wer ist der Sittlichste? Einmal der, welcher das Gesetz am häufigsten erfüllt: also, gleich dem Brahmanen, das Bewußtsein desselben überallhin und in jeden kleinen Zeitteil trägt, so daß er fortwährend erfinderisch ist in Gelegenheiten, das Gesetz zu erfüllen. Sodann der, der es auch in den schwersten Fällen erfüllt. Der Sittlichste ist der, welcher am meisten der Sitte opfert: welches aber sind die größten Opfer? Nach der Beantwortung dieser Frage entfalten sich mehrere unterschiedliche Moralen; aber der wichtigste Unterschied bleibt doch jener, welcher die Moralität der häufigsten Erfüllung von der der schwersten Erfüllung trennt. Man täusche sich über das Motiv jener Moral nicht, welche die schwerste Erfüllung der Sitte als Zeichen der Sittlichkeit fordert! Die Selbstüberwindung wird nicht ihrer nützlichen Folgen halber, die sie für das Individuum hat, gefordert, sondern damit die Sitte, das Herkommen herrschend erscheine, trotz allem individuellen Gegengelüst und Vorteil: der einzelne soll sich opfern, – so heischt es die Sittlichkeit der Sitte. – Jene Moralisten dagegen, welche wie die Nachfolger der sokratischen Fußtapfen die Moral der Selbstbeherrschung und Enthaltsamkeit dem Individuum als seinen eigensten Vorteil, als seinen persönlichsten Schlüssel zum Glück ans Herz legen, machen die Ausnahme – und wenn es uns anders erscheint, so ist es, weil wir unter ihrer Nachwirkung erzogen sind: sie alle gehen eine neue Straße unter höchlichster Mißbilligung aller Vertreter der Sittlichkeit der Sitte, – sie lösen sich aus der Gemeinde aus, als Unsittliche, und sind, im tiefsten Verstande, böse. Ebenso erschien einem tugendhaften Römer alten Schrotes jeder Christ, welcher »am ersten nach seiner eigenen Seligkeit trachtete«, – als böse. – Überall, wo es eine Gemeinde und folglich eine Sittlichkeit der Sitte gibt, herrscht auch der Gedanke, daß die Strafe für die Verletzung der Sitte vor allem auf die Gemeinde fällt: jene übernatürliche Strafe, deren Äußerung und Grenze so schwer zu begreifen ist und mit so abergläubischer Angst ergründet wird. Die Gemeinde kann den einzelnen anhalten, daß er den nächsten Schaden, den seine Tat im Gefolge hatte, am einzelnen oder an der Gemeinde wieder gut mache, sie kann auch eine Art Rache am einzelnen dafür nehmen, daß durch ihn, als angebliche Nachwirkung seiner Tat, sich die göttlichen Wolken und Zorneswetter über der Gemeinde gesammelt haben, – aber sie empfindet die Schuld des einzelnen doch vor allem als ihre Schuld und trägt dessen Strafe als ihre Strafe –: »die Sitten sind locker geworden, so klagt es in der Seele eines jeden, wenn solche Taten möglich sind.« Jede individuelle Handlung, jede individuelle Denkweise erregt Schauder; es ist gar nicht auszurechnen, was gerade die seltneren, ausgesuchteren, ursprünglicheren Geister im ganzen Verlauf der Geschichte dadurch gelitten haben müssen, daß sie immer als die bösen und gefährlichen empfunden wurden, ja daß sie sich selber so empfanden. Unter der Herrschaft der Sittlichkeit der Sitte hat die Originalität jeder Art ein böses Gewissen bekommen; bis diesen Augenblick ist der Himmel der Besten noch dadurch verdüsterter, als er sein müßte.
10
Gegenbewegung zwischen Sinn der Sittlichkeit und Sinn der Kausalität. – In dem Maße, in welchem der Sinn der Kausalität zunimmt, nimmt der Umfang des Reiches der Sittlichkeit ab: denn jedesmal, wenn man die notwendigen Wirkungen begriffen hat und gesondert von allen Zufällen, allem gelegentlichen Nachher (post hoc) zu denken versteht, hat man eine Unzahl phantastischer Kausalitäten, an welche als Grundlagen von Sitten bisher geglaubt wurde, zerstört – die wirkliche Welt ist viel kleiner als die phantastische – und jedesmal ist ein Stück Ängstlichkeit und Zwang aus der Welt verschwunden, jedesmal auch ein Stück Achtung vor der Autorität der Sitte: die Sittlichkeit im großen hat eingebüßt. Wer sie dagegen vermehren will, muß zu verhüten wissen, daß die Erfolge kontrollierbar werden.
11
Volksmoral und Volksmedizin. – An der Moral, welche in einer Gemeinde herrscht, wird fortwährend und von jedermann gearbeitet: die meisten bringen Beispiele über Beispiele für das behauptete Verhältnis von Ursache und Folge, Schuld und Strafe hinzu, bestätigen es als wohlbegründet und mehren seinen Glauben: einige machen neue Beobachtungen über Handlungen und Folgen und ziehen Schlüsse und Gesetze daraus: die wenigsten nehmen hie und da Anstoß und lassen den Glauben an diesen Punkten schwach werden. – Alle aber sind einander gleich in der gänzlich rohen, unwissenschaftlichen Art ihrer Tätigkeit; ob es sich um Beispiele, Beobachtungen oder Anstöße handelt, ob um den Beweis, die Bekräftigung, den Ausdruck, die Widerlegung eines Gesetzes, – es ist wertloses Material und wertlose Form, wie Material und Form aller Volksmedizin. Volksmedizin und Volksmoral gehören zusammen und sollten nicht mehr so verschieden abgeschätzt werden, wie es immer noch geschieht: beides sind die gefährlichsten Scheinwissenschaften.
12
Die Folge als Zutat. – Ehemals glaubte man, der Erfolg einer Tat sei nicht eine Folge, sondern eine freie Zutat – nämlich Gottes. Ist eine größere Verwirrung denkbar? Man mußte sich um die Tat und um den Erfolg besonders bemühen, mit ganz verschiedenen Mitteln und Praktiken!
13
Zur neuen Erziehung des Menschengeschlechts. – Helft, ihr Hilfreichen und Wohlgesinnten, doch an dem einen Werke mit, den Begriff der Strafe, der die ganze Welt überwuchert hat, aus ihr zu entfernen! Es gibt kein böseres Unkraut! Nicht nur in die Folgen unserer Handlungsweisen hat man ihn gelegt – und wie schrecklich und vernunftwidrig ist schon dies, Ursache und Wirkung als Ursache und Strafe zu verstehen! – aber man hat mehr getan und die ganze reine Zufälligkeit des Geschehens um ihre Unschuld gebracht, mit dieser verruchten Interpretationskunst des Straf-Begriffs. Ja, man hat die Tollheit so weit getrieben, die Existenz selber als Strafe empfinden zu heißen, – es ist, als ob die Phantasterei von Kerkermeistern und Henkern bisher die Erziehung des Menschengeschlechts geleitet hätte!
14
Bedeutung des Wahnsinns in der Geschichte der Moralität. – Wenn trotz jenem furchtbaren Druck der »Sittlichkeit der Sitte«, unter dem alle Gemeinwesen der Menschheit lebten, viele Jahrtausende lang vor unserer Zeitrechnung und in derselben im ganzen und großen fort bis auf den heutigen Tag (wir selber wohnen in der kleinen Welt der Ausnahmen und gleichsam in der bösen Zone): – wenn, sage ich, trotzdem neue und abweichende Gedanken, Wertschätzungen, Triebe immer wieder herausbrachen, so geschah dies unter einer schauderhaften Geleitschaft: fast überall ist es der Wahnsinn, welcher dem neuen Gedanken den Weg bahnt, welcher den Bann eines verehrten Brauches und Aberglaubens bricht. Begreift ihr es, weshalb es der Wahnsinn sein mußte? Etwas in Stimme und Gebärde so Grausenhaftes und Unberechenbares wie die dämonischen Launen des Wetters und des Meeres und deshalb einer ähnlichen Scheu und Beobachtung Würdiges? Etwas, das so sichtbar das Zeichen völliger Unfreiwilligkeit trug, wie die Zuckungen und der Schaum des Epileptischen, das den Wahnsinnigen dergestalt als Maske und Schallrohr einer Gottheit zu kennzeichnen schien? Etwas, das dem Träger eines neuen Gedankens selber Ehrfurcht und Schauder vor sich und nicht mehr Gewissensbisse gab und ihn dazu trieb, der Prophet und Märtyrer desselben zu werden? – Während es uns heute noch immer wieder nahegelegt wird, daß dem Genie, anstatt eines Kornes Salz, ein Korn Wahnwurz beigegeben ist, lag allen früheren Menschen der Gedanke viel näher, daß überall, wo es Wahnsinn gibt, es auch ein Korn Genie und Weisheit gäbe, – etwas »Göttliches«, wie man sich zuflüsterte. Oder vielmehr: man drückte sich kräftig genug aus. »Durch den Wahnsinn sind die größten Güter über Griechenland gekommen«, sagte Plato mit der ganzen alten Menschheit. Gehen wir noch einen Schritt weiter: allen jenen überlegenen Menschen, welche es unwiderstehlich dahin zog, das Joch irgendeiner Sittlichkeit zu brechen und neue Gesetze zu geben, blieb, wenn sie nicht wirklich wahnsinnig waren, nichts übrig, als sich wahnsinnig zu machen oder zu stellen – und zwar gilt dies für die Neuerer auf allen Gebieten, nicht nur auf dem der priesterlichen und politischen Satzung: – selbst der Neuerer des poetischen Metrums mußte durch den Wahnsinn sich beglaubigen. (Bis in viel mildere Zeiten hinein verblieb daraus den Dichtern eine gewisse Konvention des Wahnsinns: auf welche zum Beispiel Solon zurückgriff, als er die Athener zur Wiedereroberung von Salamis aufstachelte.) – »Wie macht man sich wahnsinnig, wenn man es nicht ist und nicht wagt, es zu scheinen?« diesem entsetzlichen Gedankengange haben fast alle bedeutenden Menschen der älteren Zivilisation nachgehangen; eine geheime Lehre von Kunstgriffen und diätetischen Winken pflanzte sich darüber fort, nebst dem Gefühle der Unschuld, ja Heiligkeit eines solchen Nachsinnens und Vorhabens. Die Rezepte, um bei den Indianern ein Medizinmann, bei den Christen des Mittelalters ein Heiliger, bei den Grönländern ein Angekok, bei den Brasilianern ein Paje zu werden, sind im wesentlichen dieselben: unsinniges Fasten, fortgesetzte geschlechtliche Enthaltung, in die Wüste gehen oder auf einen Berg oder eine Säule steigen, oder »sich auf eine bejahrte Weide setzen, die in einen See hinaussieht« und schlechterdings an nichts denken als das, was eine Verzückung und geistige Unordnung mit sich bringen kann. Wer wagt es, einen Blick in die Wildnis bitterster und überflüssigster Seelennöte zu tun, in welchen wahrscheinlich gerade die fruchtbarsten Menschen aller Zeiten geschmachtet haben! Jene Seufzer der Einsamen und Verstörten zu hören: »Ach, so gebt doch Wahnsinn, ihr Himmlischen! Wahnsinn, daß ich endlich an mich selber glaube! Gebt Delirien und Zuckungen, plötzliche Lichter und Finsternisse, schreckt mich mit Frost und Glut, wie sie kein Sterblicher noch empfand, mit Getöse und umgehenden Gestalten, laßt mich heulen und winseln und wie ein Tier kriechen: nur daß ich bei mir selber Glauben finde! Der Zweifel frißt mich auf, ich habe das Gesetz getötet, das Gesetz ängstigt mich wie ein Leichnam einen Lebendigen: wenn ich nicht mehr bin als das Gesetz, so bin ich der Verworfenste von allen. Der neue Geist, der in mir ist, woher ist er, wenn er nicht von euch ist? Beweist es mir doch, daß ich euer bin; der Wahnsinn allein beweist es mir.« Und nur zu oft erreichte diese Inbrunst ihr Ziel zu gut: in jener Zeit, in welcher das Christentum am reichsten seine Fruchtbarkeit an Heiligen und Wüsten-Einsiedlern bewies und sich dadurch selber zu beweisen vermeinte, gab es in Jerusalem große Irrenhäuser für verunglückte Heilige, für jene, welche ihr letztes Korn Salz darangegeben hatten.
15
Die ältesten Trostmittel. – Erste Stufe: der Mensch sieht in jedem Übelbefinden und Mißgeschick etwas, wofür er irgend jemand anderes leiden lassen muß, – dabei wird er sich seiner noch vorhandenen Macht bewußt, und dies tröstet ihn. Zweite Stufe: der Mensch sieht in jedem Übelbefinden und Mißgeschick eine Strafe, das heißt die Sühnung der Schuld und das Mittel, sich vom bösartigen Zauber eines wirklichen oder vermeintlichen Unrechtes loszumachen. Wenn er dieses Vorteils ansichtig wird, welchen das Unglück mit sich bringt, so glaubt er einen anderen nicht mehr dafür leiden lassen zu müssen, – er sagt sich von dieser Art Befriedigung los, weil er nun eine andere hat.
16
Erster Satz der Zivilisation.– Bei rohen Völkern gibt es eine Gattung von Sitten, deren Absicht die Sitte überhaupt zu sein scheint: peinliche und im Grunde überflüssige Bestimmungen (wie zum Beispiel die unter den Kamtschadalen, niemals den Schnee von den Schuhen mit dem Messer abzuschaben, niemals eine Kohle mit dem Messer zu spießen, niemals ein Eisen ins Feuer zu legen – und der Tod trifft den, welcher in solchen Stücken zuwiderhandelt!), die aber die fortwährende Nähe der Sitte, den unausgesetzten Zwang, Sitten zu üben, fortwährend im Bewußtsein erhalten: zur Bekräftigung des großen Satzes, mit dem die Zivilisation beginnt: jede Sitte ist besser als keine Sitte.
17
Die gute und die böse Natur. – Erst haben die Menschen sich in die Natur hineingedichtet: sie sahen überall sich und ihresgleichen, nämlich ihre böse und launenhafte Gesinnung, gleichsam versteckt unter Wolken, Gewittern, Raubtieren, Bäumen und Kräutern: damals erfanden sie die »böse Natur«. Dann kam einmal eine Zeit, da sie sich wieder aus der Natur herausdichteten, die Zeit Rousseaus: man war einander so satt, daß man durchaus einen Weltwinkel haben wollte, wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual: man erfand die »gute Natur«.
18
Die Moral des freiwilligen Leidens. – Welcher Genuß ist für Menschen im Kriegszustande jener kleinen, stets gefährdeten Gemeinde, wo die strengste Sittlichkeit waltet, der höchste? Also für kraftvolle, rachsüchtige, feindselige, tückische, argwöhnische, zum Furchtbarsten bereite und durch Entbehrung und Sittlichkeit gehärtete Seelen? Der Genuß der Grausamkeit: so wie es auch zur Tugend einer solchen Seele in diesen Zuständen gerechnet wird, in der Grausamkeit erfinderisch und unersättlich zu sein. An dem Tun des Grausamen erquickt sich die Gemeinde und wirft einmal die Düsterkeit der beständigen Angst und Vorsicht von sich. Die Grausamkeit gehört zur ältesten Festfreude der Menschheit. Folglich denkt man sich auch die Götter erquickt und festlich gestimmt, wenn man ihnen den Anblick der Grausamkeit anbietet, – und so schleicht sich die Vorstellung in die Welt, daß das freiwillige Leiden, die selbsterwählte Marter einen guten Sinn und Wert habe. Allmählich formt die Sitte in der Gemeinde eine Praxis gemäß dieser Vorstellung: man wird bei allem ausschweifenden Wohlbefinden von nun an mißtrauischer und bei allen schweren schmerzhaften Zuständen zuversichtlicher; man sagt sich: es mögen wohl die Götter ungnädig wegen des Glücks und gnädig wegen unseres Leidens auf uns sehen, – nicht etwa mitleidig! Denn das Mitleiden gilt als verächtlich und einer starken, furchtbaren Seele unwürdig; – aber gnädig, weil sie dadurch ergötzt und guter Dinge werden: denn der Grausame genießt den höchsten Kitzel des Machtgefühls. So kommt in den Begriff des »sittlichsten Menschen« der Gemeinde die Tugend des häufigen Leidens, der Entbehrung, der harten Lebensweise, der grausamen Kasteiung, – nicht, um es wieder und wieder zu sagen, als Mittel der Zucht, der Selbstbeherrschung, des Verlangens nach individuellem Glück, – sondern als eine Tugend, welche der Gemeinde bei den bösen Göttern einen guten Geruch macht und wie ein beständiges Versöhnungsopfer auf dem Altare zu ihnen empordampft. Alle jene geistigen Führer der Völker, welche in dem trägen furchtbaren Schlamm ihrer Sitten etwas zu bewegen vermochten, haben außer dem Wahnsinn auch die freiwillige Marter nötig gehabt, um Glauben zu finden – und zumeist und zuerst, wie immer, den Glauben an sich selber! Je mehr gerade ihr Geist auf neuen Bahnen ging und folglich von Gewissensbissen und Ängsten gequält wurde, um so grausamer wüteten sie gegen das eigene Fleisch, das eigene Gelüste und die eigene Gesundheit, – wie um der Gottheit einen Ersatz an Lust zu bieten, wenn sie vielleicht um der vernachlässigten und bekämpften Gebräuche und der neuen Ziele willen erbittert sein sollte. Glaube man nicht zu schnell, daß wir jetzt von einer solchen Logik des Gefühls uns völlig befreit hätten! Die heldenhaftesten Seelen mögen sich darüber mit sich befragen. Jeder kleinste Schritt auf dem Felde des freien Denkens, des persönlich gestalteten Lebens ist von jeher mit geistigen und körperlichen Martern erstritten worden: nicht nur das Vorwärts-Schreiten, nein! vor allem das Schreiten, die Bewegung, die Veränderung hat ihre unzähligen Märtyrer nötig gehabt, durch die langen pfadsuchenden und grundlegenden Jahrtausende hindurch, an welche man freilich nicht denkt, wenn man, wie gewohnt, von »Weltgeschichte«, von diesem lächerlich kleinen Ausschnitt des menschlichen Daseins redet; und selbst in dieser sogenannten Weltgeschichte, welche im Grunde ein Lärm um die letzten Neuigkeiten ist, gibt es kein eigentlich wichtigeres Thema, als die uralte Tragödie von den Märtyrern, die den Sumpf bewegen wollten. Nichts ist teurer erkauft als das Wenige von menschlicher Vernunft und vom Gefühle der Freiheit, welches jetzt unsern Stolz ausmacht. Dieser Stolz aber ist es, dessentwegen es uns jetzt fast unmöglich wird, mit jenen ungeheuren Zeitstrecken der »Sittlichkeit der Sitte« zu empfinden, welche der »Weltgeschichte« vorausliegen, als die wirkliche und entscheidende Hauptgeschichte, welche den Charakter der Menschheit festgestellt hat: wo das Leiden als Tugend, die Grausamkeit als Tugend, die Verstellung als Tugend, die Rache als Tugend, die Verleugnung der Vernunft als Tugend, dagegen das Wohlbefinden als Gefahr, die Wißbegier als Gefahr, der Friede als Gefahr, das Mitleiden als Gefahr, das Bemitleidetwerden als Schimpf, die Arbeit als Schimpf, der Wahnsinn als Göttlichkeit, die Veränderung als das Unsittliche und Verderbenschwangere in Geltung war! – Ihr meint, es habe sich alles dies geändert, und die Menschheit müsse somit ihren Charakter vertauscht haben? Oh, ihr Menschenkenner, lernt euch besser kennen!
19
Sittlichkeit und Verdummung. – Die Sitte repräsentiert die Erfahrungen früherer Menschen über das vermeintlich Nützliche und Schädliche, – aber das Gefühl für die Sitte (Sittlichkeit) bezieht sich nicht auf jene Erfahrungen als solche, sondern auf das Alter, die Heiligkeit, die Indiskutabilität der Sitte. Und damit wirkt dies Gefühl dem entgegen, daß man neue Erfahrungen macht und die Sitten korrigiert: das heißt, die Sittlichkeit wirkt der Entstehung neuer und besserer Sitten entgegen: sie verdummt.
20
Freitäter und Freidenker. – Die Freitäter sind im Nachteil gegen die Freidenker, weil die Menschen sichtbarer an den Folgen von Taten als von Gedanken leiden. Bedenkt man aber, daß diese wie jene ihre Befriedigung suchen, und daß den Freidenkern schon ein Ausdenken und Aussprechen von verbotenen Dingen diese Befriedigung gibt, so ist in Ansehung der Motive alles eins: und in Ansehung der Folgen wird der Ausschlag sogar gegen den Freidenker sein, vorausgesetzt, daß man nicht nach der nächsten und gröbsten Sichtbarkeit – das heißt: nicht wie alle Welt urteilt. Man hat viel von der Verunglimpfung wieder zurückzunehmen, mit der die Menschen alle jene bedacht haben, welche durch die Tat den Bann einer Sitte durchbrachen, – im allgemeinen heißen sie Verbrecher. Jeder, der das bestehende Sittengesetz umwarf, hat bisher zuerst immer als schlechter Mensch gegolten: aber wenn man, wie es vorkam, hinterher es nicht wieder aufzurichten vermochte und sich damit zufrieden gab, so veränderte sich das Prädikat allmählich; – die Geschichte handelt fast nur von diesen schlechten Menschen, welche später gutgesprochen worden sind!
21
»Erfüllung des Gesetzes.« – Im Falle, daß die Befolgung einer moralischen Vorschrift doch ein anderes Resultat ergibt, als versprochen und erwartet wird, und den Sittlichen nicht das verheißene Glück, sondern wider Erwarten Unglück und Elend trifft, so bleibt immer die Ausflucht des Gewissenhaften und Ängstlichen übrig: »es ist etwas in der Ausführung versehen worden.« Im allerschlimmsten Falle wird eine tief leidende und zerdrückte Menschheit sogar dekretieren: »es ist unmöglich, die Vorschrift gut auszuführen, wir sind durch und durch schwach und sündhaft und der Moralität im innersten Grunde nicht fähig, folglich haben wir auch keinen Anspruch auf Glück und Gelingen. Die moralischen Vorschriften und Verheißungen sind für bessere Wesen, als wir sind, gegeben.«
22
Werke und Glaube. – Immer noch wird durch die protestantischen Lehrer jener Grundirrtum fortgepflanzt: daß es nur auf den Glauben ankomme, und daß aus dem Glauben die Werke notwendig folgen müssen. Dies ist schlechterdings nicht wahr, aber klingt so verführerisch, daß es schon andere Intelligenzen als die Luthers (nämlich die des Sokrates und Plato) betört hat: obwohl der Augenschein aller Erfahrungen aller Tage dagegen spricht. Das zuversichtlichste Wissen oder Glauben kann nicht die Kraft zur Tat, noch die Gewandtheit zur Tat geben, es kann nicht die Übung jenes feinen, vielteiligen Mechanismus ersetzen, welche vorhergegangen sein muß, damit irgend etwas aus einer Vorstellung sich in Aktion verwandeln könne. Vor allem und zuerst die Werke! Das heißt Übung, Übung, Übung! Der dazugehörige »Glaube« wird sich schon einstellen, – dessen seid versichert!
23
Worin wir am feinsten sind. – Dadurch, daß man sich viele tausend Jahre lang die Sachen (Natur, Werkzeuge, Eigentum jeder Art) ebenfalls belebt und beseelt dachte, mit der Kraft zu schaden und sich den menschlichen Absichten zu entziehen, ist das Gefühl der Ohnmacht unter den Menschen viel größer und viel häufiger gewesen, als es hätte sein müssen: man hatte ja nötig, sich der Sachen ebenso zu versichern, wie der Menschen und Tiere, durch Gewalt, Zwang, Schmeichelei, Verträge, Opfer, – und hier ist der Ursprung der meisten abergläubischen Gebräuche, das heißt eines erheblichen, vielleicht überwiegenden und trotzdem vergeudeten und unnützen Bestandteils aller von Menschen bisher geübten Tätigkeit! – Aber weil das Gefühl der Ohnmacht und der Furcht so stark und so lange fast fortwährend in Reizung war, hat sich das Gefühl der Macht in solcher Feinheit entwickelt, daß es jetzt hierin der Mensch mit der delikatesten Goldwaage aufnehmen kann. Es ist sein stärkster Hang geworden; die Mittel, welche man entdeckte, sich dieses Gefühl zu schaffen, sind beinahe die Geschichte der Kultur.
24
Der Beweis einer Vorschrift. – Im allgemeinen wird die Güte oder Schlechtigkeit einer Vorschrift, zum Beispiel der, Brot zu backen, so bewiesen, daß das in ihr besprochene Resultat sich ergibt oder nicht ergibt, vorausgesetzt, daß sie genau ausgeführt wird. Anders steht es jetzt mit den moralischen Vorschriften: denn hier sind gerade die Resultate nicht zu übersehen, oder deutbar und unbestimmt. Diese Vorschriften ruhen auf Hypothesen von dem allergeringsten wissenschaftlichen Werte, deren Beweis und deren Widerlegung aus den Resultaten im Grunde gleich unmöglich ist: – aber einstmals, bei der ursprünglichen Roheit aller Wissenschaft und den geringen Ansprüchen, die man machte, um ein Ding für erwiesen zu nehmen, – einstmals wurde die Güte oder Schlechtigkeit einer Vorschrift der Sitte ebenso festgestellt wie jetzt die jeder anderen Vorschrift: durch Hinweisung auf den Erfolg. Wenn bei den Eingeborenen in Russisch-Amerika die Vorschrift gilt: du sollst keinen Tierknochen ins Feuer werfen oder den Hunden geben, – so wird sie so bewiesen: »tue es und du wirst kein Glück auf der Jagd haben.« Nun aber hat man in irgendeinem Sinne fast immer »kein Glück auf der Jagd«; es ist nicht leicht möglich, die Güte der Vorschrift auf diesem Wege zu widerlegen, namentlich wenn eine Gemeinde und nicht ein einzelner als Träger der Strafe gilt; vielmehr wird immer ein Umstand eintreten, welcher die Vorschrift zu beweisen scheint.
25
Sitte und Schönheit.– Zugunsten der Sitte sei nicht verschwiegen, daß bei jedem, der sich ihr völlig und von ganzem Herzen und von Anbeging an unterwirft, die Angriffs- und Verteidigungsorgane – die körperlichen und geistigen – verkümmern: das heißt, er wird zunehmend schöner! Denn die Übung jener Organe und der ihnen entsprechenden Gesinnung ist es, welche häßlich erhält und häßlicher macht. Der alte Pavian ist darum häßlicher als der junge, und der weibliche junge Pavian ist dem Menschen am ähnlichsten: also am schönsten. – Hiernach mache man einen Schluß auf den Ursprung der Schönheit der Weiber!
26
Die Tiere und die Moral. – Die Praktiken, welche in der verfeinerten Gesellschaft gefordert werden: das sorgfältige Vermeiden des Lächerlichen, des Auffälligen, des Anmaßenden, das Zurückstellen seiner Tugenden sowohl wie seiner heftigeren Begehrungen, das Sich-gleichgeben, Sich-einordnen, Sich-verringern, – dies alles als die gesellschaftliche Moral ist im groben überall bis in die tiefste Tierwelt hinab zu finden, – und erst in dieser Tiefe sehen wir die Hinterabsicht aller dieser liebenswürdigen Vorkehrungen: man will seinen Verfolgern entgehen und im Aufsuchen seiner Beute begünstigt sein. Deshalb lernen die Tiere sich beherrschen und sich in der Weise verstellen, daß manche zum Beispiel ihre Farben der Farbe der Umgebung anpassen (vermöge der sogenannten »chromatischen Funktion«), daß sie sich tot stellen oder die Formen und Farben eines anderen Tieres oder von Sand, Blättern, Flechten, Schwämmen annehmen (das, was die englischen Forscher mit mimicry bezeichnen). So verbirgt sich der einzelne unter der Allgemeinschaft des Begriffes »Mensch« oder unter der Gesellschaft, oder paßt sich an Fürsten, Stände, Parteien, Meinungen der Zeit oder der Umgebung an: und zu allen den feinen Arten, uns glücklich, dankbar, mächtig, verliebt zu stellen, wird man leicht das tierische Gleichnis finden. Auch jenen Sinn für Wahrheit, der im Grunde der Sinn für Sicherheit ist, hat der Mensch mit dem Tiere gemeinsam: man will sich nicht täuschen lassen, sich nicht durch sich selber irreführen lassen, man hört dem Zureden der eigenen Leidenschaften mißtrauisch zu, man bezwingt sich, und bleibt gegen sich auf der Lauer; dies alles versteht das Tier gleich dem Menschen, auch bei ihm wächst die Selbstbeherrschung aus dem Sinn für das Wirkliche (aus der Klugheit) heraus. Ebenfalls beobachtet es die Wirkungen, die es auf die Vorstellung anderer Tiere ausübt, es lernt von dort aus auf sich zurückblicken, sich »objektiv« nehmen, es hat seinen Grad von Selbsterkenntnis. Das Tier beurteilt die Bewegungen seiner Gegner und Freunde, es lernt ihre Eigentümlichkeiten auswendig, es richtet sich auf diese ein: gegen einzelne einer bestimmten Gattung gibt es ein für allemal den Kampf auf und ebenso errät es in der Annäherung mancher Arten von Tieren die Absicht des Friedens und des Vertrags. Die Anfänge der Gerechtigkeit, wie die der Klugheit, Mäßigung, Tapferkeit, – kurz alles, was wir mit dem Namen der sokratischen Tugenden bezeichnen, ist tierhaft: eine Folge jener Triebe, welche lehren, nach Nahrung zu suchen und den Feinden zu entgehen. Erwägen wir nun, daß auch der höchste Mensch sich eben nur in der Art seiner Nahrung und in dem Begriff dessen, was ihm alles feindlich ist, erhoben und verfeinert hat, so wird es nicht unerlaubt sein, das ganze moralische Phänomen als tierhaft zu bezeichnen.
27
Der Wert im Glauben an übermenschliche Leidenschaften. – Die Institution der Ehe hält hartnäckig den Glauben aufrecht, daß die Liebe, obschon eine Leidenschaft, doch als solche der Dauer fähig sei, ja daß die dauerhafte lebenslängliche Liebe als Regel aufgestellt werden könne. Durch diese Zähigkeit eines edlen Glaubens, trotzdem daß derselbe sehr oft und fast in der Regel widerlegt wird und somit eine pia fraus ist, hat sie der Liebe einen höheren Adel gegeben. Alle Institutionen, welche einer Leidenschaft Glauben an ihre Dauer