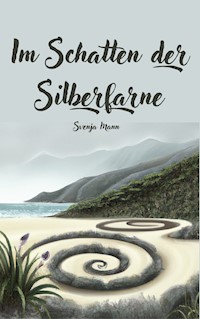Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach Jahren der Distanz kehrt Kate widerwillig in das kleine Dorf zurück, in dem sie aufgewachsen ist. Mit ihrer Schwester, die seit Jahren in Australien lebt, pflegt sie schon lange keinen Kontakt mehr, mit ihrem deutlich jüngeren Bruder verbindet sie wenig und die Beziehung zu ihren Eltern, insbesondere zu ihrem Vater, ist angespannt. Um ihr Gesicht zu wahren, bemüht sich Kate verzweifelt darum, die Risse in ihrem Leben vor den kritischen Augen ihrer Eltern zu verbergen. Doch zurück im Kreis ihrer Familie muss sie schnell feststellen, dass sich weder die Gegenwart, noch die Vergangenheit so einfach abschütteln lässt. Kate sieht sich mit alten Dämonen und ungelösten Konflikten konfrontiert - und erkennt dabei, dass sie nicht die Einzige ist, die etwas zu verbergen hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
For all sisters, born and chosen. May you always find a way back to each other.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Dank
1
Ich schreie. Ich schreie aus Leibeskräften, in einem Raum voller Menschen, bis meine Stimmbänder versagen. Niemand hört mich.
Die Menge um mich herum bewegt sich auf und ab, unkontrollierbar, wie die schwarzen Wogen einer aufgewühlten See. Das Dröhnen des Basses donnert durch meine Venen. Stück für Stück, Welle für Welle, lockert sich der Knoten, der mein Innerstes fesselt.
Plötzlich teilt sich die Masse. Schwitzende Leiber drängen mich zur Seite. Salz perlt über meine Lippen. Gierig sauge ich die heiße, stickige Luft ein, versuche hastig, meine Lungen mit ausreichend Sauerstoff zu füllen für das, was nun folgt. Ein Moment der Ruhe, der fast schon meditativen Gelassenheit. Dann... Chaos.
Adrenalin rauscht durch meinen Körper, dringt bis in die hintersten, verborgensten Ecken meines Seins vor. Wir kollidieren wie Moleküle, setzen Energie frei, die die immer dünner werdende Luft zwischen uns elektrisiert.
Ich fühle, ich rieche, ich höre. Ich lebe. Dafür bin ich gekommen. Um zu leben.
Ich pralle gegen die Schulter eines bulligen Mannes mit Bart, verliere daraufhin das Gleichgewicht. Jemand bekommt meinen Ellbogen in die Rippen. Benommen taumele ich durch das Meer an Körpern und schweißnassen Gliedmaßen. Hilfreiche Hände greifen nach mir, richten mich auf. Sie geben mir Halt, ziehen mich zurück in die wogende Masse.
Ich bin ein Niemand in dieser Masse an schwitzenden Leibern, aber dennoch Teil von etwas. Etwas, das sich mit Worten nicht beschreiben lässt.
Ich bin alleine gekommen, ich gehe alleine nach Hause.
Die kühle Abendluft trifft mich hart, als ich aus dem völlig überhitzten Club hinaus auf die Straße trete. Schwer atmend lehne ich mich gegen die Hauswand, darauf wartend, dass sich die Welt aufhört zu drehen. Die Backsteine in meinem Rücken vibrieren im Rhythmus der Musik, die bis hier draußen zu hören ist.
Kurz bin ich versucht, ins Innere des Clubs zurückzukehren, mich wieder in die heißen Wogen zu stürzen, dem Chaos hinzugeben und die Nacht durchzutanzen. Ein unangenehmer Schmerz in meiner rechten Ferse erinnert mich jedoch umgehend daran, dass es Zeit ist, den Heimweg anzutreten.
Ich presse meine Zeigefinger auf meine Ohren, die noch immer wild dröhnen. Winzige Schweißperlen rollen die Wölbungen meiner Wirbelsäule hinab, versickern nach und nach im bereits durchfeuchteten Bund meiner Hose. Trotz der Hitze, die mein Körper noch immer ausstrahlt, schlüpfe ich in die Ärmel meiner Jeansjacke, bevor ich mich in Bewegung setze.
Es ist spät, oder früh, doch das scheint hier niemanden zu interessieren. Eine Stadt wie diese schläft nie. Musik tropft aus Mauerritzen, Bässe lassen den Erdboden unter meinen Füßen vibrieren.
Auf dem Weg zur U-Bahn-Station steige ich über zerbrochene Glasflaschen und achtlos weggeworfene Dönertüten - die weißen, mit dem roten Dönermann und dem Riesenspieß. Ich ignoriere die wie gigantische Brotkrumen platzierten Pfützen an Erbrochenem. Dezent halte ich mir den Kragen meiner Jacke vor das Gesicht, als ich an einem notdürftig mit Papiertaschentüchern bedeckten Exkrementhaufen eindeutig menschlichen Ursprungs vorbeieile, den freundlicherweise jemand in der nach Urin stinkenden Fußgängerunterführung hinterlassen hat.
Die U-Bahn fährt erst ratternd, dann quietschend in die Station ein. Türen gleiten auseinander, ich steige ein. Ich halte mich fern von anderen Menschen, bemühe mich darum, weder den pöbelnden Fußballfans, noch der jungen Dame im Lederharnisch übermäßig viel Beachtung zu schenken, deren blanke Brüste mich von der gegenüberliegenden Sitzbank aus anstarren.
Mein Puls pocht in meinen Schläfen. Erschöpft lehne ich meinen Hinterkopf an die kühle Glasscheibe hinter mir. Es riecht nach einer Mischung aus Bier, Gras und Energy Drinks. Berlin an einem Sonntagmorgen ist jedes Mal aufs Neue ein Erlebnis für sich.
Der schnellste Weg von der U-Bahn-Haltestelle zurück nach Hause führt durch einen schlecht beleuchteten Park. Als ich die mit Zigarettenstummeln übersäten Stufen der U-Bahnstation hinabsteige, vergrabe ich meine Hände tief in den Taschen meiner Jacke. Ich taste nach meinem Schlüsselbund, den ich einsatzbereit in den Hohlräumen zwischen meinen Fingern platziere. Zur Sicherheit. Verstohlen werfe ich einen Blick über meine Schulter, doch die Menschen, die mit mir gemeinsam ausgestiegen sind, haben sich bereits in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Ich bin allein.
Schotter knirscht unter meinen Lederstiefeln, als ich den asphaltierten Bürgersteig verlasse, um in den dunkel vor mir liegenden Park abzubiegen. Fernab der Straße ist es mit einem Mal unverhältnismäßig still um mich herum. Lediglich meine eigenen, zügig aufeinander folgenden Schritte hallen durch die Nacht. Ich lockere den Griff um meinen Schlüsselbund ein wenig. Meine Schultern sacken nach unten, als die Anspannung nach und nach aus meinen Muskeln weicht.
Es ist nicht mehr weit bis zu meiner Wohnung. Ich kann bereits die Umrisse meines Balkons in der Dunkelheit ausmachen, das Fenster dahinter ein düsteres Loch in der Hauswand. Niemand wartet dort auf mich. Nicht mehr.
Als hätten meine Füße ihren eigenen Verstand entwickelt, verlangsamt sich mein Schritt plötzlich. Mit Blei in den Waden komme ich zum Stehen, lasse mich unvermittelt auf einer nahestehenden Parkbank nieder. Mein Puls rast, weiße Punkte tanzen vor mir wie Schneeflocken. Ich atme konzentriert ein und aus, um möglichst tiefe Atemzüge bemüht.
Der Gedanke an die Dunkelheit und die klaffende Leere, die mich in meiner Wohnung erwartet, hat mich kalt erwischt, hat die Panik erneut aufleben lassen, die seit Wochen, seit Monaten unterschwellig in mir wabert. Unsichtbar, doch so nah an der Oberfläche, dass der kleinste Auslöser ausreicht, um sie ans Tageslicht zu befördern.
Mit klopfendem Herzen lehne ich mich zurück, lege den Kopf in den Nacken. Zu sehen gibt es über mir nicht viel, obwohl ich in diesen frühen Morgenstunden an ein beinahe wolkenloses Firmament starre. Das Licht der Sterne verblasst im Angesicht der Strahlkraft dieser millionenstarken Metropole, dieser Stadt, die niemals schläft. Einer Stadt, in der ich nur eine von vielen bin. Eine von vielen, die in eine kalte, dunkle, verlassene Wohnung zurückkehren muss. Allein.
2
Noch immer habe ich mich nicht an die Stille gewöhnt, an den kalten Platz neben mir auf der Matratze, den fehlenden Kaffeeduft in der Morgenluft.
Umgeben von kahlen Wänden, sorgfältig aufeinander gestapelten Kartons und bis zum Rand gefüllten Wäschekörben, starre ich an eine Zimmerdecke über mir, die mit jedem Atemzug näher zu rücken scheint.
Felix hat mir bei seinem Auszug lediglich die fest installierten Deckenlampen gelassen, und das auch nur, weil ihm das Abmontieren zu aufwändig war.
Stöhnend presse ich meine Fingerspitzen auf meine geschwollenen Augenlider, fahre mit der Zunge über meine brennenden Lippen. Mein Körper fühlt sich an, als hätte man ihn im Schleudergang einmal durch die Waschmaschine gejagt. Vorsichtig streiche ich mit meiner rechten Hand über meine schmerzende Schulter. Das fahle Licht der Morgensonne, das durch einen Spalt zwischen den nur halb heruntergelassenen Rollladen fällt, offenbart zahlreiche dunkle Flecken auf meinen Oberarmen. Sie werden schon bald in allen möglichen Blau- und Grüntönen schimmern.
Probeweise wackle ich mit meinen Zehen. Seit ich keinen Alkohol mehr trinke, wache ich zwar morgens ohne dieses unangenehme Pochen in den Schläfen, ohne diesen faulen Geschmack im Mund auf, doch der Rest meines Körper fühlt sich nicht unbedingt weniger mitgenommen an.
Seufzend rolle ich mich auf die Seite, darauf bedacht, möglichst umsichtig mit meinen lädierten Körperteilen umzugehen. Ich taste den staubigen Holzboden nach meinem Handy ab. Keine neuen Nachrichten.
Lustlos und uninspiriert scrolle ich durch meinen Instagram-Feed. Ich setze hier ein Herzchen, dort ein Herzchen, suche nach Event-Fotos der gestrigen Nacht. Ich kommentiere Beiträge meiner Freundinnen, klicke mich durch Storys und Reels und Live-Videos, um mich auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen. Irgendwie muss ich ja sicherstellen, dass ich nichts verpasst habe.
Für einen Moment schwebt mein Finger unschlüssig über dem Suchfeld. Bevor ich mich versehe, schnellt mein Daumen herunter und wählt das erste Suchergebnis aus der langen Liste an Resultaten aus.
Zu meiner Enttäuschung, gibt es keine neuen Beiträge auf Annas Profil. Auf meinem Daumennagel kauend, betrachte ich zum wiederholten Mal das Foto, das allem Anschein nach als letztes hochgeladen wurde. Annas wohlgeformter Körper an einem traumhaften, weißen Sandstrand. Ihr langes, blondes Haar, um das ich sie immer schon beneidet habe, flattert verführerisch im Wind. Ihr Lächeln, das Anna wohl ihrem ach so perfekten Leben zu verdanken hat, lässt ihre Augen strahlen, als wohnte die Sonne höchstpersönlich in ihrem hübschen Köpfchen.
Angewidert verdrehe ich meine Augen. Für den Bruchteil einer Sekunde bin ich versucht, Finn eine Nachricht zu schicken. Ich will meine Neugierde stillen, möchte wissen, wann er das letzte Mal mit unserer lieben Schwester gesprochen hat. Ich verwerfe diesen Gedanken jedoch genauso schnell wieder, wie er gekommen ist. Aus meinem Bruder, einem sechzehnjährigen, pubertierenden Teenager, der sich lieber in seinem testosteronverseuchten Zimmer einsperrt, als Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen, mehr als eine einsilbige Antwort herauszubekommen, ist ohnehin vergebene Liebesmüh.
Der Bildschirm meines Smartphones verdunkelt sich. Ich beginne, nachdenklich meine Unterlippe zwischen meinen Zähnen hin und her zu schieben.
Anna. Meine Schwester. Das Bild von ihr am Strand geht mir schon lange nicht mehr aus dem Kopf. Es hat sich in mein Gedächtnis gebrannt, schleicht sich bei nahezu jeder Gelegenheit in mein Bewusstsein - und macht mich wütend.
Knapp zehn Jahre ist es nun her, seit ich Anna das letzte Mal gesehen oder ein Wort mit ihr gewechselt habe. Seit fast einem Jahrzehnt herrscht absolute Funkstille zwischen meiner einzigen Schwester und mir.
»Es sind doch nur drei Monate, Kitty«, wispert Anna, während sie mir mit dem Daumen über die feuchte Wange streicht. »Du wirst sehen, die Zeit wird wie im Flug vergehen. Ehe du dich versiehst, bin ich schon wieder hier.«
Ich nicke, presse laut schniefend den flauschigen Teddybären mit der knallroten Schleife an meine Brust, den mir Anna gerade mit einem schelmischen Zwinkern in die Hand gedrückt hat. Natürlich ist der Teddy kein ernst gemeintes Geschenk. Sie will mich damit nur necken, ein letztes Mal die große Schwester heraushängen lassen. Süß ist es aber irgendwie trotzdem. Der kleine Kerl wird auf jeden Fall einen Ehrenplatz auf meinem Bett erhalten.
Anna lächelt mir aufmunternd zu. Sie haucht mir zum Abschied einen flüchtigen Kuss auf die Stirn, bevor sie sich den Henkel ihrer Reisetasche lässig über die Schulter schwingt. Ich sehe ihr nach, bis ich den in goldenen Lettern gehaltenen Schriftzug Abiturjahrgang 2013 in der Menschenmenge am Flughafen nicht mehr ausfindig machen kann.
Nun ist sie wirklich weg. In dem Moment der Erkenntnis zerbricht mein Herz in abertausende Stücke. Man sagt, dass man geliebte Menschen ziehen lassen soll, wenn man sie nicht verlieren will. Mit meinen siebzehn Jahren ist mir jedoch ziemlich egal, was andere Leute sagen.
Ich durchsuche Annas Profil nach einem Foto, das mehr von ihrem Gesicht zeigt. Als ich endlich eines gefunden habe, versuche ich konzentriert, ihre mir einst so vertrauten Gesichtszüge genauer unter die Lupe zu nehmen.
Ich sehe die eisblauen Augen und die stolz nach oben geschwungenen Lippen meines Vaters. Ihr herzerwärmendes Lächeln hat sie von meiner Mutter. Ich hole tief Luft. Früher hat man uns oft für Zwillinge gehalten, obwohl Anna fast anderthalb Jahre älter ist als ich. Heute würde man wahrscheinlich nicht einmal vermuten, dass wir überhaupt miteinander verwandt sind.
Als der Bildschirm meines Smartphones erneut schwarz wird, starre ich plötzlich in das Gesicht einer Frau, die ihr Strahlen schon vor einer ganzen Weile verloren hat. Ein bitterer Geschmack breitet sich von meinem Mund in meinem gesamten Körper aus.
Anna ist glücklich. Schön für sie. Keine Ahnung, warum mich dies überhaupt noch interessiert. Abrupt richte ich mich auf, schlage schwungvoll meine Bettdecke zur Seite und platziere meine nackten Füße auf den kühlen Holzdielen. Es dauert, bis ich genug Energie finde, um mich in eine aufrechte Position zu bringen.
Wie fast jeden Morgen jogge ich nach dem Frühstück zum Fitnessstudio. Irgendwie hat es sich eingebürgert, den Weg durch den noch verschlafenen Park als Warm-Up-Session zu nutzen. Ich liebe es, in gemächlichem Tempo durch den Park zu laufen. Heute jedoch ist nicht der passende Tag dafür.
Die Blätter der hochgewachsenen Ahornbäume, die einigen sonntäglichen Parkbesucherinnen gnädig Schatten spenden, haben bereits damit begonnen, ihren finalen Lebensabschnitt in den kunterbuntesten Herbstfarben anzukündigen.
Erleichtert, der gähnenden Leere meiner Wohnung entkommen zu sein, erhöhe ich mein Tempo. Ich schlafe in meiner Wohnung, ich esse dort, aber ich lebe nicht mehr in ihr. Die kahlen Wände, die unmöblierten Räume, die ohrenbetäubende Stille sind nichts als konstante Erinnerungen an den Scherbenhaufen, der sich mein Leben schimpft. Mein Herz zieht sich zusammen, ich gerate aus dem Takt. Da ist sie wieder, diese Enge in meiner Brust.
Ich beiße meine Zähne hart aufeinander, bis meine Kiefergelenke schmerzen. Verbissen senke ich mein Kinn, fokussiere meine gesamte Konzentration darauf, Energie in meine Muskeln zu senden mit dem Ziel, meinen Körper zu neuen Höchstleistungen zu animieren. Je schneller mein Herz schlägt, je stärker meine Lungenflügel damit beschäftigt sind, Sauerstoff durch meinen Körper zu pumpen, desto weniger Kapazitäten hat mein Gehirn, sich mit düsteren Gedanken zu beschäftigen.
Keuchend, auf die Lehne einer Parkbank gestützt, komme ich schließlich zum Stehen. Wieder ist es Anna, die sich ungefragt in mein Bewusstsein drängt. Sie tanzt über einen weißen Sandstrand, ein spöttisches Lächeln auf den Lippen, Schadenfreude in eisblauen Augen.
Ich stemme meine Hände in die Hüften, sauge gierig die kühle Herbstluft ein, nach der sich meine geplagten Lungenflügel verzehren. Mein Brustkorb hebt und senkt sich, wild, fordernd, unnachgiebig.
Für einen Moment habe ich meine Gedanken zum Schweigen gebracht, doch die Nadelstiche in meinem Herzen lassen trotzdem nicht nach.
»Morgen Kate«, murmelt Leon abwesend, als ich meine Mitgliedskarte vor das nicht gerade dezent piepsende Kartenlesegerät halte.
Kate. Der Klang dieses Namens zaubert mir auch jetzt noch ein Lächeln auf die Lippen. Seitdem ich in Berlin lebe, stellte ich mich überall nur noch als Kate vor. Klingt irgendwie weltlicher, finde ich, sexier als Kitty, als Katja. Oder gar als Katharina.
Die Härchen auf meinem Unterarm richten sich auf, als die donnernde, stets tadelnde Stimme meines Vaters in meinen Ohren hallt. Wie kein anderer vermag er es, seiner über Jahrzehnte angesammelten Enttäuschung einzig und allein durch die Erwähnung meines Namens Ausdruck zu verleihen. Katharina. Für ihn war und bin ich stets Katharina.
Ich zwänge mich durch das geöffnete Drehkreuz. Wie immer, lasse ich Katharina vor der Tür des Fitnessstudios zurück. Ich löse mich von ihr wie eine Schlange von abgestorbener Haut, bevor sie in ihren Bau kriecht. Für Katharina gibt es hier keinen Platz.
Da Leon seine Aufmerksamkeit bereits wieder auf das leuchtende Display in seiner Hand gerichtet hat, lächele ich bloß höflich und verzichte darauf, mich um eine vermutlich wenig inspirierende Konversation mit ihm zu bemühen.
Zielstrebig steige ich die Stufen der freistehenden Treppe nach oben. Ich bin heute später hier als üblich. Normalerweise trainiere ich in den frühen Morgenstunden, an regulären Wochentagen häufig sogar noch vor Arbeitsbeginn. Mit der nun anwesenden Mittagscrowd habe ich normalerweise kaum Berührungspunkte. Es ist daher nicht verwunderlich, dass ich auf meinem Weg in den Freihantelbereich kaum vertraute Gesichter entdecken kann.
Nicht, dass dies für mich in irgendeiner Form einen Unterschied macht. Mir begegnen zwar tagtäglich die selben Menschen - schließlich haben wir alle unsere Routinen - doch über mehr als ein anerkennendes Kopfnicken gehen unsere vorwiegend nonverbalen Unterhaltungen ohnehin nicht hinaus. Meine Enttäuschung über die anwesenden, mir völlig fremden Personen hält sich dementsprechend in Grenzen.
Nachdem ich mich auf einer mitgenommen aussehenden Hantelbank niedergelassen habe, krame ich in meinem Sportbeutel nach meinem Handy. Ich will zumindest nach außen hin den Anschein erwecken, mich einer gewissen sozialen Beliebtheit zu erfreuen. Noch immer keine neuen Nachrichten. Schulterzuckend lasse ich mein Smartphone in meinen Schoß sinken. Ich wische einige Male mit dem Daumen über den Bildschirm, um die App mit meinem Trainingsplan zu finden. Diesem folge ich seit Wochen rigoros und absolut kompromisslos. Ich habe mir viel vorgenommen.
Ohne weiter Zeit zu verlieren, stülpe ich mir meine Kopfhörer über die Ohren, drehe die Musik auf und mache mich ans Werk. Mit einer geschickten Bewegung wuchte ich ein Hantelpaar in die Höhe. Langsam lasse ich die Gewichte auf meine Brust sinken, bevor ich sie anschließend in möglichst gleichbleibender Geschwindigkeit in die Höhe presse. Brust und Schultern stehen heute auf dem Plan.
Nach einer Weile rollen Schweißperlen zwischen meinen Brüsten hinab. Mein Training fängt langsam an, sich auszuzahlen, stelle ich mit einem Blick in den Spiegel fest, der fast die gesamte Wandfläche einnimmt. Meine Schultern sind breiter geworden, meine Arme definierter. Ich lächle zufrieden.
Da ich keine weiteren Pläne für den restlichen Nachmittag habe, lasse ich mir bei der Ausführung meiner Übungen Zeit. Zwischen meinen Sets gönne ich mir ausgiebige Ruhezeiten, die ich dazu nutze, die anderen trainingswütigen Menschen um mich herum mit verstohlenen Blicken zu mustern.
Als einzige Frau im Raum ziehe ich naturgemäß einiges an Aufmerksamkeit auf mich. Vor Monaten wäre mir dies noch unangenehm gewesen. Die neugierigen, irritierten, lüsternen Blicke des meist männlichen Publikums haben mich zu Beginn meiner Fitnessreise unglaublich verunsichert, wenn nicht sogar abgestoßen.
Mittlerweile jedoch habe ich genug Selbstbewusstsein aufgebaut, um mich von diesem Gehabe nicht länger einschüchtern zu lassen. Ich habe das gleiche Recht, hier zu sein, wie jeder andere auch. Ich straffe meine Schultern, richte mich auf und wuchte das Hantelpaar, das ich benutzt habe, zurück auf die dafür vorgesehene Ablagefläche.
Als ich mich umdrehe, stolpere ich beinahe über eine achtlos zurückgelassene Langhantel, die irgendein rücksichtsloser Kerl dort liegen gelassen haben muss. Die werten Herren der Schöpfung sind es wohl gewohnt, dass man ihnen auch außerhalb der heimischen Sphäre alles hinterher räumt.
Kopfschüttelnd steige ich über die Metallstange, sammle meine sieben Sachen zusammen und schlängle mich auf meinem Weg in die Umkleidekabine an ächzenden, stöhnenden, schwitzenden und ach so toll aussehenden Körpern vorbei. Die Mittagscrowd ist definitiv nicht mein Fall. Ich muss zusehen, dass ich es beim nächsten Mal früher ins Fitnessstudio schaffe.
Zurück in meiner Wohnung scrolle ich uninspiriert durch die Fotogalerie meines Smartphones. Ich bin auf der Suche nach Bildern, die sich für eine Veröffentlichung auf meinem Instagram-Profil eignen. Mit neiderweckenden Strandfotos kann ich zwar nicht dienen, denke ich grimmig, aber vielleicht macht sich das ein oder andere Gym-Selfie ja ganz gut auf meinem Profil. Anna soll schließlich auch etwas zum Bestaunen haben.
Einmal gepostet, ploppen in kurzen Abständen zahlreiche Herzchen unter meinem Beitrag auf. Von links und rechts hagelt es Komplimente, die mir, davon bin ich überzeugt, definitiv einen Motivationsschub für die nächsten Tage geben werden.
Wenig später, im Badezimmer, beäuge ich mich jedoch schon wieder kritisch vor dem Spiegel. Als Kind zu pummelig, als Teenager zu dürr, als erwachsene Frau zu muskulös und männlich. In Zukunft wahrscheinlich zu faltig, zu schrumpelig, zu grau. Egal wie ich mich drehe und wende, recke und strecke, irgendetwas gibt es immer auszusetzen. Zumindest solange ich nicht Anna heiße und aussehe wie ein wahr gewordener Männertraum.
Meine Schultern sacken in sich zusammen. Anna hat mit Sicherheit kein Problem mit diesem kleinen, verdammten Wörtchen zu. Zwei Buchstaben, die sich mit widerspenstigen Widerhaken in meinem Kopf festgeklammert haben und es immer wieder schaffen, meine Gedanken zu vergiften, meine Selbstwahrnehmung zu verzerren.
Ich seufze, starre in das frustrierte Gesicht einer Frau, die nichts mehr mit der gemeinsam hat, die vor wenigen Stunden noch stolz, vielleicht sogar ein wenig hochmütig, durchs Fitnessstudio stolziert ist.
Ich wende mich ab und betrete die Duschkabine. Ich drehe den Hahn voll auf und lasse mir für eine Weile viel zu heißes Wasser ins Gesicht prasseln. Mit leicht geöffneten Lippen sehe ich dabei zu, wie der Wasserdampf nach und nach das kleine Badezimmer füllt, den Spiegel beschlägt und meine erbärmliche Reflektion verschluckt. Erleichterung macht sich in mir breit.
3
Fetzen eines zerfledderten Papiertaschentuches rieseln wie Schneeflocken auf meine schwarze Stoffhose. Meine Lippen sind fest aufeinander gepresst, während ich Michaels nicht enden wollenden Monolog schweigend über mich ergehen lasse.
Mein Gesicht prickelt, Blut rauscht in meinen Ohren, sodass ich nur Bruchstücke der Sätze wahrnehme, die Michaels Lippen im Sekundentakt verlassen. Ich klammere mich an ihnen fest wie an einem Stück Treibholz, das in einem Schwall an Worten schwimmt.
»…sehr leid…«
Ein verlegenes Räuspern.
»…kein Budget mehr…«
Papier, das über eine Tischplatte geschoben wird.
»…die Hände gebunden…«
Ein unangenehmes Quietschen eines Stuhlscharniers, als Michael sich nach vorne beugt, um seine Ellbogen auf dem Schreibtisch abzulegen.
»…eine Grundsatzentscheidung…«
Ein Zischen, gefolgt von dem Geräusch von Wasser, das aus einer Flasche in ein Trinkglas gefüllt wird.
»…nicht persönlich nehmen…«
Schweigen. Stille.
Ich blinzle, krampfhaft darum bemüht, meine Emotionen nicht an die Oberfläche treiben zu lassen. Als ich mein Kinn anhebe und Michael in die Augen blicke, weiß ich, dass mir dies nicht gelungen ist. Mit einem betretenen Ausdruck auf dem Gesicht schiebt er das Wasserglas zu mir hinüber.
»Es tut mir wirklich leid, Kate. Ich habe alles versucht. Aber in der aktuellen Situation war da tatsächlich nichts zu machen.« Michael lehnt sich in seinem Stuhl zurück, platziert seine verschränkten Arme strategisch vor dem fehlenden Knopf seines Hemdes. »Vielleicht sieht es im nächsten Jahr besser aus.«
Ich starre ihn für einen Augenblick an, versucht, ihm mit meiner Kündigung zu drohen. Schließlich ist dies bereits das zweite Mal in Folge, dass er mir mit fadenscheinigen Ausreden eine fest versprochene Gehaltserhöhung versagt hat.
Michael jedoch lässt sich nicht beirren und hält meinem Blick stand. Auf etwaige Einwände, auf Rückfragen, auf hitzige Diskussionen ist er ganz offensichtlich vorbereitet, das ist ihm deutlich anzusehen. Ich hingegen bin nicht vorbereitet. Naiverweise hatte ich fest damit gerechnet, nicht noch einmal abgewiesen zu werden.
Ich erhebe mich. Die Papierfetzen meines Taschentuchs segeln auf Michaels gut gepflegten Teppichboden. Er quittiert dies mit einem irritierten Stirnrunzeln. Demonstrativ streiche ich auch die letzten verbliebenen Papiertaschentuchflocken von meiner Hose.
»Vielen Dank für das Gespräch, Michael«, presse ich kühl über meine Lippen.
Heißes Blut pulsiert in meinen Wangen. Ich mache auf dem Absatz kehrt, beschleunige meinen Schritt aber erst, als ich in den schlecht beleuchteten Flur hinaustrete und hastig in Richtung Ausgang fliehe. Ich mache mir nicht die Mühe, mich zu verabschieden.
In einer verkehrsberuhigten Seitenstraße lasse ich mich wenige Minuten später unter einem stattlichen Kastanienbaum auf einem Mauerstück nieder. Links und rechts von mir liegen die stacheligen Fruchtbecher des Baumes verstreut.
Ich kann meine Tränen nicht länger zurückhalten. Dicke, salzige Tropfen rollen über meine Wangen, während ich mit meinem Daumen über eine der glatten Kastanien streiche, die der Baum abgeworfen hat. Helfen tut es nicht. In einem Anfall von Wut feuere ich die tiefbraune Nuss mit voller Wucht auf die gegenüberliegende Straßenseite. Mit meinem Handrücken versuche ich vorsichtig, mein brennendes Gesicht zu trocknen.
Ich bin wütend. Wütend auf Michael, wütender auf mich selbst, aber am wütendsten darüber, dass ich schon wieder nicht das bekommen habe, was mir zusteht. Eine weitere Kastanie löst sich aus dem Geäst und zerschellt auf dem grauschwarzen Asphalt des Gehwegs.
Fein. Ich presse Daumen und Zeigefinger auf meine Augenlider. Kündigen ist keine Option, nicht in meiner Situation. Aber Michael wird schon sehen, was er davon hat. Ich werde die Füße stillhalten, so wie bisher auch. Natürlich. Aber dieses Mal vielleicht ein wenig stiller, als ihm lieb ist. Vielleicht werde ich noch andere Körperteile still halten. Ich starre auf meine Hände, die locker in meinem Schoß liegen. Keinen Finger mehr werde ich für diesen Laden krümmen.
Äußerst undamenhaft ziehe ich die Nase hoch. Ich streife den Henkel meiner Tasche über meine Schulter, wühle darin nach der Packung mit Taschentüchern, bis mir einfällt, dass ich diese auf Michaels Schreibtisch liegen gelassen habe. Ich halte mir meinen Handrücken unter meine triefende Nase und suche verzweifelt nach einem alten Taschentuch, um mich zumindest notdürftig zu versorgen. Vergebens.
Als es auf einmal laut neben mir platscht, schließe ich entnervt meine Augen. Das kann doch nun wirklich nicht wahr sein. Verstohlen werfe ich einen Blick über meine rechte Schulter und stelle fest, dass dieses neuerliche Geschenk des Himmels nicht neben mir, sondern auf mir gelandet ist. Auf meinem rechten Ärmel prangt ein fast handtellergroßer, weißgräulicher Fleck, der sich langsam seinen Weg meinen Arm bahnt.
Wütend schaue ich nach oben. Zwischen den dichten Ästen des Kastanienbaumes, verborgen von an die Finger eines Clowns erinnernden, goldgrünen Blättern, glaube ich, eine pechschwarze Krähe kichern zu hören.
Ich sitze auf unserer Terrasse, meine nackten Füße auf einem Gartenstuhl abgelegt. Über mir wiegen die weißen Vorhänge vor Annas Zimmerfenster in der Sommerbrise leise hin und her, bauschen sich im nächsten Windstoß auf wie flauschige Zuckerwolken.
»Verdammt nochmal!« schallt es plötzlich aus dem Haus. »Kitty!«
Ich rutsche ein Stück in meinem Stuhl nach unten, als die aufgebrachte Stimme meiner Schwester die Luft zerschneidet. Durch die offene Terrassentür höre ich Annas polternde Schritte auf der Holztreppe, die in das Erdgeschoss führt.
In höchster Eile streife ich mir den dunkelblauen Kapuzenpulli über, der hinter mir über der Stuhllehne hängt. Ich schaffe es gerade noch, den Reißverschluss nach oben zu zerren, bevor Anna auf die warmen Terracottafliesen hinaus tritt. Ihre Hände hat sie wutentbrannt in die Hüften gestemmt.
»Wo zur Hölle ist mein schwarzes Top?«
Eisblaue Augen funkeln mich wütend über den Gartentisch hinweg an.
»Woher soll ich das wissen?« erwidere ich mit einem unschuldigen Schulterzucken.
Ich verberge meine Nasenspitze tiefer in meiner Ausgabe von Fifty Shades of Grey, denn ich wage es nicht, Anna anzusehen.
Meine Schwester, natürlich nicht auf den Kopf gefallen, lässt sich jedoch nicht so leicht täuschen, wie ich gehofft habe. Dafür kennt sie mich zu gut.
»Ach ja?« hakt sie unbeeindruckt nach. »Könntest du mir dann vielleicht mal erklären, warum du in der allergrößten Mittagshitze einen Pullover trägst?« Sie kneift ihre Augen zusammen, umkreist den Gartentisch langsam wie eine Katze das Mauseloch.
Ich springe auf. Mein Buch landet mit einem lauten Knall auf dem Tisch. Ich benutze den Gartenstuhl als Schutzwall und schiebe ihn zwischen uns. Dann mache ich einige Schritte rückwärts, bis ich plötzlich weiches Gras unter meinen Fußsohlen spüre.
»Also erstens geht dich das gar nichts an… und zweitens… schon mal was von UV-Strahlung und Sonnenbrand gehört?« werfe ich ein, die Arme abwehrend vor der Brust verschränkt.
Anna schnauft belustigt. »Das glaubst du ja wohl selber nicht.« Sie hat mich nun fast erreicht, streckt ihre spindeldürren Finger nach dem Reißverschluss aus. Sie bekommt ihn beinahe zu fassen. »Lass doch mal sehen, was du da so Schönes drunter trägst…«
Ich stoße einen spitzen Schrei aus, schlage Annas Hand beiseite und ergreife die Flucht. Meine Schwester stürzt mir sogleich hinterher. Wie zwei wild gewordene Welpen drehen wir einige Kreise um den Gartentisch, bis Anna mir eine Falle stellt und mir mit einem der Gartenstühle den Weg versperrt. Mir bleibt nichts anderes übrig, als auf die Wiese auszuweichen.
»Na warte, ich krieg dich schon noch«, brüllt Anna mir fuchsteufelswild hinterher, während ich einmal quer durch den Garten sprinte.
Unter dem großen Kirschbaum bekommt sie mich am Ärmel zu fassen. Für eine Weile rangeln wir miteinander, bis ich plötzlich einen dumpfen Schlag auf meinem Scheitel verspüre. Irritiert halten wir inne.
Anna starrt mich mit weit aufgerissenen Augen an. Vogelscheiße läuft warm über meine Stirn, bahnt sich langsam einen Weg über meinen sommersprossigen Nasenrücken, bis die Brühe von meiner Nasenspitze zwischen uns auf die Wiese tropft.
Anna grinst. Dann bricht sie in schallendes Gelächter aus, das so ansteckend ist, dass ich trotz allen Ekels nicht anders kann, als einzustimmen. Wir lachen, bis unsere Rippen schmerzen und wir uns vor Erschöpfung in das weiche Gras sinken lassen.
Nur zwischen Schwestern liegen Hass und Liebe so nah beieinander.
4
Mit einem lauten Knall fällt die Haustür hinter mir ins Schloss. Ich stehe in meiner leeren Wohnung. Allein. Ich schlüpfe aus meinen Schuhen, kümmere mich nicht darum, sie ordentlich wegzuräumen. Ich wüsste ohnehin nicht wohin. Selbst der Schuhschrank, der einst im Flur stand, gehörte Felix.
Mein Puls hämmert unerbittlich in meinen Schläfen. Noch bevor ich aus den Ärmeln meiner Jacke schlüpfe, wühle ich in meiner Handtasche nach einer Schmerztablette. Ohne diese kleinen, weißen Pillen gehe ich schon lange nicht mehr aus dem Haus. Fündig geworden, spüle ich eine von ihnen mit einem Glas Leitungswasser hinunter, das ich sogleich auswasche und umgedreht neben das Spülbecken stelle. Es ist das einzige Glas, das sich noch in meinem Besitz befindet. Mein Blick streift die fest verschlossene Zimmertür, die seit Monaten nicht mehr geöffnet worden ist. Hinter ihr verbirgt sich das Überbleibsel eines vergangenen Lebens - eines Lebens, in dem ich noch viele Gläser besessen habe.
Ich werfe meine Jacke auf den flimsigen Ikea-Holzstuhl namens Ivar, den ich vor ein paar Wochen zufällig am Straßenrand entdeckt und mit nach Hause genommen habe. Funktional, aber unbequem. Aus Mangel an Alternativen marschiere ich in mein Schlafzimmer und lasse mich dort mit einem frustrierten Seufzer der Erleichterung bäuchlings auf mein Bett fallen. Beziehungsweise auf das, was davon noch übrig ist: eine einzelne Matratze.
Für eine Weile atme ich in mein Kissen hinein, bis die Luft darin so dünn wird, dass mir schwarz vor Augen wird. Atemlos rolle ich mich auf den Rücken und richte meinen Blick an die Zimmerdecke. Die Finger meiner rechten Hand zucken nervös. Sie sehnen sich nach einem Tennisball.
Gute Dinge passieren in meiner Familie ausschließlich hinter verschlossenen Türen.
Annas Haare kitzeln meine Wange, als sie mir den Tennisball reicht.
»Na los, du bist dran«, wispert sie, so leise es eben nur geht.
Auf keinen Fall wollen wir erneut die Aufmerksamkeit unserer Eltern erregen, die uns bereits zum wiederholten Male zum Schlafen aufgefordert haben.
Ich nehme den Tennisball entgegen, kneife dann hochkonzentriert ein Auge zusammen, um den Abstand zwischen meiner Hand und der Zimmerdecke abzuschätzen.
Anna und ich spielen ein Spiel. Unser Spiel. Ziel ist es, den Tennisball so nah wie möglich an die Zimmerdecke zu werfen, ohne diese jedoch zu berühren. Annas Würfe waren bis dahin nur mittelmäßig erfolgreich, was ungewöhnlich für sie ist. Zweimal hat sie die Decke berührt. Ihr dritter und letzter Versuch ist ihr zwar besser gelungen, doch sie ist dennoch weit unter ihrer regulären Leistung geblieben. Dieser Abend birgt Potential für mich. Vielleicht gelingt es mir heute endlich, meine große Schwester in unserem Spiel zu schlagen.
Ich hole aus und stoße den Ball mit einer geschickten Bewegung meines Handgelenkes von mir. Er prallt mit einem dumpfen Schlag von der Decke ab und landet direkt in Annas ausgestreckter Hand.
Für einen Moment versteifen sich unsere Körper unter der Bettdecke. Gebannt halten wir die Luft an, doch auch nach mehreren flachen und merkwürdig synchronisierten Atemzügen regt sich im Haus nichts. Erleichtert lassen wir die Luft aus unseren Lungen entweichen.
Erneut reicht Anna mir den Ball. »Nicht schlecht, Schwesterchen. Aber noch nicht gut genug, um mich zu schlagen. Los, nochmal. Zweiter Versuch.«
Wieder nehme ich den Tennisball entgegen. Ich atme tief durch, hole erneut aus und lasse den Ball durch die Luft flitzen. Zu kurz. Ich fange den Tennisball gerade noch ab, bevor er in meinem Gesicht landen kann.
Anna kicherte vergnügt in den Zipfel ihrer Bettdecke.
»Okay, letzte Chance…«
Ich stiere an die Zimmerdecke über uns, fokussiere den Punkt, der sich direkt über meiner Stirn befindet. Krampfhaft versuche ich, meine ganze Energie auf diese eine Stelle zu richten. Mein Handgelenk biegt sich, der Tennisball löst sich aus meiner Hand, schnellt durch die Luft. Ein Schatten huscht über die Zimmerdecke, bewegt sich auf den Punkt an der Decke zu, den ich zuvor anvisiert habe. Nicht mehr als ein Haar passt zwischen Zimmerdecke und Tennisball. Aber ein Haar passt dazwischen. Der Sieg ist meiner.
Vergnügt quietsche ich auf. Noch bevor Anna mir mit weit aufgerissenen Augen die Hand auf den Mund pressen kann, weiß ich, dass dies ein Fehler war. Schwere Schritte poltern die Holzstufen hinauf, stampfen den Flur entlang, auf die Zimmertür zu. Geistesgegenwärtig schafft Anna es noch, den Lichtschalter umzulegen, um unser Zimmer in Dunkelheit zu tauchen.
Ich spüre den heißen Atem meiner Schwester auf meiner Wange. Sie hält meine Hand, als unser Vater die Zimmertür aufreißt. Der Zorn in seiner Stimme lässt uns das Blut in den Adern gefrieren. Während seine geballte Wut durch den Raum donnert, förmlich von den Wänden widerhallt, nur um erneut durch meinen zitternden Körper zu fahren, presse ich meine Augenlider fest aufeinander. Ich suche Zuflucht in der Finsternis.
Dieses Donnerwetter ist meine Schuld. Ich bin es, die nicht in ihrem eigenen Bett liegt. Ich bin es, die über den Flur in ein anderes Zimmer geschlichen ist. Ich bin es, die Schuld trägt. Weil ich immer Schuld trage. Und ich weiß, dass mein Vater der gleichen Meinung ist. Wutentbrannt packt er mich am Arm, zerrt mich aus dem Bett und schleift mich durch den Flur zurück in mein Zimmer.
Egal was ich tue, egal wie sehr ich mich anstrenge, ich kann nicht gewinnen. Niemals.
Ich fühle mich verfolgt. Meine rechter Fuß baumelt vom Ende meiner Matratze, meine Ferse streift den Fußboden. Ich verstehe nicht, warum ich mich auf einmal immer wieder in Erinnerungen an meine Schwester verliere. Eine Schwester, mit der ich seit Jahren kein Wort mehr gewechselt habe. Falls dies der erbärmliche Versuch meines Unterbewusstseins sein soll, die klaffende Lücke in meinem Herzen, die Felix dort hinterlassen hat, mit Erinnerungen an Anna zu füllen, dann bin ich damit ganz und gar nicht einverstanden. Anna ist schon lange Geschichte für mich. Ich habe mit ihr abgeschlossen. Daran wird auch die Trennung von Felix nichts ändern.
Als das Display meines Smartphones plötzlich aufleuchtet, lenke ich meine Aufmerksamkeit auf die Nachricht, die dort erscheint.
Ciara: Sorry Babe, hab erst am Wochenende wieder Zeit. Hast du dann Lust auf einen Drink?
Enttäuscht beiße ich mir auf die Unterlippe. Als ich Ciara auf dem Heimweg geschrieben habe, hatte ich gehofft, den heutigen Abend nicht alleine verbringen zu müssen. Nach der Hiobsbotschaft von Michael könnte ich dringend ein wenig Ablenkung gebrauchen. Vor allem wäre mir jedoch ein wenig
Gesellschaft willkommen.
Ich checke die Einträge in meinem Kalender und rolle genervt mit den Augen, als ich feststelle, dass ich am Wochenende bereits Pläne habe. Unaufschiebbare Pläne. Eilig huschen meine Finger über die Oberfläche meines Handys. Unter meinem Daumen spüre ich deutlich die tiefen Risse, die das Display durchziehen.
Kate: Alles gut. Bin am Wochenende leider bei meinen Eltern, aber vielleicht darauf die Woche? Würde mich freuen. xxx
Ich kaue auf der Innenseite meiner Wange herum, während ich auf eine Antwort von Ciara warte. Kleine Schweißperlen bilden sich auf meiner Stirn. Den bereits lange geplanten Besuch bei meinen Eltern hatte ich vollkommen vergessen - oder erfolgreich verdrängt.
Ich rufe unseren Familien-Chat auf und überfliege die letzten Nachrichten, die wir ausgetauscht haben. Doch je mehr Nachrichten ich lese, desto schneller schlägt mein Puls. Der subtil vorwurfsvolle Ton meines Vaters gefällt mir auch mit einigen Wochen Abstand nicht. Für einen Moment spiele ich ernsthaft mit dem Gedanken, mir eine Ausrede einfallen zu lassen, um diesem anstehenden Familientreffen zu entgehen. Dann wiederum erinnere ich mich an das letzte Telefonat mit meiner Mutter, an den flehenden Unterton in ihrer Stimme. Und an die Erleichterung, als ich doch nachgegeben und versprochen habe, an ihrem Geburtstagswochenende nach Hause zu kommen.
Ich seufze, puste mir im gleichen Zug eine lose Haarsträhne aus der Stirn. Es hilft ja nicht. Es wird Zeit, sich der Realität zu stellen. Und vor allem Zeit, mal wieder nach Hause zurückzukehren, denn auch meine Eltern habe ich seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr gesehen. Und das liegt nicht allein an den knapp fünfhundert Kilometern Luftlinie, die uns voneinander trennen.
Ich werfe mein Handy in die Luft, fange es auf, bevor es mitten in meinem Gesicht landen und mir die Nase brechen kann. Eine Welle des Bedauerns schwappt durch meinen Körper. Eine gebrochene Nase wäre immerhin Grund genug, meine Reise doch noch abzusagen.
Ich seufze. Sie lastet auf mir. Die Tatsache, dass meine Eltern noch immer nicht wissen, dass Felix und ich kein Paar mehr sind. Dennoch scheue ich mich seit Monaten davor, es ihnen mitzuteilen.
Ich rolle mich auf die Seite und blicke nachdenklich aus dem Fenster, mein Kinn auf meine Unterarme gestützt. Es gibt da so einige Dinge, die meine Eltern nicht über mich wissen und wenn ich ehrlich bin, dann bin ich auch nicht sonderlich erpicht darauf, diesen Zustand zu ändern. Je weniger Information sie haben, desto weniger Angriffsfläche bietet sich ihnen.
In der Wohnung direkt gegenüber geht auf einmal das Licht an. Ganz plötzlich offenbart sich mir die Wohnung der jungen Frau, die dort wohnt, wie ein frontal geöffnetes Puppenhaus. Geschäftig marschiert sie durch ihr Reich. Vermutlich hat sie nicht den leisesten Schimmer, wie entblößt sie ist, wie viele zutiefst intime Einblick in ihr Leben ich gerade bekomme. Was genau die Frau gegenüber tut, kann ich aufgrund der Distanz nicht erkennen. Dennoch habe ich in diesem Moment das Gefühl mehr über sie zu wissen, als ihr vermutlich lieb ist.
Ich weiß, wann sie aufsteht, wann sie zur Arbeit geht, was sie trägt, wenn sie morgens aus dem Bett steigt. Ich kenne ihre Routinen. Sie kauft regelmäßig frische Blumen für ihren Esstisch, den sie so gut wie nie benutzt. Sie liebt Bücher, die sie aus Mangel an Regalplätzen auf einer antiken Kommode stapelt. Ich weiß, dass sie auf Kerzen steht, denn abends tanzen oft unruhige Schatten an ihren Wänden.
Ich weiß viel über sie, und doch auch irgendwie nichts. Weder habe ich Ahnung, wie sie heißt, noch wie ihre Stimme klingt, oder welches Parfüm sie trägt. Obwohl sie mir so nah ist, ist sie doch nichts weiter als eine Fremde für mich. Eine von vielen in einer Millionenstadt. Begegnete sie mir im Supermarkt, außerhalb dieser vertrauten vier Wände, würde ich sie vermutlich nicht einmal erkennen. Dass ich existiere, dass ich sie manchmal beobachte, ahnt sie wahrscheinlich nicht.
Ich kämpfe mich von meiner Matratze und lasse meine Rollläden herunter. Die feinen Härchen auf meinem Unterarm richten sich auf, denn mit einem Mal fühle auch ich mich beobachtet. Ich schalte das Licht nicht ein, als ich auf dem Weg in meine Küche an der fest verschlossenen Zimmertür vorbei schlurfe, um mir ein Glas Wasser zu holen.
Wenig später sitze ich mit meinem Laptop auf dem Schoß, das Glas auf dem Boden neben mir, erneut auf meiner Matratze. Dies ist der einzige Ort in meiner Wohnung, an dem ich noch einigermaßen bequem sitzen kann. Denn natürlich hat auch unsere Couch Felix gehört.
Wie jeden Abend klicke ich mich erfolglos durch Wohnungsanzeigen. Nachricht um Nachricht verlässt meinen Postausgang, obwohl ich weiß, dass ich auf die meisten von ihnen keine Antwort erhalten werde. Als alleinstehende Frau eine Bleibe in Berlin zu finden, grenzt an ein Ding der Unmöglichkeit.
Bereits seit der Trennung von Felix suche ich nach einer neuen Unterkunft. Vergebens. Dabei brauche ich dringend eine Alternative zu dieser Wohnung, die Monat für Monat ein immer größeres Loch in mein Portemonnaie frisst. Ohne die Gehaltserhöhung, auf die ich fest gesetzt hatte, weiß ich nun sicher, dass ich die Wohnung auf gar keinen Fall werde halten können.
Mein linker Daumennagel ist bereits bis auf die Nagelhaut herunter gekaut. Unruhig tippen meine übrigen Finger auf den Metallrahmen meines Laptops. Langsam aber sicher gehen mir die Optionen aus. Mir läuft die Zeit davon.
Neben mir leuchtet der Bildschirm meines Handys immer und immer wieder auf. Meine Gruppenchats explodieren. Ich werfe einen flüchtigen Blick auf die Nachrichten, tippe mit einer Hand Antworten ein, während ich mit der anderen von einer Wohnungsanzeige zur nächsten scrolle.
In weiser Voraussicht habe ich für beinahe jeden weiteren Abend in dieser Woche Pläne gemacht. Alles ist besser, als allein in diesem Loch zu sitzen, das sich mein Zuhause schimpft. Ich kann nicht länger Abend für Abend dieser erdrückenden Stille lauschen und verzweifelt nach Wohnungen suchen, zu deren Besichtigungen ich sowieso nicht eingeladen werde.
Als ich genug von den Wohnungsanzeigen habe, wechsle ich zu Jobinseraten. Doch auch hier hege ich kaum große Hoffnungen. Ohne Studium und ohne sonstige Qualifikationen wird es schwierig sein, einen besser bezahlten Job zu finden als den, den ich bereits habe. Ein frustrierter Seufzer entweicht mir. Leider ist das eine Realität, die auch Michael kennt. Er weiß, dass er mich in der Hand hat.
Das grelle Licht meines Laptop-Bildschirms beginnt, unangenehm in meinen Augen zu brennen. Ich schmecke Blut. Statt weiter an meinem Nagel zu knabbern, beginne ich, an meinem schmerzenden Daumen zu saugen. Ich will die Blutung stoppen, den Schmerz lindern und vergessen, dass nichts, absolut gar nichts, in meinem Leben nach Plan läuft.
5
Die Bahnfahrt zu meinen Eltern am Wochenende entpuppt sich als wahrer Albtraum. Weil ein Ersatzzug herbeigeschafft werden muss, verliert meine Sitzplatzreservierung ihre Gültigkeit. Zusätzliche Zugausfälle auf der Strecke führen dazu, dass die Abteile der Holzklasse so hoffnungslos überfüllt sind, dass ich einen Großteil der Fahrt auf dem Fußboden vor den übelriechenden Toiletten verbringen muss. Eine Mutter spaziert mit hochrotem Kopf und einem kreischenden Baby in den Armen durch die überfüllten Gänge. Zwei junge Männer haben ihre Kopfhörer vergessen, lassen sich jedoch nicht davon abhalten, ein YouTube-Video nach dem anderen anzuschauen. Irgendjemand isst Eiersalat aus einer Tupperdose. Auf halber Strecke fällt die Klimaanlage aus.
Wir bleiben fünfundvierzig Minuten in Gütersloh stecken, weil sich irgendwo auf der Strecke Fußgänger befinden. Nach dem Halt in Bochum werden die Toiletten gesperrt, weil das Personal vergessen hat, die Spülwasservorräte aufzufüllen. In Duisburg verpasse ich meinen Anschlusszug und stehe mir am Gleis die Beine in den Bauch. Ein ganz normaler Reisetag mit der Bahn eben.
Als ich endlich an meiner Zielhaltestelle ankomme, ist es bereits dunkel. Kurz spiele ich mit dem Gedanken, meine Mutter anzurufen und sie zu bitten, mir mit dem Auto entgegenzukommen. So könnte ich mir immerhin den zwanzigminütigen Fußweg von der Bushaltestelle zum Haus meiner Eltern sparen.
Nach einem prüfenden Blick über meine Schulter entscheide ich mich dagegen. Um mich herum ist es bis auf das Zirpen der Grillen, die den letzten dahinsiechenden Sommertagen hinterher trauern, absolut still. Ein kleiner Spaziergang vor dem Showdown wird mir sicherlich gut tun.
Ich schiebe mein Handy zurück in meine Hosentasche und schließe für einen Moment erleichtert meine Augen. Es duftet nach feuchter Erde, morschem Holz und frischer Landluft. Erstes Herbstlaub knistert unter meinen Schuhsohlen, als ich mich in Bewegung setze.
Es ist ein Weilchen her, seit ich das letzte Mal diese Landstraße entlang spaziert bin. Gerade einmal dreihundert Menschen leben in dem Dorf, das meine Eltern seit jeher ihre Heimat nennen. Sie haben nie woanders gelebt.
Die schmale Sichel des Mondes wirft ein silbriges Licht auf den aufgesprungenen Asphalt vor mir. Die Feldstraße, die gerade genug Platz für einen kleinen PKW bietet, ist komplett unbeleuchtet, vom Mondlicht einmal abgesehen. Laternen am Straßenrand gibt es hier nicht.
Mir macht die Dunkelheit jedoch nichts aus. Nicht hier. Jede Ritze, jedes Schlagloch, jede Biegung in der Straße ist mir vertraut. Außerdem werde ich für das fehlende Licht mit einer Vielzahl funkelnder Sterne entschädigt, die das endlos scheinende Himmelszelt über mir zum Glitzern bringen.
Die Hände tief in meine Jackentaschen geschoben, spaziere ich durch eine wunderschöne, kristallklare Spätsommernacht. Eine sanfte Abendbrise streicht zärtlich durch mein Haar. Ein Willkommensgruß. In dieser Atmosphäre sollten meine Schritte mit jedem zurückgelegten Meter leichter werden. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Riemen meines Rucksacks schneiden tief in meine Schultern.
Ich fahre mir mit der Zungenspitze über die Lippen. Wie schon lange nicht mehr, sehne ich mich nach einer Zigarette.
Mitten in der Nacht haben Anna und ich uns klammheimlich aus dem Haus geschlichen. Wir liegen auf einer alten Wolldecke, inmitten eines unbestellten Feldes, das zwischen unserem Dorf und der hinter einem kleinen Wäldchen verborgenen Hauptstraße liegt. Über uns funkeln die Sterne in einer Intensität am Nachthimmel, die ich selten erlebt habe. Neben mir leuchtet die Glut eines Zigarettenstummels auf.
»Darf ich auch mal?« wispere ich in die Dunkelheit, obwohl ich die Antwort ohnehin schon kenne.
Ohne ihren Blick von dem unendlichen Himmelszelt über uns abzuwenden, schüttelt Anna ihren Kopf.
»Auf gar keinen Fall.«
Sie hält mich für zu jung. Ich dränge sie nicht weiter, denn das hätte eh keinen Zweck. Wenn Anna von etwas überzeugt ist, dann ist sie davon so leicht nicht mehr abzubringen. Sie war schon immer äußerst dickköpfig, wenn es um solche Dinge ging.
Wir schweigen. In einträchtiger Stille lauschen wir den zarten Geräuschen der Nacht und warten. Auf die Perseiden, den Sternschnuppenschauer, der für diese Nacht vorhergesagt wurde.
Ich fröstele, denn langsam wird es frisch hier draußen. Eine feuchte Kälte kriecht durch meine zu dünne Kleidung und jagt mir einen Schauer nach dem anderen über den Körper. Ich hätte doch auf Anna hören und meine wärmere Jacke anziehen sollen. Instinktiv rücke ich ein Stück näher an meine Schwester heran. Sie greift prompt nach meiner Hand und umschließt meine Finger mit ihren. Annas Hände sind immer warm.
Ich bin dankbar dafür, dass sie hier neben mir liegt. Sie ist nur wegen mir hier. Wenn ich sie nicht angebettelt hätte, mich zu begleiten, dann würde sie jetzt in aller Seelenruhe in ihrem warmen Bett schlummern.
»Da, noch eine! Hast du gesehen?« flüstert sie und stößt mir aufgeregt mit dem Ellbogen in die Rippen.
Enttäuscht verneine ich. Anna hat schon mindestens fünf Sternschnuppen gesehen. Ich keine einzige.
»Was hast du dir gewünscht?« frage ich sie. Gespannt halte ich die Luft an.
Anna kichert leise. Sie dreht ihren Kopf in meine Richtung. Ich kann ihren warmen Atem auf meiner Wange spüren.
»Das sag ich dir doch nicht. Sonst geht mein Wunsch ja nicht in Erfüllung.«
Ich nicke verständnisvoll, auch wenn mir ihre Antwort insgeheim doch einen kleinen Stich versetzt hat. Natürlich hat sie Recht. Man muss seinen Wunsch geheim halten, wenn man will, dass er in Erfüllung geht. Gleichzeitig bin ich mir aber ziemlich sicher, dass ich ihr umgekehrt trotzdem von meinem Wunsch erzählt hätte.
Schließlich sind wir Schwestern. Und Schwestern sollten keine Geheimnisse voreinander haben.
Erst als ich beim Anblick des leeren Stellplatzes vor dem Haus meiner Eltern erleichtert ausatme, fällt mir auf, dass ich auf den letzten Metern angespannt die Luft angehalten habe.
Die automatische Eingangsbeleuchtung schaltet sich ein, als ich vor der Haustür stehe. Ich streife mir den Riemen meines Rucksacks von der Schulter, um in der aufgenähten Vordertasche nach meinem Schlüssel zu suchen. In genau diesem Moment öffnet sich die Eingangstür. Meine Mutter steht mit weit aufgerissenen Augen vor mir, eine weiße Plastiktüte in der Hand. Leere Glasflaschen klimpern aneinander.
»Katharina! Da bist du ja endlich«, ruft sie aus. »Ich habe mich schon gefragt, wo du bleibst. Na los, komm rein, komm rein.« Sie drückt mir einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Wie immer riecht sie nach Pfefferminz-Bonbons.
Ich bürste meine Stiefel auf der Reisigmatte ab, bevor ich das Haus betrete. Als ich über die Schwelle schreite, lasse ich Kate aus Berlin auf dem Fußabtreter zurück. Es ist Katharina, die im Flur aus ihren Stiefeln schlüpft.
Meine Mutter, die ungeduldig mit dem Fuß wippend darauf gewartet hat, dass ich endlich herein komme, zwängt sich umständlich an mir vorbei. Sie steigt die Betonstufen in den Vorgarten hinunter.
»Geh ruhig schon ins Wohnzimmer durch«, ruft sie mir über die Schulter hinweg zu, »ich muss nur noch kurz zum Auto.«
Sie reckt die Plastiktüte mit Altglas in die Höhe, das erneut scheppernd aneinander klirrt. Entschuldigend zuckt sie mit den Schultern, huscht anschließend in ihren Hausschuhen über den gepflasterten Pfad und verschwindet in der Dunkelheit.
Weil ich meinem Vater nicht unbegleitet gegenübertreten möchte, warte ich im Flur, bis Mama zurückgekehrt ist. Ihre Mundwinkel zucken nervös, doch mit etwas Fantasie und Wohlwollen meine ich, ein Lächeln auf ihren Lippen ausmachen zu können.
Sie mustert mich von oben bis unten, macht dann einen Schritt auf mich zu und drückt mich steif an sich. Ich erwidere ihre Umarmung zögerlich, schlinge meine Arme dann jedoch fest um ihren zierlichen Körper. Sie wirkt kleiner, schmaler als zuvor. Sie hält mich für einen Augenblick länger fest als gewöhnlich.
»Schön, dass du da bist, Katharina.« Sie schiebt mich ein Stück von sich weg und tätschelt mir die Wange. »Gut schaust du aus, Kind.«
Bevor ich reagieren kann, hat sie sich bereits von mir abgewandt und mir damit die Sicht auf den Spiegel freigegeben, der neben dem Garderobenständer an der Wand hängt. Dunkle Ringe zeichnen sich unter meinen Augen ab. Meine Haut wirkt fahl, mein Haar ist strähnig und ungekämmt. Stresspickel haben sich rund um meinen Mund gebildet. Ich weiß nicht, was sie gesehen hat, aber es ist nicht das, was ich sehe.
»Magst du eine Tasse Tee?« ruft Mama mir aus der Küche zu. Ich kann sie bereits mit Tassen und dem Wasserkocher hantieren hören.
»Gerne.«
Ihrer Stimme folgend schlendere ich durch den langgezogenen Hausflur. In diesem Haus sieht alles noch genauso aus wie immer. Nichts hat sich verändert. Gar nichts. Nirgendwo scheint die Zeit so sehr stillzustehen wie in diesem Haus.
»Hast du schon gegessen?« erkundigt sich meine Mutter, als ich die Tür zur Küche aufstoße. »Oder soll ich dir noch ein Brot schmieren?«
Obwohl ich meinen Magen unter meiner Handfläche rumoren höre, schüttle ich den Kopf.
»Nein, lass mal. Ist schon in Ordnung. Ich habe keinen Appetit.«
»Bist du dir sicher?« Skeptisch schaut sie mich über ihre Schulter hinweg an, doch ich nicke bloß.
»Ja. Aber danke für das Angebot«, füge ich hinzu, als sie mir kurz darauf eine dampfende Teetasse reicht.
Vorsichtig nippe ich an der heißen, wohlig duftenden Flüssigkeit.
»Wo ist Papa?« erkundige ich mich. Dabei verberge ich meine Nasenspitze vorsorglich tief in meiner Teetasse.
Meine Mutter mustert mich über den Rand ihres eigenen Bechers hinweg, entscheidet sich jedoch dazu, den Kommentar herunterzuschlucken, der ihr offensichtlich auf den Lippen lag.
»Arbeiten«, antwortet sie schließlich nur. Behutsam stellt sie ihre Tasse auf der Küchentheke ab. »Ein Notfall. Edgars Kuh kalbt. Papa wird sicher die ganze Nacht unterwegs sein.«
Ich seufze erleichtert auf, wofür ich prompt einen tadelnden Blick ernte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Hitze auf meinen Wangen, einzig und alleine dem heißen Wasserdampf zu verdanken habe, der in sanften Wölkchen von meiner Tasse aufsteigt.
Verlegen räuspere ich mich. »Und was ist mit Finn?«
»Der ist oben in seinem Zimmer.«
Ich nicke. Wir schweigen für eine Weile. Ich trinke meinen Tee, meine Mutter wischt über ohnehin schon blitzblanke Küchenoberflächen. Fragen stellt sie mir keine. Und auch mir fallen keine ein.
Wenig später liege ich, erschöpft von der Reise, in dem Bett meiner Schwester. Mein ehemaliges Zimmer existiert nicht mehr. Mein Vater hat es bereits vor Jahren in ein zweites Büro umgewandelt.
Ich lasse meinen Blick durch den Raum schweifen. Annas Zimmer sieht noch exakt so aus wie damals. Selbst die alten Bravo-Poster und Starschnitte hängen noch an den Wänden. Oben auf dem Kleiderschrank sitzt ein abgenutzter Teddybär, dessen einst knallrote Schleife mitgenommen an seinem Hals hängt. Sein rechtes Auge fehlt.
»Was meinst du damit, du kommst doch noch nicht zurück?«
Stille am anderen Ende der Leitung.
Ich sitze mit angewinkelten Beinen auf meinem Bett, den Hörer des Telefonapparates zwischen Ohr und Schulter geklemmt. Ich starre in die schwarzen, ausdruckslosen Augen eines Teddybären, den ich in meinen zitternden Händen halte. Eine einzelne Träne rollt über meine Wange, landet auf der schimmernden Schleife, die sich augenblicklich dunkelrot verfärbt.
»Es sind doch nur ein paar Monate«, wispert Anna ins Telefon. Ihr schlechtes Gewissen lässt ihre Stimmbänder vibrieren.
»Den Spruch kenne ich. Das hast du mir schon mal erzählt.«
Ich kann nicht verhindern, dass sich meine Stimme hebt. Der Schmerz in meiner Brust hat mich vollkommen im Griff, lässt nun Träne um Träne über mein Gesicht kullern.
Anna schweigt. Sie unternimmt nicht einmal den leisesten Versuch, mich zu beruhigen. Sie weiß, dass es zwecklos ist.
Nun schluchze ich hemmungslos, knete den weichen Körper des Teddybären in meinen Händen. Alle Tapferkeit, alle Geduld, sämtliche Zurückhaltung, die ich bis dahin an den Tag gelegt habe, wird mit einem Mal aus meinem Körper geschwemmt.
»Du hast versprochen, in ein paar Wochen wieder hier zu sein. Und jetzt willst du noch einmal drei Monate in Australien bleiben?«
»Komm schon Kitty, jetzt sei doch nicht so…«
Ich lasse sie nicht weiter zu Wort kommen.
»Nein!« brülle ich in den Hörer. »Du hast es versprochen, Anna. Du kannst mich doch nicht einfach hier im Stich lassen!«
»Kitty, ich…«
Ich höre nichts weiter als das Rauschen meines Blutes in meinen Ohren. Mein Gesicht fühlt sich taub an, meine Lippen prickeln. Ehe ich mich versehe, drückt mein Daumen auf das rote Telefonhörersymbol. Die Leitung wird unterbrochen.
Auf den ersten Schock, die Trauer, folgt unbändige Wut. Ich zerre an den dämlich dreinblickenden Knopfaugen des Teddybären. Ich möchte ihm die verdammten Dinger aus dem Kopf reißen, damit er mich nicht mehr anstarren kann. Als ich endlich das erste schwarze Plastikknöpfchen in meiner Hand halte, hole ich aus und schleudere es quer durch mein Zimmer. Es titscht einige Male auf dem Holzboden auf und rollt dann unter den großen Kleiderschrank, wo es für immer verschwinden soll.
Anna. Immer wieder Anna. Ich rolle mich auf die Seite und starre von da an die blanke Wand an.
Auf der anderen Seite höre ich die gedämpfte Stimme meines Bruders. Leise flüstert er skurrile Anweisungen in das Mikrofon seines Headsets. Vermutlich wird er noch bis spät in die Nacht vor seinem Laptop sitzen und zocken. Verdenken kann ich es ihm nicht. So weit ich weiß, endet Finns Computerzeit an normalen Abenden pünktlich um 20 Uhr, exakt eine Stunde nach dem Abendbrot. Papa macht keine Ausnahmen.
Auf der anderen Seite der Wand lacht Finn leise. Edgars Kuh zum Dank ist heute kein normaler Abend. Papa ist nicht da und Mama interessiert es normalerweise herzlich wenig, was wir in unseren Zimmern treiben.
Das Licht der Nachttischlampe neben mir flackert nervös. Obwohl meine Augen vor Müdigkeit brennen, finde ich schon seit geraumer Zeit nicht in den Schlaf. Ich rolle mich zurück auf die andere Seite und öffne die fast leergeräumte Nachttischschublade. Ich finde sofort, wonach ich suche. Die Finger meiner Hand schließen sich um einen gelben Tennisball.
Ich brauche einen Moment, bevor ich den Dreh wieder heraus habe, doch schon bald gelingen mir die ersten, fast perfekten Würfe. Heutzutage hätte meine Schwester keine Chance mehr gegen mich, dessen bin ich mir sicher.
Irgendwann, spät in der Nacht, vernehme ich das leise Brummen eines Automotors, gefolgt von knirschenden Steinen unter Gummireifen und dem dumpfen Klang einer Autotür, die ins Schloss fällt. Hastig lösche ich das Licht. Fast gleichzeitig verstummen die Geräusche aus dem Nebenzimmer. Das Haus meiner Eltern liegt dunkel und still da, während ich den schweren Schritten meines Vaters lausche, die langsam näher kommen. Ich presse meine Lider zusammen, damit das Weiß meiner Augäpfel nicht in der Dunkelheit leuchtet.
Als ich am nächsten Morgen aufwache, duftet es im ganzen Haus verführerisch nach frisch gebackenem Kuchen. Der köstliche Geruch treibt mich flink aus den Federn.
Ich öffne Annas Zimmertür und luge vorsichtig durch den schmalen Spalt. Es fällt kein Tageslicht in den Flur. Sämtliche Zimmertüren auf der Etage sind fest verschlossen. Meine Familie liebt verschlossene Türen.
Behände husche ich durch den Flur, steige dann die knarrenden Holzstufen hinab. Auf dem Weg nach unten passiere ich die Galerie von Kinder- und Familienfotos, die fast die gesamte Wand neben der Treppe ziert.
Es ist Annas strahlendes Kinderlächeln, das meine Aufmerksamkeit auf sich zieht und mich auf halbem Weg innehalten lässt. Ihr Lächeln und ihre leuchtend blauen Augen üben eine Anziehungskraft aus, die weder mein kleiner Bruder noch ich je besessen haben. Unsere Bilder verblassen neben denen unserer Schwester.
Anna ist das glücklich quietschende Baby mit dem goldenen Haarflaum. Sie ist das strahlende Kleinkind, das ihrem missmutigen Schwesterchen mit der Babyakne die Stirn küsst. Annas Einschulungsbild hängt neben Finns an der Wand. Meines fehlt, denn an meinem ersten Schultag hat man die Kamera vergessen. Anna, gerade zwölf geworden, sitzt neben meiner Mutter im Krankenhaus und wiegt stolz unseren neugeborenen Bruder in den Armen. Ich stehe, halb abgeschnitten, verlegen im Hintergrund.
Ich beuge mich nach vorne. Wenn man das Foto genauer betrachtet, kann man erkennen, dass Baby Finn meinen Finger mit seiner winzigen, pummeligen Faust umschlossen hält. Ein Lächeln breitet sich auf meinem Gesicht aus. Damals war ich vollkommen vernarrt in meinen kleinen Bruder.
Vorsichtig setze ich meinen Weg die Stufen hinab fort. Auf der letzten halte ich jedoch erneut inne. Das allerletzte Foto zeigt meine Eltern zusammen mit Anna vor dem Opernhaus in Sydney. Die Aufnahme ist neu, ich kenne sie noch nicht. Sie hat ein Bild ersetzt, auf dem Finn und ich bei seiner Konfirmation vor zwei Jahren zu sehen waren.
Wieder beuge ich mich ein Stück nach vorne, um das Foto genauer zu begutachten. Es muss bei dem letzten Besuch meiner Eltern bei Anna entstanden sein. Ich schnaufe verächtlich. Es ist schwer zu sagen, wer glücklicher aussieht. Bevor ich meinen Weg fortsetze, versetze ich dem Bilderrahmen einen dezenten Stupser mit meinem Zeigefinger, sodass er nicht länger perfekt ausgerichtet an seinem Nagel hängt.
In der Küche steht meine Mutter in ihrer dunkelgrauen Kochschürze vor dem Herd und backt ihren Geburtstagskuchen. Draußen vor dem Fenster sehe ich Finn mit einer großen, blauen Plastiktüte in der Hand. Er sammelt heruntergefallenes Laub im Vorgarten ein. Ich kann mir ein Schmunzeln nicht verkneifen. Diese ehrenvolle Aufgabe ist ihm mit Sicherheit von Papa aufgedrückt worden. Wenn heute Nachmittag die Verwandtschaft und vermutlich die halbe Nachbarschaft aufschlägt, muss schließlich alles perfekt aussehen. Gut, dass ich Papa gestern nicht mehr über den Weg gelaufen bin. Sonst hätte er mich mit Sicherheit auch vor seinen Karren gespannt.
»Guten Morgen, mein Schatz«, zwitschert meine Mutter fröhlich, als sie mich im Türrahmen bemerkt.
Ich zucke zusammen, als sie sich umdreht. Erst jetzt, im Tageslicht, fällt mir auf, wie eingefallen ihre Wangen aussehen.
»In der Kanne ist noch frischer Kaffee, wenn du welchen magst.«
»Danke«, erwidere ich und drücke ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange. »Alles Gute zum Geburtstag, Mama.«
Sie lächelt zufrieden vor sich hin, macht allerdings keine Anstalten, ihre Aufmerksamkeit von dem Kuchenteig abzuwenden, den sie eifrig auf der mehlbestäubten Küchentheke knetet.
Ich öffne einen der Küchenschränke, um eine Tasse herauszuholen. Als ich sie ein wenig lauter als beabsichtigt auf dem Esstisch abstelle, wirft mir Mama zunächst einen erschrockenen, dann einen mahnenden Blick zu.
»Pass doch bitte auf, Katharina. Papa schläft noch. Er ist gestern erst spät in der Nacht nach Hause gekommen.«
Ich rolle mit den Augen, entschuldige mich jedoch sogleich. Natürlich. Mein Vater schläft noch und so lange steht die Welt in diesem Haus still. Der Herr im Haus darf unter keinen Umständen gestört werden.
Ich lasse mich auf einen der Küchenstühle sinken. Während ich an meinem Kaffee nippe, beobachte ich Mama fasziniert dabei, wie sie beinahe lautlos durch die Küche huscht, praktisch geräuschlos das Chaos beseitigt, welches das Kuchenbacken hinterlassen hat. Auch wenn es unmöglich scheint, stählerne Backbleche aufeinander zu stapeln, ohne dabei Geräusche zu machen, bringt meine Mutter es irgendwie fertig. Jahrelange Übung vermute ich.
»Kann ich dir noch bei irgendwas helfen?« frage ich sie im Flüsterton.