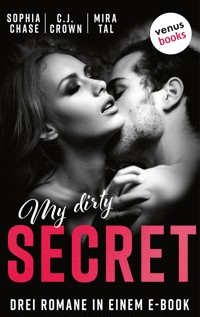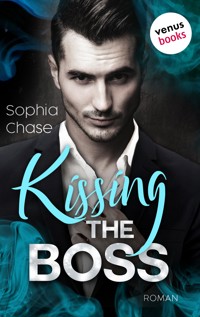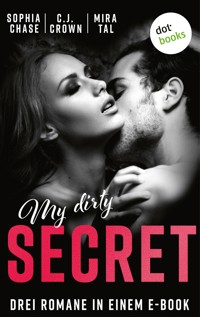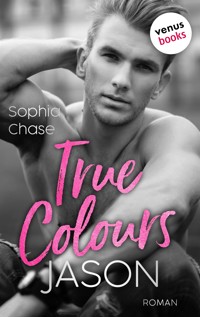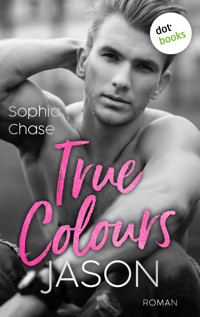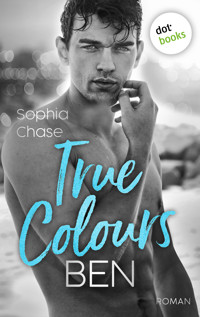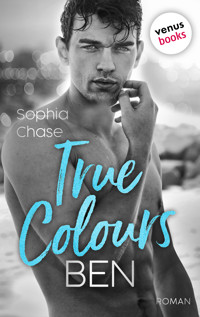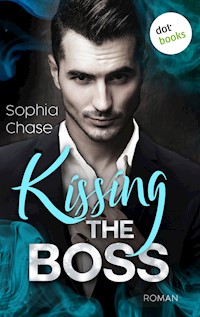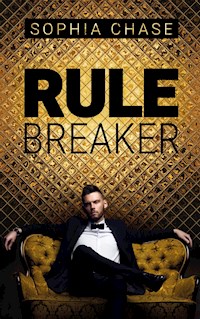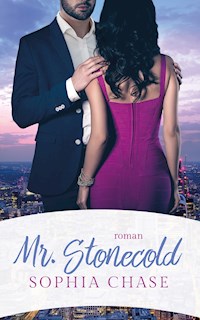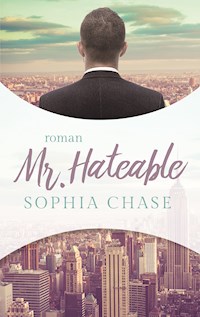
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Verhältnis mit dem Chef – für Lauren ein No-Go! Zum Glück ist ihr neuer Boss ein riesiger Mistkerl, arrogant, selbstverliebt und großkotzig. Leider ist er aber auch furchtbar attraktiv und scannt sie mit diesem einen bestimmten Blick, der sie bis in ihre Träume verfolgt. Finley Shaw hat sich fest vorgenommen, aus seinen Fehlern zu lernen. Deshalb lautet sein oberstes Gebot: Lass die Finger von deiner Assistentin! Doch er kann nicht aufhören, Lauren anzugaffen, als wäre sie das saftigste Stück Steak, das er jemals auf seinem Teller hatte. Dabei hat er im Augenblick sehr viel größere Probleme am Hals, die seinen Ruf gefährden, als nur die Frage, wie er Lauren ins Bett bekommen könnte. Er weiß, dass er sie in ein Spinnennetz ziehen wird, das mächtiger ist, als er zu glauben vermag …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Sophia Chase
Mr. Hateable
Dieses eBook wurde erstellt bei
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Buch interessieren! Noch mehr Infos zum Autor und seinem Buch finden Sie auf tolino-media.de - oder werden Sie selbst eBook-Autor bei tolino media.
- gekürzte Vorschau -
Inhaltsverzeichnis
Titel
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
EPILOG
Impressum tolino
EINS
Finn
Es regnet und regnet und regnet.
Das Wetter bringt mich normalerweise überhaupt nicht aus meiner täglichen Routine, da ich Leute um mich habe, die alles kurzerhand und ohne Widerrede für mich erledigen – und das sogar bei Regenwetter, über welches sich andere Menschen pausenlos zu beschweren pflegen. Heute aber reißt mich das Wetter aus meiner Komfortzone – ungewollt. Normalerweise muss ich mir keinerlei Gedanken darüber machen, ob ich einen Regenschirm im Auto liegen habe, um schnell zum Bäcker laufen zu können, ohne dabei klitschnass zu werden.
Allerdings werden meine Gewohnheiten heute buchstäblich in einen Koffer gepackt und aus dem dreiundfünfzigsten Stock geworfen.
Während ich nun also völlig entgegen meinen Gewohnheiten einen öden Einkaufswagen in den noch öderen Supermarkt schiebe, wird mir bewusst, dass ich in einer völlig anderen Welt als all die Menschen ringsum lebe. Ich bin – keine Ahnung – vielleicht erst viermal in meinem Leben einkaufen gewesen. Daher gleicht es einem Wunder, dass es mir dennoch gelingt, mich scheinbar problemlos in die Reihen der anderen Menschen einzugliedern. Ich hoffe zumindest, dass ich das durchhalten werde. Doch niemand starrt mich an, bedenkt mich nicht einmal mit einem Seitenblick, als ich in meinem schwarzen Maßanzug und den auf Hochglanz polierten Lederschuhen über die gelblichen, stellenweise etwas schmuddeligen Fliesen wandere.
Es gibt wohl nur einen einzigen Menschen auf der Welt, der es schafft, mich in einen Supermarkt in Southwalk zu bringen – und dieser Jemand ist mein Dad. Ein Mann, vor dem ich den größten Respekt habe; der es so gut wie kein anderer versteht, mir als Vorbild zu dienen und Stärke, Macht und Autorität zu demonstrieren. Mein Leben lang schaue ich schon zu ihm auf. Ich bewundere das, was er in seinem Leben geschaffen hat, und weiß dennoch sicher – und mit etwas Unbehagen –, wie riesig die Fußstapfen sind, in die ich einmal zu treten gedenke.
Aber genug damit. Ich schiebe diese Gedanken beiseite und bleibe vor dem Regal, nach dem ich die längste Zeit gesucht habe, stehen. Ich trommele ungeduldig mit den Fingern auf die weiße Plastikvorrichtung des Einkaufswagens, in die man Münzen oder Einkaufswagenchips stecken kann, und scanne Reihe für Reihe ab. Obwohl meine innerlichen Lobeshymnen auf meinen Dad gerade noch ziemlich freudig und ausufernd waren, breitet sich in mir nun schlechte Laune aus.
„Wie ich das hier alles hasse“, grummele ich vor mich hin und greife nach einer Shampooflasche vor mir auf dem Regal.
Ich öffne den Verschluss, schnüffele daran und rümpfe die Nase.
Was erwarte ich mir auch von einem Laden wie diesem? Einfach abartig. Alles hier. Wieso meint mein Dad, ausgerechnet hier würde ich das finden, nach dem er verlangt hat?
Die nächste Flasche bringt auch kein zielführendes Ergebnis. Das ist echt ermüdend. Außerdem drängt die Zeit. Mein Dad will in zwei Stunden zum Flughafen losfahren. Ich frage mich nur noch, wieso er mich hergeschickt hat – und nicht seine Assistentin. Wozu bezahlt er sie denn eigentlich? Doch mein Dad denkt wohl sehr pragmatisch – und ist irgendwie bodenständiger als ich. Er meint immer, man solle für nichts zu stolz sein. Man könne jede Arbeit selbst machen – wenn man nur wolle. Das mag ja für ihn zutreffen – für mich jedoch sicher nicht.
Lediglich ein weiteres Mal probiere ich es jetzt noch. Wenn ich wieder nicht die richtige Marke erwische, muss er eben ohne sein geliebtes Shampoo wegfliegen. Das wird er schon überleben, und die Haare werden ihm bestimmt auch nicht ausfallen – zumindest der klägliche Rest, der noch übrig ist.
Gerade als ich in meiner Jacketttasche nach meinem Handy krame, um die Nachricht meines Dads noch einmal zu lesen, schiebt sich vor mir eine Frau zwischen das Regal und mich. Sie duckt sich, denkt, auf diese Weise weniger störend zu sein, doch ich bin jetzt endgültig genervt. Mit ausgestrecktem Zeigefinger fährt sie über die Produkte der mittleren Regalreihe, tippt dann siegessicher auf ein Shampoo und zieht es heraus.
Meine Augen fixieren diesen dunkelbraunen Haarschopf vor mir so starr, als könnte ich es dank meiner Wut, die sich nun auf diese Tussi projiziert, ihren Schädel mit reiner Gedankenkraft zu zertrümmern. Doch sie zuckt nicht einmal.
Nicht einmal die Tatsache, dass ihr die zweite Flasche aus der Hand gleitet, zu Boden fällt und mit einem lauten – zumindest hört es für mich so an – „Plopp“ aufspringt, bringt sie aus der Ruhe. Erst als sie die gelartige Pfütze, die sich rasch vor meinen Füßen ausgebreitet hat, bemerkt, wird sie aktiver. Sie blickt mich an, murmelt eine leise Entschuldigung und scannt mich im nächsten Moment von oben bis unten ab. So dreist muss man mal sein. Obwohl sie anscheinend irgendetwas an sich hat, das mir gefällt, würde ich die Kleine im Augenblick am liebsten erwürgen.
Sie betrachtet meinen Anzug und die Schuhe und scheint zu dem klugen Schluss zu kommen, dass ich nicht bloß irgendein Penner von der Straße bin – weswegen sie eilig in ihrer Handtasche zu kramen beginnt und mir dann verlegen lächelnd eine Packung Taschentücher reicht.
„Es tut mir so leid. Ich … ich wollte Sie wirklich nicht bespritzen.“
Zumindest diese Worte bringen mich innerlich zum Lachen. Kein Mensch benutzt in solch einer Situation das Wort „bespritzen“, während weiße Flüssigkeit meine Schuhe einrahmt. Entweder hat die Kleine echt Sinn für Humor, oder aber sie ist stockdumm und gedankenlos obendrein.
Ihrerseits bewaffnet mit einer Ration Taschentücher, geht sie nun zu Boden und fängt an, das Shampoo, das ein wenig hochgespritzt ist, von meinen Schuhen zu wischen. Ich beobachte sie von oben, ziehe ihr jedoch den Fuß vor der Nase weg, als ich merke, wie viel schlimmer sie die Sache mit ihrer Aktion zu machen droht.
„Hören Sie auf!“, schnauze ich sie an. „Gott, wie kann man nur so blöd und ungeschickt sein?!“
Noch immer kniend, zerknüllt sie das Taschentuch in ihrer Hand und seufzt.
Von ihrem schlechten Gewissen bekomme ich auch keine neuen Schuhe. So heißt das wohl, ich darf heute den ganzen Tag mit dreckigen, stinkenden und verschmierten Schuhen umherlaufen. Und das alles nur, weil diese Kuh zu dumm ist, eine Flasche Shampoo festzuhalten.
Ich blicke erneut auf meine Schuhe und überlege, woher Sara, meine Assistentin, vor zehn Uhr neue Schuhe auftreiben könnte, als ich einen verdächtigen Fleck auf meiner Hose entdecke. Um genau zu sein, sind es sogar mehrere Flecken, die sich von meinem rechten Hosenbein bis hinauf zu meinem Gürtel ausbreiten. Anscheinend ist diese Shampooflasche nicht bloß runtergefallen, sondern regelrecht vor mir explodiert.
Nun hat auch die Tussi vor mir das gesamte Ausmaß ihrer tollen Aktion mitbekommen und beißt sich verhalten auf die Unterlippe. Schon ist sie wieder mit diesen verfickten Taschentüchern zur Stelle und arbeitet sich ausgerechnet von oben nach unten. In ihrer Panik kommen ihre Finger meinem Schwanz viel zu nahe. Ich packe ihr Handgelenk und zerre sie hoch.
„Wenn Sie mich noch ein einziges Mal anfassen, werde ich …“, doch ich breche den Satz ab und atme tief durch. Einmal. Zweimal. Ich bemerke, wie fest ich ihr Handgelenk halte, und lasse es augenblicklich los. Die Kleine blickt mich deutlich erschüttert an und taumelt einen Schritt rückwärts.
„Ich wollte das wirklich nicht“, versucht sie es noch einmal, mich gnädiger zu stimmen, aber vergebens. Es ist mir egal, ob sie es mit Absicht getan hat oder nicht, passiert ist passiert, und sie hat Schuld daran.
„Das ist mir scheißegal“, fauche ich und nehme eines ihrer Taschentücher, die sie mir zuvor übergeben hat.
Probehalber wische ich über einen Fleck, der immer noch deutlich zu sehen ist. Mit aufgeblähten Nasenflügeln starre ich sie an. „Haben Sie eine Ahnung, wie viel diese Hose gekostet hat? Von den Schuhen mal gar nicht zu sprechen. Aber natürlich haben Sie das nicht“, sage ich mit einem Seitenblick auf ihr dunkelrotes Kleid und die Jeansjacke, die sie darüber trägt.
Sie bemerkt meinen abschätzigen Blick und zieht die Jacke am Hals enger zu. Damit verwehrt sie mir den Blick auf ihr Dekolleté – der einzige Ausblick, der mir in diesem Augenblick reizvoll erschien.
„Gott, was sind Sie nur für ein widerlicher Arsch. Ich habe bloß Ihre Schuhe beschmutzt und nicht versucht, Ihnen den Schädel mit einem Säbel vom Körper abzutrennen. Und wenn diese verdammten Schuhe schon so teuer sind, wie Sie meinen, dann können Sie sich die Reinigung wohl mühelos leisten. Meine Güte!“
Ihre Wangen haben sich während ihres Vortrags gerötet. Sie ist nun ehrlich aufgebracht, und längst ist dieser peinlich berührte Ausdruck aus ihrem Gesicht gewichen. Zum ersten Mal habe ich jetzt erlebt, dass mir jemand – ausgenommen mein Dad – so richtig die Meinung gegeigt hat.
Fast bewundernswert.
Aber purer Zündstoff für meine Kanonen.
„… und überhaupt: Wie zum Teufel können Sie sich erlauben, mich als dumm zu bezeichnen?! Sie … Sie Wichser.“ Um ihre Aussage zu untermalen, schleudert sie mir die vollgeschmierten Taschentücher mitten auf die Brust.
Während diese zu Boden segeln und ich um meine Fassung ringe, breitet sich im Gesicht der dummen Ziege ein gewinnendes Grinsen aus.
„Sie werden für die Reinigung bezahlen!“
„Einen Scheiß werde ich“, wehrt sie meine Forderung mit selbstsicherer Stimme ab.
„Doch, das werden Sie“, halte ich fast schon hilflos dagegen und funkele sie, so es denn möglich ist, noch böser an. „Geben Sie mir Ihren Namen und Ihre Adresse.“
„Sie können mich mal“, meint sie abfällig grinsend und verzieht das Gesicht.
Demonstrativ dreht sie sich leicht zur Seite, greift nach einer neuen Shampooflasche und wirft sie entrüstet in ihren Einkaufskorb. Ihr Grinsen ist zu viel für mich. Ich spüre, wie es tief in mir so stark brodelt, dass ich Angst habe, zum ersten Mal in meinem Leben könne mir die Hand ausrutschen. Und dann ausgerechnet gegenüber einer Frau. Ich bin schon einer Menge engstirniger, verblödeter Arschlöcher begegnet, aber diese dumme Kuh ist nun sehr rasch ganz oben auf der Liste der Idioten gelandet.
„Weil mir meine Eltern eine Menge guter Dinge, aber vor allem Anstand beigebracht haben, möchte ich mich noch einmal bei Ihnen für den kleinen Unfall entschuldigen“, bemerkt sie plötzlich, scheint sich zu diesen Worten aber zwingen zu müssen. „Einen schönen Tag noch.“ Sie nickt beinahe majestätisch und ist tatsächlich drauf und dran, sich einfach aus dem Staub zu machen, als der blonde Schopf eines Supermarktmitarbeiters im Gang zu sehen ist.
Die kleine Schreckschraube bleibt nun doch stehen und betrachtet den Kerl. Ihre Irritation ist unübersehbar.
„Gibt es hier ein Problem?“, fragt er, weil unsere verbale Kollision wohl nicht zu überhören war.
Die nervige Schachtel schüttelt den Kopf und kommt mir mit ihrer Erklärung zuvor. „Wir hatten nur eine kleine Unstimmigkeit. Alles wieder gut.“
Der Kerl, der vielleicht gerade mal fünfundzwanzig ist, blickt von der Tussi zu mir, dann entdeckt er die Sauerei, die meine Füße umgibt. Ich hebe meinen rechten Fuß und bin nicht auf das schlabbrige Geräusch vorbereitet, das dabei zu hören ist.
„Eine Unstimmigkeit mit Materialschaden“, meint der Typ und blickt an mir hoch.
„Ja, vielleicht kann jemand sauber machen, bevor sich noch einer Ihrer Kunden den Hals bricht.“
Der Marktangestellte zieht die Augenbrauen hoch und kommt ein Stück näher. Er bückt sich, um die Flasche aufzuheben und sie kritisch zu mustern.
Irgendetwas ist wohl in die Göre gefahren, als sie plötzlich neben den Mann tritt und all ihre weiblichen Reize einsetzt. Sprich: Sie lächelt zurückhaltend-liebevoll, klimpert mit den Wimpern und senkt den Blick auf jene Art, wie nur Frauen es draufhaben. „Ich wollte ihm nur helfen, damit er trotz seines Missgeschicks seine Schuhe noch retten kann. Aber er wurde sofort ausfallend. Da habe ich meine Hilfsmaßnahme sein lassen und wollte gerade gehen. Sie wissen ja: Der Klügere gibt nach.“
Was zum Teufel labert diese dämliche Kuh da?
„Dann haben Sie also die Flasche fallen gelassen?“, fragt er an mich gewandt.
„Nein!“ Was wird das hier?
„Ja, doch, das hat er.“
Da unsere Antworten simultan erklingen, blickt der Kerl verwirrt von einer Person zur anderen.
„Sie war es“, verteidige ich mich.
„Okay, wer war es jetzt wirklich?“, bohrt der Typ nach.
„Jeff, er war es“, wendet sich die Kleine eindringlich an ihn, und noch während ich mich frage, woher sie seinen Namen kennt, sticht mir das Schild an seinem Hemd ins Auge. Gott, diese Schleimernummer – wie unterdurchschnittlich. „Jeff, ich wollte nur helfen, doch er hat mich als dumm bezeichnet und mein Handgelenk verdreht, als ich ihm die Schuhe putzen wollte.“
Und tatsächlich ist ihr Handgelenk, das sie zur Demonstration gut sichtbar hochstreckt, eindeutig gerötet. Innerhalb weniger Sekunden bin ich der letzte Arsch für diesen Kerl, und ich kann nur froh sein, dass die Zicke nicht auch noch zu heulen angefangen hat.
„Stimmt das so?“, fragt er mich jetzt, und beide sehen auf völlig unterschiedliche Weise zu mir – der Mann prüfend und die kleine Hexe triumphierend.
„Es ist doch ganz egal, was ich jetzt sage, Sie haben sich doch ohnehin von eindeutigeren Argumenten überzeugen lassen.“
Zu meiner eigenen Überraschung fühlt er sich ertappt und weicht ein Stück von der bissigen Kuh zurück.
„Was wollen Sie von mir, Jeff?“, fahre ich fort und betone seinen Namen, anders als die Kleine, etwas abwertend.
„Also, ich für meine Seite wäre mit einer mir gebührenden Entschuldigung ganz zufrieden“, meldet sich die Verrückte nun wieder zu Wort und spinnt ihr Lügennetz weiter und weiter.
Ich presse die Lippen zusammen und hindere mich mit purer Willenskraft daran, meine Hände zu Fäusten zu ballen und weiß Gott was mit ihnen zu machen.
„Das wäre immerhin ein Anfang. Es geht mich nichts an, wie Sie sich normalerweise Frauen gegenüber verhalten. Aber diese hier wollte Ihnen einfach nur helfen, soweit ich das verstanden habe.“
„Was für ein Haufen Scheiße“, fluche ich laut, während ich mich der verlogenen Bitch zuwende und meine Hand zu ihr austrecke. „Ich entschuldige mich für meine Worte.“
Sie grinst, betrachtet prüfend meine Hand, greift dann aber danach. „Entschuldigung angenommen.“
Ruckartiger, als sie es erwartet hat, ziehe ich meine Hand zurück und grinse, als sie leicht schwankt.
„Sie könnten Jeff anbieten, das Shampoo zu bezahlen – wo wir gerade bei Ihrer Läuterung begonnen haben.“
Wäre ich ein Druckkessel, würde nun aus meinen Ohren Dampf hervorquellen. So jedoch erdolche ich sie mit einem stummen Blick und schlucke eine weitere Beleidigung hinunter. Jeffs erwartungsvolle Haltung gibt mir den Rest. Fauchend entreiße ich ihm die aufgeplatzte Shampooflasche und werfe sie in meinen Einkaufswagen.
„Das ist doch der reinste Arschladen. Absoluter Kindergarten. Verlogene Schlampe“, schimpfe ich leise vor mich hin, während ich den Wagen an den beiden vorbeischiebe, um endlich hier wegzukommen.
Ich versuche den hämischen Ton zu ignorieren, mit dem sich die Bitch hinter meinem Rücken bei mir verabschiedet. Doch ich schwöre mir hoch und heilig, nie wieder einen Fuß in irgendeinen jämmerlichen Supermarkt zu setzen. Es gibt nun wohl mehr als einen Grund, wieso ich das sonst immer meinen Angestellten überlasse.
Nachdem ich die kaputte Shampooflasche bezahlt und sie draußen in den Müll geworfen habe, fahre ich mit leeren Händen nach Brentfort. Dort befindet sich das Headquarter unserer Firma. Mein Dad hat in jungen Jahren einen Pharmakonzern aufgebaut. Nach der Fusion mit einem kleineren, aber forschungsstarken Nachbarbetrieb zählt SMP nun zu den führendsten Unternehmen Englands. Von klein auf wusste ich, dass ich meinem Dad nachfolgen wollte, studierte deswegen Pharmamanagement und -technologie und stieg nach dem Studium ins Unternehmen ein. Nun, mit 32 Jahren, habe ich meinem Dad bereits allzu gut bewiesen, wie gut ich in meinem Job bin. Er hat mich, als SMP erneut vergrößert und eine neue Zentrale gebaut wurde, zu seinem direkten Vertreter ernannt. Seither dreht sich wirklich alles in meinem Leben um meinen Job.
Wenn man meine Mitarbeiter fragt, werden sie wohl sagen, dass ich zwar fair, aber ein Arschloch bin. Das mag sogar so stimmen.
Ich bin knallhart, gebe mich bei schlechter Arbeit nicht mit Ausreden zufrieden und dulde keine Verspätungen, Faulheit und Schlampigkeit. Ich verlange von den Leuten um mich herum, dass sie alles geben. Nur dann dürfen sie auch Lob oder Anerkennung von mir erwarten. Wer denkt, er kann mich verarschen, ist schneller wieder draußen, als er seinen Namen sagen kann.
So ist es wohl als Wunder zu bezeichnen, dass mein Dad als das komplette Gegenteil von mir gilt. Er ist nett, hat für jeden, den er auf dem Weg zu seinem Büro trifft, ein nettes Wort übrig, und mich würde es nicht wundern, wenn er auch noch die Geburtstage seiner engsten Mitarbeiter auf seinem Kalender notiert hätte. Als ich vor ein paar Jahren in der Firma begann, dachten die Leute, sie hätten einen zweiten Michael Shaw vor sich. Sie lernten schnell, dass durch mich, Finley Shaw, hier nun ein anderer Wind wehte. Und im Übrigen ist es mir egal, was die Leute hier über mich denken, oder dass sie hinter meinem Rücken über mich tuscheln und mein Leben diskutieren. Es ist mir egal, welche Gerüchte über mich kursieren, dass sie eingeschüchtert von mir sind oder dass sie mich als selbstgefälligen Arsch sehen. Es ist mein verdammter Job und ich bin auf keinen dieser Handlanger angewiesen.
Als sich die Lifttüren in der vierzehnten Etage öffnen und ich meine Laptoptasche anhebe, um auszusteigen, habe ich mich wieder gefasst. Ich steuere zielsicher die rechte Kiefernholztür an, hinter der sich mein Büro befindet. Der gesamte Vorraum ist mit Glaswänden ausstaffiert, während Jenna hinter ihrem Empfangspult die Stellung hält und mich höflich lächelnd begrüßt. Ich ignoriere ihr Lächeln, das heute sogar noch etwas gezwungener als sonst wirkt. Ich brumme ein tiefes „Morgen“, gehe an ihr vorbei und öffne die Tür zu meinem Reich.
Der Raum, wo ich die meiste Zeit meines Tages verbringe, ist groß und hell. Die Einrichtung ist auf ein Minimum beschränkt, doch ich erkenne regelmäßig in den Augen der Leute, die hier reinkommen, wie eindrucksvoll mein riesiger schwarzer Schreibtisch auf sie wirkt. Dahinter throne ich auf meinem großen Ledersessel und überblicke das Areal unserer Firma mit all seinen Gebäuden; dem Forschungstrakt, der Verwaltung, der Fertigung. Vor der Glasfront steht eine l-förmige rote Ledercouch, davor ein Glastisch. An der Wand hinter meinem Schreibtisch hängen meine Auszeichnungen und eine Aufnahme des Firmengebäudes aus der Vogelperspektive.
Rechts neben meinem Schreibtisch führt eine Tür zum Arbeitsraum meiner Assistentin Sara, die immer und jederzeit für mich erreichbar sein muss. Sie ist die, ich muss überlegen, siebte Assistentin, seit ich hier bin. Mein Verschleiß an Angestellten bietet guten Nährboden für so ziemlich jeden Tratsch und jede noch so gewagte Vermutung. Doch mir ist das völlig gleich, und ich tue so, als würde ich von den Lästereien und Verschwörungstheorien nichts mitbekommen.
Sollen sie ihren Spaß haben, solange sie da sind.
Grinsend nehme ich hinter meinem Schreibtisch Platz, stelle die Tasche neben dem Sessel ab und betätige den schwarzen, viereckigen Knopf, der mich direkt mit Sara verbindet. Ich könnte durch das Ding zwar mit ihr sprechen, habe es aber noch nie getan, sondern ordere sie lieber direkt durch einen Knopfdruck zu mir herein.
Während ich auf den Kaffee und die Tageszeitung, die sie mir dank meines Signals bringen wird, warte, lehne ich mich zurück, fahre den PC hoch und schüttele bei der Erinnerung an das seltsame Erlebnis im Supermarkt, das nur wenige Minuten zurückliegt, den Kopf.
„Was für eine dämliche Ziege“, murmele ich wohl schon zum fünften Mal laut vor mich hin, während ich mein Passwort eingebe.
Ich öffne das Mail-Programm und blicke ungeduldig auf meine Armbanduhr.
Wo bleibt Sara mit meinem Kaffee?
Zur Hölle, kann man sich denn auf niemanden verlassen?!
Ich schäle mich aus meinem Jackett und lege es auf meinen Schreibtisch, damit Sara es nachher wegbringen kann. Genau so läuft das jeden einzelnen Tag ab. Nur scheint heute etwas nicht zu stimmen, weshalb ich ein zweites Mal den Rufknopf betätige. Sollte Sara ihr Job heilig sein, dann sollte sie besser innerhalb der nächsten zehn Sekunden auftauchen – oder sie kann sich auf einen wahren Vulkanausbruch gefasst machen.
Während ich den Countdown beginne, trommele ich mit meinen Fingern auf die Arbeitsplatte. Als die zehn Sekunden vorbei sind, stehe ich mit einer ungeheuren Wut im Bauch auf, marschiere festen Schrittes auf die Tür zu Saras Büro zu und reiße sie mit grimmiger Miene auf.
Doch wie ich zu meiner Verwunderung entdecken muss, ist ihr Schreibtisch unbesetzt. Sie ist nicht da.
Mit einer ausholenden Geste knalle ich die Tür zu, durchquere mein Büro und baue mich vor Jennas Pult auf. „Wo ist Sara?“, frage ich, und es ist mir egal, dass sie gerade den Telefonhörer an ihr Ohr gedrückt hält.
Sie schluckt hastig, entschuldigt sich kurz beim Anrufer und legt den Hörer beiseite. Unbehaglich räuspert sie sich und bringt sich in Position.
„Sie … sie kommt nicht mehr“, erklärt sie mit rauer Stimme.
„Was soll das heißen?“, schnauze ich sie an und frage mich, ob heute internationaler Tag der Arschlöcher ist.
„Ihr …“
„Rufen Sie sie an, und sagen Sie ihr, sie soll ihren Arsch hierher bewegen“, unterbreche ich Jennas Erklärungsversuche schroff.
Jenna betrachtet mich eine gefühlte Ewigkeit, bis sie wohl genug Mut gefasst hat, ihr Kinn reckt und mich ansieht, als wäre ich der Botschafter des Teufels. „Es geht um ihre Schwangerschaft. Sie hatte Beschwerden. Momentan wird ihr schnell alles zu viel.“
Ich schnaube voller Wut und schüttele den Kopf. „Die Schwangerschaft“, erinnere ich mich selbst, weil ich diese am liebsten längst verdrängt hätte. „Solange die Geburt nicht hier stattfindet, kann sie arbeiten.“
Was für ein mieser Scheißtag. Echt.
„Ich fürchte, daraus wird nichts mehr, Mr Shaw. Sie hat vorhin eine ärztliche Bescheinigung geschickt und ist ab sofort von der Arbeit freigestellt. Ihr … Ihr Vater meinte, das ginge in Ordnung.“
„Mein Vater“, wiederhole ich erneut ihre Worte und zwinge mich, hier stehen zu bleiben, anstatt sofort ins Büro meines Dads zu stürmen und ihn zu fragen, warum zur Hölle er sich in meine Angelegenheiten einmischt.
Ich atme tief durch, fahre mir durch die Haare und blicke aus dem Fenster. „Gut. Zuerst einmal bringen Sie mir Kaffee und meine Zeitungen. Dann fragen Sie meinen Dad, welches Shampoo er jetzt verdammt noch einmal braucht, und wenn Sie das erledigt haben, Jenna, besorgen Sie mir neue Schuhe, eine Hose und eine verdammte Assistentin – und zwar dalli!“
Jenna wirkt nun zwar nur noch wie ein Häufchen Elend, nachdem ich Wort für Wort lauter geworden bin und meine Entrüstung deutlich machen will. Doch der Gefühlszustand von Jenna ist mir so was von egal.
Mit hochgezogenen Augenbrauen warte ich auf eine Bestätigung ihrerseits, die in Form eines leichten Nickens doch noch kommt.
„Na dann los“, fahre ich sie an und schnippe in ihre Richtung, um sie irgendwie aus ihrer Kaninchenstarre zu reißen.
Schnell stürmt sie in Saras Büro, während ich kopfschüttelnd in meines zurückgehe.
Ich kann nur hoffen, dass Jenna entweder Sara zurückbringt oder mir eine neue brauchbare Assistentin besorgt. Vor allem hoffe ich für die Leute um mich herum, dass sie ihren Auftrag ordentlich erfüllen wird, weil meine Laune ansonsten ihren wohl absoluten Tiefpunkt erreichen wird. Und das möchte sicher niemand miterleben.
ZWEI
Lauren
„Die Idee ist doch die, dass man die Ware zu den Menschen bringt. Ganz nach dem Motto: Ich habe etwas zu verkaufen, sieh es dir in Ruhe in deinen eigenen vier Wänden an und entscheide, ob du es nicht vielleicht gleich behalten willst.“
Angie versucht mich nun bereits seit einer knappen halben Stunde – also der Zeit, die ich vom Aufstehen bis zu meiner letzten Etappe im Bad gebraucht habe – von ihrem neuesten Geschäftsmodell zu überzeugen.
„Das gibt es doch schon zuhauf“, schmettere ich ihre Idee mit dieser simplen Bemerkung ab, während ich meine Haare, die ich gestern Abend noch extra nachgefärbt habe, mit den Fingern in die richtige Position zu bringen versuche. „Sind sie nicht viel zu dunkel geworden?“
Ich bin etwas unsicher und drehe den Kopf zur Seite, während ich auf Angies Antwort warte.
Ich wollte Schokobraun haben, doch nun erstrahlen meine Haare eher in einem dunklen Braun. Wahrscheinlich muss ich mich erst noch an diese Farbe gewöhnen.
„Ich finde, die Farbe steht dir“, meint meine gute Freundin, mit der ich seit einem Jahr gemeinsam in einer Wohnung lebe, und rutscht unruhig auf der Kante der Badewanne, auf der sie schon die ganze Zeit lang sitzt, hin und her. „Du siehst sexy aus.“
Ich stimme zwar in ihr Grinsen ein, doch frage ich mich insgeheim, ob ich an meinem ersten Tag im neuen Job tatsächlich ein solch eindeutiges Statement abgeben sollte. „Also doch ein anderes Kleid“, überlege ich laut und blicke an mir hinab.
„Wieso?“, will Angie wissen und runzelt die Stirn.
„Ich weiß auch nicht.“
„Lauren, du machst das schon. Du bist für den Job ohnehin überqualifiziert; das packst du mit links – ganz egal, welches Kleid du trägst oder welche Farbe deine Haare haben. Ich verstehe sowieso immer noch nicht, wieso du nach deinem Studienabschluss nun einen Job annimmst, den jeder Idiot machen könnte.“ Kopfschüttelnd schnappt sie sich die weiße Ikea-Schüssel, in der sich Schokopops und ein halber Liter Milch befinden. Genüsslich löffelt sie ihr Frühstück, wie sie es nennt.
Nein, Angie versteht wirklich nicht, wieso ich den Job, für den ich mich vor über zwei Monaten bewarb, nun angenommen habe. Sie mag in gewisser Weise recht haben, ich bin höchstwahrscheinlich überqualifiziert. Immerhin habe ich acht Semester emsig studiert, ein Jahr im Ausland gearbeitet und mir den Arsch aufgerissen, um einen einwandfreien Abschluss zu erlangen. Doch wenn ich eines gelernt habe, dann das: dass man trotz aller Errungenschaften anfangs immer ganz unten in der Hierarchie steht. Gut, ich hatte die Chance, die Leitung eines winzigen Labors in Limehouse zu übernehmen. Und mit winzig meine ich die Art von klein, die bedeutet, dass vier Menschen plus ihr Equipment bestehend aus Computern, Schreibtischen und ihrer Forschungsausrüstung in einem sechzehn Quadratmeter großen Hinterhofzimmer ohne Klimaanlange Platz finden müssen. Alleine der Gedanke daran löst jetzt noch klaustrophobische Zustände bei mir aus. Außerdem habe ich kein Interesse an der Erforschung von Industriekleber. Damit war diese Stelle für mich gestorben, und ich begann mich zu fragen, was zum Teufel ich nun machen sollte.
Denn ja, ich war der Auffassung – wie so ziemlich jeder, der jemals studiert hat –, dass einem nach dem Abschluss fast jede Tür einer tollen Firma offen stehen würde. Doch ich war weder die Tochter von Richard Branson, noch hat irgendjemand ausgerechnet auf mich gewartet. Ohne Empfehlung läuft in der Berufswelt so gut wie gar nichts. Und wohl anders als viele meiner Studienkollegen habe ich ein großes Ziel: Ich möchte beruflich hoch hinaus. Ich will nicht bloß die Leitung eines Schuhschachtellabors übernehmen, sondern dorthin, wo es große Herausforderungen und dazu Erfolg und Ruhm gibt. Und um das Ziel zu erreichen, muss ich von denen lernen, die es bereits geschafft haben. Denn sie haben genauso von unten begonnen. Also lautete mein Plan, mich bei den Riesen der Branche zu bewerben – möglichst nahe an den Rädelsführern, um so viele Erfahrungen wie möglich sammeln zu können.
Ich bewarb mich für eine Stelle als Assistentin bei exakt fünf Konzernen – und erst gestern bekam ich eine Zusage von SMP. Um ehrlich zu sein, war SMP von Anfang an meine Nummer eins. Ich kann mich mit der Philosophie dieses Unternehmens gut identifizieren. Ich finde es toll, was sie in den vergangenen Jahren bezüglich Transparenz in der Forschung als auch hinsichtlich so mancher Feldstudien verändert haben. In Zeiten, in denen die Menschen wissen wollen, wie gewisse Inhaltsstoffe wirken, und vor allem, wo und wie sie nicht schlecht wirken, ist es unabdingbar, den Patienten die Informationen zu bieten. Und das mag ich.
Außerdem finde ich die Firmengeschichte spannend. Michael Shaw, der Gründer, hatte einst eine Idee und gab alles dafür, seine Träume in die Wirklichkeit umzusetzen. Innerhalb von dreißig Jahren hat sich dieser kleine Betrieb, der SMP früher einmal war, zu einem Megakonzern entwickelt, geschickt abgewickelt durch Fusionen, Forschung und Erweiterung der Produktpalette. Michael Shaw gilt als Meister seines Fachs. Im Laufe der nächsten Jahre wird wohl, laut Homepage, sein Sohn seinen Platz einnehmen. Dieser Sohn ist für mich vielleicht sogar noch viel interessanter, weil er ungefähr in meinem Alter ist und es dennoch geschafft hat, seinen Platz im Unternehmen seines Dads zu finden. Er hat wohl nicht nur seinen Platz gefunden, wie ich glaube, sondern vermutlich auch neue Ideen eingebracht, um seine Position zu stärken. Er war maßgeblich an der letzten Erweiterung von SMP beteiligt und hat einiges dafür getan, den Sektor Healthcare zu vergrößern.
Und genau für diesen Mann werde ich ab heute arbeiten. Ich bin ziemlich aufgeregt deshalb.
Dank dieser Einstellung habe ich nun die Möglichkeit, Finley Shaw genau auf die Finger zu schauen. Ich darf vielleicht dabei sein, wenn er eine Idee um die andere umsetzt. Und das ist es doch, was ich wollte.
„Ich muss los“, verkünde ich, nachdem ich etwas Lipgloss aufgetragen habe. Gerade so viel, um frisch, aber nicht zu überladen zu wirken.
„Melde dich in der Pause mal. Ich will hören, wie es dir geht“, fordert Angie und folgt mir bis zur Wohnungstür.
Ich schlüpfe in meine Schuhe und bete, dass ich passend gekleidet bin. Ich bin zwar wirklich kein graues Mäuschen, doch in meinem Alltagsleben gab es bisher nur einen Dresscode: legere und gemütliche Kleidung. Ich habe mir für meinen neuen Job sogar ein paar neue Kleider gekauft, inklusive Schuhe. Der erste Eindruck ist ja ausschlaggebend. Natürlich habe ich aber nicht vor, ab nächster Woche in Jogginghosen im Büro anzutanzen.
„Mach’s gut“, verabschiede ich mich von meiner Freundin und winke, als ich aus der Tür gehe.
Um Zeit, aber vor allem Nerven zu sparen, verzichte ich auf den Fußweg und fahre mit dem Zug von meiner Wohnung in Chelsea zu SMP nach Brentfort. Ich habe Glück und ergattere einen Sitzplatz – meine Füße werden es mir noch danken.
Eine gute halbe Stunde später stehe ich vor dem Firmengebäude von SMP. Ein dunkelgrauer Glasbau mit einem erhabenen Mittelteil und kleinen, niedrigeren Ausläufern zu jeder Seite empfängt mich, als ich die Straßenseite quere und den Schranken, der den Eingang markiert, passiere. Ich bin gezwungen, mich in der Eingangshalle nach dem richtigen Stockwerk zu erkundigen. Die Dame, die ich frage, ist sehr freundlich, worüber ich sehr erleichtert bin. Mit dem Lift fahre ich nach oben in den vierzehnten Stock. Während unten noch relativ geschäftiges Treiben herrschte, ist es hier oben vergleichsweise sehr ruhig. Meine Schritte hallen viel zu laut, als ich aus dem Lift steige und zielsicher das nächste Empfangspult ansteuere.
Plötzlich fühlen sich meine Hände klamm an, und ich kann meinen Puls regelrecht in meinem Hals schlagen spüren. Jetzt weiß ich auch, wieso es besser war, heute nichts zu frühstücken.
Die Frau, die nun zu mir hochblickt, lächelt mich an und steht auf. „Guten Tag“, sagt sie, kommt um ihren Schreibtisch herum und streckt mir die Hand entgegen. „Lauren, richtig?“
„Ja, das stimmt. Guten Tag“, erwidere ich und habe das Gefühl, dass meine Stimme sich schrill und krächzend anhört.
„Ich bin Jenna“, stellt sie sich vor, und schon jetzt mag ich ihr nettes Lächeln. „Sind Sie mit dem Auto hier?“
„Nein, ich bin mit dem Zug gefahren“, erkläre ich.
„Okay, dann bekommen Sie eine Monatskarte von mir. Sie müssen mich nur erinnern, Ihnen jeden Monat eine zu geben.“
„Wow, das ist toll“, erwidere ich und habe mit einem solchen Service überhaupt nicht gerechnet.
Jenna nickt, schnappt sich eine Mappe und deutet mit dem Kinn auf eine Tür hinter sich. „Egal, ob sie mit dem Auto, dem Bus oder dem Zug kommen, Mr Shaw übernimmt die Kosten. Das hat man wohl nicht überall. Folgen Sie mir, dann zeige ich Ihnen Ihr neues Reich.“
Mein eigenes Reich stellt sich als respektables Büro heraus. Die Fensterfront hinter meinem Schreibtisch macht es hell und freundlich. Ich kann noch gar nicht richtig glauben, dass ich von nun an hier arbeiten werde. Das ist einfach nur fantastisch.
Während Jenna mir das Schlüsselsystem erklärt, streiche ich mit einer Hand über den Schreibtisch.
„Mr Shaw kommt gegen acht ins Büro; da sollten Sie auf alle Fälle immer schon da sein“, sagt sie eindringlich, und ihre Stimme klingt plötzlich anders – irgendwie abfälliger als noch gerade eben. „Diese Tür führt in sein Büro, aber Sie dürfen es auf gar keinen Fall einfach so betreten. Er drückt, wenn er etwas von Ihnen braucht, einen Knopf, woraufhin dieses Licht hier blinkt.“ Mit ihrem Zeigefinger tippt sie auf ein rotes Lämpchen neben dem Monitor. „Dann erst gehen Sie rein. Morgens will er immer eine Auswahl an verschiedenen Tageszeitungen auf seinem Tisch liegen haben. Dazu eine Tasse Kaffee – schwarz, ohne Zucker.“
„Okay“, meine ich und kann mir ein Seufzen nicht verkneifen. Bis dato war mir nicht bewusst, wie schwerwiegend die Bedeutung von Kaffee sein kann. „Er ist noch nicht da, oder?“
„Nein. Er wird aber gleich kommen.“ Wieder klingt Jenna, als wäre Finley Shaw ein menschenfressendes Monster.
Ich fange mich zu fragen an, wie schlimm er wirklich sein kann.
„Sie sind taff“, sagt sie, lässt es aber wie eine Frage klingen.
„Ich denke schon“, erwidere ich achselzuckend.
„Das können Sie hier gut gebrauchen. Und einen Tipp noch: Mr Shaw ist an Ihrer Meinung, Ihren Wünschen und Bedürfnissen nicht interessiert. Wenn Sie den Job länger behalten wollen, dann würde ich an Ihrer Stelle den Kontakt mit ihm auf ein Minimum beschränken, die Arbeit anstandslos erledigen und den Mund halten.“
Hilfe. „Das klingt ja … schräg.“
Jenna gibt einen belustigten Ton von sich. „Wenn Sie mich brauchen – ich bin da draußen.“
„Danke“, murmele ich nun gänzlich verunsichert und nehme zögerlich Platz.
Vor Kurzem war ich noch so euphorisch, und nun habe ich keine Ahnung mehr, welche Person ich in Kürze antreffen werde.
Bevor Mr Shaw kommt, nutze ich die Zeit noch, die Liste mit all meinen Aufgaben, die Jenna mir hingelegt hat, durchzugehen. Mein gesamter Tagesablauf ist zeitlich strikt geplant. Vom morgendlichen Kaffee bis hin zum Verlassen meines Büros. Mr Shaw scheint so gut wie jede Aufgabe, die in seinem Leben anfällt, auf mich als seine Assistentin abzuwälzen. Ich bin sozusagen für den reibungslosen Ablauf seines gesamten Alltags verantwortlich.
Meine Hoffnung war, in beruflicher Hinsicht von ihm lernen zu können, doch nun fühle ich mich, als hätte ich die Aufgaben seiner Nanny zu erfüllen. Bildlich sehe ich mich schon neben seiner Badewanne hocken und ihn mit einem Waschlappen mit aufgedrucktem Spongebob den Rücken schrubben. Danach müssen noch fleißig die Zähne geputzt werden, und schon ist es Zeit, den kleinen Finley in sein Bettchen zu bringen.
Mal sehen, wie der Typ in Wirklichkeit drauf ist. Vielleicht übertreibt Jenna nur. Immerhin kenne ich sie erst seit ein paar Minuten.
Ich fahre den PC hoch, suche in der Liste nach meinem Passwort und bin erstaunt, mein eigenes, komplett eingerichtetes Benutzerkonto vor mir zu sehen. Ich habe sogar schon einen Mail-Account mit einer Mail darin.
„Willkommen bei SMP“, lese ich leise. Eine Willkommensmail von Michael Shaw – wie nett. Darin schreibt er, er sei froh, mich im Kreise seiner Angestellten begrüßen zu dürfen. Das klingt so gar nicht nach dem, was Jenna vorhin anklingen ließ.
Mein Blick gleitet zur Uhr – es ist drei Minuten vor acht. Wenn Finley Shaw ein pünktlicher Typ ist, sollte er in drei Minuten hier auftauchen. Mein Puls beschleunigt sich erneut ein wenig, während ich nach der ersten Tageszeitung greife und den Wissenschafts- sowie den Börsenteil mit Post-its markiere. Ganz so, wie Mr Shaw es laut meinem Aufgabenkatalog wünscht. Danach mache ich Kaffee – die Kaffeemaschine finde ich auf einem Sideboard neben meinem Schreibtisch. Um exakt zwei Minuten nach acht blinkt das rote Lämpchen neben meinem Monitor.
Ich atme tief durch, klemme mir den Stapel Zeitungen unter einen Arm und greife nach der Tasse Kaffee. Ein Kreuzzeichen erscheint mir übertrieben, doch zumindest wende ich mich kurz an jenen da oben, den ich zeit meines Lebens zwar nie wirklich beachtet habe, dessen moralische Unterstützung ich nun aber gut gebrauchen könnte.
Mr Shaws Büro ist erwartungsgemäß um einiges größer als meines. Wenn ich mich nicht irre, ist dieser Raum wohl genauso groß wie meine Wohnung. Doch ich versuche mich auf den Mann, der augenblicklich mit dem Rücken zu mir sitzt, zu konzentrieren. Er trägt einen dunkelgrauen Anzug, der das dunkle Braun seiner Haare auf erstaunliche Weise untermalt. Er blickt auf seinen Monitor und trommelt mit der linken Hand auf seine Schreibtischplatte.
Ich umrunde seinen Schreibtisch, stelle die Tasse neben seiner rechten Hand ab, weil ich hoffe, dass er Rechtshänder ist, und platziere den Stoß Zeitungen daneben. Shaw blickt keinen Moment auf, noch sagt er irgendetwas zu mir. Es ist tatsächlich so, als würde ich nicht existieren. Erst als ich die Tasse ein letztes Mal geraderücke und nicht wirklich weiß, ob ich nun gehen oder bleiben soll, sehe ich ihm ins Gesicht und … erstarre augenblicklich.
Gott, nein!
Während er etwas in seinen Computer tippt, sagt er mit abweisend-genervter Stimme. „Sie werden nicht dafür bezahlt, um hier dumm herumzustehen, sondern um zu arbeiten.“
Mein Blut sackt von meinem Kopf in meine Beine, und tatsächlich habe ich einen Augenblick lang das Gefühl, demnächst umzufallen. Doch ich versuche standhaft zu bleiben – in jeder Hinsicht. Ich nehme meinen gesamten Mut zusammen und höre mich kleinlaut sagen: „Ich bin Lauren. Ihre neue Assistentin.“
Seine linke Augenbraue wandert nach oben, doch anders als erwartet sieht er mich immer noch nicht an.
Weitere qualvolle Sekunden verstreichen, bis er zum ersten Mal ganz langsam von meinen Füßen aufwärts zu meinem Gesicht blickt. Seine Miene verrät keinerlei Emotionen, was mich nur noch nervöser macht.
„Lauren“, wiederholt er, als sei mein Name ein Synonym für eine höchst ansteckende Krankheit. „Hören Sie: Es ist mir egal, ob Sie Lauren, Paula oder Henrietta heißen, solange Sie Ihren Job erledigen.“ Er blickt zu seiner Kaffeetasse und ergreift sie. „Wann haben Sie den Kaffee gemacht?“
„Ahm … gerade vorhin“, antworte ich und versuche mich nicht weiter von seiner Masche einschüchtern zu lassen.
„Ein dehnbarer Begriff.“
„Vor fünf Minuten“, präzisiere ich meine Aussage.
Sein Blick gleitet von meinem Gesicht verächtlich zu der Tasse zurück. „Wissen Sie, was guten Kaffee ausmacht?“
Ich schüttele den Kopf und bin gespannt, was er mir über Kaffee zu sagen hat.
„Die Temperatur“, erklärt er. „Und der hier – den können Sie mitnehmen. Bringen Sie mir einen neuen.“
Wäre er nicht mein Boss, der, wie sich gerade zum zweiten Mal herausgestellt hat, ein riesengroßes Arschloch ist, würde ich irgendeine schlagfertige Bemerkung vom Stapel lassen. Unter den gegebenen Umständen jedoch greife ich nach der Tasse, gehe zurück in mein Büro und mache ihm erneut Kaffee.
Während ich zusehe, wie die dampfende braune Flüssigkeit in die Tasse läuft, versuche ich mich zu beruhigen. Nicht nur, dass Finley Shaw ein Ekelpaket ist, er ist auch noch der Kerl, dessen Schuhe ich gestern unabsichtlich mit Shampoo überzogen habe. Der Mann, den ich vor dem Angestellten des Supermarkts als eigentlichen Übeltäter und Pöbler denunziert habe.
Gott, ich bin am Arsch.
Ich kann nur hoffen, dass er sich nicht mehr an mich erinnert. Zumindest aber scheint das der Fall zu sein, weil er nicht so gewirkt hat.
Zurück in seinem Büro stelle ich die Tasse erneut neben ihm ab und warte gespannt.
„Besser“, sagt er, und vermutlich ist das die allerhöchste Wertschätzung, die ich je von ihm erwarten kann. Shaws imaginärer Ritterschlag. „Jetzt verraten Sie mir mal, wie Sie diesen ungeordneten Haufen da finden!“
Mit seinem Kinn deutet er auf den Zeitungsstapel. Ich fasse es einfach nicht, dass er sogar daran etwas auszusetzen hat.
„Ich will die Zeitungen geordnet haben. Aufgereiht und griffbereit. So schwer kann das doch nicht sein. Oder?“
In mir drin meldet sich eine drängende Stimme zu Wort, die Missfallen daran anmeldet, so mit sich umspringen zu lassen. Doch es hilft nichts. Die Wahrheit ist, dass Finley Shaw mit mir machen kann, was er möchte, solange ich hier arbeite. Er sitzt am längeren Hebel, und eine neue Assistentin ist schnell gefunden.
Wie verdammt frustrierend.
„Ich werde mich künftig mehr bemühen“, versichere ich ihm und muss mich beherrschen, ihm den Stapel Zeitungen nicht über die Rübe zu ziehen.
Auf seinem Gesicht breitet sich etwas aus, das wohl ein Grinsen darstellen soll. Doch selbst dieser Ausdruck wirkt völlig hämisch und so was von selbstverliebt, dass ich nicht anders kann, als innerlich Giftpfeile auf ihn zu schießen. Doch weil sich diese Miene langsam verabschiedet und eindeutig einer enormen Ungeduld weicht, mache ich mich ans Werk und bringe Ordnung in die Auswahl an Zeitungen.
Shaw beschäftigt sich währenddessen wieder mit seinem PC. Aus den Augenwinkeln betrachte ich ihn verstohlen. Er sieht genauso wie die Kerle aus den Zeitschriften, die Angie liest, aus. Einer dieser Anzugträger in einem hypermodernen Büro, mit einer Rolex am Handgelenk, Designerschuhen und dieser Leck-mich-am-Arsch-Haltung. Bilder von Typen wie Finley Shaw hängen an unserem Kühlschrank, und Angie und ich geben ihnen immer Namen.
Denn er hat wohl so ziemlich alles, was ein Mann braucht – mal abgesehen davon, dass ich nichts über die Größe seines Penis sagen kann. Doch wahrscheinlich – bei seinem Glück – ist selbst der überdurchschnittlich lang und prall. Und vermutlich weiß Finley Arschgeige Shaw auch gut damit umzugehen. Bis heute hätte ich nicht für möglich gehalten, dass es diese Art von Männer tatsächlich gibt: erfolgreiche, gut aussehende Arschlöcher, die grässlich egoistisch, selbstverliebt und überheblich sind.
Doch ich habe mich wohl getäuscht – in vielerlei Hinsicht.
„Abraham Beachan erwartet meine Antwort auf eines seiner Angebote“, meint Shaw nun in diesem unterkühlten Ton, während er ein bedrucktes Blatt Papier vor mich hinlegt. „Ich brauche drei Kopien; eine davon geben Sie meinem Vater, die anderen beiden mir. Außerdem möchte ich, dass Sie einen Termin mit Mr Hoff vereinbaren – irgendwann die Woche mal soll er herkommen. Sagen Sie ihm, es gibt wichtige Neuigkeiten.“
Ich strenge mich an, mir die Namen zu merken, und frage mich, wie Shaw reagieren würde, wenn ich sie vergesse oder irgendeinen weiteren Fehler mache. Seine Toleranzgrenze scheint ohnehin nicht zu existieren, und das bisschen habe ich bereits nach nur zehn Minuten verbraucht.
Während ich eilig nicke und dann sein Büro verlasse, frage ich mich, ob ich tatsächlich so ein Trottel bin oder Shaw es darauf anlegt, mir dieses Gefühl zu vermitteln.
Nachdem ich wenig später die Kopien angefertigt und eine davon an Michael Shaw, besser gesagt: an dessen Assistentin, weitergegeben habe, mache ich mich auf die Suche nach einer Mail-Adresse oder einer Nummer von Mr Hoff. Ich gehe das Telefonverzeichnis des Büros durch, finde dort aber keinen Mr Hoff. Meine Verzweiflung steigert sich, als ich jedes verfügbare Adressbuch, das ich in meinem Computer finde, öffne, aber die Suche ergebnislos bleibt. Ein Vorname wäre hilfreich, ebenso wäre es großartig zu wissen, was dieser Mr Hoff macht. Ist er ein Angestellter? Ein Partner?
Meine letzte Hoffnung besteht darin, bei Jenna nachzufragen. Doch gerade, als ich aufstehen und zu ihr gehen möchte, fängt das Lämpchen neben dem Computer zu blinken an.
Verdammt.
Mit akuter Kurzatmigkeit betrete ich erneut Finley Shaws Büro. Sein Schreibtisch ist nun voll geräumt mit irgendwelchen Papieren und Notizen.
Ich bleibe in sicherem Abstand zu ihm stehen, bis er zu mir aufsieht und genervt die Stirn runzelt. Vorsichtig nähere ich mich und hoffe, er bemerkt nichts von der Abneigung, die ich innerhalb der letzten Stunde gegen ihn entwickelt habe.
„Räumen Sie die Zeitungen weg; sie liegen mir im Weg“, fordert er, und natürlich bringt er dabei das Wort „Bitte“ nicht über die Lippen.
Arschloch!
Normalerweise bin ich ein Mensch, der bereit ist, für sein Recht zu kämpfen, ich bin durchaus konfliktfreudig. Doch nicht nur, dass ich in Shaws Fall eindeutig den Kürzeren ziehen würde; ich bin mir auch sicher, Finley Shaw ist von jener Sorte, die nicht fähig ist, auf andere einzugehen oder Fehler zuzugeben. Ein verwöhnter Schnösel, der in einem Riesenbüro sitzt und sich wie der Herrscher der Welt fühlt. Doch mir ist auch klar, wie gut Shaws Ruf in der Branche ist. Wie innovativ und erfolgreich seine Projekte sind. Und deswegen wollte ich ja eben auch hierher.
Und sollte ich nun etwas Unüberlegtes machen, zum Beispiel den Stapel Zeitungen nehmen und Shaw damit die Nase brechen, würde es mich wohl nachhaltig aus der Berufswelt verbannen. Mein Zeugnis würde schlecht ausfallen; von der Klage, die mir drohen würde, mal abgesehen.
Da erscheint es mir hinsichtlich meiner Karriere verlockender, meine Seele an Shaw zu verkaufen – vorübergehend zumindest.
Deshalb stapele ich die Zeitungen wieder ordentlich und frage mich, ob Shaw überhaupt eine davon gelesen hat. Zumindest sehen sie unbenutzt aus. Doch ich presse die Lippen zusammen und grinse freundlich. „Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, Mr Shaw?“
Sein Blick wandert skeptisch von meinem Gesicht zu meinen Händen, die sich krampfhaft um den Stoß Zeitungen legen. „Danke“, erwidert er, und das klingt für seine Verhältnisse beinahe freundlich.
Geht doch, denke ich mir, während ich dabei bin, aus seinem Büro zu stöckeln. Doch kurz bevor ich bei der Tür zu meinem Büro – dem sichersten Ort in diesem Stockwerk – ankomme, zwingt mich Shaws Frage in meinem Rücken dazu, stehen zu bleiben.
„Haben Sie Hoff schon erreicht?“
Ich atme tief ein und überlege, während ich mich umdrehe, ob ich lügen oder die Wahrheit sagen soll. „Noch nicht“, antworte ich ehrlich.
Mal sehen, ob ich meine Ehrlichkeit gleich bereue.
Shaw runzelt die Stirn und rückt in seinem Sessel herum. „Wieso?“
Sein Blick gleitet zu seiner Uhr, dann zurück zu mir.
„Ich … ich konnte seine Adresse oder Nummer noch nirgendwo finden.“
Ein stetes Ticken erfüllt meine Ohren, und ich frage mich, ob es möglich ist, Shaws Uhr bis zu mir zu hören – eher unwahrscheinlich. Oder vielleicht falle ich auch nur gleich um, weil er nichts sagt, sondern mit dem Bleistift in seiner Hand immer wieder auf die Tischplatte klopft.
„Sie wollen mir also erklären, dass Sie innerhalb der letzten halben Stunde exakt drei Kopien gemacht haben – und sonst nichts?“
Autsch.
Ich könnte ihm noch weismachen, dass ich ihn innerlich verflucht und meine gesamte Existenz infrage gestellt habe. Doch vermutlich wäre er darüber auch nicht erfreuter, deswegen halte ich den Mund.
Shaw dreht seinen Schreibtischsessel so, dass er mir praktisch gegenübersitzt. Mir wird bewusst, wie lang seine Beine sind und wie perfekt proportioniert sein Körper aussieht. Beim Blick auf seine schwarzen, polierten Schuhe überrollt mich eine Welle der Übelkeit. Gut möglich, dass mein erstes Gehalt für genau solche Schuhe draufgehen wird.
„Ich habe die Datenbank nach seiner Adresse durchsucht, konnte nichts finden und wollte mich gerade an Jenna wenden, u…“
„An Jenna“, wiederholt er. „Wissen Sie, Lauren, dass Sie diesen Job bekommen haben? Sie werden dafür bezahlt, die Dinge, die ich Ihnen sage, zu erledigen. Würde diese Aufgabe Jenna übernehmen, dann bräuchte ich Sie doch gar nicht hier. Sie könnten wieder gehen. Möchten Sie das?“
Jegliche Farbe weicht aus meinem Gesicht; zumindest fühlt es sich so an. „Nein, das möchte ich nicht“, stammele ich, recke jedoch das Kinn. „Es ist mein erster Tag.“
„Das ist mir so was von egal, das können Sie mir glauben.“
Eine Weile sehen wir uns gegenseitig stumm an. Shaw denkt wohl, ich würde unter seinen Blicken einknicken oder gleich um Gnade winseln. Doch ich bin stark. Ich bin eine starke Frau. Ich habe mich bis heute von keinem einzigen Menschen respektlos behandeln lassen. Da meine einzigen Waffen in diesem ungleichen Kampf mein starker Wille, meine Sturheit und mein Stolz sind, gebe ich alles, um mich von Shaw nicht unterbuttern zu lassen.
„Duncan Hoff; er ist mein Anwalt. Sie finden seine Nummer im Telefonbuch unter Peter & Hoff.“
Shaw scheint zu glauben, dass er soeben eine schier selbstlose Tat vollbracht hat, mir, der dummen Neuen, zu helfen. Doch ich werde mich weder bei ihm bedanken, noch werde ich mir anmerken lassen, wie erleichtert ich jetzt bin. Vermutlich ist es doch so, dass er mich absichtlich hat auflaufen lassen. Entweder, um sich seinen Alltag zu erheitern, oder, um zu testen, wie taff ich bin.
Ziemlich erleichtert setze ich mich in meinem Büro hinter meinen Schreibtisch und erachte es als sehr großen Erfolg, als ich wenig später nicht nur Duncan Hoffs Nummer gefunden, sondern ihn auch am Telefon erreicht habe. Ich vereinbare den von Shaw gewünschten Termin mit ihm und widme mich bis zu meiner Mittagspause dem Kennenlernen meiner Pflichten. Shaw lässt mich zum Glück in Ruhe. Er schickt mir lediglich zwei Mails mit Anhängen, die ich durchsehen und für ihn ausdrucken soll. Doch auch sonst habe ich eine Menge zu tun. Ich wälze Berichte, die ich für Shaw nach Dringlichkeit und Wichtigkeit sortieren soll. Ich kontrolliere Abrechnungen, plane Geschäftsreisen, kümmere mich um Unterkünfte und den Transport. Alles Arbeiten, die ich schon zuvor gemacht habe, während verschiedener Praktika, aber auch im vergangenen halben Jahr. Die Firma, für die ich gearbeitet habe, war zwar viel kleiner, doch die Tätigkeiten gleichen einander. Der einzige Unterschied besteht darin, dass mein alter Boss nicht annähernd so herrisch und arschig war wie Finley Shaw.
Um kurz nach zwölf steckt Jenna ihren Kopf zur Tür herein und fragt mich, ob ich mit ihr zu Mittag essen möchte. Ich bin mehr als erleichtert, mit jemand Nettem sprechen zu dürfen, und folge ihr in den ersten Stock, wo ich mich inmitten einer Ansammlung von anderen Mitarbeitern, die ihr Essen auf hellgrauen Plastiktabletts zu ihren Tischen tragen, wiederfinde. Ich entscheide mich für Lasagne und eine kleine Schüssel Salat. Jenna und ich nehmen an einem kleinen Tisch Platz. Während ich einen Schluck von meiner Cola nehme, mustert sie mich.
„Wie war Ihr erster Vormittag?“, fragt sie und streicht sich eine hellbraune Strähne hinters Ohr.
Jenna wirkt auf mich, als würde sie mit Finley Shaw sehr viel besser zurechtkommen als ich, und ich frage mich, ob ich vielleicht nicht zu sensibel für diesen Job bin – oder für diesen Mann, wie ich mich genervt gedanklich korrigiere.
„Ich lebe noch; das sollte als Beschreibung meines psychischen Zustands reichen.“
Sie grinst, spießt eine Tomate auf ihre Gabel und steckt sie in den Mund. „Ich wollte es Ihnen eigentlich schon heute Morgen sagen, aber ich dachte mir, Sie würden es schon noch früh genug selbst herausfinden: Finley Shaw ist ein Arschloch.“ Sie legt den Zeigefinger an die Lippen.
Ich kann nicht anders, als prustend die Hände vor meinen Mund zu halten. Und auch Jenna lacht herzhaft. „Ja, das ist er wirklich. Aber wieso ist er das? Ich meine: Ist sein Dad auch so?“
„Sie wollen wissen, ob das familiär bedingt ist? Nein, eher nicht. Sich dermaßen aufzuspielen ist Finleys ganz persönliche Art der Arbeitsweise – oder eben sein Charakter.“
Vermutlich ist diese Tatsache für mich deshalb so unbegreiflich, weil ich zu großer Höflichkeit erzogen wurde. Meine Mum hat darauf sehr viel mehr Wert gelegt als auf Disziplin oder Selbstbestimmung. Diese Aufgabe hat mein Dad übernommen, der es verstand, mir all die Chancen, die ich im Leben haben könnte, näherzubringen.
Ich frage mich, was bei Finley Shaw schiefgelaufen sein muss, um ein solches Ekelpaket zu werden. Bestimmt wurde er von griesgrämigen Nannys großgezogen. Nebenbei stelle ich mir seine Kindheit trist und einsam vor. Ein Vater, der erst spät nach Hause kommt, eine Mutter, die sich um ihre gesellschaftlichen Aufgaben kümmert, und dazwischen ein kleiner Junge, der sich verloren und einsam fühlt.
Gott, fast bekomme ich Mitleid mit Shaw.
Aber nur fast.
Denn da ist immer noch seine boshafte Art, wie er einen ansieht und einem das Gefühl gibt, eine Made zu sein, die ihm den schmackhaften Speck rauben will.
„Dabei wird er in der Branche hochgelobt. Er versteht sein Geschäft“, überlege ich laut.
Jenna schüttelt den Kopf. „Das mag stimmen, nur hat Finley seine Finger in sehr, sehr vielen Angelegenheiten drin, mit denen sein Dad nichts zu tun haben möchte.“
„Was denn?“, frage ich neugierig und nehme noch einen Schluck Cola.
Jenny blickt sich kurz um, doch keiner nimmt großartig Notiz von uns. „Es geht um Geld. Sehr viel Geld. Außerdem hatte Finley Shaw Schwierigkeiten mit den Ergebnissen der letzten Studien zu einem Antidepressivum. Die Behörden werfen ihm vor, die Studie gefälscht zu haben, er streitet es natürlich ab, doch die Aktionäre verweigern ihm deswegen die Zahlung seines Jahresbonus. Sie wollen, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Vorher wird er kein Geld sehen.“
Ich kann mir vorstellen, um welch horrende Summe es sich bei einem Jahresbonus für einen Mann in Shaws Position handeln muss. Ebenso weiß ich, wie sehr die Konzerne die Schlupflöcher, die ihnen die Gesetze bieten, ausnutzen. Studien werden gefälscht, Leute getäuscht, und am Ende hat niemand von etwas gewusst. Sollten Shaws Aktionäre ihre Weigerung durchbringen, wird das eine Welle der Veränderung hervorrufen. So viel ist sicher.
„Das erklärt zumindest seine Laune“, murmele ich.
„Die ist niemals gravierend besser oder schlechter. Sie müssen starke Nerven beweisen, Lauren. Am Anfang wird er es Ihnen verdammt schwermachen. Vor allem jetzt, nachdem Sara einfach verschwunden ist. Sie müssen sich durchbeißen. Wenn Sie erst einmal seinen Respekt erlangt haben, dann ist er zumindest fair zu Ihnen.“
Ich frage mich, was ich tun muss, um Shaws Respekt für mich zu gewinnen. Muss ich bis zum Erdkern wandern und wieder zurück? Den Mars bereisen? Ein wildes Pferd bezwingen und auf ihm in sein Büro reiten? Doch ich bezweifele, dass er mir diesen Erfolg gönnen würde. Wahrscheinlich würde er selbst die Entdeckung des heiligen Grals mit einem grimmigen Achselzucken abtun.
„Was meinen Sie damit, dass Sara verschwunden ist?“, stelle ich stattdessen eine Frage, die interessante Informationen über meine Vorgängerin verspricht, anstatt mich mit den unendlichen Möglichkeiten meines Scheiterns zu beschäftigen.
Jenna legt jedoch bedeutungsschwanger ihre Gabel zur Seite und sieht mich starr an. „Lauren, ob Sie es glauben oder nicht: Aber ich mag diesen Job hier. Die Leute – ausgenommen Finley Shaw – sind toll. Ich habe vor fünf Jahren in der Buchhaltung angefangen, und nun sitze ich in der Chefetage. Ich werde mit Ihnen nicht über Sara sprechen, weil ich meinen Job behalten möchte. Ganz einfach.“
Ich runzele die Stirn. „Ist das Thema Sara so gefährlich, oder wie darf ich das verstehen?“
Sie seufzt. „Sie war Ihre Vorgängerin, und jetzt hat sie aufgehört. Punkt. Vergessen wir den Rest einfach. Okay?“
Vergessen kann ich das jetzt bestimmt nicht mehr. Aber ich werde Jenna zuliebe nicht weiter nachbohren. „Okay. Sie sind der einzige Mensch mit Einfühlungsvermögen da oben. Ich will es mir mit Ihnen auf keinen Fall verscherzen“, sage ich und lasse es leicht und locker klingen.
Doch vermutlich ist es wirklich so, dass Shaw schnell und einfach kurzen Prozess mit jemandem macht, der Scheiße gebaut hat.
„Keine Angst; ich bin ein Urgestein.“
Während wir aufessen, quatschen wir über Filme, Serien und Bücher. Ich verstehe mich gut mit Jenna.
Als ich wenig später zurück an meinen Arbeitsplatz gehe, fühle ich mich, als hätte ich nun Rückendeckung. Jemanden, der zu mir hält, wenn Finley Shaw wieder den großen Macker raushängen lässt.
Doch wie sich herausstellt, verläuft der Rest des Tages friedlich.
Genau genommen ignoriert mich Shaw nun und ist dazu übergangen, mir kurze Anweisungen per Mail zukommen zu lassen. Am Ende meines ersten Arbeitstages finde ich in meinem Posteingang eine Liste mit Dingen, die ich für Shaw zu erledigen habe. Allerdings fügt er in der Mail an, ich hätte dazu morgen auch noch Zeit. In der letzten Zeile findet er sogar Platz für eine kurze Verabschiedung. Ich antworte ihm schnell noch und wünsche ihm einen schönen Feierabend, ehe ich meine Handtasche, mein Handy und meine Jacke zusammenpacke und verschwinde.
Tag eins ist also überstanden.
DREI
Lauren
Es gelingt mir innerhalb der nächsten beiden Tage, eine Möglichkeit zu finden, mit Shaw in Kontakt zu treten, ohne von ihm erwürgt, beleidigt oder angeschrien zu werden. Seine Laune scheint – zumindest für seine Verhältnisse – prächtig zu sein. Ich erlaube mir keine gravierenden Fehler, und er zeigt sogar eine höfliche Seite, indem er mein „Guten Morgen“ an meinem dritten Arbeitstag erstmals erwidert.
Zwar war das „Morgen“, das von ihm kam, eher als Murmeln zu vernehmen, doch immerhin ist das besser als sein üblicher unheilvoller Blick.
Um eins erscheint Duncan Hoff, der Anwalt, zu seinem Termin mit Shaw. Kurz nachdem die Stimmen der beiden Männer gedämpft durch meine Tür ertönt sind, fängt das rote Lämpchen schon auf meinem Schreibtisch zu blinken an.
Duncan Hoff stellt sich als junger, groß gewachsener, blonder Mann mit Anzug und einem frechen Grinsen im Gesicht heraus. Keine Ahnung, weshalb, aber ich hatte ein ganz anderes Bild von ihm vor Augen. Eher in der Art Ende fünfzig, Kugelbauch, Zigarette im Mundwinkel.
„Oh, wieder mal eine Neue“, begrüßt mich Hoff. Er reicht mir nicht die Hand, als ich vor die beiden trete und auf Instruktionen warte, mustert mich jedoch mit einem Blick, den nur Männer Frauen zuwerfen können.
„Ja“, erwidert Shaw beiläufig. „Was möchtest du trinken?“
Duncan Hoff überlegt eine Sekunde, während er mich nicht aus den Augen lässt. „Eine Tasse Kaffee wäre toll.“
Die Art, wie er das sagt, und vor allem die Art, wie er mich dabei ansieht, wirken so, als wolle er diese Tasse Kaffee mit mir alleine trinken – ohne Shaw.
„Für mich auch, ja“, reißt mich Letzterer prompt aus der stummen Konversation mit Hoff.
Ich nicke und gehe kurz zurück in mein Büro, um für die beiden Kaffee vorzubereiten. Mit zwei Tassen kehre ich wenig später zurück. Die beiden Männer haben auf Shaws roter Ledercouch Platz genommen und unterhalten sich über Duncan Hoffs letzten Urlaub. Er scheint segeln gewesen zu sein. Seine Augen leuchten, als er Shaw davon erzählt, und ich frage mich, wie gut sich die beiden wirklich kennen.
Sind sie vielleicht sogar richtig miteinander befreundet? Zumindest dürften sie auch im selben Alter sein.
Nachdem ich die Tassen hingestellt habe, richte ich mich neben Shaw auf und warte Hoffs nächste Sprechpause ab. „Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, Mr Shaw?“
Shaw blickt auf, doch wie immer kann er das nicht, ohne mich vorher genau zu mustern. Während Hoffs Musterung der eines Mannes gleichkommt, dem gefällt, was er sieht, kann ich Shaws Empfinden wohl nur als abschätzig bezeichnen.
„Sie können mir die Beta-Akten bringen.
- Ende der Buchvorschau -
Impressum
Texte © Copyright by Originalausgabe 2018 C by Sophia Chase Lektorat: Dr. Antonia Barboric Jennifer Rottinger alias. Sophia Chase Bergstr. 4 4282 Pierbach [email protected] Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des vollständigen oder teilweisen Nachdrucks in jeglicher Form.
Bildmaterialien © Copyright by C by Sophia Chase Cover: Rauschgold
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN: 978-3-7394-3573-2