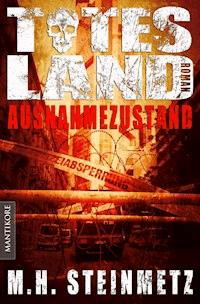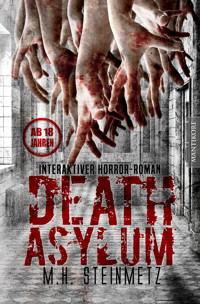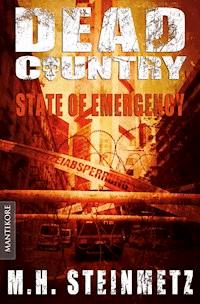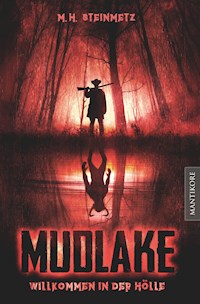
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mantikore-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie glaubten, sie hätten ihn in den Höllenschlund zurückgeschickt. Doch ein Jahrhundert später ist er wieder da. Stärker als je zuvor … Im Jahre 1876 stellen sich vier Revolverhelden einem brutalen Saloon-besitzer entgegen. Dabei stoßen sie auf ein Labyrinth, das sich wie ein böses Geschwür unter dem Provinznest Deadwood ausbreitet. Was als wilde Schießerei beginnt, endet nach einem Ritt durch die Hölle auf einer Farm, auf der sich Geschehnisse jenseits menschlicher Vorstellungskraft zutragen. Einhundert Jahre später gerät am selben Ort der Bus einer Abschlussklasse in die Fänge brutaler Dorfbewohner. Das Schicksal der Teenager entscheidet sich am Ufer des Mudlake, durch dessen schlammtriefende Oberfläche ein grauenvolles Geheimnis bricht … Brutaler Horror-Trip von Genre-Meister M.H. Steinmetz
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MUDLAKEWILLKOMMEN IN DER HÖLLE
1. Auflage
Veröffentlicht durch den
MANTIKORE-VERLAG NICOLAI BONCZYK
Frankfurt am Main 2021
www.mantikore-verlag.de
Copyright © MANTIKORE-VERLAG NICOLAI BONCZYK
Text © M. H. Steinmetz
Umschlaggestaltung: Jelena Gajic & Matthias Lück
Lektorat: Andre Piotrowski
Satz: Karl-Heinz Zapf
VP: 314-178-01-03-0421
eISBN: 978-3-96188-143-7
M. H. Steinmetz
MUDLAKE
WILLKOMMEN IN DER HÖLLE
Roman
Inhalt
1863: Prolog
1976: Road Trip
1864: Bushwhackers Raid
1976: Die Hitze der Jugend
1864: 52 Knoten
1976: Kinder des Mais
1976: Die Carlin-Brüder
1876: Welcome to Deadwood, South Dakota
1976: The White House Inn
1976: McCall’s Prairie Market and Store
1876: Eine denkwürdige Zusammenkunft im Nuttall & Man’s
1976: Ein guter Zeitpunkt, um die Suche zu beenden
1976: JD’s Tavern
1876: The Gem Varieté Theater
1976: Carlin’s Gas Station - Best in the Northern Plains
1876: Das Loch
1976: Batterien und Bier
1976: Totenvögel
1876: Verdammt will ich sein, wenn das kein guter Tag ist!
1976: Der Käfig
1976: Du weißt, was du zu tun hast
1876: Pulverdampf und Springfield Rifles
1976: Amy-Lee
1976: Dämonen des Südens
1876: Labyrinth
1976: Friss oder stirb
1976: Haben die in Iowa noch die Todesstrafe?
1876: Annabelle
1976: Nitroglyzerin
1976: Der Olymp der Zügellosigkeit
1876: Ich mach uns eine leckere Pfanne
1976: Helter Skelter
1976: Mum kocht schon seit Jahren nicht mehr
1876: Saloon Nr. 10
1976: Weil wir das hier eben so machen
1976: Monster
1876: Toter Nummer 4 - Gott sei seiner armen Seele gnädig!
1976: Wer wird überleben und was wird von ihnen übrig sein?
1976: Kloake
1876: Augen wie geschmolzener Stahl
1976: Das ist Iowa, Babys - Schweinedung und Mais, so weit das Auge reicht
1976: Er kommt
1876: Die Paullin-Farm
1976: Fünf Minuten
1976: Schwarze Wirbel
1876: Pfade, die sich kreuzen
1976: Ein uralter, vergessener Gott
1976: Entscheidungen
1876: Mudlake
1976: Verrecke!
1976: Ketten und Haken
1876: El Diabolo
1976: Verdorben bis ins Mark
1976: Eine McCall schoss nie daneben
1876: Elenor
1976: Ich will sehen
1876: Das alte Lied von Unterdrückung und Sklaverei
1976: Die Kiste
1976: Sixgun Wedding
1876: Geschmolzenes Blei
1976: Night of the Living Dead
1876: Inferno
1976: Der mopsige Behemoth!
1876: Blaues Licht
Prolog
21. August – Lawrence, Kansas
»Treibt sie aus den Häusern!« William T. Anderson, Captain der Missouri Partisan Rangers, bellte den Befehl wie ein tollwütiger Hund und trieb seinem Pferd die Sporen in die Flanken, dass es sich vor Schmerzen schreiend aufbäumte. Mit harter Hand rang er es nieder, denn es hatte nicht aufzubegehren. Sein zerzaustes, schulterlanges Haar und der volle, aber ungepflegte Bart verliehen ihm das Aussehen eines erbarmungslosen Streiters. Die graue, zerschlissene Uniform mit den gelben Abzeichen hob sein wildes, womöglich bösartiges Wesen überdeutlich hervor. Kaltblütig schoss er einem kleinen Mädchen in den Kopf, das weinend aus einem brennenden Holzhaus stürzte. Er lachte, weil ihr Schädel unter der Einwirkung der Kugel wie eine überreife Tomate zerplatzte. Puppe und Kind fielen in den Schmutz. Der sterbende Körper scharrte im Dreck, bis die Muskeln den Tod akzeptierten. »Gewährt keine Gnade, sag ich! Kein Erbarmen!«
Die Luft war erfüllt von entsetzten, ja ungläubigen Schreien wegen der hemmungslosen Gewalt, die ein böser Gott namens Krieg über sie niedergehen ließ. Vom Weinen kleiner Kinder, die sich verzweifelt an ihre toten Mütter klammerten, die von Pferdehufen zertrampelt im Straßenschlamm lagen. Dem um Gnade flehenden Winseln junger Frauen, wenn die Raider sie an den Haaren packten und ihnen die Röcke vom Leib schnitten, damit sie über sie herfallen konnten, um ihre Löcher zu stopfen.
Eine Einheit Bushwhackers, das waren unabhängig von der regulären Armee operierende Partisanen, galoppierte johlend die Main Street entlang, trieb eine Gruppe Männer wie Rinder vor sich her. Viele der stolpernden Kerle trugen die Longjohns der vergangenen Nacht, einige rannten nackt und von Striemen überzogen um ihr armseliges Leben. Die Reiter kesselten die Männer ein und metzelten sie mit Säbeln und Bullenpeitschen nieder, bis der letzte von ihnen blutend und zerstückelt im Dreck lag.
An der großen Kreuzung zwischen der Bank und dem Vergnügungshaus für zahlungskräftige Gentlemen stürmten Bushwhackers mitsamt ihren Pferden in den Saloon, um einen zaghaft aufkommenden Widerstand einiger blau gekleideter Soldaten im Keim zu ersticken. Lachend ritten sie Tische und Stuhl zu Bruch, trieben verzweifelte Männer und Frauen nach oben und dort aus den Fenstern. Wer in den Straßenmatsch stürzte, wurde von Pferden niedergetrampelt, erschossen oder erschlagen.
Pulverdampf zog wie zäher Nebel durch die Straßen. Die Reiter trieben die Einwohner von Lawrence vor dem Saloon zusammen. Beißender Qualm vermischte sich mit dem scharfen Gestank menschlicher Ausscheidungen, weil sich viele der gequälten Menschenkreaturen vor Todesangst in die Hosen oder Röcke machten.
»Es gibt nichts Berauschenderes als den Geruch des Krieges.« Captain William Clark Quantrill saß mit einem übergeschlagenen Bein auf seinem Pferd und zog genüsslich an einer glimmenden Zigarre. Der Rauch umgab sein kantiges Gesicht wie eine düstere, Unheil verkündende Wolke. »So muss man das mit diesen Yankeeschweinen machen. Es gibt nur diesen einen, zur Hölle heiligen Weg der absoluten Tilgung.«
Eine ältere Frau in einem schlammbespritzten, schwarzen Kleid trat vor ihn hin und fiel mit gefalteten Händen auf die Knie, um für die friedliebenden Einwohner von Lawrence um Gnade zu flehen. Quantrill lachte, gab seinem Pferd die Sporen und ritt sie nieder.
Anderson zügelte sein Pferd neben ihm, ließ es aufgeregt kreiseln. »Ein paar Häuser fehlen noch, dann haben wir alle beisammen!« Er lachte rau, brachte sein Pferd durch einen brutalen Ruck an den Zügeln zum Stehen, sodass es das Maul schäumend aufriss.
Quantrills Blick huschte wie der eines Falken über die apokalyptische Szenerie. Er gab einem seiner Raider einen Wink. »Dort hinten, der Fettsack im Nachthemd!«
Der Raider johlte auf, gab seinem Pferd die Sporen und galoppierte dem Fliehenden hinterher, der versuchte, eins der nahen Maisfelder zu erreichen, die Lawrence wie einen fetten Speckgürtel umgaben. Er zog seinen Säbel und spaltete dem Mann den Kopf bis zum Hals. Mit einem zweiten Hieb schlug er ihm den Schädel gänzlich ab. Der Raider sprang aus dem Sattel, zog den Kopf aus dem Dreck und schleuderte ihn lachend zwischen die Einwohner der einst blühenden Stadt, in der man sich weitab von den verhärteten Fronten des Krieges sicher gefühlt hatte.
Quantrill nickte Anderson zu, als handle es sich um die selbstverliebte Inszenierung eines verschmähten Theaterregisseurs vor einem imaginären Publikum. »Wenn du die Yankees aufhalten willst, musst du ihnen in die ungeschützte Flanke fallen … Du musst zu Satan persönlich werden, deine Männer zu Dämonen, einer fürchterlichen Geißel, der nichts heilig ist.« Er stieß eine Wolke Zigarrenrauch aus, dass sein Gesicht für einen Moment dahinter verschwand und nur der buschige Schnauzbart abstand, um sich vor dem erwachenden Tag zu verdunkeln. Seine kleinen, verkniffenen Augen krochen aus dem Dunst, sein Mund redete düstere Worte. »Werde zu Satan, sag ich, und gib dich mit keinem Geringeren zufrieden! Geh einen Pakt mit dem Bösen ein, um selbst zum Bösen zu werden, nur auf diese Weise kann es funktionieren!«
Anderson steckte seinen leer geschossenen Remington New Model Army Vorderlader weg und zog ein identisches Modell, das geladen war. Es war unmöglich, auf einem tänzelnden Pferd Pulver und Kugeln in die Kammern zu füllen und diese mit dem Ladehebel zu verpressen. »Dieser verdammte Senator James Henry Lane, wegen dem wir gekommen sind, nun, den kann keiner finden … hat sich wohl in den Mais abgesetzt. Sollen wir ’n Feuer legen, um ihn rauszutreiben, Sir?«
Quantrill schüttelte den Kopf und zeigte auf das dicht gedrängte Häuflein menschlicher Schafe. »Erst wenn wir mit denen hier fertig sind. Dazu muss ich allerdings eines von dir wissen, William.«
»Was immer Sie wollen, Sir!«
»Kannst du dir vorstellen, wie es in der Hölle zugeht?«
Anderson lachte, hob den Revolver und suchte sich ein Ziel. Er fand es in einem jungen Mann, der ihn aus der zusammengetriebenen Menge heraus anstarrte. Ein Schuldiger dessen, was in den frühen Morgenstunden über Lawrence hereingebrochen war. Einer, der nichts dagegen unternommen hatte, weil er ein Feigling war. »He du, langer Kerl!«, rief er.
Der Mann machte ein überraschtes Gesicht. Er sah sich flehend um und hoffte wohl, dass Anderson einen anderen meinte. Er senkte den Blick und nickte mit sorgenvoller Miene. Er wusste, dass seine letzte Stunde geschlagen hatte. Sein sorgfältig gestutzter Schnauzbart, das weiße Unterhemd und die feinen Hosenträger ließen auf einen Mann schließen, der eher mit Worten als mit Waffen umzugehen wusste. »Ich?«
»Ja, dich mein ich«, rief Anderson ungeduldig. »Komm hierher zu mir, Yankeeschwein!«
Der Mann tat, was Anderson wollte, sah ihn ängstlich und zugleich fragend an.
Anderson lachte. »Mein Captain hat mich gefragt, ob ich mir die Hölle vorstellen kann. Was sagst du dazu, hä?«
»Ich … ich verstehe nicht ganz. Die … Hölle?«
Anderson schoss dem Mann ins Gesicht. »Falsche Antwort, Dummkopf.« Dann, an Quantrill gewandt: »Die ganze Welt ist für mich zur Hölle geworden, seit die Yankees meine Schwester haben sterben lassen. Sie haben mir alles genommen, was ich liebte, mir die Seele aus dem Fleisch gerissen.«
Quantrill grunzte. »Ich kenne deine Geschichte, William Anderson, und ich weiß, das es ’ne beschissene Lüge ist. Du kannst überhaupt nicht lieben … Hast Pferde gestohlen, drüben in Missouri. Deinen Nachbarn in Kansas und ’nen Unschuldigen erschossen, um deinen Vater zu rächen. Die Bosheit steht dir ins Gesicht geschrieben, so sieht’s aus und nicht anders!«
Anderson wich seinem Blick nicht aus, kaute auf der Unterlippe herum. »Mein Leben ist die Hölle, Sir, das ist wahrlich nicht gelogen!«
»Dann wird es Zeit, dass du deiner Hölle ein Gesicht verpasst!« Ein aufbrausender Wind wirbelte Staub auf, der sich mit dem Pulverqualm zu einem düsteren Nebel vermischte und das Sonnenlicht über den Dächern von Lawrence fraß. Quantrill drehte sich im Sattel um, denn ihnen blieb nicht mehr viel Zeit. »Zusammentreiben und durchzählen! Ich will die Namen jedes Einzelnen dieser Schweinehunde auf einem Papier haben … Patterson, nimm dir ein paar Männer und räum die Bank aus. James, nimm dir die Geschäfte vor. Alles, was Wert hat, geht mit!«
Anderson sah auf den Leichnam ohne Gesicht hinab. Rauch stieg aus dem Loch in seinem Kopf. »Es ist so weit, Sir!«
Quantrill nickte, weil es genau das war, was er hören wollte. »Dann lass deine Hölle auf Lawrence los, Anderson. Du hast hier jetzt das Sagen!« Damit wendete er sein Pferd und preschte mit einer Handvoll Raider davon. »Wir sehen uns beim Treffpunkt in Missouri!«, rief er über die Schulter zurück, bevor ihn der pulverdampfende Nebel verschluckte.
Anderson lächelte. Er wusste, dies war sein Augenblick, und Quantrill hatte ihm diesen geschenkt. All die Wut, die sich sein Leben lang aufgestaut hatte, die ihn regelrecht dazu zwang, sich über jedes Gesetz zu erheben, zu morden und zu stehlen, wurde zu einem legitimen Mittel, um Vergeltung zu üben. Das Tor zur Hölle hatte sich aufgetan und er würde alles dafür tun, um es offen zu halten.
Um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, schoss er in die Luft. »Raiders, treibt die Frauen in die gottverdammte Kirche und vernagelt die Türen!«
Unter den etwa zweihundert zusammengetriebenen Einwohnern brach Unruhe aus. Einige besonders mutige Ehemänner wollten ihre Frauen nicht ziehen lassen, weil sie befürchteten, was zu befürchten war. Kinder klammerten sich weinend an die Beine ihrer Mütter, wurden mitgeschleift.
»Was is’n mit den Bälgern?«, wollte ein Raider wissen. Er hielt eine bluttriefende Bullenpeitsche in der Hand. Ein rauer Kerl mit faulen Zähnen, der seinen Verstand in den Wirren des Krieges verloren hatte.
»Hängt sie auf, ihr Hunde. Das soll ’n verfluchtes Mahnmal werden!«, knirschte Anderson und grinste hämisch. »Gleich hier, am Balkon des Saloons, in einer Reihe!«
Road Trip
August, irgendwo in Iowa
»The Ramones? Was is’n das für’n schräger Mist?« Jamie Peterson strich sich sein braunes, zerzaustes Haar nach hinten, riss seinen Mund auf und gähnte herzhaft, während er die Musikkassette unschlüssig in der Hand drehte. Er war müde und genervt von der langen Busfahrt, die kein Ende zu nehmen schien. Zudem schwitzte er wie ein Schwein.
»Is’ echt der Wahnsinn, ich sag’s dir! Punkrock, Mann! Hab’s im Radio aufgenommen! Brandneu, kriegst nicht in ’nem Laden hier.« Brady rutschte aufgeregt auf der durchgesessenen Sitzbank des Schulbusses umher, der sich zwischen endlos erscheinenden Maisfeldern eine Landstraße entlangquälte. Er war enttäuscht, dass Jamie die Band nicht kannte. Dass dieser sich nicht von seinem schnell und gern aufbrausenden Enthusiasmus anstecken ließ. Andererseits war es kein Wunder, wenn man ihn sich ansah, in den stets schmutzigen Jeans und dem karierten Hemd, das seine beste Zeit längst hinter sich hatte und dem der Begriff »altmodisch« geschmeichelt hätte. Brady war anders. Er trug sein Haar lang und wild, mochte T-Shirts mit V-Ausschnitt, die eng am Körper saßen, und Jeanshosen mit Schlag, wie man sie in England trug, weil das verdammt cool war. »Punkrock«, wiederholte er enttäuscht. »Der aufstrebende Protest der vergessenen Generation X!« Womöglich lag es daran, dass er achtzehn war und Jamie ein Jahr jünger.
Dämliches Landei …
»Mach mal das Fenster auf, sonst erstick ich hier noch«, maulte Jamie stattdessen und gab ihm das Tape zurück. Anscheinend merkte er, dass sein Freund angepisst war, und versuchte einzulenken. »Meinetwegen, ich hör’s mir an, wenn wir angekommen sind … dafür gibst du aber jetzt damit Ruhe, okay?«
Bradys Miene hellte sich auf. »Yeah, Mann, alles cool!« Brady fuhr sich mit den Fingern über die Lippen, mimte einen Reißverschluss. Er stellte sich auf und griff nach dem Hebel, um die Scheibe nach unten zu ziehen. Sein Kumpel hatte recht, die Luft im Bus roch in der Tat verbraucht wie abgestandener Atem. Manchmal, wenn ein Lufthauch von unten durch den Bus zog, roch es fürchterlich nach Schweiß und nassen Socken. Kein Wunder, denn die Sonne brannte nur so vom Himmel. Brady hasste den Sommer. Der August war der schlimmste Monat von allen. Dann glühte in New York, wo sie herkamen, der Asphalt und die Abgase zogen nicht mehr aus den Häuserschluchten hinaus. Aber hier auf dem Land verhielt es sich kaum besser. Hier gab es keinen Schatten, sondern nur diesen verdammten Mais.
Winzige, gelbe, alles verhöhnende Gesichter …
Er schirmte sich die Augen ab, weil ihn die tief stehende Abendsonne blendete, und ließ seinen Blick über die Maisfelder schweifen. In einiger Entfernung gab es eine Baumgruppe, dazwischen ein paar Gebäude, die marode und verlassen wirkten. Dennoch war er sich sicher, dass sich dort etwas bewegt hatte. Kaum mehr als ein huschender Schatten, der sich zwischen die windschiefen Holzbauwerke duckte, während der Bus vorüberfuhr. Er hob die Schultern, entriegelte die Scheibe und zog sie nach unten.
Krass. Wie in »The Hills Have Eyes« Jetzt ’ne Autopanne, und wir sind geliefert …
Für Brady das reinste Futter für seine ausgeprägte Fantasie. Er war ein echter Horrorfreak. Ob Filme oder Bücher, er nahm alles mit. Natürlich auch den italienischen, richtig krassen Scheiß. Die neue Generation von Filmen, in denen Blut und Gedärme nur so spitzten und es nicht ganz offensichtlich war, ob es Maske oder Snuff war. Gab ja schließlich ’ne Menge Gerüchte darüber. Einer der älteren Jungs aus dem Waisenhaus jobbte als Filmvorführer und schleuste ihn an den Wochenenden ins Kino, wenn was Entsprechendes lief. Wes Cravens »The Hills Have Eyes« hatte er letzten Sonntag gesehen. Ein Hammerfilm, der alles bisher Dagewesene übertraf.
Mutierte Freaks in den Hügeln, ahnungslose Spießer … Massaker pur!
Brady ließ sich schwer in den Sitz fallen und grinste Jamie an. Abgesehen von Punkrock-Musik gab ein weiteres Thema, das ihn brennend interessierte: Mädchen!
»Was meinst du, wer ist schärfer: die O’Hara oder die Neue, Hope?«
Jamie rieb sich die Augen. Ihm machte die Hitze arg zu schaffen. Er dachte einen Moment über Bradys Frage nach. Schwester O’Hara war ihre Lehrerin, hatte die Fahrt nach South Dakota organisiert, damit sie für den Sommer aus dem kochend heißen Moloch New York rauskamen. Er schätzte sie auf jenseits der vierzig bis knapp unter fünfzig. Ein fieses Grinsen stahl sich in sein Gesicht. »Ganz klar die O’Hara. Selbst in ’nem grauen Sack hat die ’ne rattenscharfe Figur. Außerdem«, er schnalzte mit der Zunge, »hab ich gesehen, dass sie ’ne echte Blondine ist.«
Brady musste nicht lange nachdenken, um zu wissen, was er damit meinte. »Ich dachte, Nonnen tragen diese graue Zirkuszeltunterwäsche. Alter, wir hab’n ’ne heiße Nummer als Lehrerin.« Er beugte sich verschwörerisch zu Jamie und zwinkerte ihm zu. »So wie in dem Film, den wir heimlich geschaut haben. Weißt, was ich meine.« Er kicherte. »Musst mal ’n Blick auf ihr Schwesternkleid werfen, wenn die sich bückt und sich der Stoff an ihren Körper schmiegt. Ich schwör dir, die hat nichts drunter, genau so, wie du’s sagst …«
Jamie grinste. »Yeah, ich wette, die ist …« Eine zusammengerollte Zeitschrift schlug von hinten auf seinem Kopf ein und stoppte seinen Redefluss. »Autsch …!« Jamie sprang auf und drehte sich auf der Bank um, damit er sah, wer ihn geschlagen hatte.
»Ihr seid so was von bescheuert«, kommentierte Hope sein Gespräch mit Brady. Jamie wurde feuerrot, weil ihm schlagartig bewusst war, dass sie nicht nur das mit der O’Hara mitbekommen hatte, sondern auch die Vergleichsfrage.
Gleich zu Beginn der Klassenfahrt unten durch … voll verkackt …
»Ich sollte es ihr stecken, damit sie euch die verdammten Ohren langzieht!« Sie musste alles mit angehört haben. Ihm war peinlich, dass er sich von Brady zu solchen Äußerungen hatte hinreißen lassen. Hope hatte verdammt noch mal recht, sich so aufzuregen. Jetzt galt es, Schadensbegrenzung zu betreiben, damit Hope sie nicht bei ihrer Lehrerin verpfiff. Schwester O’Hara war der Inbegriff der Unerbittlichkeit. Lachen stand bei ihr ebenso wenig auf dem Programm wie Barmherzigkeit.
Hope hatte ihn von der ersten Sekunde an fasziniert, vor allem, weil sie der Sängerin von Blondie ähnlich sah. Sie hatte glattes, weißblondes Haar, das ihr bis zum unteren Rücken reichte. Ihr knackiger Hintern und die kleinen Brüste wirkten ihrem Alter entsprechend jugendlicher als bei der Sängerin. Sie grinste die beiden Jungs keck an. »Also, wie war das denn gleich, wer schärfer ist, hm? Denkt mal genau drüber nach!«
Jamies Gesicht glühte. Er wollte im Erdboden versinken, während sich Brady auf der Bank möglichst klein machte. Hätte es einen Weg gegeben, um im Erdboden zu versinken, er hätte ihn genutzt. »Na ja, wir dachten nur …«, stammelte Jamie und rang um einen Ausweg aus der für ihn äußerst peinlichen Lage. Er sah zwar nach hinten, wo Hope mit ihren Freundinnen Cherryl und Lissy saß, war sich aber sicher, dass ihn jeder im Bus anstarrte. Er konnte ihre hämisch grinsenden Gesichter vor seinem geistigen Auge sehen, wie sie einander feixend ansahen und hinter vorgehaltener Hand tuschelten.
»Ich bezweifle, dass ihr überhaupt denken könnt«, erwiderte Hope zwinkernd und ließ sich nach hinten neben ihre Freundinnen auf die Bank fallen. Brady schielte zwischen den Sitzen hindurch. In Jamies Augen musste sie in dem Jeansmini, der geknoteten roten Bluse und den Cowboystiefeln wie eine Göttin wirken.
Sie ist ’ne verdammte Sexgöttin …
Brady beschloss, Hope sein besonderes Augenmerk zu widmen, sobald sie an ihrem Zielort in South Dakota angekommen waren. Er würde von dieser Fahrt nicht als Jungfrau zurückkehren, egal was Schwester O’Hara anstellen mochte, um ihn davon abzuhalten.
Die schwarzhaarige Lissy, die eine knallenge Schlagjeans trug, von der man denken konnte, jemand hätte sie darin eingenäht, kicherte albern. »Der sabbert doch gleich.« Sie stellte einen Fuß nach oben und spielte mit ihren rot lackierten Zehennägeln vor Jamies Gesicht herum. »Lutsch meinen Zeh, Jamie Peterson!«
Brady kniete sich jetzt ebenfalls auf die Bank, um seinem Kumpel beizustehen, der mit den Mädchen offensichtlich überfordert war. »Hey, lass Jamie in Ruhe, blöde Zicke. Spiel deine verdammten Spielchen mit ’nem anderen!«
Lissy zeigte ihm den Mittelfinger, verschränkte beleidigt die Arme und sah aus dem Fenster. »Du bist ’n Idiot!«
Die beiden anderen Mädchen kicherten. Hope strich eine Strähne aus dem Gesicht. »Lass gut sein, Brady, bist echt nicht mein Typ.«
Brady keuchte, suchte nach einer passenden Antwort, doch ihm wollte keine einfallen. Hope lähmte sein Denken, machte ihn tumb.
Cherryl, die ihren atemberaubenden Cheerleaderkörper in eins dieser Lycra-Minikleidchen zwängte, sprang in die Bresche, sah ihn mit schüchternem Augenaufschlag an und setzte einen obendrauf. »Och, is’ er jetzt traurig, der Kleine … weil er nicht mitspielen darf?« Sie schnalzte obszön mit der Zunge, um ihn zu provozieren.
Brady hasste es, wenn die Mädchen derart herablassend mit ihm redeten. Es machte ihn stinksauer. Sie hatten alle eine beschissene Kindheit hinter sich, ohne Frage. Manche von ihnen waren durch die Hölle gegangen, hatten alles verloren. Doch das St. Marys hatte sie allesamt aufgenommen, egal welche Geschichte sie ihnen auftischten oder wie daneben sie sich verhielten. Cherryl hatte kein Recht, ihn auf diese Weise fertigzumachen.
Wenn sie doch nur nicht so ein höllisch scharfes Gerät wär …
Innerlich brodelnd legte er Jamie eine Hand auf die Schulter. »Scheiß drauf, Jamie, die schafft’s nicht, dass ich mich aufrege …«
Jamies Lippen formten ein »Was soll das denn jetzt?« als stumme Frage und er ließ sich auf die Bank sinken. »Sag mal, was war’n das?«
Brady setzte sich den Kopfhörer auf und drückte auf dem klobigen Kassettenrekorder die Taste Play nach unten, bis sie laut klickte. Das Gerät hatte die Größe einer Handtasche und steckte in einer mit Löchern perforierten, braunen Kunstlederhülle. Es war schwer und unhandlich, verbrauchte außerdem eine Menge Batterien, aber das war es ihm wert. Er schob den Lautstärkeregler weit nach oben, bis die Welt im Sound von Sheena Is a Punk Rocker von den Ramones versank und er nicht mehr in dem schaukelnden, nach Schweiß stinkenden Bus saß.
Wenn wir von diesem Scheißtrip zurück sind, zieh ich los und besorge mit ’ne vernünftige Lederjacke und schwarze Jeans … Anschließend werden wir sehen, wer nur spielen will … Dann geht’s so richtig horrorfilmmäßig ab …
Als er bei Here Today, Gone Tomorrow angekommen war, stieß ihm Jamie schmerzhaft in die Rippen. Brady riss sich den Kopfhörer von den Ohren. »Mann, bist du irre?«
»Sorry, aber …« Jamie deutete nach vorne. Schwester O’Hara war aufgestanden, sah durch die Frontscheibe des Schulbusses und schien sich mit dem Fahrer zu unterhalten. Sie stand vornübergebeugt da, dass sich unter dem dünnen Stoff der sommerlichen Schwesternbekleidung ihr runder Hintern deutlich abzeichnete. Am Steuer saß der fette Mister Kindermann, der aus Louisiana kam und von allen mit seinem Vornamen Bart angesprochen werden wollte, aber in diesem lang gezogenen, bescheuerten Südstaatenslang.
Boooort …
Brady konnte die rot-verschwitzte Baseballmütze sehen, die er auf seinem footballgroßen Kopf trug, und wie sie sich nickend bewegte. Kindermann war ein geiler Bock, der den jungen Dingern hinterhergaffte, bis ihm der Sabber aus den stets feuchten Mundwinkeln tropfte. Kein Wunder, dass er sich die Finger nach dieser Fahrt geleckt hatte, denn die Hälfte der zwanzig Jugendlichen waren Mädchen.
Die fette Hand des Fahrers schaltete einen Gang runter, dann einen weiteren. Der Motor heulte protestierend und die Bremsen kreischten trocken, bis der Bus schaukelnd zum Stehen kam. Brady stand wie alle anderen auf und sah aus dem Fenster, um den Grund des ungeplanten Stopps zu erfahren. Sie befanden sich mitten im Nirgendwo auf der Landstraße, die sich wie eine schnurgerade Narbe durch die endlosen Maisfelder zog. Nichts hatte sich in den letzten Stunden an der Landschaft verändert. »Beschissene Iowa-Einöde …«
Kindermann bewegte den langen Hebel, um von seinem Sitz aus die vordere Tür zu öffnen, damit er und Schwester O’Hara aussteigen konnten. Brady fing an zu grinsen, stieß Jamie an und beugte sich dicht an das Ohr seines Freundes. »Sieh dir nur diesen geilen Hintern an. Hundertprozentig hat die nichts drunter.«
Jamie kicherte heiser, ging aber nicht auf die Bemerkung Bradys ein. »Is’n Motorradfahrer.«
Brady runzelte die Stirn. »Was?«
»Na, weswegen wir angehalten haben«, erklärte Jamie. »So’n Kerl, der mit seiner Mühle Probleme hat.«
»Ihr miesen kleinen Spacken … hab genau gehört, was ihr über unsere Lehrerin gesagt habt«, zischte ihnen Hope warnend zu, während sie an ihnen vorbeischlüpfte, um auszusteigen. »Armselige Wichser! Sollte ihr vielleicht mal stecken, was in euren kranken Birnen vorgeht.«
Jamie wurde feuerrot, obgleich er es nicht gewesen war, der das über die O’Hara gesagt hatte. Resignierend sank er auf seinen Sitzplatz zurück. »Werd nie bei der landen, solang du solchen Mist laberst …«
Brady hörte ihm nur beiläufig zu. Er dachte an etwas vollkommen anderes. An den Film The Hills Have Eyes und den Schatten, den er zwischen den verlassenen Hütten gesehen hatte. Ein geheimnisvoller Beobachter, der es vorzog, in den Schatten zu bleiben. Es passte einfach alles.
Hab doch gleich gewusst, dass die Sache spannend wird …
Bushwhackers Raid
27. September – Centralia
»Alles bereit?«
Cole Younger nickte William T. Anderson zu. »Der Bahnhofsvorsteher hat sich in die Hose geschissen, als er meinen Revolver gesehen hat. Is’ ihm braun aus den Hosenbeinen gelaufen, auf die Bodenbretter getropft. Aber er wird den Zug anhalten, so, wie er es immer tut.«
Auf der gegenüberliegenden Gleisseite der Bahnstation von Centralia lauerte Quantrill mit seinen Männern im Schatten des Mietstalls. Der Überfall auf Lawrence lag über ein Jahr zurück und vieles hatte sich verändert. Anderson folgte seinem Weg durch die Hölle, genau wie Quantrill es vorausgesagt hatte. Nachdem die Bushwhackers die zweihundertzwanzig braven Bürger von Lawrence im Namen des Krieges massakriert, verstümmelt, vergewaltigt und skalpiert hatten, meldeten sich in Andersons Kopf Stimmen zu Wort. Stimmen, die aus dem tiefsten Schlund der Hölle wisperten, dass er weitermachen sollte. Nein, dass er es musste, weil es kein Zurück mehr gab, denn dies war der nur der Anfang. Der Tropfen auf den Stein, der stetig fallen musste, um ihn auszuhöhlen. Die Stimmen forderten mehr: mehr Blut, mehr Qual, mehr Opfer. Es entstand ein Sog, der gefüttert werden wollte.
Und Anderson war bereit zu liefern. Der Krieg war ihm stets ein verlässlicher Acker gewesen, Säbel und Pistolen die passenden Werkzeuge, um ihn zu bestellen. Der Süden brachte das Argument, das er brauchte, um seine Gräueltaten zu rechtfertigen. Die Legitimation. Anderson führte inzwischen seine eigenen Reiter, die Missouri Partisan Rangers, ein wilder Haufen bärtiger, zu allem entschlossener Männer, deren Augen tief in den ausgezehrten Gesichtern lagen und leuchteten wie Mondsteine. Endlich befand er sich mit Quantrill auf Augenhöhe, obwohl dessen Rang deutlich über seinem lag. Es hatte deswegen keinen Streit zwischen den beiden Männern gegeben. Vielmehr war die Intention seines Vorgesetzten eine andere und sie kamen sich nicht mit ihren Interessen in die Quere. Während für Quantrill der Sieg der Südstaaten das höchste Ziel überhaupt zu sein schien, um nach dem Krieg in die Politik zu gehen, folgte Anderson seinen eigenen, düsteren Pfaden, die die unheimlichen Stimmen ihm diktierten.
Seine Spur zog sich wie ein mit Blut gefüllter Fluss durch Kansas und Missouri, hinterließ ausgebrannte Städte und verstümmelte Körper an seinen Ufern. Hinter vorgehaltener Hand nannte man ihn Bloody Bill Anderson. Bald galt es als schlechtes Omen, seinen Namen laut auszusprechen. Als würde man damit einen Dämon aus dem siebten Kreis der Hölle heraufbeschwören, der nach Blut und Fleisch gierte.
»Heute werden wir ein Exempel statuieren, das in die Geschichte eingehen wird«, raunte Anderson seinem Freund Cole Younger zu. »Der Zug der Northern Railroad wird nie in Macon ankommen. Niemand, der sich in dem Zug befindet, wird Macon erreichen.«
»Mir soll’s recht sein, solange genügend Yankees dabei draufgehen«, knurrte Cole und spuckte einen dicken Klumpen Kautabak in den Dreck. »Allein der Name, Northern Railroad, da könnt ich glatt kotzen …«
»Draufgehen? Zur Hölle, wir werden sie nicht nur töten, wir werden sie auseinandernehmen, bis …«
»Halt’s Maul, Frank!«, zischte Bloody Bill den Mann neben Cole Younger an. Wie sie alle trug der Reiter das Grau der Südstaaten und einen Schlapphut mit breiter Krempe. Wie bei den anderen hingen seine Perkussionsrevolver an einem Gürtel über dem Mantel, um sie jederzeit ohne viel Aufhebens ziehen zu können. Wie unter den Reitern üblich, trug er gleich mehrere der Waffen, denn im Gefecht blieb selten Zeit, diese nachzuladen. Leerschießen und wegwerfen war die Devise. Aufsammeln konnte man sie nach dem Gefecht immer noch.
»Der Zug kommt!«
Ich bin bei dir, raunte eine Stimme in Anderson Kopf. Bin es immer gewesen. In dir. Seit dem Anbeginn deiner Tage.
Nähre mich mit Blut und Seelen, und ich zeige dir deine wahre Bestimmung, die weit über die belanglosen Streitigkeiten der Menschen hinausgeht!
Anderson griff sich an die Schläfen, schwankte im Sattel und wäre womöglich sogar gestürzt, wenn Cole und Frank ihn nicht gestützt hätten. Er schlug ihre Hände weg, weil er sich die Schwäche nicht eingestehen wollte. Vor den Männern musste er stark und unerschütterlich wirken wie ein Fels. »Lasst die Finger von mir, verdammt!«
»Wohooo«, meinte Frank James und hob entschuldigend die Arme. »Spar dir deine Wut für die Yankees, Captain!«
Anderson warf ihm einen vor Hass funkelnden Blick zu. Es fiel ihm von Tag zu Tag schwerer, zwischen Freund und Feind zu unterschieden.
Verliere ich wegen all der Gräuel den Verstand?
Habe ich eine Krankheit im Kopf, einen Tumor, der auf mein Denken drückt?
Anderson schüttelte die Bedenken von sich wie ein nasser Köter den Dreck in seinem Fell. »Lassen wir die Hunde des Krieges auf sie los!«
Schwarz dampfend kündigte der stampfende Zug seine Ankunft an. Die lange Reihe von ratternden Wagen schob sich wie ein tausendfüßiges, schwarzes Insekt die Gleise entlang. Der Bahnhofsvorsteher stand wie vereinbart auf dem Bahnsteig und wedelte eifrig mit seiner roten Flagge, um dem Lokführer zu signalisieren, dass er in Centralia stoppen sollte. Kreischend schlossen sich die Bremsen des Zuges. Der Lokführer öffnete das Dampfventil, der Druck aus dem Dampfbehälter entwich mit einem Zischen. Siedend heißer, wolkiger Wasserdampf stieg auf.
Der Lokführer beugte sich aus dem Fenster und sprach mit dem Mann auf dem Bahnsteig, kaum dass die Lok zum Stehen gekommen war, was im Stampfen der Maschine allerdings unterging. Der ließ die Flagge fallen, drehte sich um, rutschte auf seinen eigenen Fäkalien aus, die sich wie ein brauner Pfad hinter ihm herzogen, und stolperte Richtung Bahnhofsgebäude davon. Der trockene Knall eines Schusses beendete seine Flucht bereits nach dem ersten Meter.
Das war Andersons Signal. Er stieß den johlenden Rebellenschrei aus und gab seinem Pferd die Sporen, das schmerzerfüllt aufschrie, nach vorne und die Böschung zum Bahnsteig hinab sprang.
Die Kriegsmaschine setzte sich in Pferdeschweiß und Pulverdampf gehüllt in Gang. Während Quantrills Männer den Lokführer und den Heizer beseitigten und jeden erschossen, der vom Zug auf den Bahnsteig sprang, nahm sich Andersons Einheit die Personenwagen von der Waldseite her vor. Sie traten die Türen ein, schossen blindlings auf jene, die in den Gängen standen, trampelten rücksichtslos über sie hinweg und trieben die panisch durcheinanderschreienden Fahrgäste durch den Zug und auf die Gleise. Dort erwartete sie bereits ein grinsender Bloody Bill Anderson, umgeben von seinen besten Schützen, die nur darauf warteten, ihre Pistolen, Säbel und Gewehre endlich einsetzen zu dürfen. Doch der ersehnte Befehl stand aus, hing in der Luft wie das Damoklesschwert am seidenen Faden.
Als Anderson sah, dass sich wie erwartet Unionssoldaten unter den Fahrgästen befanden, wandelte sich sein Grinsen zu einer hämischen Grimasse. »Trennt die Yankees vom Rest. Den anderen nehmt ab, was von Wert ist, danach macht mit ihnen, was ihr wollt!«
Der seidene Faden zwirbelte sich auf, wurde dünner. Cole Younger und Frank James übernahmen das Aussortieren der unbewaffneten Unionssoldaten. Sie trieben die teils verletzten Männer wie Vieh hinter den Zug und ließen sie sich in einer Reihe aufstellen. Da von allen Seiten Rebellen sie umgaben, blieb ihnen keine Möglichkeit zur Flucht, also hoben sie ihre Hände und ergaben sich zitternd ihrem Schicksal.
»Wo kommt ihr her, wo habt ihr gekämpft, hm?«, wollte Bloody Bill wissen. Er musste laut brüllen, um das Zischen und Stampfen der Lokomotive zu übertönen. Keiner der insgesamt dreiundzwanzig Unionssoldaten antwortete. Er ritt den ersten von ihnen, einen vollbärtigen Mann, dessen Arm in einer Verbandsschlinge steckte, kurzerhand nieder, ließ sein Pferd kreiseln und es auf seinem Oberkörper eine Parade tanzen.
Einer fasste Mut und trat, wohl in der Absicht, Schlimmeres zu vermeiden, beherzt vor. »Wir sind rechtschaffene Soldaten der Cumberland-Armee unter Generalmajor George Henry Thomas, kommen vom Atlanta-Feldzug. Die Männer fahren nach Hause zu ihren Familien, Sir, um einige Tage mit ihnen zu verbringen. Es ist nicht rechtens, sie davon abzuhalten.«
Cole hob seinen Revolver, um dem mutigen Mann eine Kugel zu verpassen. Anderson galoppierte ihm in die Schusslinie und zügelte sein Pferd dicht vor dem Gesicht des Mannes. »Glaubt ihr, ihr könnt dem Krieg einfach den Rücken kehren, hä? Glaubt ihr das ernsthaft? Dass es eine Art von Arbeit wäre, wie ein Feld zu bestellen oder ein Pferd zu beschlagen?«
»Ich weiß, wer Sie sind, Sir«, stotterte der Mann, trat von einem Bein aufs andere. Es war nicht zu übersehen, dass er Angst hatte. Trotzdem war er nach vorne getreten. Als Leutnant musste er vor seinen Männern und auch für sie geradestehen.
Bloody Bill Anderson sprang vor ihm aus dem Sattel und zog seinen langen, gebogenen Säbel. »Du tust gut daran, mich zu kennen, denn ich bin dein schlimmster Albtraum, Junge!« Die Spitze der Klinge verharrte vor dem rechten Auge des stocksteif dastehenden Mannes. »Wie ist dein Name?«, wollte Bloody Bill wissen.
»Joshua … Joshua Carr, Sir«, keuchte er in verkrampften Ton. »Aus New York, Sir.«
Bloody Bill grinste. »Bist du ein Held, Joshua Carr?«
Joshuas Kehlkopf bewegte sich hektisch auf und ab. »Nein, Sir. Nur ein … ich bin ein einfacher Lehrer. Im Frieden bringe ich Kindern Lesen, Schreiben und Rechnen bei, damit aus ihnen was werden kann.«
»Ein Lehrer, sagst du? Und die hinter dir, diese zweiundzwanzig winselnden Bastarde, sind das deine gottverdammten Schüler?«
»Ich … nun ja … es sind meine Kameraden, Sir.«
Die Klingenspitze kam dem Auge näher. »Was nun, hä? Für was kämpft ihr denn eigentlich? Die Freiheit der Nigger? Das Kapital? Lincoln? Letztendlich England?« Speichel spritzte von Bloody Bills Lippen in Joshuas Gesicht, lief in zähen Fäden hinunter. Sein ungezügelter Hass auf den Norden saß unermesslich tief.
Eine Frau schrie gellend auf der von ihnen abgekehrten Seite des Zuges. Ein trockener Knall beendete ihr Geschrei. Weitere Schüsse, auf die noch mehr Schreie folgten. Quantrill hatte mit dem Aufräumen begonnen.
»Ich … zur Hölle, ich weiß es nicht, Sir!« Tränen rannen aus Joshuas Augen. Seine Knie fingen an zu zittern. Er sabberte, aber es gelang ihm dennoch, aufrecht zu stehen.
Anderson fühlte, wie sich scharfe Krallen in sein Gehirn bohrten, um es aufzuschlitzen, damit es hineingelangen konnte. Es entzog ihm die Kontrolle, war schwarz, finster und böse. Das Wort Hölle musste der Schlüssel gewesen sein, um den Wahnsinn zu entfesseln.
Ich bin da …
»Der Lehrer und seine zweiundzwanzig Schüler der Hölle, das gefällt mir«, raunte er mit deutlich dunklerer Stimme als zuvor, aber laut genug, dass jeder es hören konnte. »Dein Blut wird auf ewig mir gehören, Joshua Carr. Deins und das deiner Brut!«
»Sir, ich …«, flehte der weinende Mann und erwartete mit geschlossenen Augen den Tod.
Bloody Bill Anderson kannte kein Erbarmen. Er ließ den zitternden Mann stehen, ging zu einem rothaarigen, strubbelköpfigen Jungen von höchstens achtzehn Jahren. Er packte ihn am Schopf, zerrte ihn vor Joshua hin, wo er dem Jungen in die Kniekehlen trat, damit er vor ihm auf dem Boden hockte. »Öffne die Augen und sieh zu, Joshua Carr, denn das ist deine erste Lektion.«
Als Joshua seine tränenverschleierten Augen öffnete, hielt Anderson den Rotschopf fest an den Haaren gepackt, stemmte ihm einen Fuß in den Nacken und schnitt ihm mit einer geübten Bewegung von einem Ohr zum anderen quer über die Stirn. Der Junge schrie gellend auf, wehrte sich verzweifelt, doch Bloody Bill drückte ihn mit dem Stiefel in den Staub. Mit aller Kraft zog er den roten Schopf nach hinten. Sein Säbel vollzog seine schneidende Arbeit wie beim Häuten eines Tieres. Der Skalp löste sich vom Kopf des Jungen, dessen erstickte Schreie dumpf und in Wölkchen aus dem Staub klangen.
Joshua Carr sah schluchzend mit an, als Bloody Bill Anderson den Rothaarigen skalpierte, wie es die Indianer taten. Das war das herbeigesehnte Zeichen. Der seidene Faden riss endgültig entzwei, das Damoklesschwert sauste nieder. Andersons Männer sprangen aus den Sätteln und nahmen sich die blau berockten Schüler der Hölle vor, wie ihr Anführer es ihnen vorgemacht hatte. Manchen, die fliehen wollten, schossen sie in die Beine oder den Rücken, aber so, dass sie nicht daran starben. Denen, die ihre Fäuste hoben, schossen sie in Arme und Schultern. Was von der anderen Seite des Zuges unter Quantrills blutiger Arbeit schon schrecklich genug klang, steigerte sich unter den Säbeln und Messern der Bushwhackers zu einem rauschenden Inferno im blutroten Kleid.
Als Bloody Bill mit seinem Handwerk fertig war, ließ er von dem sich windend-wimmernden Jungen ab, ging zu Joshua und setzte ihm die blutige Haut wie eine Kappe auf den Kopf. »Willst du, dass ich das bei dir mache?«
Joshua wurde blass, würgte seine letzte Mahlzeit hervor und erbrach sich vor Andersons Stiefel. Das Blut des Jungen lief ihm aus der warmen Haut in den Nacken und übers Gesicht. »Ne-nein, Sir.«
Bloody Bill nickte zufrieden, griff dem ehemals rothaarigen, jetzt schopflosen Jungen am blutgetränkten Kragen und zog ihn in eine sitzende Position, damit er ihm Ohren, Nase und Lippen abschneiden konnte. Der Junge zitterte wie Espenlaub, spuckte blutigen Speichel, der in zähen Fäden von seinem Kinn tropfte.
Joshua weinte, während ihm Bloody Bill die fleischig-blutigen Brocken in Hemd- und Hosentaschen stopfte und auf diese klopfte, als hätte er ihm ein Geschenk von hohem Wert gemacht. Er war mit den Jungen jedoch noch längst nicht fertig, ging zu ihm zurück und zog ihn auf die Beine. Trotz der Misshandlungen gelang es dem Mann, wie ein Volltrunkener schwankend zu stehen.
Anderson Bushwhackers vollzogen an den Unionssoldaten ihr grausames Werk, das weit über Verstümmelung hinausging, während Quantrills Reiter Zug und Bahnhof anzündeten, um beides unbrauchbar zu machen. Es war ein Gemetzel ohnegleichen. Ein Fanal hemmungsloser Zerstörung, die Ausgeburt eines kranken, hasserfüllten Geistes.
Er zog einen Dolch, trat zu Joshua hin und warf ihm die Waffe vor die Füße. »Ich will, das du ihm die Kehle durchschneidest.« Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, zog er einen Remington Revolver und richtete ihn auf Joshuas Stirn. »Oder bitte mich darum, abzudrücken.«
Joshuas Augen wurden und der Blutkappe groß. »Sir, ich …«
»Du bist der göttliche Erlöser seiner Qualen. So musst du’s sehen und nicht anders.« Klackend rastete der Schlagbolzen ein.
Der Gedemütigte, der Joshua war, schnaufte durch die Nase ein, wohl um einer aufsteigenden Übelkeit Herr zu werden. Er sah erst Anderson ins Gesicht, dann in das verstümmelte des Jungen und bückte sich schließlich, um den Dolch aufzuheben.
»Gut so«, knurrte Anderson. Das sie umgebende Inferno wurde zur Nebensache, versank in einem Toben aus Nichtigkeit. »Tu, was ich sage, oder ich komme über dich wie der schlimmste aller Dämonen.« Sein mit der anderen Hand geführter Säbel schnitt quer über Joshuas Stirn, um unmissverständlich klarzustellen, dass er es ernst meinte. Joshuas Blut vermengte ich mit dem des Jungen, tauchte sein Gesicht in grelles, nasses Rot, machte es zur maskenhaften Fratze.
Joshua schloss die Augen und stieß zu. Direkt in die Brust des Jungen, der den Stoß willig in sich aufnahm, weil es für ihn in der Tat die Erlösung bedeutete. Gleichzeitig zischte Andersons Säbel durch die Luft und schlug ihm den Kopf ab.
»Sauf, du Hurensohn! Sauf das Blut deines Schülers!«, schrie er wie von Sinnen, während der enthauptete Körper gegen Joshua kippte und ihn aus dem Halsstumpf mit Blut übergoss.
Joshua brach wimmernd in die Knie und warf den Dolch weg, als hätte er sich an ihm verbrannt. Bloody Bill Anderson streichelte gedankenverloren den schmierigen Skalp auf Joshuas Kopf. »So werde ich meine zweiundzwanzig Schüler der Hölle nähren, jetzt wie in späteren Tagen …«
Die Hitze der Jugend
Vivian jauchzte vor Freude. Sie lief um die Ladentheke herum und dem Postboten entgegen, der sich mit dem größten Paket abmühte, das sie je bekommen hatte. Überhaupt war es das erste richtige Paket, das sie in ihren siebzehnjährigen Leben bekam.
Oh bitte, Herr, es muss für mich sein!
Mit einem Ruck riss sie die gläserne Ladentür auf, dass das kleine Glöckchen darüber wild bimmelte und fast durch den Laden flog. »Chuck, endlich!«, keuchte sie dem Postboten aufgeregt entgegen. »Ist das da für mich? Ist es? Ja?« Dabei deutete sie auf das Paket in seinen Händen, in das gut und gerne ein Globus gepasst hätte.
Chuck kam die dreißig Meilen von Sheldon einmal die Woche vorbei, brachte die Post und nahm neue mit. Das tat er bereits, solange sie sich erinnern konnte. Mit seinem dürren Körper und dem schmierigen, nach hinten gekämmten schütteren Haar war er wahrlich keine Augenweide. Für Vivian wirkte er heute jedoch wie ein Gott, der aus Sheldon, Iowa ins verschlafene Purgatory herabgestiegen war, um Heil zu bringen. Oder, wie heute, zumindest Pakete.
Postbote Chuck schob den Klumpen Kautabak von einer Wangentasche in die andere und nickte. »Yeah … is’ in der Tat für dich, Mädchen.« Verwundert besah er den Absender. »Kommt nicht oft vor, dass ich ’n Paket aus Übersee ausliefere … Hast ’n Freund in England, hä?«
»Brieffreundin«, beeilte sich Vivian, ihn zu verbessern, und hibbelte herum, weil er sich an dem Paket festklammerte. Es fiel ihm wohl schwer, sich davon zu trennen. »Komm schon, gib mir das Ding!«, bettelte sie.
Chuck drehte das Paket in den Händen, hob es an und roch an der verknautschten Pappe. »Hm.« Dann hielt er es sich ans Ohr und rüttelte daran. Der Inhalt klapperte. »Sach mal, was is’n das Weiteste, wo du von hier weg warst, Mädchen?«
Vivian verdrehte genervt die Augen. Sie wollte es unbedingt haben, die Pappe aufreißen, darin herumwühlen. Stattdessen stand sie vor dem Laden ihrer Eltern und musste einem Postboten dämliche Fragen beantworten. »Letztes Jahr, Sioux City, als Tante Betsy geheiratet hat. Du weißt schon, diesen Versicherungstypen, der die Farmen abgeklappert hat.« Vivian erinnerte sich nur ungern an den brütend heißen Tag zurück. Sie hatten mit Dads klapprigem Truck den ganzen Tag gebraucht, um sich in einer mit Girlanden dekorierten Turnhalle zu Tode zu langweilen und selbst gemachten Pfirsich-Eistee zu trinken. Hinterher hatte eine Woche lang ihr Magen rebelliert und sie hatte meiste Zeit kotzend über der Toilette verbracht, weil was mit dem Abendessen schiefgelaufen war. »Und du?«
Chuck lachte krächzend. Er hörte sich an wie eine alte Krähe, die Husten hatte. »Vietnam, Mädchen … das feuchte, heiße, verdammt dreckige Nam, wo man sich auf jedem Scheißhaus ’nen Tripper holt. Dein Dad kann ’n Lied von singen, sag ich dir …«
»Eine scheiß Oper aus Tod und Schmerz.« Vivian zuckte zusammen. Ihr Vater stand direkt hinter ihr. Sie hatte ihn nicht kommen hören. Trotz seiner Körpergröße konnte er sich lautlos bewegen. Ertappt drehte sie sich zu ihm um. »Dad … ich mag’s nicht, wenn du dich so anschleichst.«
Bob McCall wischte sich mit einem Lappen seine blutigen Hände ab. Er hatte hinten im Kühlhaus an den Fleischpaketen gearbeitet, die Chuck wie jeden Freitag mitnehmen würde. Bob konnte in der Tat ein Lied über Vietnam singen. Zehn Jahre hatte er im Dschungel verbracht. 1975 war der Krieg vorbei gewesen und er kehrte als anderer Mensch zurück. Er hatte sein Lachen wie auch sein Leben in Saigon verloren. Bob McCall hatte nie darüber gesprochen, was er dort erlebt hatte, und sich in seiner wortkargen Art in die Arbeit im Laden gestürzt, als wäre er nie weg gewesen.
Bob nickte dem Postboten zu. »Chuck …«
Der schob den Kautabak zurück in die andere Backe. »Bob …«
»Was hast’n da?« Bob zeigte auf das Paket.
»Ist für deine Tochter … von überm Teich … England.«
»England?«
»Jepp.«
Bob nahm Chuck das Paket aus der Hand und sah es unschlüssig an. Sein von der Arbeit blutiger Daumen hinterließ einen verwischten Abdruck auf der Pappe. Dann sah er zu Vivian. »Wie kommst’n an ein Paket aus England, Tochter?«
Die rollte genervt die Augen. »Ach, komm, Dad, weißt du nicht mehr? Die Brieffreundschaftsaktion vorletztes Jahr mit der Schule in London?«
»Und was is’n da drin?«, wollte er wissen. Seinem Gesicht nach zu urteilen, dachte er darüber nach, das Paket aufzureißen, um selbst nachzusehen.
»Du weißt, wie ich über die von außerhalb denke«, brummte er missmutig.
»Dad … bitte …«
»Wie wir alle über die von außerhalb denken!« Er sah den Postboten mit seinen stechenden Augen warnend an.
Chuck wich dem Blick des schweren Eins-neunzig-Mannes aus, sah zu Boden und hob die Hände. »Bin nur der Postbote, Sir. Liefere Pakete aus und nehm andere mit …« Er trat zum Lieferwagen zurück und tat beschäftigt. »Geht mich ansonsten nichts an, was hier geschieht.«
Bob nickte zufrieden und widmete sich seiner Tochter. »Was schreibst du über uns denn so, hm? Von dem Leben hier, der Weite des Landes … den Schweineställen? Sicher nicht von den Maisfeldern …«
Vivian knetete von Angst ergriffen ihre Finger. Ein falsches Wort, und sie würde es bitter bereuen. »Wir haben über Musik geschrieben, Dad … nichts weiter. Mädchensachen halt, nichts von hier, außer dass wir einen Laden haben …«
Die schallende Ohrfeige schmetterte ihren Kopf zur Seite. »Selbst das geht die dort draußen nichts an, hörst du?« Er knirschte mit den Zähnen und packte sie an ihrem schwarzen Shirt, sodass es in den Nähten knackte. »Lass dir das eine Warnung sein, Tochter! Ein falsches Wort in die falschen Ohren, und die dort oben fangen an, Fragen zu stellen!«
Er ließ sie los und drückte ihr das Paket gegen die Brust. »Du weißt, dass ich dich liebe. Nimm dein Paket und geh auf dein Zimmer. In zehn Minuten stehst du wieder hinter der Theke!«
Vivians Wange brannte wie Feuer. Sie strich sich ihr schwarzes Shirt glatt, drehte sich ohne ein weiteres Wort um und lief durch den Laden und nach oben in ihr Zimmer. Nachdem sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, schluchzte sie auf. Sie warf das Paket aufs Bett und setzte sich davor auf den Boden. »Die von außerhalb«, äffte sie ihren Vater nach und verzog das Gesicht. »Und wenn du mir mein Blondie-Shirt zerrissen hast, werde ich …«
Nichts werde ich … Er hat recht. Es geht die von außerhalb nichts an, wie die Leute hier ticken. Die würden das eh nicht verstehen.
Verstohlen zog sie den Schuhkarton unter dem Bett hervor und klappte ihn auf. Ihre Finger strichen behutsam über das zusammengerollte Bündel Dollarscheine. Die Zugfahrpläne von Sheldon nach Minneapolis von dort weiter nach New York kannte sie auswendig. »Ich werde von hier verschwinden.« Vivian hasste das Leben in dieser Einöde, in der man abgesehen von sich besaufen nichts unternehmen konnte. Sie sehnte sich dagegen nach Musik, nach jungen Leuten und einem Leben ohne Zwang. Sie zog ein zerfleddertes Magazin mit dem Titel PUNK aus dem Karton. »Eine von außerhalb werden.«
Vivian zog das Paket vom Bett und das Klappmesser aus der Gesäßtasche ihrer dunkelblauen Jeans, das sie bei sich trug, wenn sie im Laden arbeitete. Nervös zog sie sich den schwarzen Pferdeschwanz straff. »Mal sehen, was du mir Schönes geschickt hast, Mary-Ann.«
Sie setzte die Schnitte wie beim Auspacken der Ware, akribisch darauf bedacht, nicht zu tief zu schneiden. Andächtig klappte sie die Kartonage auseinander. »Hölle noch mal, ist das krass!« Der Inhalt verschlug ihr den Atem. Vivian zog die beiden T-Shirts, den Brief und die Musikkassette heraus und sprang aufs Bett. »Wow … einfach nur … wow!«
Vivian legte sich auf den Rücken und faltete das schwarze Ramones-Shirt auseinander. »YES! … der Baseballschläger-Adler!« Das andere Shirt war von Joy Division, einer Band, die sie nicht kannte. »Unknown Pleasures«, flüsterte sie ehrfürchtig und fand, dass es zu ihrer geplanten Flucht passte. Doch dazu fehlten ihr eine Menge Dollarnoten und die konnte sie nur unten im Laden verdienen. Das rief ihr die Zehnminuten-Frist ins Gedächtnis, die sie von ihrem Vater eingeräumt bekommen hatte.
»Fuck, der Laden!« Sie hatte die Frist überschritten. Vivian stopfte alles ins Paket, gab dem Schuhkarton einen Tritt, das er unter dem Bett verschwand, und lief in den Laden zurück. Sie passierte die Tür hinter der Theke und rannte direkt in ihren Vater hinein. Vivian keuchte. »Hab’s nicht vergessen, Dad.«
Sie rechnete mit einer weiteren Ohrfeige, doch Bob McCall lächelte zu ihr herab. »Ich weiß doch, bist ’n gutes Mädchen. Hilf mir mal mit den Kühlboxen, ja?«
Vivian atmete erleichtert auf. Der Inhalt der Kühlboxen war die Haupteinnahmequelle des Gemischtwarenladens ihrer Eltern. Der Eingang zum Kühlraum befand sich hinter der Fleischauslage, eine massive Stahltür mit zwei abgegriffenen Riegeln, die stets geschlossen sein musste, um die Kälte im Innern konstant zu halten.
Sie öffnete die Tür und schlüpfte in die angenehme Kälte des überraschend großen Raums. Mit dem Rücken schob sie die Tür zu und schloss für einen Moment die Augen, damit ihr erhitzter Körper abkühlen konnte. Es war jedes Mal ein kleiner Schock, die Kälte zu spüren. Gleichzeitig war es ein angenehm prickelndes Gefühl, wenn sich der Schweiß abkühlte und die kalte Luft in ihre Lunge strömte. Wenn sie danach in die Wärme zurückkehrte, fühlte sie sich wie ein Eis am Stil.
Vivian stieß sich ab und schlängelte sich zwischen dem von der Decke an Fleischerhaken hängenden Fleisch hindurch, um zur rückwärtigen Wand zu gelangen, wo Dad die Kühlboxen vorbereitete. Sie stieß mit der Schulter gegen eine der Hälften, die dadurch ins Schwingen geriet, eine andere anstieß und die wieder eine, bis schließlich alle schwankten und einen grotesken Tanz aus gehäuteten, fleischigen Torsi aufführten, dass Vivian kichern musste.
Bob McCall hatte das Metzgerhandwerk von seinem Vater erlernt. Er wusste, wo die Schnitte zu setzen waren, wie man die Häute abzog und die Knochen teilte. Auf seinem alten, von Narben überzogenen Arbeitstisch trennte er von dem Schlachtgut zuerst die Extremitäten ab, um sie auszubluten. Das Holz hatte deswegen im Laufe der Jahre eine dunkle, fast schwarze Farbe angenommen. Er zog ihnen die Haut ab und legte sie in einem speziellen Salz ein, das es nur in den Bergen South Dakotas gab. Das Pökelfleisch war einfach der Hammer.
Im nächsten Arbeitsschritt schnitt er die Köpfe ab, achtete aber darauf, dass der Hals am Torso verblieb. Die ließ er, wie sie waren, und steckte sie in gläserne Kästen, die Vivian an Aquarien erinnerten, weil er sie mit einer Art Sirup ausgoss. Wenn er Fleisch in den Kühlboxen verschickte, ging jedes Mal der dazugehörige Kopf mit auf die Reise, denn darauf legte die Kundschaft in der großen Stadt besonderen Wert.
Er brach den Körpertorso auf und nahm ihn aus, wie es ein Metzger machte. Hier wurde nichts in den Abfall geworfen. Selbst die Haut verarbeitete er zu Hundekauknochen. Für Großstädter mochte der Arbeitsbereich im Kühlhaus nicht hygienisch, die Beile, Hackklingen und Messer antiquiert wirken, doch McCall interessierte das nicht. Hier in Purgatory tickten die Uhren anders, auf Meinungen von außerhalb gab man einen feuchten Dreck.
Unabhängig davon, wie sehr sie das Leben in Purgatory hasste, arbeitete Vivian gerne im Laden ihrer Eltern. Sie half im Kühlhaus, gab dem Mastvieh in der Scheune hinter dem Haus Futter und hätte wahrscheinlich einen der Jungs aus dem Ort geheiratet, wenn da nicht diese Brieffreundschaft wäre. Mary-Ann schenkte ihr mit ihren ausschweifenden Briefen einen Blick über den Horizont hinaus, vermittelte ihr neues Wissen und verdammt coole Musik. Sie hatte in Vivians Kopf mit ihren Zeilen einen Keim gesetzt, der sie dazu trieb, mehr vom Leben zu erwarten als die langweilige, ländliche Einöde.
Heute waren es fünf Kühlboxen, die ihr Vater vorbereitet hatte. Sie lud die mit Eis und Fleisch gefüllten Boxen auf eine Sackkarre, rollte sie aus dem Kühlhaus und durch den Laden zu Chuck, der sie rauchend neben dem Postlieferwagen erwartete. »Verdammt, Mädchen, hast mich in der Hitze ganz schön warten lassen.« Er warf einen schrägen Blick auf die Boxen und öffnete die Hecktüren des Wagens. »Wer frisst nur diesen ganzen Mist?«
Das Geschäft mit dem Fleisch lief inoffiziell. Chuck sah Vivian dabei zu, wie sie die schweren Boxen verstaute, half ihr aber nicht. Lieber gaffte er Vivian auf den Hintern und versuchte, einen Blick in ihr vom Schweiß feuchtes Shirt zu erhaschen, wenn sie sich nach vorne beugte. Ihre Haut dampfte, weil sie kalt war.
»Mein Gott, Chuck, noch nie ’n weibliches Wesen gesehen?«, schnauzte sie ihn leicht säuerlich an und riss von der letzten Box einen Zettel ab, auf dem die Empfängeradresse vermerkt war.
Chuck schnaufte schwer, machte aber keine Anstalten, seinen Blick abzuwenden. »Sorry, Mädchen, is’ nur, dass du zu ’ner verdammt schönen Frau heranwächst.«
Es gab über die Lieferungen keinen Einlieferungsbescheid oder eine Aufsplittung in Warenpreis und Steuer. Die einzige Buchführung bestand aus einem abgegriffenen Heft, das Bob McCall in der Gesäßtasche trug, und dem Zettel mit dem Adressaten, der dem Postboten mit jeder Lieferung übergeben wurde.
Vivian funkelte ihn genervt an. »Geh dich erst mal waschen und besorg dir ’nen vernünftigen Haarschnitt, du stinkst zum Himmel, Mann. Jeder würd sonst meinen, dass du ’n Problem mit Wasser hast.« Chuck war ein Schwein, aber eins, das auf seine eigene Art liebenswert war. Der dürre Kerl tat keiner Fliege was zuleide. Einmal hatte er eine Katze angefahren. Die brachte er mit in den Laden und weinte wie ein Schoßhund. Bob brach dem armen Tier kurzerhand das Genick, um es von seinem Leiden zu erlösen. Ja, auf diese Weise machte man das in Purgatory.
»35 Pine Street, Yonkers. New York also … feiert Sam Carr mal wieder ’ne Party, hm?« Grunzend steckte er das Papier in die Hosentasche. »Na meinetwegen … sollen die in der Stadt ihren Spaß haben, während wir hier schuften und schwitzen wie die Schweine.« Chuck nickte Vivian zu und schwang sich hinters Steuer. »Grüße an Bob und deine Mum, seh’n uns nächste Woche …«
Vivian sah dem Postwagen sehnsüchtig hinterher, bis er nach Süden auf den Interstate bog und dort eine Staubwolke hinter sich herziehend verschwand. Sie wünschte sich nichts sehnlicher, als im Fond des Lieferwagens zu sitzen und der ländlichen Einöde sofort zu entfliehen, andererseits hielt sie hier ein nahezu unzertrennliches Band, das weit über das der Familie hinausging. Der Spruch Keiner geht für immer von hier weg kam nicht von ungefähr.
Nur für ’ne Weile wär toll, ein oder zwei Jahre …
»Die Jugend ist ’n verdammter Fluch, Vivian«, krächzte es hinter ihr.
Vivian erschrak, obgleich sie wegen der Stimme wusste, wer da stand. Sie drehte sich um und rang sich ein schräges Lächeln ab. Es war die alte Ruth Dickson, die sich einmal mehr an sie herangeschlichen hatte. Ihr wächsernes Gesicht glich einer faltigen Kraterlandschaft, ihr Hals, der aus dem abgetragenen schwarzen Kleid herausragte, dem einer Schildkröte. Sie stützte sich gebückt auf einen Stock, den sie im Wald gefunden haben musste.
Was will diese gottverdammte Hexe von mir?
»Ruth, verdammt, hab dir schon tausend Mal gesagt, du sollst dich nicht an mich ranschleichen!«
»Ich weiß, was in dir vorgeht«, sprach Ruth unbeeindruckt weiter. »Hör auf meine Worte, behalt’s für dich, und wenn dir das Glück hold ist, zieh’s durch.« Vivian schluckte. Ihr war die Frau unbehaglich. In ihren Erinnerungen war sie schon immer alt gewesen. Selbst Dad wusste nicht, wie alt sie wirklich war. Dazu der penetrante Gestank nach Mottenkugeln und etwas Süßlichem, eben so, wie alte Leute manchmal rochen. Fröstelnd rieb sie sich die Arme. »Keine Ahnung, was du mir damit sagen willst, Ruth …«
Die Alte kam ihr nah, unterschritt deutlich Vivians Wohlfühldistanz, was ihr unangenehm vorkam. Ihr Ärmchen kam nach oben, ihr dürrer Finger tippte gegen Vivians Brust. »Die Hitze der Jugend, Kindchen, die Hitze der Jugend …« Sie räusperte sich, fing an zu würgen und schluckte einen Brocken hinunter. Um was es sich handelte, wollte sich Vivian auf keinen Fall vorstellen. Ihr Finger drückte weiterhin in Vivians Oberkörper. Sie war erstaunt darüber, wie hart und lang ihre Fingernägel waren. Und spitz genug, um sie an Krallen zu erinnern. »Ich war ein blutjunges und naives Ding wie du, als sie nach dem Krieg zu uns kamen …« Ruth lachte krächzend. »Hab meine Unschuld an die Dämonen des Südens verloren …«
Vivian dachte an ihren Vater und Vietnam. Diesen Krieg konnte sie unmöglich meinen, denn nach Vietnam waren kaum Leute hierher gekommen. Ruth sprach oft von den Dämonen des Südens, die Purgatory heimgesucht und alles ins Schlechte verkehrt hatten. Sie behauptete sogar, dass der Boden nur deswegen schwarz sei, weil er vom Bösen verdorben sei. Was sollte man sagen, Ruth war eben verrückt.
»Sie haben ihre Verderbtheit in uns eingepflanzt wie missgestaltete Föten … und wir sind dumm genug gewesen, sie auszutragen.« Die alte Ruth berührte Vivians Wange. »Du bist anders, Kindchen, erinnerst mich an deine Mutter … Lass dich nicht von ihnen benutzen, wie sie es mit uns taten …« Ruth ließ von ihr ab und schlurfte weiter ihres Weges, drehte sich aber nach einigen Schritte noch einmal zu ihr um. »Wenn du reden willst, sprich nur mit mir und niemandem sonst … nur mit mir, hörst du, Kindchen?«
Damit ließ die alte Frau Vivian stehen, die ihr entgeistert nachstarrte. Sie war froh, dass Ruth weiterging. Dennoch hätte sie gerne gewusst, was diese Anspielung zu bedeuten hatte. Ruth Dickson war eine Außenseiterin, die am Stadtrand in einem Wäldchen eine heruntergekommene Hütte bewohnte. Sie hatte niemanden, der sich um sie kümmerte, und kam nur selten in die Stadt.
Ist sie wegen mir gekommen? Um mir das zu sagen?
Vivian dachte mit Schaudern an den letzten Sonntag zurück. Der Prediger hatte die alte Frau während der Messe vor der versammelten Gemeinde gedemütigt. »Ungläubige Hexe« hatte er sie genannt und dafür eine Menge Zustimmung geerntet. Es war wirklich besser, sich von ihr fernzuhalten, um nicht in ihr schlechtes Licht gerückt zu werden.
Trotz der Sommerhitze war ihr plötzlich kalt. »Verrückte Alte«, murmelte sie und ging in den Laden zurück, um ihrer Arbeit nachzugehen.
52 Knoten
30. Oktober – Irgendwo in Iowa
Ein eisiger Wind heulte über die endlosen Weiten der Plains, trocknete den flockigen Schweiß auf den Flanken der gehetzten Pferde. Über den Himmel zogen düstere, regenschwere Wolken. Ein Unwetter kündigte sich an. Al Swearengen lief der Schweiß in den Nacken, brannte auf seiner wunden, aufgeschürften Haut. Gehetzt zügelte der Mann mit dem eisigen Blick sein Pferd und blickte sich um, suchte den Horizont hinter ihnen nach Staubwolken oder Bewegungen ab, die ihre Verfolger verraten würden. Er konnte nichts dergleichen entdecken, er wusste lediglich, dass sie da waren. Dass die Jäger nun die Gejagten waren.
Das Blatt hatte sich gewendet, nachdem sich Cole Younger und die James-Brüder an der Stompers Lodge von ihnen getrennt hatten, um in Kansas ihr eigenes Ding zu drehen. Die Bushwhackers gerieten in Ray County, Missouri in einen Hinterhalt. Eine hastig zusammengestellte Miliz unter Oberst Samuel P. Cox hatte ihnen in einem Talkessel zwischen Büschen kauernd und auf Bäumen sitzend aufgelauert und ohne Warnung das Feuer eröffnet. Endlich konnten sich die Bürger an den Schlächtern von Lawrence und Centralia rächen. Und sie hatten nicht vor, Gefangene machen. Sie wollten töten.
Die Dämonen des Massakers wurden selbst massakriert …
Es ging alles furchtbar schnell. Die Bushwhackers kämpften mit den Zügeln zwischen den Zähnen, einen Revolver in jeder Hand, und schossen wild um sich. Waren die Waffen leer, warfen sie diese weg und zogen neue. Dennoch hatten sie nicht den Hauch einer Chance. Sie fielen reihenweise den Kugeln des wütenden Mobs zum Opfer. In einem Inferno aus panisch schreienden Pferden, aufgewirbeltem Staub und Pulverdampf lagen bald dreihundert Reiter blutend und sich vor Schmerzen windend im kackbraunen Missouri-Dreck. Swearengen hatte sie von den Hügeln steigen sehen, um den Verletzten mit Knüppeln und Steinen die Schädel einzuschlagen, meist auch alle anderen Knochen im Leib. Der Hass steigerte sich zu einem Rausch, der menschlichen Matsch gebar. Endlich konnten sie den Bushwhackers das heimzahlen, was die ihren Familien angetan hatten.
Viel später, sie hatten das vom Pulverdampf geschwängerte Schlachtfeld längst hinter sich gelassen, dachte Swearengen oft darüber nach, was letztendlich den Unterschied zwischen den Grausamkeiten der Bürger und denen der Bushwhackers ausmachte. Er fand darauf keine Antwort, weil es keinen Unterschied gab. Die Kriegsmaschine hatte ihre Menschlichkeit zu feinem Staub zermahlen, den der Wind in alle Himmelsrichtungen verwehte.
Im Getümmel des Gefechts hatte er gesehen, wie Bloody Bill Anderson getroffen wurde und stürzte. Kurz entschlossen sprang er vom Pferd und nutzte den staubigen Nebel, der Freund mit Feind verschmelzen ließ, um ihn auf ein anderes Pferd zu ziehen. Im Dunst verwandelten sie sich in geisterhafte Schemen. Nur eine Handvoll Männer entkamen dem Zorn Gottes, der in apokalyptischer Form auf sie niedergegangen war.
Was aus dem Staub ersteht, zerfällt zu Staub …
Jetzt ritt er zusammen mit Jack McCall und dem schwer verletzten Bloody Bill Anderson nach Norden, tief hinein ins verhasste Land der Yankees. Ein anderer Ausweg hatte sich ihnen nie geboten.