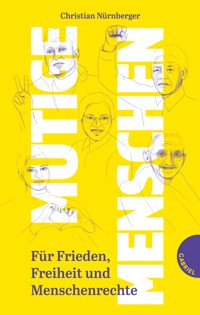
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gabriel in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Spannende und unterhaltsame Kurz-Biografien von mutigen und inspirienden Persönlichkeiten - vom Spiegel-Bestseller-Autor erzählt. Christian Nürnberger erzählt von Frauen und Männern, die Mut bewiesen haben oder immer noch beweisen: Mut, die Dinge anders zu sehen, mit der bisherigen Tradition zu brechen oder einer Übermacht die Stirn zu bieten. Sie kämpfen für Gerechtigkeit, für die Demokratie, für Feminismus, für mehr Klimaschutz, gegen Unterdrückung, Überwachung, Rassismus oder Korruption. Dabei riskieren sie viel und ob sich ihr Einsatz lohnen wird, wissen sie nicht. Porträts von: - Peter Benenson - Simone de Beauvoir - Bartolomé de Las Casas - Mahatma Gandhi - Maria Kolesnikowa - Martin Luther - Nelson Mandela - Alexej Nawalny - Rosa Parks - Disha Ravi - Bertha von Suttner - Edward Snowden - Ray Wong
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
Christian Nürnberger erzählt von Frauen und Männern, die Mut bewiesen haben oder immer noch beweisen: Mut, die Dinge anders zu sehen, Mut, etwas Neues zu wagen, Mut, mit der Tradition zu brechen oder einer Übermacht die Stirn zu bieten: Peter Benenson · Simone de Beauvoir · Bartolomé de Las Casas · Mahatma Gandhi · Maria Kolesnikowa · Martin Luther · Nelson Mandela · Alexej Nawalny · Rosa Parks · Disha Ravi · Bertha von Suttner · Edward Snowden und Ray Wong.
Der Autor
© Privat
Christian Nürnberger (Jahrgang 1951) ist ein hochkarätiger Autor. Für »Mutige Menschen – Widerstand im Dritten Reich« wurde er mit dem DJLP 2010 ausgezeichnet. Seine Luther-Biografie »Der rebellische Mönch, die entlaufene Nonne und der größte Bestseller aller Zeiten« stand monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Mehr über Christian Nürnberger: www.christian-nuernberger.de
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Gabriel auch!Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor*innen und Übersetzer*innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator*innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher und Autoren auf:www.gabriel-verlag.de
Viel Spaß beim Lesen!
Für die vielen mutigen Menschen, die heute unterLebensgefahr für die Freiheit in Iran, Russland, China,Belarus und in der Ukraine kämpfen.
Vorwort
Mut ist etwas Sonderbares. Man hält die Sache für klar und denkt nicht weiter darüber nach, aber in meiner Familie lebte ein Kater, der mich lehrte, dass es so einfach auch wieder nicht ist.
Regelmäßig sah ich ihn jenseits unseres Gartenzauns durch den Stadtpark streifen. Manchmal kam ein Hund des Weges, erspähte von Weitem den mit seinem weiß-roten Fell gut sichtbaren Kater – und sofort passierte, was für solche Fälle die Natur vorgesehen hat: Adrenalingetrieben schoss der Hund wie eine Rakete aus dreißig Metern Entfernung auf seine Beute zu. Nun hätte eigentlich Teil zwei des von der Natur vorgesehenen Programms starten müssen: Mein Kater hätte in höchster Eile auf den nächsten Baum oder über den Zaun fliehen sollen.
Tat er aber nicht. Er stellte sich mit seiner Breitseite auf, machte einen Buckel, sträubte das Fell, fauchte und hob die Tatze. Und machte die Erfahrung, dass es wirkte. Die meisten Hunde zogen in gebührendem Abstand die Notbremse, trollten sich und taten so, als ob nichts gewesen wäre. Einige andere aber ließen sich davon nicht beeindrucken oder glaubten es nicht und rasten in unvermindertem Tempo auf meinen Kater zu, bis sie für ihn in Reichweite waren – und bekamen von ihm fürchterlich eine gewischt. Wer jemals die ausgefahrenen Krallen einer Katze auf seiner Haut gespürt hat, kann sich deren Wirkung in der weichen Hundeschnauze vorstellen. Solche Hunde, und seien sie noch so groß, ziehen gedemütigt winselnd von dannen.
Einmal, ein einziges Mal, hatte ich bisher indirekt beobachten können, dass die Strategie, dem Gegner furchtlos drohend ins Gesicht zu blicken, offenbar nicht funktionierte. Ich weiß nicht, warum. Ich war nicht im Park, habe den Hund nicht gesehen, sondern saß im Garten und sah, wie unser Kater panisch über den Zaun sprang, durch den Garten raste, über den Fischteich zu springen versuchte und ins Wasser platschte.
Das hat mich nicht nur amüsiert, sondern auch beruhigt, denn ich dachte immer: Mut ist für solche Fälle von der Natur aus guten Gründen nicht vorgesehen. Realistisch betrachtet hatte mein Kater gegen einen großen Hund keine Chance. Irgendwann wäre eine Dogge oder ein Kampfhund gekommen und hätte ihn in der Luft zerfetzt, darum wäre es für ihn stets »vernünftiger« gewesen, davonzulaufen. Aber offenbar konnte mein Kater unterscheiden, welche Hunde von seinem Mut zu beeindrucken waren und welche nicht. Jedenfalls hoffte ich das.
Den Mut verloren hatte er durch diese Begegnung mit einem Hund, der es offenbar »ernster meinte« als die anderen, übrigens nicht. Schon wenige Tage nach seiner »Schlappe« hatte ich wieder einen Hund winselnd das Feld räumen sehen.
Ich frage mich: Woher nahm mein Kater diesen Mut? Die meisten Katzen fliehen. Er blieb stehen. Und woher wusste er, wann es besser ist zu fliehen? Warum setzte er sich überhaupt der Gefahr aus, wenn er sich durch einen einfachen Sprung über den Zaun sofort in Sicherheit hätte bringen können? Ich glaube nicht, dass es Abenteuerlust war, dass es ihm Spaß gemacht hat, sich einem Hund in den Weg zu stellen. Ich bin mir sicher, dass er Angst hatte, wenn so eine Bestie auf ihn zustürmte. Aber irgendetwas zwang ihn, seine Angst zu überwinden und dem Fluchtreflex zu widerstehen. Vielleicht verfügte mein mutiger Kater über eine Art Wertesystem, das ihm sagte: Das hier ist dein Revier, darauf haben fremde Eindringlinge nichts zu melden, und wer es dennoch probiert, kriegt deine Krallen zu spüren.
Großes Gewicht bekommt die Frage nach dem Mut, sobald man sie auf Menschen, Gruppen, Völker anwendet. Warum kuschen die meisten Menschen vor ihrem Chef? Warum schweigen so viele in der U-Bahn, oder sehen weg, wenn ein paar Rechte einen Schwarzen anpöbeln oder Teenager einen Obdachlosen? Warum schweigen in Deutschland ganze Dörfer, wenn einer kommt und nach der Zeit zwischen 1933 und 1945 fragt?
Ja, es gab Ausnahmen, gibt immer Ausnahmen. Es gibt Menschen, die in der U-Bahn nicht schweigen, die vor ihrem Chef nicht katzbuckeln, die unangenehme Wahrheiten aussprechen. Immer gab es Widerstand gegen Lüge, Unrecht, Unterdrückung, Armut, Krieg. Aber immer ging dieser Widerstand von kleinen Minderheiten, oft nur von Einzelnen aus. Und nicht selten endete dieser Widerstand mit deren Tod.
Mut ist wohl keine Sache des Willens und des bewussten Entschlusses, sondern die Menschheit scheint eben aus zwei Gruppen zu bestehen: einer Minderheit, die keine Angst kennt und »von Natur aus« mutig ist, und einer Mehrheit, die »von Natur aus« feige ist. Also gibt es eigentlich gar keine mutigen Menschen, denn wer keine Angst hat, braucht keinen Mut. Und wer ihn bräuchte, hat ihn nicht.
Dieser Meinung scheinen die meisten Feiglinge anzuhängen und manche von ihnen rechtfertigen damit sogar ihre Feigheit. Feigheit sei ein Menschenrecht, hatte ein deutscher Dichter gesagt, nachdem ihm vorgeworfen wurde, in der DDR als Spitzel für die Staatssicherheit gearbeitet zu haben. Dem widersprach emphatisch Joachim Gauck, damals Vorsitzender des Vereins »Gegen Vergessen – für Demokratie«. Wer so etwas sage, sei »ein Idiot. Feigheit ist menschlich. Sie ist Schwäche, Versagen. Aber sie als Menschenrecht in den Rang dessen zu erheben, was in der Wertordnung ganz oben steht – da begegnet uns nicht nur Irrtum, sondern da beginnt schon die Lüge.«1
Von Natur aus sind die meisten feige. Angst und Furcht sind natürliche, evolutionär entstandene genetische Überlebensprogramme. Darum ist Mut die Ausnahme und Feigheit die Regel. Eben deshalb ist instinktives, gedankenloses Mitläufertum die beste Basis für jeden Diktator und der Mut weniger Einzelner die größte Gefahr für die Inhaber der Macht.
Wer Mut beweist, riskiert etwas, gefährdet sich, setzt seine Karriere aufs Spiel, seine Gesundheit, seine Freiheit, sein Leben. Er riskiert den Bruch mit seiner Familie, mit Freunden, mit Traditionen, nimmt Liebesentzug in Kauf, Drohungen, Spott und Verletzungen. Und in dem Moment, in dem er das tut, kann er nie wissen, ob sich der Einsatz lohnt, ob er zum Erfolg führt. Aber Erfolg, der »Lohn« ist nicht das höchste Ziel des Mutigen. Vielmehr zeigt er Mut, weil er davon durchdrungen ist, dass bestimmte Werte – Würde, Anstand, Frieden, Freiheit, Wahrheit, Gerechtigkeit – unbedingt gelten müssen, und im Extremfall kann dann dieses unbedingte Festhalten an bestimmten Werten das eigene Leben kosten. Dieses Risiko nicht einzugehen, liegt in der Natur des Menschen.
Aber der Gehorsam gegen unsere Natur ist eben kein Menschenrecht, denn das Menschsein beginnt immer erst dort, wo wir diesen Gehorsam bewusst aufkündigen. Es bedarf eines bewussten Entschlusses aus Freiheit. Dazu gehört dann auch die Überwindung unserer natürlichen Angst.
Das können wir nicht von Natur aus. Das muss gelernt, geübt, trainiert werden. Darum ist es zu bequem, sich darauf hinauszureden, dass es eben Mutige und Feiglinge gibt, und niemand etwas dafür könne, wenn er zu den Feigen gehört. »Man ist nicht mutig oder feige, sondern meist beides«, sagt Gauck. »Vielleicht schweigt man erst mal nur, wenn andere Unrecht tun. Dann sagt man im kleinen Kreis etwas dagegen. Dann sucht man Verbündete, eine Öffentlichkeit. Wer will, kann erleben, wie Mut und Widerstandswille wachsen.«
Immer dort, wo ein Samenkörnchen Mut in den Boden fällt und ausnahmsweise mal aufgeht, verändert sich die Welt. Am Anfang jeder Weltveränderung steht meistens ein Mutiger. Oder der Mut einer kleinen Gruppe. Der Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Der Mut, einfach die Wahrheit auszusprechen. Der Mut, einer Übermacht die Stirn zu bieten. Der Mut, sich einen neuen Weg zu bahnen. Der Mut, die Dinge anders zu sehen. Der Mut zur Umkehr. Der Mut, etwas Neues zu wagen. Der Mut zu einem Umweg. Der Mut, sein Leben in die eigene Hand zu nehmen. Der Mut, mit seiner eigenen Tradition zu brechen, aus einer Religionsgemeinschaft auszutreten – oder auch das Gegenteil davon: der Mut, an einer Tradition festzuhalten, die von allen verraten wird, der Mut, in eine Religionsgemeinschaft einzutreten oder einen bestimmten Glauben gegen deren eigene Priester zu verteidigen.
Auch Mahatma Gandhi hat als Feigling angefangen. Jedenfalls hat er das über sich selbst so gesagt: »Ich war ein Feigling.« Wobei die Betonung auf »war« liegt. Irgendwann in seinem Leben war er dann kein Feigling mehr, spätestens als er in Südafrika unter den Schlägen der Polizei öffentlich Pässe verbrannte.
Diese Wandlung vom normal natürlichen Feigling zum mutigen Menschen haben alle hier Porträtierten durchgemacht. Keiner von ihnen war schon von Geburt an mutig, sondern ist es geworden, der eine ganz plötzlich, der andere im Verlauf vieler Jahre. Erst dann, als diese Wandlung vollzogen war, konnten sie zu den Kämpfern für Freiheit, Frieden und Menschenrechte werden, als die wir sie kennen und als die wir sie heute verehren.
Erzählt werden all diese Geschichten aber nicht, um Heldenverehrung zu betreiben, auch nicht, um aus Feiglingen Mutige zu machen, sondern in der Absicht, so etwas wie ein »Lernen von den Meister*innen« zu ermöglichen. Wie baut sich Widerstand auf? Wie lässt sich Angst überwinden? Wofür zu kämpfen lohnt sich?
Es geht weiterhin darum, zu zeigen, wie aus einem ersten kleinen mutigen Schritt der Mut wächst, den zweiten zu machen, und mit diesem der Mut zum dritten und allen weiteren Schritten. Manchmal, wenn gerade eine günstige Konstellation herrscht, endet so eine Reihe von Schritten plötzlich in einem Umsturz von gewaltigen Ausmaßen, wie etwa bei Martin Luther, bei dem man sich fragt: Wie war es möglich, dass ein kleiner unbekannter Mönch aus der deutschen Provinz eine europäische Supermacht, nämlich die römische Kirche, zum Beben bringen konnte?
Was dieses Buch auch zeigen kann: Sichtbarer Mut hat immer eine unsichtbare Vorgeschichte, und diese Vorgeschichten sind es, die heute allen jenen Mut machen können, die wegen anhaltenden Misserfolgs mutlos zu werden drohen und kurz davor sind, resigniert aufzugeben. Dafür steht die Näherin Rosa Parks. Sie blieb eines Tages im Bus einfach sitzen, als sie aufstehen sollte, um einem Weißen Platz zu machen. Aber Rosa Parks war zu dem Zeitpunkt bereits seit zwölf Jahren Mitglied einer gewerkschaftsähnlichen Vereinigung von Schwarzen Bürgerrechtlern. Ihrem einsamen Widerstandsakt im Bus sind also zwölf Jahre Bewusstseinsbildung vorausgegangen.
Das zeigt: Der kleine Mut der kleinen Leute ist nicht vergeblich. Und auch das Schreiben gegen das Unrecht ist es nicht. Dass aus dem Feigling Gandhi der gewaltfreie Kämpfer gegen das britische Empire wurde, hatte viel damit zu tun, dass Gandhi das Neue Testament und Bücher von Tolstoj und Thoreau gelesen hatte. Gandhis Taten und Schriften wiederum haben Nelson Mandela und Martin Luther King inspiriert. Geschriebenes entfaltet seine Wirkung, auch wenn man nicht sagen kann, wann, wo und wie.
Wem der Mut fehlt, sich wie Gandhi niederknüppeln zu lassen, oder wie Mandela für Jahrzehnte ins Gefängnis zu gehen, muss nicht verzweifeln. Peter Benenson ist eine ideale Konstruktion eingefallen für alle, die zwar gerne etwas zur Verbesserung der Welt beisteuern möchten, aber nicht über den Heldenmut verfügen, ihr Leben oder ihre Gesundheit zu riskieren. Benenson ist der Gründer von amnesty international und diese Organisation bietet jedem die Gelegenheit, sich nach seinem eigenen Maß zu engagieren. Schon mit einer einzigen E-Mail, vorformuliert von amnesty, kann man politisch Verfolgten helfen. Allein die gelegentliche Information auf den Websites von amnesty über deren aktuelle Kampagnen ist ein Wert an sich, weil diese Informationen zur politischen Bewusstseinsbildung beitragen, und diese ist die Voraussetzung für Mut.
Damit ist implizit auch gesagt: Der Mut, um den es hier geht, ist etwas anderes als Abenteuerlust. Allein in einem Einhandsegler durch die Ozeane zu pflügen, mit einem Heißluft-Ballon um die Erde zu schweben, den Mount Everest zu erklimmen oder die Arktis zu durchqueren, mag eine wertvolle Selbsterfahrung für den sein, der sich mit solchen Übungen an die Grenzen des Menschenmöglichen begibt. Aber deren Nutzen für die Menschheit dürfte ähnlich begrenzt sein wie der Nutzen des Mutes meines Katers für die Katzen dieser Welt.
Jedoch 27 Jahre ins Gefängnis zu gehen wie Nelson Mandela, um die Apartheid zu beenden und geraubtes Land an dessen legitime Erben zurückzugeben, oder sich in Lebensgefahr begeben und tatsächlich in der Gefahr umkommen wie Alexej Nawalny, um die Welt über die Wahrheit des »Systems Putin« aufzuklären, das ist echter Mut. Es ist ein Mut, der sich für andere Menschen auszahlt.
Man kann von niemandem verlangen, seine Existenz aufs Spiel zu setzen. Aber sich vor sich selbst und anderen einzugestehen, dass man bequem und feige war oder es ist, das zumindest sollte verlangt werden. Nach dem Fall der Mauer haben wir erlebt, dass die Bürgerrechtler, die sich gegen das DDR-Regime zur Wehr gesetzt hatten, von den Mitläufern nicht verehrt, sondern denunziert und beschimpft worden sind, vermutlich, weil sie den lebenden Beweis für das eigene Versagen darstellten. Wer selber keinen Mut bewiesen hat, sollte wenigstens jenen Respekt erweisen, die ihn bewiesen haben, statt sie auch noch schlechtzumachen.
Und alle anderen, denen nie Mut abverlangt wurde, weil sie in einem Land leben, das keine Helden nötig hat, sollten dankbar sein für das Glück, in solch einem Land leben zu dürfen. Das Buch möchte daher auch bewusst machen, wie wenig selbstverständlich Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Geschichte waren und wie hart dafür in anderen Regionen unserer Welt immer noch gekämpft werden muss. Eine Verfassung, wie wir sie seit mehr als sieben Jahrzehnten in Deutschland haben, ist eine Kostbarkeit. Wir sollten sie hegen und pflegen, denn sie erhält sich nicht von selbst.
Dafür braucht es zum Glück keinen Mut, schon gar keinen Heldenmut, nur manchmal ein bisschen Engagement und Zivilcourage. Wenigstens dazu sollten wir uns von den wirklich Mutigen anspornen lassen.
Weil oft vergessen wird, wie hart für die Freiheit gekämpft werden musste, erscheinen Geschichten darüber vielen als Gähn- und Abnick-Thema. Was soll daran schon interessant oder spannend sein? Für Frieden, Freiheit, Menschenrechte sind wir doch alle, wer dagegen ist, ist nicht ernst zu nehmen, und letztlich ist es für die betreffenden Freiheitskämpfer doch ein lukratives Geschäft. Irgendwann werden sie mit Ansehen, Preisen, Ehrungen und Geld überschüttet und ihre Bücher verkaufen sich bestens.
So zu denken ist man versucht, weil die meisten derer, die hier porträtiert werden, sich längst durchgesetzt haben und fast unumschränkt anerkannt sind. Selbst Simone de Beauvoir ist schon auf dem besten Weg, von ihren früheren Gegnern heiliggesprochen zu werden.
Tatsächlich aber war sie, wie jeder Kämpfer und jede Kämpferin für Freiheit, zu Beginn des Kampfes umstritten und angefeindet, sie ist verhöhnt, lächerlich gemacht und nicht selten auch bedroht worden. Wie Simone de Beauvoir haben deshalb die Porträtierten tatsächlich alle sehr viel Mut, Selbstbewusstsein, Durchhaltewillen, Stehvermögen, Unbeirrbarkeit und einen langen Atem gebraucht.
Und andere brauchen diese Kraft noch, wie etwa Maria Kolesnikowa, Swetlana Tichanowskaja und Veronika Zepkalo, denen es in Belarus beinahe gelungen wäre, gewaltlos das Regime des Diktators Alexander Lukaschenko hinwegzufegen. Ja, sie wurden mit Ehrungen überhäuft, aber Zepkalo muss mit ihrem Mann und ihren Kindern im Exil leben, Tichanowskaja sogar getrennt von ihrem Mann, der in Lukaschenkos Straflager gefangen gehalten wird. Und die Dritte im Bund, Maria Kolesnikowa, hätte leicht nach Deutschland fliehen können, wo sie in Stuttgart einen zweiten Wohnsitz hat und in Sicherheit wäre. Aber sie hat es vorgezogen, in Belarus zu bleiben, bei den vielen, die mit ihr gegen das Regime demonstriert haben, verprügelt, inhaftiert, gefoltert worden sind, und die außerhalb von Belarus kaum jemand kennt. Seit September 2020 ist sie nun selbst im Gefängnis.
Freiheit, Frieden, Menschenrechte werden nicht vom Christkind gebracht, sondern müssen unter Gefahr erkämpft werden, und sind verbunden mit Entzweiung, Streit, ja Hass. Daher sind Freiheitskämpfe nichts Romantisches. Freiheitskämpfer sind keine Helden, keine Ritter ohne Fehl und Tadel, auch wenn spätere Generationen stets dazu neigen, die Kämpfer zu verklären, Helden aus ihnen zu machen, sie zu Autoritäten aufzubauen. Das gelingt so gut wie immer, wenn sich die Rauchwolken schon lange verzogen haben.
Aber solange sie sich noch mitten im Kampfgetümmel befinden, und noch gar nicht sicher ist, ob sie ihren Kampf gewinnen, brauchen sie Unterstützer*innen, die selbst ein wenig des Mutes bedürfen, aber vor allem über ein sicheres Urteil verfügen und ein Wertegerüst, das nicht schon nach dem ersten Windstoß zusammenbricht. Dieses Buch will seinen Leser*innen helfen, sich solch ein sicheres Urteil zu bilden und die Werte kennenzulernen, die Orientierung geben können auch in schwierigen Lebenslagen.
Christian Nürnberger
1Joachim Gauck über »Die Liebe zur Wahrheit« in: Chrismon 05.2008, S. 24
Simone de Beauvoir
Ein Buch wird zum Anfang vom Ende des Patriarchats
* 1908 in Paris (Boulevard du Montparnasse Nr. 103) — 1913–1925 Besuch der katholischen Privatschule Cours Desir, Abschluss mit dem Abitur — 1925/26 Studium der Philologie am Institut Sainte-Marie in Neuilly und der Mathematik am Institut Catholique in Paris — 1928/29 Diplomarbeit über den Philosophen und Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz. Vorbereitung auf die agrégation (Lehrerlaubnis) an der Sorbonne und der École Normale Supérieure. Probezeit als Lehramtskandidatin am Lycée Janson-de-Sailly — 1929 Bekanntschaft mit Jean-Paul Sartre und Beginn ihrer Beziehung — 1943 Entlassung aus dem Schuldienst; Veröffentlichung ihres ersten Romans, L'Invitée (Sie kam und blieb) ab diesem Zeitpunkt freie Schriftstellerin — 1949 Veröffentlichung der Schrift Le Deuxième Sexe (Das andere Geschlecht) — † 14. April 1986 in Paris. Sie wird neben Jean-Paul Sartre auf dem Pariser Friedhof Montparnasse beigesetzt
Im Jahr 1949 ereignete sich etwas Außergewöhnliches, nur merkte es die Welt nicht. Es erschien ein Buch. Geschrieben von einer Frau. Die hieß Simone de Beauvoir. Heute, aus der Rückschau, wissen wir, dass diese Simone de Beauvoir nicht einfach nur ein Buch geschrieben, sondern eine Weltrevolution angestoßen hatte.
Allerdings hat es viele Jahre gedauert, bis die Welt darauf aufmerksam wurde, und noch länger, bis sich auf der Welt wegen dieses Buches etwas änderte.
Zunächst erregte sich nur eine kleine europäische, hauptsächlich Pariser Intellektuellen-Elite über dieses Buch. Auch eine kleine New Yorker Intellektuellen-Elite nahm aufgeregt Notiz davon. Aber in Paris wie in New York galt die Aufregung mehr dem Umstand, dass die Autorin unverheiratet mit einem Mann zusammenlebte, noch dazu mit einem, der schon berühmt war: dem Schriftsteller und Pariser Intellektuellen Jean Paul Sartre. Es war vor allem das Paar Beauvoir-Sartre, das die Aufmerksamkeit dann auch auf das Buch lenkte, dessen Inhalt irgendwie auch mit dieser nichtehelichen Verbindung zu tun hatte.
Aber die übrige Welt ging weiter ihren üblichen Gang. Der große Rest der Menschheit ignorierte das Buch und nahm auch von diesem Paar kaum eine Notiz. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass das Buch in seiner Wirkung und Bedeutung eigentlich nur mit Martin Luthers Thesenanschlag im Jahr 1517 zu vergleichen ist. Aber 1949, als dieses Buch erschien, konnte das noch niemand ahnen, nicht einmal die Autorin. Die Botschaft brauchte Zeit.
Der Titel lautete ziemlich unspektakulär: Le Deuxième Sexe (»Das zweite Geschlecht«). Klang nicht besonders griffig, schon gar nicht sensationell. In Deutschland erschien es 1951 unter dem Titel Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau. Auch kein Brüller. Kein Wunder, dass es bald schon entschlummerte in den Bibliotheken, wo es scheinbar verstaubte.
Scheinbar. Denn untergründig wirkte es weiter, und nach knapp anderthalb Jahrzehnten tauchte es wieder auf, wenn auch nur in Form eines anderen Buches. 1963 erschien in den USA: The Feminine Mystique von Betty Friedan (1921–2006). Daraus wurde ein Weltbestseller, der sich drei Millionen Mal verkaufte, in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde, 1966 auch auf Deutsch unter dem Titel Der Weiblichkeitswahn oder die Selbstbefreiung der Frau.
Ihm folgten weitere Bücher zum selben Thema. Dann noch mehr, und irgendwann nannte man das: Frauenliteratur. Was in ihnen drinstand, war inspiriert von dem einen Buch, das Beauvoir schon längst geschrieben hatte. Aber erst jetzt waren die Ohren dafür gespitzt. Erst jetzt haben sich Millionen Köpfe, vor allem weibliche, dafür geöffnet. Auch in Deutschland. Da lernte man nun, dass es etwas wirklich Neues gibt. Man nannte es: Feminismus. Und irgendwann sagte jemand, Simone de Beauvoirs Buch über das »andere Geschlecht« sei die »Bibel des Feminismus«.
Treffender hätte man es nicht sagen können. Es ist tatsächlich eine Bibel. Die Gegenbibel. Das Gegenbuch zum zentralen Buch unserer Kultur, in dem schon ganz am Anfang steht: »Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein.« So sprach angeblich Gott zu Eva nach dem Sündenfall, kurz vor der Vertreibung aus dem Paradies.
»Er soll dein Herr sein« – als jüdische Priester dies vor vielleicht 2.500 Jahren schrieben, mussten sie vermutlich nicht lange überlegen. In ihrer Umwelt unter den benachbarten Völkern herrschte schon immer der Mann über die Frau. Seit Jahrtausenden wurde nach dieser Regel gelebt in den alten Kulturen. Nicht nur den Männern, sondern auch den Frauen erschien es als etwas Natürliches, dass nur der Mann zählt und die Frau etwas ihm Untergeordnetes ist, fast so etwas wie seine persönliche Habe, sein Besitz, seine Viehherden.
Die Juden hatten vieles kritisiert und manches grundlegend anders gemacht als es bei ihren Nachbarn üblich war, aber an der Herrschaft des Mannes über die Frau rüttelten sie nicht. Im Gegenteil. Die jüdischen Priester verliehen dieser Herrschaft die göttliche Weihe. Was ihnen als natürliche Ordnung erschienen war, machten sie nun zur göttlichen Fügung. Und die christlichen Verfasser des Neuen Testaments, allen voran der Apostel Paulus, bekräftigten diese angeblich gottgewollte Ordnung.
Damit war in der jüdischen, christlichen und später auch islamischen Welt das Patriarchat zementiert. Es hat fast bis heute alles überdauert, was je gekommen war und wieder verschwunden ist. Weltreiche, Kaiser, Könige und Päpste kamen und gingen. Großartige Kunstwerke wurden erschaffen, viele wieder zerstört. Wertvolles Wissen haben die Menschen angehäuft und vieles wieder vergessen. Tempel, Dome, Paläste und glanzvolle Städte wurden gebaut und wieder dem Erdboden gleichgemacht. Es war ein vieltausendjähriges Werden und Vergehen. Nur eines verging nie, hielt sich durch alle Zeiten hindurch wie etwas Heiliges, Unantastbares, scheinbar Immerwährendes: die Vorherrschaft des Mannes.
Es schien keinen Grund zu geben, an dieser ältesten Herrschaftsform etwas zu ändern. Noch nicht einmal die neuzeitlichen Philosophen und Aufklärer hatten das patriarchale Prinzip infrage gestellt. Und auch die Frauen selbst nicht.
Bis auf eine: Olympe de Gouges. Sie war die Erste, die es dann doch gewagt hat, indem sie sich auf den Schlachtruf der Französischen Revolution von 1789 berief: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Schriftstellerin Olympe de Gouges (1748–1793) leitete daraus eine einfache, im Grunde triviale Dreisatz-Logik ab: Alle Menschen sind gleich. Frauen sind Menschen. Also sind Frauen den Männern gleich. Also stehen ihnen die gleichen Rechte zu – ein eigentlich für jedermann einfach nachzuvollziehender Gedanke. Und doch eine Idee, die um zwei Jahrhunderte zu früh kam.
Die Männer der Revolution waren unfähig, das Selbstverständliche an dieser Forderung zu erkennen. Ihre Menschenrechte wollten sie nur auf sich selbst angewandt sehen, auf den männlichen Teil der Menschheit, auf den männlichen weißhäutigen Teil der Menschheit, wie sich im weiteren Verlauf der Geschichte noch herausstellen sollte.
Vier Jahre nach ihrer Erklärung der Frauenrechte landete Olympe de Gouges auf dem Schafott, wurde vergessen. Im Jahr ihrer Hinrichtung verbot die Nationalversammlung die während der Revolution entstandenen Frauenclubs, später kam ein generelles Versammlungsverbot für Frauen hinzu.
Von den Fortschritten, die Napoleon gewaltsam in ganz Europa durchzusetzen versuchte, kam bei den Frauen nichts an. Der Ehemann war der gesetzliche Vormund seiner Frau, er durfte ihr nicht einmal eine Generalvollmacht erteilen, und die Ersparnisse der Frau gehörten dem Mann. Ertappte ein Mann seine Frau beim Ehebruch, war er berechtigt, sie zu erschießen. Vom aktiven und passiven Wahlrecht waren die Frauen noch lange ausgeschlossen.
Erst die Arbeiterbewegungen des 19. Jahrhunderts setzte die Frauenrechte wieder auf die Tagesordnung. Dabei ging es aber vor allem um das grundlegendste demokratische Recht überhaupt: das Wahlrecht. In Deutschland hatte es bis 1918 gedauert, bis Frauen wählen durften. Die Männerherrschaft ging trotzdem weiter, kam unter Hitler sogar noch einmal zu neuer Blüte, endete kurzzeitig in den Jahren vor und nach dem Kriegsende, als die »Trümmerfrauen« bewiesen, dass es auch ohne Männer geht. Aber mit der Heimkehr der Männer kehrte auch das Patriarchat wieder zurück.
In Deutschland herrschte es noch rund 30 Jahre unangefochten weiter. Dann kamen die Frauen, die dem Neuen anhingen und sich als Feministinnen bezeichneten, was in konservativen Kreisen schon bald zu einem Schimpfwort wurde. Feminismus galt als ideologieverdächtig, was so viel hieß wie: einseitige und darum falsche Betrachtungsweise der Welt im Allgemeinen und des Geschlechterverhältnisses im Besonderen.
Damit war der Kampf eröffnet. Er dauert bis heute an, und die Feministinnen gewannen eine Schlacht nach der anderen. Heute können junge Frauen gar nicht glauben, was ihre Mütter und Großmütter über ihre Jugend erzählen. Wenn sie sich heute die Werbung der 50er- und 60er-Jahre anschauten, sähen sie: Frauen waren verheiratete Hausfrauen und Mütter. Und wer von ihnen auf die verwegene Idee kam, einen Beruf auszuüben, brauchte dafür die Erlaubnis des Ehegatten.
Eine Frau als Ingenieurin, Professorin, Soldatin, Boxerin, Rennfahrerin, Astronautin, gar Ministerin oder Bundeskanzlerin – unvorstellbar. Eine Frau, die unverheiratet mit einem Mann zusammenlebt – undenkbar. Eine Frau, die ein uneheliches Kind gebiert – eine Schande. Eine Frau, die bei ihrer Heirat ihren Namen behält – Quatsch. Eine Frau mit eigenem Bankkonto – Unsinn.
Mädchen durften in der Schule keine Hosen tragen. Selbst einer erwachsenen Frau, wie der Sängerin Esther Ofarim ist 1966 in Hamburg der Zutritt zu einer Bar verwehrt worden, weil sie einen Hosenanzug trug, erzählt Elke Heidenreich. »Und meine Freundin Senta durfte 1969 in einem Damensmoking, den Yves Saint-Laurent kurz zuvor erfunden hatte, in London in einem Hotel nicht in den Speisesaal. CSU-Bundestagsvizepräsident Richard Jaeger drohte 1970, er werde jede Frau, die in Hosen im Parlament erschiene, aus dem Saal jagen.«
All dies ist heute unvorstellbar für junge Frauen. Heute mühen sich jüdische und christliche Theologinnen, die scheinbar klaren Ansagen der Bibel zu relativieren. Sie präsentieren biblische Fundstellen, die belegen sollen, dass die Bibel als Ganzes vielleicht dem Buchstaben das Patriarchat begründet, aber doch nicht dem Geist nach.
Dieser Geist sei frauenfreundlich, sagen sie, und tatsächlich war Jesus frauenfreundlicher als Paulus, und im Judentum hatte die Frau in manchen Bereichen schon immer eine stärkere Stellung als in anderen Religionen. Daher interpretieren jüdische und christliche Theologinnen die Bibel heute so, als ob Gott schon immer die Gleichberechtigung der Geschlechter gewollt habe und dieser Wille nur verfälscht worden sei von jüdischen und christlichen Theologen.
Aber dass sie das tun, ist nicht das Verdienst innerkirchlicher Aufklärung, sondern außerkirchlicher Kritik. Der Anstoß, die Bibel neu zu lesen und Gott frauenfreundlicher erscheinen zu lassen, kam nicht aus der Bibel der Juden und Christen, sondern: aus der Bibel des Feminismus, geschrieben von Simone de Beauvoir.
Dieses Buch war zum einen ein Skandal und zum anderen der große Donnerschlag gegen das Patriarchat. Wenn wir heute über Quoten und Frauenrechte reden, die Berufstätigkeit der Frau fast allen Menschen im westlichen Kulturkreis als etwas Selbstverständliches erscheint, und überall Gleichstellungsbeauftragte darüber wachen, dass der Frau aufgrund ihres Geschlechts kein Nachteil erwächst – dann ist das und noch vieles mehr vor allem das Verdienst der französischen Philosophin und Schriftstellerin Simone de Beauvoir.
Auch sie hatte einen Satz geprägt, den man als Revolutions-Motto ähnlich bedeutenden Sätzen gleichstellen kann: »Man wird nicht als Frau geboren, man wird es.« In seiner Bedeutung ist er ähnlich geschichtsträchtigen Sätzen aus anderen Groß-Zeitenwenden mindestens ebenbürtig, wie zum Beispiel:
–»Erkenne dich selbst« – antike griechische Philosophie.
–»Werde, der du bist« – griechischer Dichter Pindar, von Friedrich Nietzsche übersetzt.
–»Hier stehe ich, ich kann nicht anders« – Martin Luther.
–»Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen« – Immanuel Kant.
–»Nicht das Bewusstsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewusstsein« – Karl Marx.
Und genau solche Sätze hatten es der französischen Philosophin angetan. Sie hatte den Mut, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Sie hatte kritisch gefragt: Was, wenn es der Frau verboten wäre, die zu werden, die sie ist? »Was, wenn du selbst zu werden dich zur Zielscheibe von Gespött, Bosheit und Scham macht?«
Durch gründliches Nachdenken über solche Fragen ist sie zu jenen verblüffenden Schlüssen, provokanten Erkenntnissen und skandalträchtigen Schlussfolgerungen gekommen, die den Sturz des Patriarchats einleiteten. Erstmals hatte eine Frau konsequent und radikal darüber nachgedacht, was es heißt, eine Frau zu sein, was es für Frauen bedeutet, vom Mann gegängelt, bevormundet, angebetet, verachtet, idealisiert, mythisiert, definiert und penetriert zu werden.
Simone de Beauvoir ging es damals noch nicht primär um gleichen Lohn für gleiche Arbeit, um Bildungschancen und um politische Rechte, sondern um etwas viel Grundsätzlicheres: die tatsächlichen und vermeintlichen Unterschiede in der Biologie des Mannes und der Frau. Und um die Frage, ob diese biologischen Unterschiede tatsächlich eine Rechtfertigung sein können für die aus ihr abgeleiteten Rollenzuweisungen für Männer und Frauen.
Mit welchem Recht wird die Frau auf eine Trösterin und Pflegerin reduziert, ins Haus verwiesen, zur Mutterschaft verpflichtet? Wer definiert das Wesen der Frau? Mit welcher Begründung? Zu welchem Zweck?
Bis heute versuchen Männer noch immer, die herkömmliche Rollenverteilung mit dem grundsätzlichen Anderssein der Frau zu begründen. Immer wieder bemühten und bemühen sie die Biologie, die Natur und das Tierreich, um die Weisheit und Zweckmäßigkeit der in vielen Jahrtausenden bewährten Geschlechterordnung zu erklären.
Sie verstehen nicht, dass es nicht um Zweckmäßigkeit geht, nicht um Biologie und noch nicht einmal um Glück, sondern um Würde, ja um Gottebenbildlichkeit. Männer, die nur unter der Bedingung mit Frauen leben können, dass diese sich ihnen unterordnen und zu ihnen aufblicken, sind davon um eine ganze historische Epoche weiter entfernt als Männer, die mit Frauen auf gleicher Augenhöhe leben möchten.
Dasselbe gilt andersherum. Auch Frauen, die zu einem Mann aufblicken und sich ihm unterwerfen möchten, sind von dieser Gottebenbildlichkeit noch Lichtjahre weiter entfernt als die anderen. Und eine wichtige Etappe zu diesem Ziel der Gottebenbildlichkeit heißt nun mal Freiheit, Gleichheit, Menschenwürde.
Darum sind Diskussionen über die Biologie der Frau überflüssig. Es genügt der Hinweis auf das Grundgesetz.
Dort steht, niemand dürfe wegen seines Geschlechts benachteiligt werden. Wenn also eine Frau Boxerin, Fußballerin oder Soldatin werden will, dann hat die Gesellschaft nicht zu sagen, aber das gehört sich doch nicht für eine Frau, sondern dann hat die Gesellschaft die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Frau Boxerin, Fußballerin oder Soldatin werden kann. Und wenn eine Frau sagt, dass sie genau wie die Männer einen Beruf und eine Familie haben will, dann hat die Gesellschaft der Frau nicht zu sagen, aber du gehörst doch ins Haus zu den Kindern, sondern hat dafür zu sorgen, dass das Recht der Frau auf Familie und Beruf respektiert wird. Weil es nun mal im Grundgesetz steht.
Daraus folgt: Leben, Wirtschaft und Arbeit müssen so organisiert werden, dass Frauen Kinder haben und zugleich einen Beruf ausüben können – so, wie es die Männer schon immer können.
Eigentlich ein selbstverständlicher Gedanke. Und doch war es ein weiter Weg vom 1949 formulierten Satz »Man wird nicht als Frau geboren, man wird es« bis heute. Und der Weg ist noch lange nicht zu Ende.
Aber dass Frauen ihn gegen alle Widerstände gehen, verdanken sie diesem Satz und vor allem der Tatsache, dass Simone de Beauvoir diesen Satz in allen Facetten durchdacht und vor keinem Tabu haltgemacht hatte, auch nicht vor Sex. Sie schrieb über weibliche und männliche Geschlechtsteile, über ihre eigene Sexualität, ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse – und das in wissenschaftlichen Aufsätzen und Büchern zu einer Zeit, als die Sexualität noch tief tabuisiert war.
Daher galt sie als Skandal-Autorin. »Ich habe alles über die Vagina Ihrer Chefin erfahren«, sagte der christliche Schriftsteller François Mauriac, mehr empört als spöttisch, zu einem Mitarbeiter von Simone de Beauvoir nach der Lektüre ihres 900 Seiten dicken Buches. Die katholische Kirche hatte das Buch gleich schon mal auf den Index gesetzt.
Sogar Beauvoirs Freund, der Schriftsteller Albert Camus, tobte, sie habe den französischen Mann lächerlich gemacht. Unbefriedigt und frigide sei sie, wüteten ihre Kritiker, lesbisch, männermordend sei sie, las man in den Medien.
All das kümmerte sie nicht. Sie schrieb einfach, was sie dachte, worüber sie nachdachte, und zu welchen Ergebnissen sie dabei kam. Und ein Ergebnis war eben dieser berühmte und gar nicht so eindeutige, fast rätselhafte Satz: »Man wird nicht als Frau geboren, man wird es.«
Über lange Zeit machten es sich viele zu einfach mit diesem Satz und übersetzten ihn ungenau und interpretierend zu: »Man wird nicht als Frau geboren, sondern zur Frau gemacht.« Aber so hatte Beauvoir es nicht geschrieben.
Zwar stimmt schon: Mädchen werden vom Tag der Geburt an zur Frau gemacht in der Familie und in der Gesellschaft.
Aber, sagte Beauvoir, das müsse nicht so sein. Dass die Manipulation gelingt, setzt voraus, dass die, die manipuliert wird, sich manipulieren lässt. So eine wird dann zu jener gesellschaftlich gewollten Frau, weil sie es mit sich geschehen lässt, oder es sogar will. Deshalb hat Beauvoir schon sehr bewusst so genau formuliert: »Man wird nicht als Frau geboren, man wird es.«
Man wird es aufgrund der äußeren Einflüsse, die auf einen Menschen einwirken: Elternhaus, Schule, Kirche, Staat, Peergroups, Kino, Fernsehen, Bücher, Zeitungen. Man wird es aber auch aufgrund der eigenen Entscheidungen. Mit zunehmendem Alter kann ein Mädchen immer besser erkennen, wie es von äußeren Mächten geformt wird – und kann dann irgendwann entscheiden, ob es sich das widerstandslos gefallen lässt, um der patriarchalen Gesellschaft zu gefallen. Oder ob es sich bewusst widersetzt, um ein eigenständiger, selbstbewusster Mensch zu werden, der so unabhängig vom Mann existieren kann, wie dieser schon immer unabhängig von der Frau sein Leben führen kann – egal ob sie der »Gesellschaft« gefällt oder nicht.
Das ist ein komplizierter Prozess, denn natürlich muss ein Mensch zunächst einmal überhaupt befähigt sein, die Welt nicht einfach so hinzunehmen, wie sie ist. Dazu braucht es ein Mindestmaß an Bildung. Ohne sie wird ein Mädchen niemals vordringen zu der Frage: Will ich das, eine Frau werden, wie andere sie haben wollen? Es gibt unzählige Bildungsbiografien, in denen ein Mensch nie an diesen Punkt gelangt, an dem er bewusst sein Schicksal in die eigene Hand nehmen kann.
Was das betrifft, hatte Simone de Beauvoir Glück. Geboren und aufgewachsen in einem der besten Pariser Viertel (103 Boulevard du Montparnasse), Vater Anwalt, Mutter Bankierstochter, adliger Hintergrund, Dienstbotin im Hause, katholische Mädchenschule, Klassenbeste, Ferien auf dem Schloss, wenn auch ohne Strom und ohne Wasser aus der Leitung – daraus ließ sich etwas machen, wenngleich die Eltern so konservativ waren, wie man eben damals war, wenn man adlig geboren wurde. Als ein zweites Kind unterwegs war, hofften die Eltern und die ganze Verwandtschaft, dass es nun aber ein Junge würde. Doch leider, auch wieder nur ein Mädchen – Simones Schwester Hélène. Die Großeltern schrieben ergeben: »Wir fügen uns Gottes Willen.«
Man war streng katholisch in der sozialen Welt Simones. Ihre Kindheit stand unter den zwei Geboten: »Du sollst nicht tun, was ungebührlich ist« und »Du sollst nicht lesen, was ungebührlich ist«. Egal, es gab genug zu lesen, was sich gehörte.
Aber vor allem: Es gab da einen grundlegenden Widerspruch im Leben der Eltern. Gutkatholisch war nur die Mutter, der Vater aber war Atheist. Bücher bekam Simone von beiden, vom Vater jedoch ganz andere als von der Mutter. Und ihren Vater beschrieb sie als witzig, belesen, elegant, der wunderbar Gedichte aufsagen und leidenschaftlich debattieren konnte.
Ihr Vater stellte für sie eine kleine Anthologie mit Gedichten zusammen und brachte ihr bei, sie »mit Betonung« aufzusagen. Ihre Mutter wiederum schenkte ihr ein Buchabonnement und verschaffte ihr Zugang zu mehreren Bibliotheken.
Sie war also eine Tochter aus gutem bildungsbürgerlichen Haus, jedoch eine, deren Eltern durch eine Verkettung unglücklicher Umstände – Krieg, Revolution in Russland, vernichtetes Aktienvermögen, eine nicht ausbezahlte Mitgift – in eine wirtschaftlich prekäre Lage kamen, ausziehen mussten aus der standesgemäßen Umgebung. Die elfjährige Simone und ihre Schwester lebten nun in einer armseligen Wohnung im fünften Stock, dunkel und schmutzig, ohne Aufzug und fließendes Wasser, kein Bad, keine Zentralheizung.
Aber auch das hatte einen Bildungseffekt: Das Mädchen machte nun Bekanntschaft mit den Härten des Lebens und mit der Armut, und lernte zugleich, sich davon nicht unterkriegen zu lassen und die Armut in Würde zu ertragen.
Schließlich der christliche Glaube, den das Mädchen Simone ernst nahm, und über den sie als 57-jährige Frau einmal sagte, dass er dazu geführt hatte, sich selbst als »eine Seele« wahrzunehmen, was hieß: nicht männlich, nicht weiblich, sondern Mensch. Gott macht keinen Unterschied, dachte die kleine Philosophin.
Aber da draußen in der Welt, so lernte das Mädchen im Lauf der Zeit, da wird der Unterschied gemacht. Und nicht nur da draußen. Auch drinnen, in ihrer eigenen Familie, erkannte sie ab ungefähr dem elften Lebensjahr jene Unterschiede, die sich dann im Lauf der Jahrzehnte zu dem einen großen Unterschied verdichteten.
Es fing damit an, dass man sie einerseits dazu erzogen hatte, altklug zu sein, zu lesen und alles zu hinterfragen. Andererseits erkannte sie bestürzt, dass eben dies von ihrer Umwelt und ihrer Familie umso weniger erwartet wurde, je älter sie wurde. Mädchen und junge Frauen wurden auf ihre Rolle als Ehefrau und Mutter vorbereitet. Deshalb hatten sie den Männern zu gefallen und durch »weibliche Eigenschaften« aufzufallen, Zurückhaltung, Hingabe, Fürsorglichkeit, Bildung. Selbstständiges Denken, gar Widerspruch gegen den Mann, Kritik waren nicht gefragt.
Weitere Widersprüchlichkeiten in der eigenen Familie schärften zusätzlich ihren Sinn für die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Der Mann hatte die Rolle des Ernährers der Familie zu spielen. Aber was, wenn er, wie Simones Vater, diese Rolle zunehmend schlechter und zuletzt gar nicht mehr ausfüllt? Kein Vermögen, mal hier ein Job, mal da einer, zuletzt fast gar keiner mehr. Dafür spielte er schon Bridge am Nachmittag, gab das wenige Geld, das er noch verdiente, zu einem Großteil fürs Trinken und Spielen aus, und machte seiner Frau Szenen, wenn sie Haushaltsgeld von ihm verlangte. In der Nacht hörten sie und ihre Schwester, wie sich die Eltern über Bordelle, Geliebte und Glücksspiele stritten.
Später im Leben thematisierte Beauvoir, in welche Zerrissenheit Frauen geraten können durch die ihnen diktierte Rolle. Sie hatte es ja bei ihrer eigenen Mutter erlebt.
Einerseits versuchte diese ihre Rolle als pflichtgetreue Gattin zu spielen. Andererseits fragte sie sich, warum sie da mitspielen sollte, wenn der Gatte seine Rolle des Ernährers nicht erfüllt. Aber sie hatte keine Antwort darauf. Sie spielte einfach immer weiter mit und heroisierte dieses Mitspielen als Opfer, das sie der Familie brachte.
Doch war es, wie Simone irgendwann erkannte, kein freiwilliges, aus Souveränität erbrachtes Opfer, sondern ein erzwungenes, eines, das erbracht wurde aus Mangel an anderen Gelegenheiten. Das führte dann bei Simones Mutter, wie bei vielen anderen Frauen dieser Generation auch, zu Bitterkeit und einem ständigen Aufbegehren gegen den Zwang und die Entbehrungen, denen sie sich doch unterwarf.
Schon früh wurde Simone also mit der Frage konfrontiert, wie eine Frau denn diese entgegengesetzten Wünsche – hier ein Leben in Hingabe an andere führen, da ein eigenes Leben haben – in Einklang bringen soll. »Sie sollte eine der zentralen Fragen von Beauvoirs Tagebüchern als Studentin, ihrer existenzialistischen Ethik und ihres Feminismus werden.«
Darüber wurde Simone zur großen Philosophin. Immer schärfer sah sie diese Widersprüche, immer schärfer den gemachten Unterschied zwischen Mann und Frau. Er rückte so in ihr zentrales Blickfeld, dass sie sich systematisch zu fragen begann: Woher kommt er? Was erhält ihn aufrecht? Warum erscheint er allen als so natürlich und normal, obwohl er doch das Gegenteil von normal ist?
Allmählich erkannte sie, dass Frauen etwas Ähnliches widerfuhr wie nicht-weißen Menschen. Die wurden aufgrund körperlicher Merkmale, wie etwa Hautfarbe, bestimmten »Rassen« zugeordnet, und von da an war es dann nur noch ein kurzer Weg, Menschen bestimmten Kasten zuzuordnen und so etwas wie Sklavenkasten zu schaffen.
Genau das Gleiche haben die Männer mit den Frauen gemacht. Sie haben sie als »andere« definiert und sie damit auch in eine andere Kaste verbannt: das andere Geschlecht. Eine Frau ist, was ein Mann nicht ist. Der Mann ist die Norm, das Maß aller Dinge, seine Sicht der Dinge die objektive und wahre. Er definiert, wie ein Mann zu sein hat, und wie eine Frau. Er ist als Mann an sich interessant. Die Frau jedoch ist nur interessant in Bezug auf ihn.
Bei theoretischen Diskussionen habe es sie manchmal geärgert, von Männern gesagt zu bekommen: »Sie denken das und das, weil Sie eine Frau sind.« Ihr sei sofort klar gewesen, dass sie darauf keinesfalls entgegnen durfte: »Und Sie denken das Gegenteil, weil Sie ein Mann sind.« Nein, die richtige Antwort konnte nur lauten: »Ich denke es, weil es stimmt.«
Es gibt zwar weibliche und männliche Sichtweisen, aber nicht weibliche und männliche Wahrheiten, sondern immer nur die eine Wahrheit, die jedoch durch die Brille des Mannes anders wahrgenommen wird als durch die Brille der Frau. Das Problem ist nur: Der Mann weiß nicht, dass er die Männerbrille aufhat. Er denkt, dass die Welt objektiv so sei, wie sie sich ihm durch die Brille, von der er nichts weiß, darstellt. Und wenn dann die Frauen mit ihrer Sicht der Wirklichkeit dagegenhalten, sich eingestehend, dass sie die Frauenbrille aufhaben, sagen die Männer: Ja eben, darum könnt ihr die Welt ja nicht so sehen, wie sie ist. Es hat lange gedauert, bis die Männer lernten, dass auch sie Brillenträger sind.
Das Schlimmste aber war, dass zu der Zeit, als Beauvoir ihr Buch schrieb, die Frauen selbst geglaubt hatten, dass ihre weibliche Sicht auf die Welt nicht so objektiv richtig sein konnte wie die männliche. Darum setzten sie sich freiwillig die Männerbrille auf, um die Welt so zu sehen, wie die Männer. Und zwar in einem ganz umfassenden Sinn:
»Die Frau versucht, mit seinen Augen zu sehen. Sie liest die Bücher, die er liest. Sie zieht die Bilder, die Musik vor, die er vorzieht. Sie interessiert sich nur für Landschaften, die sie gemeinsam mit ihm sieht, für Gedanken, die von ihm kommen. Sie übernimmt seine Freundschaften, seine Feindschaften, seine Meinungen.«
Diesem Schicksal wollte Simone de Beauvoir unbedingt entgehen. Daher verweigerte sie Ehe und Mutterschaft, führte ein selbstbestimmtes Leben als Schriftstellerin. Auch wieder ein Skandal. Und als ob ihr das noch nicht reichte, tat sie etwas noch Skandalöseres: Sie war dauernd mit dem Philosophen Jean Paul Sartre zusammen, wohnte zeitweise bei ihm, dann wieder nicht, unterhielt eine lebenslange Beziehung zu ihm, zeitweise aber auch zu anderen Männern und sogar zu Frauen. Aber kehrte immer wieder zurück zu Sartre, wurde mit ihm ein weltberühmtes Paar und mit diesem Leben erregte sie zunächst viel mehr Aufsehen als mit ihrem Buch.
Kein Wunder. Das Buch ist ein dicker Brummer, nicht einfach zu lesen, und außerdem war ja niemand da, der sich der Sache annehmen und ihr Thema im öffentlichen Bewusstsein hätte halten können. Die Wissenschaft, die Verlage, die Zeitungen, die Zeitschriften, das Radio und später das Fernsehen bestanden aus Männern, die noch nicht wussten, dass sie die Männerbrille tragen.
Ihnen erschien daher Sartre klüger, tiefer, bedeutender als die Frau an seiner Seite, die sie allenfalls als interessantes Beiwerk wahrnahmen, als Sartres unkonventionelle Muse, Geliebte, Verehrerin. Er, Sartre, wurde auch allein, für sich wahrgenommen, sie immer nur in Verbindung mit ihm. Zusammen aber faszinierten sie ihre Umwelt, weil sie sich um bürgerliche Konventionen nicht scherten und ein irgendwie existenzialistisches, exotisches, provokantes Leben führten, das aber nur lebbar war in der Pariser Boheme, nicht für Herrn Hinz und Frau Kunz in den Provinzen dieser Welt.
Beauvoirs Buch wartete unterdessen auf seine Neu-Entdeckung, die dann in den USA erfolgte durch Betty Friedan. In deren Buch über den Weiblichkeitswahn stand kaum etwas, was nicht auch schon bei Beauvoir gestanden hätte, nur kürzer, verständlicher und auf einen kleineren Ausschnitt konzentriert.
Friedan hatte sich vor allem auf die Frau in ihrer Rolle als Hausfrau beschränkt und mit ihrem Buch etwas auf den Begriff gebracht, was viele Frauen in den USA, wie auch in anderen wohlhabenden Ländern damals untergründig fühlten, jedoch nicht formulieren konnten. Sie klagten, aber unbestimmt, waren unzufrieden, aber konnten nicht sagen, was ihnen fehlt. Und dabei hatten sie doch alles: Staubsauger, Kühlschrank, Fernseher, Auto, Eigenheim und sämtliche Wasch- und Putzmittel, um dieses Paradies sauber zu halten.
Nur empfanden sie das Paradies als Käfig, und auch wenn dieser golden war, wurden sie geplagt von einem Gefühl der Langeweile und der Leere. Viele verfielen dem Alkohol oder wurden tablettensüchtig. Es war, als ob sie auf jemand warteten, der ihr Leiden auf den Begriff bringt.
Das hat dann Betty Friedan getan. Sie sagte, was ihnen fehlte: Freiheit. Ein selbstbestimmtes Leben. Verwirklichung im Beruf. Unabhängigkeit vom Mann. Ein eigenes Leben auf Augenhöhe mit dem Mann. Dafür öffnete Betty Friedan den Frauen die Augen, und plötzlich sahen sie: Ihr Leben ist eine Vorstadthölle. Und da begann er, der Kampf der Frauen um Gleichberechtigung.
In Deutschland begann dieser Kampf mit einem Tomatenwurf während des Frankfurter Bundeskongresses des SDS (Sozialistischer Studentenbund Deutschland) im Jahr 1968. Das war das berühmte Jahr, in dem weltweit die Student*innen aufbegehrten gegen alte Autoritäten, den Muff von tausend Jahren unter den Talaren, gegen Konventionen, Traditionen, den Vietnamkrieg und die globale Vorherrschaft der USA. Man träumte vom Sozialismus. Wieder einmal ging es um die Gleichheit aller Menschen.
Aber die Frauen rochen den Braten, merkten schnell, dass sie von den Männern, ihren Genossen, die von Gleichheit schwadronierten, schon wieder ausersehen waren, die zweite Geige zu spielen, den Kaffee zu kochen, die Stube zu putzen, die Flugblätter zu tippen, die ihnen die Genossen diktierten. Und nach getaner politischer Arbeit hatten sie als Sex-Objekte zur Verfügung zu stehen.
Und da beförderte die Romanistikstudentin Sigrid Damm-Rüger ihre Tomaten dem Theoretiker Hans-Jürgen Krahl ins Gesicht, beschuldigte ihn als Frauenfeind und schrie: »Genosse, du bist objektiv ein Konterrevolutionär!« (Der Spiegel)
Es ging den Studenten um die Herrschaft im Staat, gerechte Verhältnisse, Gleichheit, ein grundsätzlich anderes Leben. Darum ging es den Studentinnen auch, zusätzlich aber auch um das Verhältnis des weiblichen Wesens zu jenem, das einen Penis trägt. Der »Frankfurter Weiberrat« beantragte, die »sozialistischen Eminenzen« von ihren »bürgerlichen Schwänzen« zu befreien. Der Geschlechterkampf war eröffnet.
Es dauerte dann nicht mehr lange, bis eine andere junge, unbekannte Frau auf den Plan trat, von der man damals nicht genau sagen konnte, was sie eigentlich ist: Studentin, freie Journalistin, Jobberin, Aktivistin der 68er-Szene?



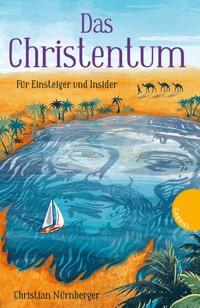















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









