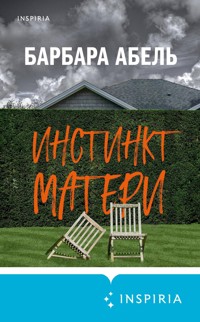10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die Inspiration für den großen Kinofilm »Mothers' Instinct« mit Anne Hathaway und Jessica Chastain in den Hauptrollen
Psychothriller: Wenn beste Freundinnen erbitterte Feindinnen werden
Auf der einen Seite wohnen Tiphaine und Sylvain, auf der anderen Laetitia und David. Zwei Paare, Nachbarn, enge Freunde. Ihre Kinder wachsen gemeinsam auf, fast wie Zwillinge. Ein perfektes Kleinstadtglück. Bis ein einziger Moment alles verändert: Einer der Jungen stürzt aus dem Fenster und stirbt. Für die Mutter Tiphaine bricht eine Welt zusammen, und Laetitia, die auf der anderen Seite der Hecke das Unglück ansehen musste, ist geplagt von Schuldgefühlen. Die einstige Idylle entpuppt sich – vor allem für die Mütter – immer mehr als Hölle, Vorwürfe und Misstrauen machen sich breit, aus den besten Freundinnen werden Gegnerinnen …
Mutterinstinkt ist ein Roman mit soghafter Spannung, unerwarteten Wendungen und einem Finale, das unter die Haut geht - eine unheimliche Geschichte mit starken weiblichen Hauptfiguren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Ähnliche
Titel
Barbara Abel
Mutterinstinkt
Roman
Aus dem Französischen von Sophie Nieder
Insel Verlag
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel Derrière la hainebei Fleuve Noir, einem Imprint von Univers Poche.
eBook Insel Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 4925.
Erste Auflage 2022insel taschenbuch 4925Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen AusgabeInsel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2022© 2012, Fleuve Noir, département d’Univers PocheAlle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns aucheine Nutzung des Werks für Text und Data Miningim Sinne von § 44b UrhG vor.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagabbildung: Filmplakat zum Film Duellesvon Oliver Masset-Depasse, © TROÏKA, Paris
eISBN 978-3-458-77337-5
www.suhrkamp.de
Widmung
Tausend Dank an Jean-Paul,
der mir vom anderen Ende der Welt aus
eine wertvolle Hilfe gewesen ist.
Mutterinstinkt
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Sieben Jahre zuvor
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Mutter-Kind-Pass
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Mutter-Kind-Pass
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Mutter-Kind-Pass
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Mutter-Kind-Pass
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Mutter-Kind-Pass
Informationen zum Buch
Laetitia war es gelungen, perfekt einzuparken. Beim ersten Versuch. Ihre Stimmung verbesserte das jedoch nicht.
»Mach den Gameboy aus, Milo, wir sind da«, sagte sie mechanisch.
Der Junge auf der Rückbank war in sein Spiel vertieft.
Die junge Frau stieg mit ihrer Aktenmappe, Milos Schulranzen und zwei Einkaufstaschen aus dem Auto … und hatte keine Hand mehr frei, um dem Kind die Autotür zu öffnen. Sie klopfte mit dem Ellenbogen ans Fenster:
»Beeil dich, Milo, ich bin beladen wie ein Packesel!«
»Warte, ich muss noch speichern.«
Die unbequeme Haltung und ihr trödelnder Sohn brachten das Fass ihrer aufkommenden Wut endgültig zum Überlaufen.
»Milo!«, wiederholte Laetitia scharf, weil an jenem Tag außer dem Einparken rein gar nichts reibungslos verlaufen war. »Du steigst jetzt sofort aus, sonst gibt es eine Woche Gameboy-Verbot.«
»Ich komm ja schon!«, stöhnte er, ohne den Blick von der Konsole abzuwenden.
Er rutschte bis an den Rand der Rückbank, schob erst ein Bein und dann den Rest seines Körpers schleppend aus dem Wagen.
»Und wenn das nicht zu viel verlangt ist, kannst du auch noch die Tür zumachen!«
»Laetitia!«, rief jemand hinter ihr, und sie erstarrte. »Können wir kurz reden?«
Sie drehte sich um. Es war Tiphaine, die im Jogging-Outfit nur wenige Meter hinter ihr stand. Sie war verschwitzt von der Anstrengung, ihr Gesicht glänzte, und einige Haarsträhnen klebten an ihrer Stirn. Völlig außer Atem wartete sie auf eine Antwort, als diese ausblieb, ging sie zu Milo und wuschelte ihm durchs Haar.
»Na, mein Großer, wie geht es dir?«, fragte sie freundlich.
»Hallo Tante Tiph!«, antwortete der Junge und strahlte sie an.
Mit den Nerven am Ende ging Laetitia zwei große Schritte auf sie zu, packte ihren Sohn verärgert am Arm und stellte sich zwischen die beiden.
»Ich verbiete dir, mit ihm zu sprechen«, zischte sie zwischen den Zähnen hervor.
Tiphaine nahm diesen Angriff hin, ohne mit der Wimper zu zucken.
»Laetitia, bitte … Ich möchte mit dir reden.«
»Milo, geh ins Haus!«, wies ihn seine Mutter an.
»Mama …«
»Du gehst jetzt rein, habe ich gesagt!«, befahl sie in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete.
Milo zögerte und ging dann schmollend ins Haus. Sobald er drinnen war, wandte sie sich wieder Tiphaine zu:
»Ich warne dich, du geistesgestörtes Miststück, wenn ich dich noch einmal in seiner Nähe erwische, kratze ich dir die Augen aus!«
»Laetitia, wenn du nicht verstehst, dass ich niemals …«
»Halt den Mund!«, zischte sie. »Spar dir deine billigen Ausreden, ich glaube dir kein Wort!«
»Ach nein? Und was glaubst du?«
Laetitia warf ihr einen eisigen Blick zu.
»Ich weiß genau, was du vorhast, Tiphaine. Aber ich warne dich: Das nächste Mal, wenn Milo etwas passiert, egal was, rufe ich die Polizei!«
Tiphaine schien ehrlich erstaunt. Sie sah Laetitia fragend an, während sie versuchte, den Sinn ihrer Worte zu begreifen. Als sie verstand, dass Laetitia ihre Meinung nicht ändern würde, stieß sie einen tiefen Seufzer aus, um zu zeigen, welchen Schmerz das Gebaren ihres Gegenübers in ihr auslöste:
»Ich weiß nicht, was das für ein paranoides Delirium ist, in das du dich da gerade verrennst, aber eins ist sicher, du liegst völlig daneben. Bitte versuch wenigstens, mir ein bisschen zu glauben. Wenn nicht für mich, dann tu es für Milo. Du bist gerade dabei, ihn langsam aber sicher zugrunde zu richten …«
Laetitia zog spöttisch eine Augenbraue hoch, und für einen Moment erschien ein grausamer Glanz in ihren Augen, wie ein Blitz, der die grauen Gewitterwolken durchbricht.
»Natürlich! Du weißt schließlich genau, wie man ein Kind zugrunde richtet«, sagte sie in einem nahezu sanften Ton.
Die Ohrfeige traf Laetitia unerwartet. Kaum hatte sie den Satz beendet, landete Tiphaines Hand mit einem lauten Knall auf ihrer Wange. Sie starrte Tiphaine mit weit aufgerissenen Augen an. Die Einkaufstüten und Taschen in ihren Händen waren tonnenschwer, sie ließ sie fallen und fasste sich stumm an die Wange.
»Das darfst du nicht!«, rief Tiphaine wutentbrannt und den Tränen nahe, als ob sie ihren Schlag rechtfertigen wollte.
Einen Augenblick lang sahen sich die beiden Frauen an, bereit, aufeinander loszugehen. Das wäre vielleicht auch passiert, wenn nicht ein Ruf der hasserfüllten Konfrontation ein Ende gesetzt hätte.
»Laetitia!«
Auf der Türschwelle des Hauses, in dem Milo kurz zuvor verschwunden war, erschien ein Mann und kam auf sie zu. David fasste Laetitia sofort bei den Schultern und stellte sich schützend vor sie.
»Sie hat mich geohrfeigt!«, schrie sie auf, noch unter dem Schock des Angriffs.
»Manchmal tun Worte mehr weh als eine Ohrfeige«, stammelte Tiphaine, selbst erschrocken über die Richtung, die diese Auseinandersetzung genommen hatte.
David bedachte sie mit einem harten Blick, suchte nach den passenden Worten und zeigte drohend mit dem Finger in ihre Richtung.
»Diesmal bist du zu weit gegangen, Tiphaine! Wir werden Anzeige erstatten.«
Tiphaine biss die Zähne zusammen, doch es gelang ihr nicht, die Gefühle, die in diesem Moment in ihr tobten, zu verbergen. Es dauerte ein paar Sekunden, bis sie sich wieder unter Kontrolle und die Tränen hinuntergeschluckt hatte, dann nickte sie vielsagend.
»Wie du willst, David. Der große Unterschied zwischen euch und mir ist nämlich, dass ich nichts mehr zu verlieren habe.«
Nachdem er die auf dem Bürgersteig verstreuten Taschen aufgesammelt hatte, zog David Laetitia mit sich ins Haus und knallte die Tür hinter ihnen zu. Tiphaine zitterte am ganzen Körper und brauchte noch einen Augenblick, um sich zu beruhigen.
Dann ging auch sie zur Tür ihrer Doppelhaushälfte und zog die Schlüssel aus der Tasche ihrer Jogginghose.
Sieben Jahre zuvor
Kapitel 1
»Prost!«
Drei erhobene Gläser, zwei davon mit Champagner und eines mit Wasser, stießen klirrend aneinander. David und Sylvain tranken in kleinen Schlucken, der Champagner prickelte in ihren Kehlen. Laetitia hingegen stellte ihr Glas ohne weitere Umstände gleich wieder ab und streichelte ihren Bauch, der schon verdächtig rund war.
»Hast du gar keinen Alkohol getrunken, seit du schwanger bist?«, fragte Sylvain.
»Keinen Tropfen!«, antwortete Laetitia stolz.
»Meine Frau ist eine Heilige«, neckte David sie liebevoll. »Du kannst dir gar nicht vorstellen, was sie sich alles antut, um unserem Sohn den besten Start ins Leben zu bieten: keinen Alkohol, kein Salz, kein Fett, kaum Zucker, gedämpftes Gemüse, tonnenweise Obst, kein rotes Fleisch, viel Fisch, Yoga, Schwimmen, klassische Musik, früh ins Bett gehen …«
Er seufzte und fuhr fort:
»Seit sechs Monaten führen wir ein unglaublich langweiliges Leben!«
»Ich bin keine Heilige, sondern schwanger, das ist nicht das Gleiche!«, erwiderte Laetitia und bestrafte die scherzhafte Bemerkung ihres Mannes mit einem Klaps auf seinen Schenkel.
»Und dann liegt sie mir auch noch mit ihren pädagogischen Prinzipien in den Ohren … Der arme Junge! Er wird nicht viel zu lachen haben!«
»Ihr sprecht schon über seine Erziehung?«, fragte Sylvain erstaunt.
»Natürlich!«, erwiderte Laetitia ganz ernsthaft. »Wir werden nicht erst anfangen, darüber nachzudenken, wie man die Probleme löst, wenn sie schon im Raum stehen.«
»Und worüber sprecht ihr so?«
»Über alles Mögliche: als Team agieren, sich niemals vor dem Kind widersprechen, keine Süßigkeiten vor dem vierten Lebensjahr, keine Cola vor dem siebten Lebensjahr, kein Gameboy vor dem elften Lebensjahr …«
»Ich glaube, wir werden ihm bald anbieten, dass er zu uns kommen kann, wenn er es bei euch zu schwer hat!«
David schaute auf die Uhr.
»Wir hätten mit dem Anstoßen auf deine bessere Hälfte warten sollen«, sagte er zu Sylvain. »Sie wird enttäuscht sein, dass wir ohne sie angefangen haben.«
»Aber nein, erstens hasst sie Champagner, und zweitens hat sie selbst gesagt, dass sie sich nicht hetzen will und dass wir nicht auf sie warten sollen. Sie ist zurzeit ein bisschen … erschöpft.«
»Warum trinken wir eigentlich Champagner?«, wollte Laetitia wissen. »Ein Gläschen Wein hätte es auch getan.«
Die Frage brachte Sylvain in Verlegenheit. Er stammelte »naja …«, »also …«, »wir haben uns gedacht …«, während er offensichtlich nach einer plausiblen Begründung suchte.
»Was? Was habt ihr euch gedacht?«, hakte Laetitia nach, die sich darüber amüsierte, dass die Situation für ihren Freund so peinlich zu sein schien.
Seine Verlegenheit ließ sie Verdacht schöpfen: Um Champagner zu verschenken, braucht man eigentlich keinen Vorwand, und um Champagner zu trinken erst recht nicht … oder doch, eigentlich schon! Man bringt eine Flasche Champagner mit, wenn es gute Neuigkeiten gibt!
Laetitia schaute Sylvain misstrauisch an, sie spürte, dass da etwas im Busch war, und sie wollte dieses Etwas gerade aus dem Blattwerk hervorlocken, da begriff sie es plötzlich:
»Sie ist schwanger!«, schrie sie und richtete sich in ihrem Sessel auf.
»W… Was?«, stotterte Sylvain, dem die Situation immer unangenehmer wurde.
»Ihr bekommt ein Kind?«, rief David strahlend.
»Nein … naja … eigentlich …«
Ein Klingeln an der Haustür half ihm aus der Patsche, in die er sich immer tiefer hineinritt. Laetitia sprang auf und eilte in Richtung Hausflur.
Sie rief »Herzlichen Glückwunsch!« und war verschwunden.
»Sag ihr nichts!«, rief ihr Sylvain hinterher. »Ich habe ihr versprochen, euch nichts zu verraten, bevor sie da ist.«
Er sah David betroffen an:
»Sie wird mich umbringen!«
David lachte und stand ebenfalls auf, um Sylvain zu umarmen.
»Willkommen im Club! Wie weit ist sie?«
»Im dritten Monat.«
Als Laetitia die Tür öffnete, strahlte sie vor Glück übers ganze Gesicht.
»Meine Liebe!«, platzte sie lachend heraus. »Unsere Kinder werden zusammen aufwachsen, wie wunderbar!«
Und sie warf sich in Tiphaines Arme, ohne ihr Zeit zu lassen, etwas zu erwidern.
Kapitel 2
Wenn er später an diesen Abend zurückdachte, erinnerte sich David zuerst daran, wie perfekt alles gewesen war, in jedem Blick, jeder Geste, jedem Wort lag so unglaublich viel Glück. Die Zukunftspläne, die Versprechen, das Lachen und das klare Gefühl, dass eine Familie keine Bürde ist, sondern etwas, für das man sich bewusst entscheidet – und dass er, David, das Waisenkind, das haltlos und ohne Anker aufgewachsen war, endlich seinen Heimathafen gefunden hatte. Er, der verlassene kleine Junge, der durch mehrere Pflegefamilien und Heime geschleift worden war, in einem permanenten Balanceakt zwischen Gut und Böse, bei dem er hundert Mal das Gleichgewicht verloren hatte und sich hundert Mal knapp wieder gefangen hatte, um am Ende vorbestraft wieder von vorne zu beginnen.
Zurück zum Anfang.
Und sein Anfangspunkt war sie, Laetitia. Und das Küken, das in ihrem Bauch heranwuchs. Sein kleiner Spatz. Der Sohn, dem er alles geben würde, was ihm verwehrt gewesen war, den er an die Hand nehmen und auf einen guten Weg führen würde. Er sagte »auf einen guten Weg«, weil in seinen Augen »der rechte Weg« nicht existierte, das war nur eine Illusion, ein Trugbild, wie man es Kindern zeigte, damit sie ja nicht aus der Reihe tanzen. Nicht anecken. Nicht auffallen. Immer geradeaus, mit gesenktem Blick und Scheuklappen.
Von wegen!
Nichts ist gerecht im Leben. Stattdessen ist das Dasein wie ein riesiges zerklüftetes Gelände, übersät mit Hindernissen, steilen Kurven und Umwegen, eine Art Labyrinth, in dem an jeder Ecke Fallen lauern, in dem es keinen geraden Weg gibt.
Der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten?
Der, den man kennt.
Aber egal, was man tut, egal, welche Weichen man stellt, am Ende des Weges kommt immer das Gleiche heraus.
Das dachte David.
Zumindest, bis er Laetitia traf.
Er machte es wie alle anderen, er schlug den einzigen Weg ein, den er vor sich sah, eine Hängebrücke über einem Abgrund ohne Wegweiser, ohne Geländer. Ohne die beiden Leitplanken, die ihn mit Liebe und Geduld bis zum Berg des Erwachsenenalters hätten führen können.
Und so fiel er.
Zuerst beging er kleinere Straftaten. Marihuana mit dreizehn, Kokain mit fünfzehn. Kaum in der Jugend angekommen, saß er schon in den Startlöchern zur ewigen Jagd nach Geld, zu zweifelhaften Plänen, zu schlechtem Umgang. Dann begann die Abwärtsspirale. Aus kleinen Diebstählen wurden ernstere Vergehen: Raubüberfälle, Einbrüche, Gewalt.
Zwei Jahre Erziehungsanstalt.
Endlich draußen, ein erster Versuch, wieder auf die Beine zu kommen und seinen Weg fortzusetzen. David klammerte sich fest, wo er konnte, an ein paar morschen Ästen, die schnell nachgaben, aber vor allem an Strohhalmen. Er geriet aufs Glatteis, kam ins Schleudern, und schon saß er wieder drin, diesmal vier Jahre Gefängnis für bewaffneten Raubüberfall.
Als er zum zweiten Mal aus dem Gefängnis herauskam, schwor er sich, nie wieder dorthin zurückzukehren. Er rappelte sich erneut auf und versuchte weiterzukommen, koste es was es wolle, zuerst kriechend (er arbeitete als Tellerwäscher in einem chinesischen Restaurant, um sich eine Dachkammer für 300 Euro monatlich zu leisten, ohne Warmwasser, mit Toiletten auf dem Flur und Kakerlaken an der Wand), dann auf allen vieren (er wurde Busfahrer, wieder eine Dachkammer, aber diesmal eine größere, mit warmem Wasser; noch immer ohne eigene Toilette, aber dafür auch ohne Kakerlaken). Und dann, nach und nach, richtete er sich wieder auf, prüfte sein Gleichgewicht bei jedem Schritt, setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Es dauerte mehrere Jahre.
Mit 27 war er Reinigungskraft in einem Krankenhaus und Mieter einer Einzimmerwohnung mit Bad.
Dort kreuzte sich sein Pfad mit dem Laetitias. Im Krankenhaus, nicht in der Einzimmerwohnung oder in seinem Bad.
Ihr Werdegang war eher eine ebenmäßige, gut asphaltierte Landstraße, die sich durch eine idyllische Landschaft mit viel Grün schlängelte, einige Obstbäume, ein paar zu überquerende Hügel und viele Wiesen und Felder bis zum Horizont. Ein klarer Himmel. Bis ihre beiden Leitplanken von einem Lastwagen niedergemäht wurden.
Es war nachts geschehen, in der Nacht, in welcher der Sonntag auf den Montag trifft. Und »treffen« ist hier in der Tat das passende Wort. Ihre Eltern kehrten von einem Treffen mit Freunden zurück und, ach, es war gar nicht so spät, erst kurz nach Mitternacht …, und es passierte ebendort, auf einer Nationalstraße, um genau zu sein. Es regnete, auch wenn dieses Detail nicht besonders interessant ist … genauso wie der Rest der Geschichte. Es war ein Unfall, wie sie ständig passieren, die beiden waren zur falschen Zeit am falschen Ort, als der Lastwagen sie traf, und fielen dem, was Laetitia später »die drei K« nannte, zum Opfer: Kreuzung, Kraftfahrzeug, Karambolage.
Ihre Mutter starb an Ort und Stelle. Oder besser gesagt, zwanzig Meter daneben. Das Auto machte einen Schlenker zur Seite, sie wurde nach vorn geschleudert, und ihr Körper landete auf dem benachbarten Feld. Sie war sofort tot. Laetitias Vater hingegen überlebte eine Woche. Eine Woche zwischen Leben und Tod, in der sie an seinem Bett saß und das Krankenzimmer nur selten verließ, um einige Stunden zu schlafen, zu duschen oder sich umzuziehen.
Und um David zu begegnen. Als er sie sah, in der Sekunde, als er ihr seine Augen zuwandte … es war Liebe auf den ersten Blick: Sie saß im Flur, während ihr Vater operiert wurde, und trotz ihres vom Kummer gezeichneten Gesichts, trotz ihrer vom Weinen geröteten Augen, trotz ihrer vom vielen Schnäuzen wunden Nase war er verzaubert und gerührt, und er musste ihr unbedingt die Hand reichen, ihr helfen, diesen Schicksalsschlag zu überstehen, und sie vielleicht einige Augenblicke auf dem Weg der Trauer begleiten.
Die folgenden Monate waren seltsam für Laetitia. Ein gnadenloser Kampf zwischen dem bodenlosen Schmerz über den Verlust ihrer Eltern und dem berauschendsten aller Gefühle, unsterblicher Verliebtheit. Da sie Einzelkind war, blieben ihr von der Familie nur noch ein Onkel und zwei Cousins ersten Grades, die sie seit ihrer Kindheit nicht mehr gesehen hatte, und so ergriff sie Davids Hand wie eine Schiffbrüchige einen Rettungsring. Sie wusste anfangs nicht recht, wo das alles hinführen sollte, war von Schuldgefühlen zerfressen, weil sie diesen Mann begehrte, den sie am Sterbebett ihres Vaters getroffen hatte, weil sie an ihn dachte, anstatt um ihre Eltern zu weinen, weil sie sich beim Lächeln, beim Träumen ertappte … Gleichzeitig nahm sie es ihm übel, dass er einfach da war, als ob er darauf aus wäre, sie von ihrem Schmerz abzubringen, und hasste ihn für all die Dinge, die ihr in Wahrheit so guttaten.
Sackgassen, Einbahnstraßen, Umwege und falsche Abzweigungen, sie fuhren sich eine Weile fest, aber dann entschieden sie sich, den Weg fortzusetzen, es zumindest zu versuchen, und ein Stück gemeinsam zu gehen. Eineinhalb Jahre später zogen sie in Laetitias Elternhaus, in dem sie ihre Kindheit verbracht hatte und das zu verkaufen oder zu vermieten sie nicht übers Herz brachte. Es war unvorstellbar, dass Fremde diese Wände in Besitz nehmen können, in denen die meisten ihrer Kindheitserinnerungen schlummerten. Und weil sie keine Familie mehr hatte und er auch nicht, beschlossen sie, zusammen eine zu gründen. Ihre eigene.
David glaubte felsenfest an diesen Neuanfang. Sie waren auf dem richtigen Weg, daran gab es nichts zu rütteln, gemeinsam würden sie Berge erklimmen, und, Hand in Hand, zu ihrer schönsten Reise aufbrechen!
Zum ersten Mal seit Langem sah David der Zukunft zuversichtlich entgegen, allerdings vergaß er dabei ein kleines Detail: Egal, was man tut, egal, welche Weichen man stellt, am Ende kommt immer das Gleiche heraus.
Kapitel 3
David und Laetitia Brunelle machten bald Bekanntschaft mit Tiphaine und Sylvain Geniot. Sie waren etwa im gleichen Alter, entspannte Mittdreißiger, sie waren Nachbarn, und zwischen ihren Gärten lag nur eine einfache Hecke. David stellte schnell fest, dass Sylvain King Crimson, Pink Floyd und Archive hörte, Bands, die er selbst auch mochte, während Laetitia Tiphaine im wahrsten Sinne des Wortes vor einer kulinarischen Katastrophe bewahrte, als ihr eines Abends das Olivenöl ausging. Laetitia gab ihr also ihre Flasche kaltgepresstes natives Olivenöl mit, und Tiphaine brachte sie am nächsten Morgen zurück. Laetitia bot ihr einen Kaffee an, Tiphaine nahm an, und so entstand ein Ritual, auf das die beiden schon bald um keinen Preis mehr verzichten wollten.
Die zwei Paare beschnupperten sich einige Wochen lang, zunächst vorsichtig, dann fassten sie allmählich Vertrauen. Und schließlich wurden sie Freunde.
Ihre Doppelhaushälften waren identisch, sowohl von außen als auch in der Aufteilung der Zimmer: Von der Straße aus sah man jeweils eine weiße Fassade, eine Tür aus lackiertem Holz, ein großes Fenster im Erdgeschoss und zwei schmälere im ersten Stock, ein geneigtes Dach mit Luke. Und einen Schornstein, der auf der einen wie auf der anderen Seite nicht mehr in Betrieb war. Beide Häuser hatten auf der Rückseite eine Terrasse, die direkt auf den schmalen, fast zwanzig Meter langen Garten hinausging. Jener der Brunelles bestand aus einer einfachen Rasenfläche, die David hin und wieder mähte. Den Garten der Geniots hingegen hatte Tiphaine, die Gärtnerin war und in der städtischen Baumschule arbeitete, sehr sorgfältig und geschmackvoll geplant und angelegt: Blumen, Kräuter und Kletterpflanzen, Büsche und Sträucher teilten sich den Platz, sodass er zu jeder Jahreszeit voller Farben und Düfte war. Ganz unten gab es sogar ein kleines Gemüsebeet, Tiphaines ganzer Stolz.
Nach einigen Monaten wurden die beiden Paare unzertrennlich. Ihre Freundschaft, die sie alle zu schätzen wussten, wurde durch die Tatsache, dass sie Nachbarn waren, noch verstärkt. Es war so einfach, auf der Türschwelle miteinander zu plaudern oder sich abends zum Essen, Trinken, Lachen, Diskutieren, Musikhören oder Pläneschmieden zu treffen …
Und als dann Laetitia und Tiphaine im Abstand von drei Monaten schwanger wurden, war ihr Glück vollkommen.
Milo Brunelle stieß an einem späten Dienstagnachmittag seinen ersten Schrei aus und löste eine regelrechte Sturzflut von Gefühlen aus, die sich in die Herzen und das Leben seiner Eltern ergoss. Gleich am nächsten Morgen kamen Tiphaine und Sylvain vorbei, um das Neugeborene zu bewundern. Laetitia legte Tiphaine ihr winziges Baby vorsichtig in den Arm …
»Er ist so klein!«
Tiphaine hielt das Kind sanft an sich gedrückt. Unten, mit seinem »dreimonatigen Rückstand«, strampelte unmittelbar nach dem Kontakt mit Milo plötzlich der Fötus, der sich immer noch bequem zusammengerollt im Bauch seiner Mutter befand. Es war, als wollte er schon jetzt mit diesem Freund kommunizieren, der ihm bald näherstehen würde als ein Bruder.
Dann wurde Maxime Geniot geboren. Tiphaine hatte seit dreizehn Stunden in den Wehen gelegen. Ein rasender Schmerz zerriss ihren ganzen Körper, wurde von Sekunde zu Sekunde stärker, und auch das Schreien verschaffte ihr keine Erleichterung. »Ich kann nicht mehr, macht, dass es aufhört, bitte!«, und man versprach ihr, es würde gleich vorbei sein, sie müsse nur noch ein bisschen durchhalten …
Das Kind kam mit der Morgendämmerung zur Welt. Die Mutter schwieg und der Vater auch, während sie langsam wieder zu sich kamen und wie gebannt das Kind betrachteten, gerührt, erfüllt, entzückt. Es war ein anstrengender Tag. Die Familien der jungen Eltern, alle wollten das Baby zuerst sehen, eilten nach Papas Anruf sofort herbei: Eltern, Brüder, Schwestern, samt Partnerinnen und Partnern und Kindern, drängten sich um das Bett der Mama und bedachten sie mit Ratschlägen, Kommentaren und Glückwünschen.
David und Laetitia waren diskreter. Sie erkundigten sich am Telefon nach Tiphaines Befinden, bevor sie am nächsten Morgen selbst im kleinen Krankenhauszimmer vorbeikamen, um das Baby zu bewundern.
Sie waren echte Freunde.
Und vor allem hatten sie das alles auch vor Kurzem durchlebt.
Am selben Abend lud David Sylvain ein, mit ihm um die Häuser zu ziehen. Während die beiden Frauen sich um die Kleinen kümmerten, die eine im Krankenhaus und die andere zu Hause, stießen die frischgebackenen Väter auf Maxime an, dann auf Milo, auf ihre Frauen, auf die Freundschaft, auf die Zukunft und, wo sie schon einmal dabei waren, auf die ganze Welt, auf die schöne Zeit, die gerade anbrach, auf die wunderbaren Väter, die sie ganz sicher werden würden … Sie tranken reichlich und lang und redeten mindestens genauso viel.
War es der Alkohol, die Müdigkeit, das Übermaß an Emotionen? Trunken von alledem schüttete Sylvain David sein Herz aus: Er vertraute ihm seine Ansichten über seine Beziehung an, über das Familienleben, über die Kindererziehung, erzählte ihm, wie er es mit Maxime machen würde, dass er als Vater eine überaus wichtige Rolle einnehmen würde. Er würde Präsenz zeigen, zuhören, aufmerksam, verständnisvoll und wohlwollend sein, nicht wie sein eigener Vater, der zwar da gewesen war, aber immer über alles geschimpft hatte: über Kinder, Lärm, Musik, Fastfood, Videospiele, Freunde … über das Leben eben! Er war nicht in der Lage zu leben, das war sein Problem, und kommunizieren konnte er auch nicht! Er war unfähig, seine Meinung zu sagen, ohne andere zu kritisieren. Weil früher alles besser war. Zu seiner Zeit.
»Zu seiner Zeit war alles genauso wie heute, nur beschissener!«, rief Sylvain stockend.
»Und verstehst du dich heute besser mit deinem Vater?«, fragte David, für den es immer noch eine heikle Sache war, an seine eigenen Eltern zu denken, vor allem seit Milo geboren war und er festgestellt hatte, wie verletzlich, zart und hilflos Babys waren.
Die schmerzhafte Frage, die er sich schon als kleiner Junge gestellt hatte, ließ ihm nun, wo er selbst Vater war, keine Ruhe mehr: Wie kann man nur sein Kind verlassen?
Sylvain, der von Davids quälenden Gedanken nichts ahnte, zuckte mit den Schultern und starrte ins Leere.
»Ich habe meine Hoffnung, auf väterliches Verständnis zu stoßen, endgültig begraben, und er hat es aufgegeben, aus mir den perfekten Sohn machen zu wollen. Wir arrangieren uns mit der Situation. Und wir beklagen uns nicht.«
David nickte nachdenklich. Auch er hatte sich zum Ziel gesetzt, der beste aller Väter zu werden, auch wenn ihm, im Gegensatz zu Sylvain, der Vergleich fehlte.
Beide schwiegen einen Augenblick. Und als sie merkten, dass sie in düsteren Grübeleien zu versinken drohten, gab David eine weitere Runde aus und wechselte das Thema:
»Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt, du und Tiphaine? Ihr habt immer ein Geheimnis daraus gemacht …«
Sylvain war von der Frage überrumpelt. Einige Sekunden lang starrte er David entsetzt an, als habe dieser etwas ausgesprochen Indiskretes gefragt.
»Das ist eine üble Geschichte«, murmelte er.
»Was?«
David dachte, er hätte sich verhört. Er musste lachen und sah Sylvain perplex und neugierig an, versuchte an dessen Gestik und Mimik abzulesen, ob es ein Scherz gewesen war.
Mit finsterem Blick drehte Sylvain sein Glas in der Hand und starrte in die dunkelrote Flüssigkeit, als spielte sich dort etwas höchst Dramatisches ab.
»Vergiss es«, knurrte er schließlich.
David insistierte nicht. Gespalten zwischen der brennenden Neugier über Sylvains merkwürdige Reaktion und dem Gefühl der Verlegenheit, das nun im Raum stand, zog er es vor zu schweigen. Durch den Alkohol schien sich die Zeit auszudehnen, und das verlieh dem Moment eine seltsame Stimmung, irgendetwas zwischen Peinlichkeit und Unverständnis. Sylvain rührte sich nicht. David, der sich immer unwohler fühlte, schaute auf die Uhr.
»Drei Uhr! Wir sollten nach Hause gehen …«
Er erhob sich von seinem Stuhl, verlor das Gleichgewicht, fing sich aber wieder, indem er sich an der Rückenlehne abstützte, ergriff dabei seine Jacke, die er dort hingehängt hatte, und machte sich daran, sie anzuziehen.
»Es war vor fünf Jahren«, brummte Sylvain, der immer noch reglos dasaß. »Tiphaine war damals Apothekerin.«
»Hmm?«
David hielt verwirrt inne. Sylvain sah mit verkrampftem Kiefer und zusammengepressten Lippen zu ihm auf und in seinem Blick lag eine bodenlose Verzweiflung.
David setzte sich langsam wieder hin.
Kapitel 4
»Stéphane war mein bester Freund. Stéphane Legendre. Wir kannten uns seit unserer Kindheit, waren praktisch zusammen aufgewachsen, fast wie Brüder; es war eine Freundschaft auf Gedeih und Verderb. Stéphane hatte sein Medizinstudium mit brillantem Ergebnis abgeschlossen und gerade eine Praxis für Allgemeinmedizin eröffnet. Er war sehr selbstbewusst und von sich eingenommen, ziemlich gutaussehend, ein Typ, der nie an sich zweifelt, und vor allem nicht an seinem eigenen Charme … Ein Idiot! Aber er war mein Kumpel. Eines Spätnachmittags rief er mich an, völlig panisch. Vor drei Tagen hatte er einer Patientin ein Medikament verschrieben, dessen Wirkstoff in dieser Dosierung eindeutig schädlich für schwangere Frauen war. Nun war seine Patientin aber im dritten Monat, ungefähr. Er hatte ›vergessen‹, sie danach zu fragen. Und sie hatte sich keine Sorgen gemacht und ihm blind vertraut, nach dem Motto, wenn der Arzt das verschreibt, dann muss es schon richtig sein. Die Folge war, dass sie nach zwei Tagen, also am Vorabend des Anrufs, ihr Baby verlor. Die Gynäkologin erkannte gleich den Zusammenhang zwischen der Fehlgeburt und dem Medikament und nahm mit Stéphane Kontakt auf. Überrascht und panisch, leugnete er, ihr diese Menge verschrieben zu haben, und behauptete, dass die angeordnete Dosierung für den Fötus unbedenklich gewesen sei. Die Auseinandersetzung wurde schärfer, es hagelte Drohungen: Anzeige, Schmerzensgeld, das ganze Repertoire. Daraufhin rief er mich sofort an, und ich merkte, dass er ins Schleudern kam, er sah sich schon eines groben Behandlungsfehlers schuldig, zu hohem Schadenersatz, Berufsverbot und vielleicht sogar zu einer Gefängnisstrafe verurteilt …«
Sylvain hielt kurz inne, kaute auf seiner Unterlippe herum und fuhr dann fort.
»Er erklärt mir, dass der einzige direkte Beweis, der gegen ihn vorliege, das Rezept sei. Und ich frage ihn ganz blöd: ›Also, kein Rezept, kein Beweis?‹ Und er stimmt zu. Es sei ganz einfach. Man müsse sich nur das Rezept beschaffen und es durch eines mit der richtigen Dosierung ersetzen. Man muss einfach nur … aber das ist leichter gesagt als getan! Und das Duplikat? Stéphane verspricht mir, sich darum zu kümmern. Mithilfe der Adresse der Patientin identifizieren wir Apotheken, in denen sie das Medikament möglicherweise gekauft hat. Es gibt zwei. Ich gehe zur ersten, die sich direkt neben ihrer Wohnung befindet. Ich weiß nicht genau, was ich dort tun soll, wir haben nicht viel Zeit, wenn das Rezept das einzige Beweisstück ist, wird es mit Sicherheit im Zentrum des gesamten Prozesses stehen. Vielleicht ist es sogar schon zu spät … Ich beschließe zu improvisieren, stelle mich in die Schlange, schaue mir die Räumlichkeiten genau an, beobachte die Apothekerin, ihr Auftreten und was sie tut. Sie nimmt das Rezept des Kunden vor mir entgegen, gibt ihm das Medikament und legt das Rezept in eine Schublade. Jetzt bin ich dran. Ich behaupte Halsschmerzen zu haben und frage sie, was ich tun soll, sie rät mir zum Arzt zu gehen, ich lache spöttisch und erkläre, dass ich ein tiefes Misstrauen gegenüber der gesamten Ärzteschaft hege: ›Alles Scharlatane, man geht wegen Halsschmerzen hin und sie diagnostizieren einem Prostatakrebs.‹ Das bringt sie zum Lachen, und ich denke mir, dass sie hübsch ist, wenn sie lacht … Sie verkauft mir ein Spray gegen die Halsschmerzen, ich bezahle und gehe raus.«
Sylvain seufzte, zog die Schultern hoch und sprach weiter:
»Es ist kurz vor Ladenschluss. Ich riskiere alles, ich betrete wieder die Apotheke und ich sage, dass es meinem Hals schon viel besser gehe, vielen Dank, aber dass ich sie jetzt unbedingt auf einen Aperitif in der kleinen Bar gleich nebenan einladen möchte. Sie lacht, sie zögert, und ich sage ›Nur einen Aperitif‹, sie rät mir, lieber einen Kumpel anzurufen, ich erkläre, dass ich ein tiefes Misstrauen gegenüber meinen Kumpels hege: ›Alles Schmarotzer, man lädt sie auf ein Gläschen ein und sie verlangen ein Abendessen‹, das bringt sie noch mehr zum Lachen, und ich sage mir, dass sie wirklich sehr hübsch ist, wenn sie lacht.«
Stille. Bedauern. Oder vielleicht Reue.
David hakte nach:
»Konntest du das Rezept beschaffen?«
Sylvain nickte.
»Während sie sich im Hinterzimmer umzog und ihre Sachen holte. Bevor sie verschwand, sagte sie: ›Ich bin in einer Minute zurück.‹ Alles ging ganz schnell, ich habe nicht nachgedacht, bin hinter den Tresen gerannt und habe die Schublade durchsucht. Ich weiß noch, dass ich im Kopf die Sekunden zählte und dass ich mir bis sechzig Zeit gab. Nach sechzig Sekunden würde ich es aufgeben, zu riskant. Zumal es ja auch nicht sicher war, dass es die richtige Apotheke war, aber ich hatte Glück. Ich fand unter den Rezepten ziemlich rasch das richtige, sie waren nach Datum geordnet, und ich habe sofort Stéphanes Handschrift erkannt. Ich hatte das andere Rezept dabei, das, welches Stéphane der Patientin hätte ausstellen sollen. Ich hatte sogar die Geistesgegenwart, noch den Stempel der Apotheke daraufzusetzen, der auf der Theke neben der Kasse stand. Ich habe es ausgetauscht und alles wieder so hingelegt wie vorher, ohne Spuren zu hinterlassen … In der Zwischenzeit war Stéphane zu der Patientin gefahren, um nach ihr zu schauen, mit ihr zu sprechen und zu verstehen, was passiert war … Und um die Duplikate auszutauschen. Die arme Frau hat überhaupt nichts gemerkt, er hat sicher alle Register gezogen, und sie ist ihm voll auf den Leim gegangen. Als er ihr Haus verließ, gab es keine Beweise mehr gegen ihn.«
»Und dann?«
Sylvain hielt inne. Man spürte, dass sein Gewissen ihm zu schaffen machte. Dass die Worte, die er nun aussprechen würde, selbst wenn sie sich auf fünf Jahre zurückliegende Ereignisse bezogen, auf ihn so verheerend wirkten wie ein starkes Gift.
»Es war die Apothekerin, die wegen eines groben Fehlers verurteilt wurde. Das Rezept entlastete Stéphane, aber nun stimmte die angegebene Dosierung nicht mehr mit dem Medikament überein, das sie der Patientin verkauft hatte. Das Problem war, dass ich sie immer noch traf. Sie gefiel mir immer besser, und ich habe mich in sie verliebt. So richtig. Ich war in einem Teufelskreis gefangen. Am Anfang hatte ich nicht an die Auswirkungen gedacht, die meine Tat auf sie haben würde, und als mir klar wurde, dass ich sie wirklich in Schwierigkeiten gebracht hatte, habe ich Stéphane unter Druck gesetzt, für seinen Fehler geradezustehen. Natürlich hat das Arschloch sich geweigert. Ich habe ihm gedroht, alles auffliegen zu lassen – das hätte mich zwar auch in den Skandal verstrickt, aber, ich schwöre dir, das war mir völlig egal. Ich war bereit zu bezahlen. Doch ich wusste auch, dass ich sie verlieren würde. Und diesen Gedanken konnte ich nicht ertragen. Sie war die Frau meines Lebens. Und je mehr Zeit verging, desto weniger war es mir möglich, ihr zu gestehen, was ich getan habe.«
Überwältigt von den Gefühlen, die der Alkohol wieder aufflammen ließ und verstärkte, versank Sylvain in Schweigen.
»Was ist passiert?«, fragte David leise und legte seinem Freund die Hand auf die Schulter.
Es dauerte einige Sekunden, bis er antworten konnte.
»Das habe ich doch schon erzählt. Sie wurde für einen groben Fehler verurteilt, sie musste der Patientin Schmerzensgeld bezahlen und hat ihre Approbation verloren. Sie hat alles verloren.«
»Und du, was hast du gemacht?«
»Ich bin bei ihr geblieben und habe ihr geholfen, diese schwere Zeit zu überstehen. Zuerst habe ich ihr Geld geliehen, damit sie bezahlen kann, und als sie es mir zurückgeben wollte, habe ich es nicht angenommen. Wir sind zusammengezogen, sie hat eine Ausbildung als Gärtnerin gemacht, die Jahre sind vergangen, sie ist wieder auf die Beine gekommen, wir haben die Stadt verlassen und sind hier gelandet. Das Schlimmste ist, glaube ich, dass sie mir unendlich dankbar ist. Manchmal sagt sie zu mir, dass die ganze Sache mit dem Prozess zwar hart für sie war, die Schuldgefühle und ihre Unfähigkeit, zu verstehen, was damals passiert ist, aber dass ihr Leben ihr heute so viel besser gefällt als das, bevor …«
Sylvain unterbrach sich wieder und versuchte, das Schluchzen, das in ihm aufstieg, zu unterdrücken …
»Eines ist sicher: Ich stehe in ihrer Schuld«, sagte er, als er sich wieder gefasst hatte. »Eine Schuld, die ich niemals begleichen kann. Egal, was ich tue. Sie kann alles von mir verlangen. Wirklich alles.«
David lächelte traurig.
»Und dein Kumpel Stéphane?«, wollte er wissen.
Sylvain schüttelte den Kopf und antwortete:
»Wir haben endgültig den Kontakt abgebrochen. Wir haben beide das Schicksal des anderen in der Hand. Er kann mein Leben zerstören, und ich kann seines vernichten. Wir sind unser gegenseitiges Verhängnis.«
»Und Tiphaine? Weiß sie immer noch nichts?«
»Wenn wir noch zusammen sind, dann nur deshalb, weil sie es nicht weiß.«
»Glaubst du wirklich, dass sie dich verlassen würde, wenn sie es wüsste?«
Sylvain musterte David mit einem schmerzerfüllten Blick.
»Ich bin mir sicher, dass sie mich verlassen würde, mir den Umgang mit meinem Sohn verbieten und den Rest ihres Lebens versuchen würde, das meine zu zerstören.«
David verzog das Gesicht, um zu verstehen zu geben, dass ihm diese Befürchtungen übertrieben schienen. Sylvain erwiderte sofort in einem harten Ton:
»Was würdest du an ihrer Stelle tun?«
Anstelle einer Antwort versuchte David, es sich vorzustellen und kam dann sehr schnell zum gleichen Schluss oder zumindest zu einem ähnlichen Ergebnis. Weit davon entfernt, sich über diese stille Zustimmung zu freuen, stürzte Sylvain in eine tiefe Verzweiflung.
Diesmal schwiegen sie beide.
Während die Geschichte David vollkommen ausgenüchtert hatte, schien Sylvain noch tiefer im Nebel des Alkohols zu versinken. David bemerkte es und entschied, diesen Abend der erschütternden Enthüllungen zu beenden. Er stand auf, ging um den Tisch und packte dann seinen Freund bei der Taille, legte dessen Arm um seine Schultern und brachte ihn zum Auto.
Als sie beide saßen, und er sich und Sylvain angeschnallt hatte, brach David die Stille, wobei er einen gewissen Groll gegen Sylvain nicht verbergen konnte:
»Warum hast du mir das alles erzählt?«
Der zuckte nur mit den Schultern, als ginge ihn diese Geschichte nichts mehr an.
»Vielleicht, um das Risiko einzugehen, dass sie es eines Tages durch jemand anderen erfährt … Ich habe schon versucht, es ihr zu sagen, aber ich habe es nicht geschafft.«
Davids Stimmung verdüsterte sich. Er steckte den Schlüssel ins Zündschloss und drehte sich zu Sylvain um:
»Tut mir leid, Alter, ich denke gar nicht daran, mich in diese Sache einzumischen. Wenn du willst, dass sie es erfährt, musst du selbst mit ihr darüber sprechen!«
Als David am Morgen nach dieser merkwürdigen Nacht, in der Glück und Tragik so eng aufeinandergefolgt waren, zur Arbeit aufbrach, fing ihn Sylvain auf der Türschwelle ab:
»Hast du Zeit für einen Kaffee?«
David zögerte, sah auf die Uhr und betrat schließlich das Nachbarhaus. Sie sprachen das Thema erst an, als sie am Tisch saßen:
»Ich wollte mich für gestern Abend entschuldigen«, setzte Sylvain sofort an, »ich … ich war betrunken, mir war nicht bewusst, in was für eine unangenehme Situation ich dich bringe, indem ich dir das alles erzähle …«
»Mach dir keine Gedanken«, beruhigte ihn David mit einem verständnisvollen Lächeln. »Wir haben getrunken. Viel zu viel. Wenn man trinkt, tut man idiotische Dinge.«
»Nicht nur, wenn man trinkt«, brummte Sylvain leise.
David lächelte ihm vielsagend zu.
»Bezüglich der Sache, die ich dir im Auto gesagt habe …«, fuhr Sylvain mit lauter Stimme fort. »Bitte … beachte es nicht.«
»Was meinst du?«
»Versprich mir, dass du es ihr niemals sagst! Das alles muss unter uns bleiben. Ich weiß nicht, warum ich es dir erzählt habe, wahrscheinlich ist das alles wegen Maximes Geburt wieder hochgekommen, und dann noch der Alkohol, ich musste mich aussprechen … Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan und …«
»Ich habe es dir doch gesagt«, unterbrach ihn David, »ich habe nicht die geringste Absicht, mich da einzumischen. Wir sind doch Freunde, oder?«
Sylvain konnte sich ein bitteres Lachen nicht verkneifen.
»Eben, als ich das letzte Mal einen Freund hatte, hat es kein gutes Ende genommen …«
»Hör zu, Sylvain. Es wäre mir tatsächlich lieber gewesen, nichts darüber zu wissen. Aber jetzt ist es zu spät. Also lass uns nicht mehr darüber reden, in Ordnung?«
Sylvain nickte.
»Und Laetitia?«, fragte er dann.
»Was ist mit Laetitia?«
»Hast du …«
»Natürlich nicht!«
»Danke!«
Mutter-Kind-Pass
1. Lebensjahr: 6.-7. Monat
Ab welchem Alter konnte ihr Kind ein Spielzeug von einer Hand in die andere überführen?
4 ½ Monate
Ab welchem Alter hat ihr Kind versucht, sich mit Ihrer Hilfe aufzusetzen?
5 Monate
Dreht ihr Kind den Kopf, um die Quelle eines Geräusches zu lokalisieren?
Ja.
Wenn Kinder müde sind, zeigen sie das. Was sind die Anzeichen für Müdigkeit bei Ihrem Kind?
M. strampelt viel und fängt bei jeder Kleinigkeit an zu weinen.
M. ist seit dem 6. Monat in der Kita. Leichter Schnupfen, gelegentlicher Husten.
Auszufüllen durch den Kinderarzt:
Gewicht: 9,580 kg Größe: 74,5 cm
Notizen:
Soor: Dektarin Mundgel 4 x/Tag nach den Mahlzeiten auftragen
Einfacher Schnupfen: Kind mit erhöhtem Kopf schlafen lassen; gründlich Nase putzen mit Nasensauger; Nasivin Baby Nasentropfen; 1 Tropfen in jedes Nasenloch 3 ×/Tag für max. 5 Tage
Kapitel 5
In den folgenden Monaten waren die Babys das einzige Gesprächsthema. Die Mütter vertrauten sich ihre Sorgen, ihre Zweifel und ihre Freuden an …
»Sein Popo ist ganz rot, und er hat die ganze Nacht geweint. Meinst du, dass ich mit ihm zum Kinderarzt gehen sollte?«
»Hat er Fieber?«
»37,6.«
»Ganz sicher zahnt er.«
… während die Väter sich gegenseitig unterstützten, um diese schwere Zeit der Vernachlässigung und der erzwungenen Keuschheit zu überstehen.
»Hast du Lust auf eine Partie Billard bei Simon heute Abend?«
»Und ob ich Lust habe! Soll ich dich um acht abholen?«
»Abgemacht!«
Man traf sich zum Füttern und Fläschchengeben auf der einen Seite und auf der anderen, um ein Gläschen zu trinken, auf andere Gedanken zu kommen und sich über die allzu kurzen Nächte zu beklagen. Man half sich gegenseitig mit Windeln und Zäpfchen aus, vertraute den anderen das Baby an, während man eine Runde laufen ging oder – ein unübertreffliches Vergnügen – während man sich eine kurze Siesta gönnte. Das Leben war von einem atemlosen Rhythmus aus täglichem Entzücken und uneingestandener Sehnsucht nach jener Freiheit geprägt, die nun der Vergangenheit angehörte.