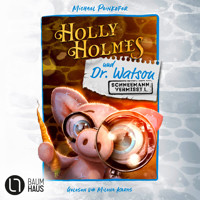12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nominiert für den SERAPH 2023 in der Kategorie »Bestes Buch«!
Sieben Schicksale. Drei Wurzeln. Ein Stamm.
Den alten Mythen nach umfasst ein gewaltiger Baum in den Tiefen des Waldes von Myrk alles Leben und alle Länder des Reiches. Doch die Völker des Hochwaldes sind in blutige Fehden verstrickt. Der grausame Häuptling Marfast strebt nach der Herrschaft über ganz Myrk und wandelt dabei auf einem schmalen Grat zwischen Ruchlosigkeit und Wahnsinn. Das Schicksal der Welt ruht nun auf den Schultern einer ungestümen Kriegerin, einer jungen Waldfrau und eines heimatlosen Jungen, in deren rätselhafter Vergangenheit eine außergewöhnliche Verbindung zu den Geistern des Waldes liegt.
Gekonnt verwebt SPIEGEL-Bestsellerautor Michael Peinkofer geheimnisvolle, germanische Sagenmotive mit einer düsteren High-Fantasy-Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy:
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Myrk« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Karte: Timo Kümmel
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Coverabbildung: Guter Punkt, München, Sarah Borchart unter Verwendung von Motiven von iStock / Getty Images Plus
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Vorwort
Karte
ERILAZ ANDI SKANDAZ (Helden und Schurken)
Prolog
1
Achtzehn Sommer später
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Epilog
Zwei Winter später
Die Sprache von Myrk: Einige wichtige Begriffe
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Vorwort
Für alle Geschichtenerzähler – und besonders für die Autoren von fantastischer Literatur – spielen Mythen eine wichtige Rolle. Sie sind der Urgrund dessen, woraus wir unsere Inspiration beziehen, versuchen Antworten auf die komplexen Fragen des Menschseins zu finden und spiegeln die Gemütslage ganzer Kulturkreise wider. Und bis zum heutigen Tag sind sie die Rohmasse, aus der sich immer wieder neue Geschichten formen.
Ganz zu den Anfängen des Erzählens zurückzukehren und aus jenen Urgeschichten zu schöpfen, ist immer wieder reizvoll. Mein Roman »Land der Mythen« hat sich seinerzeit den Bergsagen meiner Allgäuer Heimat gewidmet, in »Myrk« habe ich mich nun dem nordisch-germanischen Sagenkreis zugewandt, von dessen Helden und Schurken und gar wundersamen Gestalten Sie in diesem Roman einige wiederfinden werden, ebenso wie das immerwährende Spiel von Liebe, Macht, Intrige und Verrat, an dem sich schon unsere Urahnen erfreuten. Manches Motiv wird Ihnen vielleicht vertraut vorkommen, lieber Leser, und manche Figur werden Sie künftig womöglich in einem ganz neuen Licht betrachten.
»Myrk« ist keine Welt im klassischen Sinn – es ist ein großer, bisweilen kaum durchdringlicher Wald, gewissermaßen der Urwald aller Sagen. Dass viele der alten Geschichten in dunklen Wäldern spielen – von Siegfried, der bei der Jagd im Odenwald von Hagen ermordet wird, bis hin zu Hänsel und Gretel, die sich im dunklen Wald verlaufen –, ist natürlich kein Zufall. In einer Zeit, da der größte Teil Nordeuropas von üppigen Wäldern bedeckt war, gehörten diese zur täglichen Lebenswirklichkeit der Menschen – als Leben spendende Zuflucht, aber auch als ein Ort von Ängsten und Gefahren. Dieser Zwiespalt, der so viele Geschichten inspiriert hat, spiegelt sich auch in der dunklen Welt von »Myrk« wider, die Ihnen aus diesem Grund gleichermaßen fremd wie vertraut erscheinen mag.
Bedanken möchte ich mich bei allen, die mich auf dieser Reise zurück zu den mystischen Wurzeln (was bei einem Roman, der im Wald spielt, ja schon fast wörtlich zu nehmen ist) begleitet haben: Beim Piper-Fantasy-Team, insbesondere bei Karin Pauluth, für die trotz Pandemie so problemlose Zusammenarbeit; bei Uwe Raum-Deinzer für die langjährige Freundschaft und das engagierte Lektorat; bei meinem Agenten Peter Molden für die stets so zuverlässige Unterstützung. Sowie bei all den unbekannten, längst vergessenen Sängern und Erzählern, die einst an den Feuern saßen und durch ihre schöpferische Fantasie jenen reichen Sagenschatz geschaffen haben, aus dem ich schöpfen durfte.
Die Geschichte von »Myrk« ist zeitlich noch früher angesiedelt – vor dem Nibelungenlied, vor der Wielandsage und noch lange vor den Märchen, die die Gebrüder Grimm einst gesammelt haben – und entführt Sie, liebe Leser, in eine archaische, urwüchsige Welt, in der es all diese Mythen (noch) nicht gab.
Zurück zu den Wurzeln.
Michael Peinkofer
Frühjahr 2022
ERILAZ ANDI SKANDAZ (Helden und Schurken)
Aldatru
Geist des Waldes
Bredo
Berater und wikkan von Häuptling Marfast
Brekina
Priesterin des Waldes
Derk
Baumjäger aus Raska Danna
Falk
sein Bruder
Gernoth
grefan des Drachenvolks
Grid
Schülerin Huldas
Grewo
ein alter Gerber
Hadburk
Krieger der skallriddaz
Hanz
Ziehsohn Meister Mimirs
Hulda
eine alte Waldfrau
Huorn
ein blodjagon
Kunnart der Starke
Häuptling des Drachenvolks
Marfast der Unbarmherzige
Häuptling des Bärenvolks
Meinrad
betagter Bärenkrieger
Metiga
Feuerpriesterin Tandaras
Mimir
Meisterschmied der Durgen
Nyra
eine junge Durgin
Rekwold
Anführer der skallriddaz
Salda
Gemahlin Kunnarts
Walbaran der Weise
König der Durgen
Wyland
ein Runenschmied
Prolog
Der Wald war in Aufruhr.
Der uralte, von Wurzeln und Fäulnis durchdrungene Boden bebte, die Farne schrien Schmerz und Wehmut laut hinaus, und die Bäume, die jahrtausendealten Säulen der Welt, bluteten Harz aus zahllosen Wunden.
Brekina lief, so rasch ihre Füße sie trugen, doch der Moment war nahe, in dem ihre Beine ihr den Dienst versagen und vor Erschöpfung unter ihr zusammenbrechen würden. Kalter Schweiß stand ihr auf der Stirn, ihr Herzschlag hämmerte, Blut rauschte in ihren Ohren. Angst schnürte ihr die Kehle zu, und als würde sich ihre Furcht auf ihre Umgebung übertragen, schien auch das Dickicht zu erzittern. Vögel flatterten kreischend auf, kleine Tiere stoben davon, flohen vor ihr, so wie sie selbst floh. Ihr Atem ging stoßweise. Gehetzt sah sie sich um, wusste um die Verfolger, die ihr auf den Fersen waren und ihr mit blanken Klingen und mörderischen, mit Widerhaken versehenen Pfeilen nach dem Leben trachteten.
Der Frevel, den sie begangen hatte, war zu groß, um sie am Leben zu lassen, die Kränkung zu gewaltig. Und doch hatte sie nicht anders gekonnt, als nach ihrem Herzen zu entscheiden, zu ihrem Verderben … doch zum Wohl des Lebens, das in ihr reifte.
Ihre Schritte wurden schwer und schleppend, der Schmerz in ihrem Rücken zur Qual. Anfangs hatte sie ihn kaum gespürt, doch jetzt breitete er sich in ihrem Körper aus wie Schlangengift – wobei gar nicht auszuschließen war, dass die Spitze des Pfeils tatsächlich in Gift getaucht gewesen war.
Wie lange sie bereits durch den Urwald irrte, wusste Brekina nicht mehr zu sagen. Den Mantel aus Hirschfell eng um die Schultern geschlungen, stieg sie über die von Pilzen überwucherten Stämme abgestorbener Bäume, tauchte unter Vorhängen aus Farn und Moos hindurch und überquerte Brücken aus Wurzelwerk, die sich über geheimnisvoll flüsternde Bäche und grüne Tümpel spannten.
Mit jedem Schritt, den sie ging, drang sie tiefer ins Herz des Waldes vor. Und je weiter sie vorankam, desto mehr hatte sie das Gefühl, aufgesogen zu werden von der dunklen, feuchten Dämmerung, die unter den knorrigen Eichen herrschte, eins zu werden mit der beruhigenden Stille, die zwischen den uralten Bäumen hing und sie wie eine schützende Mauer umgab.
Brekina merkte, wie sie ruhiger wurde und auch der Schmerz sich legte, der Pfeilspitze zum Trotz, die unterhalb ihres rechten Schulterblattes stak. Ihr rasselnder Atem und der dünne Blutfaden, der aus ihrem Mundwinkel rann, machten ihr jedoch unbarmherzig klar, dass dies ihr letzter Weg sein würde. Auch ihre Gabe könnte sie nicht retten, nicht dieses Mal. Dennoch überkam sie eine seltsame Ruhe, nun, da sie den inneren Kern des Waldes erreichte. Hier, sagte sie sich, hatte einst alles seinen Anfang genommen – und hier würde es enden.
Deshalb war sie hierhergekommen.
Um sowohl sich als auch das Leben, das in ihr reifte, jener Macht anzuvertrauen, die Myrk hatte wachsen lassen und die dem Wald seit jeher Fülle und Leben schenkte.
Aldatru …
Von ihren Verfolgern war nichts mehr zu hören. Vielleicht hatten die Warge im Dickicht ihre Spur verloren, waren abgelenkt worden von anderen Gerüchen. Oder die Blutjäger waren umgekehrt, weil sie lieber den Wutanfällen ihres Herrn entgegensahen als dem Zorn des Waldes.
Brekina würde es nicht mehr erfahren.
Ihre Zeit war gekommen.
Ihr Leben verlangte es danach weiterzuziehen. Früher, als die Natur es vorgesehen hatte, würde es ihren Körper verlassen, und es würde Brekina nicht mehr vergönnt sein, jenes neue Leben in ihr als Mutter zu umhegen und vor den Gefahren der Welt zu beschützen.
Ihr Blick verschwamm bereits, als sie die Lichtung des Lebensbaumes erreichte. Die Erschöpfung, die sie bis jetzt tapfer geleugnet hatte, holte sie ein, und sie sank zu Boden, in eine schützende Kuhle, die die Wurzeln formten. Tröstenden Armen gleich streckten sie sich ihr entgegen, als hätten sie nur auf sie gewartet.
Auf ihren hölzernen Wanderstab gestützt, der ihr so wertvolle Dienste geleistet hatte, ließ Brekina sich nieder. Weiches Moos empfing ihren geschundenen Körper und linderte ihren Schmerz, selbst den der Pfeilspitze, die dadurch nur noch tiefer in ihre Lunge drang. Brekina schloss die Augen, reinigte ihren Geist von den Resten weltlichen Schmerzes, die dort verblieben waren, von eitlem Zorn und banger Furcht.
»Aldatru«, flüsterte sie und öffnete ihren Geist für die Gegenwart des Ewigen – und konnte im nächsten Moment bereits spüren, wie ihr aus dem Boden des Waldes und dem Wurzelwerk, das ihn durchdrang, neue Kraft erwuchs. Ihr Atem beruhigte sich und ebenso ihr Herzschlag.
Aber in diesem Augenblick setzten die Wehen ein.
Es gab keine Vorwarnung, nichts, das sie auf den Schmerz vorbereitet hätte, der ihren Unterleib plötzlich durchflutete. Alles in ihr sträubte sich dagegen, das Leben, das in ihr gereift war, bereits so früh in diese Welt zu entlassen, und doch wusste sie, dass sie keine Wahl hatte.
»Aldatru«, stieß sie abermals hervor, lauter diesmal, während eine neue Welle von Schmerz durch ihren Körper flutete. Sie warf den Umhang aus Hirschfell ab und zerriss ihr Kleid, vertraute sich dem Schutz des Waldes an in der Absicht, eins zu werden mit dem Ewigen, mit der urwüchsigen Kraft, die alles Leben in Myrk durchdrang.
»Aldatru!«
Als sie den Namen diesmal aussprach, war es ein lauter Schrei, der zugleich Gebet, Verwünschung und flehentliche Bitte war. Brekina brüllte ihren Schmerz und ihre Verzweiflung hinaus, während sie auf dem Boden lag, die Beine gespreizt und bereit, die letzte ihr verbliebene Kraft dazu zu nutzen, das neue Leben in ihr in die Welt zu entlassen.
Doch allein würde sie es nicht schaffen.
Nicht ohne Beistand …
Brekina wusste, dass sie längst nicht mehr allein war. Verborgene Augen beobachteten sie, und auch wenn diese Augen weder Mensch noch Tier gehörten, hoffte sie dennoch, dass ihre Besitzer freundlich sein und sich ihrer erbarmen würden.
»Aldatru!«, schrie sie noch einmal, während sie das Gefühl hatte, vom Schmerz zerrissen zu werden.
In diesem Augenblick spürte sie das Beben.
Der Boden und das weiche Moos unter ihr erzitterten, ebenso wie das uralte Wurzelwerk. Im nächsten Moment lag ein Rauschen in der Luft, wie der Flügelschlag von tausend Vögeln es nicht zustande gebracht hätte, und die jahrtausendealten Bäume schienen sich zu bewegen.
Brekina hatte den Namen des Ewigen gerufen.
Und der Wald antwortete.
1
Achtzehn Sommer später
Das scharfe Blatt der Axt ging nieder.
Ein ums andere Mal grub sich das Eisen in den Stamm der Eiche, ließ Splitter von Borke und Holz nach allen Seiten fliegen, während es sich zum Kern des alten Baumes wühlte, unbarmherzig und unaufhaltsam, Schlag für Schlag.
Der Kampf war stets derselbe, und immer endete er auf die gleiche Weise: Anfangs leistete der Baum noch tapfer Widerstand, stellte sich der Klinge scheinbar unbezwingbar entgegen, trotzte ihr mit seiner schieren Größe und der Erfahrung überdauerter Zeitalter. Doch irgendwann, wenn rohe Muskelkraft und menschlicher Wille das Blatt wieder und wieder in den Stamm getrieben hatten, gab auch der mächtigste Riese nach. Dann wankte er, zum ersten Mal in tausend Wintern, und schließlich barst er mit markigem Krachen und Splittern und ging zu Boden, rauschend und knackend und unter dem Jubelgeschrei jener, die ihn zu Fall gebracht hatten.
So jedenfalls war es früher gewesen.
In letzter Zeit war nur noch das Knacken und Bersten der Bäume zu hören, Jubel vernahm man kaum noch. Zu groß war die Anzahl der Bäume, die dieser Tage gefällt wurden, zu groß die Eile, zu der die Baumtöter angetrieben wurden.
Falk und Derk gehörten zu ihnen.
Von ihrem Vater hatten sie das Handwerk des Baumfällens erlernt, so wie es ihm von seinem Vater beigebracht worden war, doch niemand konnte sich an eine Zeit erinnern, in der so viele Bäume erlegt worden waren wie in diesen Tagen. Erst am Vormittag hatten sie einen der grünen Giganten zu Fall gebracht, die sich in diesem Teil des Waldes turmhoch in den Himmel reckten. Nun waren die Brüder bei einer alten Buche zugange, deren Wurzeln und Rinde von einem langen und bewegten Leben kündeten – das noch vor Sonnenuntergang enden würde …
»Ich weiß nicht«, meinte Falk, während er die Axt ein weiteres Mal mit vernichtender Wucht in die bereits entstandene Kerbe schlug, »wenn es so weitergeht, wird es bald keine Bäume mehr geben, die wir fällen können.«
»Du redest Unsinn, wie immer.« Sein Bruder hatte sich auf den Stumpf des Baumes niedergelassen, den sie am Vormittag gefällt hatten, und kaute auf einem zähen Stück gedörrten Hasenfleischs herum. Die Ähnlichkeit zwischen den zweien war nicht allzu ausgeprägt. Beide hatten langes Haar, das in schweißgetränkten Zotten auf ihre breiten Schultern fiel, ansonsten waren sie so verschieden, wie zwei Menschen es nur sein konnten. Falk war groß und sehnig, sein Bruder breitschultrig und klein. Er war der Ältere der beiden und bestimmte, was gemacht wurde, so war es immer gewesen.
»Der Wald von Myrk ist unendlich groß, was also macht es schon, wenn wir in diesem Jahr ein paar Bäume mehr fällen?«
»Ich weiß nicht.« Falk, der bereits zum nächsten Schlag ausgeholt hatte, ließ die Axt wieder sinken und schüttelte den Kopf. Es war ein warmer Frühlingstag, der Schweiß rann ihm von der Stirn. »Nur weil noch keiner den Rand der Welt gesehen hat, bedeutet das nicht, dass es ihn nicht gibt. Außerdem«, fügte er hinzu, »ist es gegen das Gesetz.«
»Welches Gesetz?«
»Das Gesetz der Baumjagd, wie Großvater es uns gelehrt hat. Es besagt, dass wir nicht mehr Bäume erlegen dürfen, als wir unbedingt benötigen.«
»Wer sagt denn, dass sie nicht benötigt werden?« Derk rollte mit den Augen, die Bedenken seines Bruders ärgerten ihn. »Harjatugan Marfast braucht das ganze Holz eben unbedingt, sonst hätte er wohl kaum angeordnet, es zu fällen.«
»Und wozu?« Falk schnaubte, während er den Blick über die Lichtung schweifen ließ, die es vor ein paar Tagen noch nicht gegeben hatte. Da hatten die Bäume noch so dicht gestanden, dass kaum ein Lichtstrahl bis zum moosbedeckten Boden vorgedrungen war. Jetzt lag er in gleißendem Sonnenschein, und wohin man auch blickte, sah man nur Stümpfe und herrenlos am Boden liegende Borke, ein Fest für Käfer und Würmer, die sich bereits darüber hermachten. Die Stämme selbst waren noch an Ort und Stelle geschält und bereits fortgebracht worden.
»Keiner weiß, was mit all dem Holz geschieht«, dachte Falk weiter laut nach. »Die einen sagen, dass Häuptling Marfast damit seine Baumfestung erweitern wolle; die anderen behaupten, dass er Unmengen von Holzkohle brauche, um die Essen seiner Waffenschmieden damit zu befeuern; und wieder andere sagen, dass er seinen wikkan mit dem Bau neuer Kriegsmaschinen beauftragt habe …«
»Und? Kann uns das nicht egal sein?« Derks Kiefer kapitulierten vor dem letzten Rest Dörrfleisch. Kurzerhand spuckte er es aus, griff wieder nach seiner Axt und stand auf. »Warum quälst du dein bisschen Verstand mit diesen Fragen, Bruder?«, wollte er wissen. »Es ist nicht unsere Sache, sich über so etwas den Kopf zu zerbrechen.«
»Und wenn Marfast wirklich zum Krieg rüstet?«
»Lass ihn, uns kann es doch egal sein! Was immer Marfast vorhat, seine Gier nach Holz füllt unsere Bäuche.«
Falk nickte, das stimmte durchaus. Sämtliche Baumtöter des Dorfes waren beschäftigt, und rechnete man noch die Rindenhäuter, die Holzschneider und die Zimmerleute dazu, so waren es noch einige mehr. Vielerorts konnte man dieser Tage den Klang von Äxten im Hochwald hören. Marfasts Hunger nach Holz schien unersättlich und würde noch für viele Monde volle Mägen und gut gefüllte Vorratslager für den Winter bedeuten.
»Du hast recht«, gab Falk zu, was sein Bruder nur mit einem Schnauben beantwortete. Dann machten die beiden sich gemeinsam wieder an die Arbeit, senkten Schlag um Schlag ihre Äxte in die alte Buche und vergrößerten die Kerbe mit jedem Hieb.
Splitter flogen, die immer weicher und saftiger wurden, je weiter sie sich dem Kern des Baumes näherten – und plötzlich sickerte etwas zwischen den wunden Fasern der Buche hervor. Falk sog scharf Luft ein und prallte zurück, selbst sein beherzter Bruder hielt mitten im Schlag inne.
»Was bei allen Bäumen …?«, stieß dieser hervor.
»Blut!«, gab Falk die schreckliche Antwort. »Das ist Blut, Derk! Ich habe es gewusst, es ist Frevel!«
»Mach Platz!« Mit dem Schaft der Axt stieß sein Bruder ihn weg. Dann trat er vor und bückte sich hinab, steckte seine Hand in die Kerbe. Mit den Fingern befühlte er die austretende Flüssigkeit, prüfte ihre Beschaffenheit, die zäh war und klebrig. Schließlich roch er daran.
»Baumharz, nichts weiter«, stellte er fest.
Falk war nicht überzeugt. »Warum ist es dann so rot?«
»Woher soll ich das wissen? Machen wir weiter«, blaffte Derk und wollte die Axt wieder heben, doch sein Bruder ließ ihn nicht.
»Erinnerst du dich an die Geschichten, die Großvater uns am Feuer erzählt hat?«
Derk seufzte. »Und?«
»Auch an das, was er über blutende Bäume sagte?«
»Es war das Gewäsch eines alten Mannes. Aberglaube, nichts weiter.«
»Dass diese Bäume Aldatru gehören«, fuhr Falk unbeirrt fort. »Dass es sein Blut ist, das in ihren Adern fließt.«
»Und so was glaubst du?«
»Was, wenn er recht hatte?«
»Selbst wenn, was sollen wir deiner Ansicht nach jetzt tun?« Derk sah fragend zu seinem Bruder auf. »Uns dem Befehl verweigern? Es heißt, Marfasts Runenschwert sei so scharf, dass es einen Mann vom Scheitel bis zur Sohle spalten kann. Willst du, dass er es an dir ausprobiert?«
»Bei allen stinkenden Morcheln, nein!« Falk schüttelte entsetzt den Kopf.
»Also weiter«, knurrte Derk nur und setzte die Arbeit fort, und widerwillig trug auch Falk wieder seinen Teil dazu bei. Abwechselnd schlugen sie die Blätter ihrer Äxte in die Kerbe, und mit jedem Splitter Holz, den sie herausbrachen, trat noch mehr Harz hervor, so schreiend rot wie frisches Blut. In zahlreichen Rinnsalen kroch es am Stamm herab, suchte sich einen Weg über die knorrige Rinde und versickerte im Boden, wo es dunkle Spuren hinterließ, als wäre die Erde dort verbrannt.
Falk sah es mit Unbehagen, aber er sagte nichts mehr. Sie machten weiter, und endlich kam der Zeitpunkt, da der Baum bezwungen war.
»Zurück!«, zischte Derk, und sie huschten davon, während der grüne Riese sich neigte, quälend langsam zuerst, dann immer schneller, und schließlich mit urtümlicher Wucht zu Boden schlug, als wollte er die halbe Welt unter sich begraben. Äste brachen, und Zweige barsten, Vögel flatterten kreischend auf.
Dann trat Stille ein, in die Derks Siegesschrei platzte, heiser und trotzig. Dazu stieß er die Axt, deren Blatt so rot war wie nach einer geschlagenen Schlacht, hoch in die Luft und schwenkte sie triumphierend.
Falk schwieg und sah zu Boden, wo das Baumblut dunkle Spuren hinterlassen hatte.
Und im selben Moment erklang der schaurige Ruf.
»Barumur!«
Die Stimme war feindselig und voller Zorn, und sie schien überall gleichzeitig zu sein. Wie ein Sturm fegte sie über die Lichtung, brachte auch die anderen Baumtöter dazu, ihre Äxte sinken zu lassen und sich erschrocken umzusehen.
»Barumur!«, erscholl es wieder.
Falk und sein Bruder tauschten erschrockene Blicke, nicht einmal Derk fiel mehr ein Einwand ein.
»Barumur!«
Es war Anklage und Schuldspruch zugleich, und sie hielten die Werkzeuge des grausamen Frevels noch in den Händen. Falk ließ seine Axt fallen, die plötzlich unendlich viel zu wiegen schien. Derk behielt sie in den Händen, auch dann noch, als der Boden von schweren Erschütterungen durchlaufen wurde und die grüne Wand des Waldes sich teilte.
Im nächsten Moment brach das blanke Grauen aus dem Dickicht. Es packte Derk Baumtöter mit seiner Klauenhand und riss ihn senkrecht empor. Sein heiseres Geschrei endete in dem Augenblick, da er mitten entzweigerissen und in zwei Hälften davongeschleudert wurde. Seine blutigen Innereien regneten herab und besudelten den Boden.
Es war der Moment, in dem Falk schreiend herumfuhr. Dann begann er zu laufen, so schnell seine dürren Beine ihn trugen.
2
Meister Mimir hatte die Erschütterung gespürt.
Die leise Verwerfung im Gefüge der Welt.
Für jene, die dafür empfänglich waren, war sie wohl in ganz Myrk zu spüren gewesen, von Braka Harda bis hinunter in die Tiefen der Wroti Bergaz … doch da es kaum noch jemanden gab, der Vorkommnissen dieser Art Bedeutung beimaß, würde es den meisten wohl verborgen bleiben wie so vieles andere.
Mimir hatte nie verstanden, warum die Menschen derart blind waren. Zwar hatte es der Schöpfung gefallen, sie mit zwei Augen zu versehen, doch machten die großen Leute davon nur selten Gebrauch – und was ihre Herzen betraf, so waren sie bisweilen so blind wie die Olme, die in den Pfuhlen tief unter den Wurzelstollen lebten.
Die Zeit der Durgen ging zu Ende, gewiss. Dieser Tatsache hatte Meister Mimir bereits ins Auge gesehen, als andere seines Volks noch die hohen Hallen von Nibelheim mit ihren funkelnden Schätzen gerühmt und das steinerne Zeitalter besungen hatten. Aber der Gedanke, dass nach den urwüchsigen, bodenständigen Bewohnern des Wurzelgebirges nunmehr die ungestümen Menschen Myrk beherrschen sollten, bereitete dem alten Schmied dennoch Unbehagen – vielleicht auch deshalb, weil er die Menschen besser kannte als jeder andere durgo.
Die Höhle klang wieder vom hellen Klang des Hammers, den der Meister mit der Rechten schwang, während die Linke das glühende Stück Metall mit der Zange hielt. Wieder und wieder fiel der Hammer auf den Amboss nieder und bearbeitete das Werkstück, das der Vollendung nahe war. Nicht nur, dass die Form nun genau der entsprach, die der Schmied vor seinem inneren Auge gehabt hatte; die magischen Runen waren auch eingelegt worden, zwei an der Zahl: Die eine dafür, dass die Waffe ihre Schärfe behalten und niemals fehlgehen möge; die andere zum Schutz vor Hinterhalt und Angriff.
Mimir wusste nicht mehr zu sagen, wie viele Klingen, Axtblätter und Speerspitzen er im Laufe seines langen Lebens gefertigt hatte, schon damals als Metallurg am Hof Seiner Hoheit des Durgenkönigs; später dann auch in der Fremde, in die man ihn verbannt hatte. Diese Gerspitze jedoch sollte etwas Besonderes werden, ein Geschenk für einen besonderen jungen Mann zu einem besonderen Anlass. Und wenn sie erst im Tiefenwasser gehärtet und geschliffen worden war, so würde sie mit einem besonderen Holz zu einer besonderen Waffe verschmelzen. Ein guter Ger, so pflegte sein Lehrherr Amilias vor undenklich langer Zeit zu sagen, war im Kampf der beste Freund – und Kämpfe würden kommen.
Wenn es um Menschen ging, so hatte Meister Mimir gelernt, brauchte man nie besonders lange darauf zu warten.
Noch ein-, zweimal ließ er den Schmiedehammer niedergehen, bereinigte die letzten Unebenheiten. Dann hob er die Spitze mit der Zange hoch und betrachtete sie im roten Schein der Esse.
Die eingelegten Runen konnte man im glühenden Zustand noch deutlich erkennen, weiß leuchteten sie in der Tiefe des Metalls. Meister Mimir betrachtete sein jüngstes Werkstück von allen Seiten, dann nickte er zufrieden und tauchte die Spitze mit der Zange in den Quell, der die Höhle durchfloss und in den Tiefen der Wroti Bergaz entsprang.
Weißer Dampf stieg zischend auf und verbreitete sich in der Schmiede, hüllte sie in fahlen Dunst.
Der Meister beließ den Stahl in der Quelle, die ihn härten würde und ihm zugleich Geschmeidigkeit verlieh. Danach brauchte die Spitze nur noch geschliffen und poliert zu werden, und das Geburtstagsgeschenk würde fertig sein. Ein gutes, ein nützliches Geschenk, eines Sohnes würdig.
Der Gedanke begleitete Mimir, während er die Schmiede verließ. Langsam durchmaß er die einsamen Stollen, durch deren Felsendecke das Wurzelgeflecht der Bäume drang, die oben an der Oberfläche wuchsen. Einst hatten sich in diesen Gängen zahllose Durgen gedrängt, waren die Gewölbe erfüllt gewesen von Hunderten Stimmen und die Luft durchsetzt von der Hitze der Essen und dem Geruch von Ruß und glühendem Eisen. Doch die Schmieden von Izarnabur waren längst verlassen, die Meister der alten Zeit fortgegangen. Stille war eingekehrt, nur noch wenige Kinder der Tiefe hausten in den Hallen, die einst von Leben gewimmelt hatten. Es war das Schicksal einer aussterbenden Art, deren Spuren sich schon bald im Wind der Zeit verlieren würden, unauffindbar.
Für Meister Mimir bedeutete das immerhin, dass es an Platz nicht mangelte. Die Gewölbe, in denen der Junge und er sich eingerichtet hatten, waren mehr als großzügig bemessen. Anfangs hatte der Meister hier allein gelebt, später dann in Gesellschaft des Jungen, der so unvermittelt in sein Leben getreten war. Dass jener Tag nunmehr bereits achtzehn Sommer und Winter zurückliegen sollte, war Mimir unbegreiflich.
Er hatte nie hinterfragt, warum alles so gekommen war und das Schicksal ausgerechnet ihn dazu ausersehen hatte, sich um diesen Jungen zu kümmern. Doch von Beginn an war ihm klar gewesen, dass hier Mächte wirkten, die so alt waren wie die Welt und die er nicht ansatzweise verstand – und so hatte er die ihm zugedachte Aufgabe ohne Zögern angenommen.
Der Meister legte die lederne, von Brandspuren und Rußflecken übersäte Schürze ab und trat an das steinerne Becken, um Gesicht und Hände zu waschen. Das Gesicht, das sich im Wasser spiegelte, war alt und runzlig geworden, erinnerte ihn mehr an die Rinde eines alten Baumes denn an die Miene eines Durgs. Das schlohweiße Haar und der lange geflochtene Bart, die es umrahmten, machten den Eindruck nicht besser. Meister Mimir hatte sich wohl oder übel an den Gedanken zu gewöhnen, dass er, im zweihundertvierten Jahr seines Lebens stehend, nicht mehr zu den Jüngsten gehörte …
»Meister Mimir?«
Er hatte nicht bemerkt, dass sich jemand genähert hatte, entsprechend fuhr er zusammen. Seine unter dem weißen Haar verborgenen Ohren hatten ihm auch schon bessere Dienste geleistet, ein weiteres Anzeichen dafür, dass sich die Last der Jahre bemerkbar machte.
»Ja, Nyra?«, fragte er, während er noch damit beschäftigt war, sich das Gesicht abzutrocknen. Er hatte die Stimme des Mädchens erkannt, das mit Vater, Mutter und ein paar vorlauten Brüdern im Oststollen lebte, zusammen mit den anderen wenigen Bewohnern, die Izarnabur noch hatte. Im ersten Moment war Meister Mimir ungehalten über die Störung. Dann wurde ihm klar, warum das Mädchen gekommen war …
»Ist er hier?«, erkundigte sich Nyra prompt.
Meister Mimir wischte sich noch ein letztes Mal über das Gesicht, dann wandte er sich dem Mädchen zu, das ihn erwartungsvoll ansah. Nyra war hübsch mit ihrem runden, von blonden Zöpfen umrahmten Gesicht und den stets geröteten Wangen. Ihr Mund war klein und ihre Nase zierlich für eine durga. Im Blick ihrer wachen braunen Augen lag stets etwas Freundliches, beinahe Liebevolles.
Aber auch das würde nichts nützen.
»Nein, Nyra«, erwiderte Meister Mimir wahrheitsgemäß. »Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen.«
»Wie schade!« Sie zog einen Schmollmund und sah hinab auf ihre nackten, schmutzigen Füße. »Ich wollte ihm zum Geburtstag gratulieren. Der ist doch heute, oder nicht?«
»Allerdings.« Meister Mimir nickte. »Aber ich habe Hanz hinabgeschickt, um in den unteren Stollen Pilze zu ernten, und ich fürchte, so bald wird er nicht zurückkehren.«
»Das ist schade«, sagte sie noch einmal. Sie wirkte ehrlich enttäuscht. »Vielleicht kann ich ja hier auf ihn warten?«, fragte sie dann, wieder Hoffnung schöpfend.
Meister Mimir holte scharf Luft, das fehlte noch! »Wie ich bereits sagte, wird er so bald nicht wiederkommen«, antwortete er schnell. »Ich erwarte ihn erst zum Abend zurück.«
»Oh«, machte Nyra, und schließlich nickte sie.
Braves Mädchen, dachte Meister Mimir.
»Werdet Ihr ihm sagen, dass ich hier gewesen bin?«
»Aber natürlich.«
»Ihm meine Glückwünsche ausrichten?«
»Auch das gerne.«
»Und ihm einen Kuss von mir geben?«
»Das … äh … tust du wohl lieber selber«, erwiderte der alte Meisterschmied und wurde rot unter seinem weißen Bart. Was diesen jungen Leuten alles einfiel! War er selbst auch einmal so gewesen? Er wusste es nicht mehr, es lag zu lange zurück. Dennoch rang er sich ein Lächeln ab. »Alles andere werde ich ihm ausrichten, ganz bestimmt«, versicherte er.
»Danke, Meister Mimir!« Nyra nickte zum Abschied und wandte sich zum Gehen.
»Möge der Berg dich allzeit schirmen, Kind.«
»Euch auch, Meister Mimir.«
Damit war sie verschwunden, die Schritte ihrer nackten Füße verloren sich im Stollen.
Meister Mimir legte das Tuch beiseite, mit dem er sich das Gesicht abgewischt hatte und das jetzt voller Rußflecken war, und ließ sich auf der in die Wand gemeißelten Sitzbank nieder.
Die Zuneigung des Mädchens rührte ihn – und machte ihn gleichzeitig traurig. Er hätte es ihr sagen sollen, schalt er sich jetzt. Ihr klarmachen, dass die Zuneigung, die sie tief in ihrem Herzen zu hegen schien, keine Zukunft hatte. Der Junge, an den sie ihr Herz so leichtfertig verschenkt hatte, hatte kein Auge für sie und auch für keine andere Durgin.
Denn ganz gleich, wie lange er schon bei ihnen lebte und wie sehr sie alle ihn lieb gewonnen haben mochten – Hanz war keiner von ihnen, und so würde es immer sein.
Er war ein Mensch.
3
Skeldabryg trug seinen Namen zu Recht.
In der alten Sprache beschrieb das Wort eine von Schilden beschirmte Brücke, also einen Ort, der Sicherheit sowohl vor den Elementen als auch vor Feinden versprach, und dieses Versprechen hatte der uralte Hort des Drachenvolks über die Jahrhunderte mehr als einmal eingelöst.
Auf Bäumen, die vor undenklich langer Zeit einem Brand anheimgefallen waren und deren Holz in den Flammen so hart und dauerhaft wie Stein geworden war, hatte der Drachenstamm in luftiger Höhe seine Häuser errichtet, sie mit Palisaden umgeben und durch Brücken verbunden, und nicht wenige behaupteten, dass eine so errichtete Festung uneinnehmbar sei; in alten Erzählungen wurde gar berichtet, dass es kein gewöhnlicher Brand, sondern Drachenfeuer gewesen sei, das das Holz der Bäume einst gehärtet habe.
Diese uralte Verbindung zu den lindwyrmaz, auf die sich der Stamm bis zum heutigen Tag berief, erklärte sowohl seine Nähe zu den Baumechsen, die aus den Drachen hervorgegangen waren, als auch seinen Anspruch darauf, über die anderen Völker des Hochwalds zu gebieten. Und es machte Kunnart, den Häuptling des Drachenstammes, zu einem der mächtigsten Männer von Braka Harda. Was nicht bedeutete, dass sich dieser damit zufriedengegeben hätte. Kunnarts Ehrgeiz ging sehr viel weiter.
In jeder Hinsicht.
Der Herrscher von Skeldabryg fläzte auf seinem Lager, Arme und Beine von sich gestreckt und so nackt, wie er einst aus dem Schoß seiner Mutter gekrochen war. Er hatte seinen sehnigen, von rötlich blasser Haut überzogenen Körper stets als mehr betrachtet denn als bloßes Mittel zum Zweck; er sah ihn auch als Gefäß seiner Macht, und wie jedes Gefäß, das etwas Wertvolles enthielt, war es reich verziert. Tätowierungen überzogen Kunnarts Arme und die Beine, Nachbildungen von Drachenschuppen, die die Künstler des Stammes mit Knochennadeln in seine Haut gestochen und mit dunklem Pflanzensaft nachgezeichnet hatten. Auch eine Hälfte seines Gesichts war davon bedeckt, sodass man den Häuptling des Drachenstammes in bekleidetem Zustand für ein Echsenwesen hätte halten mögen, wie sie in alten Mythen Erwähnung fanden – wäre da nicht das feuerrote Haar auf seinem Kopf gewesen. Gewöhnlich trug er es zum Schopf gebunden, jetzt hing es in schweißnassen Strähnen herab, wie überhaupt sein ganzer Körper von Schweißperlen übersät war. Sein Brustkorb hob und senkte sich unter tiefen Atemzügen, seine Männlichkeit war erschlafft.
Die Frau, die Schuld an seinem erschöpften Zustand trug, lag neben ihm, nackt wie Kunnart selbst bis auf das Amulett mit dem oval geformten, geheimnisvoll grün schimmernden Edelstein, das sie niemals ablegte; doch anders als die rötliche, tätowierte Haut des Häuptlings war ihre ohne jede Zeichnung und so weiß wie Ziegenmilch, ihr Haar dagegen schwarz wie die Nacht. Metiga war ihr Name, wie aus dem Nichts war sie in sein Leben getreten und hatte ihn davon überzeugt, dass es nur die Kraft der Vorsehung gewesen sein konnte, die sie zusammengeführt hatte. Und Kunnart hatte keinen Grund gefunden, an dieser Schlussfolgerung zu zweifeln.
Im Gegenteil.
Sie beugte sich über ihn und leckte den Schweiß von seiner Brust, dabei ließ sie ihre Mähne über seinen Körper gleiten. Kunnart vergrub seine Hände darin, zog sie an den Haaren, sodass ihr ein Schrei entfuhr. Er verstärkte seinen Griff und hielt sie fest, während er sich an ihrer Schönheit weidete.
Ihr Gesicht war makellos, ihre Nase schmal, ebenso wie ihre Wangenknochen und ihre Lippen, was ihrem Aussehen etwas Herrschaftliches verlieh, eines Häuptlings wahrhaft würdig; am meisten jedoch schlugen ihn ihre Augen in Bann, die grün waren mit gelben Sprenkeln und etwas Reptilienhaftes hatten. Genau wie die Augen der Feuergöttin Tandara, deren Hohepriesterin sie war.
Metiga war nicht mehr jung, hatte vierzig Winter kommen und gehen sehen, doch ihr Körper, dessen Reize sie wirksam einzusetzen wusste, war immer noch dazu angetan, einen Mann um den Verstand zu bringen. Besonders jenen, der an der Spitze des Drachenstammes stand.
»Hage«, knurrte er, verächtlich und bewundernd zugleich, »irgendwann bringst du mich noch um.«
»Sag das nicht, Herr«, erwiderte sie mit unschuldigem Blick. »Ich bin nur aus einem einzigen Grund zu Euch gekommen: Um Euch nach Kräften zu unterstützen und Euch zu dienen, dem mächtigsten Herrscher von Myrk, erhabener noch als selbst Marfast der Unbarmherzige …«
Kunnart verzog angewidert das Gesicht. »Warum sagst du so etwas?«, fragte er aufgebracht und stieß sie von sich. »Willst du dich über mich lustig machen? Du weißt genau, dass ich seinen Namen nicht hören will. Nicht aus deinem Mund und am allerwenigsten hier.«
Metiga hatte sich auf dem Lager aufgesetzt. »Verzeih, Herr«, bat sie mit leisem Spott. »Ich wusste nicht, dass dich seine bloße Erwähnung so in Unruhe versetzt. Oder sollte es gar Furcht sein, die ich da höre?«
»Unsinn«, schnaubte er. »Dieser elende Aufschneider versetzt mich weder in Unruhe noch in Furcht.«
»Deine Leibesmitte sagt etwas anderes«, versetzte sie mit einem despektierlichen Blick.
»Verdammtes Weib!« Er packte sie an den nackten Schultern und riss sie wieder zu sich herab, sodass sie auf ihm zu liegen kam und ihr Gesicht dicht über seinem schwebte. Er konnte ihren Herzschlag spüren und ihren warmen Atem.
»Soll ich gehen, Herr?«, fragte sie. »Damit du dich ganz und gar deinem Zorn und deinem Selbstmitleid hingeben kannst?«
»Hüte deine Zunge, Metiga!«, zischte er. »Du wärst nicht die Erste, der ich sie herausschneiden lasse.«
»Sicher nicht«, gab sie zu. »Doch wer würde dir dann die Zukunft weissagen? Wer die Runen in der Glut des Feuers deuten? Und wer die Gunst der Feuergöttin für dich erflehen?«
Er sah sie an, hatte das Gefühl, sich im Reptiliengrün ihrer Augen zu verlieren. Wie so viele Male zuvor merkte er, dass sein Zorn verging wie Rauch im Wind. »Elende Hage«, knurrte er, »was machst du mit mir?«
»Ich gebe dir, was dir sonst niemand geben kann«, flüsterte sie, während sie ihn sanft liebkoste, »nämlich die Zukunft. Nicht der Häuptling des Bärenvolks, sondern du wirst siegreich sein in dem Krieg, der heraufzieht. Und nicht er wird am Ende die Krone von Myrk auf seiner Stirn tragen, sondern du, mein Geliebter.«
»Sag es mir«, stieß er hervor, während er merkte, wie sich seine Leibesmitte wieder regte – nicht nur der aufreizenden Bewegungen wegen, die Metiga auf ihm vollführte, sondern auch infolge der vielversprechenden Aussichten, die sie ihm beschrieb. »Was haben die Feuerrunen dir verraten?«
»Dass dein Erzfeind zum Krieg gegen dich rüstet«, wisperte sie. »Dass er Vorrichtungen bauen lässt, mit deren Hilfe er Skeldabryg bestürmen will – doch weder sie noch Zauberkraft werden ihn zum Ziel führen, denn du, Kunnart der Starke, wirst im Kampf gegen ihn obsiegen. Du wirst sein Haupt in den Händen halten und es seinen Leuten entgegenschleudern. Du wirst zum größten aller Anführer werden, und alle Stämme von Myrk, die hohen wie die niederen, werden sich dir unterwerfen und alle Wesen des Waldes sich vor dir beugen, die menschlichen ebenso wie die übrigen.«
»Wann?«, wollte er wissen, bebend vor Wollust.
»Schon sehr bald«, kündigte die Feuerpriesterin an, während sie ihn in einer ebenso sanften wie geschickten Bewegung in sich hineingleiten ließ. »Denn die Zeiten sind dabei, sich für immer zu ändern.«
4
»Zieht ihn hoch!«
Der Befehl war kaum verklungen, da wurde die Winde bereits betätigt. Knarrend holte sie das Seil aus dickem Lindenbast ein, dessen unteres Ende gut fünfzig Fuß tiefer im zähen schwarzen Wasser des Blutpfuhls hing.
Das längliche Gebilde, das sich schließlich daraus löste, war mit grünem Schlick und fauligem Moos überzogen. Man brauchte Fantasie, um zu begreifen, dass es ein Mann war, der dort hing, ein junger Holzfäller, der den Zorn Marfasts auf sich gezogen hatte.
Der Mann war nackt bis auf die Moosfetzen, die an ihm hingen, seine bleiche Haut bildete einen merkwürdigen Kontrast zum Eitergrün des Schlicks. Das Seil war um seine Fußgelenke geschlungen, sodass er kopfüber daran hing, seine gefesselten Arme baumelten unter ihm. Und wohin man auch sah, war sein nackter, hagerer Körper von fingerdicken, wurmähnlichen Kreaturen übersät – Blutegel, von denen es im Pfuhl nur so wimmelte und die sich an seinem Lebenssaft labten.
Auf einer schmalen, von einem hölzernen Geländer umgebenen Balustrade standen zwei Männer. Als der Gefangene unmittelbar vor ihnen hing, hob der kleinere der beiden den Arm, worauf die Winde angehalten wurde.
Kopfüber am Seil hängend, schaukelte der Gefangene vor den beiden hin und her, dabei rang er keuchend nach Luft. Einer der Egel versuchte daraufhin, in seine Mundhöhle zu kriechen. Der Mann würgte und spuckte, was seine Peiniger zu lautem Gelächter veranlasste.
»Nun?«, fragte der kleinere, dessen Haupt so kahl war wie das Ei einer Baumechse und der einen Mantel aus Hirschleder mit kunstvoll gestickten Tressen trug, als Zeichen des hohen Ranges, den er bekleidete. »Bist du jetzt endlich bereit, deinem Herrn und Häuptling die Wahrheit zu sagen?«
»I… ich …« Der Gefangene übergab sich. Wasser, das er beim Untertauchen geschluckt hatte, blubberte aus ihm heraus, zusammen mit den Resten dessen, was er gegessen hatte. »… habe … nie etwas anderes getan«, keuchte er dann. Seine Stimme hatte jeden Klang verloren, war nur noch ein Windhauch.
»Du erwartest also, dass dein Herr und Gebieter deinen dreisten Lügen Glauben schenkt, mit denen du ganz offenbar nur deine Feigheit vertuschen willst?«
»Ist … die Wahrheit«, versicherte der Gefangene noch einmal. Blinzelnd versuchte er die Augen zu öffnen, aber der Schlick rann ihm hinein, sodass er sie gleich wieder schloss. »Mein Bruder ist tot, so wie alle anderen aus dem Dorf … die Baumtöter, die Häuter, die Schneider …«
»Das wissen wir, aber wer hat sie getötet?«
»Habe ich … schon gesagt. Der Wald …«
»… wurde lebendig, ich weiß.« Der kahle kleine Mann mit dem kunstvoll gefertigten Mantel wandte sich zu dem anderen um, der schweigend hinter ihm stand, mit vor der Brust verschränkten Armen, groß und dunkel wie ein Schatten. »Ich fürchte, mehr werden wir aus ihm nicht herausbekommen, Herr.«
Der andere nickte langsam, dann trat er einen Schritt vor, was die Plattform knarren ließ. Er war ein wahrer Koloss. Nicht nur, dass er seinen Untergebenen um drei Haupteslängen überragte, seine Schultern waren auch doppelt so breit wie die des Mantelträgers. Sein Oberkörper war unbekleidet, wahre Muskelberge zeichneten sich unter der wettergegerbten und von Narben übersäten Haut ab. Um die Hüften trug er einen breiten Gürtel, ein silberner Schädel bildete die Schnalle. Von dort reichte ein Waffenrock aus Bärenfell fast bis hinab zum Boden, nur die Spitzen seiner aus Hirschleder gefertigten Stiefel waren zu sehen. Sein Haupt war von einer schwarzen Mähne überzogen, in die sich hier und dort etwas Grau mischte und die sich am Kinn mit einem dichten Bart vereinte, der die untere Gesichtspartie fast vollständig verhüllte. Was vom Mund zu sehen war, war dünnlippig und schmal, mit einem Ausdruck von Grausamkeit. Die Nase, über die eine weitere Narbe verlief, erinnerte an den Schnabel eines Raubvogels, was als Zeichen großer Entschlossenheit galt, und tatsächlich hatte es Marfast, harjatugan des mächtigsten und größten Stammes von Braka Harda, nie an Entschlusskraft fehlen lassen. In seinen eng stehenden Augen schien feurige Glut zu brennen, während er den Gefangenen durchdringend anstarrte.
»Habt … Erbarmen«, stieß dieser hervor. Seine Stimme klang bereits matt und kraftlos, während die Egel immer noch weiter an ihm sogen. »Es tut … so … weh …«
»Die Wahrheit zu finden, ist immer ein schmerzlicher Prozess«, beschied Marfast ihm grimmig. Seine Stimme ließ mehr an das Knurren eines Raubtiers denken als an ein menschliches Organ. »Wie heißt du, Sohn?«
»Falk«, kam es tonlos zurück.
»Falk.« Marfast nickte und trat ans Geländer der Plattform, beugte sich so weit vor, dass das umgedrehte Gesicht des Gefangenen direkt vor ihm schwebte und er den fauligen Gestank des Schlicks riechen konnte.
»Du weißt, wer ich bin?«
»I… ja, Herr.«
»Du weißt, wie ich mit Feiglingen verfahre?«
Der Gefangene nickte.
»Und dennoch willst du bei deiner Geschichte bleiben? Mir nicht sagen, was wirklich auf jener Lichtung geschehen ist?«
»Hab es gesagt … Wahrheit.«
»Man fand dich in einem hohlen Baum, am ganzen Körper zitternd vor Furcht, während alle anderen tot gewesen sind, grausam zugerichtet!«
»Es war der Wald … seine Rache.«
»Falk«, sagte Marfast, jetzt wieder knurrend wie ein Raubtier, »ich bin Marfast der Unbarmherzige, Sohn Hartfasts, den man den Großen nannte, und Herrscher des Bärenvolks, des mächtigsten aller Stämme von Myrk. Denkst du wirklich, ich würde es auf sich beruhen lassen, wenn jemand in mein Gebiet eindringt, meine Arbeiter tötet und auf so dreiste Weise meine Pläne stört? Sind es Wolfsmenschen gewesen? Schädelreiter? Sag es mir!«
»Das … kann ich nicht«, kam es zurück. Eisige Schauder schüttelten den Gefangenen, doch weder lag es an der klammen Kälte des Pfuhls noch am Schmerz oder dem Abscheu vor den Egeln. Etwas anderes entsetzte ihn und versiegelte seinen Mund. Etwas, das er noch weitaus mehr zu fürchten schien als Marfasts Zorn – und das ärgerte diesen …
»Barumur«, stieß der Gefangene hervor.
»Was faselst du?«
»Barumur«, wiederholte Falk Baumtöter – und es waren die letzten Worte, die er auf dieser Welt sprach.
Von jäher Wut gepackt, zückte Marfast den Dolch an seinem breiten Gürtel und durchtrennte mit einer einzigen fließenden Bewegung den Strick, an dem der Gefangene hing.
Falk kam noch dazu, einen gedämpften Laut des Entsetzens auszustoßen, dann stürzte er kopfüber in den Pfuhl hinab. Es gab ein dumpfes Platschen, als er in das dunkle Wasser eintauchte und aufgrund seiner gefesselten Arme und Beine sofort darin versank.
Marfast blickte nicht hinterher.
Die Egel würden sich um ihn kümmern.
»Was denkst du, Bredo?«, wandte er sich stattdessen an den kahlköpfigen kleinen Mann, der ihm als sein Berater und wikkan diente.
»Ich denke«, erwiderte dieser, »dass der Holzfäller die Wahrheit gesprochen hat.«
»Die Wahrheit?« Marfast ballte seine Pranken zu Fäusten. Jede davon war dazu angetan, den kleineren Mann zu zerschmettern. »Du denkst, etwas ist aus dem Wald gekommen, hat lauthals ›Baummörder‹ gerufen und all diese Männer verstümmelt?«
»Jedenfalls hat er es für die Wahrheit gehalten«, schränkte Bredo ein. Seine listigen grauen Augen funkelten dabei. »Andernfalls hätte er es nicht gewagt, Euch all dies ins Gesicht zu sagen, Herr! Bedenkt, wer Ihr seid!«
Die Schmeichelei beschwichtigte Marfast ein wenig, dennoch knurrte er, unwillig wie ein hungriges Raubtier. Er trat auf die andere Seite der Plattform, deren Bohlen wiederum unter dem Gewicht seiner Schritte knarrten, und ließ seinen Blick über die Palisadenmauern und Zinnen von Festingart schweifen, der mächtigen Baumburg, die sich seit Generationen im Besitz des Bärenstammes befand. Trutzig erhob sie sich im Norden Braka Dannas, ihre Fundamente ruhten auf den Wurzeln der aldafem, jener fünf am Flussufer gelegenen Eichen, unter deren mächtigen Kronen Marfasts Urahn Gortafast einst dem Bären begegnet war, dem er mit bloßen Händen das Rückgrat gebrochen und dessen Blut er getrunken hatte. Der Bär war dadurch zu seinem Runentier geworden, und es war die Geburtsstunde des Stammes gewesen, den Gortafast an diesem Ort begründen sollte. All das lag lange zurück, doch bis zum heutigen Tag bildeten die aldafem, die Alten Fünf, die Türme von Festingart, die nie ein Feind überwunden hatte, und so sollte es bleiben.
»Dies ist schon der vierte Vorfall dieser Art«, stellte Marfast missmutig fest. »Meine Ahnen blicken bereits auf mich herab und verspotten mich.«
»Niemand verspottet Euch, Herr«, wandte Bredo beflissen ein. »Eure Tapferkeit und Eure Verdienste sind unbestritten. Eure Krieger lieben und verehren Euch, und Eure Feinde fürchten Euch. So ist es stets gewesen, und so wird es immer sein.«
»Aber offenbar fürchten sie mich nicht genug.« Mit den Fäusten drosch Marfast auf das hölzerne Geländer ein. »Wer, Bredo? Wer ist so dreist, sich mir entgegenzustellen? Noch dazu auf solch unerhörte Art und Weise? Wer kennt meine Pläne und versucht, sie zu stören?«
»Ihr wisst, wie es heißt, mein harja«, erwiderte der Berater beflissen, »Gerüchte verbreiten sich wie Wurzelwerk – und sind ebenso schwierig zu beseitigen. Der Klang der Äxte im Wald ist nicht zu überhören. Die anderen Stämme wissen, dass ihr in großen Mengen Holz schlagen lasst, und natürlich fragen sie sich, wozu es bestimmt sein mag. Vielleicht ist der eine oder andere auf den Gedanken verfallen, dass es klüger wäre, Euch jetzt zu bekämpfen, noch ehe unsere Pläne ganz zur Entfaltung gelangen können …«
»Also ist es Kunnart«, folgerte Marfast. Der Gedanke an seinen ewigen Rivalen – den einzigen, der seinen Aufstieg noch gefährden konnte – ließ ihn vor Abscheu das Gesicht verziehen.
»Wir wissen aus zuverlässiger Quelle, dass der Herr von Skeldabryg ebenfalls zum Krieg rüstet«, räumte Bredo ein, »und es wäre durchaus denkbar, dass er hinter den Überfällen steckt. Doch weshalb finden wir die Baumtöter und Holzarbeiter stets so grässlich verunstaltet vor, mit ausgerissenen Gliedern und zerschmetterten Leibern? Und wie passt das zu dem, was uns jener Überlebende berichtet hat?«
Marfast ließ ein verächtliches Schnauben vernehmen. »Pah! Das Grauen spielt dem Verstand bisweilen Streiche. Ich habe an Schlachten teilgenommen, an deren Ende manche Krieger Stein und Bein geschworen haben, gegen leibhaftige Riesen und Trolle gekämpft zu haben. Gesehen habe ich in all den Jahren jedoch nicht eine einzige dieser Kreaturen. Vielleicht hat der Verstand des Holzfällers dieses Gemetzel einfach nicht ertragen …«
»… oder aber er ist Blendwerk erlegen«, gab der Berater zu bedenken, »einem Bann, wie nur Hagen ihn aussprechen können.«
Marfast wandte sich zu ihm um. »Du denkst …?«
»Es ist die einzige Erklärung. Wer auch immer hinter diesen Überfällen steht, nutzt den Aberglauben der Männer, um sie in Furcht und Verzweiflung zu stürzen – und metzelt sie dann aus dem Hinterhalt nieder.«
»Du hast recht«, stieß Marfast hervor. »Dies ist nicht das Werk von aufrechten Kriegern, sondern von feigen Meuchelmördern.«
»In Raska Danna gibt es noch immer viele, die dem alten Glauben frönen, Waldverehrer und Baumanbeter, die nicht wahrhaben wollen, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Womöglich haben sie sich an eine seydona gewandt, denn ihre Handschrift ist es, die ich hier lese.«
»Waldweiber und Hagenvolk.« Voller Verachtung spuckte Marfast aus. »Ich dachte, ich hätte diese Brut ausgerottet?«
»Das haben wir alle gehofft, Herr, doch anscheinend haben wir uns geirrt. Der Wald kennt viele dunkle Schlupfwinkel, die Möglichkeit ist nicht von der Hand zu weisen, dass die eine oder andere Hage Eurem gerechten Zorn entkommen konnte. Doch nun scheinen sie ihre Verstecke wieder zu verlassen, um sich an Euch zu rächen.«
Marfast atmete tief ein und aus. Er stand völlig unbewegt, nur das schwarzes Haupt wiegte er nachdenklich hin und her. »In diesem Fall«, sagte er schließlich, »sollte ich wohl noch einmal nach den blodjagon rufen. Die Jagd ist ganz offenbar noch nicht zu Ende.«
5
Die Flöte klang seltsam und fremd inmitten des Waldes, dennoch störte sie nicht die Harmonie der Natur.
Süß wie Honig und sanft wie Seidenfarn war die Melodie, die dem aus Wurzelholz gefertigten Instrument entsprang, sich mit dem Summen der Bienen und dem Gesang der Vögel verband und sich in das Gehör der uralten knorrigen Bäume schmeichelte, ehe es auf den Strahlen der wärmenden Sonne zu deren hohen Wipfeln emporstieg.
Und so wie die Klänge der Flöte eins waren mit Myrk, so war es auch die junge Frau, die auf der Flöte spielte.
In ihrer schlichten grünen Tunika kauerte sie auf einem Wurzelstumpf, die Beine angewinkelt und übereinandergeschlagen wie ein Schneider, die Augen geschlossen.
Sie war so sehr in ihr Spiel vertieft, so sehr darauf bedacht, eins zu werden mit dem Wald, dass sie weder die Hasen bemerkte, die aus dem Unterholz huschten, um den ungewohnten Tönen zu lauschen, noch den Schmetterling, der sich auf ihrem blonden, zu einem langen Zopf geflochtenen Haar niederließ, um sogleich wieder aufzuflattern und mit der Musik emporzusteigen.
In ihrem Bemühen, mit ihrer Umgebung zu verschmelzen, selbst zu einem Teil des Waldes zu werden, das Wachsen des Farns zu fühlen und den tiefen Herzschlag der Bäume, setzte sie die Flöte ab und sang das alte Lied vom ewigen Werden und Vergehen, vom Kreislauf des Lebens im Wald:
Alles hat Sinn und findet Bestimmung
Vom kleinsten Wurm bis zum mächtigsten Raubtier.
Der Wurm bereitet den Boden
und nährt die Käfer und Spinnen,
die den Vögeln zur Nahrung dienen und den kleinen Nagern,
die gejagt werden von Fuchs, Dachs und Marder.
Die fürchten den Wolf und den Bären
und den Menschen, der als einzige Kreatur
auch seinesgleichen jagt und tötet.
Wer immer fällt, zerfällt zu Staub,
dient als Nahrung dem Wurm, dem kleinsten.
Wer also ist der erste aller Jäger,
welcher der gefährlichste?
Alles hat Sinn und findet Bestimmung
im ewigen Kreislauf von Myrk …
Und für einen kurzen Moment, zum allerersten Mal in ihrem Leben, gelang es ihr!
Plötzlich schien alles eins zu werden: das Wachsen und Entstehen, die Pilze, die aus dem Boden schossen, das Keimen der jungen Sprösslinge, die einst zu mächtigen Eichen werden würden, die Geburt neuen Lebens zu Lande, zu Wasser und in den hohen Kronen der Bäume – aber auch der Tod, der Verfall und die Fäulnis, wenn sich alles wieder mit der Welt vereinte, die es hervorgebracht hatte, wieder und wieder, in vollendetem Gleichgewicht und ewigem Kreislauf.
Für einen kurzen, winzigen Augenblick lag alles vor ihr, die Schöpfung in ihrer Vollkommenheit, und sie glaubte zu verstehen, das Ganze zu sehen, das Leben in all seinen Farben. Doch schon mit dem nächsten Atemzug veränderte sich alles wieder.
Das wunderbare Gleichgewicht währte nur einen flüchtigen Augenblick, dann hatte es den Anschein, als ob das Vergehen Oberhand gewänne. Schatten krochen über das Land, vergifteten den Boden, verdörrten die Pflanzen und ließen die Tiere sterben, erstickten das Werden mit dunkler Hand – ein unheimliches, alles überwucherndes Verderben, das den Wald und alles, was in ihm lebte, verzehrte und unter sich begrub, bis nichts mehr davon übrig war. Und inmitten all des Verfalls und des fauligen Gestanks, der die Luft tränkte und in dunklen Schwaden die Sonne verfinsterte, stand ein einzelner Baum, der letzte, der geblieben war.
Sein Laub hatte er abgeworfen, er war völlig kahl. Die Rinde war grau, die Zweige abgestorben, die Wurzeln kalkig weiß und krank. Und seine Früchte, einst Lichter der Hoffnung, spendeten nicht länger Leben, sondern waren erloschen und zu Totengerippen verfallen, die grausig und leer im Pesthauch wehten, den der kalte Wind herantrug.
Am Fuß des toten Baumes jedoch, halb von Asche bedeckt und halb von giftig grauem Moos überwuchert, lag die reglose Gestalt einer alten Frau mit langem grauem Haar. In ihren knochigen Händen hielt sie eine Flöte, auf der sie bis zuletzt gespielt zu haben schien. Ihre Gesichtszüge waren ausgemergelt und entstellt, und sie hatte nur noch ein Auge, aus dem sie trübe aufsah, vom nahen Tod gezeichnet, während ihr schmaler Mund ein letztes, lautloses Wort formte.
Aldatru …
Grid schreckte empor.
Sie riss die Augen auf und schnappte nach Luft, dankbar dafür, dass sie nicht nach Verwesung, sondern nach frischem Farn und Wildkräutern roch. Ihr Herz schlug heftig, während sie sich gehetzt auf der Lichtung umblickte. Erst nach und nach begriff sie, dass in Wirklichkeit nichts geschehen war … dass sie sich noch immer an jenem ruhigen Ort befand, an den sie sich zurückgezogen hatte, um in aller Ruhe ihren Übungen nachzugehen. Doch die Bilder, die sie vor ihrem geistigen Auge gesehen hatte, waren so wirklich gewesen, der Schrecken so greifbar, dass sie noch immer das Gefühl hatte, die bittere Gegenwart des Todes zu spüren.
Erst jetzt fiel ihr auf, dass sie die Flöte gar nicht mehr in den Händen hielt. Zu ihren Füßen lag sie im Moos, musste ihr aus der Hand gefallen sein, ohne dass sie es bemerkt hatte, so sehr war sie in ihrem Wachtraum gefangen gewesen … Oder war es gar kein Traum gewesen, sondern etwas anderes?
Grid hob die Flöte vom Boden auf. Sie war aus einem einzigen, sich verzweigenden Stück Wurzelholz gefertigt und hatte zwei mit Tonlöchern versehene Klangkörper, sodass man zweistimmig auf ihr spielen konnte. Es war die einzige Flöte dieser Art, die Grid je gesehen hatte, und sie bezweifelte, dass es noch eine zweite gab – und dieselbe Flöte hatte sie in ihrer Vision erblickt.
Dieselbe Flöte hatte die alte Frau in der Hand gehabt.
Die alte Frau, die keine andere gewesen sein konnte als …
Plötzlich hielt Grid es nicht mehr aus.
Von jäher Angst getrieben schoss sie in die Höhe, rannte von der Lichtung und verschwand im dunklen Wald, schlug den kürzesten Weg zurück nach Itisdorn ein.
Frau Hulda musste hiervon erfahren.
So schnell wie möglich.
6
Die Wurzelstollen befanden sich in den Tiefen der Berge, weit unter den Gewölben, in denen die Durgenschmiede einst ihre Essen geschürt und glühenden Stahl gehämmert hatten. In alter Zeit war Eisen- und Kupfererz in diesen Stollen abgebaut worden, doch die Adern waren längst ausgebeutet und die alten Gänge aufgelassen worden. Eine andere Form von Leben hatte sich nun in ihnen ausgebreitet. Und wenn man etwas von der Zubereitung verstand, war es überaus schmackhaftes Leben, das in den dunklen Stollen gedieh.
Hanz lief das Wasser im Mund zusammen, während er den Gang hinabging, eine Grubenlaterne in der Hand und einen leeren Weidenkorb auf dem Rücken. Die Pilze, die zu beiden Seiten die Stollenwände übersäten und an einigen Stellen sogar von der Decke wucherten, waren faustgroß und weiß wie frisch gefallener Schnee, jeder einzelne davon war ein Leckerbissen.
Dass sie hier unten so gut gediehen, war ein echter Glücksfall, bescherten sie Meister Mimir und ihm doch stets gut gefüllte Mägen. Hunger, selbst im härtesten und strengsten Winter, kannten die beiden nicht, und Hanz’ Erfindungsreichtum sorgte stets dafür, dass keine Eintönigkeit aufkam: Pilzsuppe, Bratpilz, gesottener Pilz, Pilze frisch vom Feuer, herausgeschwenkt in Höhlenbutter, Pilzeintopf mit Wurzelrüben, mit Pilzen gefüllter Fisch, Pilzbrot und Pilzkuchen, Pilz an Alraune – all diese Rezepturen hatte er sich ausgedacht und war dabei sicher, noch längst nicht alle Zubereitungsweisen gefunden zu haben, mittels denen sich Höhlenpilze in ein schmackhaftes Gericht verwandeln ließen.
Der Lichtschein der Laterne, der lautlos durch den Stollen glitt, erfasste eine Nische im Fels. Hanz wusste aus Erfahrung, dass hier die schönsten und größten Pilze gediehen. Die Kappen waren makellos, die Stiele von schmalen rötlichen Adern durchzogen, was auf feinen Geschmack schließen ließ. Hanz stellte die Laterne ab und nahm den Korb von den Schultern. Dann zückte er das Messer an seinem Gürtel und begann mit der Ernte.
Ihm war natürlich klar, dass es kein Zufall sein konnte, dass Meister Mimir ihn ausgerechnet heute hierhergeschickt hatte. Der alte durgo war ein wahrer Meisterschmied und der beste Ziehvater, den sich Hanz nur wünschen konnte – aber er war auch ein furchtbar schlechter Lügner. Hanz hatte sofort durchschaut, dass Meister Mimir ihm diesen Auftrag nur gegeben hatte, um in Ruhe eine Überraschung für seinen Geburtstag vorzubereiten, denn der war heute … auch wenn es nicht wirklich sein Geburtstag war.
Wann Hanz tatsächlich geboren war, wusste er nicht, vermutlich kurz vor jenem schicksalhaften Tag, an dem er vor dem Eingang zu Meister Mimirs alter Schmiede gelegen hatte und den er seither als den Tag feierte, an dem sein Leben begonnen hatte. Denn hätte sich der Durg nicht seiner angenommen, wäre er im Wald wohl das Opfer von Wölfen, Bären oder Saribanten geworden, und sein Leben hätte geendet, noch bevor es richtig angefangen hatte. Entsprechend dankbar war Hanz seinem Ziehvater, und nicht nur dafür, dass er ihn bei sich aufgenommen und ihn an Sohnes statt großgezogen hatte. Sondern auch, weil er ihm niemals das Gefühl gegeben hatte, anders zu sein … obwohl er es in so vieler Hinsicht war.
Das begann schon mit der körperlichen Erscheinung: Während alle durgi klein und gedrungen waren und an das Leben in den Tiefen des Wurzelgebirges angepasst, war Hanz so dünn wie eine Bohnenstange und immerhin so groß, dass er sich in vielen Stollen bücken musste. Auch war es bei den Durgen Brauch, dass das Handwerk vom Vater auf den Sohn überging – doch schwächlich, wie er nun einmal war, war Hanz nicht dazu in der Lage, einen Schmiedehammer zu heben, geschweige denn ihn mehrmals hintereinander auf einen Amboss niedergehen zu lassen und dabei noch ein glühendes Stück Metall zu bearbeiten.
Hanz’ Stärken lagen auf anderen Gebieten, doch Meister Mimir hatte ihm dies nie zum Vorwurf gemacht. Im Gegenteil: Der Meister hatte Hanz stets ermutigt, das zu sein und zu tun, was in ihm war. »Es ergibt keinen Sinn«, pflegte er zu sagen, »in einem Erzbergwerk nach Kohle zu graben.« Folglich hatte sich Hanz auf das Zubereiten von Nahrung verlegt, denn das war seine Leidenschaft, und wenn das Angebot an Essbarem in den Stollen auch nicht allzu große Abwechslung bot, bereitete es ihm doch Freude, den immer gleichen Zutaten stets einen neuen Geschmack abzugewinnen, indem er verschiedene Salze oder Kräuter und Beeren aus dem Wald hinzufügte.
Doch tief in seinem Inneren spürte Hanz auch, dass es so nicht ewig weitergehen, dass er nicht für immer in Izarnabur bleiben konnte.
Anfangs hatte ihn der Gedanke erschreckt, und er hatte ihn rasch wieder verdrängt. Aber ausgerechnet heute, an seinem Geburtstag, gelang ihm dies nicht – oder war womöglich sein Geburtstag gar der Grund dafür?
Meister Mimir und die anderen Durgen, die in versprengten kleinen Sippen in den alten Stollen lebten, waren stets gut und freundlich zu ihm gewesen, warum also beschlichen ihn solche Gedanken? Hanz schämte sich dafür und schalt sich einen Narren. Mit dem Ernten der Pilze war er inzwischen fertig, der Korb war bis zum Rand gefüllt. Gerade wollte er ihn wieder auf die Schultern nehmen, als aus der Tiefe des Stollens Geräusche zu hören waren.
Ein Knirschen.
Ein heiseres Zischen.
Dann das Rieseln von losem Gestein.
»Heda!«, rief Hanz in die trübe Schwärze hinein, in der sich der Schein der Grubenlaterne schon nach wenigen Schritten verlor. Er erwartete nicht, eine Antwort zu bekommen, aber der Klang seiner eigenen Stimme, auch wenn sie hohl und dumpf von der Stollendecke hallte, hatte etwas Beruhigendes.
Nicht, dass sich Hanz im Finsteren gefürchtet hätte – wer in einem alten Erzbergwerk aufgewachsen war, gewöhnte sich von frühester Kindheit an daran. Dennoch gab es einen wichtigen Unterschied: Die durgi, deren Augen so gut an spärliche Lichtverhältnisse angepasst waren, dass sie auch dann noch alles erkennen konnten, wenn Hanz die Hand nicht mehr vor Augen sah, betrachteten die Dunkelheit als etwas Natürliches, von dem nicht zwangsläufig Bedrohung ausging; Hanz hingegen fragte sich stets, was sich dort in der teerigen Schwärze verbergen mochte, zumal wenn er seltsame Geräusche vernahm.
Zwar gab es – von Olmen, Wyrmern und Wollratten abgesehen – nicht mehr viel in diesen Stollen, das lebte. Aber irgendetwas war dort vor ihm in der Finsternis. Und dem Knirschen nach, das jetzt wieder zu hören war, kam es näher!
Unwillkürlich wich Hanz zurück, den Korb mit den Pilzen ließ er stehen. Sein Herz begann heftiger zu schlagen, eine unbestimmte Panik bemächtigte sich seiner, die er sich selbst nicht erklären konnte. Er war doch schon oft hier unten gewesen, kannte sich in den Stollen aus. Woher nun diese Furcht nur wegen ein paar seltsamer Geräusche?
Hanz schüttelte unwirsch den braunen Schopf, als könnte er seine Angst auf diese Weise loswerden. Entschlossen wollte er vortreten, um sich den Korb und die Laterne zurückzuholen – als er in der Dunkelheit jenseits des Lichtscheins eine Bewegung wahrnahm. Und im nächsten Augenblick schien die Dunkelheit selbst lebendig zu werden!
Hanz stieß einen heiseren Schrei aus, als eine riesige Kreatur aus der Tiefe des Stollens kam.
Es war ein Stollenwyrm, eines jener scheuen Geschöpfe, die in der Dunkelheit des Berges lebten. Trotz ihrer eindrucksvollen Größe – ein ausgewachsener wyrm konnte so dick wie ein Baum und so lang wie ein Fuhrwerk werden – waren die Kreaturen eigentlich harmlos und friedfertig, die durgi hatten sie in ihren Minen einst sogar als Lasttiere eingesetzt.
Dieser wyrm



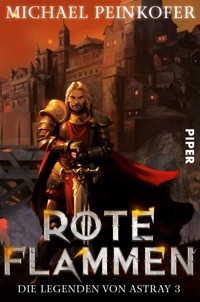
![Die Farm der fantastischen Tiere. Voll angekokelt! [Band 1] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/710616cb53ccb4acc4a9849ce5514b3c/w200_u90.jpg)
![Die Farm der fantastischen Tiere. Einfach unbegreiflich! [Band 2] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d3987251531d3c0eb5b0ada994d2676/w200_u90.jpg)