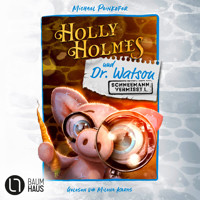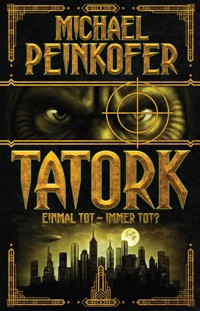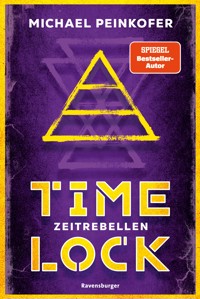8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sarah Kincaid ermittelt
- Sprache: Deutsch
Paris, 1882: Die junge englische Aristokratin Sarah Kincaid wird auf ein wissenschaftliches Symposium nach Frankreich gerufen. Von dem Wahrsager und Hypnotiseur Maurice du Gard erfährt sie, dass ihr Vater, der sich auf einer geheimen Regierungsmission befindet, in Lebensgefahr schwebt.
Sarah macht sich entgegen aller Warnungen auf, um ihn zu retten. Von Paris über Malta bis nach Alexandria führt sie die abenteuerliche Reise, die nicht nur zu Lande und zu Wasser, sondern auch durch die Tiefen des Meeres verläuft. Gejagt von einem mysteriösen Killer, findet Sarah schließlich ihren Vater. Während Alexandrien im Zuge der Urabi-Krise von britischen Kanonenbooten bombardiert wird, begeben sich die beiden in den Katakomben der Stadt auf die Suche nach dem wohl größten Geheimnis der Antike: der verschollenen Bibliothek von Alexandria ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 610
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Paris, 1882: Die junge englische Aristokratin Sarah Kincaid wird auf ein wissenschaftliches Symposium nach Frankreich gerufen. Von dem Wahrsager und Hypnotiseur Maurice du Gard erfährt sie, dass ihr Vater, der sich auf einer geheimen Regierungsmission befindet, in Lebensgefahr schwebt.
Sarah macht sich entgegen aller Warnungen auf, um ihn zu retten. Von Paris über Malta bis nach Alexandria führt sie die abenteuerliche Reise, die nicht nur zu Lande und zu Wasser, sondern auch durch die Tiefen des Meeres verläuft. Gejagt von einem mysteriösen Killer, findet Sarah schließlich ihren Vater. Während Alexandrien im Zuge der Urabi-Krise von britischen Kanonenbooten bombardiert wird, begeben sich die beiden in den Katakomben der Stadt auf die Suche nach dem wohl größten Geheimnis der Antike: der verschollenen Bibliothek von Alexandria ...
Über Michael Peinkofer
Michael Peinkofer studierte in München Germanistik, Geschichte und Kommunikationswissenschaft. Seit 1995 arbeitet er als freier Autor, Filmjournalist und Übersetzer. Unter diversen Pseudonymen hat er bereits zahlreiche Romane verschiedener Genres verfasst. Bekannt wurde er durch den Bestseller »Die Bruderschaft der Runen«. Michael Peinkofer lebt mit seiner Familie im Allgäu.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Michael Peinkofer
Die Flamme von Pharos
Nach den Aufzeichnungen von Lady Kincaid
Historischer Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
PROLOG
1. BUCH — PARIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2. BUCH — IN DER TIEFE
1
2
3
4
5
6
7
3. BUCH — ALEXANDRIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EPILOG
DANKSAGUNG
Anmerkungen
Impressum
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
IN LIEBEVOLLER ERINNERUNG AN ANNA WEIGELT
PROLOG
Kälte.
Stille.
Dunkelheit.
Der Odem von mehr als zwei Jahrtausenden dringt aus dem Stollen, dessen Wände aus glatt gehauenem Stein bestehen. Das Licht der Öllampe reicht nicht aus, um das Ende des Ganges zu erfassen, das in unergründlicher, drohender Schwärze liegt.
Das Knirschen der Stiefel auf dem feuchten und sandigen Boden stört die jahrtausendealte Stille. Mit jedem Schritt bringt der flackernde Fackelschein ein wenig mehr von jenem Ort ans Licht, den seit Menschengedenken niemand mehr betreten hat.
Vorsichtig setzt der Eindringling seinen Weg fort. Und obgleich sein keuchender Atem und das Pochen seines eigenen Herzens ihn beständig daran erinnern, dass er sich auf verbotenes Terrain begibt, ist er einen Augenblick lang unaufmerksam, lässt sich hinreißen vom süßen Gedanken an unsterblichen Ruhm.
Er bemerkt nicht, dass eine der sandbedeckten Fliesen, auf die er tritt, ein wenig nachgibt, und er hört auch nicht das Knacken hinter uralten Mauern. Ein Luftzug reißt ihn aus seinen Gedanken, und er blickt in die dunklen Nischen seitlich des Ganges, aus denen ihm im nächsten Moment blankes Verderben entgegenschlägt.
Einer jähen Eingabe folgend, wirft sich der Eindringling nach vorn auf den steinernen Boden, während die Wände des Stollens zusammenzurücken scheinen. Ein wuchtiges Geräusch erfüllt die modrige Luft, und er spürt, wie etwas ihn nur um Haaresbreite verfehlt, sich wie ein Vorhang hinter ihm schließt. Die tönerne Lampe entwindet sich seinem Griff und rollt kullernd davon – und als der Eindringling sich stöhnend aufrichtet, erkennt er, mit welch knapper Not er seinem Ende entgangen ist. Eiserne Speere, rostbesetzt, aber noch so tödlich wie vor zwei Jahrtausenden, ragen von beiden Seiten in den Gang, eine Falle, gebaut, um jeden unerwünschten Besucher bei lebendigem Leib zu pfählen.
»Die Phalanx der Makedonen«, flüstert der Eindringling.
Er weiß, dass er auf dem richtigen Weg ist, und trotz der Todesgefahr ergreift erneut die Neugier des Forschers von ihm Besitz. Er hebt die Lampe vom Boden auf und folgt dem Stollen immer weiter in die dunkle Tiefe, bis er auf einen steinernen Torbogen stößt.
Fünf Schriftzeichen sind in den Sandstein gemeißelt. Mit zitternden Händen zeichnet der Eindringling sie nach, um sich ganz sicher zu sein.
ΑΒΓΔΕ
Er kennt die Bedeutung dieser Zeichen, und mehr als je zuvor glaubt er sich dem Ziel seiner Suche nahe. Er durchschreitet den Bogen, und während sich der Stollen um ihn verbreitert und die Wände zurückweichen, schält sich im Schein der Flamme eine Pforte aus dem Dunkel.
Der Eindringling hält den Atem an, denn er ist kurz davor, das Geheimnis zu ergründen und mit eigenen Augen zu erblicken, was Jahrtausende verborgen war. Gefangen im Sog der Vergangenheit und hungernd nach wissenschaftlicher Erkenntnis, nach der Antwort auf die letzten Fragen, nähert er sich der Pforte – während ihm unbemerkt die Hand mit der Klinge folgt, ein züngelnder Schattenriss an der Wand …
In diesem Moment war die Vision zu Ende.
Wie ein Blitz aus heiterem Himmel hatte sie Maurice du Gard ereilt, zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt.
Du Gard blinzelte, brauchte einen Augenblick, um sich im Hier und Jetzt zurechtzufinden. Zu seiner Verblüffung fand er sich auf einer Bühne wieder. Ein purpurner Vorhang erhob sich vor ihm wie eine Wand, dahinter konnte er Hunderte Stimmen ungeduldig murmeln hören. Der Vergleich mit einem Bienenstock drängte sich du Gard auf, aber es waren keine Insekten, die auf der anderen Seite des Vorhangs warteten.
Es war sein Publikum …
»Mesdames et Messieurs«, ließ sich in diesem Augenblick eine heisere Stimme vernehmen, die nach Aufmerksamkeit heischte und das Gemurmel im Saal jäh verstummen ließ, »begrüßen Sie mit mir den Meister des Übersinnlichen, den Magier des Tarot, den Herrn der Hypnose – den großen Maurice du Gard …«
Applaus brandete auf, und der Vorhang teilte sich. Grelles Licht blendete du Gard, jenseits dessen er die sensationslüsterne Menge wusste. Er wusste, was von ihm erwartet wurde, und mit einem festen Schritt trat er aus der Benommenheit seiner Vision hinein ins gleißende Rampenlicht.
Es hatte begonnen …
1. BUCH
PARIS
1
GEHEIME REGIERUNGSDEPESCHE 128:
Verehrte Lady Kincaid!
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen versichern, dass entgegen allen Befürchtungen, die Sie hegen mögen, Ihr Vater wohlauf und in Sicherheit ist. Lord Kincaid bedauert, Ihnen dies nicht persönlich mitteilen zu können, aber seine Anwesenheit im Rahmen eines Ausgrabungsprojektes, das er im Regierungsauftrag durchführt, ist gegenwärtig unabdingbar. Da seine ursprünglichen Pläne, am Symposion des internationalen Forschungskreises für Archäologie in Paris teilzunehmen, dadurch durchkreuzt werden, möchte er Sie überdies bitten, ihn dort zu vertreten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine näheren Angaben bezüglich der Örtlichkeit, der Natur und des Standes der aktuellen Arbeit Ihres Vaters machen können – zu vielfältig und zu weitreichend sind die Interessen, die davon betroffen sind.
Ihr Vater ist überzeugt davon, dass Sie als treue Untertanin Ihrer Majestät der Königin Ihre Pflichten kennen und in jedem Falle wissen werden, was zu tun ist. Er lässt Sie herzlich grüßen und wünscht Ihnen alles erdenklich Gute.
Gez. Sir Wilfred Pommeroy
Sekretär des Schatzkanzlers
London, 8. Juni 1882
MUSÉE DU LOUVRE, PARIS
ACHT WOCHEN ZUVOR
Die Luft in dem kleinen Arbeitszimmer, dessen Regale bis unter die Decke mit Folianten, Dokumenten, Tonscherben, Gipsabdrücken und Abklatschen gefüllt waren, war schwül und stickig. Früher war der strenge Geruch von Staub und Sulfat Pierre Recassin wie ein Lebenselixier erschienen; an diesem Abend wurde ihm übel davon.
»Wo ist es?«
Die Stimme, die aus der Dunkelheit drang, war kalt und schneidend wie der rasiermesserscharfe Stahl, der an Recassins Kehle gepresst wurde.
»Allmählich werde ich es leid, immer dieselbe Frage zu stellen, Monsieur le Conservateur«, fuhr die Stimme fort, deren kehliger Klang Recassin eisige Schauer über den Rücken jagte. »Wo ist es? Wo haben Sie es versteckt?«
»I-ich weiß es nicht«, antwortete Recassin zum wiederholten Male. »Bitte glauben Sie mir doch, wer immer Sie sind …«
Noch immer konnte er das Gesicht des Mannes nicht sehen, der über ihm stand und auf ihn herabblickte. Der Lichtkreis der Gaslampe, die auf dem Schreibtisch stand, erfasste den Fremden nur bis zum Kinn; seine restlichen Züge blieben verborgen, nur hin und wieder hatte Recassin den Eindruck, ein mitleidlos blickendes Auge in der Finsternis blitzen zu sehen. Eine unheilvolle Aura schien den Besucher zu umgeben, Schwärze sein Begleiter zu sein.
Recassin wollte schlucken, aber die Klinge an seiner Kehle hinderte ihn daran. Blut rann an seinem Hals herab, tränkte den Kragen seines Hemdes und das Revers des Rocks.
»Ozymandias«, stieß er hilflos hervor, »Ozymandias kennt die Antwort …«
»Ist das alles?«, krächzte die Stimme, die einen eigenartigen Akzent hatte. »Wollen Sie mich mit Rätseln abspeisen? Angesichts der bedauerlichen Lage, in der Sie sich befinden, erscheint mir das mehr als unangebracht.«
»Mehr … weiß ich … nicht.« Recassins Antwort kam stoßweise, seine Stimme war kaum noch zu hören.
»Das ist nicht wahr. Auch wenn Sie alles unternommen haben, um die Spuren Ihrer Herkunft zu verwischen, weiß ich dennoch, wer Sie sind. Und deshalb weiß ich auch, was sich in Ihrem Besitz befindet. Ich frage Sie also zum letzten Mal, Recassin: Wo ist es? Lassen Sie sich gesagt sein, dass ich allmählich die Geduld mit Ihnen verliere …«
Es war weder der fremdländische Akzent noch die hochgestochene Ausdrucksweise seines Peinigers, die Recassin verstörte, sondern die Ruhe, mit der der Fremde sprach. Sie allein ließ keinen Zweifel daran, dass der Mann von der mörderischen Waffe in seiner Hand Gebrauch machen würde, wenn er nicht bekam, wonach er verlangte.
»I-ich habe … ihn nicht mehr«, erwiderte Recassin deshalb, am ganzen Leib vor Furcht zitternd.
»Wir machen Fortschritte«, erkannte der andere so leise wie spöttisch an. »Immerhin geben Sie jetzt zu, zu wissen, von welchem Gegenstand ich spreche.«
»I-ich weiß es«, gestand Recassin ein, während ihm Tränen der Angst und der Verzweiflung über die bärtigen Wangen rannen.
»Dann geben Sie ihn mir, und ich werde Sie nicht länger behelligen.«
»D-das kann ich nicht.«
»Warum nicht?«
»Weil ich ihn … nicht mehr habe.«
»Monsieur le Conservateur«, sagte die Stimme in geheucheltem Bedauern. »Sie wollen mich doch nicht etwa belügen? In Ihrer Situation wäre dies ein törichtes Unterfangen.«
»Aber ich sage Ihnen die Wahrheit … glauben Sie mir … ich habe ihn weggegeben.«
»Nachdem er sich generationenlang in Ihrem Besitz befunden hat?« Die gesichtslose Gestalt schnaubte. »Wen versuchen Sie hier zu täuschen, Recassin?«
»Bitte glauben Sie mir … habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß … Gegenstand ist nicht mehr … in meinem Besitz.«
»Wer hat ihn dann?«, wollte der Fremde wissen, und einmal mehr hatte Recassin den Eindruck, dass die Augen seines Peinigers gnadenlos blitzten.
»Ein Freund.«
»Wer?«
»Sie kennen ihn nicht.«
»Die Entscheidung darüber sollten Sie mir überlassen. Ich frage Sie also zum letzten Mal: Wem haben Sie den Gegenstand gegeben? Antworten Sie, Recassin, oder Ihr Schweigen wird der letzte Fehler sein, den Sie auf dieser Welt begehen.«
Der Fremde verstärkte den Druck der Klinge. Recassin konnte spüren, wie sie tiefer durch seine Haut schnitt, der Halsschlagader nahe kam – und er wusste, dass dies das Ende war.
So sehr seine Furcht ihn dazu drängte, den Namen dessen preiszugeben, dem er das Kleinod anvertraut hatte, so sehr wusste er, dass es sinnlos gewesen wäre. Der Tonfall seines Peinigers sagte ihm, dass dieser genoss, was er tat. Was immer Recassin auch unternahm, was immer er auch offenbarte, es würde nichts nützen. Am Ende würde der Fremde seiner Lust zu töten freien Lauf lassen. Recassin würde sterben, dessen wurde er sich in diesem Augenblick mit einer Klarheit und Nüchternheit bewusst, die ihn selbst überraschte.
Sein Tod war unausweichlich.
Also konnte er auch schweigen.
»Fahren Sie zur Hölle«, stieß er hervor und starrte trotzig dorthin, wo er das Gesicht des Fremden vermutete.
»Ist das Ihr letztes Wort?«
»Mein letztes«, bestätigte Recassin flüsternd.
»Wie recht Sie haben«, kam die zynische Antwort aus dem Dunkel. Der Fremde beugte sich vor, sodass der Lichtkreis der Lampe sein Gesicht erfasste – und mit Entsetzen erkannte Recassin, dass es nicht zwei Augen waren, sondern tatsächlich nur eines, das hasserfüllt auf ihn starrte.
Der Schrei, den er ausstoßen wollte, verließ seine Kehle nie.
Ohne zu zögern oder auch nur zu zittern, führte die Hand des Fremden die rasiermesserscharfe Sichel. Ein Blutschwall schoss aus Recassins Kehle und tränkte die Aufzeichnungen auf dem Schreibtisch vor ihm.
Einen Augenblick später schlug das Haupt des Kurators mit dumpfem Poltern zu Boden.
2
PERSÖNLICHES TAGEBUCH
SARAH KINCAID
Paris!
Seit zwei Tagen weile ich nun in der Stadt an der Seine und bereite mich auf das Symposion vor, an dem ich an Vaters Stelle teilnehmen soll – und noch immer ist mir rätselhaft, was genau es mit der Regierungsdepesche auf sich hatte, die mich in London erreichte.
Nachdem ich mehr als zwei Monate lang nichts von Vater gehört habe, wurde mir darin lapidar mitgeteilt, dass er wohlauf sei und an einem geheimen Ausgrabungsprojekt der Regierung teilnehme, über dessen Details allerdings nichts bekannt werden dürfe; dafür bat man mich, Vater beim Jahrestreffen des internationalen Forschungskreises für Archäologie an der Pariser Sorbonne zu vertreten.
So sehr es mir einerseits schmeichelt, nach Frankreich reisen und vor solch gelehrten Häuptern sprechen zu dürfen, so verwundert bin ich andererseits. Den ganzen Winter über, während er sich in seinem Arbeitszimmer und der Bibliothek von Kincaid Manor vergrub, sprach Vater von kaum etwas anderem als davon, seine Theorien, die assyrische Geschichte betreffend, den Wissenschaftskollegen vorzustellen – und nun, da sich im Rahmen des Symposions eine willkommene Gelegenheit dazu bietet, nimmt er sie nicht wahr.
Ich kann nur annehmen, dass es gute Gründe dafür gibt und dass diese Gründe in den »vielfältigen und weitreichenden Interessen« liegen, von denen in der Depesche die Rede war. Weder weiß ich, worum es dabei geht, noch kann ich mir vorstellen, dass eine archäologische Ausgrabung von solcher Wichtigkeit sein soll. Doch ich empfinde großen Stolz bei dem Gedanken, dass mein Vater diese Expedition leitet, und natürlich werde ich ihm jede Unterstützung zukommen lassen, zu der ich fähig bin. Deshalb habe ich keinen Augenblick gezögert, seiner Bitte nachzukommen und nach Paris zu reisen – noch lieber freilich hätte ich Vater wie in früheren Tagen begleitet.
Ein geheimes Ausgrabungsprojekt der Regierung …
Unablässig frage ich mich, was damit wohl gemeint sein mag. Damaskus, Kairo, Jerusalem – die Namen ferner und exotischer Orte gehen mir durch den Kopf. Alleine ihr Klang sorgt dafür, dass mein Herz schneller schlägt und ich mich zurücksehne nach jener Freiheit, die ich vor Jahren erfahren durfte. Nun hat mich die Realität unserer Tage wieder eingeholt. Vorbei die Zeiten, in denen ich meinen Vater auf seinen Streifzügen rund um die Welt begleiten und an jenem großen Abenteuer teilhaben durfte, das die Vergangenheit birgt. Nach seinem Willen soll ich eine Lady werden, soll all das lernen, was meinem Titel entspricht – dabei würde ich den Samt meiner Kleider und die früh sommerliche Wärme Europas jederzeit gegen staubigen Drillich und die sengende Sonne der Wüste tauschen.
In London hatte ich das Gefühl, inmitten trister Mauern und eng geschnürter Korsette zu ersticken – umso gelegener kam mir die Reise nach Paris, das es an Exotik zwar nicht mit Konstantinopel oder Samarkand aufnehmen kann, mir aber dennoch ein wenig Abwechslung bietet – und nicht zuletzt die Möglichkeit, vor einem anerkannten Fachpublikum zu beweisen, dass die Archäologie meine wahre Leidenschaft ist …
GRANDE AMPHITHEATRE, LA SORBONNE, PARIS
16. JUNI 1882
»… aus diesem Grund, geschätzte Zuhörer, komme ich zu dem Schluss, dass die historische Rolle von König Assurbanipal neu überdacht werden sollte. Die moderne Forschung sollte aufgeklärt genug sein, in diesem letzten bedeutenden Herrscher des Assyrerreiches das zu sehen, was er wohl auch gewesen ist: einen von Größenwahn und Machthunger zerfressenen Menschen, der buchstäblich über Leichen ging.«
Sarah Kincaid blickte von dem Manuskript auf, das vor ihr auf dem Rednerpult lag und nicht in ihrer Handschrift, sondern in der ihres Vaters verfasst war. Sie gab sich Mühe, die Aufregung zu verbergen, die sie empfand, denn nach all den Jahren, in denen sie ihren Vater auf seinen Reisen begleitet und sich dem Studium der Archäologie verschrieben hatte, war dies ihr erster großer Auftritt vor einem fachkundigen Publikum. Entsprechend schnell schlug ihr Herz, entsprechend weich waren ihre Knie.
Das Auditorium war bis zum letzten Rang hinauf besetzt, selbst auf den schmalen Gängen, die zwischen den Sitzreihen verliefen, drängten sich Zuschauer, vom Erstsemester bis hinauf zum Doktoranden. Sarah war klar, dass dieses rege Interesse nicht so sehr den Theorien Gardiner Kincaids galt, sondern der Tatsache, dass sie von seiner Tochter vorgetragen wurden. Zwar war es, im Gegensatz zu den englischen Universitäten, durchaus nicht ungewöhnlich, dass Frauen an der Sorbonne studierten; sie jedoch in solch hervorgehobener Position agieren und an einem wissenschaftlichen Symposion teilnehmen zu sehen sorgte auch hier für Erstaunen, und nicht wenigen der ergrauten Professoren, die in den ersten Sitzreihen Platz genommen hatten und in ihren hochgeschlossenen Krägen schier zu ersticken schienen, war deutlich anzusehen, was sie davon hielten.
Sarah stand in einem schlichten, beigefarbenen Kleid am Pult, das lange, dunkle Haar zu einem Zopf geflochten und hochgesteckt. Ihr für eine Lady etwas zu dunkler Teint und die Sommersprossen über ihrer keck hervorspringenden Nase waren von einer schlichten Schönheit; weder trug sie Schmuck noch sonstigen Putz; davon hielt sie nicht viel. Sie wollte in diesem Augenblick nicht in erster Linie als Frau wahrgenommen werden, sondern als Wissenschaftlerin, die die jüngsten Theorien ihres Lehrers vortrug.
»Geschätzte Zuhörer, so weit die Ausführungen Gardiner Kincaids die assyrische Spätzeit betreffend. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit«, brachte Sarah den Vortrag zu Ende – Applaus, wie er an dieser Stelle üblich gewesen wäre, blieb jedoch aus.
»Sollte es noch Fragen bezüglich der angesprochenen Hypothesen geben«, fügte Sarah deshalb hinzu, »bin ich gerne bereit, diese mit Ihnen zu diskutieren, wobei ich mich nach Kräften bemühen werde, meinen Vater würdig zu vertre …«
»Fragen habe ich allerdings!« Die Stimme, die diese Worte rief, schnitt wie ein Messer durch die Luft. In der vordersten Sitzreihe erhob sich ein hagerer Mann, der wie seine Kollegen Hemd und Rock trug. Obwohl Sarah sein Alter erst auf Mitte dreißig schätzte, strahlte er jene gravitätische Würde aus, die für gewöhnlich nur ergrauten Häuptern zu eigen war. Sein dunkles Haar stand wirr in alle Richtungen, die silberumrandete Brille auf seiner Nase bebte, während er Sarah mit vorwurfsvollen Blicken musterte.
»Wie können Sie es wagen?«, zeterte er und schien dabei Mühe zu haben, an sich zu halten. »Wie können Sie das Erbe eines der bedeutendsten Herrscher Assyriens derart in Zweifel ziehen? Die Bedeutung Assurbanipals für die abendländische Kultur ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Oder sollte Ihnen entgangen sein, dass er die erste Großbibliothek der Geschichte gegründet hat?«
»Im Gegenteil, Monsieur …«
»… Hingis«, vervollständigte der Angesprochene, dessen Schnurrbart vor Zorn bebte. »Dr. Friedrich Hingis vom Archäologischen Institut der Universität Genf.«
Hingis.
Sarah kannte den Namen. Ihr Vater hatte ihn wiederholt erwähnt. Hingis war ein Schüler Schliemanns, was bedeutete, dass er auf Gardiner Kincaid nicht gut zu sprechen war …
»Im Gegenteil, Dr. Hingis«, nahm Sarah den Fehdehandschuh auf, den der Schweizer Gelehrte ihr so unvermittelt hingeworfen hatte. »Wie Sie meinen Ausführungen entnehmen konnten, sind uns Assurbanipals Verdienste um die abendländische Geistesgeschichte durchaus bekannt. Allerdings bezweifelt mein Vater, dass Assurbanipal der erste Bibliotheksgründer war, den das Altertum kannte. Diverse Quellen deuten darauf hin, dass es schon zu wesentlich früherer Zeit bedeutende Schriftensammlungen in Ebla und Hattusa gab. Und mein Vater nimmt weiter an, dass auch in Assur selbst eine Bibliothek existierte, die bereits von Tiglatpileser eingerichtet wurde, und zwar rund ein halbes Jahrtausend zuvor.«
»Er nimmt es an!«, schmetterte Hingis spöttisch in das weite Halbrund des Hörsaals. »Und hat er dafür auch schlüssige Beweise vorgelegt?«
»Durchaus«, versicherte Sarah mit einem Lächeln, das ebenso charmant wie hintergründig war, »und ich nahm eigentlich an, ich hätte die vergangenen beiden Stunden damit zugebracht, Ihnen diese Beweise zu erläutern …«
In den oberen Rängen, wo die Erstsemester saßen, die mit den Regeln der akademischen Ordnung noch wenig vertraut waren, wurde laut gelacht. Weiter unten ließ sich verhaltener Applaus vernehmen, und einige der Gelehrten in den vordersten Reihen bedachten Hingis mit tadelnden Blicken. Dem Schweizer wurde bewusst, dass er sich bloßgestellt hatte, und er errötete. Mit gehetztem Blick schien er einen Weg aus seiner peinlichen Lage zu suchen – und fand ihn prompt …
»Ich habe Ihnen durchaus zugehört«, versicherte er, allem Anschein zum Trotz, »dennoch bin ich nicht bereit, den Theorien Ihres Vaters in allen genannten Punkten zu folgen.«
»Das steht Ihnen frei«, erwiderte Sarah gelassen. »Aber ich möchte zu bedenken geben, dass die Sammlung Assurbanipals, von der wir seit der britischen Grabung in Ninive wissen, weder eine Bibliothek im modernen noch eine im Sinn der antiken Tradition gewesen ist. Es war vielmehr eine Privatsammlung, einzig und allein dazu angetan, den Bedürfnissen des Herrschers zu dienen.«
»Das schmälert nicht die Bedeutung der Tat«, wandte Hingis ein.
»Wohl nicht, aber sie verdient auch nicht den Stellenwert, den wir ihr bislang eingeräumt haben. Um zu seinen Beständen zu gelangen, hat Assurbanipal rücksichtslos die Bestände anderer Bibliotheken, sei es in Assur oder in Babylon, geplündert. Und wir dürfen annehmen, dass er dabei ebenso wenig zimperlich zu Werke ging, wie er es bei der Festigung der Reichsgrenzen getan hat – ich erinnere in diesem Zusammenhang nur an sein Vorgehen während des babylonischen Aufstands.«
»Assurbanipal tat, was zur Sicherung seiner Herrschaft nötig war«, hielt Hingis dagegen. »Wie uns die Geschichte lehrt, sind bisweilen Opfer nötig, um die Vision von einem historisch bedeutsamen Großreich Realität werden zu lassen.«
»Die Vision von einem historisch bedeutsamen Großreich?« Sarah hob die Brauen. »Wollen Sie behaupten, dies wäre Assurbanipals Ziel gewesen?«
»Warum nicht?«
»Weil ich sehr bezweifeln möchte, dass die altorientalischen Herrscher an ihren Nachruhm dachten«, erklärte Sarah. »Was immer diese Männer taten, geschah aus persönlicher Gier nach Reichtum und Macht, und dazu war ihnen jedes Mittel recht.«
»Woher wollen Sie das wissen? Das Assyrerreich war unter Sargon das größte, das es bis dahin auf Erden gegeben hatte, und es ist völlig unstrittig, dass die Assyrer den von ihnen unterworfenen Völkern Frieden und Stabilität gebracht haben, dazu eine Kultur, die zur damaligen Zeit in der Welt führend war. Wer möchte ernstlich bestreiten, dass dies eine Vision von historischer Bedeutung ist?«
Diesmal war es Hingis, der Beifall erntete, vor allem von Seiten seiner ergrauten Kollegen, aber auch von den Rängen. Einige Professoren erhoben sich gar von ihren Sitzen, um ihrer Zustimmung Ausdruck zu verleihen.
»Eigenartig«, sagte Sarah, nachdem der Applaus verebbt war, »wieso habe ich den Eindruck, dass es bei diesem Disput nicht wirklich um das Reich der Assyrer geht?«
»Vielleicht deshalb, weil diese Thematik sehr viel aktueller ist, als Sie es sich vorstellen können«, konterte Hingis, was erneut für lautstarke Zustimmung sorgte.
»Offensichtlich«, knurrte Sarah mit Blick auf die eifrig nickende Professorenriege.
»Wenn ich Sie recht verstanden habe«, fuhr der Schweizer fort, der jetzt erst richtig in Fahrt zu kommen schien, »behaupten Sie, dass die Dominanz einer Kultur über eine andere etwas Verwerfliches ist, dessen sich die Geschichtsschreibung im Nachhinein schämen müsste.«
»Zunächst einmal«, wandte Sarah mit ruhiger Stimme ein und versuchte erneut ein Lächeln, auch wenn es ihr angesichts der zunehmend kritischen Blicke schwerfiel, »handelt es sich nicht um meine Theorien, sondern um die meines Vaters, die ich hier in aller Bescheidenheit vorgetragen habe. Dennoch bin ich wie er der Ansicht, dass kulturelle Dominanz kein angeborenes Privileg ist.«
»Was soll das heißen?« Einer der Professoren, der einen Lehrstuhl in Cambridge bekleidete und wie Sarah als Gast am Symposion teilnahm, sprang auf. »Will Ihr Vater etwa die Rechtmäßigkeit der kolonialen Idee in Zweifel ziehen? Jeder weiß, dass die moderne Welt nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht hat, sich den Herausforderungen der Zeit zu stellen und dafür zu sorgen, dass die primitiven Völker dieser Welt mit den Segnungen von Fortschritt und Technik bekannt gemacht werden. Nicht von ungefähr engagiert sich Großbritannien an vielen Schauplätzen dieser Welt, und unsere französischen Freunde« – er nickte gönnerhaft in Richtung seiner Pariser Kollegen – »nehmen seit dem vergangenen Jahr verstärkt ihre Verantwortung im Norden des afrikanischen Kontinents wahr. Wollen Sie all das in Frage stellen?«
»Nein«, stellte Sarah klar. »Wenngleich mein Vater die Methoden der kolonialen Bewegung nicht immer billigt, ist er stets ein treuer Untertan der Krone und ein vehementer Verfechter moderner Ideen gewesen. Aber er verwehrt sich dagegen, die Geschichte als Rechtfertigung zu missbrauchen.«
»Was soll das heißen?«
»Das soll heißen, dass die Geschichte der Menschheit eine Geschichte ständiger Veränderung ist«, erläuterte Sarah. »Im Augenblick mag unsere Kultur in der Welt führend sein, aber dieser Zustand muss nicht von Dauer sein – und am Ende sind wir es vielleicht, die von anderen kolonisiert und beherrscht werden.«
»Das ist unerhört!«, ereiferte sich nun auch einer der französischen Professoren. »Ein Affront! Ein Affront!«
»Nein«, widersprach Sarah gelassen, »nur die konsequente Anwendung dessen, womit wir uns täglich beschäftigen. Aus der Geschichte zu lernen sollte das oberste Ziel unserer Wissenschaft sein – oder sehen Sie das anders, meine Herren?«
Im Auditorium war Unruhe ausgebrochen. Während einzelne Studenten sich über den lautstark geführten Disput köstlich zu amüsieren schienen, ergriffen andere für ihre Lehrer und Doktorväter Partei. Immer wieder ab es Zwischenrufe, sodass Justin Guillaume, der vom Dekanat eingesetzte Sprecher des Symposions, sich schließlich genötigt sah, die Anwesenden zur Ordnung zu rufen.
»Alles, was recht ist, Lady Kincaid«, rief Hingis in das Rund der Zuschauer, die sich nur ganz allmählich wieder beruhigten. Seine Stimme triefte dabei vor Sarkasmus. »Eines muss man Ihrem Vater lassen – er hat in der Tat viel gewagt, als er Sie zu seiner Vertretung geschickt hat.«
»Was wollen Sie damit sagen?«, fragte Sarah.
»Nun, bei alldem musste er doch wissen, dass man ihn heftig angreifen und für seine Theorien zur Rede stellen würde. Wie überaus mutig von ihm, seine Tochter zu entsenden, die noch nicht einmal einen akademischen Grad besitzt.«
Erneut wurde Beifall laut. Das Lächeln verschwand aus Sarahs Zügen, der Blick ihrer blauen Augen wurde streng und eisig. Für eine Hypothese kritisiert zu werden gehörte zur akademischen Kultur und machte ihr nichts aus. Hingis allerdings war dabei, den wissenschaftlichen Disput zum persönlichen Schlagabtausch zu machen. Und obwohl eine Stimme in ihrem Hinterkopf sie davor warnte, ließ Sarah sich auf diesen Schlagabtausch ein …
»Es ist wohl wahr, dass ich keinen akademischen Grad besitze«, erwiderte sie offen und mit einer Stimme, die nicht mehr vor Aufregung bebte, sondern vor Entrüstung. »Die Gründe dafür dürften zumindest dem Gentleman aus Cambridge wohlbekannt sein. Dennoch bin ich bei einem Meister des Fachs in die Lehre gegangen, der mich wohl unterwiesen hat – nicht anders als Sie, Dr. Hingis.«
»Das lässt sich wohl kaum vergleichen.« Hingis lachte höhnisch auf. »Mein Lehrer hat, wie alle hier wissen, die Mauern Trojas wiederentdeckt, vor denen schon die Helden der homerischen Epen gefochten haben. Er hat einen Mythos aus den Nebeln der Geschichte gehoben und Wirklichkeit werden lassen – von einer solchen Entdeckung kann Ihr Vater doch nur träumen.«
»Sie ist ihm bislang verwehrt geblieben, das ist wahr«, räumte Sarah ein. Die Tatsache, dass Gardiner Kincaid dem Geheimnis von Troja ebenfalls auf der Spur gewesen, Schliemann ihm jedoch zuvorgekommen war, ließ sie unerwähnt – Hingis hätte es nur gegen sie verwendet. »Dafür«, fuhr sie fort, »hat er sich in vielen anderen Bereichen um die Geschichtsforschung im Allgemeinen und die Archäologie im Besonderen verdient gemacht und gilt als anerkannte Kapazität.«
»Wenn das so ist, warum ist er dann nicht hier?«, wandte Hingis mit überlegenem Grinsen ein. »Wieso schickt ein respektabler Gelehrter vom Schlage Lord Kincaids seine Tochter zu einer so wichtigen Zusammenkunft wie dieser?«
»Weil er verhindert ist«, entgegnete Sarah und versuchte, ihr eigenes Unwissen über den Aufenthaltsort ihres Vaters hinter einer entschlossenen Miene zu verbergen.
»Verhindert? Inwiefern?«
»Mein Vater befindet sich auf einer archäologischen Mission, über deren Details ich Ihnen allerdings nichts verraten darf.«
»Dürfen Sie es nicht? Oder können Sie es nicht?« Hingis’ Grinsen wurde immer breiter. Mit dem Gespür eines Aasfressers, der über seiner Beute kreist, tastete er sich an Sarahs wunden Punkt heran.
»Ich darf es Ihnen nicht sagen, bedaure«, erwiderte diese kühl, aber offenbar nicht überzeugend genug.
»Ich glaube Ihnen nicht«, erklärte der Schweizer in seinem geschliffenen Französisch, das anders als Sarahs frei von jedem Akzent war. »Ich denke, Sie wissen nicht, wo sich Lord Kincaid tatsächlich aufhält, was wiederum bedeutet, dass er als unentschuldigt gilt.«
»Was?« Sarah horchte auf. »Aber …«
»Laut den Statuten des Forschungskreises hat jeder Gelehrte, der dem Symposion aus welchen Gründen auch immer fernbleibt, sich unter Angabe seines gegenwärtigen Aufenthaltsortes zu entschuldigen. Andernfalls droht ihm der Ausschluss aus dem Kreis.«
»Das könnte Ihnen so passen«, ereiferte sich Sarah, die in diesem Moment nicht anders konnte, als ihrer ungestümen Natur zu folgen. »Jeder hier weiß, dass mein Vater und Sie in wissenschaftlichen Belangen erbitterte Gegner sind, Doktor. Sie tun das nur, um ihn in Misskredit zu bringen und …«
»Ich bitte Sie!« Hingis brachte es fertig, gleichzeitig pikiert und amüsiert zu klingen. »Wollen Sie mir ernstlich unterstellen, ich würde diese ehrwürdige Einrichtung dazu missbrauchen, um persönliche Fehden auszutragen?« Er schüttelte verständnislos den Kopf, und nicht wenige der Anwesenden folgten seinem Beispiel.
»Natürlich nicht«, entgegnete Sarah bissig, die nicht wusste, was sie darauf noch erwidern sollte. Sie kam sich in diesem Augenblick unendlich dumm vor. Hingis hatte sie vorgeführt, und sie hatte es noch nicht einmal bemerkt. Statt souverän aufzutreten, wie es ihre Absicht gewesen war, hatte sie durch ihre Unbeherrschtheit und ihre Art, die Dinge offen auszusprechen, nicht nur sich selbst bloßgestellt, sondern auch ihren Vater. Hingis hatte keine Gelegenheit ausgelassen, Gardiner Kincaids Ruf als seriöser Wissenschaftler zu untergraben – und Sarah hatte ihm sogar noch zugearbeitet …
»Ich denke, wir haben genug gehört, Lady Kincaid«, sagte Dekanatssprecher Guillaume. »Die Herren sehen sich in ausreichendem Maße informiert, um eine Entscheidung treffen zu können.«
»Eine Entscheidung? In welcher Sache?«
»Wie Dr. Hingis schon ankündigte, wird es darum gehen, ob Professor Kincaid noch weiterhin als Mitglied dieses Kreises zu gelten hat. Nicht genug damit, dass er es versäumt hat, uns über seine laufende Grabung zu unterrichten, hat er es auch nicht für nötig befunden, uns über seinen derzeitigen Aufenthalt in Kenntnis zu setzen. Dass die Statuten in solch gravierender Weise missachtet werden, kann das Gremium nicht ungestraft hinnehmen.«
»A-aber ich bin doch hier«, wandte Sarah stammelnd ein. »Mein Vater hat mich zu seiner Vertretung geschickt.«
»Auch in diesem Punkt sind die Statuten eindeutig. Nur anerkannten Gelehrten ist der Zutritt zu diesem Symposion gestattet. Aus alter Verbundenheit zu Ihrem Vater haben wir in Ihrem Fall eine Ausnahme gemacht, aber ich fürchte, das war ein Fehler.«
»Aber …«
»Mit Ihrem Erscheinen«, fuhr Guillaume unbeirrt fort, »haben Sie Ihrem Vater keinen guten Dienst erwiesen, Lady Kincaid – und wenn ich offen sein soll, bezweifle ich, dass er Sie dazu autorisiert hat.«
»Wollen Sie behaupten, ich wäre ohne Vaters Wissen hier?«
»Der Verdacht drängt sich auf.«
»Das ist eine infame Unterstellung«, beschwerte sich Sarah.
»Dann beweisen Sie uns das Gegenteil«, verlangte Hingis grinsend. »Verraten Sie uns, wo sich Ihr Vater gegenwärtig aufhält, und retten Sie damit sowohl seinen Ruf als auch den Ihren. Andernfalls müssen wir Sie auffordern, das Auditorium unverzüglich zu verlassen.«
Obwohl man ihr in London eingeschärft hatte, dass es sich für eine Dame von hohem Rang nicht schickte, biss Sarah sich auf die Lippen.
Jetzt erst erkannte sie das ganze Ausmaß von Hingis’ Ränkekunst auf der einen und ihrer eigenen Naivität auf der anderen Seite. Der Disput hatte von Anfang an nur darauf abgezielt, sie in Zugzwang zu bringen. Gardiner Kincaids Konkurrenten wollten wissen, woran er arbeitete, und unabhängig davon, was Sarah ihnen antwortete: Sie würde ihrem Vater auf jeden Fall schaden. Wenn sie weiterhin so tat, als wollte sie die Wahrheit für sich behalten, würde man Gardiner Kincaid aus dem Forschungskreis ausschließen – ebenso, wenn sie zugab, dass auch sie über seinen Aufenthalt nicht informiert war.
Es widerstrebte Sarah, keine Wahl mehr zu haben, und der Gedanke, dass Ihr Vater ihretwegen einen Nachteil erlitt, war ihr unerträglich. Sie war nach Paris gekommen, um ihn auf dem Symposion würdig zu vertreten, und nicht, um alles zu zerstören, wofür er die letzten zehn Jahre hart gearbeitet hatte.
Sarah war klar, dass es nur eine Möglichkeit gab, wie sich Gardiner Kincaids Name reinhalten ließ, eine Möglichkeit freilich, die das Ende ihrer eigenen akademischen Karriere bedeutete, noch ehe sie überhaupt richtig begonnen hatte. Dekanatssprecher Guillaume hatte ihr den Weg gewiesen, und ihrem Vater zuliebe war Sarah bereit, diesen Weg zu beschreiten. Denn bei allem, was die Archäologie ihr bedeutete – ihre persönliche Ehre lag ihr noch mehr am Herzen …
»In diesem Fall«, sagte sie so leise, das nur die obersten Gelehrten in den ersten Reihen sie verstehen konnten, »ist es wohl an der Zeit, Ihnen allen ein Geständnis zu machen, meine Herren. Monsieur Guillaume hatte recht, was seinen Verdacht betraf.«
»Wie dürfen wir das verstehen?«, erkundigte sich Hingis.
»Mein Vater weiß nicht, dass ich hier bin«, erklärte Sarah mit fester Stimme, »und er weiß auch nichts von dieser Zusammenkunft.«
»Aber – wie ist das möglich?«, fragte Guillaume. »Die Einladungen dazu wurden bereits vor einem halben Jahr versandt.«
»Ich weiß.« Sarah nickte. »Ich habe den Brief abgefangen, mit dem Vorsatz, die Abwesenheit meines Vaters für mein eigenes Vorankommen zu nutzen. Leider ist dieses Vorhaben kläglich gescheitert, und ich bitte Sie und ihn, mir zu verzeihen. Meinen Vater trifft keine Schuld an seinem unentschuldigten Fehlen, verehrte Messieurs – mir allein ist alles anzulasten.«
»Nun«, erwiderte der Sprecher des Dekanats einigermaßen verblüfft, »wenn das so ist …«
Die Gelehrten begannen miteinander zu tuscheln. Sarah schaute in empörte Mienen. Nasen wurde gerümpft und Brauen entrüstet hochgezogen, während die Mitglieder des Kreises sich berieten. Nur einer nahm am allgemeinen Disput nicht teil – Friedrich Hingis.
Über die ergrauten Häupter seiner Kollegen hinweg sandte er Sarah einen Blick, der nicht schwer zu deuten war. Der intrigante Gelehrte hatte gehofft, Gardiner Kincaid zu diskreditieren und womöglich auch in Erfahrung zu bringen, woran sein Erzrivale arbeitete. Dabei hatte er geglaubt, ein leichtes Spiel zu haben – dass Kincaids Tochter es vorziehen würde, sich selbst zu belasten, ehe sie ihren Vater offener Kritik aussetzte, damit hatte Hingis nicht gerechnet. Wohl deshalb, dachte Sarah, weil er selbst zu einer solchen Handlung niemals fähig gewesen wäre. Es war ein stiller Sieg für Sarah – und zugleich einer, der zu einem hohen Preis erkauft wurde, denn das Gremium reagierte mit aller Härte.
»Sarah Kincaid«, verkündete Guillaume den soeben gefassten Beschluss (und Sarah hatte das Gefühl, in seiner Stimme einen Hauch von Genugtuung zu vernehmen), »Sie haben zugegeben, ein ehrbares Mitglied dieses Forschungskreises vorsätzlich getäuscht und hintergangen zu haben. Dass es sich dabei um Ihren eigenen Vater handelt, schmälert die Tat in keiner Weise, sondern lässt sie nur noch ruchloser erscheinen. Wegen Anmaßung und vorsätzlichen Betrugs werden Sie deshalb mit augenblicklicher Wirkung dieser Räumlichkeiten verwiesen und gelten fortan auf dem gesamten Campus als unerwünschte Person. Sollten Sie diesem Beschluss zuwiderhandeln, behalten wir uns weitere Schritte vor, ansonsten werden wir mit Rücksicht sowohl auf ihr Geschlecht als auch auf Ihren Stand auf eine Anzeige bei der Polizei verzichten.«
»Danke, sehr freundlich«, sagte Sarah, ohne mit der Wimper zu zucken, aber es war ihr anzusehen, dass es ihr mit ihrer Verbundenheit nicht sehr ernst war.
»Die Gelehrten und ich können nur unsere tiefe Abscheu über Ihr Handeln zum Ausdruck bringen – es angemessen zu bestrafen sowie erzieherische Maßnahmen zu ergreifen, die eine Wiederholung in der Zukunft ausschließen, ist alleine Sache Ihres Vaters, den wir über diesen Vorfall en detail in Kenntnis setzen werden.«
»Tun Sie das«, erwiderte Sarah ruhig, »ich bin sicher, er wird es mit Interesse vernehmen.«
Mit wenigen Handgriffen packte sie ihre Unterlagen zusammen und klemmte sie sich unter den Arm. Dann verließ sie erhobenen Hauptes das Rednerpult, verfolgt von anklagenden Blicken, die erst von ihr abließen, als die schweren, goldbeschlagenen Türen des Hörsaals hinter ihr ins Schloss fielen.
Erst jetzt gab Sarah ihren Gefühlen nach.
In ihren Augenwinkeln blitzte es feucht. Sie ballte die Fäuste und bebte am ganzen Körper vor hilfloser Wut. Sarah war von sich selbst enttäuscht, von ihrer himmelschreienden Naivität, mit der sie Hingis auf den Leim gegangen war. Und nicht zuletzt ertappte Sarah sich dabei, dass ein kleiner Teil ihres Zorns auch jenem Mann galt, der sie in diese Situation gebracht hatte.
Ihrem Vater …
Eine knappe Regierungsdepesche mit der Aufforderung, nach Paris zu kommen und ihn zu vertreten – das war alles, was sie in zweieinhalb Monaten von Gardiner Kincaid gehört oder gesehen hatte. Nicht nur, dass er seine Arbeit vor ihr verheimlichte, was er noch nie zuvor getan hatte, er ließ sie auch noch ins offene Messer rennen, was das Gremium und seine Statuten betraf. Für einen Augenblick gab Sarah ihrer Frustration nach, fühlte sich einsam und im Stich gelassen – aber schon im nächsten Moment rief sie sich wieder zur Vernunft.
Sie kannte ihren Vater gut genug, um zu wissen, dass es für all dies Gründe geben musste – Gründe, die so gewichtig waren, dass sie sowohl die Geheimhaltung rechtfertigten als auch das unentschuldigte Fehlen auf einem Symposion. Der alte Gardiner hatte sicher nicht gewollt, dass Sarah seinetwegen in Schwierigkeiten geriet, also schuldete sie ihm Loyalität, was immer andere auch sagen mochten.
Sarah atmete tief durch und straffte ihre zierliche Gestalt. Vom Wunsch beseelt, den Ort der Niederlage rasch zu verlassen, passierte sie den hohen Gang mit der stuckverzierten Decke und erreichte den Haupttrakt des weitläufigen Universitätsgebäudes zwischen Boulevard Saint Michel und Rue Saint Jacques, das in seinen Grundzügen auf Richelieu zurückging und zu Beginn des Jahrhunderts beträchtlich erweitert worden war. Sarah durchquerte die von Säulen getragene Aula und hielt zielstrebig auf die hohe Pforte des Ausgangs zu – als sich aus dem Schatten einer der Säulen unvermittelt eine Gestalt löste.
»Lady Kincaid?«
Sarah, die in Gedanken versunken gewesen war, erschrak heftig, wofür es allerdings keinen Grund zu geben schien. Der Mann, der sie angesprochen hatte, war korrekt gekleidet und von fortgeschrittenem Alter. Sein schwarzer Gehrock war makellos und bot einen augenfälligen Kontrast zu seinem schlohweißen Haar und Vollbart, die ein blasses, milde blickendes Gesicht umrahmten. In seinen Händen hielt er Stock und Zylinder, der Ausdruck seiner Augen hatte etwas Jungenhaftes – und obwohl sie sich nicht erinnern konnte, ihm je zuvor begegnet zu sein, hatte Sarah den Eindruck, dass sie den Mann kennen musste …
»Ja?«, fragte sie überrascht.
»Ein Freund bat mich, Ihnen das hier zu geben«, erwiderte der fremde Gentleman, der nur auf sie gewartet zu haben schien, und händigte ihr ein mit Wachs versiegeltes Kuvert aus, das sie verblüfft entgegennahm.
»Merci beaucoup«, hörte sie sich selbst sagen, während der Fremde mit unbestimmtem Lächeln nickte, den Zylinderhut aufsetzte und zwischen den Säulen verschwand.
»Monsieur?«, rief Sarah ihm hinterher – aber der geheimnisvolle Gentleman reagierte nicht.
Ein wenig verwundert blickte Sarah auf den Brief, den er ihr gegeben hatte und der einen eigenartigen Geruch verströmte. Sie schnupperte daran und roch süßlichen Tabak, was ihre Neugier nur noch mehr entfachte. Sarah erbrach das Siegel, dessen Initialen »MG« lauteten, öffnete das Kuvert und entnahm ihm eine Karte, die handbeschrieben war. Das Wort invitation – Einladung – sprang Sarah förmlich ins Auge, und gespannt las sie weiter:
»Lady Kincaid, da uns zu Ohren gekommen ist, dass Sie in der Stadt weilen, möchten wir Sie in höflichster Form ersuchen, uns die Ehre Ihres Besuchs zu erweisen. In der Hoffnung, dass Sie Ihre wertvolle Zeit in dieser wunderbaren Stadt noch nicht anderweitig vergeben haben, würden wir uns freuen, Sie am morgigen Abend zu unserer Darbietung im Varieté ›Le Miroir Brisé‹, Rue Lepic, Montmartre, als unseren Ehrengast begrüßen zu dürfen. In hochachtungsvoller Ergebenheit: Maurice du Gard, Wahrsager und Hypnotiseur.«
Nun, da sie den Inhalt des Schreibens kannte, war Sarah noch verwunderter als zuvor. Wer, in aller Welt, war dieser Maurice du Gard? Woher kannte er ihren Namen und wusste, dass sie sich in Paris aufhielt? Und wie, in aller Welt, kam er dazu, sie zu seiner Varietédarbietung einzuladen?
In einer ersten Reaktion blickte Sarah in die Richtung, in der der rätselhafte Überbringer der Karte verschwunden war, aber von ihm war weit und breit nichts mehr zu sehen und also auch keine Antwort zu erwarten. Was aber sollte das sein? Ein schlechter Scherz? Ein Trick, den Hingis und seine Gefolgsleute sich ausgedacht hatten, um sie noch einmal vorzuführen?
Nach dem, was im Auditorium vorgefallen war, konnte Sarah sich so ziemlich alles vorstellen – aber es änderte nichts daran, dass ihr die Einladung schmeichelte. Wahrsagerei und Hypnose waren zwar beileibe nichts, wofür sie sich erwärmen konnte – im Gegenteil, sie war davon überzeugt, dass das eine wie das andere billiger Hokuspokus war, mit dem man allenfalls schlichte Gemüter beeindrucken konnte – jedoch gefiel ihr nach der herben Behandlung, die ihr vor dem Gremium zuteil geworden war, der freundliche Wortlaut der Einladung. Wenigstens, sagte sie sich, schien ihr nicht ganz Paris feindlich gesonnen zu sein …
Sarah warf einen Blick auf die Adresse.
Montmartre.
Zweifellos würden ihre Zofe und ihr Kutscher, die sie nach Paris begleitet hatten, nicht sehr erbaut darüber sein, wenn sie ausgerechnet jenem Teil von Paris einen Besuch abstattete, den ehrbare Bürger abschätzig als demimonde bezeichneten, als Halbwelt, die die Heimat von Gaunern und Prostituierten, aber auch von Künstlern und Mäzenen war. Zudem hatten sich dort seit einigen Jahren kleine Theater und Varietés niedergelassen, sodass der Montmartre auf dem besten Weg dazu war, sich zum Amüsierviertel von Paris zu entwickeln, zum schillernden Tummelplatz obskurer Gestalten und vergnügungshungriger Bürger.
Ein verwegenes Grinsen huschte über Sarahs Züge. Niedergeschlagen, wie sie sich fühlte, war die Halbwelt des Montmartre vielleicht der rechte Ort für sie, und ein wenig Zerstreuung konnte ihr nach allem, was ihr widerfahren war, tatsächlich nicht schaden. Vielleicht, sagte sie sich, würde sie so auf andere Gedanken kommen und ihren Ärger und die Enttäuschung für ein paar Stunden vergessen.
Einen Abend lang würde sie ihr bürgerliches Dasein hinter sich lassen und dem Leben der Boheme frönen, eintauchen in eine andere, fremde Welt, in der alles möglich, aber nichts so war, wie es schien. Sarah Kincaid ahnte nicht, dass es eine Reise ohne Rückkehr sein würde.
3
PERSÖNLICHES TAGEBUCH SARAH KINCAID
NACHTRAG
Ich staune, wie sich der Montmartre verändert hat.
Als ich zuletzt hier war, war ich noch ein junges Mädchen. Sanfte Hügel und Weinberge prägten damals das Bild der Landschaft, auf deren Kuppen sich malerische Windmühlen erhoben. Die Weinberge gibt es noch, aber sie sind umbaut von Häusern, die sich in engen Straßen und Gassen rings um die Hügel winden, und über allem thront der begonnene, aber noch längst nicht vollendete Bau der Basilika vom Heiligen Herzen Jesu, dessen Türme und Kuppel die Stadt einst weit überblicken werden.
Was sich am Montmartre abspielt, ist schwer zu beschreiben und für englische Begriffe kaum zu verstehen. Prunk, wie er in London nur an der Pall Mall anzutreffen ist, und Elend wie in den Gassen des East End begegnen einander scheinbar ohne Scheu; wohlhabende Damen und Herren flanieren zu den Lokalen und Varietés, während zwielichtige Gestalten in dunklen Nischen kauern und Dirnen ihre Dienste feilbieten, mit derselben Selbstverständlichkeit, mit der junge Maler ihre Bilder zum Kauf anbieten. Hier liest ein mittelloser Künstler für ein paar Centimes Oden und Gedichte, dort versucht ein Taschenspieler, den Leuten ihr Geld abzuluchsen.
Harte Wirklichkeit und schöner Schein liegen nah beisammen an diesem Ort. Allenthalben ist Musik in den Gassen zu hören, die von den unterschiedlichsten Gerüchen beherrscht werden, einige davon Ekel erregend, andere betörend. Selbst nach Einbruch der Dunkelheit herrscht auf den Hauptstraßen ein quirliges Schieben und Drängen. Das Viertel scheint bei Tag und Nacht auf den Beinen zu sein, überall wird diskutiert und parliert. Moderne und Fortschritt scheinen greifbar an diesem Ort, und nach den Erlebnissen des Tages bin ich dankbar und glücklich, ein Teil davon zu sein …
RUE LEPIC, MONTMARTRE
ABEND DES 17. JUNI 1882
Im Foyer des »Miroir Brisé« herrschte drückende Enge.
Von außen machte das Theater, das in den Mauern eines alten Weingehöfts Platz gefunden hatte, einen wenig Vertrauen erweckenden Eindruck: Von Rissen durchzogene Mauern, von denen der Putz an vielen Stellen abgesprungen war, umgaben das Etablissement, und wäre das von flackernden Gaslaternen beleuchtete Schild nicht gewesen, das das Theater als das »Haus der tausend Sensationen« anpries, hätte wohl niemand einen derart illustren Ort hinter solch trister Kulisse vermutet. Dass dieser äußere Eindruck täuschte, merkte der Besucher erst, wenn er durch die breite Eingangstür trat.
Denn wie so vieles am Montmartre war auch das »Miroir Brisé« nicht, was es auf den ersten Blick zu sein schien. Ein mit roten Teppichen ausgeschlagener Raum, dessen Wände mit ebenfalls roten Seidentapeten versehen waren, die kunstvoll verschlungene Muster aufwiesen, empfing denjenigen, der die Welt des »zersprungenen Spiegels«, betrat. Kristallene Lüster hingen von der Decke des Foyers, das die treffende Bezeichnung la chambre rouge trug. Hier drängten sich die Gäste, während ihnen von beflissenen Dienern in blauen Livrées Mäntel und Hüte abgenommen wurden und grell geschminkte junge Frauen mit wahren Ungetümen von Federputz Champagner servierten.
Sarah Kincaid verzichtete darauf, von dem perlenden Getränk zu probieren; ihr bereitete es ungleich mehr Vergnügen, am Rand zu stehen und all die illustren Gestalten zu beobachten, die das Foyer bevölkerten: Da waren ein beleibter Herr in Gehrock und Zylinder, der ein honoriges Amt zu bekleiden schien, dessen schrille Begleiterin jedoch offensichtlich einem weitaus weniger angesehenen Gewerbe nachging; ein junger Bonvivant, der zur Freude seiner applaudierenden Freunde von seinen amourösen Eskapaden berichtete; eine hagere Dame, deren pikierter Gesichtsausdruck darauf schließen ließ, wie sehr sie sich über diesen Ort empörte (was sie jedoch nicht daran hinderte, ihn aufzusuchen); schließlich ein Zwergwüchsiger, der durch die Reihen der Wartenden huschte und sich einen Spaß daraus machte, die Damen zu necken. Das Gelächter, das die von Zigarrenrauch geschwängerte Luft erfüllte, zeigte die ganze Bandbreite menschlicher Heiterkeit, vom verschämten Kichern bis zum ordinären Dröhnen. Es übertönte das Klavier, das mit frivolem Klimpern einen Musette-Walzer intonierte, und über allem lag eine unausgesprochene Spannung, die ihren Höhepunkt erreichte, als die Pforten zum Theatersaal sich öffneten.
Mit lautstarken »Aaahs« und »Ooohs« auf den Lippen drängten die Besucher in den Zuschauerraum, wobei mancher feine Herr in Rock und Schleife höchst unfein die Ellbogen zum Einsatz brachte. Sarah, die dem Treiben aus der Distanz beiwohnte, wartete ab, bis das ärgste Gedränge sich gelegt hatte. Dann erst zeigte auch sie ihre Platzkarte vor, worauf ein Theaterdiener sie zu ihrem Sitz geleitete.
Einmal mehr kam Sarah nicht umhin zu staunen. Hatte schon das Foyer mit überladenem Dekor überrascht, so galt dies umso mehr für den Zuschauerraum. Dass es sich dabei ursprünglich um die Scheune des alten Weinguts gehandelt hatte, war nicht mehr zu erkennen. Auch hier bedeckten seidene Tapeten die Wände, und funkelnder Glitter an der Decke sorgte für die Illusion eines Sternenhimmels bei klarer Nacht. Die Sitze – Sarah schätzte, dass der Raum an die zweihundert Besucher fasste – waren samtbeschlagen. Die meisten Reihen hatten sich bereits gefüllt, nur in den Logen waren noch Plätze frei. Verwundert nahm Sarah zur Kenntnis, dass der Theaterdiener sie eben dorthin führte, zu einem Sitz in der ersten Reihe, der uneingeschränkte Sicht auf die Bühne bot.
»Sind Sie sicher, dass dies mein Platz ist?«, erkundigte sie sich verwundert.
»Bien sûr, Madame«, gab der Diener mit würdevoller Miene zurück. »Monsieur du Gard hat diesen Platz eigens für Sie ausgewählt.«
»Demnach kennt er mich?«
»Gewiss«, erwiderte der Diener rätselhaft. »Monsieur du Gard kennt viele Menschen. Und er weiß alles über sie …«
Er wartete ab, bis Sarah sich gesetzt hatte, dann verbeugte er sich höflich und entfernte sich. Ein wenig ratlos blieb Sarah zurück. Noch immer fragte sie sich, wie besagter Maurice du Gard, der ein ziemlich geheimnisvoller Zeitgenosse zu sein schien, dazu gekommen war, sie einzuladen. Kannte er sie tatsächlich? Oder war er vielleicht ein Bekannter ihres Vaters?
Sie sann darüber nach, während der Saal sich vollends füllte. Auch die Logenplätze zu Sarahs Seiten wurden eingenommen, von Männern in Fräcken und Frauen, deren süßlich-blumiger Duft Sarah fast den Atem raubte. Unvermittelt erlosch der künstliche Sternenhimmel, und es wurde dunkel. Ein einzelnes Bühnenlicht flammte auf, das einen hellen Lichtkreis auf den Vorhang warf. Ein Trommelwirbel erklang, und eine Beifall heischende Stimme verkündete: »Mesdames et Messieurs, begrüßen Sie mit mir den Meister des Übersinnlichen, den Magier des Tarot, den Herrn der Hypnose – den großen Maurice du Gard!«
Beifall brandete auf, zu dem sich der Vorhang teilte – und aus der Dunkelheit trat ein schlanker Mann ins Rampenlicht.
Die glitzernde, mit allerlei fremdartigen Zeichen bestickte Robe, die er trug, sah nach billigem Kirmeszauber aus, wodurch Sarah ihre Vorurteile nur bestätigt fand. In Maurice du Gards Gesicht jedoch entdeckte sie etwas, womit sie nicht gerechnet hatte: Tiefer Ernst stand in den blassen, von schulterlangem schwarzem Haar umrahmten Zügen zu lesen, deren Alter unmöglich zu schätzen war. Und in du Gards Augen entdeckte Sarah die geweiteten Pupillen eines Menschen, der Opiate zu sich nahm.
So befremdet sie einerseits von du Gards Erscheinung war, so fasziniert war Sarah auf der anderen Seite. Und diese Mischung blieb bestehen, während du Gard sich auf der Bühne alle Mühe gab, die Zuschauer das Staunen zu lehren. Das Rampenlicht erlosch, und im Schein zweier Kerzen begann du Gard, die Zukunft zu deuten, indem er Tarotkarten legte und eine funkelnde Kristallkugel befragte. Augenblicke ausgelassener Heiterkeit – etwa wenn er einem Herrn in der vierten Reihe prophezeite, dass diesen schon bald ein dringendes Bedürfnis überkommen werde, was prompt auch kurz darauf geschah – folgten solche von atemloser Dramatik, als er in zwei Menschen aus dem Zuschauerraum, die einander vorher niemals begegnet waren, zwei in einem früheren Leben getrennte Geschwister erkannte und wieder zusammenführte. Tatsächlich stellte sich heraus, dass beide von denselben Dingen träumten, was du Gard als Beweis für eine frühere Existenz deutete und wofür er tosenden Beifall erntete.
So sehr Sarah sich gegen all dies sträubte, und so sehr sie nach rationalen Lösungen suchte (die freilich einfach zu finden waren), konnte sie nicht anders, als sich von der allgemeinen Begeisterung mitreißen zu lassen. Wehrte sie sich am Anfang noch dagegen, in du Gard etwas anderes zu sehen als einen gewitzten Scharlatan, nötigte die Art und Weise, wie er sich auf der Bühne präsentierte und das Publikum in seinen Bann schlug, ihr Respekt ab. Unwillkürlich fragte sie sich, wie ein Mann vom Schlage du Gards wohl mit einem Intriganten wie Friedrich Hingis umgesprungen wäre, und wünschte sich, auch nur einen Hauch des Selbstbewusstseins und der Ausstrahlung zu besitzen, die du Gard auf der Bühne verströmte.
Dankbar für die Zerstreuung, die die Darbietung ihr bot, gab Sarah schließlich jeden rationalen Widerstand auf und machte das, was alle im Saal taten: Sie ließ sich unterhalten und folgte bereitwillig jedem Trick und jeder Manipulation du Gards – auch dann, als er sich zwei Freiwillige aus dem Publikum aussuchte (einer von ihnen der beleibte Herr, der Sarah im Foyer aufgefallen war) und sie unter Hypnoseeinfluss dazu brachte, den Cancan zu tanzen. Das Gelächter der Zuschauer ließ den Saal erbeben, und auch Sarah ertappte sich dabei, dass sie sich ausschütten wollte vor Lachen. Ihre Heiterkeit verschwand allerdings jäh, als du Gard ankündigte, nun das Meisterstück des Abends präsentieren zu wollen, wofür er eine Dame aus dem Publikum bräuchte – und sein Blick geradewegs auf Sarah fiel.
»Die Dame in der ersten Reihe«, sagte er mit charmantem Lächeln. »Würden Sie zu mir auf die Bühne kommen?«
»Ei-eigentlich nicht«, erwiderte Sarah, die sich unversehens im Mittelpunkt des Zuschauerinteresses sah. Der Bühnenscheinwerfer erfasste sie und riss sie aus der dunklen Anonymität.
»Pourquoi?? Sie werden sich doch nicht vor mir fürchten? Keine Sorge, ma chère – der kleine Maurice ist ein artiger Junge. All die Zuschauer hier können das bezeugen …«
Spontaner Beifall brandete auf. Das Publikum fraß du Gard inzwischen aus der Hand. Sich seinem Willen zu widersetzen wäre einer Ohrfeige gleichgekommen, also rang sich Sarah ein gequältes Lächeln ab und beschloss, gute Miene zum bösen Spiel zu machen.
»Alors, das lobe ich mir. Applaus für meine mutige Freiwillige, Messieurdames. Applaus …«
Unter dem tosenden Beifall der Zuschauer stieg Sarah die Stufen zur Bühne hinauf, wo sie von du Gard in seinem Glitzerhemd in Empfang genommen wurde. Aus der Nähe betrachtet, wirkte der Franzose noch um vieles unwirklicher, aber einmal mehr fiel Sarah auf, wie ernst seine Augen blickten, selbst dann, wenn er das Publikum zum Lachen brachte.
»Bitte«, sagte er und deutete auf einen Samt beschlagenen Stuhl, der in der Mitte der Bühne stand. »Nehmen Sie Platz.«
»Und dann?«, wollte Sarah wissen.
»Du meine Güte.« Er grinste. »Sie sind misstrauisch.«
»Besser misstrauisch, als das Tanzbein zu schwingen wie La Goulue1«, erwiderte Sarah schlagfertig.
Du Gard blickte erstaunt drein und ließ ein lang gezogenes »Oooh« vernehmen, in das das Publikum mit einfiel. »Sollte mich hier jemand durchschaut haben?«, fragte er mit jungenhafter Unschuldsmiene. »Keine Angst, Mademoiselle. Ich versichere Ihnen, dass ich Ihnen weder Schmerz zufügen noch Sie zwingen werde, Ihre Beine zu zeigen – was allerdings sehr schade ist.«
Sarah bedachte du Gard mit einem strafenden Blick, während ein neuerliches »Oooh« durch den Saal ging. Dann ließ sie sich widerstrebend auf den Stuhl nieder, sodass sie dem Publikum zugewandt saß. Du Gard trat hinter sie und hielt seine Hände flach über ihren Kopf, so dicht, dass er fast ihr Haar berührte.
»Was ich nun tun werde«, kündigte er an, während erneut ein Trommelwirbel anschwoll, »grenzt an Zauberei. Es ist die höchste Weihe, die einem Vertreter meiner Kunst zuteil werden kann. Mesdames et Messieurs – ich werde nun versuchen, die Gedanken dieser jungen Frau zu lesen. Bitte verhalten Sie sich still, damit ich mich völlig konzentrieren kann …«
Jegliches Geräusch im Zuschauerraum verstummte, nur der Trommelwirbel blieb bestehen, der du Gard eigenartigerweise nicht zu stören schien. Sarah konnte nicht sehen, welche Vorstellung der Franzose hinter ihr ablieferte, aber sie war überzeugt davon, dass er alle Register seines schauspielerischen Könnens zog.
Sollte er.
Es war wissenschaftlich erwiesen, dass es nicht möglich war, die Gedanken eines Menschen zu lesen, zu erahnen oder was auch immer. Du Gard, so lautete die enttäuschende Einsicht, war eben doch nichts weiter als ein windiger Betrüger, auch wenn er seine Lügen mit ungewöhnlich viel Charme verkaufte …
»Ich empfange etwas«, verkündete er jetzt mit Effekt heischender Stimme, was Sarah nur ein müdes Lächeln entlockte. »Ich sehe es jetzt deutlich vor mir …«
»Was?«, wollte Sarah ungeduldig wissen.
»Finsternis …«, erwiderte du Gard leise.
»Das wundert mich nicht weiter«, konterte Sarah trocken.
»Sie haben die Finsternis hinter sich gelassen«, fuhr der Franzose unbeirrt fort. »Sie sind sich nicht im Klaren darüber, woher Sie kommen und wer Sie wirklich sind …«
»Wer ist das schon?«, hielt Sarah dagegen, während sie gleichzeitig merkte, wie ihre Nackenhaare sich sträubten.
War es tatsächlich möglich?
Konnte es wirklich sein?
Hatte du Gard tatsächlich in ihren Gedanken gelesen?
Natürlich nicht, es handelte sich um puren Zufall, nichts weiter. Allerdings um einen der besonders frappierenden Sorte, das musste selbst Sarah eingestehen …
»Sie kommen von weit her«, fuhr du Gard fort. »Aus einer Stadt, die in Nebeln verborgen ist …«
»Sehr gut«, erkannte sie spöttisch an, nun schon wieder ein wenig ruhiger. »Allerdings muss man kein Wahrsager sein, um meinen britischen Akzent zu bemerken.«
»Richtig«, räumte du Gard ungerührt ein, während er sich weiter zu konzentrieren schien. »Sie sind nach Paris gekommen, um jemanden in einer dringlichen Angelegenheit zu vertreten … Jemanden, der Ihnen nahe steht … sehr nahe.«
»D-das stimmt.« Sarah kam nicht umhin, verblüfft zu bejahen.
»Es ist jemand, den Sie sehr lieben. Jemand, an dem Ihr Herz mehr hängt als an jedem anderen Menschen auf dieser Welt. Mesdames et Messieurs, befinden wir uns etwa auf der Spur eines gut gehüteten Geheimnisses? Sollte diese junge Engländerin nach Frankreich gekommen sein, um ihren heimlichen Geliebten zu treffen?«
Gegen derlei Spekulationen wollte Sarah entschieden Einspruch erheben, aber der abermals anschwellende Trommelwirbel und die erneuten »Aaahs« und »Ooohs« der Zuschauer ließen sie nicht zu Wort kommen. Knisternde Spannung lag in der Luft, die sich aus unverhohlenem Voyeurismus nährte. Jeder schien dabei sein zu wollen, wenn eine junge Frau aus offenbar gutem Hause, noch dazu eine Engländerin, öffentlich zum Flittchen deklariert wurde.
»Mais non!«, gab du Gard in diesem Augenblick zu aller Enttäuschung kund. »Ich habe mich geirrt! Es ist ihr Vater, den diese junge Frau mehr als alles andere auf der Welt liebt und dessentwegen sie nach Paris gekommen ist. Applaus, Messieurdames, für diese tugendhafte junge Dame …«
Du Gard verstand sein Publikum meisterlich zu lenken. Waren die Zuschauer eben noch enttäuscht darüber gewesen, dass an diesem Abend kein Skandal ans Licht kommen würde, reagierten sie jetzt mit Erleichterung und klatschten artig Beifall, der sich noch verstärkte, als du Gard sich vor Sarah galant verbeugte und sie mit Handkuss und zuckersüßem Lächeln entließ.
Der Saal tobte und verlangte nach Zugaben, die du Gard bereitwillig gewährte. Einmal mehr waren die Besucher des »Miroir Brisé« begeistert und würden nur Gutes über das Theater an der Rue Lepic zu berichten wissen.
Anders als Sarah Kincaid.
War die Vorstellung erst vorüber, hatte sie noch eine Rechnung zu begleichen – mit einem angeblichen Wahrsager namens Maurice du Gard …



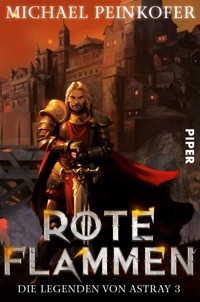
![Die Farm der fantastischen Tiere. Voll angekokelt! [Band 1] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/710616cb53ccb4acc4a9849ce5514b3c/w200_u90.jpg)



![Die Farm der fantastischen Tiere. Einfach unbegreiflich! [Band 2] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d3987251531d3c0eb5b0ada994d2676/w200_u90.jpg)