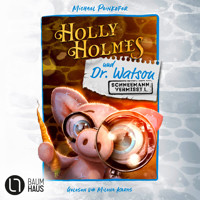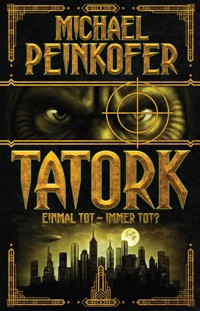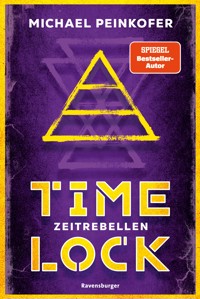
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Timelock
- Sprache: Deutsch
Die Rettung deiner Zukunft liegt in der Vergangenheit. Jason wächst in einem Überwachungsstaat auf. Doch immer wieder beschleicht ihn das Gefühl, dass etwas mit dieser Realität nicht stimmt: die Mammuts im Zoo. Die riesige Pyramide, die dem Despoten Nimrod als Herrschersitz dient. Nimrods mit übermenschlichen Kräften ausgestattete Leibgarde … Als Jason eine Widerstandsgruppe kennenlernt, erfährt er, dass Nimrod die Vergangenheit verändert hat, um in der Gegenwart die Herrschaft an sich zu reißen. Kann Jason diese Timelocks finden und zerstören? Erlebe alle Abenteuer der Mystery-Thriller-Reihe "Timelock"! Band 1: Zeitrebellen Band 2: Zeithüter (Sommer 2025) Band 3: Zeitmeister (Frühjahr 2026)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Alle Abenteuer des Mystery-Thrillers Timelock:
Zeitrebellen
Zeithüter (Sommer 2025)
Zeitmeister (Frühjahr 2026)
Als Ravensburger E-Book erschienen 2025 Die Print-Ausgabe erscheint im Ravensburger Verlag
© 2025 Ravensburger Verlag Text © 2025 by Michael Peinkofer Die Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt auf Vermittlung der literarischen Agentur Peter Molden, Köln. Covergestaltung: ZeroMedia GmbH Verwendete Bilder von Shutterstock/Mlap Studio, FinePic® Alle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.
ISBN 978-3-473-51265-2
ravensburger.com/service
Prolog
»Du wirst die Zukunft ändern!«
Die Worte scheinen überall zu sein, in seinem Kopf und um ihn herum, während rings um ihn Blitze zucken und die Nacht zum Tag machen.
»Nein!«, widerspricht er und schüttelt den Kopf. Tränen brennen in seinen Augen.
»Du willst die Zukunft ändern!«, beharrt die dunkle Gestalt, die hoch über ihm thront und mit glühenden Augen auf ihn starrt. »Denn nur du kannst die Zukunft ändern!«
»Niemals!«, ruft er in seiner Verzweiflung, und dann erinnert er sich an das Schwert in seiner Hand.
Sie kämpfen.
Klingen treffen aufeinander, Funken schlagen und fliegen hinaus in die sturmgepeitschte Nacht. Auge in Auge stehen sie einander gegenüber zum letzten, entscheidenden Kampf. Keinen von ihnen kümmert es, dass der Boden, auf dem sie stehen, nur wenige Handbreit misst und dass jeder Fehltritt den Tod bedeuten kann. Denn jenseits des rostigen Stahlträgers, auf denen sie fechtend balancieren, klafft die dunkle, alles verschlingende Tiefe!
Wäre es heller Tag, könnte man ringsum zahllose Gebäude sehen, Hochhäuser und Wolkenkratzer, die sich wie Bausteine aneinanderreihen; man könnte über die Flüsse blicken und hinaus auf die Bucht, wo die Freiheitsstatue ihre leuchtende Fackel hält. Doch die Dunkelheit, die über New York gekommen ist, ist schwärzer als jede Nacht. Nur die Blitze, die flackernd den Himmel teilen, reißen die Stadt und ihre Straßenschluchten für Augenblicke aus der Finsternis.
Er weiß, dass er keine Chance hat gegen diese Dunkelheit, und doch versucht er, sie zu bekämpfen, mit einem gekrümmten Schwert, das einst einem Samurai gehörte … Woher er das weiß, kann er nicht sagen, er erinnert sich nicht. Aber der Gedanke lässt ihn nicht mehr los.
Das Japan der Samurai.
Die Zeit der Maya.
Das antike Rom.
Das alte Ägypten.
Die letzte Eiszeit …
In diesem einen Augenblick scheint all dies zusammenzufinden, in dieser dunklen Nacht, hoch über den Dächern von New York City.
»Du hättest nicht kommen sollen!«, ruft die dunkle Gestalt mit den leuchtenden Augen ihm zu. »Nicht an diesen Ort – und nicht zu dieser Zeit!«
»Aber ich bin hier«, widerspricht er mit dem Mut der Verzweiflung, während er zugleich fühlen kann, wie die Angst nach ihm greift und sein Herz fast zerquetscht. Wieder greift der Schatten mit den glühenden Augen an, wieder trifft Stahl auf Stahl. Gerade noch kann er die Attacke abwehren, aber die Wucht des Hiebes ist zu stark!
Er verliert das Gleichgewicht und beginnt zu schwanken. Das Schwert entwindet sich seinem Griff, verschwindet in der dunklen Tiefe. Einen hässlichen Moment lang versucht er, sich auf dem schmalen Träger auszubalancieren und vor dem Sturz in den Abgrund zu bewahren – aber dann ist der Schatten da und versetzt ihm einen Stoß.
Hilflos mit den Armen rudernd, stürzt er nach vorn ins Leere, kippt in die Tiefe, die ihn wie ein hungriges Monster verschlingt. Er sieht die Straßenschluchten und die winzigen Fahrzeuge unter sich, spürt das Kribbeln in seinem Magen, doch er kann nichts tun. Nicht einmal schreien kann er, Todesangst schnürt ihm die Kehle zu, während er rücklings stürzt und stürzt. Hoch über ihm steht sein Erzfeind auf der Spitze des noch unfertigen Gebäudes, in der einen Hand das Schwert, die andere zur Siegesfaust geballt, ein schwarzer Umriss, umgeben von flackernden Blitzen.
Und das Letzte, was er hört, ist sein triumphierendes Gelächter …
1 Die Metropole
Im Jahr 2025Die Gegenwart …
»Nein!«
Indem er jäh die Augen aufriss, fand J-4418 in die Wirklichkeit zurück. Für einen Moment war er erleichtert, dass da keine Nacht war, die ihn umgab, keine Blitze und kein Abgrund, der ihn verschlang. Stattdessen umgab ihn nur nüchternes Grau.
Er hatte geträumt.
Am hellen Tag.
Schon wieder …
»Ja, J-4418?«, fragte eine Stimme, die so scharf war wie ein Messer. »Du willst etwas zum Unterricht beitragen?«
Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass es sonst völlig still war im Raum und dass aller Augen auf ihn gerichtet waren – vermutlich deshalb, weil er im Moment seines Erwachens laut geschrien hatte …
»Ich … äh … es tut mir leid«, stieß er hervor.
Manche der anderen, die ihn von allen Seiten anstarrten, grinsten hämisch. Sie alle hatten kurz geschnittene Haare. Sie alle trugen feuerrote Uniformen. Auch er selbst.
»Was tut dir leid?« Die Besitzerin der klingenscharfen Stimme trat in sein Blickfeld. Sie war groß und schlank und wie alle Lehrer am Institut in dunkles Grün gekleidet. Ihr Name war Dr. Wolff, doch die Schüler nannten sie schlicht »die Wölfin«. Und nicht nur, weil ihr kurzes Haar grau war und ihre Augen so kalt wie die eines Raubtiers. Sondern auch, weil es hieß, sie hätte schon den einen oder anderen Schüler gefressen …
»Was genau tut dir leid, J-4418?«, fragte die Lehrerin für Geschichtskunde, während sie zwischen den Reihen auf ihn zukam … fünf Reihen mit je fünf Schulbänken, die in exakten Linien ausgerichtet waren. »Dass du nichts Sinnvolles beizutragen hast? Oder dass du einmal mehr während meines Unterrichts geschlafen hast?«
»I-ich habe nicht geschlafen«, beeilte sich 4418 zu versichern. Ein paar der anderen lachten schadenfroh. »Ich habe nur …«
»Was?«, hakte die Wölfin nach. Sie trat vor seine Bank und beugte sich weit zu ihm hinab. »Was hast du getan, J-4418? Möchtest du uns davon …?« Sie verstummte plötzlich und der ohnehin schon strenge Ausdruck in ihrem Gesicht wurde noch härter, geradezu erbarmungslos. »Sind das Tränen, die ich da in deinen Augen sehe, J-4418?«
»Nei-nein«, beeilte er sich zu versichern. Mit dem Handrücken wischte er sich über die Augen, nur um festzustellen, dass sie tatsächlich feucht waren.
Der Traum!
Er hatte geträumt, Tränen in den Augen zu haben – aber warum, in aller Welt, waren sie jetzt tatsächlich nass?
Wieder lachten einige in der Klasse. Die Wölfin verzog angewidert das Gesicht. »Was habe ich über Tränen gesagt?«, erkundigte sie sich an die Klasse gewandt, wobei sich ihre Augen zu Schlitzen verengten. »A-1528?«
»Tränen sind Schwäche«, kam es aus der anderen Ecke des Klassenraumes wie aus der Pistole geschossen zurück. A-1528 war ein wenig älter als J-4418 und gehörte zu Dr. Wolffs erklärten Lieblingen. 4418 gehörte nicht dazu …
»So ist es«, bestätigte die Wölfin, ohne dabei den Blick von J-4418 zu nehmen. »Und sollen wir Schwäche zeigen?«
»Nein, Dr. Wolff.«
»Warum nicht?«
»Weil ein Feind unsere Schwäche erkennen und ausnützen könnte«, kam die Antwort ohne Zögern. »Aber es ist wichtig, dass wir alle stark sind, dass die Gemeinschaft stark ist, damit auch Nimropia stark ist und damit der Lenker auf uns alle stolz sein kann. Deshalb müssen wir alle stets wachsam sein, denn Schwäche ist wie eine Seuche, die um sich greift, und das dürfen wir nicht zulassen. Keine Macht den Schwachen!«
»Sehr gut, A-1528.« Dr. Wolff nickte ihrem Schützling wohlwollend zu. A-1528 schien vor Stolz beinahe zu platzen.
»I-ich habe nicht wirklich geweint«, beeilte sich J-4418 zu versichern. »Ich hatte nur plötzlich so ein Brennen in den Augen und da habe ich …«
»Ein Brennen in den Augen, natürlich«, sagte die Wölfin – und sie sagte es so, dass erneut einige lachten, am lautesten A-1528. »Ich werde dein Fehlverhalten dem Rektorat melden, wo man deine Bestrafung festsetzen wird … es sei denn, du kannst mir hier und jetzt den Grund dafür nennen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika am Ende des letzten Krieges besiegt und der Obhut des Lenkers unterworfen wurden.«
»Wa-was?«
Dr. Wolff hatte sich aufgerichtet und die dürren Arme vor der Brust verschränkt. »Wenn du, wie du sagst, nicht geschlafen hast, sondern nur ein wenig abgelenkt warst, solltest du zumindest in groben Zügen wiederholen können, was ich der Klasse soeben erklärt habe«, fügte sie lauernd hinzu.
J-4418 hielt ihren bohrenden Blick nicht mehr aus.
Er starrte auf die blankpolierte Schulbank vor sich, während er merkte, wie sein Gesicht heiß wurde und er gleichzeitig fröstelte. Natürlich hatte er keinen blassen Schimmer von den Dingen, nach denen seine Geschichtslehrerin fragte, wie sollte er auch? Er hatte schließlich wieder diesen dämlichen Traum gehabt … aber das konnte er ihr ja unmöglich sagen. Also starrte er weiter auf den Tisch.
Und starrte und starrte.
Und schwieg …
Eine gefühlte Ewigkeit lang ließ die Wölfin ihn schmoren, während nicht nur sie, sondern auch die ganze Klasse auf ihn starrte. »A-1528«, sagte sie schließlich nur.
»Der Grund für die Kapitulation der Vereinigten Staaten war der Abwurf der Atombombe auf Washington D.C. im Jahr 1946«, kam die Antwort erneut ohne Zögern. »Seither gehört Nordamerika zum Reich des Lenkers, es herrscht die Pax Nimrodiana.«
»Das ist richtig«, bestätigte die Wölfin, während sie 4418 einmal mehr mit ihrem Blick durchbohrte. Vielleicht wäre sie im nächsten Moment tatsächlich über ihn hergefallen und hätte ihn gefressen – hätte in diesem Moment nicht der schrille Ton der Klingel die Stunde beendet.
Dennoch blieben die Schüler alle unbewegt sitzen. Niemand hätte es gewagt, aufzustehen oder gar den Raum zu verlassen, ohne dass der Gruß gesprochen worden war …
»Du hast Glück, J-4418, wie so oft«, sagte Dr. Wolff in die Stille, die nach dem Verstummen der Klingel entstand. »Doch keine Glückssträhne hält ewig«, sagte sie mit höhnischem Grinsen voraus. »Möge Nimrod uns lenken!«
»Möge Nimrod uns lenken!«, scholl es aus vierundzwanzig Kehlen zurück.
J-4418 bewegte nur artig den Mund.
Aber kein Laut kam dabei über seine Lippen.
2 Kyoto, Japan
Zur selben Zeit
Otaku zögerte.
Der Moment, in dem man nach einem Gegenstand griff, um ihn in seiner Tasche verschwinden lassen, war immer der entscheidende. Denn danach gab es keinen Weg mehr zurück.
Man war dann ein Dieb.
Nicht mehr und nicht weniger.
Aus welchen Gründen man klaute, war den Leuten ziemlich egal, wenn sie einen erwischten, danach fragte niemand – nicht auf der Straße, nicht bei der Polizei und die Wächter schon gar nicht. Man musste also sehr genau wissen, was man tat – wonach man griff, welchen Fluchtweg man anschließend einschlagen und wo man Unterschlupf suchen wollte … und natürlich, ob die Beute das Risiko wirklich wert war.
Was Letzteres betraf, brauchte Otaku nicht lange nachzudenken. Er hatte Hunger, einen besseren Grund zu klauen gab es nicht. Die Grauen Wächter sahen das allerdings ganz anders: Wer auf dem Nishiki-Markt beim Klauen erwischt wurde, hatte keine Gnade zu erwarten, ganz gleich, worum es sich bei dem Diebstahl handelte. Erwachsene wanderten sofort ins Gefängnis, Kinder und Jugendliche wurden in eine staatliche Lehranstalt gesteckt – und wenn es einen Ort gab, an den Otaku niemals, niemals gehen wollte, dann war es die Anstalt.
Sie nannten es »Schule«.
Aber es war sehr viel mehr als das.
Man bekam dort die Haare geschnitten, wurde in eine rote Uniform gesteckt und von seinen Freunden getrennt. So ziemlich alle Kinder, die Otaku einmal gekannt und mit denen er in den Straßen gespielt hatte, waren früher oder später in einer Anstalt verschwunden. Und wenn er ihnen irgendwann zufällig wiederbegegnet war, waren sie nicht mehr dieselben gewesen. Man hatte sie zu Bürgern gemacht, zu ergebenen Untertanen des Lenkers, die keine Fragen stellten und mit dem zufrieden waren, was täglich über die großen Bildschirme flimmerte – und wenn Otaku eins ganz sicher wusste, dann dass Hana und er niemals so werden wollten.
Nein, sagte er entschlossen zu sich selbst.
Sie würden ihn nicht erwischen.
Niemals …
In geduckter Haltung, die Kapuze seines löchrigen Hoodies über den Kopf gezogen, kauerte er unter dem Verkaufstisch – genau dort, wo sich das Gemüse befand. Ringsum sah er Beine, die hektisch auf und ab gingen. Manchmal blieben Beinpaare stehen, wenn ihre Besitzer etwas kauften, nur um gleich darauf wieder weiterzugehen. Dazu war lautes Stimmengewirr zu hören, wie immer auf dem Markt.
Inmitten all dieses Treibens würde niemand auf eine Hand achten, die von unter dem Tisch emporgriff und sich ein paar Tomaten krallte … hoffte Otaku wenigstens.
Vorsichtig spähte er aus seinem Versteck, und als er halbwegs sicher war, dass niemand hinsah, langte er auch schon zu!
Der erste Griff brachte ihm gleich zwei schöne fleischige Tomaten ein, der zweite eine große Paprika. Rasch ließ er beides in seinem Beutel verschwinden. Noch mal so eine Ausbeute, sagte er sich, und Hana und er würden einen vollen Magen haben … wenigstens bis zum nächsten Tag.
Schon griff er erneut hinauf und bekam eine weitere Paprika zu fassen – als plötzlich etwas nach seiner Hand schnappte.
»Hab ich dich, du elender Dieb!«
Otaku holte erschrocken Luft, als sich die Pranke eines Erwachsenen wie ein Schraubstock um sein Handgelenk legte. Im nächsten Moment wurde er auch schon aus seinem Versteck gezerrt.
»Ich habe ihn, ich habe ihn!«, rief der Mann, der ihn festhielt und offenbar der Besitzer des Marktstandes war. »Diesmal habe ich dich erwischt, du elender Dieb!«
Für einen Moment war Otaku so erschrocken, dass er nicht wusste, was er tun sollte. Blut schoss ihm ins Gesicht und sein Herzschlag hämmerte derart, dass er ihn im Kopf hören konnte. Dann, noch bevor der Verkäufer – ein kleiner Mann, der beinahe ebenso breit war wie hoch – die Wächter rufen konnte, holte Otaku aus und trat ihm mit aller Kraft gegen das Schienbein.
»Auuu!«, jammerte der Verkäufer und lockerte seinen Griff für einen Augenblick. Das genügte Otaku, um sich loszureißen und die Flucht zu ergreifen. »Da läuft er, der Dieb!«, rief der Mann. »Lasst ihn nicht entkommen!«
Mehrere Passanten drehten sich nach Otaku um, aber ehe sie reagieren und nach ihm greifen konnten, war er schon an ihnen vorbei. Jetzt machte es sich bezahlt, dass er sich seinen Fluchtweg vorher genau überlegt hatte!
In gebückter Haltung huschte er auf die andere Seite der Budenstraße, tauchte unter zwei fleischigen Pranken hindurch, die nach ihm greifen wollten, und rettete sich mit den Beinen voran unter den nächsten Verkaufstisch. Dass er dabei durch die Überreste einer Wassermelone schlitterte, die irgendjemand hatte fallen lassen, war ihm herzlich egal. Kaum war er unter dem Tisch, huschte er auf allen vieren weiter, vorbei an Dutzenden Beinpaaren, die alle wild durcheinanderrannten.
»Wo ist er denn hin?«
»Ich habe ihn nicht gesehen!«
»Die Grauen! Wo bleiben die Grauen?«
Otakus Herz schlug ihm bis zum Hals. Wenn er mit jemandem ganz und gar nicht zusammentreffen wollte, dann waren das die Grauen Wächter. Einem dicklichen Gemüseverkäufer zu entkommen, war eine Sache. Aber bei den Wächtern, die ihren Namen den weiten grauen Mänteln verdankten, die sie stets trugen, war das nicht so einfach möglich. Wen sie erst in den Klauen hatten, den ließen sie nicht wieder los – dann hieß es ab in die Anstalt, ob man nun wollte oder nicht.
Wieselflink kroch Otaku ans Ende des Verkaufstisches. Mit einem Blick vergewisserte er sich, dass niemand hinsah, dann huschte er unter dem Tisch hervor und tauchte in die Menge der Menschen, die auf dem Markt von Kyoto einkauften.
Zuerst ging alles gut.
Wie ein Aal schlängelte er sich zwischen den Erwachsenen hindurch und glaubte schon, endlich aufatmen zu können – als er wieder jemanden rufen hörte: »Dort drüben ist er! Der mit der Kapuze!«
Und diesmal waren es nicht nur ein paar aufgebrachte Verkäufer, die die Verfolgung aufnahmen.
Es waren die Grauen Wächter!
Ein gepanzerter Einsatzwagen war vorgefahren und grobschlächtige Kerle sprangen daraus auf die Straße, jeder an die zwei Meter groß und so breit wie eine Tür. Ihre Arme waren lang und kräftig, die Gesichter kantig, die Köpfe kahlrasiert. Alle trugen verspiegelte Sonnenbrillen, sodass man ihre Augen nicht sehen konnte. Und obwohl es ein heißer Sommertag war, trugen sie wie immer ihre grauen Mäntel, die fast bis zum Boden reichten.
Der Anblick der Grauen versetzte Otaku in Panik.
Auf dem Absatz fuhr er herum und begann zu laufen. Jetzt war es kein Spiel mehr, sondern ein Rennen auf Leben und Tod, das er sich mit den Wächtern lieferte! Grimmig stürmten die grauen Riesen durch die Menschenmenge, die ihnen eingeschüchtert Platz machte, während Otaku aufpassen musste, dass ihn keine der Hände zu fassen bekam, die von allen Seiten nach ihm schnappten.
Atemlos rannte er, das Herz schlug ihm bis zum Hals. Er spürte, wie die Wächter in seinem Rücken aufholten. Sie riefen ihm etwas zu, aber es waren keine verständlichen Wörter, sondern mehr ein wütendes Brüllen, wie aus der Kehle eines Raubtiers.
Otaku rannte noch schneller.
Sein Ziel hatte er fest im Blick – den Parkplatz auf der anderen Seite des Marktes, wo sich ein Lieferwagen an den anderen reihte. Wenn es ihm gelang, die Transporter zu erreichen, war er so gut wie gerettet. Aber das musste er erst mal schaffen …
Schnell wie der Blitz huschte er hin und her, sprang hier über Marktstände und rutschte dort unter ihnen hindurch. Ein Fass, das bis zum Rand mit Zwiebeln gefüllt war, riss er im Vorbeilaufen um. Hunderte von Zwiebeln ergossen sich über den Boden, hüpften und kullerten. Der Wächter, der ihm am dichtesten folgte, rutschte darauf aus und fiel hin. Aber wenn Otaku gehofft hatte, dass die anderen Grauen dadurch aufgehalten würden, so hatte er sich gründlich geirrt. Mit einer fast übermenschlichen Reaktionsschnelle sprangen die Wächter über den Gestürzten hinweg. Fünf, sechs Meter weit setzten sie durch die Luft und verfolgten Otaku dann weiter – und kamen ihm gefährlich nahe.
Otaku hatte das Gefühl, ihren Atem in seinem Nacken zu spüren, glaubte schon, dass sie jeden Augenblick nach ihm greifen und ihn packen würden – als er endlich die Lieferwagen erreichte! Mit den Beinen voraus ließ er sich zu Boden gleiten und schlitterte unter einen Transporter – und von dort weiter zum nächsten. Otakus Ziel war das rostige Regengitter, das dort in den Asphalt eingelassen war.
Mit einem kurzen Eisenstab, den er eigens zu diesem Zweck dabeihatte, hebelte er das Gitter aus seiner Verankerung, dann glitt er mit den Beinen voraus in die dunkle Öffnung.
Obwohl es im Schacht dunkel war, fand sein rechter Fuß einen Halt, und Otaku verharrte, um das Gitter an seinen Platz zurückzuschieben.
Einer der Wächter stieß etwas hervor, das wie eine Frage klang. Die anderen antworteten mit einem wütenden Knurren, das kaum etwas Menschliches an sich hatte.
Am ganzen Körper zitternd, kletterte Otaku in die Tiefe. Der Schacht war so eng, dass kein Erwachsener durchklettern konnte, trotzdem atmete er es erst auf dem Grund des Schachts erleichtert auf.
Früher oder später würden die Wächter sicher herausfinden, wie und wohin er so plötzlich verschwunden war, aber bis dahin würde er schon weit weg sein. Er hatte es geschafft, war in Sicherheit – aber diesmal war es knapp gewesen.
Verflixt knapp …
Im spärlichen Licht, das von oben einfiel, betrachtete Otaku mit einem schiefen Grinsen seine Beute. Zwei Tomaten und eine Paprika. Nicht gerade üppig, aber für heute musste es reichen. Mit einer entschlossenen Geste stieß er die Kapuze zurück, sodass sein wirres, blau gefärbtes Haar zum Vorschein kam. Dann machte er sich durch das Labyrinth der Kanalisation auf den Weg zurück zum Versteck.
Hana wartete sicher schon.
3 Lehranstalt 118, Metropole
Unterdessen
Nach dem Geschichtsunterricht bei Dr. Wolff war Mittagspause.
Zusammen mit den anderen Schülern von Lehranstalt 118 fand J-4418 sich im Speisesaal ein, einer großen Halle mit fensterlosen Wänden. Licht fiel nur durch das gläserne Dach herein, durch das man die grauen Wolken über der Hauptstadt sehen konnte – und den Turm der Anstalt, an dessen Spitze das purpurfarbene Banner mit der Pyramide flatterte – die Fahne von Nimropia und Nimrod dem Lenker.
Den Lenker selbst hatte schon lange niemand mehr gesehen. Manche behaupteten, dass er seine Pyramide im Herzen der Stadt schon seit Jahren nicht mehr verlassen hätte. Doch seine Fahne wehte überall, nicht nur in der Metropole, sondern auch in allen anderen Städten, war allgegenwärtig.
So wie die Grauen Wächter.
Die Anstalten.
Und die Lehrer …
Nacheinander fanden sich die Klassen, die jeweils aus genau 25 Jungen und Mädchen bestanden, im Speisesaal ein. Die Schüler nahmen sich Teller und stellten sich an der Essensausgabe an. Niemand drängelte, es gab keinen Tumult. Einerseits, weil die Kameras an den Decken alles aufnahmen und man fürs Drängeln bestraft wurde. Andererseits aber auch, weil es niemand eilig hatte, zur Ausgabe zu kommen.
Klar, das Zeug, das sie dort verteilten, machte einen vollen Magen. Aber es schmeckte scheußlich.
Beklommen sah J-4418 auf den braunen Brei, den der Koch ihm auf den Teller klatschte. Früher hatte er noch herauszufinden versucht, was drin war – Getreide, vermutlich auch Gemüse, ab und zu vielleicht sogar etwas Fisch oder Fleisch. Irgendwie brachten sie es fertig, dass das Zeug nach nichts aussah und nach noch weniger schmeckte. Aber wenn man nichts anderes bekam, dann aß man es.
An richtige Nahrung konnte sich 4418 kaum erinnern. Damals war er noch ein kleiner Junge gewesen und hatte bei seinen Eltern gelebt. Auch an sie konnte er sich kaum noch erinnern. Mehr als flüchtige Eindrücke waren ihm nicht von ihnen geblieben.
An einem der langen Metalltische waren Plätze frei. Er setzte sich und begann zu löffeln, und schließlich bekam er Gesellschaft. Es war T-7516, der einzige Freund, den er in der Anstalt hatte … wenn es so etwas hier überhaupt hab.
»Mann, was es heute wieder alles zu futtern gibt«, meinte T-7516, während er seinen Teller abstellte und sich neben J-4418 setzte. »Braunbrei, frisch aus der Dose! Bin gespannt, wonach er heute schmeckt – mehr nach nichts oder doch eher nach überhaupt nichts.« Er grinste, probierte einen Löffel und machte ein nachdenkliches Gesicht. »Nach überhaupt nichts, würde ich sagen – was meinst du?«
J-4418 sah ins Gesicht des Freundes, auf dessen Kopf trotz des kurzen Haarschnitts ein Wirrwarr von blonden Locken wucherte. T-7516 war in der Lage, die Dinge so zu nehmen, wie sie nun einmal waren, und oft konnte er sogar noch darüber lachen. Er grübelte nicht so viel wie 4418, das machte die Sache einfacher für ihn …
»Sag mal, was war denn heute los mit dir?«, wollte 7516 wissen, während er drauflosspachtelte. Der Löffel in seiner Hand rotierte wie die Schaufeln eines Raddampfers. »Bist du wirklich im Unterricht eingeschlafen?«
»Natürlich nicht«, erwiderte J-4418, der lustlos in seinem Essen stocherte. »Ich hatte nur wieder den Traum.«
»Denfelben?«, fragte T-7516 mit vollem Mund.
J-4418 nickte.
Der andere schluckte runter und sah ihn mit großen Augen von der Seite an. »Das ist nicht gut.«
»Denkst du, das weiß ich nicht?«
»Weißt du noch, der Typ aus dem Schlafsaal nebenan? Seine Nummer weiß ich nicht mehr, irgendwas mit einer Acht. Aber der hatte auch immer Albträume und hat nachts im Schlaf geredet. Irgendwann haben die Wächter ihn dann abgeholt und wir haben ihn nie wieder gesehen.«
»Es ist kein Albtraum und ich rede auch nicht im Schlaf«, verteidigte sich J-4418.
»Aber du pennst mitten im Unterricht. Wenn dir das noch mal passiert, dreht die Wölfin durch.«
J-4418 biss sich auf die Lippen. »Wird es nicht«, behauptete er trotzig.
»Woher willst du das wissen?« T-7516 schaufelte wieder. »Waf, wenn ef noch flimmer wird?«
»Es wird nicht schlimmer«, stellte J-4418 klar. Wieder stocherte er in seinem Brei, dann schob er den Teller beiseite.
»Isst du das noch?«, fragte T-7516, der seine Portion schon aufgefuttert hatte.
»Nein, kannst du haben.«
»Danke, Alter.«
T-7516 zog den Teller zu sich heran und futterte weiter. Auf eine schräge Weise schien es ihm doch irgendwie zu schmecken.
»Kann … ich dich was fragen, Mann?«, begann J-4418 vorsichtig.
»Logif.«
»Hast du dich je gefragt, wer deine Eltern waren?«
»Was?« T-7516 verschluckte sich beinahe am Brei. Er ließ den Löffel sinken und starrte seinen Freund verständnislos an.
»Deine Eltern«, beharrte J-4418. »Hast du dich nie gefragt, wer sie waren?«
»Nein«, sagte T-7516 schnell, »weil man das nicht darf! Und du solltest nicht über solche Sachen reden«, fügte er hinzu, während er sich nervös umblickte. Aber von den anderen Schülern, die mit ihnen am Tisch saßen und ihren Brei löffelten, schien niemand etwas mitbekommen zu haben. Und von den Lehrern, die die Aufsicht hatten, glücklicherweise auch niemand. »Wir brauchen unsere Eltern nicht, das weißt du ganz genau. Der Lenker sorgt besser für uns, als sie es jemals könnten, und er wird immer für sein Volk da sein.«
»Das ist, was sie uns erzählen. Dabei hat keiner von uns den Schatten je gesehen …«
»Mensch!«, zischte T-7516 erschrocken. Jetzt schien sogar ihm der Appetit vergangen zu sein, denn er aß nicht mehr weiter. »Was ist denn heute los mit dir? So was darfst du nicht sagen! So darfst du den Lenker nicht nennen, das ist strengstens verboten!«
»Weiß ich«, knurrte J-4418.
Der andere schüttelte den Kopf, dass die blonden Locken wackelten. »Woher kommen all diese komischen Gedanken in deinem Kopf? Hat das was mit diesem Albtraum zu tun?«
»Es ist kein Albtraum. Es ist mehr wie …« J-4418 suchte nach dem passenden Wort. »… wie eine Erinnerung.«
»Eine Erinnerung? An was?«
»Weiß ich nicht. Aber ich sehe diese Dinge so deutlich vor mir, als wären sie wirklich geschehen. Verstehst du das?«
»Nö«, gab T-7516 offen zu.
»Vergiss es.« J-4418 winkte ab. »Aber manchmal, da kommt es mir vor, als ob …«
»Als ob was?«, hakte sein Freund nach.
»Na ja.« J-4418 zögerte, war sich nicht sicher, ob er es sagen sollte … und wie er es sagen sollte. »Als ob das alles hier einfach nicht richtig wä…«
»Sieh an, wen haben wir denn da?«, sagte plötzlich jemand hinter ihm.
J-4418 fuhr auf seinem Metallstuhl herum.
A-1528 stand vor ihm und er war nicht allein. Einige Jungs und Mädchen aus der Klasse waren bei ihm. Sie waren ihm willenlos ergeben und folgten ihm auf Schritt und Tritt. Sie nannten sich »Fünfzehner«, weil sie alle eine 15 in ihren Namen hatten.
»Wenn du mich fragst, dann ist nur eins hier nicht richtig, und das ist dein Kopf«, meinte A-1528 und lächelte dabei – natürlich lächelte er, auf den Kameras durfte es ja nicht aus aussehen, als ob er Stunk anfing. Seine Meute grinste dazu.
»Lasst mich in Ruhe«, knurrte J-4418.
»Gerne.« A-1528 grinste über sein ganzes blasses Gesicht. Er war schon sechzehn und damit nicht nur älter als J-4418, sondern auch einen Kopf größer. Und unter seinem roten Overall zeichneten sich eisenharte Sehnen und Muskeln ab. Nicht nur in Geschichtskunde war er der beste, sondern auch im Kampfsport … »Schließlich hast du nachher noch eine wichtige Verabredung beim Rektor, nicht wahr? Stell dir vor, wir wissen schon, was deine Strafe sein wird.«
J-4418 gab sich Mühe, sich seinen Ärger nicht anmerken zu lassen. Aber innerlich kochte er …
»Soweit wir gehört haben, darfst du heute die Klos im ersten Stock schrubben«, rieb ihm der andere hämisch unter die Nase.
»Na und? Das macht mir nichts aus.«
»Dann ist es ja gut.« A-1528 setzte wieder sein Kameralächeln auf. »Es könnte nämlich sein, dass der eine oder andere von uns heute vergessen wird runterzuspülen. Und verstopft werden die Toiletten wohl auch sein …«
Wieder lachten sie alle – und J-4418 ballte die Fäuste. Sein Puls beschleunigte sich, Schweiß trat ihm auf die Stirn. Am liebsten wäre er aufgesprungen und hätte sich auf A-1528 gestürzt. Dass dieser größer und stärker war als er, war ihm in diesem Moment ziemlich egal …
»Tu’s nicht«, redete T-7516 ihm halblaut zu. »Das ist es nicht wert …«
»Da hörst du’s – du solltest tun, was dein Aufpasser sagt«, tönte A-1528 weiter. »Ist auch besser, wenn ein anderer für dich die Entscheidungen trifft, so dämlich, wie du bist.«
J-4418 hörte das Blut in seinem Kopf rauschen.
Ihm war klar, dass der Ältere es nur darauf anlegte, ihn zu ärgern. Und er wusste auch, wie es später auf den Videoaufnahmen aussehen würde, wenn er jetzt aufsprang und A-1528 eins auf die Nase gab. Und dass seine Strafe dann noch um einiges schlimmer ausfallen würde … aber das alles war ihm in diesem Moment gleichgültig.
Er wollte nur, dass das höhnische Lachen aufhörte und das dämliche Grinsen über ihm endlich verschwand!
»Autsch«, sagte T-7516 plötzlich. Er sprang auf und hielt sich den Bauch.
»Was ist denn mit dir los?« A-1528 sah ihn fragend an.
»Aua«, wiederholte T-7516 und krümmte sich. »Ich hab plötzlich Bauchweh! Übles Bauchweh …«
»Kein Wunder!«, rief jemand. »Du hast ja auch zwei Portionen gefressen!«
Die anderen am Tisch begannen zu lachen, und je mehr T-7516 stöhnte und sich krümmte, desto mehr im Saal bekamen mit, was los war. Sie sprangen von ihren Stühlen auf und schauten neugierig herüber, dann kamen auch zwei von den Lehrern und schließlich die Sanitäter.
Das Durcheinander war so groß, dass A-1528 gar nicht mehr daran dachte, J-4418 zu ärgern. Und J-4418 wiederum war so besorgt um T-7516, dass er seine Wut ganz vergaß. Später, als die Sanitäter den noch immer jammernden Freund auf eine Bahre luden und hinaustrugen, um ihn auf die Krankenstation zu bringen, zwinkerte T-7516 ihm in einem kurzen, unbeobachteten Moment zu. Und J-4418 begriff.
T-7516 hatte gar kein Bauchweh.
Er spielte nur Theater, damit J-4418 keinen Blödsinn machte und etwas tat, was er später bereuen würde – spätestens dann, wenn er zwei Wochen lang die Toiletten schrubbte.
Vielleicht, sagte sich J-4418, hatte er in Anstalt 118 ja doch einen Freund.
4 Kyoto, Japan
Zur selben Zeit
Otaku war immer froh, wenn er die Kanalisation verlassen und in den alten Tunnel der Untergrundbahn wechseln konnte – erstens konnte er hier aufrecht gehen und zweitens war die Luft sehr viel besser. Allerdings konnte es furchtbar laut werden und die rostigen alten Gleise bebten, wenn nebenan auf der neuen U-Bahn-Strecke ein Zug durchfuhr.
Und es gab Ratten.
Große, haarige Biester, die so groß wie Katzen waren. Die einen sagten, die Ratten würden so groß, weil sie hier unten reichlich Fressen fanden; andere behaupteten, man hätte an der DNS der Tiere herumexperimentiert und sie dann hier unten ausgesetzt, damit sie die Bewohner der Unterwelt vertrieben: All jene, die sich weigerten, die Lehranstalten und Bürotürme zu besuchen und das zu tun, was der Lenker ihnen vorgab.
Es war ein karges, schmutziges Leben fernab vom Tageslicht. Aber es war auch ein Leben in Freiheit – jedenfalls hatte Otaku es immer so empfunden.
Endlich erreichte er die alte Haltestelle.
Viele Menschen wohnten hier unten, hatten sich Behausungen aus Karton und alten Möbelstücken errichtet. Ab und zu veranstalteten die Wächter eine Durchsuchung und nahmen fest, wen sie finden konnten – dann musste man flink sein und sich rasch eine neue Bleibe suchen. In letzter Zeit war es zwar ruhig geblieben, aber das konnte sich täglich ändern.
Otakus vorübergehendes Zuhause befand sich in einer ehemaligen Wartungskammer. Die Elektronik hatte man bereits vor langer Zeit entfernt, nur noch die Schaltkästen waren da, die er und Hana als Schränke für ihre spärliche Habe nutzten. Und es gab sogar eine Tür, die sich absperren ließ!
Es war mit Abstand die luxuriöseste Bleibe, die Otaku je gehabt hatte. Als er endlich das Nebengleis mit der Wartungskammer erreichte, klopfte er erschöpft gegen die Tür.
Dreimal lang.
Dann viermal ganz kurz.
Und noch einmal lang.
Es war das Klopfzeichen, das sie am Vortag vereinbart hatten. Kurz darauf wurde der Dornschlüssel von innen herumgedreht. Das Schloss sprang auf und Otaku drückte das rostige, quietschende Türblatt nach innen und trat ein.
»Guten Morgen!«, scholl ihm eine dünne Stimme voller Freude entgegen – und obwohl der spärliche Schein einer Notlampe die einzige Beleuchtung war, hatte es den Anschein, als würde in der kleinen Kammer die Sonne aufgehen.
Hana war schon wach.
Sie war erst acht Jahre alt, hatte aber trotzdem schon die Decken zusammengerollt, sauber gemacht und sogar schon frisches Wasser geholt.
Überhaupt war sie ungewöhnlich reif für ihr Alter. Aber das ließ sich über die meisten Kinder und Jugendlichen sagen, die hier unten in den Tunneln hausten und sich vor den Wächtern versteckten. Wenn man täglich um das Überleben kämpfte, wurde man ziemlich schnell erwachsen.
»Morgen, Krümel«, erwiderte Otaku den Gruß.
»Hast du Frühstück mitgebracht?« Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und linste neugierig nach seinem Schnappsack. Dabei drehte sie aufgeregt an ihrem Spielzeug, das sie so gut wie nie aus den Händen legte.
»Hast du schon Wasser geholt?«, fragte er dagegen.
»Und ob.« Sie nickte und warf sich stolz in die schmale Brust. »Ziemlich gut, oder?«
»Du weißt, dass du nicht allein zur Quelle gehen sollst.«
»Ich war nicht allein«, verteidigte sich Hana ein bisschen beleidigt. »Himari war dabei.«
»Trotzdem«, beharrte er.
Er zog die schäbigen Stiefel aus und stellte sie neben die Tür, dann ließ er sich erschöpft in seine Ecke sinken.
»Gibt’s jetzt Frühstück?«, fragte sie.
Er nickte müde und griff nach dem Sack mit dem Diebesgut. »Du bist eine Nervensäge, weißt du das?«
»Gleichfalls.« Sie grinste über ihr ganzes Gesicht, das so gar keine japanischen Züge an sich hatte. Wie die meisten Kinder im Untergrund konnte sich auch Hana nicht an ihre Eltern erinnern, aber sie musste aus einem anderen Land nach Japan gekommen sein, denn ihre Augen waren groß und ihr Haar hatte die Farbe von Kastanien. Manche feindeten sie deshalb an, aber Otaku war das egal. Er liebte die Verschiedenheit, so wie er die Farben liebte. Deshalb hatte er meist auch blaue Haare.
Das Mädchen legte den Kopf schief und sah ihn fragend an. »Es war knapp, oder? Beinahe hätten sie dich geschnappt …«
»Pffft«, machte er mit einer abfälligen Handbewegung. »Woher willst du denn das wissen?«
»Du bist müde, und das bist du nur, wenn du schnell laufen musstest. Und schnell laufen musst du nur, wenn sie hinter dir her waren«, rechnete Hana mit verblüffender Logik vor.
»Du bist ganz schön schlau, weißt du das?«
»Bin ja auch deine Schwester«, erwiderte sie lächelnd.
Otaku erwiderte das Lächeln. Auch wenn jeder äußere Anschein dagegensprach, sie waren wirklich wie Geschwister. Das Schicksal hatte sie zu solchen gemacht.
»Du musst gut aufpassen, hörst du? Ich habe doch sonst niemanden außer dir!« Hanas Blick nahm einen ängstlichen Ausdruck an, während sie weiter mit ihrem bunten Würfel spielte. Das Ding war gerade so groß, dass es in ihre Hände passte, und hatte von jeder Seite drei Ebenen, um die es sich drehen ließ. Ziel des Spiels war es vermutlich, alle Felder mit derselben Farbe auf eine Seite zu bringen, aber Otaku konnte sich nicht erinnern, dass es ihr jemals gelungen war. Überhaupt war es ein seltsames Spielzeug, das er noch nie zuvor gesehen hatte. Vermutlich stammte es noch von ihren Eltern, und das war wohl auch der Grund, warum sie es so gut wie nie aus den Händen legte.
»Keine Sorge«, versicherte er. »Ich komme immer zurück.«
»Aber es ist gefährlicher geworden«, beharrte sie.
»Du brauchst keine Angst zu haben.« Er sah sich in ihrem kleinen Zuhause um. »Hier drin sind wir sicher.«
»Und wenn sie doch mal wieder kommen? Die Grauen Wächter, meine ich.«
»Dann sind wir in kürzester Zeit hier weg.«
»Ich will nicht, dass sie uns fangen«, erwiderte Hana leise. »Dann würden sie uns trennen und uns in rote Anzüge stecken. Und dir würden sie die blauen Haare abschneiden«, fügte sie hinzu, auf seinen Kopf deutend.
»Das wird nicht passieren.«
»Und es würde mir niemand mehr Geschichten vorlesen«, sagte sie leise und setzte sich ihm gegenüber. »Ich liebe deine Geschichten, weißt du?«
Otaku nickte. »Ich weiß.«
»Kannst du mir nachher eine erzählen?«
»Welche denn?«, fragte er.
»Die vom Aschenputtel und dem goldenen Schuh.«
»Ach nein.« Otaku schüttelte den Kopf. »Nicht die schon wieder …«
»Bittebitte«, quengelte sie. »Das ist meine Lieblingsgeschichte. Das Mädchen darin hat keine Eltern mehr, richtig? Genau wie wir …«
»Hai«, stimmte Otaku leise zu. »Genau wie wir.«
»Aber trotzdem geht die Geschichte am Ende gut aus«, beharrte Hana.
»Stimmt auch«, gab er zu. Hoffentlich fragte sie ihn als Nächstes nicht, ob auch ihre Geschichte gut ausgehen würde. Darauf wusste er nämlich keine Antwort. »Also schön«, gab er sich geschlagen. »Ich erzähle sie dir gleich nach dem Essen.«
»Du hast also Frühstück mitgebracht?« Ihre Augen leuchteten wieder.
»Natürlich, was denkst du denn?« Er griff in den Sack und holte die beiden Tomaten und die Paprika hervor, die er mit Mühe erbeutet hatte. Dass er dabei tatsächlich um ein Haar geschnappt worden war, sagte er nicht. So wie er verschwieg, dass es tatsächlich immer schwieriger wurde, Essen zu besorgen, und die Gefahr, von den Grauen Wächtern geschnappt zu werden, immer größer.
Er gab Hana die Hälfte der Beute ab. Schweigend saßen sie nebeneinander im Halbdunkel und aßen.
5 Lehranstalt 118, Metropole
In der Nacht …
An diesem Abend kam J-4418 erst spät ins Bett.
Wie die Fünfzehner vorausgesagt hatten, war ihm Toilettendienst aufgebrummt worden und A-1528 und seine Bande hatten alles getan, damit es länger dauerte. Mitternacht war schon vorbei, als er sich todmüde in den zweiten Stock schleppte, wo sich die Schlafräume befanden. Sein Rücken schmerzte und die Arme taten ihm vom Schrubben so weh, dass er das Gefühl hatte, sie würden jeden Moment abfallen.
Auf den Test, den sie am nächsten Tag schreiben würden, hatte er sich natürlich nicht vorbereiten können. Neben einer schlechten Bewertung würde er sich vermutlich eine weitere Bestrafung einhandeln. Aber sich zu beschweren, hätte nichts genutzt. Dr. Wolff glaubte ihm ohnehin kein Wort und so hatte 4418 irgendwann beschlossen, einfach alles zu tun, was von ihm verlangt wurde. Er tröstete sich damit, dass es zumindest eines gab, was sie nicht kontrollieren konnten.
Seine Gedanken …
Obwohl er von oben bis unten nach Toilette roch, durfte er um diese Zeit nicht mehr duschen. Er wusch sich Gesicht und Hände, dann schleppte er sich in den Schlafsaal. Licht zu machen wagte er nicht aus Sorge, A-1528 und seine Kumpane zu wecken, die auch in dem Saal schliefen und ihn nur wieder schikanieren würden.
Sein ID-Armband leuchtete matt an seinem Handgelenk. In seinem spärlichen Schein tastete er sich durch die Dunkelheit zu dem metallenen Etagenbett; das obere Stockwerk war seins, im unteren lag T-7516 und tat keinen Muckser, vermutlich schlief er tief und fest. Mit buchstäblich letzter Kraft kletterte 4418 ins Bett, zog die Decke über sich und wollte einschlafen …
»Hey«, drang es flüsternd von unten.
T-7516 schlief wohl doch noch nicht.
»Hey«, erwiderte 4418.
»Wie war’s?«
»Halb so schlimm, das hab ich dir zu verdanken.«
»Schon in Ordnung.«
»Und … wie ist es dir ergangen?«
»War nicht so wild«, versicherte der Freund. »Den Nachmittag über haben sie mich zur Beobachtung auf der Krankenstation behalten. Aber da meine Bauchschmerzen plötzlich weg waren, haben sie mich wieder gehen lassen.«
»Danke noch mal.«
Eine Pause entstand, in der es völlig still wurde.
Nicht mal ein Schnarchen war zu hören.
»Darf … ich dich was fragen?«
4418 kniff die Augen zusammen. Er war todmüde und wollte eigentlich nur schlafen. Aber nach der Sache von heute Mittag hatte der Freund definitiv was gut bei ihm. »Klar doch«, versicherte er deshalb.
»Du hast heute was gesagt, was mir nicht mehr aus dem Kopf will …«
»Nämlich?«
»Du hast gesagt, dass die Dinge nicht richtig sind. Was hast du damit gemeint?«
»Nichts«, versicherte J-4418 und gähnte. »Hab ich nur so dahingesagt.«
»Nein, es war dir ernst damit, das konnte man merken. Komm schon, ich habe dir da rausgeholfen, jetzt musst du auch ehrlich sein.«
4418 nickte – damit hatte der Freund vermutlich recht. Anderseits gab es unter den Schülern der Lehranstalten ein ungeschriebenes Gesetz, nämlich dass man keinem anderen Schüler vertrauen durfte.
Vertrauen, so hieß es, war eine Schwäche. Wer anderen vertraute, der verlor selbst die Kontrolle, lieferte sich diesen Menschen aus. Nur dem Lenker durfte man vertrauen, so hieß es. Und natürlich seinen Vertretern.
Den Magistraten.
Den Rektoren.
Den Lehrern.
In der Dunkelheit des Schlafsaals huschte ein verwegenes Grinsen über das Gesicht von 4418. Er hatte noch nie viel auf das gegeben, was ihnen hier eingetrichtert wurde – warum also nicht 7516 vertrauen? Noch dazu, wo er heute so viel für ihn getan hatte?
»Also schön«, erklärte er sich flüsternd bereit, »ich werde es dir verraten. Ich meinte damit, dass mir in letzter Zeit manches … unwirklich vorkommt.«
»Unwirklich?«
»Ja, so als ob es … gar nicht wirklich existieren würde.«
»Tatsächlich? Und was genau?«
»Ganz verschiedene Dinge, auch solche, die ich manchmal auf Bildern oder im Fernsehen sehe. Die Pyramide des Lenkers zum Beispiel. Oder die Statue von Nimrod dem Sieger, die davorsteht«, erklärte 4418. »Irgendetwas ist daran falsch. Oder auch der Gruß, du weißt schon, dass Nimrod uns lenken möge …«
»Wie kann ein Gruß denn falsch sein?«
»Das weiß ich auch nicht, aber mein Gefühl sagt mir, dass etwas damit nicht stimmt. So wie mit Nimrod selbst …«
»Was soll das nun wieder heißen?«
»Hast du den Lenker schon mal gesehen? Außer im Fernsehen, meine ich?«
»Nein, das nicht«, räumte T-7516 ein, »aber …«
»Irgendetwas mit ihm ist nicht in Ordnung«, tat J-4418 seine Meinung kund. Es war das erste Mal, dass er so offen aussprach, was er sich schon seit einer ganzen Weile dachte … und es fühlte sich gut an. Es tat gut, einem Freund die Wahrheit zu sagen.
»Woher willst du das denn wissen, dass was nicht in Ordnung ist?«, wollte T-7516 von ihm erfahren.
»Ich sag dir ja, ich weiß es nicht. Es ist … nur ein Gefühl.«
»Aber irgendjemand muss dich doch auf diese Ideen gebracht haben … ich meine, ich hatte solche Gedanken noch nie!«
»Das glaube ich dir, aber …«
Etwas tief in J-4418 warnte ihn plötzlich. Die Art, wie der andere ihm Fragen stellte, während er sich gleichzeitig zu verteidigen schien, kam ihm auf einmal komisch vor. Er antwortete nicht und wieder senkte sich bleierne Stille drückend über den Schlafsaal.
»Hey?«, fragte J-4418 und beugte sich seitlich aus dem Bett, um einen Blick ins untere Stockwerk zu werfen. Aber es war so dunkel, dass er nichts sehen konnte, und eine Antwort bekam er auch nicht. »Was ist los da unten?«, flüsterte er. »Bist du eingepennt?«
Eine Antwort bekam er noch immer nicht.
Dafür ging plötzlich die Beleuchtung an.
Schlagartig war der Schlafsaal in gleißend helles Licht getaucht. J-4418 schoss von seinem Lager hoch. Er war so geblendet, dass er die Augen mit den Händen abschirmen musste. Als er blinzelnd wieder einen Blick riskierte, sah er, dass nichts so war, wie es hätte sein sollen.
Die anderen Stockbetten des Schlafsaals waren alle leer.
Nur T-7516 lag noch in der Koje unter ihm und sah mit einem bedauernden Blick zu ihm herauf. »Tut mir leid, Mann«, sagte er leise. »Aber das hast du dir echt selbst zuzuschreiben …«
»Was meinst du?«
»Ist das nicht offensichtlich?«, fragte eine schneidend scharfe Stimme von der anderen Seite des Bettes.
J-4418 fuhr herum.
Dr. Wolff stand auf der anderen Seite, in ihrer ganzen hageren Erscheinung, die Arme vor der Brust verschränkt.
Und sie war nicht allein.
Rektor Radowan war bei ihr.
Anders als die Wölfin hatte er die Arme auf dem Rücken verschränkt, so als mache er einen Spaziergang und hätte nur ganz zufällig vorbeigesehen. Doch der Blick, mit dem er J-4418 durch die Gläser seiner schwarzen Hornbrille musterte, war kalt und drohend.
»I-ich habe nichts getan«, beeilte sich 4418 zu versichern. »Die Strafarbeit habe ich beendet, wie es angeordnet war, erst vor einer halben Stunde …«
»Um die Strafarbeit geht es nicht«, beeilte sich Radowan zu versichern. »Nicht dieses Mal.«
»Wo-worum dann?«, fragte 4418, der noch immer nicht begriff.
»E-es tut mir leid, ehrlich«, beteuerte T-7516 leise und fast ein bisschen weinerlich. »Aber du musst dir unbedingt helfen lassen, das denke ich ganz ehrlich …«
4418 sah zuerst zu ihm, dann wieder zu Wolff und Radowan. Er sah den strengen, erbarmungslosen Ausdruck in ihren Gesichtern – und endlich begriff er.
»Du … du hast ihnen von unserem Gespräch heute Mittag erzählt …«
»Das muss man«, verteidigte sich T-7516. »Verdächtige Vorfälle muss man melden, weil man sonst Schwierigkeiten kriegt, und die will ich nicht, klar?«
»Glasklar«, bestätigte 4418, während er sich selbst einen Idioten schalt. »Das heute Mittag ist tatsächlich nur Theater gewesen – aber du hast nicht ihnen etwas vorgespielt, sondern mir! Um dir mein Vertrauen zu erschleichen …«
»Da-das musste ich doch«, stammelte der andere ein wenig hilflos. »Schließlich hast du ein paar schlimme Dinge über den Lenker gesagt!«
»T-7516 hat vorbildlich gehandelt, wie ein wahrer Patriot«, stellte Dr. Wolff fest.
»Ja«, pflichtete 4418 grimmig bei und schickte einen vernichtenden Blick ins untere Bett. »Und ich Trottel war so dämlich zu denken, ich hätte einen Freund.«
»Würdest du auf das hören, was man dich an dieser Einrichtung lehrt, so wüsstest du, dass man niemandem vertrauen kann, J-4418«, beschied die Wölfin ihm kalt. »Aber du scheinst zu den Unbelehrbaren zu gehören.«
4418 erwiderte nichts mehr. Trotzig kauerte er in seinem Bett und hatte das Gefühl, in einen bodenlosen Abgrund zu stürzen. Da überwand er sich endlich einmal dazu, jemandem zu vertrauen – und schon im nächsten Moment erwies sich dieser Jemand als elender Verräter.
»Ich denke, es ist an der Zeit für ein Gespräch in meinem Büro«, sagte Rektor Radowan. Seine Stimme war anders als die der Wölfin, weich und irgendwie ölig. Aber deshalb nicht weniger bedrohlich.
4418 spürte Furcht in sich hochkriechen. Gespräche im Rektorat waren berüchtigt. Wer dazu bestellt wurde, war danach meist nicht mehr derselbe …



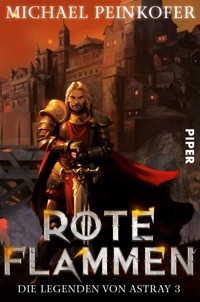
![Die Farm der fantastischen Tiere. Voll angekokelt! [Band 1] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/710616cb53ccb4acc4a9849ce5514b3c/w200_u90.jpg)



![Die Farm der fantastischen Tiere. Einfach unbegreiflich! [Band 2] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d3987251531d3c0eb5b0ada994d2676/w200_u90.jpg)