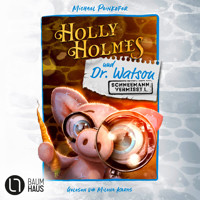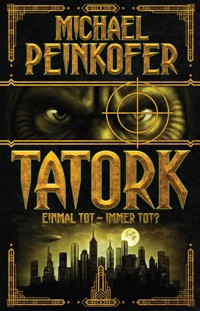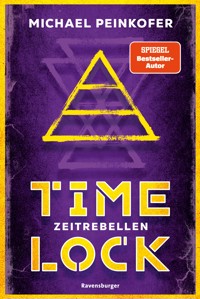14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Rom zur Kaiserzeit: Caligula sitzt auf dem Thron, doch im Volk brodelt es, und immer wieder kommt es zu politischen Unruhen. Als die Stadt von einer grausamen Mordserie erschüttert wird, beauftragt der Kaiser ein ungleiches Ermittlerduo, der Sache nachzugehen. Gerüchte werden laut, dass ein großes Tier in den Kanälen Roms sein Unwesen treibt, Menschen tötet und seine Opfer dabei bestialisch zurichtet. Doch die Ermittlungen führen auf eine unglaubliche Spur: Wurden die Morde nicht von einem gewöhnlichen Tier verübt, sondern von einem mächtigen Wesen aus der antiken römischen Mythologie? Eine gefahrvolle Reise ins Unbekannte beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy!
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Indagator« an empfehlungen@piper.de, und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Redaktion: Uwe Raum-Deinzer
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Coverabbildung: Guter Punkt München unter der Verwendung von Motiven von iStock / Getty Images Plus und Adobe Stock
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
DRAMATIS PERSONAE
PROLOGUS
VOLUMEN PRIMUM:IN TENEBRIS ABDITUM
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
VOLUMEN SECUNDUM:IN MUNDO PERDITUM
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
VOLUMEN TERTIUM:IN UNGUIBUS MANTICORI
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
EPILOGUS
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
DRAMATIS PERSONAE
Lucius Murmillo Pertinax Zenturio der Prätorianergarde
Sibylla Claudia Varro eine junge Patrizierin
Marcus Claudius Varro ihr Vater, ein Gelehrter
Marcus Furius Prätorianer, Freund Murmillos
Cassius Chaerea Tribun der Prätorianergarde
Marcus Aquila Iulianus erster Konsul von Rom
Lucius Nonius Asprenas Sprecher des Augurenkollegs
Lucius Vitellius Statthalter von Syrien
Caius Mascius Ädil von Subura
Gaius Veridius Dekurio der Reiterei
Trebata Priester des Mysterienkults
Apulia, genannt Tyche eine Straßendirne
Kersas Hausdiener Varros
Acca eine Hausmagd
Tanacos Diener im kaiserlichen Palast
Xenodamos Gelehrter aus Alexandria
Pakoris Syrer, ortskundiger Führer
Urud ein parthischer magus
Cnaeus Valerius Trierarchus der römischen Flotte
Urbiscus Soldat, Prätorianer
Livius Vacerra Lagerkommandant, Zenturio
Bagayas parthischer Garnisonskommandant
Iulia Livilla Schwester des Kaisers, 20 Jahre
Iulia Drusilla Schwester des Kaisers, 22 Jahre
Iulia Agrippina Schwester des Kaisers, 23 Jahre
sowie
Caius Caesar Augustus Germanicus Imperator von Rom
PROLOGUS
Ihr Name war Kallidrome.
Und wie jede meretrix, die von Tyros und den Inseln kam, verstand auch sie sich meisterlich darauf, ihren Kunden eine unvergessliche Nacht zu bereiten.
Zugegeben, es war kein billiges Vergnügen. Den Sold von drei Tagen verlangte Kallidrome für eine einzige Stunde ihrer wertvollen Zeit – so viel, wie man auf den Märkten des Velabrum für zwanzig Laib Brot bezahlte.
Aber, bei Mars, das war es wert.
Caius Veridius wankte. Er hatte weiche Knie, wobei er nicht wusste, ob es am Wein lag, den er getrunken hatte, oder an Kallidromes Liebeskünsten, für die sie in ganz Subura bekannt war. Vermutlich an beidem, dachte er und erleichterte sich gegen die Wand der Gasse, die mit Kritzeleien aller Art übersät war. Illa me reddit felicem, stand dort im fahlen Mondlicht zu lesen, geschrieben wohl von jemandem, der ebenfalls Kallidromes Gast gewesen war und das Bedürfnis verspürt hatte, seine tiefe Befriedigung aller Welt kundzutun.
Mit wissendem Kichern wandte Veridius sich ab und wankte weiter – nur, um zu sehen, dass es vor ihm, am Ende der Gasse, Ärger gab. Ein Mann in Begleitung zweier Fackelträger, vermutlich seine Sklaven, wurde von einer Gruppe junger Kerle behelligt, die ihn lautstark anpöbelten und beschimpften.
Schon am hellen Tag war Subura kein sicheres Pflaster, noch viel weniger bei Nacht.
Zwar bezweifelte Veridius, dass es sich um Raubgesindel handelte, doch in die Fänge eines caetus junger Schläger zu geraten, mochte im Zweifel nicht weniger schmerzhaft enden, oder gar mit einem Dolch zwischen den Rippen. Schon wurde einem der Diener seine Fackel entrungen, und sie schlugen ihn damit nieder. Veridius bog rasch in eine Seitengasse ab, in der Hoffnung, dass sie ihn nicht gesehen hatten.
Doch er hatte Pech …
»Heda!«, rief einer der Burschen ihm mit lallender Zunge nach. »Bleib stehen, Freund!«
Veridius dachte nicht daran. Im Gegenteil beschleunigte er seine Schritte, soweit seine weichen Knie und benebelten Sinne es zuließen.
»Halt!«, tönte es, dass es von den schmutzigen, mit wüsten Zeichnungen beschmierten Wänden widerhallte. »Wirst du wohl auf uns warten? Wir wollen dich was fragen …«
Veridius, der nicht erpicht darauf war, die Fragen der Raufbolde zu beantworten, beschleunigte seine Schritte abermals. Dabei geriet er ins Taumeln, prallte gegen einen aus Lehmziegeln gemauerten Vorsprung und schlug sich das Kinn blutig. Der Schmerz immerhin ließ ihn halbwegs nüchtern werden. Fluchend wankte er weiter, dem Ende der Gasse entgegen, das im Nebel, der um diese späte Stunde vom Tiber heraufzog, leicht verschwommen wirkte.
»Verdammt, bleib endlich stehen! Wir tun dir doch nichts!«
Ein paar der jungen Kerle waren ihm jetzt auf den Fersen – und anders als er konnten sie noch ordentlich laufen. Leichtfüßig rannten sie ihm hinterher, während Veridius nur weitertaumeln konnte. Ihr spöttisches Gelächter verriet, dass es ihnen Freude machte, ihn zu jagen.
Zu seiner Linken öffnete sich eine weitere Gasse, in die er hastig abbog, doch er gab sich keinen Illusionen hin. Die Läden in den unteren Stockwerken waren allesamt geschlossen, da war kein Ort, wo er sich verstecken konnte – und selbst wenn er irgendwo einen Passanten traf, würde dieser kein Interesse daran haben, ihm zu helfen und dabei womöglich selbst Ärger zu bekommen. Sich nur um seinen eigenen Kram zu kümmern, war die vielleicht wichtigste Regel, wenn man in Rom überleben wollte.
Gewiss, er konnte stehen bleiben und sich ihnen zum Kampf stellen. Er war schließlich Soldat, kein hochdekorierter, aber immerhin, und der kurze pugio, den er stets am Gürtel trug, würde einem seiner Verfolger vielleicht einen schmerzhaften Stich versetzen – aber was war mit den anderen? Besoffen, wie Veridius war, würden seine Bewegungen schwerfällig und vorhersehbar sein. Inständig wünschte er sich, weniger von Kallidromes viel zu süßem und völlig überteuertem Wein getrunken zu haben …
»Jetzt haben wir ihn gleich!«, tönte es von hinten.
Veridius konnte ihre Hiebe schon beinahe spüren.
In seiner Not bog er in die schmale Kluft zwischen zwei Häusern, quetschte sich zwischen schmutzigen Ziegeln hindurch in der Hoffnung, seinen Verfolgern so vielleicht doch noch zu entkommen – doch schon nach wenigen Schritten endete seine Flucht auf dem nur wenige Schritte durchmessenden Hinterhof einer Mietskaserne. Auf dem schlammigen Boden lag all der Unrat, den die Bewohner tagsüber aus den Fenstern kippten. Der Gestank war faulig und stechend, und ein entsetztes Pfeifen zeugte von den Ratten, die sich aus dem Staub machten, als sie Veridius gewahrten.
Der Dekurio drehte sich im Kreis, sah ringsum nichts als glatte Wände und vier Stockwerke über sich einen rechteckigen Ausschnitt Himmel, von dem fahl leuchtende Sterne gleichmütig herabblickten. Rasch wollte er wieder zurück auf die Gasse – aber es war zu spät.
Seine drei Verfolger, wüste, vierschrötige Raufbolde, zwängten sich durch den Spalt und schnitten ihm den Weg ab. Mit einer Verwünschung auf den Lippen wich er zurück, seine caligae traten in Pfützen von Pisse.
»Da bist du ja endlich«, rief der Wortführer der Gruppe – Sorge, dass einer der Hausbewohner sie hören könnte, brauchte er nicht zu haben, es würde sich ohnehin niemand einmischen.
»Verschwindet!«, befahl Veridius und gab sich Mühe, möglichst viel Autorität in seine vom Alkohol heisere Stimme zu legen. Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, zückte er den Dolch. »Haut ab, oder es wird euch leidtun!«
Für einen Moment verharrten die drei Schläger tatsächlich – dann brachen sie in schallendes Gelächter aus und ließen sehen, was sie ihrerseits dabeihatten.
Einen hölzernen Prügel, durch dessen dickes Ende ein eiserner Nagel getrieben worden war.
Einen Totschläger in Form eines Widderkopfs.
Und eine gekrümmte Klinge.
»Das hättest du nicht tun sollen, Männlein«, sagte der Wortführer, der höchstens zwanzig Sommer gesehen und eine hässliche Narbe im Gesicht hatte. »Nun hast du uns wütend gemacht, und das wird böse für dich enden.«
Schon waren sie dabei, ihn zu umkreisen.
Veridius überlegte noch, ob er ihnen einfach zuvorkommen und angreifen sollte, als der Kerl zu seiner Linken – es war der mit dem Prügel – bereits die Waffe nach ihm schwang. Doch inmitten seiner Bewegung verharrte der Jüngling plötzlich.
Die anderen lachten, weil sie glaubten, er mache Faxen, doch der junge Schläger stand wie von Iupiters Blitzen getroffen. Im nächsten Moment begann sich das schmutzige Grau seiner Tunika dunkel zu verfärben.
Auf den Schlachtfeldern, auf denen Veridius zur Ehre Roms gekämpft hatte, hatte er viel Blut fließen sehen, deshalb wusste er sofort, dass es roter Lebenssaft war, der die Tunika des Schlägers tränkte. Nur einen Lidschlag später brach der junge Kerl zusammen. Zwischen seinen Schulterblättern steckte etwas, das offenbar mit solcher Wucht eingedrungen war, dass es seinen Brustkorb durchschlagen hatte.
»Elender Bastard!«, schimpfte der Wortführer, der offenbar Veridius die Schuld gab. Mit einem Satz sprang er auf ihn zu, um ihm die rostige Klinge in den Unterleib zu treiben – im selben Moment überstürzten sich die Ereignisse.
Ein Rauschen war zu vernehmen, und etwas Dunkles stürzte von oben herab, ein Schatten, ein Schemen, der den Kerl mit der Narbe packte und ihn in die Höhe riss. Nur einen Herzschlag später kam er wieder herab, von furchtbarer Gewalt entzweigerissen. Dampfende Gedärme hingen aus den beiden Hälften, die auf dem von Unrat übersäten Boden aufschlugen.
Der verbliebene Jüngling war an die Hausmauer zurückgewichen, an die er sich zitternd presste. Von Kopf bis Fuß war er mit Blut besudelt, mit weit aufgerissenen Augen starrte er auf den abgetrennten Oberkörper seines Anführers, auf das Gesicht mit der Narbe, das grotesk verzerrt war, leblos und in namenlosem Schrecken.
Der Mund des verbliebenen Schlägers öffnete sich zu einem Schrei, der seine Lippen jedoch nie verließ, denn abermals verdunkelte der Schatten die Gasse – als sie sich wieder lichtete, lehnte anstelle des Jünglings nur noch ein kopfloser Torso an der blutbesudelten Mauer.
Wieder war ein Rauschen zu vernehmen, wie vom Schlag mächtiger Flügel. Veridius sah instinktiv nach oben – nur, um das blanke Grauen zu erblicken, das aus dem Rechteck des Sternenhimmels auf ihn herabfiel.
Er kam noch dazu, einen gellenden Schrei auszustoßen.
Doch als grässliche Klauen ihn packten und mit Urgewalt emporrissen, verstummte er für immer.
VOLUMEN PRIMUM:IN TENEBRIS ABDITUM
I
Wenn man den Helm eines Arenakämpfers trug, bestand die Welt aus kleinen Löchern.
Worauf man auch blickte, stets hatte man den Eindruck, dabei durch eine Vielzahl von Schlüssellöchern zu sehen, als wäre man nur Zuschauer und gar nicht wirklich beteiligt – bis zu dem Moment, da sich die Klinge des Gegners heiß und schmachvoll in die Eingeweide fraß …
Lucius Murmillo Pertinax hatte nicht vor, es so weit kommen zu lassen – obwohl seine Tage bei den Spielen eigentlich gezählt und er ein wenig aus der Übung war. Ganz abgesehen davon, dass er es noch nie mit einem Gegner wie diesem zu tun bekommen hatte. Niemand hatte das bislang.
Retiarius wurde der Kerl genannt, und anders als der murmillo war er nicht mit Klinge und Schild bewaffnet, sondern mit einem Dreizack, als wäre er geradewegs Neptuns feuchtem Reich entstiegen. Und mit einem mit Wurfgewichten versehenen Fischernetz, das er gegen die Beine seines Gegners schwang, stets im Bemühen, diesen in den Maschen zu fangen und zu Fall zu bringen. Zu Beginn des ungleichen Kampfes hatten Lucius und seine Kameraden noch über den seltsamen, halb nackten Aufzug des Fischkämpfers gelacht – doch je länger das Duell dauerte, je mehr von Lucius’ bewährten Finten scheiterten, und je raffinierter die Attacken des Gegners wurden, desto weniger heiter war die Stimmung.
Im Gegenteil, was als Spaß begonnen hatte, war zu einem erbitterten Duell geworden – und was die aufgeladene Stimmung und das heisere Geschrei ringsum anging, so hätte man glauben mögen, in einem Amphitheater zu sein und nicht in einem der Säle des kaiserlichen Palasts auf dem ehrwürdigen Palatin. Gerade erst hatte der neue Hausherr, der seit einem Jahr hier residierte, nachdem sein Vorgänger es mehr als zwei Dekaden ausgehalten hatte, damit begonnen, den Palast nach seinen Vorstellungen zu erweitern und umzubauen – vom Tempel Castors und Pollux’, der sich zwischen dem kaiserlichen Palast und dem Forum erhob, würde vermutlich schon bald nichts mehr zu sehen sein. Es sei denn, zwei erbittert kämpfende Gladiatoren zerstörten in ihrer Raserei all das, was Baumeister und Handwerker in den vergangenen Monaten mühsam errichtet hatten.
Erneut trug der retiarius einen Ausfall vor, diesmal nicht mit dem Netz, sondern mit dem mörderischen Dreizack, den er mit der bis zur Schulter gepanzerten Linken führte. Mit einer routinierten Bewegung, die den Zuschauern ein lautes »Oooh« entlockte, wich Lucius der Waffe aus. Der Stoß verfehlte ihn und traf stattdessen einen hüfthohen Dreifuß, auf dem eine kunstvoll gearbeitete Vase stand. Mit profanem Klirren ging sie zu Bruch, zur allgemeinen Heiterkeit der Gäste, die die Kontrahenten in weitem Rund umgaben und so inmitten des Bankettsaals des kaiserlichen domus einen provisorischen Kampfplatz gebildet hatten.
»Los doch, Pertinax! Mach ihn fertig!«, keifte eine der hohen Damen – allerdings hätte Lucius eines solchen Zurufs nicht bedurft, er war auch so bis in die Haarspitzen motiviert. Denn mochte es bei diesem Kampf auch nicht um Tod und Leben gehen, so ging es doch um sein Ansehen und seinen Ruf – und beides war am kaiserlichen Hof unabdingbar.
Die Schaulustigen sahen zu, wie sich die Kämpfenden im flackernden Schein der Feuerschalen umkreisten und sich dabei lauernd beobachteten. Lucius merkte, wie seine Handflächen schwitzten. Er fasste sein gladius fester, die kurze Klinge, mit der er blitzschnell zustechen und dabei tödlich verwunden konnte. Wie viele Siege hatte Lucius ihr zu verdanken – doch wie bekämpfte man einen Widersacher, der mit einer Stabwaffe hantierte und seinen Gegner erst gar nicht an sich herankommen ließ? Es blieb ihm nur, auf einen Fehler des retiarius zu lauern, während Lucius ihn in leicht gebückter Haltung umkreiste, dabei die Füße kreuzend, wie sein lanista es ihn einst gelehrt hatte.
Erinnerungen kehrten zurück.
Das Geschrei des alten Schleifers lag ihm plötzlich wieder in den Ohren, und er konnte den Schweiß und das Öl riechen, hatte den salzigen Geschmack von Blut auf der Zunge. Obwohl all dies Jahre zurück lag, war es ihm noch immer vertraut, nicht nur die Bewegungen, auch das Knirschen der wattierten manica an seinem Waffenarm, und der elende Gestank, wenn man unter dem Bronzehelm schwitzte.
Doch nicht nur die Erinnerungen an seine Zeit an der Gladiatorenschule von Massilia kehrten zu Lucius zurück, sondern auch die Instinkte, die er dort entwickelt hatte. Durch die Löcher im Helmvisier taxierte er seinen Gegner, der größer war als er selbst, ein Hüne geradezu, seiner bleichen Haut und dem rotblonden Haar nach Britannier. Der nackte Oberkörper des retiarius schien zu bersten vor Muskeln, und in seinen Augen lag ein mordlüsternes Blitzen, das Lucius in der Arena oft gesehen hatte … Sollte der Hüne vergessen haben, dass sie dies nur zur Zerstreuung der Anwesenden taten? Dass sie nur ein wenig Kurzweil bieten sollten, um den Kaiser und seine erlesenen Gäste zu erfreuen?
Erneut stieß der Britannier mit dem Dreizack zu, diesmal tief, um Lucius’ Beine zu treffen. Blitzschnell warf er sich zur Seite, rollte sich ab und stand zur Freude der Zuschauer sofort wieder auf den Beinen – doch zeigte sich jetzt, dass die Attacke mit dem Dreizack nur eine Finte gewesen war. Denn nun erfolgte der eigentliche Angriff mit dem Netz, das der Barbar nach ihm schwang, um ihn darin zu fangen wie einen Fisch auf dem Trockenen.
Die Attacke erwischte Lucius auf dem falschen Bein, er hatte nicht damit gerechnet. Dennoch machte er sich wie in alten Zeiten die Leichtigkeit seiner Ausrüstung zunutze und sprang in die Höhe. Das Netz wischte unter ihm hindurch, als wäre dem retiarius daran gelegen, den marmornen Boden des Palasts zu säubern – und noch ehe er es wieder zurückziehen konnte, landete Lucius darauf.
Es war ein gefährlicher Moment – hätte der Britannier über die nötige Geistesgegenwart verfügt, hätte er am Netz reißen und seinem Gegner den Boden unter den Füßen wegziehen können. So jedoch war das Gegenteil der Fall: Lucius’ Waffenhand zuckte vor, und noch ehe sein Gegner reagieren konnte, hatte er das Zugseil des Netzes bereits durchschnitten, und das Ding lag nutzlos auf dem Boden.
»Habet! Habet!«, riefen die Gäste anerkennend, was einmal mehr Erinnerungen an die Arena weckte. Und auch der Ehrgeiz, den Lucius einst empfunden hatte, kehrte zurück, der unbedingte Wille, seinen Gegner in den Staub zu werfen.
Der Britannier stieß eine Verwünschung aus, dann packte er den Dreizack mit beiden Händen und griff damit an. Der Stoß, der kräftig genug war, um einem Eber den Schädel zu zerschmettern, zielte schräg nach unten, geradewegs auf Lucius’ Eingeweide. Indem er geschickt seinen Schild einsetzte und die gegnerische Waffe an dessen Wölbung abgleiten ließ, wehrte Lucius den Angriff ab. Der retiarius jedoch, der sein ganzes Körpergewicht in den Stoß gelegt hatte, geriet dadurch ins Taumeln. Lucius rammte ihn mit dem Schild, so hart, dass der andere vollends das Gleichgewicht verlor und stürzte.
Die Gäste wichen mit einem Aufschrei zurück, als der Hüne vor ihnen niederging und mit dem Hinterkopf hart auf dem steinernen Boden aufschlug. Dabei biss er sich ein Stück seiner Zunge ab, das er keuchend ausspuckte, zum Gelächter der hohen Herren und zum Ekel der anwesenden Damen. Lucius entwaffnete ihn, indem er ihm den Dreizack aus der erschlafften Linken trat – und im nächsten Moment hatte der Britannier die Spitze des gladius an der Kehle.
Für einen Moment, während er keuchend nach Atem rang und heißes Kampfesblut in seinen Adern wallte, verspürte Lucius tatsächlich den Drang, mit der Klinge zuzustoßen und sie in der Kehle seines Gegners zu versenken … doch es war nur ein Schatten, der flüchtig vorüberzog. Schon einen Herzschlag später hatte er sich wieder unter Kontrolle und wartete auf das Urteil der gaffenden Menge, genau wie einst …
»Sehr gut, sehr gut!«, lobte eine dünne Stimme, die beim Sprechen seltsam die Höhe wechselte, als würde ihr Besitzer singen. »Nun lass von ihm ab, Freund Pertinax, und schenke dem Barbaren sein elendes Leben. Der Prokurator der Spiele wird es dir danken.«
Lucius besann sich noch einen Moment. Dann richtete er sich auf, und indem er die Klinge, die kein Blut zu kosten bekommen hatte, achtlos fallen ließ, bot er dem besiegten Gegner seine Rechte an. Aus den blaugrauen Augen des Britanniers schienen weiter Funken zu schlagen. Hilfloser Zorn spiegelte sich darin ebenso wie Scham über den verlorenen Kampf, aber auch Verblüffung über die versöhnliche Geste. Schließlich ergriff er Lucius’ Rechte, und dieser half dem Riesen dabei, wieder auf die Beine zu kommen. Unter Beschimpfungen und Hieben trieb der zuständige Hofbeamte ihn hinaus, was bei den Versammelten erneut für Heiterkeit sorgte.
Lucius öffnete das Visier und nahm den Helm ab, froh darüber, wieder frei atmen zu können und statt des eigenen Schweißes den süßlichen Duft von Myrrhe, Rosenöl und all den anderen Aromen zu riechen, in die wohlhabende Patrizier sich zu hüllen pflegten. Und bei Weitem nicht nur die Damen …
»Nun?«, erkundigte sich der Mann mit der singenden Stimme, während er sich von seiner Liege erhob und die Stufen des Podests herabstieg. Er bot einen eigentümlichen Anblick, denn sein runder, von einer weiten Toga umwallter Körper schien zu dem kleinen Kopf und den dürren Beinen nicht recht passen zu wollen. Sein dunkles Haar war trotz seiner jungen Jahre bereits spärlich, die kohleschwarzen, in tiefen Höhlen liegenden Augen standen weit auseinander und schienen in ständigem Argwohn umherzuspähen.
Doch wer aufgrund dieser Attribute diesen jungen Mann unterschätzte oder es an Respekt oder Ehrerbietung mangeln ließ, der beging einen schwerwiegenden Fehler. Denn dies war Caius Caesar Augustus Germanicus, Urenkel des großen Caesar Augustus und Großneffe des Tiberius, Herrscher des römischen Reiches, oberster Priester und Imperator und Vater des Vaterlands.
Oder, wie manche ihn nannten, wenn auch nur klammheimlich: Caligula …
»Was hältst du von dieser Idee, guter Murmillo?«, wollte der Kaiser von Lucius wissen. Dass er dabei wissbegierig sein fliehendes Kinn vorstreckte, verlieh seiner Erscheinung etwas Vogelhaftes. »Dieser retiarius könnte zum neuen Liebling der Arena werden! Die Menge wird rasen, wenn sie ihn sieht!«
»Das steht zu erwarten, Caesar«, räumte Lucius ein.
»Mit Netz und Dreizack mag er wie ein Fischer aussehen, der sich in die Arena verirrt hat«, fuhr Caligula fort und lachte über seinen eigenen Scherz. »Aber wenn er erst ein paar Gegner aufgespießt hat, wird er sich rasch Respekt verschaffen.«
»Das denke ich auch, erhabener Caesar«, stimmte Lucius zu. Diener kamen herbei und nahmen ihm Helm und Schild ab. Dann lösten sie die Verschnürung der manica und der Panzerung am linken Bein und entfernten auch sie. »Aber darf ich vielleicht einen Vorschlag machen?«
»Einen Vorschlag?« Der vorgereckte Kopf des Kaisers wippte zur Seite wie bei einem Raubtier, das Witterung aufgenommen hatte. Die Hofschranzen, die den improvisierten Kampfplatz noch immer in weitem Rund umgaben, tauschten unruhige Blicke. Caligula war für seine leichte Erregbarkeit bekannt. Dem Kaiser einen falschen Vorschlag zu unterbreiten, konnte allzu leicht mit Bestrafung enden …
»Du stehst hoch in meiner Gunst, mein guter Pertinax«, sagte er prompt, »aber übertreib es nicht. Denn was für ein Vorschlag sollte das sein, den ein ehemaliger Grubenkämpfer seinem erlauchten Herrscher zu machen hätte?«
»Ein Grubenkämpfer wohlgemerkt, der Euch alles zu verdanken hat, Caesar«, verbesserte Lucius und schmeichelte ihm damit zugleich. »Hättet Ihr mich nicht aus der Arena in die Reihen Eurer Prätorianer berufen und mich zum Zenturio ernannt, würde ich hier und jetzt nicht vor Euch stehen.«
»Das ist wahr, du verdankst mir alles«, gab der Kaiser unumwunden zu und schien sich daraufhin etwas zu beruhigen. »Was also ist das für ein Vorschlag?«, verlangte er dann großmütig zu wissen.
»Der retiarius ist ein neuartiger, furchterregender Kämpfer«, versicherte Lucius. »Hat er erst Übung im Umgang mit Netz und Dreizack, wird er so stark werden, dass ein Kampf zwischen ihm und einem murmillo oder thraex allzu rasch enden könnte … es sei denn, es gefällt Caesar, seiner göttlichen Macht gerecht zu werden und das Kampfesglück ein wenig auszugleichen.«
In Caligulas schwarzen Augen blitzte es. »Wie?«
»Gebt dem Gegner des Netzkämpfers einen Helm, der weniger geschmückt ist als der meine, sodass er sich unter dem Netz wegducken kann, ohne sich darin zu verheddern. Und verkleinert das Visier, damit seine Augen besser geschützt sind. Auf diese Weise werden die Chancen besser verteilt sein. Die beiden Kämpfer werden den Zuschauern in der Arena viel Freude bereiten – und der Dank und die Begeisterung des Volkes werden Euch sicher sein, Caesar.«
Caligula nickte, während er auf seinen dürren Beinen auf und ab ging und sich dabei das bartlose, fliehende Kinn rieb. »Ich gebe zu, die Idee ist nicht schlecht … und wie sollen wir diese neue Art von Kämpfer nennen?« Er blieb stehen und blickte in die Runde der Versammelten. »Los doch, ich erwarte eure Vorschläge«, rief er ihnen zu.
Die geladenen Gäste wichen seinen Blicken aus. Aufseiten der Herren waren es vor allem Senatoren und andere Patrizier, die zu den kaiserlichen Festen geladen wurden, sodass sich Geld und Macht die Waage hielten; was die Frauen anging, so behielt der Kaiser es sich vor, nicht nur die Damen des hohen Adels einzuladen, sondern auch solche, die ihren Lebensunterhalt zwar auf anrüchige Weise verdienten, Caligulas Vorstellung von Schönheit und Eleganz aber mehr entsprachen. Doch woher sie auch stammen mochten, ob von ganz oben oder ganz unten, sie alle schwiegen lieber, als etwas zu sagen, das dem Kaiser womöglich missfiel.
»Fürwahr, ihr seid mir ja schöne Berater!«, rief Caligula ihnen zu. »Würde ich ein Pferd zum Senator machen, würde es mir kaum weniger wertvolle Dienste leisten!«
»Nun denn«, entgegnete Marcus Aquila Iulianus, seines Zeichens erster Konsul und oberster Beamter, der sich wohl in seinem Stolz gekränkt sah, »so nennt ihn doch mergus, Caesar.«
»Wieso das?«
»Weil er elegant unter dem Netz des Gegners hindurchtaucht«, entgegnete der Konsul und machte eine entsprechende Bewegung mit der rechten Hand.
»Unfug«, lehnte Caligula ab.
»Oder fugitivus, weil er vor dem Dreizack auf der Flucht sein wird«, schlug ein Senator vor.
»Noch schlimmer!«, lautete das kaiserliche Urteil. »Niemand, der ins Amphitheater geht, will einen Gladiator davonlaufen sehen! Habt ihr denn nichts verstanden? Es muss ein Name sein, der bei seinem Gegner Respekt und beim Zuschauer große Erwartungen weckt …« Er verstummte und dachte einen Moment nach, wobei seine Augen vollends in den ohnehin schon tiefen Höhlen zu versinken schienen. »Jetzt weiß ich es!«, rief er plötzlich aus, wobei sich seine Miene wieder klärte. »Der neue Kämpfer wird secutor genannt, weil es seine Aufgabe sein wird, den retiarius in der Arena zu verfolgen!«
»Eine gute Wahl, Caesar«, bekundete Marcus Aquila, und allenthalben wurde geklatscht und Beifall bekundet. Der Kaiser erquickte sich daran wie an einem warmen Frühlingsregen und schickte Lucius ein Lächeln, das dieser hinlänglich kannte. Es lag eine gewisse Dankbarkeit darin – und zugleich die Warnung, sich von nun an wieder in Zurückhaltung zu üben.
Denn Caius Caesar Augustus Germanicus war leicht zu erfreuen, insbesondere von einem ehemaligen Gladiator, den er wohlwollend in die Reihen seiner Prätorianer aufgenommen hatte.
Doch ebenso rasch konnte man dieses Wohlwollen auch wieder verlieren – und dann war der Palatin, war ganz Rom ein sehr gefährlicher Ort.
II
Es hatte gefressen.
Hatte sich an seiner Beute gelabt, die es rasch und ohne die Mühen einer langen Jagd erlegt hatte. Der Hunger, den es verspürt hatte, war damit fürs Erste gestillt, die alten Kräfte dabei, wieder in seinen Körper zurückzukehren … aber es brauchte noch mehr davon. Und an diesem Ort, in diesem unendlichen Wald aus Steinen, gab es reiche Beute …
Anfangs war es verwirrt gewesen, hatte zum ersten Mal in seiner uralten, archaischen Existenz so etwas wie Furcht verspürt. Instinktiv hatte es zunächst die Flucht ergriffen, doch andere, noch ungleich mächtigere Naturtriebe, die darauf aus waren, zu töten, zu fressen und zu überleben, hatten es schließlich wieder in den steinernen Wald zurückkehren lassen.
Und da hatte die Bestie sie gesehen …
Unzählige kleine, zerbrechliche Kreaturen, die sich in den engen Schluchten tummelten und von denen keine Gefahr ausging, die keinen Widerstand leisteten und sich willenlos in ihr Schicksal ergaben. Ihr Fleisch, ihre Knochen und ihr Blut würden die Bestie nähren, würden ihr nach dem langen Schlaf die alte Stärke wiederbringen.
Die Bestie genoss das Gefühl, wieder am Leben zu sein, verschlang jeden einzelnen Bissen, den sie aus den leblosen, blutigen Körpern riss, mit unstillbarer Gier.
Sie wusste weder, was sie war, noch, warum sie war.
Nur dass sie noch war, das wusste sie.
Nach all den Jahrtausenden.
III
Der nach Caligulas Vorgänger domus Tiberiana benannte Palast, der bis zur Fertigstellung der zusätzlichen Räumlichkeiten auch den neuen Imperator beherbergte, verfügte über eine Unzahl von Innenhöfen.
Prächtige Gärten gab es dort, mit plätschernden Brunnen und kunstvoll gearbeiteten Statuen. Bei Nacht waren sie erfüllt vom Zirpen der Grillen und dem Duft von Lavendel, der Schein von Fackeln und Feuerpfannen spiegelte sich im dunklen Wasser der impluvia. Nicht von ungefähr waren die Kammern, die sich zu den Gärten hin öffneten, beliebte Orte, an die sich die Gäste der kaiserlichen Gelage zu fortgeschrittener Stunde zurückzogen, in weiblicher wie in männlicher Begleitung. Der Kaiser selbst war bekannt dafür, beiden Geschlechtern gleichermaßen zugeneigt zu sein, und ließ nicht nur Dirnen, sondern auch griechische Lustknaben in den Palast kommen, um sie seinen Gästen wie einen Nachtisch zu kredenzen.
In einer dieser Kammern, die aus besagten Gründen mit bequemen Liegen ausgestattet waren, verwandelte sich Lucius Pertinax vom Gladiator wieder zurück in den Zenturio. Sklaven hatten ihm eine Karaffe Wein und eine Schüssel Wasser gebracht und sich erboten, ihn auch zu waschen, aber Lucius hatte sie weggeschickt. Er wollte allein sein, und das nicht nur, weil der Kampf gegen retiarius anstrengender gewesen war und ihn mehr gefordert hatte, als er gerne zugeben wollte; es war auch eigenartig, das eine Gewand ab- und das andere wieder anzulegen, so als hätte Lucius für kurze Zeit wieder sein altes, geringeres Selbst angenommen.
Erinnerungen wurden einmal mehr geweckt, an den Halbwüchsigen, der mit fünfzehn Jahren an die Gladiatorenschule von Massilia gekommen war, um dort zu lernen und zu üben, anfangs noch hoffnungslos unterlegen, aber von der Natur mit eisernem Willen und schneller Reaktionsfähigkeit bedacht. Schließlich die ersten Kämpfe, in kleinen Arenen und noch nicht auf Leben und Tod. Und dann hatte er zum ersten Mal ein Amphitheater durch die porta sanivivaria betreten – und es auch wieder durch das Tor des Lebens verlassen. Das Geschrei der Menge, der Blutdurst in den Augen der Zuschauer, der Geruch von Schweiß und Blut, dazu das heftige Pochen des eigenen Herzens – all das würde Lucius nie vergessen. Mit heißer Glut hatte es sich in sein Gedächtnis eingebrannt und würde für immer ein Teil von ihm sein – wie sehr, das war ihm erst vorhin wieder klar geworden.
An gewöhnlichen Tagen konnte er es leicht verdrängen, gab es genügend Pflichten, denen er nachzugehen hatte, und allerhand Zerstreuung, um sich abzulenken – Besuche in den öffentlichen Bädern, die Freuden Suburas und andere Annehmlichkeiten, die Rom demjenigen bot, der es sich leisten konnte. Doch vorhin hatte Lucius sie wieder verspürt … die Dunkelheit in seinem Inneren, jenen Drang, um jeden Preis den Sieg zu erringen und seinen Gegner zu töten.
In der Arena hatte er ihn oft erlebt, jenen Augenblick, in dem er die Kontrolle über sich und sein Handeln verlor und etwas anderes die Klinge führte, etwas, das fremd und dunkel war. Er hatte keinen Namen dafür, aber in der Arena hatte ihm dieses Dunkel oft genug das Leben gerettet, bis zu jenem Tag, als das kaiserliche Urteil ihm einen anderen Weg gewiesen und einen neuen Menschen aus ihm gemacht hatte.
Doch irgendwo tief in ihm lauerte es noch immer.
In einem dunklen Abgrund …
»In Gedanken?«
Lucius fuhr herum.
Der Vorhang der Kammer war beiseitegezogen worden, und eine junge Frau stand auf der Schwelle. Die Öllampe, die sich neben dem muschelförmigen Becken auf dem Tisch befand und sanften Schein verbreitete, beleuchtete ihre zarte Gestalt und ihre edlen, patrizischen Gesichtszüge, die Lucius nur zu bekannt waren. Sie gehörten Iulia Agrippina, der ältesten Schwester des Kaisers.
»Herrin«, entfuhr es ihm überrascht, »ich …«
»Wie ich sehe, komme ich zu spät«, stellte sie mit bedauerndem Blick auf die rote Prätorianer-Tunika fest, die er bereits übergestreift hatte. Dabei wölbte sie die Lippen wie ein Kind, das schmollte. »Aber da ist nichts, das sich nicht wieder ausziehen ließe, nicht wahr?«, fügte sie hinzu und trat unaufgefordert ein.
Die Prätorianer, die freilich nur hinter vorgehaltener Hand über derlei Dinge sprachen, waren sich darüber einig, dass Agrippina die verführerischste unter den drei kaiserlichen Schwestern war. Zudem genoss sie den Ruf, es mit der Treue gegenüber ihrem Ehemann, dem Senator Domitius Ahenobarbus, nicht allzu genau zu nehmen. Manche behaupteten sogar, es sei ihr kaiserlicher Bruder selbst, der sie zu Abenteuern vielerlei Art überredete.
Tatsächlich war sie wunderschön anzusehen mit ihren dreiundzwanzig Sommern. Ein Kleid aus gelber Seide umschmeichelte ihren Körper, der mit kleinen Brüsten und wiegenden Hüften einer Venusstatue glich. Ihr braunes Haar, das einen Stich ins Rötliche hatte, war nach der neuesten Mode geflochten, ihre Gesichtszüge waren ebenmäßig, die Nase schmal, der Mund klein und sinnlich, die Lippen rot vom purpurissimum. Die Augen, von rätselhaft grüner Farbe, standen wie bei ihrem Bruder etwas zu weit auseinander, doch während es Caligulas Zügen etwas Fremdartiges verlieh, machte es die Schönheit seiner Schwester nur umso einzigartiger.
Es war am Hof bekannt, dass ein gewisser Ofonius Tigellinus um die Gunst der Kaiserschwester buhlte, ein schmeichlerischer Jüngling aus wohlhabendem Hause. Doch Lucius war nur Soldat und verfügte weder über die Bildung noch über das Einkommen, das nötig sein mochte, um eine Dame von solch hohem Stand zu betören. Was also hatte dies zu bedeuten?
»Ist es wahr, was man gemeinhin behauptet?«, fragte sie, während sie ihn unverhohlen aus ihren grünen Augen musterte.
»Was wird denn behauptet, Herrin?«
Ungeniert griff sie nach der Karaffe mit dem Wein, schenkte sich in den silbernen Becher ein und nahm einen tiefen Schluck. »Es heißt, dass in dem Augenblick, da ein Gladiator einen anderen tötet, dessen Manneskraft auf ihn übergeht«, eröffnete sie ihm dann.
»Ich habe den Britannier nicht getötet«, brachte Lucius in Erinnerung.
»Ihn nicht, aber viele andere, wie ich gehört habe.« Sie stellte den Becher beiseite und trat einen weiteren Schritt auf ihn zu, sich ihrer Stellung und ihrer Macht offenbar wohl bewusst. Ihr Busen bebte unter der dünnen Seide, es war offensichtlich, dass der Kampf sie erregt hatte – ein Phänomen, das durchaus nicht ungewöhnlich war. So mancher lanista verdiente sich ein hübsches Zubrot, indem er die prächtigsten seiner Gladiatoren des Nachts wohlhabenden Patrizierinnen zuführte – »späte Medizin« wurde das scherzhaft genannt. Auch auf Lucius war die Wahl dabei öfter gefallen, allerdings war keine der Damen auch nur von annähernd so hohem Stand gewesen wie Agrippina. Entsprechend war es nicht seine Männlichkeit, die erwachte, sondern seine Vorsicht …
Unwillkürlich wich er zurück, bis die Rückwand der Kammer es nicht mehr zuließ.
»Was ist das?«, fragte sie, während sie bereits dabei war, die Verschnürung ihres Kleides an einer Schulter zu lösen. »Ist es Furcht, die ich in deinen Augen sehe, Murmillo? Furcht in den Augen eines siegreichen Kämpfers? Eines Hauptmanns der Leibwache meines Bruders?«
Ungeniert offenbarte sie ihm, was die dünne Seide ohnehin nur unzureichend verborgen hatte, und eine mit creta geweißte Brust reckte sich ihm alabastergleich entgegen. »Schätze dich glücklich, mein guter Pertinax«, sagte sie lächelnd dazu, »dass nicht nur der Bruder deiner Erfahrung als Gladiator bedarf, sondern auch die Schwester.«
Lucius, der noch einen inneren Kampf darüber austrug, ob er sich fügen und von der verbotenen Frucht kosten oder lieber davon lassen sollte und sich damit womöglich die Feindschaft der mächtigsten Frau am Hofe zuziehen, stand selbst wie zur Statue erstarrt – als draußen plötzlich das Geräusch hektisch schlurfender Sandalen zu hören war.
»Zenturio Murmillo!«, rief jemand – und im nächsten Moment wurde der Vorhang abermals beiseitegeschlagen, und ein Sklave stand auf der Schwelle. Sein Alter war unmöglich zu schätzen. Er war barhäuptig und von kleiner Gestalt, mit Augen wie Kohlen – dies war Tanacos, Caligulas oberster Haussklave und persönlicher Diener.
»Verzeiht die Störung, Herrin«, sagte der Phrygier und sah demütig zu Boden. »Caesar verlangt, den Zenturio zu sprechen, unverzüglich.«
»Unverzüglich, hast du gehört, guter Pertinax?« Über Agrippinas schönes Gesicht huschte ein spöttisches Lächeln.
»Ich habe es vernommen«, versicherte Lucius nicht ohne eine gewisse Erleichterung.
Noch einen Augenblick zögerte sie, als obläge ihr die Entscheidungsgewalt darüber, was ein Offizier der Prätorianergarde zu tun und zu lassen habe. Dann erst trat sie beiseite und griff erneut nach dem Becher mit Wein. Ihre Brust ließ sie unverhüllt, als wollte sie ihm demonstrieren, was ihm entging. Um Tanacos’ Augen scherte sie sich nicht, so wie sich kein freier Römer um das scherte, was Sklaven sahen oder hörten. Die Strafen, die bei Indiskretionen drohten, waren so drakonisch, dass kaum je ein mancipium dagegen verstieß.
Lucius schlüpfte in den ledernen Muskelpanzer, dessen Schnallen der Phrygier schließen half, und legte die cingula an. Abschließend half ihm der Sklave, die Sandalen zu schnüren. So gerüstet verließ er die Kammer, nicht ohne noch einen Blick auf Agrippinas Gesicht zu werfen und dabei das Haupt zu neigen.
»Herrin.«
»Leb wohl, Murmillo«, erwiderte sie lächelnd. »Auf ein baldiges Wiedersehen.«
Lucius erwiderte nichts darauf. Stattdessen folgte er dem Sklaven nach draußen in die laue Nacht, die vom Zirpen der Grillen erfüllt war. Durch den Säulengang und eine verwirrende Anzahl verwinkelter Treppenhäuser und Korridore geleitete der Phrygier Lucius zurück – jedoch nicht in die Banketthalle, in der die Gäste vermutlich noch immer feierten, sondern in jenen Saal, in dem sich einst schon Caligulas Großonkel Tiberius mit den Senatoren beraten und ausländische Gesandte empfangen hatte, ehe er es vorgezogen hatte, der Tiberstadt den Rücken zu kehren und sich nach Capri zu begeben.
Zu seiner Verblüffung traf Lucius den vorhin noch so fröhlichen Imperator in düsterer Stimmung an. Auf purpurnen Kissen thronte er auf dem erhöhten Scherenstuhl, umgeben von seinen engsten Beratern – Senatoren in schweren Togen, wobei sowohl den hohen Herren als auch ihren Roben die Folgen des Gastmahls deutlich anzusehen waren. Neben den üblichen vigiles, die den Kaiser stets begleiteten, war auch Cassius Chaerea zugegen, seines Zeichens Tribun der Prätorianergarde. Als er Lucius erblickte, verzog sich sein kantiges Gesicht in unverhohlener Verachtung.
»Caesar«, sagte Lucius und hob die Hand zum Gruß.
»Da bist du ja endlich, Murmillo. Hat dich der Kampf gegen den retiarius so geschwächt?«
»Nein, Caesar«, versicherte Lucius und gab sich Mühe, dabei nicht zu erröten. »Bitte verzeiht.«
»Ein wahrer Prätorianer fleht nicht um Verzeihung, sondern bittet um angemessene Bestrafung für sein Versäumnis«, wies Cassius Chaerea ihn zurecht.
»Ach, hör schon auf damit, Tribun«, entgegnete Caligula an Lucius’ Stelle. »Wäre es so, müsste ich dir ja ständig deine Bitten erfüllen, oder nicht?«
Nun war es Chaerea, der errötete – und nicht aus Verlegenheit, sondern aus nur mühsam beherrschtem Zorn. Es war kein Geheimnis, dass der Kaiser ihn nicht mochte und keine Gelegenheit ausließ, um entweder seine hagere Gestalt, seine stets heisere Stimme oder sein verkrampftes Gemüt zum Anlass zu nehmen, ihn vor dem versammelten Hofstaat zu verspotten.
So wie es auch kein Geheimnis war, dass des Kaisers erklärter Lieblingsprätorianer ein ehemaliger Gladiator war und auf den Namen Lucius Murmillo hörte …
Der finstere Blick, mit dem Chaerea Lucius bedachte, verriet deutlich, dass er nicht den Kaiser, sondern ihn für diese Kränkung verantwortlich machte. Wäre es nach ihm und dem Präfekten Quintus Naevius Macro gegangen, wäre einem einstigen Gladiator niemals die Ehre zuteilgeworden, in die kaiserliche Leibgarde aufgenommen zu werden. Doch Macro, der den Kaiser auch in anderen Dingen hatte bevormunden wollen, hatte den Fehler begangen, Caligulas Willen zu unterschätzen. Obwohl er zu jenen gehört hatte, denen der junge Kaiser seine Herrschaft verdankte, hatte Caligula ihn am Hof in Verruf gebracht und ihn und seine Ehefrau zum Selbstmord gezwungen.
Marcus Arrecinus Clemens, der zu Jahresbeginn Macros Nachfolge im Amt des Präfekten angetreten hatte, hatte gegen einen ehemaligen Gladiator in den prätorianischen Reihen nichts mehr einzuwenden gehabt. Anders als Chaerea, der Macros Zögling gewesen war und auch den Tod seines Mentors letztlich Lucius anlastete …
»Los doch«, forderte der Kaiser einen der beiden Männer auf, die in gebückter Haltung vor seinem erhöhten Sitz standen. »Wiederhole, was du soeben berichtet hast.«
»Mein Name«, stellte der Angesprochene, ein junger Mann mit bereits schütterem Haar, sich vor, »ist Caius Mascius, Ädil des vierten Stadtbezirks.«
»Das wissen wir doch längst.« Caligula schüttelte die goldberingte Rechte, als könnte er die Dinge so beschleunigen. »Fahr endlich fort!«
»Zu meinem Bedauern«, fuhr Caius Mascius fort, der in seiner abgetragenen grauen Robe einen recht dürftigen Anblick bot, »musste ich Caesar von einem neuen Vorfall in meiner regio berichten …«
Lucius begann zu ahnen, worum es ging. Zum vierten Stadtbezirk, der sich zwischen Qurinal und Esquilin erstreckte, gehörte auch Subura – einerseits das Viertel der Armen, aber auch (oder vielmehr gerade deswegen) das Vergnügungsviertel der Stadt, in dem man für Geld so ziemlich alles bekommen konnte, wonach die Lust verlangte. Von billigen Dirnen, die es für ein As taten, über kostspielige Hetären bis hin zu Lustknaben aus fernen Ländern. Subura war, zumal nach Einbruch der Dunkelheit, alles andere als ein sicherer Ort, Überfälle und Schlägereien waren dort an der Tagesordnung, ohne dass der mit Fragen der Sicherheit betraute Ädil dagegen viel hätte unternehmen können.
In letzter Zeit allerdings brodelte es in den engen Gassen und schmutzigen Hinterhöfen. Das Volk war unzufrieden und rottete sich zusammen, Unruhe lag in der stinkenden Luft, die das gewohnte Maß bei Weitem überstieg. Und dies wiederum hatte mit den rätselhaften Todesfällen zu tun, die sich seit einiger Zeit in Subura ereigneten …
»Allem Anschein nach«, stieß Macius hervor, »haben die interfectores wieder zugeschlagen.«
»Natürlich, nur zu!«, rief der Kaiser und warf die beringte Rechte in die Luft. »Nennt sie auch noch bei dem Namen, den diese Aufrührer ihnen gegeben haben, und facht die Unruhe dadurch richtig an!«
»Aber, Caesar«, wandte Konsul Marcus Aquila ein, »bedenke, dass es bereits das zehnte Mal ist, dass jene Verbrecher zugeschlagen …«
»Das vierzehnte«, verbesserte Caius Mascius, wobei er im Kragenwurf seiner Robe zu versinken schien. Der Vergleich mit einer Schildkröte drängte sich auf. »Das Volk in Subura wird zunehmend unruhiger.«
»So?« Auf seinen Kissen thronend, reckte der Kaiser wissbegierig das kaum vorhandene Kinn vor. »Lasst hören, was mein geliebtes Volk sagt!«
»Nun« – der Ädil versank noch ein wenig tiefer im grauen Stoff –, »es gibt Stimmen, die behaupten, dass Caesar nicht in der Lage sei, die Ordnung in den Straßen aufrechtzuerhalten«, vermeldete er dann kleinlaut. »Dass der Vater des Vaterlandes seine Kinder nicht beschütze …«
»So, heißt es das?« Caligulas Mundwinkel fielen herab, verliehen seinem Gesicht einen Zug von Grausamkeit. »Ist das die Art und Weise, wie mir das Volk meine Wohltaten dankt? Sind die Kornspeicher nicht gut gefüllt? Veranstalte ich nicht die spektakulärsten Spiele, die man je gesehen hat?«
»Ohne Zweifel tut Ihr das, Caesar, aber die Menschen benötigen zu ihrer Zufriedenheit auch ein gewisses Maß an Sicherheit«, gab Konsul Aquila zu bedenken. »Wenn Furcht in den Gassen herrscht, kann Übles daraus erwachsen.«
»Nichts, womit wir nicht fertig würden«, versicherte Chaerea entschieden. »Auf seine Prätorianer kann sich Caesar stets verlassen.«
»Und es beruhigt uns alle, dies zu wissen«, räumte Aquila ein, »doch wenn wahr ist, was Mascius berichtet, so dürfen wir die Dinge nicht einfach sich selbst überlassen. Schon die letzten Regierungsjahre des erlauchten Tiberius haben mehr Unruhe gebracht, als uns allen lieb sein kann. Was Rom in diesen Tagen mehr als alles andere braucht, ist Frieden.«
»Das ist wahr«, pflichtete der Ädil ihm bei, »zumal in Subura Gerüchte die Runde machen.«
»Was für Gerüchte?«, verlangte der Kaiser zu wissen.
»Nun«, verfiel Mascius wieder in das alte Zögern, »angesichts der Tatsache, dass die Opfer allesamt grausam zugerichtet wurden, raunen manche von einem monstrum, das nachts durch die Straßen schleicht, einem Ungeheuer, das Menschen frisst. Einige behaupten gar, über den Dächern einen fliegenden Schatten gesehen zu haben. Und wieder andere munkeln von verbotener Zauberei und dunkler Magie aus Ägypten.«
»Altweibergeschwätz!«
»Mag sein, Caesar«, stimmte Marcus Aquila zu, »doch das Volk scheint daran zu glauben – und woran das Volk glaubt, das wird zur Wirklichkeit Roms.«
Caligula schickte dem Konsul einen seltsamen Blick. Seine schmalen Brauen zogen sich dabei wütend zusammen. »Willst du mich etwa belehren? Denkst du, das alles wüsste ich nicht?«
»Natürlich, Caesar«, beeilte sich der Konsul, zu versichern, der ihn an Jahren weit übertraf. »Ich erlaubte mir nur, es für Euch auszusprechen.«
»Der göttliche Caius Germanicus bedarf dessen nicht«, versicherte der Kaiser selbstbewusst. »Warum, denkt ihr, habe ich nach Lucius Pertinax schicken lassen? Damit er sich als mein Auge und mein Ohr vor Ort ein Bild von den Dingen macht!«
»Aber wieso ausgerechnet er?«, platzte Cassius Chaerea heraus. Der Tribun gab sich erst gar keine Mühe, seine Abneigung zu verbergen.
»Wen sollte ich denn sonst schicken?« Caligula bedachte ihn mit einem vernichtenden Seitenblick. »Doch nicht etwa dich?«
»Murmillo ist erst seit einem Jahr dabei«, wandte Chaerea ein. »Und seine einzige Eignung besteht darin, ein ehemaliger Gladiator zu sein.«
»Er ist ein freier römischer Bürger – berechtigt ihn das nicht dazu, ein Teil meiner Prätorianergarde zu sein?«, fragte der Kaiser.
»Gewiss, Caesar … doch in welcher Situation hätte er sich jemals schon bewährt und seinen Mut und seine Treue zu Euch unter Beweis gestellt?«
»In welcher Situation er sich bewährt hat? Das will ich dir verraten, Tribun – im Sand der Arena! Viele Dutzend Male hat er dem Tod ins Auge geblickt und über ihn triumphiert – kannst du solches auch von dir behaupten?«
»Nein, Caesar«, musste Chaerea kopfschüttelnd zugeben.
»Und was seine Treue betrifft, so glaube ich, dass der Kampf ums Überleben Lucius’ Charakter hinreichend gestählt und ihn unempfindlich für Verlockungen aller Art gemacht hat«, fuhr der Kaiser in seiner Lobrede fort. »Deshalb vertraue ich ihm mehr als jedem anderen aus den Reihen meiner Garde, einschließlich des Präfekten und seiner Tribunen.«
»Caesar.« Lucius bedankte sich für das Lob, indem er das Haupt neigte, doch er tat es mit gemischten Gefühlen. Denn zum einen sah er, wie Chaerea wie unter einem Peitschenhieb zusammenzuckte, zum anderen kannte er Caligula inzwischen gut genug, um zu wissen, dass ein Lob, noch dazu eines, das ihn aus der Masse der anderen hervorhob, stets auch mit hohen Erwartungen verbunden war.
»Ich will, dass du nach Subura gehst und dir dort einen Eindruck von den Geschehnissen machst. Mascius wird dich führen.«
»Ja, Caesar«, bestätigte Lucius ohne Zögern.
»Je…jetzt gleich?«, fragte der Ädil, dem der Gedanke überhaupt nicht zu gefallen schien.
»Nicht doch, an den nächsten Iden«, entgegnete der Kaiser. »Natürlich jetzt gleich! Auf der Stelle.«
»A…aber es herrscht Aufruhr in den Gassen! Es ist, als habe man die Furien losgelassen!«
»Dann nimm dir ein paar tüchtige Männer mit, Zenturio Murmillo«, wies Caligula Lucius an. »Und sieh dich vor – ich würde den Einzigen hier bei Hofe, der ebenso viel von den Spielen versteht wie ich, nur ungern verlieren.«
»Natürlich, Caesar.«
»Geh und berichte mir. Und dann, bei Merkur«, fügte der Kaiser mit einem giftigen Blick in Richtung Aquilas und der Senatoren hinzu, »werden wir sehen, welche Maßnahmen wir ergreifen werden.«
Die kaiserlichen Berater bekundeten lautstark ihre Zustimmung, während Lucius abermals grüßte – zuerst den Kaiser, dann seinen Tribun – und sich dann zum Gehen wandte.
Der Weg hinaus kam ihm endlos vor.
Denn bei jedem einzelnen Schritt fühlte er Chaereas vernichtenden Blick im Nacken.
Und wusste, dass er nichts Gutes zu bedeuten hatte.
IV
Der Innenhof der insula war nicht besonders groß, keine zehn Schritte im Quadrat. Hohe, aus braunen Ziegeln gemauerte Wände umgaben ihn, aus denen kleine Fenster blickten – jedenfalls, soweit der Lichtschein der Fackeln sie noch erfasste. Darüber lag alles in tiefer Schwärze, selbst der zu Beginn der Nacht noch sternenklare Himmel hatte sich verfinstert, als wollte er den Mantel der Dunkelheit über die grausame Szenerie breiten.
In seiner Zeit in der Arena hatte Lucius Murmillo manches gesehen, das sich unauslöschlich in seine Erinnerung eingebrannt hatte … doch nichts davon war mit dem zu vergleichen, was sich auf dem Innenhof abgespielt hatte.
Hier musste ein wahres Massaker stattgefunden haben.
Die Wände waren mit Blut besudelt, als hätte ein lanius hier sein blutiges Handwerk verrichtet, über den von Unrat übersäten Boden lagen abgetrennte Gliedmaßen und Eingeweide verstreut, von denen ein entsetzlicher Gestank ausging. Und dann war da noch das herrenlose Haupt, das wie zur Staffage in der Ecke lag, die Augen weiß und die Gesichtszüge in namenlosem Schrecken verzerrt.
Der Anblick von Händen oder Unterarmen, die ihren Besitzern abhandengekommen waren, war in der Arena blutiger Alltag. Lucius hatte sich daran gewöhnt, so wie er sich an manches gewöhnt hatte, um zu überleben. Doch derart viele herrenlose Gliedmaßen auf einmal hatte er noch nie gesehen, zumal sie anscheinend nicht mit einer Klinge abgetrennt, sondern schlicht und einfach abgerissen worden waren, ebenso wie der Kopf, an dem noch ein Teil des Brustkorbs hing.
Gleich mehrere der Prätorianer, die ihn zum Ort der Tat begleitet hatten, übergaben sich bei dem Anblick. Lucius selbst zog sich an jenen Ort zurück, den er in seinem Inneren für Momente geschaffen hatte, in denen die Wirklichkeit den Verstand zu ersticken drohte. Hortus tenebrarum hatte er ihn genannt.
Den Garten der Finsternis …
»Und? Hast du nun alles gesehen?« Caius Mascius’ karg behaartes Haupt wagte sich ein Stück weit aus dem Kragen hervor, während er sich hektisch umblickte. »Kannst du dem Kaiser nun berichten, Zenturio?«
»Noch nicht«, entgegnete Lucius. Im flackernden Licht seiner Fackel nahm er die blutbesudelten Wände in Augenschein. Auch an der Ummauerung der Arena hatte er solch makabre Muster gesehen, allerdings hatte sich ihr Ursprung stets am Boden befunden. In diesem Fall jedoch schien sich das Blut von oben herab ergossen zu haben … doch wohin Lucius mit der Fackel auch leuchtete, nirgendwo konnte er einen Balkon oder auch nur einen Mauervorsprung entdecken. Und bis zum Dach war es weit hinauf. Was, bei Belenus und Apoll, war hier geschehen?
Von außerhalb des Innenhofs war jetzt Geschrei zu vernehmen, unartikulierte Rufe einer aufgebrachten Menge.
Und sie kam näher.
»Zenturio, ich bitte dich inständig, dich zu beeilen«, drängte Mascius. »Die Plebejer sind äußerst aufgebracht …«
»Wollt Ihr ihnen das verdenken?« Lucius schnaubte. »Diese Männer hier sind nicht nur eines gewaltsamen, sondern auch eines höchst unnatürlichen Todes gestorben.«
»Ist es das, was du Caesar berichten willst?« Die kleinen Augen des Ädils funkelten furchtsam im Licht seiner Fackel.
»Es ist die Wahrheit.« Lucius senkte die Fackel und suchte zum wiederholten Mal den Boden ab. Doch zwischen all den Leichenteilen waren im weichen Boden keine ungewöhnlichen Spuren zu entdecken, nur die üblichen Abdrücke nackter oder mit ledernen Sandalen bekleideter Füße.
»Die Wahrheit? Woher willst du die Wahrheit kennen? Du bist nur ein Hauptmann der Prätorianer, kein haruspex und kein augur.«
»Zugegeben.« Lucius nickte. »Aber ich habe Augen im Kopf und kann berichten, was ich hier vorgefunden habe. Und ich kann mich nicht entsinnen …« Er verstummte plötzlich, als ihm etwas auffiel.
Mit der Fackel in der Hand ging er auf das herrenlose Haupt zu, das ihn in stummer Panik anzustarren schien. An dem Stück Torso, das noch daran hing, klebten einige blutige Stofffetzen, Reste einer wollenen Tunika, die wohl einst zur Kleidung eines Soldaten gehört hatte. Doch in der Schulter schien etwas zu stecken, das Lucius beim ersten Hinsehen nicht aufgefallen war …
Er bückte sich und griff danach, in der Erwartung, dass es sich um eine Waffe handelte, doch war dies nicht der Fall. Was Lucius für den Griff einer Klinge gehalten hatte, war in Wahrheit nur eine knollenähnliche Verdickung, die tief im leblosen Fleisch steckte. Er musste einige Kraft aufwenden, bis sie sich endlich schmatzend löste.
Im Licht der Fackel betrachtete er den seltsamen Gegenstand, der von rötlicher Farbe war und aus einem festen, knochenähnlichen Material zu bestehen schien. Er war eine Handspanne lang und lief so spitz zu wie ein Dorn, war aber von gewellter Form. Zudem war das Gebilde mit einem feinen Gespinst von Haaren umgeben, die zwar vom Blut des Opfers getränkt, jedoch noch deutlich erkennbar waren. Lucius roch daran – der Geruch war abstoßend bitter.
»Zenturio …?«
Die sich nähernden Stimmen waren unterdessen noch lauter geworden, Caius Mascius war einer handfesten Panik nahe.
Lucius überlegte einen Moment, öffnete dann den ledernen Beutel an seinem Gürtel und ließ den Gegenstand darin verschwinden. Dann erhob er sich und wandte sich dem Ädil zu, der sich einmal mehr in seiner Robe verkrochen hatte.
»Wir rücken ab.«
»Die Götter mögen dich segnen für diese Entscheidung«, bestätigte Mascius erleichtert. »Die Menge hat sicher mitbekommen, dass es wieder einen Zwischenfall gegeben hat, und nun will sie jemandem die Verantwortung dafür geben …«
Lucius erwiderte nichts darauf. Dem Ädil voraus, schlüpfte er durch die schmale Kluft, die den Hinterhof mit der Gasse verband. Die beiden Soldaten, die ihn begleitet hatten, bildeten die Nachhut. Der Rest der kleinen Abteilung wartete draußen auf der Gasse, den Befehl führte Marcus Furius, ein gallischer Landsmann Murmillos und vermutlich der einzige Freund, den er unter den Prätorianern hatte.
»Und?«, fragte er nur.
Lucius schüttelte lediglich den Kopf.
»Wieder die interfectores?«
»Was auch immer.« Lucius spuckte aus. Ein Schauder durchrieselte ihn, während er über die Schulter einen Blick in den Hof zurückwarf, der jetzt wieder völlig in Dunkelheit versunken war. Eine Dunkelheit von mancherlei Art …
»Dort kommen sie schon!«, rief Caius Mascius. »Offenbar haben sie bemerkt, dass Prätorianer im Viertel sind …«
Mit einem dürren Arm deutete der Ädil die Gasse hinab, von deren Ende der späten Stunde ungeachtet ein ganzer Trupp Männer und Frauen heraufzog. Ihnen allen war gemeinsam, dass sie einfache Kleidung trugen und mit Fackeln, Steinen und Prügeln bewaffnet waren. Ihre Gesichter waren wutverzerrt, und in ihren von Feuerschein beleuchteten Augen lag ein Ausdruck, den Lucius nur zu gut kannte, hatte er ihn doch in den Gesichtern unzähliger Gladiatoren, Sklaven und verurteilter Verbrecher gesehen, die in die Arena geschickt worden waren – es war nackte Todesangst. Und weil er sie schon in den Augen so vieler Menschen gesehen hatte, wusste Lucius Murmillo auch, wozu Furcht die Leute treiben konnte …
»Reihe schließen«, befahl er seinen Männern, die sich daraufhin Schild an Schild postierten, die Hände an den Griffen ihrer Schwerter. »Beschützt den Ädil.«
Er selbst trat der wütenden Meute entgegen, die rechte Hand nicht an der Waffe, sondern zum Gruß erhoben.
»Du!«, rief eine aufgebrachte Frau ihm schon von Weitem entgegen. »Prätorianer!«
»Ja, das bin ich«, bestätigte Lucius mit fester Stimme, die von den Fassaden der umliegenden Häuser widerhallte. Hier und dort wurden Fensterläden geöffnet, reckten sich dunkle Häupter in das Halbdunkel der Gasse. »Mein Name ist Lucius Murmillo.«
»Seid uns gegrüßt, Zenturio!«, rief ein großer bärtiger Mann mit einer Fackel. Sein Wort schien etwas bei den Leuten zu gelten, denn als er stehen blieb, verharrten auch die anderen, nur einen halben Steinwurf von Lucius entfernt.
»Was verschafft uns die Ehre eines so hohen Besuchs?«, fragte der Bärtige mit vor Sarkasmus triefender Stimme. Einige lachten. »Noch dazu mitten in der Nacht?«
»Ich denke, das wisst ihr sehr genau«, wich Lucius einer direkten Antwort aus. »Und ihr sollt auch wissen, dass der Kaiser um die Vorgänge in Subura weiß. Deshalb hat er seine Prätorianer geschickt, um nach dem Rechten zu sehen.«
»Wie aufmerksam von ihm«, konterte der Bärtige mit gefährlicher Ruhe. »Und, was hast du gesehen, Zenturio? Haben die Mörder ihre Opfer wieder bei lebendigem Leibe in Stücke gerissen? Oder haben sie diesmal noch etwas übrig gelassen?«
»Ach was, Mörder«, rief jemand. »Hier geht ein Ungeheuer um, das sage ich euch!«
»Maul halten!«, befahl ihm ein anderer.
Die Stimmung war gefährlich. Ein Fass von Zunder, der sich beim kleinsten Funken in eine Feuersbrunst verwandeln mochte …
»Ich weiß, dass ihr beunruhigt seid und dass ihr Angst um eure Familien habt«, versicherte Lucius, um Ruhe bemüht. »Doch dazu besteht kein Anlass.«
»Du meinst, es besteht kein Anlass?«, echote der Bärtige, und wieder gab es Gelächter. »Weißt du, wie viele von uns bereits Opfer dieser Mörder wurden?«
»Nun, ich …«
»Weißt du es?« Der andere schrie so laut, dass es von den Fassaden widerhallte. Man brauchte kein Seher zu sein, um zu erkennen, dass sich die Wut der Plebejer jederzeit in Aggression entladen konnte …
»Der Kaiser selbst hat mich geschickt«, entgegnete Lucius deshalb, und dafür brauchte er noch nicht einmal zu lügen. »Er kennt die Gefahr genau und weiß um all die Nöte und Ängste, die seine Kinder in diesen Nächten plagen.«
»Wirklich?«, rief jemand mit vom Alkohol schwerer Zunge. »Ist das, bevor oder nachdem er seine Schwestern gevögelt hat?«
»Wer hat das gesagt?«, klang die Stimme von Caius Mascius hinter dem schützenden Wall aus Schilden hervor. Aber natürlich meldete niemand sich zu Wort.
»Hört zu, Leute«, unternahm Lucius einen neuen Anlauf, die Menge zu beschwichtigen, »dies ist wahrlich keine gute Nacht. Es hat Tote gegeben, aber es müssen nicht noch mehr werden. Für heute Nacht soll genug römisches Blut geflossen sein. Geht wieder nach Hause und lasst mich meine Arbeit tun. Ich werde dem Kaiser Bericht erstatten über das, was ich hier vorgefunden habe, und ich verspreche euch, dass er alles unternehmen wird, um euch und eure Familien zu beschützen.«
»Du … versprichst es uns?«, fragte die Frau, die ihn zuerst angesprochen hatte.
»Ihr habt darauf mein Ehrenwort als Offizier der Prätorianer«, entgegnete Lucius.
Eine seltsame Stille trat daraufhin in der Gasse ein, sodass man eine Nadel hätte fallen hören können.
Dann brach die Frau in hysterisches Gelächter aus, in das die anderen einfielen und das sich wie stinkende Jauche über Lucius Murmillo Pertinax ergoss.
Danach flog der erste Stein.
Er traf Marcus Furius am Kopf und schlug eine Delle in seinen Helm. Doch es war nur der zaghafte Anfang einer wahren Lawine an Steinen und anderen Geschossen, die im nächsten Moment auf die Soldaten des Kaisers niederging.
Mit einer Verwünschung auf den Lippen fuhr Lucius herum, eilte die Gasse hinab und flüchtete sich ebenfalls hinter den Wall aus Schilden, den seine Leute errichtet hatten.
»Glaubst du mir jetzt?«, fragte Caius Mascius mit wutglänzenden Augen. »Dieser Pöbel führt sich auf wie von Sinnen!«
»Rückzug!«, befahl Lucius nur – er legte keinen Wert auf eine direkte Konfrontation mit der wütenden Meute. Zum einen hätten die Leute, aufgebracht und schlecht bewaffnet, wie sie waren, einem Dutzend gerüsteter Prätorianer kaum etwas entgegenzusetzen gehabt. Zum anderen war da auch ein gewisses Verständnis, das Lucius für diese Männer und Frauen empfand – auch wenn sie ihn in diesem Moment wohl am liebsten mit durchschnittener Kehle in der cloaca gesehen hätten.
In drei Viererreihen, die breit genug waren, um die Gasse abzuriegeln, hielten die Soldaten ihre Schilde so, dass sie nicht nur einen Wall, sondern auch ein komfortables Dach bildeten, unter dem Lucius und Ädil Mascius sichere Zuflucht fanden. Der Anblick dieser improvisierten Schildkrötenformation schien die Leute zu entmutigen – nur einer ließ sich zu einem blindwütigen Angriff hinreißen und bezahlte dafür mit seinem Leben. Die anderen begnügten sich damit, die Prätorianer mit allem zu bewerfen, dessen sie habhaft werden konnten, auch Batzen von Pferdemist waren darunter, die zwar nicht nach dem Leben, aber nach der Ehre der Gardisten zielten.
Als Lucius’ Trupp endlich die Hauptstraße erreichte, zerstreute sich die Menge, und ihr unheiliger Zorn verlor sich in den Gassen und Winkeln Suburas.
Die Prätorianer kehrten in den Palast zurück – nicht ahnend, dass sie die ganze Zeit über beobachtet worden waren.
Von einer dunklen Gestalt, die sich in den Schatten der Nacht bewegte und lautlos über die tönernen Dächer huschte.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:



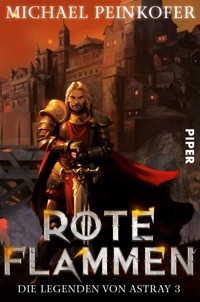
![Die Farm der fantastischen Tiere. Voll angekokelt! [Band 1] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/710616cb53ccb4acc4a9849ce5514b3c/w200_u90.jpg)
![Die Farm der fantastischen Tiere. Einfach unbegreiflich! [Band 2] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d3987251531d3c0eb5b0ada994d2676/w200_u90.jpg)